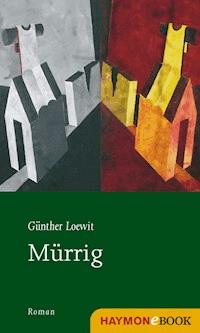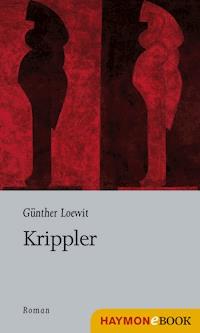Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: edition a
- Sprache: Deutsch
"Meine verblüffendsten Erfolge als Arzt habe ich nicht durch das Verschreiben, sondern durch das Absetzen von Medikamenten erzielt." Ein Landarzt öffnet die Augen für den Irrsinn unserer Medizin: Medikamentenflut, Vorsorgewahn und eine entmenschlichte Gesundheitsindustrie machen Patienten zu Konsumenten und zu Objekten. Bodenständig, praxisnah und leicht verständlich zeigt Dr. Günther Loewit, wo die Fallen in diesem System liegen, wie sie sich umgehen lassen und wie Heilung im besten Sinn wieder möglich wird.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 245
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dr. Günther Loewit:Achtung, Medizin kannIhrer Gesundheit schaden
Alle Rechte vorbehalten© 2022 edition a, Wienwww.edition-a.at
Cover: Bastian WelzerSatz: Anna-Mariya RakhmankinaLektorat: Andreas Görg
Gesetzt in der PremieraGedruckt in Deutschland
1 2 3 4 5 — 25 24 23 22
ISBN: 978-3-99001-578-0eISBN:978-3-99001-579-7
Dr. Günther Loewit
ACHTUNG,MEDIZIN KANNIHRER GESUNDHEITSCHADEN
INHALT
Vorwort
Was Sie erwartet
Vor Sorge untersuchen?
Wenn die Therapie selbst zur Krankheit wird
Ist die Schwangerschaft eine Krankheit?
Verbluten für einen guten Zweck
Sterben Karzinompatienten trotz Chemotherapie oder an der Chemotherapie?
Wirkung und Nebenwirkung von Trinkwasser – eine Schuld der Medizin?
Wie die Medizin ins Privatleben eingreift
Wozu den Sterbeprozess verlängern?
Was wir ändern können
Quellenverzeichnis
VORWORT
Meine verblüffendsten Erfolge als Arzt habe ich nicht durch das Verschreiben, sondern durch das Absetzen von Medikamenten erzielt.
Wer viele Medikamente einnimmt, braucht eine robuste Gesundheit
In Anbetracht seitenlanger Medikationslisten stellt sich immer wieder die Frage, ob Patienten wegen oder trotz der vielen Tabletten leben.
Hoch im Kurs bei Patienten, Ärzten und der Pharmaindustrie stehen unter anderem seit zirka 15 Jahren die sogenannten Magenschoner. Korrekt: PPIs (Protonenpumpeninhibitoren). Im Zeitraum von 2006 bis 2016 hat sich das Verordnungsvolumen dieser Medikamentengruppe um zweihundert Prozent erhöht und es zeigt weiter einen linearen Anstieg.1
7.30 Uhr. Ein schwüler Sommermorgen. Montag, Wochenanfang. Viele Patienten haben über das Wochenende »zugewartet«, wie sie es selbst formulieren. Jetzt stehen sie unangemeldet vor der Ordination, und jeder will als Erster begutachtet und behandelt werden. Eine bunte Sammlung von Beschwerdebildern: Kreuzschmerzen, Ohrenweh, Brechdurchfall und Kreislaufkollaps, Nasenbluten, eine kleine Schnittwunde, ein verstauchter Knöchel, Regelschmerzen und ein Nervenzusammenbruch, alles steht kunterbunt zusammengewürfelt auf der Straße und unterhält sich lautstark. Ein unvoreingenommener Beobachter würde meinen, ein Geschäft eröffnet mit einer Rabattschlacht.
Als Landarzt weiß ich, was mir die nächsten Stunden bevorsteht.
Meine resolute Assistentin zwängt sich forsch rufend durch die Kranken: »Lassen Sie mich durch, sonst können wir die Ordination nicht aufsperren.«
Ich nutze die frei gewordene Schneise und folge ihr im Respektabstand.
Sonst herrscht wenig Respekt. Immer näher rücken die Menschen an mich heran.
»Na, Herr Doktor, sind wir ausgeschlafen?«
Irgendjemand ruft: »Kann ich als Erster drankommen, ich muss in die Arbeit.«
Kein »Bitte«, kein »Guten Morgen«, kein »Dürfte ich«, kein Konjunktiv, nichts.
Schritt für Schritt kämpfe ich mich von meinem reservierten Parkplatz zur Eingangstür vor. Bis hierher ein ganz normaler Montagmorgen.
Plötzlich höre ich doch ein Bitte. »Bitte, Herr Doktor …« Es klingt fast flehentlich. Ich kenne die schwache weibliche Stimme. Frau Moris gibt Kindern im Ort kostenlos Englischnachhilfe. Die kleine ältere Dame hatte noch nie etwas gefordert. Mein Interesse ist geweckt. Ich schaue mich um. Dann kann ich sie sehen. Ich gehe in ihre Richtung. Nach ein paar Metern lichtet sich die Menschenansammlung. Etwas abseits steht Frau Moris. Sie stützt sich schwer auf ihren Gehstock. Auf der Stirn stehen ihr Schweißperlen. Ihr Gesicht ist stark gerötet. Offensichtlich hat sie Fieber. Als ich nähertreten will, winkt sie ab und lenkt meinen Blick mit einer eindeutigen Geste zu einer Bank, die nicht mehr als 15 Meter von der Ordination entfernt zwischen zwei Bäumen am Straßenrand steht.
Ich staune nicht schlecht.
Auf der Bank liegt ein sichtlich übergewichtiger Mann, regungslos, ein Arm hängt herunter. Die anderen Wartenden kümmert das offenbar wenig. Nach dem Motto: ein Konkurrent weniger um den ersten Platz. Schnell gehe ich hin.
Es ist Herr Daiml. Ein langjähriger Herz- und Bluthochdruckpatient. Starker Raucher. Undiszipliniert. Aber eine Seele von einem Menschen. Hilfsbereit, bescheiden und immer geduldig. Regelmäßig bringt er gebrechliche Patienten, für die sonst niemand Zeit hat, mit seinem alten Opel in die Ordination. Jetzt liegt er kreidebleich und schweißgebadet abseits der lärmenden Menschentraube. Im Schritt der Hose ist ein nasser Fleck zu erkennen, der Geruch von verlorenem Stuhl und Urin steigt mir in die Nase. Offensichtlich hat er es gerade noch bis hierher geschafft.
»Typisch Herzinfarkt«, schießt es mir durch den Kopf. »Das hat er jetzt davon.« Dass es so kommen würde, habe ich schon lange befürchtet. Ich spreche ihn an: »Was ist denn mit Ihnen los, seit wann liegen Sie da?«
Er gibt keine Antwort.
Ich beuge mich zu ihm hinunter und bringe meine Lippen nahe an sein Ohr. Ein ärztlicher Reflex. »Herr Daiml, hören Sie mich?«
Keine Reaktion.
Nichts.
Ich rüttle an ihm.
Wieder keine Reaktion.
Mir wird klar, dass ich mitten in einem Notfalleinsatz bin. Den ersten Patienten am Montagmorgen zu verlieren wäre kein guter Wochenanfang.
Nur ruhig bleiben. Nach der Checkliste vorgehen, die ich seit Jahren verinnerlicht habe. Mit aller Kraft drücke ich die Kante meines Daumennagels in das Ohrläppchen des bewusstlosen Mannes.
Ein heftiger Schmerzreiz.
Zu meiner Erleichterung reagiert der Patient. Er öffnet die Augen und schaut mich an. Ich bin nicht sicher, ob er mich erkennt.
»Herr Daiml?« Meine rechte Hand sucht den Puls an seinem Handgelenk.
Zu meiner Erleichterung lässt er ein leises Jammern hören.
Inzwischen sind wir von Schaulustigen umringt.
Über die Schulter rufe ich in die Menge: »Bitte, gehen Sie hinein und schicken Sie mir die Assistentin mit dem Notfallkoffer heraus. Und bringen Sie einen Stuhl für Frau Moris.« Ich drehe mich um und nicke ihr zu. Sie scheint Mühe zu haben, sich auf den Beinen zu halten. »Oder helfen Sie ihr hinein.«
Während ich auf Blutdruckapparat und Stethoskop warte, kümmere ich mich weiter um Herrn Daiml: »Haben Sie Schmerzen?«
Er scheint mich zu verstehen und schüttelt den Kopf.
Also doch kein Herzinfarkt. Vielleicht eine Hochdruckkrise? Endlich finde ich den Puls. Er ist schwach und dünn. Aber immerhin regelmäßig. Der Puls bei zu hohem Druck fühlt sich jedenfalls anders an. Eigenartig, nichts passt zusammen.
»Bekommen Sie genug Luft?«
Diesmal ein Nicken.
Inzwischen reicht mir meine Ordinationshilfe den Blutdruckapparat. Ich fixiere die Manschette am schweißnassen Oberarm und beginne sie aufzupumpen. Wie in Trance beobachte ich die Verformung des Stoffschlauches, während sich die Luftkammer aufbläht. Ich bin neugierig. Der Blutdruck wird mir weiterhelfen. Am Manometer nähert sich die Nadel der Marke 260. Ich lasse die Luft langsam ab. Ergebnis: 60 mm/HG systolischer Druck. Viel zu wenig. Der diastolische Druck ist so tief, dass er überhaupt nicht messbar ist. Also ein Herzversagen? Oder doch ein Herzinfarkt? Gar eine Ruptur? Verblutetet mein Patient gerade innerlich?
Die Ordinationsgehilfin steht immer noch neben mir. »Brauchen Sie noch etwas?«
»Ja, bringen Sie bitte das Notfall-EKG.« Nicht jeder Herzinfarkt, schießt es mir durch den Kopf, muss schließlich zwangsläufig mit Brustschmerzen verbunden sein.
Immer noch stehen genug Schaulustige um uns herum. Ich bitte einen kräftigen jungen Mann, Herrn Daimls Beine um dreißig Zentimeter anzuheben. Durch diese Maßnahme fließt das Blut aus den Beinvenen schneller in den Oberkörper zurück und unterstützt dadurch den zentralen Kreislauf. Tatsächlich hilft dieser einfache Trick. Binnen weniger Sekunden kehren etwas Farbe und Leben in das Gesicht des schlaffen Patienten zurück.
Herr Daiml murmelt: »Herr Doktor, mir tut wirklich nichts weh, mir ist nur elendiglich übel.«
Immer noch tappe ich im Dunkeln. Weil mir nichts anderes einfällt, frage ich: »Haben Sie die vorgeschriebenen Tabletten regelmäßig eingenommen?«
»Ja, natürlich, Sie kennen mich, ich mache alles, was die Ärzte sagen.«
Ich freue mich über die Aussage. Deren Inhalt glaube ich allerdings nicht, sonst hätte der Patient schon längst mit dem Rauchen aufgehört und zwanzig Kilo abgenommen. Die übliche rötliche Farbe hat die Blässe nun vollends aus seinem Gesicht verdrängt. Offensichtlich habe ich es mit einem Kreislaufkollaps zu tun. Aber warum ist der Patient kollabiert? »Haben Sie Durchfall oder haben Sie am Wochenende etwas Schlechtes gegessen?«
»Nein, da ist alles in Ordnung. Meine Frau und ich haben das Gleiche gegessen, und sie hat nichts.«
»Hat sich sonst irgendetwas in ihrem Leben verändert?«
Ich sehe, dass Herr Daiml nachdenkt. Mechanisch knöpfe ich sein Hemd auf, weil die Assistentin schon mit dem EKG-Gerät heraneilt. Rasch klebe ich die notwendigen Elektroden an den vorgesehenen Stellen auf die Haut des Patienten und verbinde die Kabel. Am Monitor erscheint das vertraute Auf und Ab der Zacken. Keine Rhythmusstörungen, keine Zeichen eines Herzinfarktes. Damit scheidet das Herz als Problem endgültig aus. Immerhin.
Noch einmal drehe ich mich um und suche Frau Moris. Ich sehe sie nicht. Etwas verärgert rufe ich: »Hat jemand der Frau Moris geholfen?« Meine Assistentin beruhigt mich: »Ein paar von den Männern haben ihr schon hineingeholfen, sie sitzt im Wartezimmer.«
Während ich nach weiteren differenzialdiagnostischen Ursachen für den offensichtlichen Kreislaufkollaps suche, beantwortet Herr Daiml meine Frage: »Nein, eigentlich hat sich nichts verändert.«
»Was heißt»eigentlich«?«, frage ich nach, weil mir nichts Besseres einfällt.
Keine Antwort. Stattdessen sinkt er wieder in sein beunruhigendes Schweigen zurück. Schlapp liegt er da, atmet schwer und schwitzt aus allen Poren. Nach wie vor habe ich einen akuten Notfall vor mir.
Sein Zustand macht mich ratlos. Nebenbei denke ich an das volle Wartezimmer.
»Herr Daiml, was heißt»eigentlich«?«, wiederhole ich meine Frage. Diesmal eindringlicher. Er antwortet nicht. Ich bin ungeduldig.
»Haben Sie sich körperlich besonders angestrengt in den letzten Tagen?«
Ein eindeutiges Kopfschütteln. Nein.
»Hat Sie ein Insekt gestochen?«, frage ich der Vollständigkeit halber. Ich ernte die gleiche Reaktion. Der junge Mann, der nach wie vor die massigen Beine von Herrn Daiml hochhält, wechselt unter hörbarem Ächzen die Position. Auch er ist mittlerweile ins Schwitzen geraten.
Plötzlich schaut mir Herr Daiml in die Augen. »Mir fällt nur etwas Unwichtiges ein«, sagt er.
»Was?«, frage ich ungeduldig.
Viel zu oft stellt sich heraus, dass für Patienten scheinbar unwichtige Details eine Schlüsselrolle in der Anamnese und in der Diagnostik spielen.
»Bei den Pulvern, die Magenschoner, die lasse ich seit vorletzter Woche weg.« Erklärend fügt er hinzu: »Weil ich noch nie Magenschmerzen gehabt habe.«
Zuerst höre ich nur die Worte. Aber mit jeder Sekunde, die vergeht, wird mir ihr Gehalt klarer. Mir geht ein Licht auf. Aus einer Ahnung wird Gewissheit. Die ärztliche Sicherheit kehrt zurück. Ich fühle mich wie ein Pokerspieler, der nach einer längeren Durststrecke auf einmal ein gutes Blatt in der Hand hält. Mit neu erwachtem Selbstbewusstsein wende ich mich an meine Assistentin: »Bitte holen Sie eine Kochsalzinfusion.« Ich bin so gut wie sicher, den Grund für das Kreislaufversagen des Patienten gefunden zu haben.
»Herr Daiml, wir werden Ihnen jetzt eine Infusion anhängen. Bald wird es Ihnen wieder besser gehen.«
Ich lege den venösen Zugang. Einer der neugierigen Zuschauer freut sich, die Rolle eines Infusionsständers übernehmen zu dürfen. Stolz hält er den prall gefüllten Infusionsbeutel so hoch er kann. Gemeinsam beobachten wir, wie die Flüssigkeit durch den Tropfenzähler rinnt. Mit jedem Zentimeter, den der Flüssigkeitsspiegel im Plastikbeutel sinkt, blüht Herr Daiml auf. »Herr Doktor, jetzt wird mir schon besser.«
Ich bin erleichtert. Zu den beiden Männern bei Herrn Daiml sage ich: »Ich gehe kurz hinein und kümmere mich um Frau Moris, machen Sie so weiter, ich komme gleich wieder.« Am Weg in die Ordination schaue ich noch einmal zurück. Die drei Herren beginnen sich miteinander zu unterhalten.
Frau Moris sitzt geduldig auf einem Sessel. Ihr Gesicht glüht. Ich will sie fragen, wie es ihr geht. Aber sie kommt mir zuvor. »Wie geht es ihm?«
»Ohne Sie hätte der Herr Daiml glatt auf der Bank sterben können«, bedanke ich mich bei ihr. Sie sagt mit müder Stimme: »Wahrscheinlich hat er Ihre Hilfe dringender gebraucht als ich.« Ich bin gerührt. »Frau Moris, Sie sind ein feiner Mensch, aber jetzt schauen wir einmal, was Ihnen fehlt.« Sie nickt. Dann hängt sie sich bei mir ein und wir gehen gemeinsam in den Ordinationsraum. Ich stecke ihr den Fieberthermometer unter die Achsel und sage halb fragend: »Ich gehe noch einmal kurz hinaus zu meinem Notfall?« Frau Moris antwortet: »Gehen Sie nur, ich laufe Ihnen bestimmt nicht weg.« Draußen läuft alles bestens. Die drei Herren scherzen miteinander. Das beruhigt mich.
Eine Stunde später kann Herr Daiml ohne fremde Hilfe zu Fuß nach Hause gehen.
Hintergründe:
Nicht jeder lebensbedrohliche Notfall hat eine so einfache Lösung. Herr Daiml wäre beinahe einem Medikationsfehler erlegen.
Medikationsfehler entwickeln sich zum Bestseller unter den Komplikationen der Heilkunde. Sie sind für fünf bis zehn Prozent aller Krankenhausaufnahmen verantwortlich.
Eine Studie über Medikationsfehler in England belegt rund 1700 Todesfälle pro Jahr im Zusammenhang mit pharmakologischer Therapie.2 Zwanzig Prozent der Fehler, so das Resümee der Autoren, werden schon bei der Verschreibung von Medikamenten begangen, fünfzig Prozent der Fehler treten im Zusammenhang mit Einnahme und Verabreichung auf.3
Herr Daiml ist ein perfektes Beispiel dafür. Bis zu der eigenmächtig durchgeführten Medikamentenreduktion nimmt er regelmäßig acht verschiedene pharmakologische Substanzen ein, auf zwölf einzelne Gaben über den Tag verteilt. Diese Therapie besteht unverändert seit Monaten und verursacht dem Patienten keine Probleme.
Die jeweilige Erstverordnung dieser Medikamente findet zu verschiedenen Zeitpunkten und ohne Absprache der einzelnen Ärzte untereinander statt. Die Verschreibung der Arzneien, die Überprüfung der Wechselwirkungen und die Dokumentation der Behandlung erfolgt durch mich, den Hausarzt. Die regelmäßig durchgeführten Blutdruckmessungen zeigen eine zufriedenstellende Einstellung der Hypertonie, das allgemeine Wohlbefinden des Patienten bestätigt den Erfolg der gesamten Behandlung. Es gilt: Never change a winning team. Obwohl er zwei Wochen vor dem Kreislaufversagen die Magenschoner absetzt, ist Herr Daiml bis zu jenem Montagmorgen beschwerdefrei.
Wie kommt es plötzlich zum Kreislaufkollaps: Fünf der acht Arzneimittel haben einen blutdrucksenkenden Effekt. Drei Medikamente verordnete der Internist im Lauf der Zeit zur Behandlung des erhöhten Blutdrucks und der Herzschwäche. Die Tablette vom Urologen zur Verkleinerung der Prostata entfaltet ganz nebenbei ebenfalls eine beachtliche blutdrucksenkende Wirkung. Schließlich wurde das Präparat primär als blutdrucksenkendes Medikament eingeführt, und erst Langzeitstudien zeigten eine prostataverkleinernde Wirkung. Eine vom Neurologen zur Beruhigung des oft aufgewühlten Patienten verordnete Arzneimittelspezialität wirkt unter anderem auch blutdrucksenkend. Vom Orthopäden bekam und bekommt der Patient schon Jahre vor der Entdeckung seines erhöhten Blutdrucks ein Schmerzmittel aus der Gruppe der NSAR (Nicht-Steroidale Anti-Rheumatika), zweimal täglich einzunehmen, verordnet. Das siebente Medikament ist die erwähnte Magentablette, die vom gewissenhaften Orthopäden zur Vorbeugung eines Magengeschwürs zusammen mit dem Rheumamedikament von Anfang an etabliert wurde. Und zu guter Letzt betrifft die achte Tablette die Schilddrüse und sollte früh am Morgen auf nüchternen Magen eingenommen werden, da sie nur im sauren Milieu des Magens resorbiert werden kann.
Natürlich hatte Herr Daiml noch nie Magenschmerzen. Schließlich steht seine ständig anwachsende Medikation zu jedem Zeitpunkt unter dem Schutz der Magentablette.
Zu den Hintergründen des Magenschutzes: Die regelmäßige Einnahme von Medikamenten belastet die Magenschleimhaut. Nicht anders, als es von Alkohol, Koffein, Nikotin und schwer verdaulichen Nahrungsmitteln wie Zwiebeln oder Knoblauch bekannt ist. Die Säurebarriere des Magens schützt einerseits Lunge und Darm vor unerwünschten Bakterien, andererseits besteht bei Übersäuerung die Gefahr der Magenentzündung und der Bildung von Geschwüren. Natürlicher Magenschutz und Magenfunktion stellen ein labiles physiologisches System dar. Im günstigsten Fall herrscht ein Gleichgewicht zwischen Säuregehalt und Schleimhautschutz. Haferbrei, Kamillen- und Fencheltee sowie warme Milch sind seit Jahrtausenden gebräuchliche Magenmedikamente bei entzündungsbedingten Magenschmerzen.
In unseren Tagen sind Entzündungen und Geschwüre der Magenschleimhaut häufig eine Folge von komplexen Dauermedikationen. Daher sind magenschleimhautschützende Medikamente regelmäßig am Anfang oder am Ende von längeren Medikationslisten zu finden. Jahrzehntelang verwendete die Medizin schleimhautschützende Substanzen, die eine Art Schutzfilm über das Mageninnere legen und den Säuregehalt des Magensekrets reduzieren. Nach und nach entwickelt die Pharmaindustrie jedoch neuere, teurere und effektivere Medikamente und bringt sie auf den Markt. Den vorläufigen Höhepunkt dieser pharmakologischen Entwicklung stellen die Protonenpumpenhemmer dar.
Durch entsprechende Produktplatzierung und -bewerbung gelang es der pharmakologischen Industrie in den vergangenen Jahrzehnten, eine ganze Generation von Ärzten dazu zu bewegen, bei jeder Verordnung von mehr als zwei oder drei Tabletten zur Sicherheit auch gleich einen PPI (Protonen-Pumpen-Inhibitor) zu verordnen. Zur Schonung und zum Schutz des Magens vor anderen Medikamenten.
Daher der im Volksmund gebräuchliche Name »Magenschoner« . Der Begriff klingt so harmlos wie »Schonkaffee« . Der soll ja bekanntlich auch gut für den Magen sein.
Aber PPIs sind alles andere als Magenschoner. Protonenpumpeninhibitoren sind hocheffektive, komplexe Medikamente, die im Gegensatz zu ihren Vorgängerprodukten (H2-Blocker) als vollkommene Säureblocker angesehen werden müssen. Protonen sind positiv geladene Teilchen, die an der Produktion der Magensäure beteiligt sind. D.h., dass es ohne Protonen keine Magensäure gibt. Dadurch eignen sich PPIs hervorragend zur Behandlung aller durch übermäßige Säureproduktion bedingten Erkrankungen, insbesondere des akuten Magengeschwürs und der Speiseröhrenentzündung. Sie bewirken aber bei vorschriftsgemäßer Einnahme eine vollkommene Entsäuerung des Magens.
Was ist im Fall von Herrn Daiml passiert? Durch das Absetzen des sogenannten Magenschoners zwei Wochen vor dem Kreislaufzusammenbruch legt er ohne sein Wissen den Grundstein für die kommende Katastrophe. Am ersten und zweiten Tag passiert gar nichts. Dann beginnt die Magenschleimhaut wieder langsam, höhere Mengen von Magensäure zu produzieren. So, wie es ihrer natürlichen Funktion entspricht. Durch die Wiederherstellung des physiologischen Magenmilieus nach zirka zehn Tagen kommt es zu einer verhängnisvollen Kaskade von Folge- und Wechselwirkungen innerhalb der bislang gut eingespielten Medikamentenmischung.
Oral eingenommene und von der Magenschleimhaut aufgenommene Medikamente benötigen das saure Milieu des Magens, um vollständig aufgelöst, aufgespalten und in den Pfortaderkreislauf aufgenommen zu werden. Das betrifft auch die blutdrucksenkenden Medikamente von Herrn Daiml. Im Lauf der zwei Wochen vor seinem Kreislaufkollaps am Montagmorgen ist der pH-Wert des Magensaftes von Herrn Daiml also von zirka 5 kontinuierlich auf seinen Normalwert zwischen 1,5 und 2 gesunken. Das entspricht in etwa dem Säuregehalt von frisch gepresstem Zitronensaft.
Auf diese Weise entfalten die fünf verschiedenen blutdrucksenkenden Tabletten zum ersten Mal seit ihrer Verordnung ihre volle Wirkung. Sie wurden zum ersten Mal optimal resorbiert.
Das Ergebnis kennen wir. In der Nacht vom Sonntag zum Montag fällt der Blutdruck von Herrn Daiml ins Bodenlose. Vermutlich begünstigt das schwüle Wetter den Prozess. Die körpereigenen Kompensationsmechanismen sind nicht mehr in der Lage, die Katastrophe abzuwenden. Wer weiß, was passiert wäre, wenn es Herr Daiml nicht mehr bis in die Nähe der Ordination geschafft hätte.
Vielleicht gar nichts. Es ist denkbar, dass er den Kreislaufkollaps auf der Bank liegend überlebt hätte.
Aber vielleicht wäre er auch verstorben.
Wer glaubt, ein Fall wie der von Herrn Daiml wäre selten, irrt.
Es gibt jedoch weit mehr als nur medikamentöse Behandlungsfehler. Falsche Diagnosen führen zu falschen Therapien und unnötigen Operationen.
Einen Meilenstein in Bezug auf Transparenz im Zusammenhang mit Behandlungsfehlern stellt die Studie »To Err Is Human: Building a Safer Health System« des Institute of Medicine (IOM) aus dem Jahr 1999 dar.
Das Ergebnis der Recherche legt nahe, dass in den USA pro Jahr mehr Menschen ihr Leben durch Therapiefehler verlieren als durch die Folgen von Drogenmissbrauch und Demenzerkrankungen zusammen. Schätzungen bewegen sich zwischen 44.000 und 98.000 Todesfällen pro Jahr.
Trotz zahlreicher Verbesserungen bei der Meldung von Medikationsfehlern und dem Schaffen von Bewusstsein innerhalb der Ärzteschaft hat sich die Situation in den vergangenen zwanzig Jahren nicht wesentlich verbessert. Mehr Medikamente als je zuvor schaffen ein noch nie dagewesenes Potenzial für unerkannte Wechsel- und Nebenwirkungen. Das bedeutet, dass auch bei Weitem nicht jede Neben- und Wechselwirkung in die verschiedenen Sicherheitssysteme eingemeldet wird. Bei Medikationen, die mehr als vier bis maximal fünf Substanzen umfassen, tappen wir Ärzte, was Resorption und Interaktion anbelangt, weitgehend im Dunkeln. Spätestens dann, wenn Patienten zehn bis 15 verschiedene Substanzen zu sich nehmen, kann niemand mehr einen wissenschaftlich seriösen Metabolismus der verwendeten Medikamente nachzeichnen.
Neuere Studien belegen immer noch eine erschreckend hohe Zahl von Medikationsfehlern mit tödlichem Ausgang.
ACHTUNG!
Im Fall von Herrn Daiml hätten eine Gewichtsreduktion um 15 Kilogramm, mehr Bewegung und der Verzicht auf Nikotin zwei der blutdrucksenkenden Medikamente unnötig gemacht. Ich weiß, das ist nicht einfach. Aber Medikamente sollten erst eingesetzt werden, wenn alle zur Verfügung stehenden konservativen Maßnahmen ohne ausreichenden Erfolg zur Anwendung gebracht wurden. Sie können davon ausgehen, dass Sie sowohl Ihren systolischen als auch Ihren diastolischen Blutdruck pro abgenommenem Kilogramm Körpergewicht um 1 mm/HG senken. Wenn Sie nicht übertreiben, stellt die Gewichtsreduktion eine medizinische Intervention ohne Neben- und Wechselwirkungen dar. Auch die Reduktion Ihres Salzkonsums senkt den Blutdruck, ohne Sie in Gefahr zu bringen.
Manchmal geht es aber nicht ohne Medikamente.
Sie sollten jede Medikation von Zeit zu Zeit auf ihre Notwendigkeit und Effizienz überprüfen lassen. Dazu berufen sind sowohl der verschreibende Arzt als auch der ausgebende Apotheker.
Halten Sie vor jeder Änderung Ihrer Medikation Rücksprache mit Ihrem Hausarzt. Das betrifft auch pharmakologische Substanzen, die Sie selbst ohne Rezept in der Apotheke oder im Supermarkt kaufen können.
Haben Sie von unterschiedlichen Fachärzten zu verschiedenen Zeitpunkten unterschiedliche Medikamente bekommen, lassen Sie die sich ergebende Medikationsliste auf Wechselwirkungen der verschiedenen Arzneien untereinander überprüfen und bei Notwendigkeit korrigieren.
Eigenmächtige Veränderungen in einer Medikationsliste können lebensbedrohliche Folgen haben. Nicht jedes Weglassen eines Medikaments ist automatisch gesund. Auch wenn viele Medikamente miteinander eingenommen sicherlich ungesund sind.
WAS SIE ERWARTET
Der Fall von Herrn Daiml ist symptomatisch für Fehlentwicklungen in der modernen Medizin. Formal betrachtet ist sein Kreislaufkollaps auf einen Eigenfehler zurückzuführen. Der Patient hat das die Magensäure blockierende Medikament eigenmächtig und ohne Rücksprache mit einem Arzt oder Apotheker abgesetzt. Kein Gericht würde mich als Hausarzt oder einen der beteiligten Spezialisten zur Verantwortung ziehen. Kurz: Die Medizin hat alles richtig gemacht. Schuld ist der Patient. Auf den ersten Blick.
Und doch agiert die Heilkunde unverantwortlich.
Patienten vertrauen nicht nur uns Ärzten, sie vertrauen auch auf ihr Gefühl und auf ihre Instinkte. Mindestens dreißig Prozent der verordneten und von den Apotheken abgegebenen Medikamente nehmen die Patienten nicht ein. Und noch einmal so viel ausgestellte Rezepte schaffen es nicht einmal bis in die Apotheke. Wie oft habe ich schon gehört, dass Patienten Antibiotika nach der Einnahme der ersten zwei Tabletten abgesetzt haben, obwohl sie über die Notwendigkeit einer Sieben- oder Zehn-Tage-Therapie aufgeklärt waren.
Warum?
Weil das Halsweh verschwunden ist, der Husten oder das Brennen in der Harnröhre schon nachgelassen hat. Das Wissen um die Resistenzentwicklung ist nicht stark genug, um das instinktive Gefühl, das Medikament nicht mehr einnehmen zu wollen, unterdrücken zu können. Patienten verhalten sich oft nicht anders als Volksschulkinder. Wir gehen als Ärzte nur allzu gerne davon aus, dass unsere Patienten unsere Ratschläge genau befolgen. Das tun sie aber nicht.
Selbst wenn die Werbung vor möglichen Wirkungen und Nebenwirkungen warnt, dürfen wir nicht davon ausgehen, dass alle Patienten diese Warnungen ernst nehmen. Die Medizin preist Medikamente und Operationen als Allheilmittel für die persönliche Gesundheit an. Was soll also schlecht daran sein, sich operieren zu lassen oder ein Medikament einzunehmen? Erst das Kleingedruckte auf der Packungsbeilage macht den einen oder anderen Konsumenten nachdenklich. Wenn Patienten die Packungsbeilage entziffern, haben sie noch immer kein ausreichendes Wissen über mögliche Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten.
An dieser Stelle möchte ich Sie kurz mit dem Cytochrom-P450-System (CYP) bekannt machen. Die folgende Passage wird Ihnen beim Verständnis der Lektüre öfter behilflich sein. CYPs sind Eiweiße mit enzymatischer Aktivität. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Verarbeitung von pharmakologischen Substanzen, vor allem in der Leber. Als Leser müssen Sie nicht viel über den Wirkungsmechanismus von CYPs wissen. Was Sie aber wissen sollten, ist, dass jeder Mensch genetisch bedingt eine unterschiedliche Ausstattung mit CYPs hat und damit unterschiedlich auf Medikamente reagiert.
So kann es sein, dass hundert Milligramm einer Schmerztablette bei einem Patienten gar nicht wirken, weil sein Körper sie zu schnell abbaut. Bei einem zweiten Patienten entsteht die statistisch ermittelte und erwartete Wirkung. Er wird übrigens der Einzige sein, der mit der Tablette zufrieden ist. Bei einem dritten Patienten wird das Medikament zu langsam abgebaut. Dieser Patient wird sich über massive Nebenwirkungen beschweren, wie sie bei einer Überdosierung entstehen. CYPs sind unter anderem auch für die gefürchteten, weil oft zu spät erkannten Wechselwirkungen von Medikamenten verantwortlich.
Die meisten Patienten wissen nicht, was passieren kann, an welchen Abgründen sie sich bewegen, wenn sie mit ihrer Medikation undiszipliniert oder von den Vorschriften abweichend umgehen. Leider wissen wir Ärzte es auch nicht immer.
Medikamente sind prinzipiell weder harmlos noch gefährlich. Wenn wir Kindern im Volksschulalter erklären, wie gefährlich scharfe Messer sein können, werden sie das prinzipiell begreifen. Bekommen diese Kinder trotzdem einen Haufen frisch geschliffener Messer zum Spielen, wird es mit Bestimmtheit Verletzte geben. Wenn wir Glück haben, werden die Verletzungen leicht sein. Es könnte aber auch zu schweren Verletzungen oder sogar zu Todesfällen kommen.
Dieses einfache Beispiel lässt sich durchaus auf den modernen Medizinbetrieb übertragen. Wir Mediziner müssen einsehen, dass wir keine Götter in Weiß sind. Die Mehrheit der Patienten sieht sich als emanzipiert und entscheidet mitunter selbst, ob und wie sie die Medikamente einnehmen will. Sie denkt sich nichts Böses und experimentiert ein wenig. Wie Herr Daiml. Das weiß die Medizin. Also muss sie auch damit rechnen.
Es gibt in dieser Analogie allerdings einen gravierenden Unterschied zwischen dem Volksschul- und dem Medizinbetrieb: Wir Ärzte wissen selbst nicht immer, wie scharf und gefährlich unsere Messer sind. Wir bekommen sie von der Pharmaindustrie zur Verfügung gestellt und spielen damit.
Betrachten wir zum Beispiel die Gebrauchsinformationen für Patienten von Humira®. Der erste Absatz beschreibt kurz und prägnant das Wirkprinzip des Medikaments im Idealfall: »Der Wirkstoff von Humira, Adalimumab, ist ein humaner monoklonaler Antikörper. Monoklonale Antikörper sind Eiweiße, die sich an ein bestimmtes Ziel anheften. Das Ziel von Adalimumab ist das Eiweiß Tumornekrosefaktor-alpha (TNFα). TNFα ist beteiligt an Abwehrreaktionen des Körpers. Bei den oben genannten Erkrankungen ist die Menge an TNFα erhöht. Humira heftet sich an TNFα und verringert dadurch die entzündlichen Vorgänge bei diesen Erkrankungen.«
So weit, so gut. Endlich ein Medikament, mit dem wir chronische Entzündungskrankheiten elegant behandeln können.
Dann kommt das Aber.
»Wenn Sie Humira anwenden, kann sich Ihr Risiko, Lymphome, Leukämie oder andere Krebsformen zu entwickeln, möglicherweise erhöhen. In Ausnahmefällen wurde bei Patienten, die mit Humira behandelt wurden, eine seltene und schwere Form des Lymphoms beobachtet. Einige dieser Patienten wurden gleichzeitig mit dem Wirkstoff Azathioprin oder 6-Mercaptopurin behandelt.«
Die Gebrauchsinformationen warnen also ganz offen. Den Patienten fehlt die Erfahrung, um das Risiko richtig einschätzen zu können. Es bleibt also uns, den Ärzten, überlassen, ob wir mit diesem scharfen Messer spielen wollen. So spielen wir immer wieder mit dem Schicksal unserer Patienten.
Seit Jahren fällt mir auf, dass Patienten, die mit monoklonalen Antikörpern behandelt werden, immer wieder an Krebs erkranken. Nicht oft, aber doch so oft, dass es in einer Landarztpraxis auffällt.
Durch komplexe Medikationen schaffen wir für die Patienten zuweilen ein höchst gefährliches Umfeld. Wir helfen in Bezug auf die Erkrankung A, verursachen dabei aber Erkrankung B. Diese Vorgehensweise deckt sich nicht mit meinen Vorstellungen einer patientenorientierten Medizin.
In den vierzig Jahren meines Arztseins hat sich vieles verändert. Nicht zuletzt ich mich selbst. Meine Praxis befindet sich seit mehreren Jahrzehnten in Marchegg am östlichen Rand des Marchfeldes, einem ländlichen Gebiet im Osten Wiens. 36 Jahre als Landarzt haben mein ärztliches Denken und Fühlen geprägt. Sie haben mir aber auch bewusst gemacht, wie weit die Bedürfnisse der Patienten und die Zielvorgaben der modernen Medizin auseinanderliegen können.
Die Zahl der Ärzte in Österreich hat sich während meines bisherigen Lebens annähernd vervierfacht. Dabei hat sich die Bevölkerung nicht annähernd verdoppelt, geschweige denn, dass Menschen viermal so alt werden oder um den Faktor vier weniger krank oder gar viermal so zufrieden mit ihrer Gesundheit wären.
Im Gegenteil. Es gibt mehr Kranke und Leidende als je zuvor. Krankenhäuser und Spitalsambulanzen sind überfüllt. Das medizinische Personal arbeitet auch abseits der Coronapandemie an der Belastungsgrenze. 25 Jahre lang habe ich als Kassenarzt und Notarzt in Personalunion hart an dieser Grenze gearbeitet. Im Alter von 53 Jahren habe ich mich dann entschieden, aus diesem System auszubrechen und als Wahlarzt zu praktizieren. Das mache ich nun seit elf Jahren. Mein Arbeitsvolumen hat sich kaum geändert. Der Strom der Patienten wächst immer weiter.
Diese Entwicklung macht mich nachdenklich. 5,9 Millionen Menschen besuchten im Jahr 2019 laut Statistik Austria zumindest einmal eine Hausärztin oder einen Hausarzt. Das sind knapp achtzig Prozent der Bevölkerung. Erschafft die moderne Medizin mehr Patienten, als sie zu heilen in der Lage ist?
Wenn wir die Fallzahlen der einzelnen Fachgesellschaften zusammenzählen, erhalten wir eine Patientenmenge, die die Einwohnerzahl des gesamten Landes deutlich übersteigt. 2,3 Millionen Menschen leiden in Österreich an Wirbelsäulenbeschwerden, zwei Millionen an Depressionen und Burnout, 1,5 Millionen an Bluthochdruck. 800.000 Menschen sind Diabetiker. 750.000 sind Osteoporosepatienten, 600.000 haben eine koronare Herzkrankheit, und Hunderttausende von Polyarthrosepatienten leben in diesem herrlichen Land. 42.000 Patienten erkranken jährlich an Krebs. Die Liste kann leider beliebig erweitert und fortgesetzt werden. Dass es trotzdem noch vereinzelt gesunde Menschen gibt, liegt daran, dass viele Patienten multimorbid sind und von mehreren Fachbereichen der Medizin gezählt und beansprucht werden.
Im Jahr 2020 gab es in österreichischen Spitälern 3,996.670 – also fast vier Millionen – medizinische Leistungen während stationärer Aufenthalte – pandemiebedingt ohnehin zwölf Prozent weniger als im Jahr davor. Von Jahr zu Jahr werden mehr Operationen durchgeführt. In kaum einem anderen Land der Welt werden mehr Knie- oder Hüftendoprothesen implantiert als in Österreich. Ich glaube nicht, dass österreichische Knie und Hüften im Vergleich zum Rest der Welt derart überproportional anfällig sind. Der Wirtschaftskomplex Gesundheitssystem boomt. Um die Umsätze der Pharma- und Medizinindustrie müssen wir uns keine Sorgen machen.
Das Gesundheitssystem ist kostspieliger denn je. Um es finanziell am Leben zu erhalten, müssen auch außerhalb der Coronapandemie genügend Patienten durch das System geschleust werden. Tag und Nacht wird untersucht, kontrolliert, operiert und therapiert. Ein großer Teil dieser ärztlichen Leistungen ist nicht notwendig. Manche dieser Leistungen schaden Patienten sogar. Eine Reduktion ärztlicher Leistungen auf das Notwendige würde demnach auch die Zahl der unerwünschten Nebenwirkungen verringern.
Der Satz »Primum non nocere« – zuerst einmal nicht schaden – ist ein essenzieller Bestandteil des hippokratischen Eides, den wir Ärzte leider schon lange nicht mehr ablegen. Die volle Aussage der Passage lautet: »Primum non nocere, secundum cavere, tertium sanare« (… zweitens vorsichtig sein und drittens heilen). Nicht zu schaden muss wieder die oberste Priorität im Medizinbetrieb werden.
Die Heilkunst hat die Menschen und ihre Schicksale aus den Augen verloren. Aus der Kunst des Heilens ist eine Gesundheitsindustrie geworden. In erschreckend vielen Bereichen des Gesundheitssystems erinnert die tägliche Routine an Fließbandarbeit. Ärzte und Pflegepersonal stehen unter extremem Zeit-, Dokumentations- und Leistungsdruck. Dieser Druck führt dazu, dass Patienten wie in einer Reparaturwerkstätte abgefertigt werden. Dass Patienten mitdenken, Gefühle zeigen und mitreden, ist nicht erwünscht.