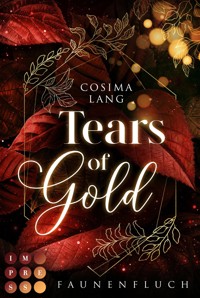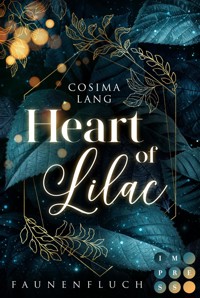5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
**Ein magischer Liebespakt in New York** Die 24-jährige New Yorkerin Tania hat schon eines früh gelernt: Geh niemals einen Pakt mit Feen ein. Doch ausgerechnet ihr Bruder begeht diesen Fehler und bricht seinen Deal. Um ihn vor einer Strafe zu bewahren, fasst Tania einen waghalsigen Plan. Sie muss Oberon, den König der Feen, treffen, um den Deal aufzulösen. Als es ihr tatsächlich gelingt, dem Feenkönig zu begegnen, stockt Tania der Atem. Der charmante König schlägt ihr einen scheinbar unmöglichen Handel vor. Außerstande, ihren Bruder im Stich zu lassen oder sich dem seltsamen Kribbeln zu entziehen, das sie in Oberons Anwesenheit verspürt, bricht Tania ihre oberste Regel und lässt sich auf den gefährlichen Pakt ein … Kannst du das Unmögliche möglich machen? Begleite eine curvy Heldin durch das magische New York – eine Urban Fantasy voller Selbstliebe, Spannung und Herzklopfen. Textauszug: »Du wirst nichts unterschreiben, Tania.« Erneut stand er so nah, dass ich seine Körperwärme spürte und sein Geruch meine Sinne flutete. »Ich schließe meine Handel nicht mit Stift und Papier ab.« »Wie dann?« »Ich habe dir den Deal vor Zeugen erklärt und du hast ihn angenommen. Alles, was jetzt noch fehlt, um ihn zu besiegeln, ist ein Kuss.« //»A Midsummer Night´s Deal. Feenpakt« ist ein in sich abgeschlossener Einzelband.//
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Impress
Die Macht der Gefühle
Impress ist ein Imprint des Carlsen Verlags und publiziert romantische und fantastische Romane für junge Erwachsene.
Wer nach Geschichten zum Mitverlieben in den beliebten Genres Romantasy, Coming-of-Age oder New Adult Romance sucht, ist bei uns genau richtig. Mit viel Gefühl, bittersüßer Stimmung und starken Heldinnen entführen wir unsere Leser*innen in die grenzenlosen Weiten fesselnder Buchwelten.
Tauch ab und lass die Realität weit hinter dir.
Jetzt anmelden!
Jetzt Fan werden!
Cosima Lang
A Midsummer Night’s Deal. Feenpakt
**Ein magischer Liebespakt in New York**
Die 24-jährige New Yorkerin Tania hat schon eines früh gelernt: Geh niemals einen Pakt mit Feen ein. Doch ausgerechnet ihr Bruder begeht diesen Fehler und bricht seinen Deal. Um ihn vor einer Strafe zu bewahren, fasst Tania einen waghalsigen Plan. Sie muss Oberon, den König der Feen, treffen, um den Deal aufzulösen. Als es ihr tatsächlich gelingt, dem Feenkönig zu begegnen, stockt Tania der Atem. Der charmante König schlägt ihr einen scheinbar unmöglichen Handel vor. Außerstande, ihren Bruder im Stich zu lassen oder sich dem seltsamen Kribbeln zu entziehen, das sie in Oberons Anwesenheit verspürt, bricht Tania ihre oberste Regel und lässt sich auf den gefährlichen Pakt ein …
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
Nachwort/Danksagung
© HelmutKirch
Cosima Lang entdeckte früh ihre Leidenschaft für Bücher, insbesondere für Fantasy- und Liebesromane. Nach ihrem Abitur begann sie selbst zu schreiben. Fremde Welten und Magie bieten ihr die Möglichkeit, aufregende Abenteuer und Mysterien zu erleben und starke Heldinnen und Helden zu erschaffen. Cosima Lang studiert Germanistik und Anglistik in Düsseldorf.
Für Ju, Emy, Sam, Christin und JulyNur eine von euch zu verlieren, wäre genauso grauenvoll wie alle zusammen.
Vorbemerkung für die Leser*innen
Liebe*r Leser*in,
dieser Roman enthält potenziell triggernde Inhalte. Aus diesem Grund befindet sich hier eine Triggerwarnung. Am Romanende findest du eine Themenübersicht dazu, die demzufolge Spoiler für den Roman enthält.
Entscheide bitte für dich selbst, ob du diese Warnung liest. Gehe während des Lesens achtsam mit dir um. Falls du während des Lesens auf Probleme stößt und/oder betroffen bist, bleib damit nicht allein. Wende dich an deine Familie, Freunde oder auch professionelle Hilfestellen.
Wir wünschen dir alles Gute und das bestmögliche Erlebnis beim Lesen dieser besonderen Geschichte.
Cosima Lang und das Impress-Team
Prolog
New York City bei Nacht war ebenso phantastisch wie einschüchternd. Tausende Lichter, die in der Dunkelheit funkelten, abertausende Seelen in einer Welt aus Glas und Stahl. Und sie alle taten dasselbe – sie träumten. Von der großen Karriere, der großen Liebe oder dem großen Glück. Denn unter dem stillen Sternenhimmel und seinem halbvollen Mond verurteilte einen niemand für seine völlig überzogenen Träume.
Auch um mich herum redeten alle an diesem Abend aufgeregt über ihre Wünsche und Sehnsüchte. Ich allerdings konnte nicht anders, als heimlich mit den Augen zu rollen. Es war gut, dass ich mich von den anderen am Tisch abgewandt hatte und stattdessen aus dem Fenster auf die Straßen hinunterschaute. Viel lieber beobachtete ich das Spiel der Lichter in der Nacht, als noch eine Geschichte über die Wunder des Theaters zu hören.
»Es ist wirklich wie ein Traum. Man spürt Lloyd Webers Genialität einfach in jeder einzelnen Note. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen.«
Der Abend war eigentlich recht lustig gewesen, bis dieser Möchtegernbroadwaystar, Johnny, aufgetaucht war und die ganze Konversation an sich gerissen hatte.
Aus dem Augenwinkel lugte ich hinüber zu meinem Zwillingsbruder William, der mit voller Konzentration an den Lippen dieses Angebers hing. Ich kannte Will gut genug, um zu wissen, dass er sich für seinen Kumpel zwar freute, aber gleichzeitig den Stich der Eifersucht verspürte.
»Wie hast du diese Rolle denn nun bekommen?«, fragte mein Bruder flehend.
»Oh, mein lieber William, das ist mein Geheimnis.« Wie ein König thronte Johnny an der Stirnseite des Tisches. Er ging völlig auf in der Hingabe der anderen, sonnte sich in seinem Moment des Ruhms. Sogar ich als Theaterlaie wusste, dass irgendein Platz im Ensemble nicht mit einer Hauptrolle vergleichbar war. Hier jedoch, inmitten arbeitsloser Schauspieler, wirkte es so, als hätte Johnny die Rolle des Phantoms ergattert. Ich hingegen träumte gerade nur noch von meinem warmen, weichen Bett.
Irgendeine Macht schien es an diesem Abend gut mit mir zu meinen, denn kurz darauf machte sich die kleine Gruppe zum Aufbruch bereit. Mir war nicht länger nach Smalltalk, also beließ ich es zum Abschied bei einem Lächeln.
Die wummernde Musik der Bar verstummte endlich, als sich die Tür hinter mir schloss. Die Nachtluft hier draußen war eiskalt und klar, winzige Schneeflocken tanzten im Licht der Laternen. Obwohl es bereits Ende Februar war, hatte sich ein Schneesturm über der Stadt ausgetobt. Nun versank New York unter einer frischen Schicht aus weißem, flauschigem Schnee.
Mehrmals holte ich tief Luft, während ich meinen Blick über die vor mir liegende Straße gleiten ließ. Sogar um drei Uhr morgens war hier immer noch die Hölle los — was sicher auch daran lag, dass es Samstagnacht war. Die New Yorker geierten nach Party und Feiern, nach Leben und Liebe. Nach Ablenkung und Ausschweifung.
Doch für mich war in dieser Nacht das Maximum erreicht, ich sehnte mich einfach nur nach der Stille meiner Wohnung.
»Bist du dir sicher, dass wir nicht gemeinsam fahren sollen?« William trat hinter mir aus der Tür. Das grelle Licht der Straßenlaternen ließ sein elegantes Gesicht kantig wirken und warf dunkle Schatten unter seine Augen. Er trug einen von diesen schicken Wintermänteln, die eigentlich viel zu teuer waren, um sie mit Schneematsch zu versauen.
Hinter ihm verließ sein heutiges Date, eine niedliche Fee mit großen braunen Augen, ebenfalls die Bar. Zwar hatte ich an diesem Abend nicht viel mit ihr sprechen können, aber sie schien nett zu sein. Ein wenig tat es mir leid, dass William ihr wahrscheinlich noch vor dem Morgengrauen das Herz brechen würde.
»Das wäre doch nur ein Umweg für euch beide.« Aus der Tasche meines dicken Winterparkas fummelte ich die schon etwas abgetragenen Handschuhe. »Wenn ich durch den Park laufe, bin ich viel schneller da. Ich schreib dir, sobald ich zu Hause bin. Ihr beide solltet euch mal lieber darum bemühen, noch ein Taxi zu bekommen.« Bevor einer der beiden noch etwas erwidern konnte, machte ich auf dem Absatz kehrt und stapfte davon.
Natürlich hatte William recht, es war gefährlich, nachts alleine durch die Stadt zu gehen. Allerdings tat ich dies nun schon seit Jahren und sah darin keine Gefahr mehr für mich. Normalerweise ging ich in Begleitung meiner Hündin Rosa, doch ab und an auch im Alleingang. So aufregend und wild New York am Tage war, so idyllisch und mysteriös konnte es in der Nacht sein.
Die dicke Schneedecke dämpfte die Geräusche um mich herum, sodass der Central Park in einer beinahe unnatürlichen Stille vor mir lag. Nur wenige Fußabdrücke zeichneten sich auf dem frisch gefallenen Schnee ab. Mit kindlicher Freude und gleichzeitig auf die versteckte Eisschicht bedacht wanderte ich extra an den Stellen entlang, an denen der Schnee noch glatt und unberührt war. Das kalte Weiß würde meine Spuren schon sehr bald wieder verschlucken, doch bis dahin blieb ein kleiner Teil von mir hier zurück.
Jetzt, am Wochenende, war der Schnee ja noch unterhaltsam, aber es graute mir schon davor, am Montag zur Arbeit zu müssen. Dann würde es wieder vorbei sein mit Winterwunderland und das Schneechaos würde die Stadt beherrschen. Bis dahin jedoch, beschloss ich, den späten Winter noch einmal richtig zu genießen.
Winzige Eiszapfen baumelten von den kahlen Bäumen um mich herum. Viele der Äste hingen dank des Gewichts tiefer, sie bildeten Torbögen, unter denen ich mich hindurchducken musste. Außer dem leisen Knirschen des Schnees unter meinen Schuhen war nichts weiter zu hören.
Diese Stille war schon seltsam. Der plötzliche Schneefall schien viele der Nachtschwärmer vertrieben zu haben. Verübeln konnte ich es ihnen nicht, durch die nasse Kälte bereute ich meine Entscheidung inzwischen auch ein wenig. Das fehlende Leben im Park verlieh ihm eine Aura des Schaurigen, so als würden in den tiefen Schatten um mich herum unbekannte Monster lauern. Ein ums andere Mal drehte ich mich um, doch war außer mir keine Seele zu entdecken.
Sogar die Elfen – winzige bezaubernde Wesen, kaum größer als ein Daumen – trauten sich bei diesem Wetter nicht aus ihren Verstecken. Im Gegensatz zu ihren noblen Verwandten, den Feen, lebten sie ausschließlich in der Natur und scheuten den Kontakt zu den Menschen. Doch des Nachts kamen sie gerne heraus, um zwischen den Bäumen zu tanzen. Heute Nacht allerdings bei dieser Kälte würden ihnen sicher die zarten Flügel gefrieren.
Vor mir machte der Weg eine Biegung nach rechts, woraufhin sich die Skyline vor mir öffnete und den Blick auf das höchste Gebäude von New York freigab. Der Erltower thronte über der Stadt als andauerndes Denkmal daran, wem sie eigentlich gehörte.
Sogar auf die Entfernung hin sah ich, dass in den meisten der schier unendlichen Fenster weiterhin Licht brannte. Die Feen arbeiteten noch bis spät in die Nacht hinein, beschäftigt mit dem Führen ihres Reiches. Nicht zum ersten Mal fragte ich mich, wie es wohl im Inneren dieses Monstrums aus Stahl, Glas und Natur aussah. Der Tower war weltweit bekannt dafür, ein gewaltiger vertikaler Garten voller bunter und außergewöhnlicher Pflanzen zu sein.
Langsam setzte ich meinen Weg fort, weiterhin vorsichtig, um auf der Eisschicht, die sich unter dem Schnee gebildet hatte, nicht auszurutschen. Die Hälfte der Strecke hatte ich zum Glück schon zurückgelegt, denn inzwischen spürte ich die Kälte der Nacht durch meine Klamotten hindurchkriechen. Die Reste des Alkohols in meinem Blut halfen leider auch nicht mich warm zu halten.
Morgen musste ich unbedingt noch einmal mit Rosa herkommen. Schnee hatte sie schon immer geliebt und so ein langer Sonntagsspaziergang würde uns beiden sicher guttun. Mit etwas Glück würden ein paar von unseren bekannten Hundebesitzern ebenfalls diese Idee haben, dann könnte sie sich mit den anderen Vierbeinern austoben.
Die Bilder in meinem Kopf zerplatzten blitzartig, als plötzlich aus dem Nichts eine Stimme an mein Ohr drang. Hektisch zuckte mein Blick über die Büsche und Bäume, bis ich die Quelle dieser Stimme entdeckte. Ein Mann kam deutlich schwankend auf mich zu, das Gesicht unter einer Kapuze verborgen. Schon auf die Entfernung roch ich seine Fahne, ein krasser Unterschied zu der klaren Nachtluft.
Der Kerl murmelte etwas vor sich hin, was ich weder verstehen konnte noch wollte. Mein Magen krampfte sich unangenehm zusammen. Hastig wich ich zur Seite aus, rutschte dabei aber auf dem gefrorenen Weg aus. Der Schrei blieb mir in der Kehle stecken, als ich ein paar feste Finger auf meinem Arm spürte.
»Vorsichtig, Kleines«, murmelte der Typ viel zu nah an meinem Ohr. Sein heißer Atem brannte mir auf der Haut, doch viel schlimmer war sein Mundgeruch nach altem Fett, Zwiebeln und abgestandenem Bier. Prompt wandte ich den Kopf ab und versuchte mich gleichzeitig aus seinem Griff zu befreien. Davon schien der Kerl allerdings wenig beeindruckt.
»Was macht denn ein so hübsches Ding nachts hier alleine? Suchst du Gesellschaft?« Zwar lallte er die Worte, doch nahm ich den bedrohlichen Unterton wahr. Je mehr ich versuchte, mich aus seinem Griff zu lösen, desto fester packte er zu. Schon jetzt war ich mir sicher, dass ich am Morgen Spuren auf meiner Haut entdecken würde. Trotzdem gab ich nicht nach. Der Alkohol in meinem Blut vertrieb die Panik zumindest so weit, dass ich mich nicht davor scheute, mit meinem freien Arm auszuholen und nach dem Kerl zu schlagen.
»Finger weg!«
Leider schienen meine Abwehrversuche keine sonderliche Wirkung zu haben. Anstatt endlich Abstand zu nehmen, kam er sogar noch näher, bis sich sein Gesicht direkt vor meinem befand. »Hab dich nicht so. Wir beide können doch etwas Spaß haben. Bei diesem Scheißwetter braucht man doch jemanden, der einen warm hält.«
Geleitet von meinem Instinkt, erkannte ich meine Chance und rammte mit voller Wucht mein Knie in ihn hinein. Der Kerl grunzte laut auf, bevor er benommen zurücktaumelte und endlich von mir abließ. Ohne ihn noch eines weiteren Blickes zu würdigen, machte ich auf dem Absatz kehrt und versuchte zu fliehen. Leider kam ich nicht weit. Noch bevor ich auch nur einen Schritt tun konnte, wurde der vereiste Boden mir zum Verhängnis. Ich fand keinen Halt, meine Füße rutschten weg und plötzlich fand ich mich auf dem Rücken liegend wieder, den Blick gen Himmel gerichtet. Ein scharfer Schmerz schoss durch meinen Körper und trieb mir die Luft aus den Lungen.
Einen Atemzug lang konnte ich nichts anderes tun, als einfach nur dazuliegen. Dann krachte die Realität wieder auf mich ein, in Form einer angsteinflößenden Gestalt, die sich nun über mir erhob.
»Auf dem Rücken liegen kannst du schon mal«, grollte der Betrunkene von oben herab, ein gieriges Funkeln in seinen Augen. Adrenalin schoss wie glühende Lava durch meine Adern, gefolgt von einer grauenerregenden Angst, die sich in mir festsetzte. Ein klein wenig befriedigt stellte ich fest, dass er den Mund noch immer vor Schmerzen verzog. Wenigstens hatte ich ihn richtig erwischt.
»Als wüsstest du etwas mit einer Frau anzufangen«, giftete ich trotz meiner prekären Lage zurück. Unter gar keinen Umständen würde ich mich vor diesem Kerl schwach zeigen. »Jetzt verschwinde endlich, bevor ich noch einmal zutrete!«
So auf dem Boden liegend war meine Drohung allerdings nicht sehr wirkungsvoll. Trotz meines schmerzenden Hinterns und Kopfes schaffte ich es zumindest, mich auf die Seite zu drehen, um nicht ganz so hilflos dazuliegen. Der Schmerz war erst einmal vergessen, ersetzt durch eine pochende Wut, die auch die Kälte von mir fernhielt.
Aus dem Augenwinkel sah ich, wie der Kerl seine Hand nach mir ausstreckte und dann … plötzlich erstarrte.
Ein dunkler, massiver Schatten hatte sich über uns gelegt. Mit einem mulmigen Gefühl folgte ich dem überraschten Blick des Betrunkenen und bemerkte eine verhüllte Gestalt, die wie aus dem Nichts neben uns aufgetaucht war.
»Ich meine, die Dame hat dir eine klare Anweisung gegeben.« Die Stimme des Fremden war angenehm tief und rau, doch auch kalt wie das Eis um uns herum.
»Das hier geht dich rein gar nichts an, Arschloch«, zischte mein Angreifer, seine Aufmerksamkeit nun ganz auf den Neuankömmling gerichtet.
Diesen Moment nutzte ich, um mich aufzurichten. Dabei wechselte mein Blick immer wieder hektisch zwischen den beiden Männern hin und her. Entweder war der Fremde mir zu Hilfe geeilt oder ich saß jetzt nur noch tiefer in der Scheiße.
»An deiner Stelle würde ich mir ganz genau überlegen, was du nun tun wirst.« Die scharfen Worte des Fremden wurden von einem noch schärferen Lächeln begleitet, das seine spitzen Eckzähne enthüllte. Dank der spärlichen Beleuchtung wirkte sein Gesicht kantig und dunkel, was ihn gänzlich wie ein Raubtier wirken ließ.
»Drecksfee«, lallte mein Angreifer mutig vor sich hin und ergriff gleichzeitig die Flucht.
Einige Augenblicke saß ich nur da und blickte der deutlich schwankenden Gestalt hinterher, wie sie in der Nacht verschwand. Nur langsam sickerte die Realität in meinen Verstand zurück. Die Berührungen des Kerls auf meiner Haut, der Klumpen aus Angst in meinem Magen, das Klopfen meines Herzens, das mir immer noch in den Ohren dröhnte. Gefolgt von einem Zittern, das mir durch Mark und Bein ging.
»Alles in Ordnung bei dir?«, erklang erneut jene raue, warme Stimme an meinem Ohr. Erst da wurde mir wieder bewusst, dass ich nicht alleine war. Langsam wandte ich den Kopf. Der Fremde neben mir kniete auf dem Boden. Dadurch waren unsere Gesichter fast auf einer Höhe, was mich deutlich weniger einschüchterte.
»Geht so«, brachte ich erschöpft hervor. Ein seltsames Schweigen breitete sich zwischen uns aus, während ich weiter versuchte, meine wirren Gedanken zu sammeln. Was gerade geschehen war, hatte sich innerhalb weniger Momente abgespielt und lief nun immer wieder wie ein Film in meinem Kopf ab. Verdammt, das hätte echt übel für mich ausgehen können.
»Danke!« Ich wandte mich nun ganz dem Fremden zu, der immer noch neben mir kniete, den Kopf leicht zur Seite gelegt. Die Wollmütze, die er trug, verbarg seine spitzen Ohren, doch die brauchte es gar nicht, um zu erkennen, dass es sich bei meinem Retter ganz klar um einen Fee handelte. Sogar in dem schummrigen Laternenlicht ging von seiner Haut ein sanfter Schimmer aus, fast so als würde er von innen heraus leuchten. Mehr konnte ich leider nicht von seinem Gesicht erkennen, da er den Schal bis über seine Mundpartie hochgezogen hatte.
»Gern geschehen.« Er reichte mir eine behandschuhte Hand. »Allerdings wäre ich lieber früher aufgetaucht.« Mit einer einzigen fließenden Bewegung erhob er sich zu seiner vollen Größe, wobei er mich mit sich zog.
Für einen Moment schoss mir ein scharfer Schmerz durch die Wirbelsäule, der sich dann als andauerndes Pochen in meinem Hintern einnistete. Das würde sicher einen dicken blauen Fleck geben. Ich unterdrückte den Drang, mir den Po zu reiben und betrachtete stattdessen verstohlen meinen Retter.
Er war mehr als einen Kopf größer als ich, was an und für sich nichts Besonderes war – so gut wie jeder war größer als ich. Der Fremde jedoch ragte nicht nur über mir auf, er war auch breiter als ich. Immer noch warfen die Laternen scharfe Kanten auf sein Gesicht, trotzdem fühlte ich mich von ihm weder bedroht noch eingeschüchtert.
»Danke nochmal«, murmelte ich, in dem Versuch, die Stille zwischen uns zu füllen. Unangenehm berührt stand ich da, unsicher, wie es nun weitergehen sollte.
»Bist du sicher, dass es dir gut geht?« Mein Herz machte einen kleinen Sprung, als er die Hand ausstreckte, um einen Klumpen Schnee aus meinem Haar zu entfernen. »Du bist ziemlich hart auf den Boden gefallen.«
»Oh, mach dir da mal keine Sorgen. Hab zum Glück ordentlich Polsterung.« Meine Stimme klang in meinen Ohren viel zu hoch und gekünstelt. »Da passiert so schnell nichts. Ich hoffe ja eher, dass der Kerl die nächsten Wochen noch ordentlich Schmerzen in den Eiern hat. Aber bei mir ist wirklich alles in Ordnung!«, betonte ich noch einmal, bevor ich schnell den Mund schloss. Es konnte doch nicht sein, dass ich gerade ernsthaft über die Eier eines Kerls sprach, anstatt einfach meine Klappe zu halten.
Für einen Moment erstarrte das Gesicht meines Retters zu einer fast bewegungslosen Maske, dann lachte er leise. »Das war auch ein ziemlich beeindruckender Tritt.«
»Für irgendwas müssen die vielen Kurse in Selbstverteidigung ja gut sein. Auch wenn ich hoffe, solch einen Tritt so schnell nicht wieder anwenden zu müssen.« Ein Schauder überlief meinen Körper, als ich noch einmal durchdachte, was mir da eigentlich passiert war und wie viel Glück ich doch gehabt hatte. Wäre der Fremde nicht aufgetaucht, dann hätte mir bei Weitem Schlimmeres drohen können als ein paar blaue Flecke.
»Wenn du möchtest, kann ich dich ein Stück begleiten«, schlug mein Retter vor, fast so als hätte er meine düsteren Gedanken gelesen.
Ich antwortete ihm nicht sofort. Stattdessen ließ ich meinen Blick noch einmal über seine Gestalt wandern. Die einfachen, dicken Wintersachen ließen nicht viele Rückschlüsse auf ihn zu, genauso wenig wie sein Gesicht, von dem ich immer noch nicht sonderlich viel erkennen konnte. Obwohl er im wahrsten Sinne des Wortes ein düsterer Fremder war, schüchterte mich seine Gegenwart nicht ein. »Wäre sicher das Beste. Vor allem, falls ich mich noch mal hinlege.«
»Das werde ich schon zu verhindern wissen.« Seine Stimme hatte diesen schelmischen Unterton, für den die Feen so bekannt waren. Doch bei ihm lag darin kaum Spott und Spaß, sondern ganz klar ein Hauch von Flirt.
Diesen Gedanken vertrieb ich, so schnell wie er gekommen war, wieder aus meinem Kopf. Falscher Zeitpunkt, falscher Ort und leider auch falscher Kerl. So ansprechend diese ganze Retter-in-der-Not-Masche auch schien, er war immer noch ein Fremder, der sich nachts alleine im Park herumtrieb.
Sorgsam darauf bedacht, immer genug Abstand zwischen uns zu lassen, setzten wir unseren Weg durch den Central Park fort. Inzwischen waren aus den winzigen Eiskristallen, die vom Himmel fielen, große Wattebäuschchen geworden, die sicher schon bald die Spuren der letzten paar Minuten verdecken würden.
Das Knirschen des Schnees unter unseren Füßen war das einzige Geräusch, das unseren Weg begleitete. Die Kälte der Nacht prickelte auf meiner Haut, die klare Luft roch angenehm nach Winter. Immer wieder schielte ich möglichst unauffällig zu dem Fremden, der entspannt neben mir herschlenderte. Seltsamerweise war die Stille zwischen uns nicht unangenehm und ich hatte auch keinen Drang, sie mit sinnlosem Geplapper zu füllen.
Aus diesem Grund überraschte es mich, als der Fremde auf einmal anfing zu sprechen. »Es geht mich ja wirklich nichts an, aber was treibt dich so spät abends noch alleine in den Central Park?«
»Das ist eine echt gute Frage.« Vor allem eine, die ich mir in den letzten Minuten schon mehrmals gestellt hatte. »Irgendwie war mir einfach danach. Nachdem ich den ganzen Abend in einer völlig überhitzen und lauten Bar verbracht hatte, dachte ich mir, die Abkühlung und Ruhe täten mir ganz gut.«
»Keinen Freund, der dich nach Hause begleiten kann?«
Einige Augenblicke grübelte ich darüber nach, ob ich seine Frage beantworten sollte.
»Ich wohne mit meinem Bruder zusammen, aber der ist die Nacht erst mal anderweitig beschäftigt«, erwiderte ich schließlich. Sicher war William inzwischen in der Wohnung seines Dates angekommen, doch, bis es ihn wieder zu uns verschlug, würden noch ein paar Stunden vergehen.
»Hast du keine Angst, nachts alleine im Park?« Skepsis färbte die Stimme meines Retters.
»New York ist am Tage leider genauso gefährlich wie in der Nacht«, antwortete ich mit einem Schulterzucken. Tatsächlich war ich häufiger bei Tageslicht auf der vollen Straße belästigt worden als nachts alleine im Park. Eine Baustelle konnte unangenehmer sein als ein verlassener Park.
»Mich geht es natürlich auch nichts an, aber was treibt dich denn so spät abends hierher?«, wechselte ich das Thema.
»Ich mag die Ruhe hier. Da kann man gut abschalten. Außerdem könnte sich ja die Chance ergeben, einer hübschen Frau zu Hilfe eilen zu müssen.« Aus dem Mund eines jeden anderen hätte das unglaublich kitschig geklungen, doch ihm kaufte ich es irgendwie ab.
»Hattest du damit schon mal Glück? … Also mit dem Retten von Frauen?«
»Bisher noch nicht. Aber es gibt ja bekanntlich für alles ein erstes Mal«, kam es prompt zurück.
»Ich persönlich hoffe ja, dass es das letzte Mal war«, murmelte ich leise.
Für einen Moment ließ er den Blick über seine Schulter wandern, so als wollte er sichergehen, dass uns niemand verfolgte. »Der Kerl hätte auf jeden Fall deutlich mehr als nur einen Tritt in die Eier verdient.« Jegliche Wärme war aus seiner Stimme verschwunden und ein ganz anderer Schauder lief über meinen Körper.
So atemberaubend und einnehmend Feen auch waren, sollte man doch niemals vergessen, wie gefährlich sie sein konnten. Unsicher vergrub ich meine geballten Fäuste in der Jackentasche und senkte den Blick.
Der Fremde bemerkte meinen plötzlichen Stimmungswechsel. »Tut mir leid. Ich wollte dich nicht ängstigen«, flüsterte er tief und warm.
»Schon gut.« Schweigen legte sich erneut über uns, nur wirkte es diesmal nicht friedlich. Aus irgendeinem Grund störte mich das und ich suchte verzweifelt nach einem auflockernden Gesprächsthema.
»Bist du aus New York?« Am liebsten hätte ich mich für die Frage geohrfeigt, doch da war sie schon aus meinem Mund herausgerutscht und wurde von einem weißen Kältehauch davongetragen. Etwas noch Unkreativeres konnte man doch nicht fragen. Der Fremde schien das zum Glück nicht so zu sehen. Die Sturmwolken, die eben noch sein Gesicht verdunkelt hatten, verzogen sich und nun zeigte sich ein kleines Schmunzeln auf seinen Lippen. »Geboren bin ich in Europa, aber ich lebe inzwischen schon so lange hier, dass ich mich als echten New Yorker sehe. Und du?«
»Ich bin nach der Highschool hierhergekommen. Das ist inzwischen auch schon mehr als fünf Jahre her.« Ich ließ meinen Blick über unsere Umgebung wandern. Hoch über den verschneiten Baumwipfeln ragten die Wolkenkratzer auf. In der Ferne waren bereits die ersten Geräusche der Stadt zu hören. »Ich würde mich jetzt nicht als New Yorkerin bezeichnen, aber inzwischen bin ich sehr gerne hier.«
»Das klingt fast schon so, als wärst du nicht freiwillig hierhergekommen?«
Etwas unstimmig wiegte ich den Kopf hin und her. »Ich wurde – sagen wir mal – dazu überredet.« Übersetzt hieß das, dass meine Eltern mich mehr oder minder gezwungen hatten, zusammen mit William nach New York zu ziehen. Denn der Broadway, das Ziel meines Bruders, befand sich nun einmal hier.
Wie so vieles in meinem Leben war dies nicht meine eigene Entscheidung gewesen. Ich war sozusagen zu Williams Wohle mitgeschleift worden. »Aber geblieben bin ich am Ende aus eigenem Willen. Es ist schon verdammt schwer, sich nicht in diese Stadt zu verlieben.«
»Das stimmt allerdings. Ich kann mir inzwischen auch nicht mehr vorstellen, hier jemals wegzugehen.« In seinen Augen konnte ich dasselbe aufgeregte Funkeln entdecken, das man bei so vielen New Yorkern sah. »Welche Orte liebst du am meisten in dieser Stadt?«
»Den Zoo und die Bibliothek«, antwortete ich sofort. Darüber musste ich gar nicht erst nachdenken. Beides waren Orte, die ich hier als Erstes für mich entdeckt hatte und zu denen es mich immer wieder hinzog. »Deine?«
»Eindeutig der Central Park. Aber nichts übertrifft den Blick über die Stadt.«
»Oh, bist du regelmäßig auf dem Empire State Building?« Außer dem weltbekannten Gebäude gab es nur zwei weitere Tower in New York, von denen man einen solchen Blick hatte.
»So in etwa«, kam es kryptisch von meinem Fremden zurück.
Doch bevor ich weiter nachbohren konnte, waren wir auch schon am Ende des Parks angekommen. Die hell erleuchteten Straßen vor uns bildeten einen starken Kontrast zum halbdunklen Park. Seltsamerweise war ich nun ein wenig traurig, dass ich schon bald zu Hause sein würde.
»Ist es von hier aus noch weit bis zu dir?«
Während ich schon halb auf die Straße trat, blieb mein Retter mit verschränkten Armen in der Dunkelheit stehen.
»Nur ein paar Blocks«, murmelte ich ausweichend.
»Dann komm gut nach Hause.« Da war sie wieder, die Wärme in seiner Stimme, die mir einen Schauer über den Rücken jagte.
»Danke für deine Rettung.« Einem Impuls nachkommend, stellte ich mich auf die Zehenspitzen und drückte ihm einen Kuss auf die kalte Wange. Bevor mich die eigene Peinlichkeit überrollte, drehte ich mich schnell um und eilte davon.
An der nächsten Ampel angekommen, konnte ich jedoch nicht anders, als noch einmal über die Schulter zu schauen. Der Fremde stand weiterhin am Parkeingang, nichts weiter als eine dunkle Gestalt vor dem schneebedeckten Hintergrund.
Kapitel eins
Drei Monate später
Das Klimpern meines Schlüssels wurde begleitet von dem aufgeregten Winseln auf der anderen Seite der Tür. Rosas Schnauze schob sich durch den Spalt.
»Hallo, mein Baby«, gurrte ich ihr entgegen, bevor ich mich an ihr vorbei in die Wohnung drückte. Vor Aufregung war sie ganz aus dem Häuschen gewesen und ihr Schwanzwedeln erinnerte in diesem Moment mehr an einen Propeller. Mit großen, runden Augen blickte sie zu mir auf.
»Willst du raus, Kleines? Leider musst du noch ein wenig warten.« Erst einmal wollte ich in Ruhe ankommen. Eigentlich sollte ich schon seit zwei Stunden zu Hause sein, aber auf Arbeit kam noch im letzten Moment ein Notfall rein.
Jetzt schmerzte jeder Muskel in meinem Körper und ich wollte nichts lieber, als mich in der Badewanne zu entspannen. Doch dafür war später Zeit. Zuerst musste ich herausfinden, ob noch etwas zu essen im Hause war oder ich mit Rosa noch schnell einkaufen musste.
»Will? Bist du da?« Ich schlüpfte aus den Schuhen, nachdem ich meine Jacke aufgehängt hatte. Um diese Uhrzeit sollte mein Bruder eigentlich schon zu Hause sein. »Warst du heute schon mit Rosa draußen?«
Ich erhielt keine Antwort, jedoch hörte ich leise Geräusche aus seinem Zimmer. »Wäre schön, wenn du mal rauskommen würdest!« Mit der Faust schlug ich mehrmals gegen seine Tür. Dann ging ich in die Küche. Wie erwartet sah es hier aus wie auf einem Schlachtfeld. Das Geschirr vom Frühstück stand nicht nur immer noch in der Spüle herum, sondern türmte sich nun zu einem bedrohlich wackeligen Turm auf.
Ein Blick in den Kühlschrank bestätigte meinen Verdacht, dass ich dringend einkaufen musste. Die Erschöpfung nach den langen Stunden auf den Beinen verwandelte sich langsam in Frust, als ich die halbleeren Take-away-Kartons bemerkte, die auf der Theke herumstanden.
»William!« Diesmal hielt ich mich erst gar nicht damit auf, an seine Tür zu klopfen. Stattdessen stürmte ich direkt in sein Zimmer, absolut dazu bereit, ihm den Kopf abzureißen. Doch beim Anblick meines Bruders verpuffte die tobende Wut in mir. Tränenüberströmt und in sich zusammengerollt, lag er auf dem Bett.
»Was ist los?« Langsam und mit erhobenen Händen trat ich näher an ihn heran. In diesem Moment erinnerte er mich an ein verletztes Tier – verängstigt, allein und möglicherweise gefährlich. »Du kannst mit mir reden.«
Einige Augenblicke lag er einfach nur so da, kein Muskel seines Körpers regte sich.
»Ich hab richtig Scheiße gebaut, Nia.« Seine Stimme klang dumpf und hohl – wie aus einem Grab – zu mir herauf.
»So schlimm kann es gar nicht sein«, versuchte ich ihn zu beruhigen, während ich auf dem Bettrand Platz nahm. Mein Bruder konnte eine richtige Dramaqueen sein. Das hier musste also gar nicht so ernst sein, wie es gerade wirkte.
Auf den ersten Blick glaubten die meisten Menschen nicht, dass Will und ich Zwillinge waren oder überhaupt miteinander verwandt. Wir teilten dieselben stahlblauen Augen und braunen Haare und das war auch schon alles. Will war hochgewachsen und schlank, ich klein und rundlich. Er war der Mittelpunkt eines jeden Raumes, den er betrat, während ich mich eher im Hintergrund hielt. Die einzige sonstige Gemeinsamkeit, die wir beide teilten, war unsere Tierliebe.
Aber das alles änderte rein gar nichts an der Liebe, die ich für meinen Bruder empfand. Obwohl er der Ältere war – wenn auch nur bezogen auf wenige Minuten – passte ich immer auf ihn auf. Ihn jetzt mit Tränen in den Augen zu sehen, zerriss mir beinahe das Herz.
Rosa gesellte sich ebenfalls zu uns und rollte sich in Wills Arme zusammen. In langsamen, gleichmäßigen Bewegungen strich er über ihr weiches, hellbraunes Fell. »Du musst mir versprechen, nicht wütend zu werden, Nia. Ich bekomme das alles schon wieder hin.«
»Jetzt erzähl mir erst einmal, was geschehen ist, dann schauen wir weiter.« Das ungute Gefühl, das mich bei seinen Worten beschlich, verdrängte ich, so gut ich konnte.
Will schaute mir nicht in die Augen, als er sprach: »Ich habe einen Deal mit einem Fee gemacht, aber ich konnte meinen Teil der Abmachung nicht erfüllen.«
»Soll das ein Scherz sein? Du hast einen Deal gemacht? Einen verfickten Deal mit einem Fee?« Meine schrille Stimme klang im Zimmer nach. Völlig fassungslos blickte ich auf meinen Bruder herab, der sich nun unter meinem Blick wandte. »Was hast du dir nur dabei gedacht?«
»Es hörte sich an wie eine sichere Sache«, verteidigte er sich schwach.
»Du solltest es besser wissen.« Mein Mitleid hielt sich jetzt in Grenzen. Stattdessen brodelte eine alles versengende Wut in meinem Inneren, die mich auf die Beine trieb. »Wo ist der Vertrag?«, fragte ich und ging unruhig im Zimmer auf und ab.
Mit dem Kinn deutete Will zu seinem Schreibtisch. »Oberste Schublade.«
Das Herz klopfte mir bis zum Halse, als ich die Schublade langsam öffnete, in fester Erwartung, dass sich im Inneren eine Giftschlange verbarg. Doch da lag nur eine unschuldig wirkende Papierrolle, verschlossen mit einem schwarzen Siegel.
Einige Herzschläge lang stand ich wie angewurzelt da, während ich auf das Ding herabsah. Furcht und Wut kämpften in meinem Inneren um die Vorherrschaft und beide schnürten mir die Kehle zu. Bisher hatte ich noch nie einen echten Feenvertrag in den Händen gehalten. Und ehrlich gesagt, hatte ich mir darunter mehr vorgestellt als eine harmlose Papierrolle. Das Schriftstück fühlte sich kühl und glatt in meinen Fingern an. Vorsichtig legte ich es auf den Schreibtisch, brach das Siegel und entrollte es.
Kurz übermannte mich meine Furcht, sodass ich mitten in der Bewegung erstarrte. Mit aller Kraft drängte ich sie zurück, dafür hatte ich jetzt keine Zeit. Als Mensch war ich zu keinerlei Magie fähig. Dennoch spürte ich das leichte Kribbeln der Macht, die vom Schriftstück ausging. Den gedrungenen Text, geschrieben in winzigen, geschwungenen Buchstaben, überflog ich nur schnell. Stattdessen konzentrierte ich mich ganz auf die beiden Unterschriften am Ende: »William Anders« und »Feinri«.
Wills Signatur würde ich unter tausenden erkennen. In unserer Kindheit hatte ich seine öfter gesehen als jede andere. Seitdem ich denken konnte, hatte er sein Autogramm bis zur Perfektion geübt, für den Tag, an dem er endlich berühmt wäre. Normalerweise musste ich bei dieser Erinnerung grinsen, doch gerade schnitt sie wie eine Klinge in mein Fleisch. Wer hatte schon damit rechnen können, dass er sein so viel geübtes Autogramm eines Tages für etwas so Dummes einsetzen würde.
Ohne von dem Vertrag aufzublicken, fragte ich Will: »Wie bist du nur auf diese schreckliche Idee gekommen?«
»Du kennst doch Johnny?« Hinter mir raschelte das Bett, als er sich aufsetzte.
Stumm nickte ich. Natürlich kannte ich diesen Angeber. Und ich verabscheute ihn von ganzem Herzen. Wie sollte ich diesen arroganten Möchtegernstar jemals vergessen? Alle paar Tage tauchte er hier auf, um Will und leider auch mir von dem »unglaublichen Leben am Broadway« zu berichten.
»Er hat mir endlich erzählt, wie er an seine Rolle im Phantom der Oper gekommen ist. Durch einen Deal mit einem Fee.«
Entsetzt schüttelte ich den Kopf. »Na und? Bloß weil Johnny sein Leben riskiert, musst du das doch nicht auch machen!«
»Ich hatte nicht vor, mein Leben zu riskieren, ich wollte lediglich meine Karriere voranbringen«, verteidigte sich Will und stand auf.
»Das kannst du sicher auch, ohne so einen Blödsinn zu machen.« Ich war so wütend, dass ich mit dem Vertrag in meiner Hand vor seiner Nase herumwedelte, und dabei völlig vergaß, dass dieses Ding voller gefährlicher Magie war. Rasch nahm ich es wieder herunter. »Man gelangt auch ohne einen Deal an ein Casting.«
»Du verstehst es einfach nicht, Nia! Das ist mein Lebenstraum!« Will war neben mich getreten, die Hände in die Hüften gestemmt. »Alles, was ich brauche, ist eine Chance. Das ist doch wohl nicht zu viel verlangt.«
»Aber deine Freiheit dafür zu verlieren, ist es schon«, murmelte ich erschöpft.
Schweigen senkte sich über uns. Will hatte den Kopf von mir abgewandt, doch ich konnte die Tränen, die in seinen Augen schimmerten, sehen. »Du hast also ein Vorsprechen bekommen. Was wollte der Fee dafür?«
»Es klang nach einer so sicheren und einfachen Sache.« Hektisch fuhr er sich durch die Haare. »Ich sollte lediglich ein paar Pakete für ihn ausliefern.«
»Was war drin in diesen Paketen?«, hakte ich weiter nach, den Blick dabei noch immer auf den Vertrag gerichtet. Mir kamen sofort Drogen, Bomben oder sogar Schlimmeres in den Sinn.
»Keine Ahnung. So etwas habe ich doch nicht gefragt. Es ging um zwanzig Päckchen, die in Manhattan ausgeliefert werden sollten. Johnny musste das Doppelte ausliefern und bei ihm gab es keinerlei Probleme.« Will schaute mich an, als würde dieser Satz alles besser machen.
»Und was ist dann bitte schiefgelaufen? Hast du die Pakete nicht pünktlich abgeliefert oder gar beschädigt?«
»Ich habe eines verloren.«
Aus irgendeinem Grund überraschte mich das nicht. Trotzdem sackte mir der Magen gefühlt in die Kniekehle und brachte mich derart ins Wanken, dass ich mich am Tisch abstützen musste. »Wie genau hast du das Paket verloren?«
»Ich habe heute Morgen sechs Pakete beim Fee abgeholt. Die letzte Ladung, dann hätte ich es endlich geschafft. Ich war so nah dran! Aber nachdem ich alle abgeliefert hatte, stand immer noch ein Name auf der Lieferliste. Ich habe wirklich alles abgesucht. Mein Auto, die Wohnung, ich bin sogar jeden Paketstopp noch einmal abgefahren, um zu gucken, ob das fehlende Päckchen dort ist, aber Fehlanzeige.«
»Scheiße, Scheiße, Scheiße.« Das war das einzige Wort, das mir gerade durch den Kopf ging. Ich glaubte Will, dass er alles getan hatte, um dieses verfluchte Päckchen wiederzufinden. »Scheiße! Vielleicht haben sie dir eins zu wenig gegeben?«
Mit gesenktem Blick schüttelte er den Kopf. »Ich habe die Pakete selbst gezählt, als ich sie angenommen habe. Da waren noch alle da.«
»Wie sieht die Strafe aus?« Es graute mir vor der Antwort, aber ich musste es wissen.
»Zwanzig Jahre Arbeit.« Wills Worte hallten wie ein Glockenschlag durch das Zimmer. Sogar Rosa legte die Ohren an und winselte leise.
»Zwanzig Jahre«, wiederholte ich dumpf.
»Es war doch eine sichere Sache, Tania. Nicht einmal wirklich der Erwähnung wert. Immerhin habe ich schon einmal als Paketbote gearbeitet und ich war mir so sicher, dass nichts schiefgehen kann. Es ging um ein Vorsprechen für Hamilton und ein nagelneues Theaterstück von Miles Conner. Du weißt doch, wie sehr ich ihn verehre, da musste ich einfach …«
Wills fortlaufenden Monolog nahm ich kaum noch wahr. Meine Gedanken zogen wilde Spiralen und seine Gründe für diesen Deal waren mir, ehrlich gesagt, völlig egal. Für mich spielte es keine Rolle, wieso er sich wieder einmal so tief in die Scheiße geritten hatte. Das Einzige, was zählte, war die Frage, wie ich meinen Bruder da wieder herausziehen konnte, um ihn nicht für immer zu verlieren.
Zwanzig Jahre.
Allein der Gedanke entfachte eine Panik in mir, die ich kaum in Worte fassen konnte. Mein ganzer Körper fing an zu glühen, mir stockte der Atem und Übelkeit setzte sich in meinem Magen fest. Ich wollte schreien, toben, flehen und beten, doch kein klarer Satz formte sich in meinem Kopf.
»Ich muss nachdenken.« Ohne weiter auf seine Worte einzugehen, drängte ich an Will vorbei. Rosa folgte mir auf dem Fuß. Die Wohnung kam mir auf einmal viel zu eng und stickig vor. Ich sehnte mich nach frischer Luft und Ruhe, um klar denken zu können.
Mit routinierten Bewegungen zog ich Rosa ihr Geschirr an, und floh mit ihr hinaus auf die Straße. Wills andauernder Wortschwall folgte mir noch immer, bis die Tür ins Schloss fiel.
Natürlich war es hier draußen auf den Straßen von New York nicht viel ruhiger, doch wummerte mir der Stadtlärm nicht so sehr in den Ohren wie Williams Stimme.
Ich verstand meinen Bruder nicht, aber das war ja nichts Neues. Es war schon immer Wills Traum gewesen, Schauspieler zu werden. Sein einziges und absolutes Bestreben, von dem ihn rein gar nichts abbringen konnte: weder die Ablehnungen von den Schauspielschulen noch die Zurückweisung beim Casting. Ganz zu schweigen von finanziellen Problemen.
Das hatte ich immer an ihm bewundert. Diese Zielstrebigkeit, diese innere Sicherheit, dass das, was er für sich anstrebte, irgendwie und irgendwann erreichbar sein würde. Doch je älter wir wurden, desto weiter rückte dieser Traum in die Ferne. Ich hatte schon lange eingesehen, dass dies nur eine Fantasie für Will bleiben würde. Er aber glaubte noch immer daran.
Dennoch, wie konnte er nur so gedankenlos und naiv sein und einen Deal mit einem Fee eingehen? Jedes Kind wusste, dass Feen berüchtigt waren, einen über den Tisch zu ziehen. Aber Menschen waren wohl aus Verzweiflung bereit, so ziemlich alles zu tun.
Verzweiflung.
Mitten in der Bewegung blieb ich stehen. Will war absolut verzweifelt, deshalb hatte er diesen Deal gemacht. Fünf Jahre waren wir nun schon in New York und während ich mich hier eingelebt, einen festen Job und einen klaren Weg für meine Zukunft hatte, hielt er sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser, die ihn niemals weit bringen würden. All seine harte Arbeit, all das Bestreben, das Hoffen, das Wünschen, das Versuchen, immer und immer wieder, zahlte sich nicht aus.
Wir waren in die Stadt, die niemals schläft, gekommen, um Wills Träume zu erfüllen. Stattdessen jagte nur ein Misserfolg den nächsten.
Verdammt nochmal, war ich denn wirklich so blind gewesen und hatte es nicht gesehen?
Meine Füße hatten mich wie von alleine bis zum Hudson River getragen. Der scharfe, kalte Wind trieb den Geruch von Salz mit sich. Die Lichter der umliegenden Stadt spiegelten sich auf dem schwarzen Wasser, die leise dahingleitenden Schiffe erinnerten an riesige Schattenmonster, die das Farbspiel durchbrachen.
Einen Moment lang stand ich nur da, während um mich herum das Leben normal weiterging. Die New Yorker waren noch auf den Beinen, auf dem Weg nach Hause, zur Arbeit, zum Essen oder einfach nur unterwegs, um den Kopf freizubekommen. Ganz egal, wohin man in dieser Stadt ging, wirklich alleine war man nie. Doch achtete hier kaum jemand auf den anderen. Die meisten waren viel zu sehr mit ihrem eigenen Leben, ihren eigenen Problemen beschäftigt.
Ich fühlte mich wie betäubt. Eben noch hatten brennende Wut und Angst mich von innen heraus verbrannt, doch jetzt lagen Furcht und Verzweiflung wie ein Eisklumpen in meinem Magen.
Vielleicht hätte ich etwas tun können, um Will zu helfen, bevor er ausgerechnet diesen riskanten Strohhalm ergriff.
Vielleicht hätte ich mehr für ihn da sein sollen, damit er sich nicht so verloren fühlte.
Vielleicht …
Rosa zerrte ungeduldig an der Leine und blickte mit großen Augen zu mir auf. Sie hielt rein gar nichts vom Herumstehen, vor allem dann nicht, wenn sie nicht weit von uns einen hübschen Park witterte. Noch immer tief in meine Gedanken versunken, ließ ich mich von ihr dorthin führen.
Es musste doch einen Ausweg geben, damit Will nicht in den Dienst dieses Feen trat. Irgendetwas im Kleingedruckten oder ein Schlupfloch. Immerhin hatte er das Paket ja nicht vernichtet, sondern lediglich verloren. Es konnte immer noch jederzeit wieder auftauchen. Möglicherweise konnte auch ein Anwalt helfen.
Diesen Gedanken verwarf ich jedoch sofort wieder. Das unfaire und gemeine an diesen Deals war ja, dass sie außerhalb menschlicher Gesetze standen. Waren die Verträge erst einmal unterzeichnet, konnte einem weder Polizei noch Anwalt helfen, aus den Verträgen wieder herauszukommen.
Der Name des Fees war Feinri. Das klang alles andere als düster. Vielleicht war der Fee nett und hatte Mitleid mit meinem Bruder. Ich hatte von einem Fall gehört, in dem im Nachhinein der ganze Vertrag für ungültig erklärt wurde. Leider konnte ich mich nicht mehr an die Details erinnern. Aber das gab mir einen Funken Hoffnung.
Plötzlich blieb Rosa neben einem Busch stehen und schnupperte daran ausgiebig. Zwischen den dicht gewachsenen Blättern bewegten sich winzige goldene Funken, die von einem sanften, kaum hörbaren Klingeln begleitet wurden. Eine besonders mutige Elfe traute sich heraus und schwirrte um Rosas Nase herum. Ich musste schmunzeln, als meine arme verwirrte Hündin nieste, bevor sie versuchte, nach dem kleinen Wesen zu schnappen.
»Oh nein, das lässt du schön bleiben.« Schnell zerrte ich Rosa weiter. Für Menschen waren Elfen zwar nicht gefährlich, aber bei Tieren konnten sie eine allergische Reaktion hervorrufen. Auf der Arbeit hatten wir schon den einen oder anderen armen Hund behandeln müssen, der eine Elfe mit einem Leckerli verwechselt hatte. Kein sonderlich schöner Anblick.
Mit einem leisen Seufzen machte ich mich auf den Weg zurück zur Wohnung. Inzwischen hatte sich mein Gemüt etwas abgekühlt, auch wenn ich einer Lösung immer noch keinen Schritt näher gekommen war. Meine Gedanken wanderten zurück zum Fee, in dessen Schuld sich mein Bruder nun befand.
Vielleicht lohnte es sich ja, einmal mit ihm zu sprechen? Das Schlimmste, was passieren konnte, war, dass er nein sagen würde und Will seine Strafe antreten musste. Mehr konnte uns doch nicht geschehen, oder?
Zurück in der Wohnung raste Rosa direkt in die Küche zum Futternapf, während ich zu Will ging. Er hatte sich wieder auf seinem Bett zusammengerollt, aber aufgehört zu weinen. Er lag reglos da und starrte an die Decke.
Ich wollte ihn so gerne trösten und ihm versprechen, dass alles wieder gut werden würde, doch blieben mir die Worte im Halse stecken.
Im Tiefkühler wartete noch ein Becher Eiscreme, der sonst nur zum Einsatz kam, wenn Will mal wieder bei einem Casting abgelehnt wurde. Aber Eis und ein schlechter Horrorfilm würden es diesmal vermutlich nicht richten können.
Als ich in sein Zimmer kam, blickte er nicht einmal in meine Richtung. Erst als ich mit dem Vertrag in der einen und einem Feuerzeug in der anderen Hand mitten im Zimmer stand, saß er auf einmal aufrecht. »Was tust du da? Das wird den Handel nicht auflösen!«
Mein Plan war riskant und, um ehrlich zu sein, auch etwas dämlich, aber ich hatte keine Zeit bis zum Morgen zu warten, um den Fee aufzusuchen. »Nein, aber der Fee wird sich uns auf diese Weise zeigen und wir können schon heute Abend mit ihm reden.« Das zumindest wusste ich. Trotzdem klopfte mir das Herz bis zum Halse, als ich die kleine Flamme an den Rand des Papiers hielt. Doch noch bevor sie irgendwelchen Schaden anrichten konnte, materialisierte sich eine Gestalt vor mir. Erschrocken biss ich die Zähne zusammen.
Der Fee Feinri trug einen edlen schwarzen Anzug, seine blonden Haare waren zurückgegelt und das Lächeln in seinem Gesicht triefte vor Hochmut. Es war schon ein sehr seltsamer Anblick: Wir konnten ihn sehen – oder besser durch ihn hindurchsehen – und dennoch befand er sich nicht wirklich in unserer Wohnung. Diese Astralprojektion war für Feen die Möglichkeit, so schnell wie möglich beim Vertragspartner aufzutauchen, sollte es ein Problem geben. Zum Beispiel eine offene Flamme, die am Papier leckte.
»Das ist eine selten dumme Idee«, sprach er mit hochnäsiger Stimme. Er schnippte mit den Fingern und das Feuerzeug in meiner Hand erlosch. Der Vertrag hatte nicht einmal Rußflecken davongetragen.
»Ich wollte lediglich deine Aufmerksamkeit bekommen«, kam ich direkt auf den Punkt. Trotz meines heftig klopfenden Herzens klang meine Stimme überraschend gefasst und entschlossen. »Eines der Pakete ist verloren gegangen, wir …«
Bevor ich weitersprechen konnte, unterbrach der Fee mich. »Das klingt ganz so, als wäre es euer Problem!«
Trotz seiner bösartigen Worte fuhr ich unberührt fort. »Wir wollten lediglich um etwas mehr Zeit bitten, um das Päckchen wiederzufinden.«
Der Fee verdrehte die Augen. »Das alles interessiert mich nicht. Der Vertrag wurde nicht erfüllt, demnach steht William Anders von nun an in meinem Dienst. Es ist nicht mein Problem, dass er so unfähig ist. Wer verliert schon ein Paket?«
Sein herablassender Ton und dieses Von-Oben-herab-Gehabe entfachte meine Wut erneut. »Mein Bruder ist vielleicht manchmal ein Esel, aber das heißt noch lange nicht, dass er diese Strafe verdient. Alles, was wir wollen, ist eine weitere Chance.«
Das Lächeln verschwand aus Feinris Gesicht. »Oh, das hättest du nicht sagen sollen. William tritt seinen Dienst Anfang des nächsten Monats an, pünktlich um Mitternacht. Bis dahin werde ich euch beiden eine Lektion erteilen.« Damit verschwand er genauso schnell, wie er gekommen war.
»Verdammt nochmal.« So viel zu »was kann schon Schlimmes passieren«! »Wir werden noch eine andere …« Die Worte blieben mir in der Kehle stecken, als ich mich zu meinem Bruder umdrehte.
Das Wesen auf dem Bett trug Wills Kleidung und saß auch genau dort, wo er eben noch gesessen hatte. Aber mir blickte kein Mann entgegen, nicht einmal mehr ein Mensch. Es sah grotesk aus, wie der Eselskopf aus den Schultern meines Bruders hervorwuchs. Noch schlimmer jedoch war das Gefühl, als mir seine Augen aus dem grauen Fell entgegenblickten. Ein ohrenbetäubender Schrei vermischte sich mit Wills unmenschlichem »I-Ah« und Rosas Winseln.
Kapitel zwei
»Das macht dann 120,28 Dollar. Ich hole Ihnen noch schnell die Medikamente.« Ich schenkte der Dame vor mir ein gezwungenes Lächeln, bevor ich kurz nach hinten ins Lager verschwand. Durch die halb offen stehende Türe konnte ich noch die Geräusche aus unserem Wartebereich hören, das Winseln, Bellen und Mauzen der wartenden Patienten.
Vor Müdigkeit schaffte ich es kaum, die Augen aufzuhalten, während ich aus den Schränken die Medikamente für die arme Katze holte, die aktuell an einem Nierenstein litt. Meine Finger wanderten über die Pappschachtel, ohne dass ich eines der Etiketten las.
»Das solltest du besser wieder zurückstellen«, erklang eine melodisch raue Stimme direkt neben mir. Eine blasse Hand erschien in meinem Blickfeld und nahm mir die Packung wieder ab. »Außer, du willst die arme Mieze auf einen Trip schicken?«
Mit einem tiefen Seufzen ließ ich die Stirn gegen die Schulter meiner besten Freundin fallen. Hyacinth war ein gutes Stück größer als ich, fast schon so groß wie mein Bruder. Ihr langes rotes Haar war heute wie an jedem anderen Tag zu einem kunstvollen Zopf geflochten und warme, braune Augen blickten mir unter ihrem Pony entgegen.
»Ich bin heute nicht ganz bei der Sache.« Ihr gewohnter Duft, nach Lavendel und Honig, stieg mir in die Nase. Für einen Moment fühlte ich mich sicher und geborgen, bis die Wirklichkeit wieder auf mich einrieselte.
Gespielt überrascht hob Hyacinth die schmale Augenbraue. Neben ihrem außergewöhnlichen Namen hatte Hyacinth auch das sanfte Schimmern der Haut und die anmutigen spitzen Ohren von ihrer Feenmutter geerbt. Lediglich die langen Eckzähne fehlten ihr, was sie im Gegensatz zu ihren Vollblutverwandten zarter wirken ließ. Eine Tatsache allerdings, von der man sich lieber nicht täuschen lassen sollte.
»Ach, darauf wäre ich ja gar nicht gekommen. Was ist los, Tania?«
Kurz schüttelte ich den Kopf. »Erzähle ich dir in der Mittagspause, gerade ist keine Zeit dafür.« Schließlich war das, was ich zu erzählen hatte, nichts, was man mal eben zwischen Tür und Angel besprach. Nachdem ich heute fast zu spät zur Arbeit gekommen war – nach einer beinahe schlaflosen Nacht –, hatte ich keine Zeit mehr gehabt, mit ihr zu sprechen. Seitdem war der Morgen in einem andauernden Strom aus Patienten und besorgten Besitzern vergangen, der mich immerhin von dem Wirrwarr in meinem Kopf abgelenkt hatte.
»Ich mache das hier fertig«, fuhr meine beste Freundin fort. »Kümmere du dich mal um den nächsten Patienten.«
Dankbar lächelte ich sie an, bevor ich mich durch eine zweite Tür verdrückte. Hier hinten war es viel ruhiger als vorne beim Empfang, dafür war der Geruch nach Desinfektionsmittel deutlich stärker. Ich unterdrückte ein Niesen, während ich in Untersuchungsraum drei trat.
Doktor Shaw, unsere Tierärztin, stand dort bereits hinter ihrem Schreibtisch. Wie alle Feen hatte sie ein jugendliches Aussehen und wirkte kaum älter als Ende zwanzig. Doch hinter ihren klugen Augen verbargen sich mehr als zweihundert Jahre Wissen und Können. Damit war sie die älteste Fee, die ich bisher kennengelernt hatte. Der aktuelle Patient, ein schneeweißes Kaninchen, saß mit zitterndem Näschen mitten auf dem Untersuchungstisch.
Ich klammerte mich mit aller Kraft an die Aufgaben, die mir meine Chefin zuteilte, damit meine Gedanken nicht zurück zum gestrigen Abend wandern konnten. Erleichtert darüber, dass dieser kleine Patient der letzte vor dem Feierabend sein sollte, führte ich meine Arbeit, so ruhig es ging, aus. Doch das Zittern meiner Hände bekam ich nicht unter Kontrolle.
Nachdem das Häschen versorgt war, begleitete ich die Besitzer noch bis zur Tür, um mich dann zu Hyacinth hinter dem Empfangstresen zu gesellen.
»Das war dann erst mal der Letzte.« Mit einem erleichterten Grinsen schloss Scott, einer meiner Kollegen, die Vordertür ab. Der Regelbetrieb war für heute beendet und sobald wir die stationären Patienten versorgt haben würden, hatten Hyacinth und ich unseren Feierabend erreicht.
Ich brachte nicht einmal mehr ein Lächeln zustande. Stattdessen ließ ich die Stirn auf den Schreibtisch vor mir sinken. Die Müdigkeit und Verzweiflung lag wie eine dicke Decke auf mir, machte mir das Atmen und Denken schwer.
»Tania, ist alles in Ordnung bei dir?« Doktor Shaw war mein betrübter Gemütszustand natürlich nicht entgangen. Ich spürte, wie sie und Hyacinth hinter meinem Rücken einen besorgten Blick austauschten.
»Nein«, schaffte ich noch zu sagen, bevor ich die Tränen nicht mehr zurückhalten konnte. Vor Will hatte ich es noch irgendwie geschafft, mich zusammenzureißen, doch jetzt war das Maximum überschritten. Die Wut über den Deal und die Angst um meinen Bruder zerfraßen mich langsam von innen.
Behutsam strich Hyacinth mir über die Haare, bevor sie mich in ihre Arme zog. »Oh Sweetie. Lass alles raus!«
Einige Minuten saßen wir nur so da, während ich mir die Seele aus dem Leib heulte. Die warme Umarmung meiner besten Freundin ließ meine Hemmungen in sich zusammenfallen. Irgendwann versiegten die Tränen endlich so weit, dass ich wieder mehr von meiner Umgebung wahrnehmen konnte.
Alle anderen Tierarzthelfer waren aus dem Wartebereich verschwunden, lediglich Doc Shaw lehnte noch an der Wand neben uns. Ihr sonst so entspanntes Gesicht war gezeichnet von Sorge und Mitgefühl.
Doch meine Aufmerksamkeit galt in diesem Moment meiner besten Freundin, die voller Unruhe zu mir herabsah. »Du erzählst mir jetzt bitte sofort, was los ist, ansonsten verliere ich hier noch den Verstand!« Der strenge Ton ihrer Stimme passte nicht zu ihrem liebevollen Gesichtsausdruck.
Es dauerte einige Sekunden, bis ich den richtigen Ansatz gefunden hatte, doch dann sprudelte alles aus mir heraus. Mit jedem Wort, das ich über den arroganten Fee und Wills Schicksal verlor, nahm meine Wut zu. Ohne es zu merken, redete ich mich immer mehr in Rage, bis ich am Ende beinahe schreiend zusammenfasste: »Jetzt sitzt Will zu Hause. Er weigert sich, die Wohnung zu verlassen. Und ich weiß nicht, wie es weitergehen soll.«
Nachdem ich mit der Erzählung geendet hatte, folgte dankbare Stille, die mir Zeit gab, meine Tränen zu trocknen.
Will hatte sich heute Morgen nicht einmal mehr aus dem Zimmer getraut, als ich zur Arbeit aufgebrochen war. Immerhin hatte er Rosa zu sich geholt – so war er wenigstens nicht ganz alleine.
Ich konnte verstehen, wieso er sich einsperrte. Die Aussicht darauf, zwanzig Jahre seines Lebens zu verlieren, musste ihm den Verstand rauben. Mal ganz abgesehen davon, dass er sich in seinem aktuellen Zustand nirgendwo sehen lassen konnte. Ich wollte ihm so gerne helfen, doch gerade sah ich keine Option.
»Fuck«, murmelte Doc Shaw leise. Die ganze Zeit über hatte sie schweigend zugehört, kein Muskel hatte sich in ihrem Gesicht gerührt, doch nun konnte sie ihre Wut nicht mehr verbergen. »Es gibt echt Arschlöcher auf der Welt.« Das sanfte Schimmern, das wie bei jedem Fee von ihrer Haut ausging, verblasste etwas, als sie die Zähne fletschte. »Will hätte es wirklich besser wissen sollen.«
Hyacinth würdigte ihren Kommentar lediglich mit einem Augenrollen, dann wandte sie sich wieder mir zu. »Ich weiß ganz genau, was in deinem Kopf vorgeht, Tania. Aber nichts davon ist deine Schuld. Nicht, dass William diesen Deal gemacht hat und erst recht nicht, dass er ihn versaut hat.«
»Aber der Eselskopf ist schon irgendwie meine Schuld«, widersprach ich schuldbewusst.
»Auch der nicht. Dieser Fee ist ein Arsch. Und so wie ich William kenne, hätte er sicher selbst schon bald etwas angestellt, das ihn in eine ähnliche Situation gebracht hätte.« Sie rümpfte die Nase und schüttelte den Kopf. »Egal was dein Kopf dir jetzt einreden will, nichts davon ist deine Schuld, hörst du?«
Kläglich nickte ich. So war meine beste Freundin. Bereit, mich vor der ganzen Welt zu verteidigen und, wenn nötig, sogar vor mir selbst. Nur leider änderten ihre Worte gerade recht wenig an meinen Schuldgefühlen gegenüber Will. Für den Deal war er ganz allein verantwortlich, aber die Verwandlung hatte ich ihm eingebrockt. »Ich kann ihn nicht für zwanzig Jahre verlieren, Hyacinth.«