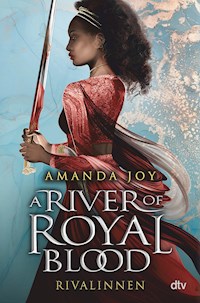16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die A River of Royal Blood-Reihe
- Sprache: Deutsch
Der spannende Kampf um den Thron geht weiter! Nachdem Eva es nicht über sich gebracht hat, ihre Schwester im Kampf um den Thron zu töten, flieht sie aus Ternain – und nimmt Isa gegen deren Willen mit. Begleitet von Aketo und einigen treuen Gefolgsleuten machen sie sich auf den Weg Richtung Norden. Dort will Eva nicht nur Verbündete finden, sondern auch die Familie ihres Vaters, um das Rätsel ihrer Herkunft und ihres magischen Erbes endlich zu lösen. Das Problem: Will sie den tödlichen Fluch, der auf ihr und ihrer Schwester lastet, endgültig brechen und ihrem Volk Frieden bringen, muss sie Isa davon überzeugen, mit ihr zusammenzuarbeiten. Die verfolgt allerdings ganz eigene Pläne … Alle Bände der ›A River of Royal Blood‹-Reihe: Band 1: A River of Royal Blood – Rivalinnen Band 2: A River of Royal Blood – Schwestern Die Bände sind nicht unabhängig voneinander lesbar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 499
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Von tödlichen Rivalinnen zu liebenden Schwestern?
Nachdem Eva sich entschieden hat, ihre Schwester nicht zu töten, flieht sie aus Ternain – und zwingt Isa sie zu begleiten. Gemeinsam mit Aketo und weiteren Gefolgsleuten tritt sie den beschwerlichen Weg in den Norden des Landes an – auf der Suche nach Mitstreitern … und Antworten.
Auf ihrer Reise trifft sie auf Verwandte ihres Vaters und kommt endlich der Wahrheit über ihre Herkunft näher. Mithilfe ihrer Familie und dank Aketos Unterstützung lernt Eva schließlich, ihre Magika zu beherrschen. Doch dies allein reicht nicht für ein Leben in Freiheit, denn noch immer liegt der tödliche Fluch auf Eva und ihrer Schwester.
Will Eva den Bann brechen, muss sie Isa dazu bringen, von dem tödlichen Geschwisterkampf abzusehen und sich mit ihr zu verbünden. Die zeigt allerdings kein Interesse an einer Zusammenarbeit. Im Gegenteil, Isa verfolgt ihre ganz eigenen Pläne …
Von Amanda Joy ist außerdem bei dtv lieferbar:
A River of Royal Blood – Rivalinnen (Band 1)
Amanda Joy
A River of Royal Blood
Schwestern
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Carina Schnell
Für all die Schwarzen Mädchen, die sich Welten ausdenken. Ich sehe euch.
ROMEO
»Ist Liebe ein zartes Ding? Sie ist zu rau, zu wild, zu tobend und sie sticht wie Dorn.«
MERCUTIO
»Begegnet Lieb Euch rau, so tut desgleichen!«
WILLIAM SHAKESPEARE, ›ROMEO UND JULIA‹
Prolog
Ysai aus Ariban
Der Himmel über dem sich am Fuß des Bergs Ariban erstreckenden Lager war dunkellila getupft – ein Vorbote der kommenden Stürme und des darauffolgenden Schnees. So weit nördlich im Land der Roune, dem gesetzlosen Gebiet östlich von Drakol und nördlich von Myre, dauerte der Wechsel vom Hochsommer zum tiefsten Winter nicht länger als ein paar Wochen.
Die niedrigeren Bergspitzen, die das Tal einrahmten, wurden vom Licht der untergehenden Sonne in Gold getaucht. Kupferlampen hingen im Kreis um jedes Zelt, obwohl der silbrige Schein der Mondsichel und Hunderttausender Sterne für die meisten Bewohner des Lagers genug Licht spendete. Denn die meisten von ihnen waren Khimaer – eine elegante Mischung aus Tier und Mensch mit Hörnern und anderen animalischen Eigenschaften, wie etwa, im Dunkeln sehen zu können. Bei den wenigen Nicht-Khimaern handelte es sich um Fey oder Blutsvettern mit ebenso ausgeprägter Sicht.
Die Lampen wurden mithilfe von Magika gesteuert und erst gelöscht, wenn die Arbeit des Tages getan war.
Ysai saß auf einem mit Schnitzereien in Form von Ranken und knospenden Wildblumen verzierten Baumstumpf und ließ eine schmale Klinge mit einer langsamen, spiralförmigen Bewegung über ein Stück weiches Noshai-Holz gleiten.
Sie war so an das Gefühl des Schnitzmessers in ihrer Hand gewöhnt, dass sie ihre ganze Aufmerksamkeit auf die ihr zugewandten Gesichter ihrer Schülerinnen und Schüler richten konnte, in deren Schößen um einiges stumpfere Messer lagen. Ihr Blick wanderte an ihnen vorbei zur nächsten Kupferlampe, die ihr warmes Licht weit gefächert verbreitete. Ysai wartete darauf, dass sie endlich flackern und damit das Ende ihres Tages verkünden würde.
Nach ihren täglichen Geschichts-, Waffen- und Magika-Lektionen übten sich die Kinder des Lagers bis spät in die Nacht in verschiedenen Disziplinen wie dem Schnitzen von Talismanen. Glücklicherweise war diese Gruppe Achtjähriger Ysais letzte Unterrichtsstunde für heute.
Statt des heiligen Noshai-Holzes hielten die Kinder die Überreste der vorherigen Gruppe älterer Schüler in ihren klebrigen Händen. Die Noshai-Bäume, die größten und ältesten Lebewesen des Nordens, wuchsen ausschließlich im A’Nir-Gebirge nördlich der Grenze zu Myre. Vor Tausenden von Jahren hatten die wilden Fey, die in diesem Gebirge gelebt hatten, den ersten Königinnen von Akhimar junge Noshai-Bäume zum Geschenk gemacht. Damals war das Königinnenreich unter einem einzigen Namen bekannt und die Königinnen hatten sowohl das Gebiet nördlich als auch das südlich des Flusses regiert. Nun war es in drei Nationen unterteilt. Im Süden hatten sich die Noshai-Bäume jedoch nie verbreitet, sodass es zur Tradition geworden war, stattdessen einen Schutztalisman aus ihrem Holz zu verschenken. In den letzten Jahrhunderten war dieser Brauch vergessen worden, bis der Stamm nach dem Großen Krieg aus Myre geflohen war und die Tradition der geschnitzten Talismane wiederaufgenommen hatte.
Die meisten Stammesmitglieder schnitzten Talismane in Form der Tiere, denen sie ähnelten, und hängten sie an die Äste der Bäume um ihre Zelte. Die Talismane besaßen schwache Magika – Gebete, gute Wünsche und eine kleine Opfergabe an ihre Göttin Khimaerani. Zusammengenommen bildeten die unzähligen Talismane, die überall im Lager verteilt waren, einen starken Abwehrzauber, der jeden warnte, der diesem Ort zu nahe kam.
»Schwester Ysai!«, rief Kisin, einer der Kleinsten und damit Vorlautesten der Gruppe. Er hatte große Sandfuchsohren und das Lampenlicht spiegelte sich in den goldenen Ringen an den Spitzen seiner gezackten Hörner. Seine Haut und sein Fell wiesen denselben kupfernen Farbton auf und obwohl die weißen Sommersprossen in seinem Gesicht Ysai an ein Rehkitz erinnerten, war seine Miene eindeutig verschlagen wie die eines Fuchses. Seine großen unschuldigen Augen standen in starkem Kontrast zu dem breiten Grinsen. »Was wirst du heute für uns schnitzen?«
Ysai hatte einen listigen Leoparden im Sinn gehabt. Die Kinder waren nie weit genug im Süden gewesen, um die großen Raubkatzen der Ebene von Arym oder des Toten Dschungels zu Gesicht zu bekommen, weshalb sie von den majestätischen Jägern fasziniert waren. Sie wusste allerdings, dass sich Kisin, wie bereits während der letzten Unterrichtsstunden, einen Fuchs wünschen würde.
»Ich habe mich noch nicht entschieden. Vielleicht kann Tosin uns helfen.« Ysai lächelte die Zwillingsschwester des Fuchsjungen an.
Im Gegensatz zu ihrem Bruder sprach Tosin nur, wenn sie aufgefordert wurde. Der Blick ihrer großen, glänzend schwarzen Augen wirkte immer leicht entrückt, als befände sie sich in einer Traumwelt. Ysai hoffte, dass ihre Fantasie deshalb ausgeprägter war als die ihres Bruders.
Das Mädchen blinzelte mehrmals und ihre Fuchsohren zuckten. »Mutter Moriya hat uns von den Krakai in der Wüste erzählt.«
Ysais Herz sank. Sie kannte die Geschichten über die Krakai, die vom Meer in die Wüste krochen, hatte aber keine Ahnung, wie diese Kreaturen aussahen. Sie selbst war nie weiter als fünfzehn Meilen nach Myre hineingeritten und nicht einmal in die Nähe der tausend Meilen entfernten Kremir-Wüste gekommen.
»Ich glaube, für einen Krakai bräuchte ich viel mehr Holz, Tosin. Vielleicht ein andermal.« Sie senkte die Stimme. »Aber ich kenne eine andere Legende, Mutter Moriyas Lieblingsgeschichte. Hat sie euch je von dem Leoparden erzählt, der so schlau war, dass er eine Schlange fing und ihren Schwanz verknotete?«
Die Kinder kicherten und rückten näher, bis sie fast auf Ysais Stiefeln saßen. Aufgeregt zupften sie an ihrem Rock. Mutter Moriya war die Anführerin des Stamms, doch da sie tatsächlich Ysais Mutter war, benutzte Ysai den Ehrentitel nur selten.
Seit zwei Monaten befand Moriya sich im Süden auf einem Raubzug an Myres Grenze. Es hatte nur ein kurzer Abstecher sein sollen, doch Ysai versuchte, sich keine allzu großen Sorgen zu machen. Moriya wurde gut beschützt. Die Stammesmitglieder, die sie begleiteten, würden für sie sterben.
Ysai erzählte die Geschichte, während sie den Körper der zum Sprung ansetzenden Raubkatze aus dem Holz schnitzte. Sie benutzte Magika, um ihren Hals und Mund so zu verändern, dass ihre Stimme tief wie die eines Leoparden klang. Sie knurrte und zischte ihre Schüler an, wann immer deren Aufmerksamkeit nachließ. Doch plötzlich spürte sie das durchdringende Beben von sich nähernden Hufschlägen auf dem Boden und Erleichterung schoss durch sie hindurch, so erfrischend wie guter myreanischer Wein. Rasch beendete sie die Geschichte und schickte ihre Schüler zum Kochfeuer in der Mitte des Lagers.
Obwohl sich die Dunkelheit der Nacht längst über das Lager gelegt hatte, herrschte reges Treiben. Leute mit Hörnern, Fangzähnen und spitzen Ohren ergossen sich aus den Zelten, um die Heimkehrenden zu begrüßen. Menschen waren die Einzigen, die hier nicht willkommen waren. Als Moriya vor fast sechzig Jahren Stammesmutter geworden war, hatte sie begonnen, sämtliche im Exil lebende Myreaner aufzusuchen, die nach Norden ins Land der Roune kamen, um sie im Stamm aufzunehmen. So waren ihre Reihen stetig gewachsen. Früher waren sie weniger als hundert gewesen, heute zählten sie beinahe zweihundertfünfzig Stammesmitglieder.
Ysai überlegte, ob sie sich in das Zelt legen sollte, das sie sich mit ihrer Mutter teilte, um ein wenig zu schlafen, bis Moriya von allen willkommen geheißen worden war. Doch sie wollte unbedingt hören, wie Moriya ihr langes Fernbleiben erklärte. Würde sie vor den anderen zugeben, dass der wahre Grund der Mission kein Raubzug, sondern eine Suche nach Antworten gewesen war? Oder würde sie ihr Vorhaben, endlich nach Süden zu ziehen und den Thron zurückzuerobern, nach wie vor geheim halten? Ysai wettete darauf, dass sich ihre Mutter weiterhin bedeckt halten würde. Die Stammesmitglieder und der Rat der Elderi zeigten sich stets ängstlich, wenn es um Pläne für die Rückkehr nach Myre ging. Sie lebten aus gutem Grund im Exil und würden ohne einen eindeutigen Plan nicht gegen die Armeen der Königin bestehen können. Niemand wollte ihre vollständige Ausrottung riskieren. Doch Moriya hatte sich ein großes Spionagenetzwerk aufgebaut und war davon überzeugt, dies sei der richtige Moment. Die Zeit für eine Revolution war gekommen. Ysai war sich da allerdings nicht so sicher.
Die Menschenköniginnen waren gnadenlos und mächtig. Die Adligen von Myre waren so herzlos und verdorben, dass sie von den Prinzessinnen verlangten, ihre eigenen Schwestern umzubringen, um auf dem Thron zu sitzen.
Ysai wagte es nicht, sich nach der Krone zu sehnen. Nicht, wenn dieser Wunsch alles in Gefahr brachte, was sie je gekannt hatte. Es war dem Stamm gelungen, jahrhundertelang sicher im Verborgenen zu leben, doch der Versuch, das zu tun, was ihnen bestimmt war – den richtigen Moment abzupassen und den Thron zurückzuerobern –, könnte ihre endgültige Zerstörung bedeuten.
Ihre Ahnen erwarteten von ihnen, dieses Risiko einzugehen. Als nach dem Großen Krieg jegliche Hoffnung auf einen Sieg verloren war, hatten die dreizehn Elderi, die der letzten Khimaer Königin gedient hatten, das A’Nir-Gebirge durchquert, um ihr Volk am Leben zu erhalten. In der Hoffnung, dass sie eines Tages in das Heimatland ihrer Vorfahren zurückkehren würden. Seitdem waren acht Generationen vergangen, während acht Menschenköniginnen unrechtmäßig auf dem Elfenbeinthron gesessen hatten, und sie waren ihrem Ziel kein Stück näher gekommen. Die Armeen der Menschen waren Zehntausende stark, während der Stamm lediglich aus wenigen Hinterbliebenen eines Volks bestand, das sich wünschte, in ein Land zurückzukehren, das ihre Existenz vergessen hatte.
Gemeinsam mit den anderen Stammesmitgliedern bahnte sich Ysai einen Weg zum Eingang des Lagers. Die große runde Lichtung im Schatten von Ariban wurde von einem Palisadenzaun aus Baumstämmen und Schlamm umgeben, für den unwahrscheinlichen Fall, dass es einige der im Land der Roune umherstreunenden Räuberbanden an ihren Schutzzaubern und Spähern vorbeischafften.
Gerade als Ysai den Zaun erreichte, wurden die Tore geöffnet. Das Donnern der Hufe erfüllte die Luft und Ysais Magen zog sich zusammen, als sie den ersten Reiter sah.
Anosh, ein Mann mit Adlerschwingen und Sturm-Magika im Blut, war die rechte Hand ihrer Mutter. Er ritt kein Pferd wie die anderen, sondern saß auf einer Shahana, einer seltenen Antilopenart, die es nur im hohen Norden gab. Wie alle Shahana war das riesige Tier größer als ein Pferd und hatte lange flinke Beine mit gespreizten Hufen, perfekt, um Schnee und Eis in den höheren Bergregionen zu meistern. Weiße spiralförmige Hörner entsprangen ihrem dreieckigen Kopf und ihr schwarzes Fell wies schneeweiße Tupfen auf. Auch ihre Brust war von schneeweißem Fell bedeckt.
Ysai kannte die Antilope gut, da sie das Reittier ihrer Mutter war. Sie bahnte sich einen Weg durch die Menge, die sich vor dem Tor versammelte, während sich eine unheilvolle Stille ausbreitete.
Sie wurde kurz darauf gebrochen, als zwei Männer eine Bahre hineintrugen.
Ysai sprintete los, als sich die Menge vor ihr teilte. Es rauschte ihr in den Ohren. Im nächsten Moment fiel sie bereits vor der Bahre auf die Knie, als sie auf dem schlammigen Boden abgestellt wurde. Ihre Mutter lächelte ihr entgegen. Ysai hatte das silberne Haar und Geweih von ihr geerbt. Beides strahlte nun hell in der dunklen Nacht. Sie musterte das Gesicht ihrer Mutter, konnte außer den leicht zusammengekniffenen Augen keine Spuren von Schmerz erkennen. Doch dann fiel ihr Blick auf den Pfeil, der aus Moriyas Taille ragte. Ein tiefroter Fleck hatte sich um die Wunde ausgebreitet.
Bevor sie auch nur ein Wort über die Lippen bringen konnte, flüsterte die Stammesmutter: »Es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Ich wurde getroffen, als wir die Grenze überquert haben.« Sie wischte eine einzelne Träne fort, die über Ysais Wange lief. »Sorge dich nicht.« Moriyas Lächeln verwandelte sich in eine schmerzverzerrte Grimasse, als sie in ihren dicken Wollmantel griff, um ein Büchlein herauszuholen. Sie legte es in Ysais Hände. »Verstehst du?«, fragte sie. »Du musst jetzt stark für mich sein.«
Furcht überkam Ysai. Wie erstarrt kniete sie im Matsch, bis sie jemand – sie wusste nicht, wer – auf die Füße zog.
Sie folgte dem Pfad, den die Umstehenden für Moriyas Bahre freigaben, während sie die Erklärungen der von ihren Reittieren absteigenden Krieger kaum wahrnahm.
Sie haben uns an der Grenze aufgelauert …
Seid versichert … die Mutter wird sich erholen.
Menschlicher Abschaum … die Feiglinge haben gewartet, bis wir …
Ysai blendete alles aus, trottete wie betäubt hinter ihrer Mutter her, während sie das Büchlein fest umklammert hielt.
Sie wusste, dass Moriya es ihr nicht gegeben hätte, stünde es nicht wirklich schlecht um sie. Der schlichte, mit Schnur umwickelte Einband mit einem Symbol der Göttlichen täuschte über die Wichtigkeit des Inhalts hinweg. Moriya führte Dutzende Tagebücher, hatte Ysai jedoch bisher nie in eins davon hineinsehen lassen.
Schließlich blieb Ysai vor einem der weißen Stoffzelte stehen, in denen die Heiler des Stamms arbeiteten. Wachleute blockierten den Eingang. Im Inneren waren nur Patienten erlaubt und sie durfte die Heiler nicht stören. Doch die Furcht wand sich kalt in ihrem Magen wie ein lebendiger Aal.
Sie setzte sich auf den Boden, sodass sie im Schein der an den umstehenden Zelten hängenden Laternen lesen konnte. Eilig blätterte sie die Seiten um, bis sie den letzten Eintrag erreichte.
Am oberen Rand waren Notizen in einer Geheimschrift verfasst. Sie waren nicht für Ysais Augen bestimmt, doch sie würde später versuchen, die Zeichen zu entziffern. Mit den Fingern fuhr sie über einen roten Fleck in einer Ecke. Das Blut war durch mehrere Seiten gesickert.
In der Mitte der Seite wechselte die Sprache zu Khimaer.
Ysai,
meine Mutter sagte mir einmal, ich würde meinen Tod erkennen, wenn er über mich käme. Laut ihr spüren es alle Frauen, die mit Khimaeranis Gabe gesegnet sind. Ich habe ihre Warnung nicht ernst genommen. Doch in dem Augenblick, in dem mich der Pfeil traf, wurde mir klar, dass ich falschgelegen hatte. Ich spürte meinen Tod auf mich zurasen, ich wusste, dass ich die Heilung nicht überleben würde. Bereits jetzt fühle ich, wie sich Schwäche wie Gift in mir ausbreitet, wie jedes einzelne meiner hundert Lebensjahre auf mir lastet wie Steine.
Im Süden herrscht Chaos. Chaos, das unseren Plänen zugutekommen wird. Entschlüssele die Geheimschrift, dann wirst du es sehen. Und rufe den Jäger heim, er wird eine wesentliche Rolle spielen. Es gibt noch eine letzte Sache. Eine andere trägt dieselbe Gabe in sich wie wir beide. Du musst unseren Stamm nach Süden führen und die Khimaer in den Bezirken befreien. Dort wirst du sie finden. Sie wird Königin werden.
Die schräge Handschrift ihrer Mutter war ungewohnt unordentlich. Sie hatte diesen Text in aller Eile verfasst und Ysai begriff kaum ein Wort. Den Blick weiterhin auf die Seite gerichtet, stand sie auf.
Sie wischte sich über die tränenfeuchten Augen und ging auf die Wachen zu. »Bitte lasst mich mit meiner Mutter sprechen. Es ist dringend.«
Einer der Wächter öffnete den Mund, wahrscheinlich, um ihr den Eintritt zu verwehren, doch er wurde von einem Schrei aus dem Inneren unterbrochen. Ysai drängte sich zwischen den beiden durch. Am ganzen Körper zitternd stürzte sie ins Zelt. Vermutlich ließen die Wächter sie nur passieren, weil sie die Tochter der Stammesmutter war.
Im Inneren knieten zwei Heilerinnen rechts und links von Moriya, die auf ein Lager aus weichen Fellen gebettet war. Ihr Bauch lag frei, der Pfeil war aus ihrer Seite entfernt worden. Doch die frische Binde war bereits blutdurchtränkt.
»Was ist los? Warum habt ihr sie nicht geheilt?«
»Wir versuchen es«, sagte die Ysai am nächsten sitzende Heilerin, eine Khimaerin mit Schakaleigenschaften und glänzend schwarzen Augen. »Ihr Körper lässt sich nicht heilen. Sie wurde nicht vergiftet, aber die inneren Wunden lassen sich nicht schließen.«
Als Ysai sich dem Lager näherte, riss Moriya die Augen auf. Sie glühten geradezu, als sie ihre Tochter mit ihrem Blick festnagelte. Ihre sonst tiefbronzene Haut war aschfahl.
»Oh, Ysai, ja, gut …«, krächzte sie. Die Haare um ihre Stirn waren schweißfeucht. Sie stemmte sich auf die Ellbogen und warf den beiden Heilerinnen einen strengen Blick zu. »Danke für all eure Bemühungen. Wisset, dass alles, was nun geschieht, nicht eure Schuld ist, Kinder. Verlasst uns nun.«
Eine Windböe riss an Ysais Schal, als die beiden die Zeltklappen öffneten und wieder hinter sich schlossen. Sobald sie allein waren, setzte sich Ysai neben Moriya und wischte ihr über die Stirn. Ihr leicht lockiges Silberhaar hatte sich um ihre Hörner geschlungen. »Ich glaube dir nicht«, sagte Ysai. »Großmutter lag falsch. Wir rufen weitere Heiler.«
Moriya runzelte die Stirn und schob Ysais zitternde Hände beiseite. »Sorge dich nicht, Kind. Uns bleibt nicht viel Zeit. Der König ist tot. Die Menschenkönigin und ihre Töchter werden sich womöglich gegenseitig zerstören und das wird unsere Chance sein. Nachdem ich fort bin, wirst du zur Stammesmutter ernannt werden. Du musst es mir versprechen, Ysai. Versprich mir, dass du uns in den Süden führen und dafür sorgen wirst, dass eine Khimaerin den Thron besteigt.«
Als Ysai zögerte, packte Moriya ihre Hand und drückte sie schmerzhaft. Ysai war überrascht, dass ihre Mutter trotz des sterbenden Lichts in ihren Augen eine derartige Kraft besaß. Moriya brachte all ihre beeindruckende Willensstärke auf, um sich noch ein wenig länger ans Leben zu klammern. Wenn sie den Heilerinnen nur eine Chance geben würde, könnten sie ihre Lebenszeit vielleicht verlängern.
Ysai wollte sich von ihr lösen, doch Moriyas Griff war zu fest. »Mutter, wie soll ich sie dazu überreden? Die Elderi denken, ich wäre immer noch ein Kind. Es wird Jahrzehnte dauern, bis ich das Vertrauen des Stamms erlangt habe.«
»Ich weiß, dass du einen Weg finden wirst, Ysai. Versprich es mir.« Die Augen ihrer Mutter glänzten inbrünstig.
Und so sagte Ysai aus Ariban, die dieses verschneite Tal in den zwanzig Jahren ihres jungen Lebens kaum verlassen hatte, Ja.
Ihre Mutter kämpfte gegen das sie verbrennende Fieber an, bis sie zur Morgendämmerung friedlich einschlief. Keiner der vielen Stammesangehörigen mit Heilgaben konnte das Fieber bannen. Sie sagten, es wäre, als hätte Moriyas Körper einfach aufgegeben.
In den folgenden Tagen wurde Moriyas Körper auf einem Scheiterhaufen verbrannt. Am Morgen danach verfolgte der gesamte Stamm, wie zwei Elderi Ysai einen Kopfschmuck aus sichelförmigen Goldplatten aufsetzten und der neuen Stammesmutter ihre Treue schworen. Doch Ysai konnte an nichts als an ihr Versprechen und den Blutfleck denken.
Bringe den Stamm nach Süden. Führe sie entweder ins Verderben oder stiehl den Thron direkt unter den Nasen der Menschen.
Sie fügte eine weitere Aufgabe hinzu: Nimm Rache an den Soldaten, die Moriya getötet haben, und zerstöre alle, die sich zwischen dein Volk und den Thron stellen.
– I –
KEINE PRINZESSIN MEHR
Und so sagte die Zauberin zu der jungen Frau: Ich habe deine Magika gestohlen. Ich werde mir deinen Thron nehmen und du wirst meine Krone aus Hörnern tragen. Dann kannst du keine Prinzessin mehr sein.
– Kindergeschichte menschlicher Herkunft
Kapitel 1
Eva
Ich träumte von Feuer. Von einem Fluss aus Blut und einer Rauchsäule, die sich so dunkel in den Himmel erhob, dass sie die Sonne verdeckte.
Ich träumte von klirrenden Klingen und knirschenden Zähnen und dem Gestank von Eingeweiden, die auf Marmorböden klatschten. Ich träumte von einem Messer, das tief in meiner Brust steckte, und einer blutroten Krone auf Isadores goldenem Haar. Ich träumte von dem Jäger, der mich kummervoll mit rot geränderten Augen ansah, während ihm Fesseln das Fleisch von den Knochen schnitten. Ich träumte vom Hof und Krönungen und feiner Seide und hauchdünnen, blutgetränkten Kleidern.
Ich träumte vom Flicken und von Chatara und davon, wie ich mit nackten Füßen auf dem zerbrochenen Kopfsteinpflaster tanzte, bis es vor Blut glänzte.
Ich träumte und träumte und träumte, beschwor die gesamte Dunkelheit herauf, die tief in mir wurzelte. Die Träume waren wie Magika. Im Wachzustand, wenn mich alle aus den Augenwinkeln beobachteten und sich sorgten, dass ich schließlich doch noch zerbrechen würde, wusste ich, dass mich meine Träume beschützten. Ich konnte lächeln und für die anderen stark sein, während ich auf die Nächte wartete, in denen ich wieder einmal schreiend erwachen würde. Aketo war der einzige Zeuge.
Wenigstens waren mir die Träume geblieben. Sosehr mich meine Furcht nachts auch von innen auffraß, verlieh sie mir tagsüber Kraft. Nachts konnte ich innerlich brodeln und schluchzen und furchtbare Ängste ausstehen, doch wenn der Morgen kam, schluckte ich alles mit einem stählernen Willen und einem aufgesetzten Lächeln herunter.
Denn ich konnte es mir nicht leisten zusammenzubrechen.
Nicht jetzt, da ich meine Schwester durch das halbe Königinnenreich verschleppt hatte, um meine Mutter davon abzuhalten, sie zu krönen, sobald sich die Nachricht über meine wahre Herkunft verbreitete. Nicht jetzt, da ich die Hälfte meiner Leibwache mit mir genommen und sie ihre Schwüre gegenüber dem Thron meinetwegen gebrochen hatten. Nicht, während ich nach einem Weg suchte, uns alle zu beschützen – auch Isadore. Nicht, solange ich mich noch nicht entschieden hatte, wie meine Zukunft aussehen würde.
Ich durfte unter diesen Umständen nicht zerbrechen. Zuerst musste ich überleben.
*
Ich lag auf dem Bauch und robbte mithilfe meiner Ellbogen vorwärts. Jede Bewegung wirbelte goldenen Staub auf, sodass ich die Augen zusammenkneifen musste. Der Himmel war klar und blau, und die Mittagssonne brannte auf meinen Rücken, doch alles, was dem beißenden Wind seine Kraft nahm, war mir willkommen. Als eine weitere Böe über mich hinwegfegte und an dem losen Zopf in meinem Nacken riss, zog sich eine Gänsehaut über meine nackten Arme.
Der Hochsommer war endgültig vorbei, doch aufgrund meiner stark geschrumpften Garderobe hatte ich meine ärmellosen Tuniken und dünnen Leggings noch nicht gegen wärmere Kleidung eingetauscht.
Seit meinem Namenstag am letzten Tag des Hochsommers waren sechs Wochen vergangen, doch glücklicherweise hielt sich die allerletzte Wärme des Jahrs hartnäckig auf der weiten Ebene. Kühlere Winde waren bereits auf dem Weg gen Süden. In Myre war der Herbst lang, das Land kühlte sich nur langsam ab, um sich auf einen kurzen und bitteren Winter vorzubereiten.
Sobald sich die Kälte vom A’Nir-Gebirge bis hinunter zum Roten Fluss erstreckte, würden wir unsere Seide und Baumwolle des Sommers und Herbsts gegen Wolle und Felle eintauschen. Dann wäre die meiste Kleidung, die ich von Ternain mitgebracht hatte, nutzlos.
Falls wir im Norden blieben, auf dem Pfad, den ich vorgegeben hatte.
Das würde sich noch herausstellen. Denn seit einer Woche steckten wir hier fest und warteten.
Sobald kein Staub mehr durch die Luft wirbelte, spähte ich durch das mitgenommene Fernrohr, das ich vor drei Wochen erstanden hatte, bevor wir die Ebene betreten hatten. Ich blinzelte und konzentrierte mich auf das kleine Dorf, das nur wenige Meilen nördlich lag. Unser Aussichtspunkt befand sich auf einer Felsnase, die wie ein Zahn aus der Ebene von Arym ragte. Im Gegensatz zu den kleineren spitzeren Felsen, mit denen das weite goldene Grasland gespickt war, erinnerte dieser Felsen jedoch eher an einen unförmigen Backenzahn. Anali und ich pressten uns flach in eine Spalte im felsigen Untergrund, sodass uns die wenigen Dorfbewohner aus der Ferne nicht entdecken konnten.
Arym bedeutete Gold auf Khimaer und die Ebene hatte diesen Namen aufgrund der hellen ockerfarbenen Erde erhalten, die schwach in der Sonne funkelte. Es war eine harsche Region, bestehend aus Aberhunderten Meilen flachem Grasland mit ebenso flachen Seen, die von einem Arm des Roten Flusses gespeist wurden, der tief unter der Erde floss. Die wenigen ebenfalls flachen Hügel waren hier und da mit kleinen, knotigen Bäumen gespickt. Nur wenige Reisende durchquerten die Ebene von Arym aus Angst vor den Löwen und anderen aus Magika entstandenen Raubtieren, die hier lebten. Ganz zu schweigen von den Gnu- und Antilopenherden. Nur die Götter wussten, was sich hier noch alles verbarg. Jedes Gebiet, das sich in Myre wild und frei entfalten konnte, verbarg Geheimnisse, von denen selbst die ältesten Geschichtsbücher nicht berichteten.
Doch selbst die schimmernde Erde konnte nicht das ärmlich wirkende Dorf aufwerten, das im Schatten eines riesigen Anwesens lag. Orai war kaum mehr als eine Ansammlung von robusten Lehmhütten mit Gitterfenstern, die in Blau-, Grün- und Lilatönen gestrichen waren und sich an der Mauer des Anwesens entlangzogen. Es gab nur zwei Gasthäuser, die augenscheinlich schon bessere Tage erlebt hatten, einen heruntergekommenen Tempel und einen Markt, der gerade zum Leben erwachte. Eine große Schafherde graste außerhalb des Dorfs, gehütet von zwei Mädchen, die nicht älter als zwölf sein konnten. Ihr Haar hing ihnen in dicken, mit Perlen und Anhängern verzierten Zöpfen bis zur Hüfte. Die älteren Frauen im Dorf trugen ihr Haar aufwendig hochgesteckt und mit gefärbten Baumwolltüchern umschlungen, die vornehmste Kleidung, die es hier zu geben schien. Laut allen Karten, die wir vor unserer Reise auf die Ebene studiert hatten, war Orai – neben Sellei, einer Siedlung an einem See, der derzeit nur eine ausgetrocknete Talmulde war, und Meteen, einem Außenposten von Blutsvetternomaden, die oft in diese Region kamen – das einzige Dorf weit und breit. Doch während Sellei und der Außenposten der Nomaden auf den Karten korrekt verzeichnet waren, befand sich Orai entgegen allen Angaben nicht fünfzig Meilen im Westen. Es hatte uns eine zusätzliche Woche gekostet, doch vor zwei Wochen hatten wir das Dorf endlich gefunden. Viele Meilen weiter südlich und versteckt hinter einigen hoch aufragenden Felsen, von denen der Geruch nach Erd-Magika ausging. Jemand hatte diesen wundersamen Ort dringend verstecken wollen. Sofort war meine Neugier geweckt. Ich hatte mir riesige Marmormauern vorgestellt, die eine gewaltige Khimaer Enklave umgaben, doch zu meiner Enttäuschung hatten wir nichts als eine winzige Häuseransammlung weit draußen auf der Ebene vorgefunden, die kaum die Bezeichnung Dorf verdiente.
Trotz allem ergab es Sinn.
Und diese Erkenntnis ließ meine Haut kribbeln. Die Maßnahmen, die zum Verbergen dieses Orts vorgenommen worden waren, erklärten einiges. Hätte ich meinem Vater besser zugehört, ihm mehr Fragen gestellt, wäre mir aufgefallen, dass er ein Geheimnis bewahrte. Der König von Myre und Kommandant der Königinnenarmee kam von diesem vergessenen Ort, und seine Familie war ihm nie in die Hauptstadt gefolgt, um dort ein Leben voller Annehmlichkeiten zu führen, die ihm seine Hochzeit mit der Königin beschert hatte? Natürlich versteckten sie etwas.
Wer auch immer einen genaueren Blick auf das Leben meines Vaters geworfen hatte, musste die Wahrheit herausgefunden und ihn getötet haben.
Sonnenlicht tanzte über die Kalksteinmauer des Anwesens, die so hoch aufragte, dass sie den strahlend blauen Himmel hätte küssen können. Dagegen wirkte jedes andere Gebäude in Orai winzig. In der Mitte der Mauer befand sich eine einfache Tür aus Teakholz und die Kalksteinblöcke waren mit Darstellungen uralter Kreaturen verziert. Aus der Entfernung konnte ich diese Details nicht ausmachen, doch an unserem ersten Abend hier hatten sich Anali und Farun nahe genug herangeschlichen.
Das einzige Anzeichen auf ein Gebäude hinter der Mauer waren zwei Turmspitzen, die wie Goldbarren im Sonnenlicht glänzten. Selbst mit dem Fernrohr war das alles, was ich aus der Ferne erkennen konnte. Alles, was ich nach zwei Tagen vom Heim der Familie meines Vaters zu sehen bekommen hatte. In diesen zwei Tagen war niemand hineingegangen oder herausgekommen. Die Dorfbewohner näherten sich dem Anwesen nicht, warfen nicht einmal Blicke in dessen Richtung. Ich suchte die hoch oben in die Mauer eingelassenen Fenster nach Bewegungen ab, wusste jedoch, dass es zwecklos war.
Niemand würde auftauchen. Meine Wachen hatten die Mauer den ganzen Tag und die ganze Nacht beobachtet und nichts anderes gesehen als ich in diesem Moment. Die Leute, die sie im Dorf dazu befragt hatten, hatten entweder den Kopf geschüttelt und sie ignoriert oder erklärt, dass sich seit einem Jahr nichts auf dem Anwesen geregt hatte.
Welche Beziehung hatten die Leute hinter der Mauer wohl zu den Dorfbewohnern? Wie konnte die Herrin des Hauses über das Dorf verfügen, wenn sie nie mit den Bewohnern interagierte? Ich war hergekommen, um Antworten auf die Frage zu bekommen, wie mein Vater seine Khimaer Herkunft so lange geheim gehalten hatte, doch ich hatte auch gehofft, hier auf einen Anhaltspunkt zu stoßen, wie es für mich weitergehen sollte. Es wäre außerdem hilfreich, einige Verbündete zu finden oder in Erfahrung zu bringen, welche Adlige mich unterstützen würden. Oder noch besser: eine zündende Idee zu haben, wie ich den Hof und meine Mutter davon überzeugen konnte, eine Khimaerin als Königin zu akzeptieren und die unzähligen Gesetze zu umgehen, die genau das verhinderten. Khimaer durften keinerlei Machtpositionen innehaben, was mir nicht gerade half. Vor unserer Abreise aus Ternain hatte ich mich durch alle Besitztümer meines Vaters gewühlt, jedoch nichts Brauchbares gefunden.
Ich hoffte, Papas Familie würde mir Antworten liefern. Falls nicht, hatte ich keine Ahnung, was ich tun sollte.
»Wie lange sollen wir noch warten?« Ich klappte das Fernrohr zusammen. Meine Haut war mit einem Schweißfilm überzogen und als der kühle Wind darüberfuhr, zitterte ich.
Anali ignorierte meine Frage. »Du hast doch gesehen, was ich gesehen habe. Auf dem Anwesen bewegt sich nichts.«
»Aber wie lange sollen wir noch warten?«, fragte ich leise, ohne meine Ungeduld zu verbergen.
Mit ihren rußschwarzen Augen hielt Anali meinen Blick fest. Sie hatte sich das eisweiße Haar, das in starkem Kontrast zu ihrer dunkel leuchtenden Haut stand, eng an den Kopf geflochten. In den Wochen, seit wir Ternain verlassen hatten, hatte sie bunte Stofffetzen in die Spitzen ihrer Zöpfe eingeflochten. Filigrane Goldketten hingen von ihren Widderhörnern, daran hingen violette Perlen, die zur Farbe ihrer Federn passten. Derartigen Schmuck hätte sie sich als Soldatin der Königinnenarmee nicht erlauben können. Nur ihre maskuline Kleidung war noch dieselbe. »Eine Woche. Dann können wir sichergehen, dass –«
»In einer Woche könnten längst Soldaten hier eingetroffen sein. Willst du etwa so lange bleiben, bis wir aufgespürt werden? Es war schon gefährlich genug, überhaupt herzukommen.«
Wir hatten nach Anzeichen dafür gesucht, dass Soldaten der Königin vor uns nach Orai gekommen waren. Bisher hatten wir keine Hinweise darauf gefunden. Doch das bedeutete nicht, dass sie nicht jeden Moment eintreffen konnten. Dieses Dorf und die Familie, die angeblich hier lebte, waren meine letzten Verbindungen zu meinem Vater. Hierherzukommen war ein Risiko, doch ich war es bereitwillig eingegangen.
»Und trotzdem sind wir hier«, entgegnete Anali barsch. »Wenn wir es überstürzen, bringen wir uns grundlos nur noch mehr in Gefahr.«
Ich setzte mich auf und steckte das Fernrohr in den schweren Gürtel um meine Hüfte, um mich an den Abstieg zu machen. Schmerz explodierte in meinem Bauch und der Kupfergeschmack von Blut erfüllte meinen Mund, als ich mir auf die Zunge biss.
Der Schmerz wurde schwächer und meine Gedanken und Sorgen zerstreuten sich. Ich konzentrierte mich ganz auf den zerklüfteten Felsen unter meinen Handflächen. Ruhe überkam mich, während ich mich nach unten vorarbeitete. Ich bewegte mich rein instinktiv. Halb rutschte ich, halb sprang ich die beinahe vertikale Felswand hinab.
Viel zu früh kam ich unten an. Ich schüttelte meine Finger aus. Die meinen Fingerspitzen entspringenden dicken schwarzen Krallen waren von der Kletterpartie mit Staub überzogen. Als ich gegen den Verband an meinem unteren Bauch drückte, zischte ich vor Schmerz. Doch ich hörte nicht auf, bis ich mich vergewissert hatte, dass meine Wunde nicht aufgerissen war und wieder zu bluten begonnen hatte.
Das war ein weiterer Luxus, den ich schmerzlich vermisste: Heiler, die mir jederzeit zur Verfügung standen.
Als sich Analis knirschende Schritte näherten, verschränkte ich die Arme vor der Brust, um zu verbergen, wie stark sie zitterten. Ich wollte niemanden an meine Verletzung erinnern, schon gar nicht meine Befehlshaberin. »Vielleicht sollte ich nachts allein einen Abstecher zum Anwesen machen. Ich wette, ich könnte die Mauer schneller hochklettern als ihr alle.«
Ich wette, ich könnte mich unbemerkt davonschleichen und noch vor Sonnenaufgang herausfinden, was hinter der Mauer liegt.
Schließlich konnte mich niemand außer meiner Schwester töten. Zu Beginn der Feier meines Namenstages hatten zwei Sorceryn Isa und mich mit einem komplexen Zauber verbunden, sodass nur wir einander töten konnten. Selbst Unfälle konnten mir dank des mächtigen Zaubers nichts anhaben. Nur Isa. Und nun, da sie meine Gefangene war, war ich in Sicherheit. Zumindest, was den Tod anging. Also würde ich die Mauer lieber selbst erklimmen, statt jemand anderen in Gefahr zu bringen.
Anali hob eine salzweiße Augenbraue. »Also wirst du mich oder den Prinzen dazu nötigen, dich zurück ins Lager zu schleppen.«
Ich schenkte ihr ein trockenes Lächeln und machte eine auffordernde Geste. »Vielleicht lasse ich euch ja nicht.«
Ich war nun stärker und schneller als zuvor. Einer der Vorteile, die mit der Befreiung meiner Magika einhergegangen waren. Außerdem konnte ich die steilen Felsen und Hügelkuppen der Ebene dank meiner seltsamen neuen Kraft nun so mühelos erklimmen, als würde ich laufen oder schwimmen. Na ja, vielleicht nicht ganz so leicht, aber die Macht, die durch meine Adern floss, hatte sich vergrößert und damit auch mein Verständnis der Natur.
Analis Gesichtszüge wurden weicher. »Während die Vorstellung, dass du Aketo und mich besiegen könntest, lächerlich ist und in unserem Lager für ein ziemliches Spektakel sorgen würde, klingt es nicht, als würde es dich deinem Ziel näher bringen. Ich verstehe, warum dir dieser Aufschub missfällt, Eva.«
»Es dauert einfach zu lange, Anali. Wir sind schon zu lange fort und haben nichts erreicht.«
Seit meinem Namenstag waren wir ständig auf der Flucht, von einem Dorf, in dem ich mich nicht sehen lassen durfte, zum nächsten. Sechs Wochen waren verstrichen, ohne dass uns Neuigkeiten vom Palast erreicht hatten, doch wir wussten alle, dass sich das jederzeit ändern konnte. Meine Mutter würde bald bekannt geben müssen, was passiert war, falls sie es nicht bereits getan hatte. Sobald sie unsere Fährte aufgenommen hatte, würde sie uns gnadenlos verfolgen lassen.
Zu allem Überfluss würde in zwei Monaten der Winter heraufziehen.
Die Luft wurde mit jedem Tag kühler und die Nächte länger. Bald würde uns die Sonne nicht mehr wärmen. Die Kälte würde sich wie ein Wintergeist über das Land legen und die von der Sommersonne ausgetrocknete Erde gefrieren lassen. Schnee würde fallen und die meisten Tiere, die auf der Ebene von Arym lebten, würden bis zum Frühling über den Fluss nach Süden ziehen.
»Ich weiß, dass du nicht mehr warten möchtest, aber wir können uns keine Fehler erlauben«, wiederholte Anali. »Wenn du ins Dorf gehst und dich jemand erkennt, wird sich das schnell herumsprechen.«
Mit einer Hand fuhr ich über die Unterseite meiner Hörner. Meine Klauen kratzten klickend über die Rillen. Da die Hörner hinter meinem Haaransatz entsprangen, wanden sich meine wirren Locken ständig darum. Ich vermisste Mirabels Geduld und die geübten Handgriffe, mit denen sie mir stets das Haar geflochten hatte. Mehr als den notdürftigen Knoten in meinem Nacken brachte ich allein nicht zustande. »Nur wenige würden mich in dieser Gestalt erkennen.« Ich sprach so leise, dass es mich überraschte, als Anali meine Worte trotz des Winds verstand.
Ihr Blick wurde hart. »Selbst wenn sie nicht wissen, wer du bist, werden sich Geschichten über ein gehörntes Mädchen auf der Ebene von Arym verbreiten. Die Familie deines Vaters lebt hier seit Jahrhunderten. Wer auch immer über den König Bescheid wusste, wird verstehen, dass es sich um dich handelt.«
Dem konnte ich nicht widersprechen, doch Anali konnte mich trotzdem nicht von meinem Plan abbringen. Sechs Wochen waren verstrichen und ich hatte immer noch nicht verstanden, wie meine Khimaer Magika funktionierte. Ich wusste immer noch nicht, wer ich wirklich war.
Auch Bakkha hatte ich seit sechs Wochen nicht gesehen. Und nun verschwendeten wir unsere Zeit, warteten und beobachteten. »Die ganze Zeit über hatten wir Glück. Die Königin wird nicht ewig warten und hier befinden wir uns auf dem Präsentierteller. Wir müssen einen sicheren Unterschlupf finden. Und wir alle brauchen dringend ein Bad.« Sowie einen Plan, wie es weitergehen sollte. Ich musste nicht nur über meine Zukunft, sondern die Zukunft von ganz Myre nachdenken.
Anali runzelte die Stirn, nickte aber nach einer Weile. »Wie lautet Euer Befehl, Eure Hoheit?«
Als sie meinen Adelstitel benutzte, zuckte ich zusammen und warf Anali einen scharfen Blick zu. Sie blinzelte unschuldig, obwohl sie wusste, dass mich Erinnerungen an meine Abstammung wütender denn je machten. Sicher würde ich bald erfahren, dass mir meine Ländereien und Titel weggenommen worden waren. Meiner Mutter würde es große Freude bereiten. »Versammele alle, wenn wir ins Lager zurückkehren. Heute Abend schmieden wir einen Plan und morgen werden wir die Mauer bei Sonnenaufgang erklimmen.«
»Wie du wünschst.« Anali neigte den Kopf. »Du bist deinem Vater so ähnlich.«
»Was?«, entfuhr es mir. Alle meine Gedanken verstummten, als sie meinen Vater erwähnte.
»Ich wusste immer, wenn er im Begriff war, einen furchtbaren Plan zu schmieden. Und jetzt sehe ich es dir ebenso an.«
»Lieber ein gewagter Plan als ein vermeintlich sicheres Ergebnis – in letzterem Fall geht immer etwas schief«, sagte ich grinsend. Ich erinnerte mich an Papas leuchtende Augen. Er hatte oft stundenlang ins Leere gestarrt, während er alle Teile eines Plans hin und her schob, bis sie zusammenpassten.
Das war eins der Dinge, die sich in den letzten Wochen verändert hatten. Ich konnte an meinen Vater denken, ohne seine Leiche vor mir zu sehen. Auch wenn es mir jedes Mal ein schlechtes Gewissen bescherte. Wie konnte ich den Mord an meinem Vater einfach so hinnehmen? Ich hatte Ternain schließlich mit dem Schwur verlassen, seinen Mörder zu finden. Bis jetzt ohne Erfolg.
Obwohl Kastro mir verraten hatte, dass seine Mutter hinter dem Angriff auf meinen Vater steckte, war ich mir sicher, dass Lady Shirea die Anweisung von jemand anderem erhalten hatte. Von jemandem am Hof, jemandem, den ich kannte.
Und hier draußen konnte ich der Wahrheit nicht auf die Spur kommen.
Anali und ich liefen schweigend durch das struppige Gras zurück zum Lager. Bei Sonnenaufgang hatte Falun eine Gruppe aus vier Spähern weit auf die Ebene hinausgeführt. Mehr konnten wir nicht entbehren. Sie mussten bereits zurückgekehrt sein, da wir einen von ihnen vor dem Lager antrafen. Arame, ein Mensch mit der Magika der Erde und des Wassers, eisblauen Augen und goldbrauner Haut, spannte gerade seinen Bogen.
Er schoss zwei Perlhühner, die durchs Dickicht gehuscht waren. Als er sich aufmachte, um seine Beute einzusammeln, gesellte Anali sich zu ihm, um mit ihm zu sprechen.
Ich wartete nicht auf sie. Sobald ich einen Fuß in unser kleines Lager setzte, trat Falun mir in den Weg und legte einen Arm um meine Schultern.
Ich seufzte und rang mir ein Lächeln ab. »Ihr seid schon von der Jagd zurück?«
Er nickte und murmelte etwas von einer Herde Gnus und dass sie Holz für neue Bögen benötigten. Erst dann kam er auf den wahren Grund dieser Unterhaltung zu sprechen. »Wie hast du geschlafen?«
»Gut«, log ich. Wieder einmal war ich schreiend erwacht, unfähig, das letzte Bild meines Albtraums abzuschütteln: mein Körper, der vor den Toren des Königinnenpalasts baumelte. Der Gestank des verwesenden Fleischs war so real gewesen, dass er mir selbst im Wachzustand noch in die Nase stach. Ich hoffte, dass Aketo Falun nichts von meinen Albträumen erzählt hatte. Ich brauchte nicht noch mehr Leute, die sich um mich sorgten.
Obwohl ich wusste, was als Nächstes kommen würde, zuckte ich zusammen, als Falun weitersprach. »Und was ist mit der anderen Sache?«
Ich biss die Zähne zusammen, während ich mir überlegte, wie ich diesem Gespräch entfliehen sollte. Ich hätte Falun nicht verraten dürfen, dass ich mit dem Gedanken spielte, Bakkha zu kontaktieren. Je öfter er in meinen Träumen auftauchte, desto dringender wollte ich in Erfahrung bringen, wo er sich aufhielt.
Doch ich wollte Bakkha nicht wissen lassen, dass ich mich um ihn sorgte. Diese Genugtuung würde ich ihm nicht verschaffen.
Falun, der Bakkhas plötzliche, unangekündigte Abreise als einen ebenso großen Vertrauensbruch sah wie ich, hatte seine Enttäuschung nicht verbergen können, als ich Bakkha erwähnt hatte. »Wir haben schon genug zu tun, da müssen wir uns nicht auch noch Sorgen um ihn machen. Er sollte sich um dich sorgen.«
Doch Bakkhas Schweigen verriet mir, dass er sich nicht um mich sorgte. Die Verbindung, die wir mit Blut besiegelt hatten, erlaubte es uns, im Geist miteinander zu kommunizieren. Durch die Koaleszenz, die unsere Magika miteinander verbunden hatte, konnte ich Bakkha immer noch wie einen Anker auf der anderen Seite spüren. Jedes Mal, wenn ich an ihn dachte, war es, als zupfte etwas an mir. Bakkha war vermutlich gegangen, um seine Verpflichtungen gegenüber dem Stamm zu erfüllen, hatte es jedoch nicht für nötig gehalten, mir davon zu erzählen. Er hatte mich nicht in seine Pläne miteinbezogen, also warum sollte es mich kümmern, was er trieb? Vielleicht suchte ich trotz seines Verrats immer noch nach einem Grund, ihm zu vertrauen. In schwachen Momenten malte ich mir aus, dass Bakkha zum Stamm gegangen war, um sie um Hilfe bei meinem Kampf um den Thron zu bitten. Doch es war närrisch zu glauben, dass sich Bakkha um eine andere Person als sich selbst scherte.
»Ich habe es mir anders überlegt.«
Die Anspannung verschwand aus Faluns Gesicht. Er hob eine zimtfarbene Braue und sah mich mit seinen ultramarinblauen Augen an. »Bist du dir sicher? Natürlich freue ich mich über deine Entscheidung, aber das letzte Mal, als wir über ihn gesprochen haben, wirktest du besorgt.«
Ich zuckte mit den Schultern und kaute auf meiner Unterlippe herum. »Du hattest recht. Unsere Verbindung ist ungebrochen. Wenn er mich wissen lassen möchte, wo er ist, kann er das jederzeit tun.«
Fals Miene verdunkelte sich. »Genau wie er uns von Anfang an die Wahrheit hätte sagen können.«
Vor meinem Namenstag hatte ich Falun über Bakkhas Lügen unterrichtet und darüber, dass der Stamm der wahre Grund war, warum der Jäger nach Myre zurückgekehrt war. Zunächst hatte Fal es Bakkha nicht übel genommen, doch nachdem Bakkha ohne ein Wort des Abschieds abgereist war, hatte auch Falun verstanden, dass er mich die ganze Zeit nur benutzt hatte. Seine einstige Zuneigung für den Jäger war verflogen.
Bakkha war geflohen, als wir ihn am meisten gebraucht hatten. Sollte er zurückkommen, würde er vor mir im Staub kriechen müssen.
Als ich nicht antwortete, legte Falun erneut einen Arm um mich, sodass seine langen Haare meine Wangen kitzelten. Er duftete nach frischer Erde und mit Honig gesüßtem Fey-Wein. »Du brauchst ihn nicht. Wir brauchen ihn nicht.«
Da war ich mir nicht so sicher.
Ohne Bakkha hätte ich die letzten Monate nicht überlebt. Doch es würde nichts bringen, das laut auszusprechen, also nickte ich und schlang einen Arm um Faluns Taille, um ihn mit mir zu ziehen. »Komm, ich habe Aketo lange genug mit meiner Schwester allein gelassen.«
*
Einer meiner größten Fehler im Laufe des letzten Jahres war es, meine Schwester zu entführen, ohne einen konkreten Plan zu haben, wie ich sie in Schach halten konnte. Zum Zeitpunkt meiner Flucht war mir lediglich bewusst, dass ich sie nicht in Ternain lassen konnte. Meine Mutter hätte sie während meiner Abwesenheit zur Königin gekrönt. Doch mir war nicht klar gewesen, wie schwierig es werden würde, eine Gefangene mit auf die Flucht zu nehmen, geschweige denn eine, die ich davon zu überzeugen hoffte, mich nicht umzubringen.
Es half nur bedingt, Isa in Ketten zu legen. Vor unserer Abreise aus Ternain hatten Anali und Falun Fesseln aus dem Palastgefängnis gestohlen. Das Eisen war mit Zaubern versehen, sodass die gefesselte Person keine Magika benutzen konnte – eine Erfindung der Sorceryn. Sie waren so leicht, dass sich meine Schwester damit mühelos bewegen konnte, und mit glühenden Runen überzogen, die nicht zu übersehen waren. Als Anali mir erklärt hatte, dass diese Ketten benutzt wurden, um Khimaer in die Bezirke zu transportieren, war mir übel geworden.
Isadore war in den frühen Morgenstunden auf einem Pferd erwacht, das an meins gebunden war, als wir Ternain gerade hinter uns gelassen hatten.
Sie hatte die Fesseln kaum bemerkt. Ihre Augen hatten sich geweitet, während sie sich in der neuen Umgebung umsah. Vor brennendem Zorn hatte sie zu zittern begonnen, ihr Blick war auf der Suche nach einer Waffe hin und her gehuscht. Bevor sie etwas sagen konnte, hatte ich das Knochenheft des Dolchs an meiner Hüfte umklammert und mit der anderen Hand eine verkorkte Silberflasche in ihre Richtung gehoben. »Ich habe genug dabei, um dich einen ganzen Monat auszuschalten. Solltest du Ärger machen oder deine Magika benutzen, werde ich dir nur zu gern die nächste Dosis verabreichen. Solltest du meine Freunde in Gefahr bringen oder gar töten …« Ich warf den Wachen einen Blick zu, die um uns herum ritten. »… wird dich dasselbe Schicksal ereilen.«
Ich wusste nicht, was ich erwartet hatte, doch als Isadore mich voller Hass angegrinst hatte, war ich erstarrt. Sie hatte mich so aus der Bahn geworfen, dass ich nicht einmal reagieren konnte, als sie aus dem Sattel sprang.
Zumindest hatte sie es versucht, denn Aketo packte sie am Kragen, bevor sie sich die Beine brechen oder das Pferd ihr die Wirbelsäule zertrampeln konnte. Die Droge hätte sie schwächen müssen, doch sie hatte sich wie ein wildes Tier im Sattel gegen seinen Griff gewehrt. Ich hatte mir das Zaumzeug ihres Reittiers geschnappt und den Göttern gedankt, dass das Pferd ruhig geblieben war. Dabei hatte ich jedoch Isas Zähnen ausweichen müssen, als sie nach meinen Händen schnappte.
Aketo hatte sein Pferd vorwärtsgetrieben. Sein fragender Blick hatte meinen gesucht und ich hatte ihm zugenickt. Er wollte meine Erlaubnis einholen, Isadore mithilfe seiner Magika zu beruhigen. Aketo konnte die Gefühle jeder Person manipulieren, die er berührte. Während Katros Verhör hatte ich aus erster Hand gesehen, wie wirkungsvoll seine Kräfte waren.
»Tut mir leid«, hatte er zu Isadore gesagt und ihre gefesselten Hände in seine genommen.
Isadore hatte ihn mit gefletschten Zähnen angegrinst. Ein Lächeln, mit dem sie einen Schrei zu unterdrücken schien. »Mach dir erst gar nicht die Mühe, dich zu entschuldigen. Wir wissen beide, was das hier ist.«
Ihre Worte hatten sich wie ein Messer in meinen Magen gebohrt. Sie wusste, was Aketo vorhatte, da sie jahrelang dasselbe getan hatte – sie hatte Leute mit ihrer Magika kontrolliert.
Ohne in die Luft schnuppern zu müssen, hatte ich gewusst, dass seine Magika in diesem Moment durch sie hindurchgeflossen war. Isadores Glieder waren herabgesackt und sie hatte unter seiner Berührung geschwankt. Ihr Blick war stumpf geworden, wenn auch der Hass darin nach wie vor klar zu erkennen war. »Ich werde mich befreien«, hatte sie geknurrt. »Und dann werde ich euch beide töten.«
»Ich glaube, über diesen Punkt sind wir längst hinaus, Isadore«, war meine leise Antwort, doch sie hatte sich sofort von mir abgewandt.
Wir hatten nicht angehalten, sondern waren weiter die Straße entlanggeritten, die zur westlichen Küste führte. Aketo und ich hatten Isadore in die Mitte genommen. Wann immer sie gegen ihre Fesseln angekämpfte, hatte er ihr Handgelenk berührt, sodass sich meine Schwester wieder beruhigte.
Aketo hörte nie auf, sich zu entschuldigen. Und das Messer in meinem Magen bohrte sich immer tiefer hinein.
Die Fesseln mussten Isadores Magika so sehr schwächen, dass Aketo sie leicht übermannen konnte. Im Gegensatz zu der Nacht, als sie ihn entführt hatte, war sie nun verletzlich und ich wusste, dass sie diese Schwäche verabscheute. Womöglich würde sie uns beide nun für immer hassen.
Von da an war Aketo jeden Tag neben ihr geritten und sie hatte es aufgegeben, Drohungen auszustoßen oder waghalsige Fluchtversuche zu unternehmen. Sie ritt schweigend zwischen uns, während Wut wie beißender Rauch von ihr ausging. Wir wechselten keine Worte. Nur dann und wann murmelte Isadore ein paar Beleidigungen und versprach mir einen grausamen Tod. Aketo und ich wechselten vielsagende Blicke, wann immer Isa unsere Anwesenheit zu vergessen schien.
Zumindest am Anfang.
Als ich nun zu meinem Zelt kam, fragte ich mich, wie sich in nur sechs Wochen alles derart verändert hatte.
Isadore und Aketo saßen vor dem Zelt auf einer im Stil der Inseln gewobenen, petrolblauen und gelben Decke. Sie zankten sich über etwas, das mit dem Cherik-Spielbrett zwischen ihnen zu tun hatte, obwohl sie die angeschlagenen Emaille-Spielfiguren in Himmelblau und Grau, die unter Spielern als Heilige Tiere bekannt waren, noch gar nicht aufgestellt hatten.
Sie stritten sich wie Kinder. Fast wie … Geschwister.
Dass die beiden gut miteinander auskamen, hätte beruhigend sein können, wäre es nicht gleichzeitig so frustrierend. Obwohl sie versprochen hatte, uns beide zu töten, hatte Isa sich mit Aketo versöhnt. Es waren hingegen die letzten Worte, die sie direkt an mich gerichtet hatte.
Ohne die Glätteisen aus dem Palast fiel ihr das Haar in seidigen Locken ins Gesicht. Sie waren noch goldener, als ich sie je zuvor gesehen hatte. Einige zimtfarbene Sommersprossen hatten sich über ihre Wangen und ihre wohlgeformte Nase verteilt. In der ärmellosen bronzefarbenen Tunika, die die Tätowierungen an ihren muskulösen Armen zur Schau stellte, und der Kalbslederleggings sah sie so liebreizend aus wie eh und je. Wäre es nicht so offensichtlich gewesen, dass sie keine Waffen trug, wäre sie als Mitglied meiner Leibwache durchgegangen.
Ihre Augen funkelten amüsiert, selbst während sie sie als Antwort auf etwas, das Aketo sagte, verdrehte. Isa beugte sich zu ihm vor und murmelte ihm etwas zu, das ich aus der Entfernung nicht verstand.
Aketo sah auf, als er meine Präsenz spürte. Er lächelte breit und strahlend wie die Sonne und streckte eine Hand nach mir aus. Die Wochen auf Reisen hatten ihm gutgetan. Goldene Strähnen zogen sich durch seine dunklen Locken. Sein Baumwollhemd spannte an Rücken und Schultern. Am Gürtel trug er ein langstieliges Messer und sein Langbogen und Köcher lagen außerhalb Isas Reichweite.
Wie erwartet verstummte meine Schwester, sobald sie mich erblickte. Sie verlagerte ihr Gewicht, damit ich die Fessel um ihren Knöchel sehen konnte. Die Kette war um einen einige Fuß entfernten Pfahl im Boden geschlungen. Ich nickte, sagte jedoch nichts, als ich an den beiden vorbeiging und im Zelt verschwand.
Einen Herzschlag später hörte ich, wie Aketo meiner Schwester etwas zumurmelte, bevor er mir ins Innere folgte. Er setzte sich neben mich, während ich meine Satteltaschen nach den Hemden durchsuchte, die ich in Dahn, der nomadischen Stadt der Blutsvettern zwischen der Silbrigen Küste und der Ebene von Arym, gekauft hatte. Nach unserer Flucht aus Ternain waren wir zum Meer im Westen geritten. Von dort aus waren wir an Bord eines Schiffs an den großen Hafenstädten an der Mündung des Roten Flusses vorbei nach Norden gereist, wo uns eine felsige Küste mit kleinen, aber gut befestigten Städten empfangen hatte, deren Bewohner durch den Handel mit den Inseln einigen Wohlstand genossen.
Dahn bedeutete Wandernde Stadt auf Khimaer. In einem fruchtbaren Tal, einige Hundert Meilen vom Meer entfernt, lebten dort alte Blutsvetternfamilien, die in mit Schnitzereien und Malereien verzierten Wagen wohnten und reisten. Über die Jahre war Dahn außerdem zu einem Treffpunkt für Händler und deren riesige Karawanen geworden, die mit der Stadt umherzogen. Dort hatten wir den Großteil unseres Gepäcks aus Ternain gegen Dinge eingetauscht, die wir für unsere Reise über die Ebene von Arym benötigten.
Mein derzeitiges Zelt war viel kleiner als jenes, in dem ich auf dem Ritt nach Asrodei geschlafen hatte. Kaum zwei Leute fanden Platz darin. Allerdings hatte ich mich daran gewöhnt, den begrenzten Raum mit Aketo zu teilen.
Seine Knie drückten gegen meine, seine Haut war warm von der Sonne.
Verlangen flackerte in mir auf.
Mein Gesicht wurde heiß. Langsam wurde es peinlich. Ich hatte unzählige Nächte dicht an Aketo geschmiegt in diesem Zelt verbracht, doch seine Anziehungskraft auf mich hatte nie nachgelassen. Es half nicht, dass ihm das ebenso sehr bewusst war wie mir.
»Also, was gibt es Neues?«, fragte er, sein Atem warm an meiner Wange.
Ich lehnte mich von ihm fort und konzentrierte mich auf meine Suche. In den letzten Wochen hatte ich gelernt, dass ich mich viel zu leicht von Aketo ablenken ließ.
An den meisten Tagen, vor allem in den meisten Nächten, brauchte ich diese Ablenkung. Aber nicht jetzt.
»Heute Abend schmieden wir einen Plan und bezwingen morgen endlich die Mauer.«
»Habt ihr jemanden gesehen? Auf dem Anwesen?«
Ich schüttelte den Kopf. »Nein, aber wir können hier nicht ewig herumsitzen. Es ist gefährlich, wenn wir uns zu lange an einem Ort aufhalten.«
»Ja, aber es ist auch gefährlich, sich unvorbereitet ins Unbekannte zu stürzen.«
Seufzend wandte ich mich ihm zu, unsere Nasen befanden sich nur wenige Zoll voneinander entfernt. Ich hätte voraussehen müssen, dass er mich zur Vorsicht gemahnen würde. »Das weiß ich. Besser als die meisten Leute, aber manchmal ist das eben notwendig. Muss ich dich daran erinnern, was hätte passieren können, wenn ich dich an meinem Namenstag mit Isadore allein gelassen hätte?«
Ein Muskel in seinem Kiefer zuckte. »Es ist nicht nötig, dass du mich an jene Nacht erinnerst oder daran, wie gefährlich deine Schwester ist.«
»Bist du dir sicher?« Meiner Meinung nach brauchte er eine tägliche Erinnerung. Ich hatte den Anblick von Isas Messer an seiner Kehle nämlich nicht vergessen. Sie machte ihn weich. Auch wenn sie ihre Magika nicht gegen ihn einsetzte, brachte sie ihn dennoch dazu, sich in ihrer Gegenwart zu entspannen.
Aketo runzelte die Stirn. Sein Blick fiel auf meinen Hals und den Anhänger, der an einer Kette darum baumelte. Das Geschenk, das er mir gemacht hatte, um offiziell um mich zu werben, bevor alles schiefgelaufen war. »Vielleicht habe ich meine … Dankbarkeit für dein furchtloses Eingreifen nicht deutlich genug ausgedrückt, wenn du findest, dass du mich daran erinnern musst.« Seine Augen funkelten amüsiert.
»Nicht nötig«, protestierte ich. Aketo grinste breit, als ich fortfuhr. »Deine Dankbarkeit hast du mir mittlerweile mehr als genug bewiesen, mein Prinz.«
»Das ist gut zu wissen.« Sanft küsste er meinen Mundwinkel. Es war verlockend, doch wir lösten uns beide wieder voneinander. »Ich mache mir bloß Sorgen. Je mehr Zeit vergeht, desto wichtiger wird jede kleine Entscheidung. Es ist, als müssten wir lediglich in die falsche Richtung schauen und alles fällt auseinander. Ich will, dass du in Sicherheit bist.« Er überbrückte die Distanz zwischen uns und fügte flüsternd hinzu: »Ich habe Angst.«
Schaudernd erinnerte ich mich an meine Träume der letzten Nächte. Leichen, die vom Tor der Himmel, dem Haupteingang des Königinnenpalasts, schwangen. In meinem Albtraum waren ihre Gesichter unter Sackleinensäcken verborgen, doch ich wusste, wer da neben mir schwang: die Mitglieder meiner Leibwache. Die Füße einer der Leichen waren mit Echsenschuppen überzogen.
Der Traum war eine Warnung. Jegliche Fehler, die ich nun beging, würden tödliche Konsequenzen haben. Und diesmal ging es nicht nur um mein Leben.
Ich küsste Aketo auf die Wange und wagte es, ihn sanft ins Kinn zu beißen. »Ich habe auch Angst. Aber selbst wenn die Suche nach meiner Familie im Sand verläuft, will ich es wenigstens endlich hinter mich bringen, damit wir weiterziehen können.«
»Hast du denn einen Plan, falls sich niemand hinter der Mauer aufhält?«
Den hatte ich und ich hätte ihm und Anali schon bei unserer Abreise aus Ternain davon erzählen müssen. Doch ein Geheimnis hing immer noch unausgesprochen zwischen mir und Aketo. Nach unserem ersten Gespräch darüber, warum er nach Ternain gekommen war, hatte ich Aketo nie danach gefragt, wie es kam, dass er meinen Vater so gut kannte.
Sein Schweigen und das meines Vaters zu diesem Thema verrieten mir, dass mir die Antwort nicht gefallen würde.
Ich hatte so im Gefühl, dass Aketos Mutter meine beste Chance war zu verstehen, was Papas Absichten gewesen waren, wenn es mir schon niemand sonst erklären konnte.
Ich löste mich von Aketo. »Können wir uns heute Abend nach dem Treffen mit den anderen unterhalten?«
Er verflocht seine Finger mit meinen, wobei er meinen spitzen Krallen mühelos auswich. »Wir können uns jetzt unterhalten.«
Sein Zögern war mir nicht entgangen. »Wir sollten Isa nicht so lange allein lassen.«
Er schenkte mir ein erleichtertes Lächeln. »Soll ich ihr die Fessel abnehmen? Du weißt doch, wie sehr Isadore eure Spaziergänge liebt.«
Ich schnaubte und Aketos herzhaftes Lachen schickte ein warmes Pulsieren durch meinen Körper. Erst gestern hatte sie zu ihm gesagt, dass sie unsere erzwungene gemeinsame Zeit als Tortur empfand, und zwar so laut, dass ich es gehört hatte.
»Nein, spielt euer Spiel zu Ende.« Ich wandte mich wieder den Satteltaschen zu und fischte das Schwert heraus, das mir mein Vater geschenkt hatte. Das Knochenheft war mittlerweile in Leder gebunden worden, doch ich konnte das Summen der Energie darunter immer noch spüren. »Ich muss nachdenken.«
Aketo drückte meine Hand ein letztes Mal und verließ das Zelt.
Und obwohl ich seine Augen auf mir spürte, als ich kurz darauf mit dem Schwert auf dem Rücken aus dem Zelt kam, hielt ich den Blick auf den Boden gerichtet und machte mich auf den Weg zum Rand des Lagers.
Bald bemerkte ich, dass mir eine meiner Wachen in respektvollem Abstand folgte. Es war Kelis, meine persönliche Leibwache. Sie war groß mit bronzefarbener Haut, weit auseinanderstehenden umbrabraunen Augen und einer nicht zu bändigenden Mähne kupferfarbener Locken. Sie erinnerte an einen Wolf, konnte einem als Antwort ebenso schnell ein breites Grinsen schenken wie ein warnendes Knurren.
Mirabel hatte Kelis vor unserer Abreise gefragt, ob sie als meine persönliche Bedienstete einspringen wollte, sollte es nötig werden. Kelis hatte zugestimmt, obwohl ich dagegengehalten hatte, dass es auf der Flucht vor meiner Mutter wenig Gelegenheit geben würde, um mich hübsch herzurichten. Wie sich herausstellte, hatte ihre Befehlshaberin ihr allerdings noch einen anderen Auftrag gegeben: mich zu beschützen.
Das war eine ebenso große Zeitverschwendung. Die einzige Person, die mir gefährlich werden konnte, war an einen Pfahl mitten im Lager gekettet.
Ich träumte oft von dem Abend, als Isa und ich vor dem versammelten Hofstaat gestanden hatten, während zwei Sorceryn unsere Seelen mit schimmernden Bändern aus Magika zu einem grausamen Zweck aneinandergebunden hatten. Inzwischen fand ich die Verflechtung jedoch nicht mehr ganz so furchtbar wie damals. Schließlich hatte es Isa das Leben gerettet und meine Liste potenziell tödlicher Feinde auf eine einzige Person reduziert. Zum ersten Mal seit Langem fühlte ich mich sicher.
Ich hatte mich aber bereits zuvor in vermeintlicher Sicherheit gewähnt und würde mich in Zukunft sicher erneut irren, was das anging. Ich trauerte meiner alten Selbstsicherheit hinterher. Das Ergebnis meines behüteten Lebens bei Hof, wodurch ich von der harten Realität eines gewöhnlichen Lebens abgeschirmt worden war und keine eigenen Entscheidungen hatte treffen müssen. Selbst während meines Aufenthalts in Asrodei hatte man mich von morgens bis abends bedient.
Und trotzdem verlangte ich nun von meinen Wachen, mir zu vertrauen.
Alle Soldatinnen und Soldaten, die mir weiterhin treu ergeben waren, nachdem sie meine wahre Gestalt gesehen hatten – fünfzehn Wachen plus Aketo, Falun und Anali –, waren vermutlich bereits des Verrats an der Krone schuldig gesprochen worden. Die Strafe dafür war die öffentliche Hinrichtung am Strang, wie in meinen Träumen.
Ich glaubte nicht, dass mir meine Khimaer Magika die Gabe der Voraussicht geschenkt hatte. Die einzigen Khimaer, die diese Macht besaßen, waren Göttliche, die längst tot waren.
Nein, es ging mir nicht um schlechte Omen, sondern um die Tatsache, dass meine Freundinnen und Freunde an meiner Seite sterben würden, sollten wir gefasst werden. Sie hatten mir ihr Vertrauen geschenkt, während ich mich immer noch an die Unmöglichkeit dessen zu gewöhnen versuchte, was ich im Begriff war zu tun. Wie sollte ich Königin werden, wenn ich mich weigerte, meine Schwester zu töten, wie es das Gesetz vorschrieb? Und wie konnte ich überhaupt darauf hoffen, jemals gekrönt zu werden, jetzt, da ich so offensichtlich Khimaerin war?
Doch solange die geringste Chance auf Erfolg bestand, musste ich um den Thron kämpfen. Die Freiheit Tausender Khimaer stand auf dem Spiel.
Als wir Orai vor ein paar Tagen gefunden hatten, hatten wir unser Lager im Schatten einer Felsformation aus gefurchten rot-weißen Steinen aufgeschlagen. Das dichte Gras der Ebene wuchs hier nur spärlich und wir befanden uns im Windschatten des einzigen Dorfbrunnens. Trotzdem riskierten wir es nur nachts, Wasser von dort zu holen.
Als ich ins höhere Gras trat, nahm ich mein Schwert ab und legte es auf den Boden. Ich winkte Kelis zu, die zwanzig Fuß entfernt stehen blieb und salutierte.
Ich begann so, wie Anali es mir beigebracht hatte, als ich nach Asrodei gezogen war. Ich beugte mich vor und stemmte die Handflächen auf den Boden. Während unserer ersten Lektion hatte Anali mich angewiesen, dem Herzschlag der Erde zu lauschen. Ich hatte erst wirklich verstanden, was sie damit meinte, als Aketo mir Kathbaria beigebracht hatte.
Nun vergrub ich meine Krallen im felsigen Untergrund und leerte meinen Geist. Der Wind fuhr wie eine Klinge durchs Gras. Nach einer Weile kribbelte Energie in meinen Händen und ich riss die Arme nach oben, als wollte ich die Sonne umarmen.
Ich durchlief die Dehnübungen, bis ich alles vergaß außer der Stärke meines Körpers und dem Rhythmus seines ganz eigenen Lieds.