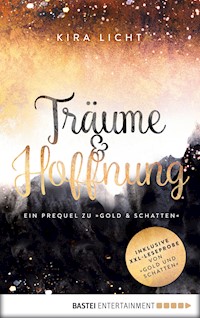9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ONE
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: A Spark of Time-Dilogie
- Sprache: Deutsch
Der Auftakt einer neuen Urban-Fantasy-Reihe mit Suchtpotenzial von Bestsellerautorin Kira Licht
Lilly deGray und ihr Vater sind bekannt dafür, dass sie in ihrem Antiquariat die verschollensten Gegenstände wieder auftreiben können. Nur dass sie dafür durch die Zeit reisen, ist ihr Geheimnis. Als das Ehepaar Fortune nach einem Familienerbstück, einer wertvollen Kette, sucht, führen alle Spuren auf die Titanic. Ein gefährlicher Auftrag, der jedoch alle Geldsorgen der Familie lösen könnte. Also reist Lilly ins Jahr 1912 zurück und gibt sich als Dienstmädchen einer Gräfin aus. Dort trifft sie auf Ray, einen Passagier der ersten Klasse, der unerwartete Gefühle in ihr auslöst. Mit dem drohenden Untergang der Titanic muss Lilly plötzlich eine Entscheidung treffen: Hält sie sich an den Kodex der Zeitreisenden - oder rettet sie Rays Leben?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 511
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin
Titel
Impressum
Trigger
Widmung
Der Kodex der Familie deGray
A Spark of Time - Rendezvous auf der Titanic
Part 2
Part 3
Anhang
Reale Personen an Bord der RMS Titanic
Reale Örtlichkeiten an Bord der RMS Titanic
Die Hunde an Bord der RMS Titanic
Reale Orte in Southampton im Jahr 1912
Inhaltsinformation
Weitere Titel der Autorin:
Gold & Schatten – Das erste Buch der Götter
Staub & Flammen – Das zweite Buch der Götter
Kaleidra – Wer das Dunkel ruft
Kaleidra – Wer die Seele berührt
Kaleidra – Wer die Liebe entfesselt
Ich bin dein Schicksal – Dusk & Dawn 1
Wir sind die Ewigkeit – Dusk & Dawn 2
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Dieses Werk wird vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München
Copyright ® 2024 by
Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Textredaktion: Christiane Schwabbaur, München
Covergestaltung: Massimo Peter-Bille, Köln
Covermotiv: © Tarzhanova/shutterstock; LedyX/shutterstock, sondem/ shutterstock, Android Boss/shutterstock, Likanaris/shutterstock, Dewitt/shutterstock, Helenaa/shutterstock, Xiao Chen studio/shutterstock, Ekaterina I/shutterstock, © mauritius images / Rob Stark / Alamy / Alamy Stock Photos
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Rimpar (www.3wplusp.de)
ISBN 978-3-7517-5665-5
one-verlag.de
luebbe.de
Liebe Leser:innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Dazu findet ihr genauere Angaben am Ende des Buches.
ACHTUNG: Sie enthalten Spoiler für das gesamte Buch.
Wir wünschen uns für euch alle das bestmögliche Leseerlebnis.
Eurer Team vom ONE-Verlag
»A single dream is more powerful than athousand realities.«
Nathaniel Hawthorne
Für euch!
Wir sind Träumer.
Für uns sind die Grenzen der Realität
nur Mauern aus Zahlen,
hinter denen das Abenteuer beginnt.
Der Kodex der Familie deGray
Die Reisenden beschützen das Zahnrad mitihrem Leben.
Die Reisenden verpflichten sich außerhalb der Familiezum Stillschweigen über ihre Fähigkeiten.
Die Reisenden verpflichten sich zu einer sorgfältigenVorbereitung der Reise und eignen sich Sprachkenntnisse,einschlägiges Wissen und kulturelles Verständnis an.
Die Reisenden müssen immer einen Auftrag haben. Siedürfen nicht aus rein persönlichen Gründen in dieVergangenheit reisen.
Die Reisenden vermeiden es, Aufmerksamkeit auf sichzu lenken, während sie sich in der Vergangenheitaufhalten.
Die Reisenden hinterlassen keine Spuren oder Beweiseihrer Anwesenheit in der Vergangenheit.
TEIL 1
Es beginnt mit Hass und Sehnsucht.
Prolog
Lilly
1957, USA, Rhode Island
Mary-Lou Elisabeth Vanderbilt hatte sich in einer Kabine der Mädchentoilette verbarrikadiert und heulte wie ein Schlosshund.
»Und dann habe ich gesagt ...« Lautes Naseputzen. »Und dann hat er gesagt ...« Schniefen und Nase hochziehen. »Und dann habe ich gesahahaaaaagt ...« Schluchzen, gefolgt von einem Hustenanfall.
Ich kam schon nicht mehr mit, wer was wann gesagt hatte, hörte aber weiter zu, während ich vorgab, meinen erdbeerroten Lippenstift vor dem Spiegel aufzufrischen. Neben mir wusch sich ein Mädchen die Hände und zupfte dann ordnend an ihrem weit schwingenden Tellerrock, unter dem die Spitze eines Petticoats hervorlugte.
Aus der Turnhalle hallte jetzt der aktuelle Platz zwei der Charts Bye Bye Love von den Everly Brothers zu uns herüber. In der Kabine wurde das Weinen prompt lauter. Mary-Lous Freundinnen Nancy-Ann Ford und Bernadette DuPont lehnten außen an der Tür und taten ihr Bestes, um Mary-Lou zu beruhigen.
»Du bist auf dem Abschlussball, und Zehntklässler wie du dürfen nur mit Einladung kommen.« Die hellblonde Bernadette richtete den schmalen Lackgürtel, der sich um ihre Taille schmiegte. »Du wirst unglaublich beliebt sein im nächsten Schuljahr. Das ist doch auch etwas.« Sie betrachtete ihre dunkelrot lackierten Nägel. »Billy und James haben in der Limousine auf dem Weg hierher schon so viel getrunken, dass sie zu nichts zu gebrauchen sind. Wir drei machen uns einfach einen schönen Abend. Wer braucht schon Jungs?«
Nancy-Ann, gehüllt in einen babyblauen Traum aus Taft und Tüll, verdrehte die Augen und nickte. »Genau. Dein Date hat immerhin einmal mit dir getanzt. Billy und James sind solche Dummköpfe.«
Mary-Lou hatte keinerlei Mitgefühl für ihre Freundinnen und deren verpatzte Dates übrig. »Aber er hat mich abserviert.«
Da ich bereits seit Beginn des Balls dabei war, wusste ich, wovon sie sprach. Ihr Date, der Elftklässler John Jacob Walton der Dritte, hatte nach dem ersten Tanz vorgeschlagen, sich ein ruhiges Plätzchen zu suchen. Dass das ruhige Plätzchen ein Synonym für knutschen und fummeln im Dunkeln war, war Mary-Lou nicht bewusst gewesen. John hatte ihre Absage sportlich genommen, ihr ein letztes Mal die Hand geküsst und sich dann ein anderes Mädchen für sein ruhiges Plätzchen gesucht.
Plötzlich schwang die Tür der Kabine auf. Nancy-Ann und Bernadette taumelten nach hinten, fingen sich aber im letzten Moment.
»Lasst uns etwas Verrücktes tun.« Mary-Lous Nase war rot vom Schnäuzen und ihre Hochsteckfrisur leicht verrutscht, dennoch blitzte Entschlossenheit in ihrem Blick auf.
»Zum letzten Mal.« Bernadette verschränkte die Arme vor der Brust. »Ich schneide dir keinen Pony.«
»Nein.« Mary-Lou strich sich eine wirre Strähne ihres dunkelbraunen Haars aus der Stirn. »Ich meine etwas wirklich Verrücktes. Verschwinden wir von hier.«
»Du weißt, dass die Aufsicht am Eingang uns nicht einfach so gehen lässt? Die Veranstaltung geht bis dreiundzwanzig Uhr, und bis dahin sitzen wir hier fest.« Nancy-Ann klang nicht begeistert. »Die Schule gleicht dank der Hartfield einem Hochsicherheitsgefängnis, und abgesehen von den vielen Anstandswauwaus gibt es noch das offizielle Sicherheitspersonal, das überall patrouilliert.«
Mary-Lous Blick glitt kurz zu mir. Ich hatte meinen Lippenstift wieder verstaut und tat jetzt so, als hätte ich etwas im Auge und wäre vollauf mit der Rettung meines Lidstrichs beschäftigt.
»Wir verschwinden aus dem Fenster. Ich kenne einen Weg durch die Hecke«, zischte Mary-Lou. »Ein bisschen die Straße runter nehmen wir uns ein Taxi zu Beat Burger. Da hängen die Jungs der öffentlichen Schule herum.« Ihre Augen wurden noch etwas größer. »Ein paar von ihnen haben Motorräder.«
Bernadette seufzte. »Mom und Dad bringen mich um.« Sie lachte auf. »Los geht's!«
Mary-Lous Blick streifte mich erneut. Sie kannte mich nicht, und ich spürte, dass sie warten wollte, bis ich ging. Also tat ich ihr den Gefallen. Ich verließ den Waschraum und hörte Kichern, kaum dass die Tür hinter mir zufiel.
Als ich das Scharren auf dem Fensterbrett hörte, drückte ich die Tür langsam wieder auf. Mary-Lou hatte ihren Freundinnen den Vortritt gelassen. Jetzt sah ich nur noch den wehenden Saum ihres pinkfarbenen Kleids, der in Richtung der Blumenbeete verschwand.
Ich beeilte mich, denn das Fenster schwang wieder zu, und durch das blickdichte Milchglas konnte ich sie nicht beobachten. Vorsichtig öffnete ich das Fenster weiter.
Hinter mir betrat jemand die Toilette, und ich tat so, als müsse ich frische Luft schnappen.
Das Knallen einer sich schließenden Kabinentür erklang hinter meinem Rücken.
Die drei Mädels rannten kichernd über die ordentlich getrimmte Rasenfläche, die durch dezent in den Beeten integrierte Lampen erleuchtet wurde.
Mary-Lou stieß einen triumphierenden Laut aus und riss den rechten Arm hoch. Etwas löste sich von ihrem Handgelenk und flog in hohem Bogen durch die Luft. Ein Lichtschein brach sich in den Hunderten Facetten und ließ das Armband aufleuchten wie eine Supernova.
Bingo.
Ich raffte meinen bauschigen Petticoat und schwang mich auf die Fensterbank. Weich landete ich auf dem Rasen. Zum Glück trug ich flache Ballerinas. Kurz sah ich mich um, denn Nancy-Ann hatte nicht übertrieben, als sie die Schule als ein Hochsicherheitsgefängnis bezeichnet hatte. Gerade heute, an einem Abend, an dem knapp einhundert Teenager zusammenkamen, war es auf diesem großen Gelände kaum möglich, sie alle zu überwachen. Deshalb hatte die Schule die Zahl der freiwilligen Aufpasser großzügig aufgestockt. Die Schüler sollten im Inneren der Gebäude bleiben, denn hier draußen gab es zu viele Möglichkeiten, sich ein wie von John Jacob Walton dem Dritten so passend bezeichnetes ruhiges Plätzchen zu suchen.
Die drei Freundinnen schafften es tatsächlich bis zur Hecke. Noch während ich auf das Blumenbeet zuging, zog Mary-Lou einen Ast zur Seite, hinter dem sich ein Durchgang befand. Dann schlüpften sie hindurch, und ihr Kichern drang bis hin zu mir ins Blumenbeet.
Schon in knapp einer Woche würde die Schulleitung die gerade begonnenen Sommerferien nutzen, um das Gelände etwas umzugestalten. Die Beete würden einem gepflasterten Weg weichen, der zu einem neu errichteten Tennisplatz führte.
Das funkelnde Diamantarmband der Familie Vanderbilt, nach dem ich mich nun bückte, würde unbemerkt von den Bauarbeitern in ihren Baggern für immer im Erdreich verschwinden.
»Hab ich dich«, flüsterte ich, als ich es hochnahm und bewundernd betrachtete. Das Schmuckstück besaß lupenreine Diamanten von knapp vier Karat und würde in der Gegenwart einen Wiederbeschaffungswert von knapp Dreißigtausend Dollar haben. Geld, das die Reparatur unserer uralten Heizungsanlage sofort wieder verschlingen würde.
Ich riss meinen Blick von dem Schmuckstück los.
Laut Mary-Lous Tagebuchaufzeichnungen, die sich in unserem Archiv befanden, war sie nicht mal auf die Idee gekommen, dass sie es hier draußen verloren hatte. Gut, dass ich ihr den ganzen Abend gefolgt war.
Ich warf einen schnellen Blick zurück, während ich das Armband in meine winzige Abendtasche schob. Die Gebäude der Newport Hills Private School spiegelten den Wohlstand ihrer Schüler wider. Die massive Architektur Neuenglands wirkte einschüchternd, und selbst die silbern glänzenden Transparente mit dem Abschlussball 1957-Schriftzug konnten diesen Eindruck kaum auflockern. Im Bundesstaat Rhode Island lebten die reichsten Familien der USA, und dementsprechend sahen sogar die Außenanlagen der Privatschule aus, als wäre man in einem Fünfsternehotel gelandet.
»Entschuldigen Sie«, erklang plötzlich eine Stimme seitlich von mir. Eine Frau in mittleren Jahren mit streng zurückgekämmten Haaren kam mit energischen Schritten auf mich zu. Sie musste mich von der Auffahrt aus gesehen und die Abkürzung über die Grünfläche genommen haben.
Dank meiner Recherchen erkannte ich sie sofort. Das kantige Kinn, die zu beiden Seiten des Gesichts spitz zulaufende Brille, der altmodische Haarknoten. Ihr in undefinierbaren Brauntönen gemusterter Rock reichte bis weit übers Knie, die Schluppen der Bluse, die sie dazu trug, waren zu einer perfekt symmetrischen Schleife gebunden.
Hatte ich ein Glück. Vor mir stand die Direktorin dieser Einrichtung. Miss Patricia Hartfield, mit Betonung auf Miss, darauf legte sie Wert.
»Guten Abend, Miss Hartfield.«
Sie stutzte und musterte mich erneut. »Kennen wir uns?«
»Ich helfe bei dem Abschlussball aus«, erwiderte ich mit einem strahlenden Lächeln. »Tiffany Errington. Ich bin die Cousine einer Ihrer ehemaligen Schülerinnen.«
»Ich weiß nicht, wer Sie sind«, erwiderte Patricia Hartfield ruhig. »Aber eine Miss Tiffany Errington ist verspätet eingetroffen und serviert seit einer Viertelstunde Punsch am Buffet.«
Verflixt. Laut unseren Aufzeichnungen hatte Tiffany den Ball abgesagt, weil sie sich eine Erkältung zugezogen hatte. Doch das war das Risiko, wenn man sich aus Mangel an Informationen auf Berichte Dritter verlassen musste. Manchmal waren sie schlicht und einfach falsch.
»Sicherheitsdienst!«, rief die Direktorin im nächsten Moment. Sie wollte nach meinem Arm greifen, doch ich wich geschickt zur Seite aus und nahm die Beine in die Hand.
Hinter mir hörte ich sie laut rufen. »Sicherheitsdienst! Unbefugte Person auf dem Campus!«
Zum Glück war sie in ihren Absatzschuhen ein ganzes Stück langsamer als ich und konnte mir nicht so schnell über die Wiese folgen. Schon hatte ich das versteckte Loch in der Hecke erreicht. Während ich den Ast zu Seite bog, sah ich mich kurz um. Zwei Männer, beide deutlich übergewichtig, kamen schnaufend angetrabt. Die Hemden ihrer Uniformen spannten gefährlich über ihren Bäuchen. Wenn das alles war, was sie hier aufboten, hatte ich leichtes Spiel.
Ich schlüpfte durch die Hecke und auf den Gehweg, der daran angrenzte, und verlangsamte meine Schritte. Dem Sicherheitspersonal war sicher schon vor der Hecke die Puste ausgegangen.
Zeit, nach Hause zurückzukehren.
Mein Petticoat mit den vielen Stofflagen erschwerte mir das Gehen. Ein offener Ford Mustang wurde neben mir langsamer, und einer der Jungs auf der Rückbank pfiff auf zwei Fingern. Seine vier Freunde, alle in den gleichen Collegejacken und mit zu Tollen gegelten Haaren, johlten zustimmend, bevor der Fahrer lachend Gas gab und das blaue Auto davonjagte.
Ich verdrehte die Augen. Jungs!
In Bobs Diner saß Dad über einem riesigen Milchshake mit Sahnehaube und orangeroter Cocktailkirsche. Auf dem Dessertteller daneben machte ich Reste von Käsekuchen mit Blaubeersoße aus.
Aus einer bunt blinkenden Jukebox erscholl All Shook Up von Elvis Presley.
»Hat es uns geschmeckt, Mr deGray?« Ich stemmte die Hände in die Hüften, als ich mich vor seinem Tisch aufbaute.
Dad deutete auf seinen leeren Teller. »Die Kuchen haben einfach besser geschmeckt, bevor sie angefangen haben, überall diese Chemikalien reinzuschmuggeln.« Er sah mich lächelnd an. »Hast du es gefunden?«
Ich klopfte auf meine kleine Abendtasche, die ich mir quer umgehängt hatte. »Habe ich.«
Ich überlegte gerade, unseren Ausflug in die Vergangenheit zu nutzen, um mir auch so einen Milchshake zu bestellen, da entdeckte ich durch die lange Fensterfront des Diners die beiden Männer des Sicherheitsdienstes. Ihre Gesichter waren zwar hochrot, und sie waren total verschwitzt, aber sie waren mir bis hierher gefolgt. Da drehte der eine den Kopf, und natürlich entdeckte er mich in dem hell erleuchteten Raum.
»Zeit zu gehen«, raunte ich Dad zu. »Wir bekommen Besuch.«
Dad seufzte und legte ein paar Scheine auf den Tisch. »Plan A oder Plan B?«
»Plan B.«
Er seufzte noch mal. »Ich hatte wirklich gehofft ...«
»Komm schon, Dad.« Ich zog ihn hoch.
Hinter der Theke war gerade viel los, und niemand hielt uns auf, als wir Richtung Küche spazierten. Eine Kellnerin, schwer beladen mit einem großen Tablett, wich uns mit einem spitzen Schrei aus, als wir durch die Tür traten. Ein junger Typ mit langer Schürze, der Burgerpattys auf einer riesigen Bratplatte wendete, rief uns etwas hinterher. Zuletzt passierten wir zwei sehr überraschte Küchenhelfer, die Obst für die Milchshakes schnippelten.
Ich hatte mir vorab die Baupläne des Diners genau angesehen, deshalb wusste ich, wie wir durch die Küche in den Hinterhof kamen.
Dad griff in seinen Hemdausschnitt, und ich wusste, dass er nach dem Anhänger griff, in dem er unser magisches Zahnrad versteckte.
Hinter uns wurde es laut. Nicht nur das Küchenpersonal nahm die Verfolgung auf, auch die Sicherheitsleute hatten unsere Flucht beobachtet und schienen noch mal alles zu geben.
Dad riss ein Regal um, aus dem große Eimer mit Mayonnaise und Ketchup mit lautem Getöse auf den Boden fielen und aufplatzten.
Endlich traten wir auf den Hof. Hier erschreckten wir nur ein paar Ratten, die in den Schatten der großen Mülltonnen nach Speiseresten suchten. Dad hatte das Zahnrad bereits in der Hand, und ich spürte die Magie, als er mich berührte. Seine Finger schlossen sich um meine, als wir einen Schritt aus dem Lichtkegel vor der Tür in die Dunkelheit machten.
Im Diner hörte ich die Männer hinter dem umgefallenen Regal fluchen.
Der wohlbekannte Wirbel baute sich um uns auf. Die Deckel der Mülltonnen klapperten, und die Magie nahm Fahrt auf. Sie riss an meinen Haaren und drückte mir die Lagen meines Rocks gegen die Beine. Ein erwartungsvolles Kribbeln durchlief mich.
Auf geht's nach Hause.
Wir drehten uns in dem Wirbel, schneller und immer schneller. Ich wollte Dad noch zulächeln, da verschwamm die Welt zu einem Meer aus Farben. Wir lösten uns auf, alles wurde ganz federleicht, laut und still, wild und friedlich zugleich. Dann hatte der Wirbel uns verschluckt.
Kapitel 1
Lilly
Die Gegenwart, USA, New York
»Sie sind ein Künstler, Mr deGray. Nein, ein Zauberer! Sie wurden uns wärmstens von den Vanderbilts empfohlen. Vielleicht erinnern Sie sich?«
»Hm ...«, brummte Dad, ohne hochzusehen. Dann schob er seine goldgerahmte Nickelbrille etwas weiter die Nase hinauf, um die unscharfe Fotografie in seiner Hand näher zu betrachten.
Er war weder ein Künstler noch ein Zauberer, und besonders charmant war er auch nicht. Also sprang ich ein.
»Vielen Dank, Mrs Fortune. Natürlich erinnern wir uns an den Vanderbilt-Auftrag. Ein wertvolles Diamantarmband, das in den Sechzigerjahren verloren ging.« Natürlich erzählte ich nicht, wie wir das Armband wirklich aufgetrieben hatten. »Wir fanden es unter dem doppelten Boden eines Überseekoffers in der Scheune eines Farmers in Montana. So hat es unbemerkt die Jahrzehnte überstanden.«
Mrs Fortune gab ein entzücktes Geräusch von sich und stupste ihren Ehemann auffordernd in die Seite. Dann endlich ließ sich auch dieser zu einer Reaktion überreden.
»Klingt wie aus einem Indiana-Jones–Film.«
»Nicht wahr?« Mrs Fortunes Stimme wanderte noch eine Oktave höher, was Dad zu einem weiteren Brummen veranlasste. In unser Gespräch brachte er sich nicht mehr ein, seit er sich in die Betrachtung des Fotos vertieft hatte.
Die Fortunes warfen ihm irritierte Blicke zu.
»Erzählen Sie mir doch noch mehr über die antike Halskette, die wir für Sie wiederfinden sollen«, sagte ich schnell. »Jedes noch so unbedeutende Detail kann für unsere Suche wichtig sein.«
Die Fortunes wechselten einen Blick und schienen zu überlegen, was sie uns noch nicht erzählt hatten.
Ich schätzte Mrs Fortune auf Anfang fünfzig. Als sie unser Antiquitätengeschäft betreten hatte, hatte ich sie von den Fotos aus dem Gesellschaftsteil des New Yorker sofort erkannt. Mary Constance Fortune war eine Grande Dame der High Society und engagierte sich in unzähligen karitativen Projekten.
Ihr Ehemann Hamish Fortune war etwa im gleichen Alter, kahlköpfig und mit einem sympathischen Lächeln. Dass es sich bei ihm um einen der reichsten Männer der Stadt handelte, verriet nur seine teure Uhr. Und vielleicht noch der graue Bentley, der vor dem Laden geparkt war.
»Mehr weiß ich leider nicht darüber«, sagte Mr Fortune und wirkte aufrichtig zerknirscht.
»Wie schade, aber da kann man nichts machen.« Ich lächelte und warf dann einen kurzen Seitenblick zu Dad. »Ein weiterer Beweis, dass die Kette nicht beim Sinken der Titanic verloren gegangen ist, wäre für uns sehr hilfreich. Nicht wahr, Dad?«
Dad brummte ein drittes Mal, doch jetzt nickte er immerhin.
Die Fortunes schienen dem Künstler beziehungsweise dem Zauberer so einiges zu verzeihen, denn sie wirkten nicht mehr so irritiert wie vorhin.
Nebenan schepperte es plötzlich laut. Wir alle hielten inne. Dann drang Rubys Stimme durch die schwere Holztür, die Dads Büro von dem Verkaufsraum des Antiquitätengeschäfts trennte. »Nichts passiert!«
Die Fortunes lachten höflich. Dad verdrehte die Augen und ließ endlich das Foto sinken.
»Alles klar, Ruby!«, rief ich. Ruby war unsere Aushilfe, sie war Schülerin an der Juilliard und angehende Balletttänzerin. Trotz der Eleganz, die in jeder ihrer Bewegungen lag, war sie der ungeschickteste Mensch, den ich kannte.
Ich wollte noch etwas zu der Fotografie sagen, doch die Blicke der Fortunes ruhten erwartungsvoll auf Dad. Der nahm die Brille ab, verschränkte die Finger ineinander und stützte dann den Kopf darauf ab. »Das Foto ist leider von sehr schlechter Qualität.«
Die Gesichter der Fortunes wurden gleichzeitig immer länger. Eine enttäuschte Stille hing gefühlt ewige Sekunden zwischen uns.
»Aber ...«, begann Mrs Fortune schließlich.
Dad, völlig immun gegen die Schwingungen im Raum, unterbrach sie sanft, aber bestimmt. »Warum wollen Sie die Kette zurückhaben? Warum gerade dieses Stück? Die Fortune-Schwestern sind in großem Reichtum aufgewachsen. Jede von ihnen muss Dutzende vergleichbare, wenn nicht sogar wertvollere Schmuckstücke besessen haben.«
»Dad«, raunte ich durch zusammengebissene Zähne. Ein Auftrag war ein Auftrag, und er brachte uns Geld ein. Geld, das wir gut gebrauchen konnten, seit der Laden wegen der Pandemie Verluste gemacht hatte. Wenn die Fortunes ihrem Namen alle Ehre machen und ein kleines Vermögen für die Wiederbeschaffung der Kette ausgeben wollten, dann sollten wir nicht groß diskutieren.
Ich rückte am Schreibtisch noch etwas näher zu meinem Vater und schenkte den Fortunes, die auf zwei antiken Holzstühlen aus der Biedermeierzeit auf der gegenüberliegenden Seite der Platte saßen, mein nettestes Lächeln.
»Wie gesagt, in einem Gespräch über die Beweggründe fallen unseren Klienten manchmal noch Details zu dem Suchobjekt ein.« Ich sah erst zu Mrs Fortune, dann zu ihrem Ehemann und hoffte, dass diese Ausrede Dads Worte abschwächen würde. Wie konnte er sich nur so im Ton vergreifen?
»Ich organisiere zurzeit eine Ausstellung mit dem Titel Schmuckstücke, die Geschichte schrieben.« Mrs Fortune wirkte verärgert über Dads barsche Fragen. »Es geht hier nicht um Stücke aus Museen. Ich möchte auch die persönliche Geschichte einer Familie darstellen. Sämtliche Erlöse, also die der Gala zur Eröffnung und die des Eintrittskartenverkaufs, werden Hilfsorganisationen hier in New York gespendet. Natürlich möchte ich als Organisatorin auch mit der Geschichte meiner Familie vertreten sein. Mit der Geschichte unserer Familie«, korrigierte sie sich hastig und sah kurz zu ihrem Mann.
»Mein Vorfahre John Fortune erbte als Bruder von Mark Fortune einen großen Teil seines Vermögens«, ergänzte Mr Fortune, seine Miene zeigte keine Verärgerung. »Mark ist 1912 beim Untergang der Titanic gestorben, von ihm gibt es keine Erinnerungsstücke. Aber seine Tochter Ethel überlebte das Unglück, und ihre Kette ist so ein besonderes Stück, so außergewöhnlich, dass ich weiß, dass sie noch irgendwo da draußen sein muss. Ich glaube ganz fest daran.«
Mr Fortune sprach mit so viel Leidenschaft und Überzeugung, dass mir ein leichter Schauer die Arme hinabjagte. Plötzlich verstand ich, warum er so ein erfolgreicher Geschäftsmann war. Seine Überzeugung war ansteckend.
»Sehr interessant. Vielen Dank für diese Einblicke.« Dad erhob sich. »Und danke, dass Sie heute hier waren. Es handelt sich ohne Zweifel um ein schönes Schmuckstück mit einer sehr bewegten Geschichte. Lassen Sie uns bitte Ihre Unterlagen hier, damit wir weitere Nachforschungen anstellen können. Wir melden uns, ob wir eine Chance sehen, die Kette zu finden.«
Die Fortunes erhoben sich gleichzeitig mit mir.
»Das klingt doch nach einem Plan.« Mr Fortune lächelte breit. »Danke für Ihre Zeit, Mr deGray. Ich freue mich, bald von Ihnen zu hören. Miss deGray.« Er streckte auch mir die Hand hin, und ich schüttelte sie.
Nachdem Dad und ich uns auch von Mrs Fortune verabschiedet hatten, brachten wir beide noch durch das Ladengeschäft zur Tür. Die kleine Glocke, die über dem Ausgang angebracht war, gab ihr unverkennbares Klimpern von sich, als das Ehepaar Fortune den Gehweg betrat. Ich war erleichtert, dass das Gespräch doch noch gut verlaufen war. Mein Blick glitt hinter ihnen her und zu dem großen grauen Wagen.
Ein Chauffeur Mitte zwanzig in schwarzer Uniform lehnte lässig an dem Bentley. Sein blondes Haar war locker nach hinten frisiert, und seine deutlich dunkleren Augenbrauen boten einen interessanten Kontrast dazu. Mit seinem perfekt geschnittenen Gesicht sah er aus, als könne er nebenher modeln. Er schien genau zu wissen, wie gut er aussah, bedachte man die Art, wie er die bewundernden Blicke der Passanten genoss. Er riss die hintere Tür des Wagens auf, um die Fortunes Platz nehmen zu lassen. Dad und mir, die in der Tür standen, schenkte er keinen Blick.
Dad hob die Hand, als der Wagen sich in den dichten Feierabendverkehr New Yorks einreihte.
»Ich bin dann auch mal weg.« Ruby erschien aus dem Lager, kaum dass ich die Tür hinter Dad und mir geschlossen hatte. Sie hatte sich den Riemen ihrer Messenger Bag quer umgehängt und das dunkle Haar in einem Pferdeschwanz gebändigt. Die weichen Sohlen ihrer Turnschuhe machten kein Geräusch auf dem Holzboden.
»Danke, Ruby«, sagte Dad. »Dann bis übermorgen.«
»Schönen Abend, Mr deGray. Bis dann, Lilly!« Sie lächelte mich an und streifte eine chinesische Vase mit ihrer Tasche. Das Porzellanmeisterwerk aus dem 18. Jahrhundert schwankte auf dem kleinen Beistelltisch zweimal gefährlich von rechts nach links, bevor es über die Kante kippte. Ruby fing die Vase im letzten Moment auf.
»Nichts passiert«, keuchte sie. Es war ihr Standardspruch. Sie strich sich eine verirrte Strähne aus dem Gesicht, nickte uns noch mal zu und huschte mit flammenden Wangen aus dem Geschäft.
Ich sah ihr nach, wie sie mit federndem Gang über die Straße Richtung U-Bahn ging.
»Wer hat diesem Mädchen gesagt, dass sie für den Job in einem Antiquitätengeschäft geeignet ist? Wer hat sie eingestellt?«
»Das warst du.« Ich küsste Dad im Vorbeigehen auf die Wange. »Du warst ganz entzückt von dem Gedanken, dass eine Ballerina bei uns arbeiten würde.«
Dad folgte mir in sein Büro. »Erinnere mich bitte nicht daran.« Er reichte mir eine Zeichnung aus der Akte, die die Fortunes hiergelassen hatten. Es war ein Stück vergilbtes Papier, das ich jetzt zum ersten Mal sah. »Und? Was sagst du dazu?«
Ich lehnte mich an ihn, und er legte den freien Arm um mich. Wie immer roch er schwach nach den kubanischen Zigarren, von denen er sich nach einem langen Tag gern eine gönnte. Es war ein herber und zugleich würziger Geruch, der mich durch mein ganzes Leben begleitet hatte und in mir für immer ein Gefühl von Heimat auslösen würde.
»Früher Jugendstil«, sagte ich, als wir die Zeichnung nun gemeinsam betrachteten. »Sie passt also in die Zeit.« Es handelte sich bei dem Papier um eine Zeichnung von Ethel Fortune. Sie zeigte eine schlichte Kette, deren Metall Ethel mit »Gold« angegeben hatte, ebenso wie bei dem großen Anhänger, der sich in der Mitte befand. Sein typisch florales Design, verziert mit Steinen, die Ethel mit »dunkelblaue Saphire« beschriftet hatte, sah aus wie ein Paradebeispiel des Jugendstils. Die Zeichnung wirkte gestochen scharf und sehr realistisch. Ethel hatte wirklich Talent gehabt.
Dad drückte mich kurz an sich, ein sicheres Zeichen dafür, dass ich mit meiner zeitlichen Einschätzung richtiglag.
»Und ist sie das?«
Jetzt nahm er wieder das Foto hoch, das er vorhin schon so lange betrachtet hatte. Es zeigte die drei Fortune-Schwestern Ethel, Mable und Alice auf dem Deck der Carpathia, einem der Schiffe, das der sinkenden Titanic zu Hilfe geeilt war. Alle drei Frauen trugen dicke Pelzmäntel. Ethel hielt immer noch die Rettungsweste in der Hand, die sie im Rettungsboot getragen hatte. Die Aufnahme war nicht aus nächster Nähe aufgenommen worden, dennoch konnte man in den undeutlich abgebildeten Gesichtern der Frauen den Schrecken der vergangenen Nacht ablesen. Sie alle hatten tiefe Ränder unter den Augen, wirkten müde und erschöpft. Ihre Mutter, die sich im Hintergrund befand, hatte gemeinsam mit ihnen in einem Rettungsboot gesessen. Noch wussten sie nicht, dass Vater und Bruder ertrunken waren. Noch waren sie voller Hoffnung, dass dieses Unglück ihre Familie nicht auseinandergerissen hatte.
Ich nahm Dad das Foto aus der Hand und strich mit dem Daumen über die verblichene dünne Pappe. Erneut ließ ich meinen Blick zu Ethel gleiten. Der Pelzmantel schien zu ausladend und schwer für ihre schmalen Schultern. Sie hatte ihn nur nachlässig geschlossen, und er offenbarte ein gutes Stück Dekolleté und Hals. Dennoch war die Qualität des Fotos einfach sehr schlecht. War da ein Kratzer auf dem Papier, oder war es der Schatten eines Anhängers? Hatte sie ihn in jener verhängnisvollen Nacht getragen?
Die Fortunes schienen sich da ganz sicher. Und wenn man auf diesem Foto eine Kette am Hals von Ethel sehen wollte, dann sah man sie auch. Irgendwie.
Ich ließ das Foto sinken, und wir sahen uns an. Dads dunkle Augen wirkten müde. »Ich habe mich im Ton vergriffen. Danke, dass du die Situation gerettet hast.«
Ich hatte also recht gehabt. Er wusste genau wie ich, wie sehr wir diesen Auftrag brauchten.
»Schon okay.« Ich lächelte ihn liebevoll an, obwohl ich mir Sorgen machte. Dad wirkte nicht nur müde, er wirkte regelrecht erschöpft. Und dennoch ging von ihm eine subtile Unruhe aus, die ich zuvor nicht bemerkt hatte. Was war mit ihm los? Ich kannte die Geschäftsbücher und unseren aktuellen Kontostand. Wir brauchten einen neuen Suchauftrag, so viel war sicher. Dennoch war unsere Situation nicht so schlecht, dass wir beunruhigt sein mussten. Warum also wirkte mein Vater so besorgt?
Kapitel 2
Lilly
»Die Fortunes haben Glück, dass der Nachlass von Ethel so umfangreich erhalten ist.« Einen Moment noch betrachteten wir beide die Aufnahme der drei Schwestern, die nun auf dem Tisch lag, dann löste Dad sich sanft von mir. Er griff in seine Westentasche und holte die altmodische Taschenuhr hervor, die er einer Armbanduhr vorzog. »Es ist zehn Minuten nach Ladenschluss. Machen wir hier die Lichter aus und essen oben noch den Rest deiner vegetarischen Lasagne. Die war wirklich ausgezeichnet.«
Dagegen hatte ich nichts einzuwenden. Ich freute mich auf den Feierabend und darüber, dass Dad meine laienhaften Kochversuche immer so sehr lobte.
Zusammen mit der Mappe verließen wir das Büro, und ich wartete hinter der Theke, während Dad das Gitter vor der Ladentür herunterließ. Wie automatisch griff meine Hand nach einem Staubtuch und wischte über das leicht milchige Glas. Es war nicht verkratzt, es war einfach nur sehr alt. Und die Schmuckstücke, die in unserer zur Ladentheke umgebauten Vitrine lagen, standen dem in nichts nach. Auf einem Bett aus dunkelblauem Samt funkelten Broschen, die zwei Weltkriege miterlebt hatten. Goldene Armreifen, die von adligen Damen getragen worden, und Solitär-Ringe aus Platin, die über Generationen hinweg der Angebeteten als Verlobungsgeschenk an den Finger gesteckt worden waren.
Dad kam zu mir hinter die Theke, steckte Bargeld und Kassenbons in eine dunkle Tasche und gemeinsam betraten wir das Lager.
Feine Staubpartikel flirrten durch die Luft und tanzten im Schein der zwei Kronleuchter, die an der hohen Decke über uns angebracht waren.
Wir passierten antike Beistelltische aus Indien, und die Luft war plötzlich von einem intensiven Geruch nach Sandelholz erfüllt. Als kleines Mädchen hatte ich mit Mom hier zwischen gestapelten chinesischen Stühlen aus Rosenholz, japanischen Schränken aus Lack und Ebenholz-Truhen aus der Kolonialzeit Verstecken gespielt. Ich kämpfte gegen die Traurigkeit, die mich sofort umfing, als ich an ihr unbeschwertes Lachen dachte.
Wir hatten die Stahltür zum Treppenhaus erreicht, und Dad drehte sich kurz zu mir um. Schnell setzte ich ein Lächeln auf.
Er schloss hinter uns ab, und gemeinsam gingen wir die Treppe hinauf. Erst da schien ihm aufzufallen, was ich unter dem Arm trug.
»Du hast die Fortune-Akte mitgenommen?«
»Seit ich keine Hausaufgaben mehr habe, weiß ich nicht, was ich abends machen soll.«
Dad schüttelte lächelnd den Kopf. »Aber du musst dir keine Arbeit suchen.«
DeGray Antiques braucht diesen Auftrag, Dad. Wir brauchen ihn dringend, und ich frage mich, warum dir das nicht klar ist.
»Das Recherchieren macht mir Spaß.« Ich zuckte die Schultern und rang mir ein unbekümmertes Lächeln ab.
Er strich mir kurz über die Wange. »Ich weiß, kleine Wühlmaus. Soll ich dir helfen? Zu zweit sind wir schneller.«
Kleine Wühlmaus. Mom hatte damit angefangen, und Dad hatte es übernommen. So nannten sie mich, weil ich mich in ein Thema hineinwühlte und dann alles um mich herum vergaß und unglaublich hartnäckig sein konnte.
»Ruh dich aus, ich gehe alles durch und berichte dir morgen, was ich gefunden hat.«
»Das ist lieb, danke, Lilly.« Dad schnaufte, so wie immer, wenn er die zwei Treppen erklommen hatte. Ich betrachtete ihn besorgt von der Seite, während er sich hinabbeugte, um den Schlüssel ins Schloss der Wohnungstür zu stecken.
Mom war gerade mal zwanzig Jahre alt gewesen, als sie sich kennenlernten, und Dad schon zweiundvierzig Jahre, doch der Altersunterschied hatte nie eine Rolle zwischen ihnen gespielt. Aber seit Mom nicht mehr da war, merkte ich Dad an, dass er über sechzig war. Außerdem ließ er sich seitdem gehen, und nicht nur sein Bauchumfang machte sich auf der Treppe bemerkbar.
»Soll ich die Lasagne aufwärmen?«, fragte er, als wir die Wohnung betraten. Er legte den Schlüssel auf die Kommode neben der Garderobe und sah dann zu mir.
»Ich mache das schon.« Ich schob mir schnell die Schuhe von den Füßen und folgte ihm dann durch den kleinen Flur.
Unsere Wohnungseinrichtung bestand aus bunt zusammengewürfelten Möbeln aus allen Erdteilen und Epochen der Welt. Ein Chippendale-Sofa aus England, die Essgruppe aus der Biedermeierzeit Frankreichs, Bodenvasen aus dem alten China und nicht zusammenpassendes Meissener Porzellan aus Deutschland. Die Mischung war leicht chaotisch, aber ich empfand den Stil als gemütlich.
Während ich die Reste der Lasagne auf zwei Teller verteilte, dachte ich an die Fortunes. Wir wurden oft weiterempfohlen, und gerade die Mundpropaganda der oberen Zehntausend brachte uns die lukrativsten Aufträge ein. Ich musste lächeln, als ich erneut daran dachte, wie und wo ich das Diamantarmband der Familie Vanderbilt tatsächlich aufgetrieben hatte.
Als die Mikrowelle meldete, dass die erste Portion Lasagne heiß war, brachte ich sie zu Dad an den Esstisch. Er machte gerade die Abrechnung der Tageseinnahmen und würde nach dem Abendbrot seine New York Times lesen, weil er das morgens nicht schaffte. Ich hingegen wollte mich unseren Finanzen widmen und mir danach den Nachlass von Miss Ethel Fortune gründlich vornehmen.
*
»Ich bin dann oben, Dad. Bis später!«
Dad spülte unsere Teller ab und hob nur kurz eine Hand, die in einem pinkfarbenen Gummihandschuh steckte.
Unser Zuhause war ein schmales Eckhaus, dessen langgezogene Grundfläche knapp vierzig Quadratmeter bot. Im Erdgeschoss waren das Geschäft und der Lagerraum untergebracht. Direkt über dem Laden befanden sich die Wohnräume, dann folgte die Etage, die meinen Eltern gehörte, und die dritte Etage war mein Reich.
Die Holztreppe, die sich wie das Innere eines Schneckenhauses in vielen Windungen bis ganz nach oben schraubte, quietschte leise, als ich die letzte Stufe überwand.
Ich mochte die offene Atmosphäre, die auf meiner Etage herrschte. Außer dem kleinen Badezimmer gab es keine Wände, die den Raum unterteilten. Blickfang war der gemauerte Kamin mit einer Feuerstelle, die so hoch war, dass man fast aufrecht darin stehen konnte. Mein weißes Doppelbett thronte unter einem Fenster. Mein Schreibtisch stand an der angrenzenden Wand, ebenfalls einem Fenster zugewandt, und bog sich unter Büchern.
Ich schlüpfte in eine gemütliche Yogahose, schob ein weiteres Fenster hoch und kletterte über eine Fußbank auf meinen improvisierten Balkon auf der Feuertreppe. Dort knipste ich die Lichterkette an, bevor ich mich auf einem Sitzkissen niederließ und die Fortune-Akte aufschlug.
Noch mal schweiften meine Gedanken kurz zu Dads komischem Verhalten. Ich hatte unsere Konten schon während des Abendessens geprüft, aber nichts Beunruhigendes gefunden. Wir hatten mit Dreitausendsechshundert Dollar zu wenig Rücklagen für ein altes Haus, in dem ständig etwas kaputtging. Aber das war nichts Neues, und diese Zahl hatte sich seit letzter Woche nicht verändert. Leider war ich zu feige gewesen, Dad direkt anzusprechen, weshalb ich das Ganze auf morgen verschoben hatte.
Ich ließ meinen Blick kurz über die beeindruckende Skyline von New York wandern, bevor ich mich wieder in das Material vertiefte, das die Fortunes uns überlassen hatten.
Die sehr wohlhabende Familie hatte sich 1912 samt einer ganzen Entourage von Dienstboten von Kanada aus auf eine Weltreise begeben. Ein Tagebuch aus dem Jahr 1910 brachte keine neuen Erkenntnisse, die anderen waren sogar noch älter. Doch sie zeigten, dass Ethel schon immer eine talentierte Zeichnerin gewesen war, denn überall fanden sich Skizzen von Menschen und Landschaften. Alle anderen Unterlagen waren jünger und verrieten nichts über den Verbleib der Kette.
Doch dann stieß ich auf einen Briefumschlag, der zwischen die Seiten eines Tagebuchs aus dem Jahr 1916, also vier Jahre nach dem Unglück, geschoben war. Der Brief darin trug das Datum »Paris im Februar 1912«.
1912? Das war das Jahr des Untergangs der Titanic.
Ich überflog Ethels sanft geschwungene Handschrift, und mein Herz begann schneller zu schlagen. Die Zeilen waren an eine Freundin namens Josepha gerichtet. Ethel beklagte sich erst über die unerwartete Kälte in Paris und schwärmte dann von den ortsansässigen Modesalons. Danach erzählte sie von den beeindruckenden Juwelen, die sie am Hals diverser Damen im Theater gesehen hatte. Schnell las ich weiter.
Stell dir vor, liebste Josepha, Papa hat mir gestattet, eine Halskette nach meinen Wünschen zu gestalten. Es ist sein Geburtstagsgeschenk. Ich habe schon eine Zeichnung angefertigt, und übermorgen werden wir einem berühmten Juwelier einen Besuch abstatten. Ich lege diesem Brief eine Kopie meiner Zeichnung bei. Was sagst du? Leider reisen wir schon in einer Woche weiter nach Wien, doch Papa hat arrangiert, dass die Kette geliefert wird, noch bevor wir uns im April in Southampton auf die Titanic einschiffen. Stell dir vor, an einem Abend sitzen wir sogar mit dem Captain an einem Tisch. Mama ist ganz verzückt über diese Aussicht. Ich freue mich auch schon sehr darauf. Was dieser Mann wohl alles zu erzählen hat!
Aber was schwärme ich nur von der Titanic, hier in Paris würde es dir gefallen, liebe Freundin. Wir haben schon jetzt zu viel gekauft, und Papa schickt Smithers mit zwei Schrankkoffern zurück in die Heimat. Ich muss dir unbedingt noch erzählen, wie köstlich hier alles schmeckt und ...
Ich ließ die Schultern sinken, als Ethel nun von dem französischen Essen schwärmte. Schade, dass sie nicht den Namen des Juweliers erwähnt hatte. Vorsichtig faltete ich das brüchige Papier wieder zusammen, und mein Blick glitt erneut zu der Skyline aus Hochhäusern, die sich grau gegen den immer dunkler werdenden Himmel abzeichneten.
Ethel hatte den Brief nie abgeschickt. Vermutlich war er zwischen Kleidungsstücken in einen der Schrankkoffer geraten, die ein gewisser Smithers, vermutlich ein Diener der Fortunes, ins heimische Kanada eskortiert hatte. Und so war der Brief samt der Zeichnung irgendwann in Ethels Nachlass gelandet.
Ich seufzte lautlos.
Wir brauchten den Auftrag der Fortunes, aber das Material reichte nicht, um ein konkretes Datum einzugrenzen.
Ich sah kurz auf mein Handy. 21:17 Uhr. Dad wäre sicher noch in seine Lektüren vertieft.
Ich kletterte samt Unterlagen zurück in mein Zimmer. Nachdem ich das Licht eingeschaltet hatte, marschierte ich zur Treppe.
»Ich bin unten, Dad!«, brüllte ich in Richtung erster Etage. Da Dad der Typ Mensch war, der sein Handy abends neben das Festnetz legte, hatte ich es aufgeben, ihm zu texten. Quer durchs Haus zu brüllen hatte sich als weitaus effektiver erwiesen.
»Okay!«, erscholl es von unten.
Ich nickte zufrieden, obwohl er mich nicht sehen konnte. Dann schloss ich Gardine für Gardine vor meinen insgesamt acht Fenstern. Für das, was nun folgte, konnte ich keine Zuschauer gebrauchen.
Bewaffnet mit der Mappe und einer kleinen Flasche Wasser ging ich zum Kamin. Die Feuerstelle wurde von aus Stein gehauenen Raubvögeln umrahmt, die entfernt an Drachen erinnerten. Ich drehte am schlanken Hals eines Falken, dessen Schnabel drohend geöffnet war. Lautlos glitt die hintere Wand der Feuerstelle zur Seite. Im Dunkel dahinter sprang ein Licht an und enthüllte eine schmale Wendeltreppe aus Travertin. Ich zog den Kopf ein, trat in die Feuerstelle und drückte im Gehen einen Knopf, der oben rechts von mir aus dem Mauerwerk ragte. Mit einem leisen Zischen schloss sich die Rückwand des Kamins hinter mir.
Die Wendeltreppe schraubte sich in einem engen Schacht scheinbar endlos nach unten. Meine Vorfahren hatten sie kurz nach dem Bau des Hauses einbauen lassen, und die beeindruckenden Kamine auf allen drei Wohnetagen waren offiziell immer nur Dekoration gewesen. Die Luft hier roch intensiv nach Backstein und dem Mörtel, der das Haus seit so langer Zeit zusammenhielt. Ich passierte den ersten Kamin, die Schlafetage meiner Eltern, und dann die Wohnetage. Die Bewegungsmelder sprangen an und erloschen mit einem leisen Klicken hinter mir.
Der Keller, der unter dem Ladengeschäft lag, war feucht, und hier schimmelten sogar die Reifen von Fahrrädern. Aber dieses Haus besaß eine zweite, geheime Kelleretage, die noch tiefer im Erdreich lag. Und genau hierhin führte die Treppe in dem Kaminschacht.
Wieder fand ich den Schalter im Gemäuer, und eine schlichte Tür öffnete sich, während hinter mir die letzten Lichter erloschen. Hier unten war es angenehm kühl, aber trocken, also genau das richtige Klima für alte Bücher.
Der Boden des Raums, den ich nun betrat, bestand aus dem gleichen grüngoldenen Travertinstein, der auch die Treppe bildete. Bücherregale aus schwarzem Holz teilten ihn in sechs Reihen. Dazwischen hingen achtarmige Kronleuchter aus dunkel schimmernder Bronze, die unsere Bibliothek in ein warmes Licht tauchten. Rechts an der Wand befanden sich zwei Arbeitsplätze mit Computern. Ich nahm an einem von ihnen Platz und knipste den PC an, während ich die Fortune-Akte und die Wasserflasche auf der Tischplatte abstellte. Schon war der Computer hochgefahren. Unsere Fotodatenbank war vermutlich größer als die des amerikanischen Universitätsnetzwerks. Meine Familie hatte schon immer die Geschichte der Welt in Bild, Text und Kunst archiviert. Es war unser Arbeitsmaterial, es war die Grundlage, auf der unser Geschäft beruhte.
Ich öffnete die Suchmaske der Bilddatenbank. Beim Stichwort Titanic öffneten sich Dutzende Fotos, die sich immer wieder wiederholten. Sie alle waren von einem Francis Browne an Bord aufgenommen und über die Jahre immer wieder abgedruckt worden. Ich entdeckte die Saphirkette am schlanken Hals von Ethel sofort. Die Aufnahme war gestochen scharf und zeigte sie, wie ich vermutete, im Speisesaal, da sie ein elegantes Abendkleid trug.
Jetzt hatte ich den Beweis, dass Ethel die Kette vor der Abreise erhalten hatte. Ich lehnte mich in meinem Stuhl zurück und runzelte die Stirn. Wie hatten es diese Aufnahmen von Bord geschafft? In der Nacht des Untergangs waren die Menschen mit kaum mehr als dem, was sie am Körper trugen, in die Rettungsboote geflüchtet. Ich googelte Francis Browne und fand heraus, dass er die Titanic nur bis Queenstown gebucht hatte. Bevor die Titanic Kurs auf das offene Meer nahm, hatte sie im französischen Cherbourg und irischen Queenstown gehalten, wo Passagiere zugestiegen oder von Bord gegangen waren. So also hatten es die Aufnahmen von Bord geschafft.
Jetzt musste ich nur noch herausfinden, ob Ethel die Kette auch nach dem Untergang noch besessen hatte.
Die Carpathia war das Schiff, das der sinkenden Titanic zu Hilfe geeilt war und die Menschen aus den Rettungsbooten aufgenommen hatte. Für sie gab es ein konkretes Datum, denn sie war am 18. April 1912 in New York eingelaufen. Und dort wurde sie bereits von besorgten Angehörigen und neugierigen Journalisten erwartet. Ich lächelte. Neugierigen Journalisten mit Fotografen im Schlepptau.
Ich gab die Eckdaten in die Suchmaske ein:
Carpathia, 1912, New York.
Ich erhielt knapp hundertfünfzig Ergebnisse. Ein Foto zeigte eine Mutter mit ihrem Baby, und halb auf dem Bild war eine junge Frau, deren Pelzmantel ich sofort wiedererkannte. Es war eindeutig Ethel, aber an ihrem Hals sah ich keine Kette.
Ich klickte mich weiter durch die Bilder. Ein Fotograf hatte Passagiere fotografiert, als sie von Bord gingen. Und wieder war da Ethel, halb hinter ihrer Mutter, beide blass und mit ernsten Gesichtern und wieder ohne Kette. Ich seufzte resigniert und klickte mich weiter durch den Katalog.
Irgendwann schloss ich das letzte Foto. Verflixt. Doch so schnell gab ich nicht auf. Ich suchte nach Fotos von Ethel aus den Jahren nach dem Unglück. Doch auch hier hatte ich kein Glück. Ich rief ihre Biografie auf. Sie hatte zwei Söhne bekommen. Ich recherchierte die Namen der Schwiegertöchter, sah mir auch Fotos von ihnen an.
Nichts.
Weil mir nichts mehr einfiel, ging ich alle Fotos ihrer Schwestern Alice und Mabel durch.
Kein Treffer.
Es war schon nach Mitternacht, mir war kalt, und mein Rücken war verspannt, als ich aufgab. Ich lehnte mich im Stuhl zurück und ließ meinen Blick ins Leere gleiten. Anhand der gefundenen Informationen ließ sich nur ein konkreter Zeitraum eingrenzen: die Jungfernfahrt der Titanic.
Kapitel 3
Damien
Silicon Valley, USA
»Diese Familie kennt kein Versagen!« Die wütende Stimme meines Vaters hallte durch den hohen Raum. Sein Büro war eine Festung aus Chrom und Stahl. Es war sein Thronsaal, seine Kommandozentrale, seine Bühne. Hier war er der totalitäre Herrscher, und so hatte er es immer gewollt.
Ruby war vor seinen ausladenden Schreibtisch zitiert worden wie ein kleines Kind. Ihre Schultern bebten, und sie weinte leise. Ich hätte sie gern in den Arm genommen und getröstet, doch das würde den Jähzorn meines Vaters nur anstacheln. Also räkelte ich mich weiter betont gelassen in dem kleinen Sessel der Sitzgruppe nahe der Tür und tat so, als ließe mich der Weinkrampf meiner Schwester kalt.
»Es tut mir leid, Vater. Ich habe alles ...« Ruby brach ab, als ein ohrenbetäubendes Krachen durch den Raum hallte.
Mein Vater hatte mit einer unwirschen Handbewegung alle Gegenstände von seinem Schreibtisch gefegt. Ruby wich zwei Schritte zurück, ihr Zittern wurde noch stärker.
Hinter uns wurde an die Tür geklopft. Vaters Sekretär steckte seinen Kopf durch die Tür. »Bitte entschuldigen Sie die Störung, Mr Belmont, ich wollte nur nachsehen, ob ...«
»Raus!«
Der Sekretär duckte sich und schloss lautlos die Tür.
Ich sah wieder zurück zu meinem Vater und Ruby, deren Schluchzen lauter geworden war.
»Fünf Monate.« Vater kam um den Schreibtisch herum und baute sich von meiner Schwester auf. »Fünf verdammte Monate!«
Ich richtete mich in dem Sessel auf, meine Muskeln spannten sich an, ich war bereit. Fass sie an, und ich breche dir dein verdammtes Genick, schoss es mir durch den Kopf.
»In dieser langen Zeit war es dir nicht möglich, dieses Ding aufzutreiben? Ich habe doch keine Versager aufgezogen.« Mein Vater machte eine ausladende Geste mit beiden Händen. »Was habe ich falsch gemacht? Sag es mir, Ruby. An welchem Punkt in deiner Ausbildung habe ich versagt? Bitte, ich lerne gern aus meinen Fehlern. Tu mir den Gefallen, denk scharf nach und sag es mir.« Sein süßes Lächeln war so falsch, dass ich die Fingernägel in das weiche Leder des Sessels grub.
»Es ist allein meine Schuld«, schluchzte Ruby. Sie hatte beide Hände vor ihre Augen gepresst. »Du hast damit nichts zu tun.«
So flink wie eine Kobra hatte Vater ihre beiden Handgelenke umfasst und nach unten gerissen. In der gleichen Sekunde war ich aufgesprungen. Lenk ihn ab, leite seine Wut auf dich. Du hältst das aus. »Vater.«
Er riss den Kopf zur Seite. Sein Blick war so stahlhart und kalt, dass ich erkannte, dass ich ihn nicht mal mehr mit Logik erreichen konnte. Er löste eine Hand, um dann mit dem Finger auf mich zu zeigen. »Du hältst dich da raus.«
Mit der anderen riss er an Rubys Arm, als wolle er sie hin und her schütteln. »Und du hör auf zu flennen. Das ist ja unerträglich.« Er schlug ihr mit der flachen Hand mitten ins Gesicht.
Ich war in der nächsten Sekunde bei ihnen. Nur mit allergrößter Willenskraft schaffte ich es, mich nicht auf meinen Vater zu stürzen.
»Ich mache es«, knurrte ich.
Nur ein Schniefen von Ruby durchbrach die Stille, die folgte. Dank der schallisolierten Panoramafenster blieben die Geräusche des Silicon Valley ausgesperrt.
Während mein Vater zurück zu seinem Schreibtischstuhl ging, legte ich sanft eine Hand auf Rubys Rücken. Es war eine deutliche Geste der Verbundenheit, die meinen Vater zu einem angeekelten Gesichtsausdruck verleitete.
»Ich mache es«, wiederholte ich, kaum dass er wieder saß.
»Nein«, flüsterte Ruby plötzlich und drehte sich abrupt zu mir. »Du wolltest doch ...«
Die Stimme meines Vaters klang schneidend. »Wenn mich nicht alles täuscht, brichst du in weniger als einer Woche zu deiner Australien-Rundreise auf, die ich dir zu deinem Schulabschluss geschenkt habe.«
»Und jetzt übernehme ich stattdessen Rubys Auftrag.« Scheiß auf Australien. Klar, ich hatte mich riesig darauf gefreut. Ich wollte diese verrückte, bunte und zugleich gefährliche Tierwelt dort kennenlernen. Mich nur ein paar Wochen länger dem Traum hingeben, dass ich dank meines guten Abschlusses alles werden konnte, was ich wollte. Nur ein paar Tage länger diese Illusion leben ... Aber für Ruby würde ich darauf verzichten. Sie war meine Schwester und die einzige Familie, die ich hatte.
»Verstehe ich nicht, Damien.« Vater lehnte sich in seinem Drehstuhl zurück und legte affektiert die Fingerspitzen aneinander. »Keine niedlichen Tierbilder fürs Familienalbum? Ich dachte, das war dein großer Traum.« Er kicherte.
Als würden dich meine Träume kümmern. »Ich springe gern ein, wenn Not am Mann ist.« Zum Glück klang meine Stimme immer noch kühl und beherrscht.
Ruby wollte mich umstimmen, ich hörte ihr nervöses Wispern nahe meinem Ohr, doch ich beachtete sie nicht. Stattdessen versuchte ich einzuschätzen, was in meinem Vater vorging. Das hatte ich in meinen achtzehn Jahren nur ein paar Mal geschafft. Dieser Mann war unberechenbar. Er war gefährlich wie ein Tsunami, der plötzlich immer höher wurde. Er war hinterlistig wie eine Schlange, die zuschlagen würde, sobald sie konnte. Dass ich ihn noch nicht umgebracht hatte, verdankte er nur meinem Anstand.
Vater wippte in seinem Stuhl nach vorn und nach hinten.
»Ich weiß deinen Einsatz zu schätzen, Champ.« Er ließ sich in seinem Stuhl wieder nach vorn sinken, stützte die Ellenbogen auf dem Tisch ab und sah uns beide an. Er deutete erst mit dem Finger auf Ruby, dann auf mich. »Du bist raus, er ist drin. Sei so lieb und schicke mir eine Kopie deiner Kündigung, Kleines.« Das böse Lächeln, das er Ruby schenkte, bedeutete nichts Gutes.
»Meine Kündigung?«, stieß sie hervor.
Vater tat bestürzt. »Wie? Was soll das für eine Frage sein?«
»Was soll sie kündigen?«, fragte ich kühl. Ich ahnte, worauf er hinauswollte. Unauffällig rückte ich noch etwas näher zu Ruby.
Vater zuckte die Schultern und sah jetzt so unschuldig aus wie ein frisch gewaschener Hundewelpe. Er liebte diese Psychospielchen. »Na, ihre Tanzausbildung an dieser Uni. Ich unterstütze keine Versager.« Dann schnalzte er mit der Zunge und streckte eine Hand in Rubys Richtung aus. Er schnippte ungeduldig mit den Fingern. »Ach, und gib mir doch auch deine Kreditkarten. Die Wohnung in New York gehört ja eh mir, da werde ich jemanden engagieren, der sie morgen ausräumt.«
Erst da schien Ruby zu verstehen. Sie gab ein unterdrücktes Geräusch von sich, dann knickten ihr die Beine weg. Ich fing sie auf. Sanft stützte ich sie, bis sie wieder einigermaßen sicher auf den eigenen Füßen stand.
»Ich soll die Juilliard kündigen? Und aus der Wohnung raus? Und meine Karten ...« Weiter kam sie nicht, denn ihre Stimme brach.
»Kleines«, sagte mein Vater betont geduldig. »Du kennst das doch. Sieger bekommen Daddys Geld, Verlierer müssen wieder zu Hause einziehen.«
Ich hätte ihm gern gesagt, wohin er sich seine Scheinchen stecken konnte. Mir war das Geld so egal. Aber jeder ging anders mit dem Druck um. Ruby kompensierte ihn mit Dingen, die sie sich kaufte. Schuhe, Klamotten, Handtaschen, sie liebte diesen ganzen Krempel, sie hielt sich daran fest. Und sie hatte immer Tänzerin werden wollen. Dass Vater ihr jetzt diesen Traum nahm, war kaum mehr als grausam zu beschreiben. Um ehrlich zu sein, es fehlte mir das passende Adjektiv dafür. »Ich übernehme ihren Auftrag, wenn für Ruby in New York alles beim Alten bleibt. Ich verzichte dafür auf meinen Urlaub.«
Vater hob die Brauen. »Ernsthaft, Champ?«
Ruby war Kleines, ich war Champ. Wir fanden beide Namen zum Kotzen.
Ich nickte, obwohl es in meinem Herzen unangenehm stach. Wenn es nach mir ginge, wäre ich schon längst abgehauen. Ich hätte ihn einfach aus meinem Leben gestrichen. Aber ich konnte hier nicht weg, weil Ruby den Absprung nicht schaffte. Weil sie Angst vor ihm hatte und weil ihr das dumme Geld so viel bedeutete. Deshalb blieb ich. Deshalb duckte ich mich. Und deshalb machte ich nicht einfach einen Abflug, wie ich es schon drei Jahre lang geplant hatte.
»Damien, du musst das nicht ...«
»Ruhe«, unterbrach Vater Ruby. »Ich schätze es, wenn jemand hart verhandelt.« Sein Blick glitt wieder zu mir. »Und ich bin gespannt, wie es ausgeht.« Er grinste. »Natürlich bin ich darauf vorbereitet. Ich wäre nicht Grayson Belmont, wenn ich nicht einen Plan B in der Hinterhand hätte. Die Nummer mit der Aushilfe ist durch. Aber da es dank deiner Inkompetenz nicht schwer war, abzusehen, dass du versagen würdest, Ruby, habe ich vorausgeplant. Ich habe das Ass in meinem Ärmel bereits ausgespielt.« Er grinste böse. »Ich hatte da ein paar Informationen, die uns jetzt sehr nützlich sein werden.«
Nun war ich es, der einen angeekelten Gesichtsausdruck unterdrücken musste. Vater liebte es, andere Menschen auszuspionieren. Vorzugsweise Menschen, die in der Öffentlichkeit standen und deren gesellschaftlicher Einfluss ihm bei seinen Geschäften nützlich sein konnte.
Da Vater auch sein Telefon vom Tisch gefegt hatte, pfiff er nun ohrenbetäubend auf zwei Fingern. Dienstbeflissen streckte wieder der Sekretär den Kopf durch die Tür. »Sir?«
Er war das Pfeifen wohl schon gewöhnt. Was für ein menschenverachtendes Verhalten.
»Die Akte Fortune, aber zügig.«
»Sofort, Sir.« Der Sekretär verschwand, nur um eine Minute später mit einem Tablet bewaffnet auf uns zuzueilen. »Bitte sehr, Sir.«
Vater riss ihm das Tablet aus der Hand. »Das wäre dann alles.«
»In Ordnung, Sir.« Der junge Mann, der vielleicht fünf Jahre älter war als ich, warf uns einen kurzen Seitenblick zu und wieselte dann aus dem Zimmer. Ich kannte ihn nicht. Die Leute arbeiteten nicht lang für Grayson Belmont.
Vater war aufgestanden, und sein Zeigefinger flog über das Tablet, um den Code einzugeben, während er um den Schreibtisch herum zu uns kam. Ich schob Ruby ein Stückchen hinter mich. Es war schon fast zu einem Reflex geworden. Verschwinde endlich, leuchtete wieder dieser warnende Schriftzug in meinem Kopf auf. Verschwinde und nimm sie mit.
Vater schien meine Geste nicht zu bemerken. Er hielt mir das Tablet unter die Nase. »Da hat sich jemand einen jungen Liebhaber gegönnt.« Schon wieder so ein ekelhaftes Kichern. Innerlich schüttelte ich mich.
Das Tablet zeigte die gestochen scharfe Aufnahme eines Paars in einer eindeutig intimen Situation. Die dunkelhaarige Frau trug nur noch wenig Stoff am Körper, der blonde Mann war komplett nackt. Ich schätzte ihn auf Mitte zwanzig, sie war in mittleren Jahren.
Vater scrollte durch die Bilder, aber irgendwann wandte ich den Kopf ab. »Verstehe«, gab ich knapp zurück. Ich wusste, womit er diese Aufnahmen gemacht hatte. Eine seiner Firmen baute winzige Drohnen, die wie Insekten aussahen und die man im Alltag gar nicht bemerkte. In ihnen war die allerneueste Technik verbaut, und die Aufnahmen waren besser als von so mancher Profikamera. Vater machte sich nicht die Mühe, nach Geheimnissen zu graben. Er behielt einfach alle einflussreichen Leute permanent im Auge, was ihm dank dieser Technik mühelos gelang.
»Das ist Mary Constance Fortune. Sie ist eine prominente Wohltäterin und Liebling der New Yorker Presse«, erklärte mein Vater, während er das Tablet wieder zu sich drehte. »Ihr Liebhaber Jamie Fallons ist ein mehr oder weniger erfolgloses Unterwäschemodel, Möchtegernschauspieler und hauptberuflich ihr Chauffeur. Und das ...« Er tippte mit einem Fingernagel auf den mittlerweile ausgeschalteten Bildschirm des Tablets. »... machen sie, wenn der Ehemann auf Geschäftsreise ist.«
»Vielleicht ist der Ehemann ein Arschloch, der mit ihr keine zwei Worte mehr wechselt, und sie tröstet sich deshalb mit einem anderen«, erwiderte ich.
»Herrgott, du klingst wie ein Psychologe.« Mein Vater verdrehte die Augen und warf das Tablet auf den Schreibtisch. »Es kann uns völlig egal sein, wer was fühlt. Fakt ist, dass wir mit ihrer Hilfe den Hasen aus dem Bau locken werden.«
Seine kryptischen Worte sagten mir nichts. Ich hatte bis gerade eben nicht mal gewusst, dass Ruby in New York einen Auftrag hatte. Eigentlich erzählten wir uns alles, deshalb machte ich meinen Vater für ihr Schweigen verantwortlich.
Dieser pfiff gerade erneut ohrenbetäubend auf seinen zwei Fingern. Wieder erschien der Kopf des blassen Sekretärs. »Sir?«
»Die Akte deGray.«
»Sofort, Sir.«
»Was hast du vor, Vater?« Ich hörte die Sorge in Rubys Stimme und drehte mich überrascht zu ihr um. Jetzt war ich neugierig. Ruby war wählerisch, wem sie ihre Sympathie schenkte, was kein Wunder war bei dieser Kindheit.
Der Sekretär durchschritt den Raum auf lautlosen Sohlen. »Sir.«
Vater nahm ihm das Tablet ab und entließ ihn mit einem Nicken. Er wartete, bis die Tür geschlossen war, bevor er das Tablet anknipste. »Die deGrays sind Reisende.«
Wie bitte? Ich hob die Brauen, und mein Blick glitt erneut zu Ruby.
Vater lachte. »Da guckst du, was? Ich hatte deiner Schwester befohlen, mit niemandem über ihren Auftrag zu sprechen. Wenigstens das hat sie hinbekommen.«
Reisende ... Das Wort hallte in mir nach. Die deGrays waren wie wir. Sie konnten in die Vergangenheit reisen. Jene Geheimnisse, die die vergangenen Jahrhunderte sicher hüteten, waren auch für sie keine Mysterien.
Vater wischte auf dem Tablet herum, als suche er nach etwas. »Vater und Tochter«, erzählte er nebenher im Plauderton. »Geben vor, Antiquitäten zu verkaufen, doch das Geschäft läuft schlecht, und sie überleben nur dank der Zeitreisen. Er gilt als Spezialdetektiv, wenn es darum geht, verloren gegangene Kunstschätze wiederzufinden. In Wirklichkeit reisen die beiden in die Vergangenheit und holen sie von dort.« Vater lachte glucksend. »Der Menschheit kann man auch echt alles erzählen. Bisher ist sie nur mit ihm zusammen gereist. Daddy hält die schützende Hand über sein kleines Töchterchen, seit seine Gattin das Zeitliche gesegnet hat.« Jetzt drehte er das Tablet zu mir. Es zeigte ein Antiquitätengeschäft, das direkt an einer Straßenkreuzung lag. Zwei Schaufensterfronten liefen im schmalen Winkel auf eine Tür zu, deren Messing altmodisch verschnörkelt war. Darüber prangte ein Schild. »DeGray Antiques«. Das dunkelrote Backsteingebäude wirkte alt, aber massiv.
»Das ist der Herr des Hauses.« Vater wischte weiter, und der Bildschirm zeigte einen etwas beleibten kleinen Mann mit grauem Haar, der auf den Stufen vor dem Eingang mit einem Postboten sprach. »Und das Töchterchen ...«
»Sie heißt Lilly«, unterbrach Ruby ihn. Als wir uns beide überrascht zu ihr umdrehten, senkte sie den Kopf und murmelte: »Ihr Name ist Lilly.«
»Danke für diesen wertvollen Beitrag«, schnauzte Vater sie an. »Du bist raus, schon vergessen? Also halte dich bedeckt. Ich betreibe hier Schadensbegrenzung. Ohne meinen Plan B könnten wir wieder ganz von vorn anfangen.«
Wieder machte ich unbewusst einen kleinen Schritt vor meine Schwester. Sie hatte vielleicht nicht so funktioniert, wie er es verlangte, aber war das ein Grund, noch weiter auf ihr herumzuhacken?
»Ich soll also ihr Zahnrad stehlen?« Meine Ablenkungstaktik funktionierte.
Vater nickte. »Die deGrays sind eine harte Nuss«, knurrte er. »Ich habe ihre Geschichte über die Jahrhunderte hinweg recherchiert, bin in die Vergangenheit gereist, um eine Gelegenheit zu finden, ihnen das Zahnrad zu entwenden. Ich kenne ihr verdammtes Haus in- und auswendig und doch ...« Die letzten Worte hatte er zischend hervorgestoßen. Ich erkannte, wie groß seine Frustration bereits war. Und das machte ihn gefährlich. Wie gesagt, diese Familie kannte kein Versagen.
Vater schien sich auf meine Frage zu besinnen. »Richtig. Du stiehlst ihr Zahnrad.« Er wischte erneut auf dem Tablet herum. »Mein Plan B ist bereits aktiv, und ich habe eine Falle vorbereitet, mit der wir den Hasen ...« Er stockte und räusperte sich dann. »Mit der wir Lilly aus dem Bau locken.«
Vater war weicher zu Ruby als zu mir. Vermutlich lag es daran, dass sie ihm ähnlich sah. Wir waren beide von Leihmüttern ausgetragen worden, denn für eine Frau in seinem Leben hatte mein Vater niemals Platz gehabt. Ruby und mein Vater besaßen beide das goldbraune, leicht gewellte Haar und die dunkelbraunen Augen. Ich hingegen ähnelte ihm kaum. Wir waren zwar beide groß und hatten die breiten Schultern eines Quarterbacks, doch mein Haar war glatt und sehr viel dunkler als seins, fast schwarz. Meine Augen waren grau und mein Gesicht um einiges kantiger.
Ich räusperte mich. »Kannst du das weiter ausführen?« Lilly aus dem Bau locken. Es klang absolut makaber. Auf was hatte ich mich hier nur eingelassen?
»Ich habe dafür gesorgt, dass Mrs Fortune in mir ihren Retter sieht.«
Ruby neben mir gab ein erschrockenes Geräusch von sich, so als wüsste sie plötzlich, was Vater plante. Er ignorierte sie und sprach einfach weiter.
»Ich habe ihr angeboten, dass diese kompromittierenden Aufnahmen eines Reporters ...« Er rahmte das letzte Wort in imaginäre Anführungszeichen. »... vernichtet werden, wofür ich sie nur um einen klitzekleinen Gefallen gebeten habe.«
»Du erpresst sie also«, stellte ich fest.
»Lass mich ausreden«, zischte er. »Mrs Fortune hat für mich Mr Fortune überredet, sich auf die Suche nach einer besonderen Saphirkette seiner Vorfahrin Ethel Fortune zu begeben. Ich habe nämlich dafür gesorgt, dass ihrem Mann Hamish der Nachlass besagter Vorfahrin zugespielt wurde. Die Dokumente stammen aus meinem Archiv, aber ich habe es so aussehen lassen, als wären sie kürzlich auf einem Dachboden gefunden worden. Und natürlich hat Mrs Fortune ihrem Gatten auf meine Weisung hin die deGrays für die Suche nach der Kette vorgeschlagen, bei denen sie bereits zu einem Termin erschienen sind. Die deGrays sind nicht dumm und werden früher oder später darauf kommen, dass die Titanic die einzige heiße Spur ist. Und damit es spannend bleibt, werde ich Mr deGray zusätzlich noch in gewaltige Schwierigkeiten bringen, ich habe bereits alles arrangiert.« Er grinste wie eine hämische Raubkatze. »Ich spekuliere nämlich darauf, dass Lilly allein reisen wird.«
»Was, wenn diese von dir arrangierten Schwierigkeiten die deGrays gar nicht sosehr aus der Bahn werfen?«, warf ich ein. »Oder wenn sie den Fortune-Auftrag ablehnen?«
Vater mochte es nicht, wenn man seine Pläne infrage stellte. »Halt doch einfach die Klappe und höre zu.« Er deutete mit einem Finger auf mich. »Du reist ebenfalls auf die Titanic. Wenn mein Plan aufgeht, ist Lilly dort verletzlich und abgelenkt zugleich, denn sie hat einen wichtigen Auftrag und ist weit weg von zu Hause. Das Zahnrad muss sich in ihrer unmittelbaren Umgebung befinden, was es einfach machen sollte, es zu finden. Ich habe bereits ein Schlupfloch in der Geschichte gefunden, das dir eine perfekte Rolle bietet. Du lässt deinen Charme spielen, wickelst sie ein bisschen ein und stiehlst das Zahnrad der Familie deGray. Ganz einfach.«
Ganz einfach. Ich würde ein Mädchen aus der Gegenwart in der Vergangenheit ohne Rückreisemöglichkeit zurücklassen, einem trauernden Ehemann auch noch die Tochter nehmen und eine ganze Familie ins Unglück stürzen. Ganz einfach. Die Logik meines Vaters. Innerlich krümmte ich mich.
»Ich hatte erst vor, die deGrays um ihr Zahnrad zu erpressen. Aber dafür müsste ich unser Geheimnis preisgeben.« Vater klang, als rede er übers Wetter. »So bleiben wir incognito, und wenn mein Plan aufgeht, haben wir noch ein wenig Spaß dabei.« Schon wieder so ein Grinsen.