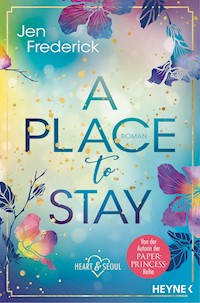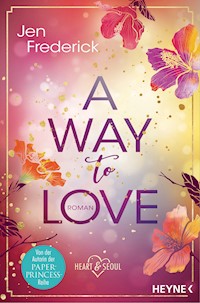
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Heart-and-Seoul-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Wenn Hoffnung und Schicksal sich treffen
Hara hat sich in ihrem Leben noch nie irgendwo richtig zugehörig gefühlt. Sie ist zwar in den USA aufgewachsen, wurde aber in Seoul geboren. Als ihr Adoptivvater stirbt, beschließt sie, dass es an der Zeit ist, ihre Wurzeln zu erforschen. Sie reist nach Seoul und ist überwältigt von dieser modernen und irgendwie magischen Stadt. Hier passt sie äußerlich rein, hat allerdings keine Ahnung von Kultur und Sprache. Zum Glück lernt Hara den charmanten Choi Yujun kennen. Er wird nicht nur ihr persönlicher Stadtführer, sondern gibt ihr das Gefühl, dazuzugehören. Mehr und mehr verliebt sich Hara in Seoul – und in Yujun. Als sie endlich ihre leibliche Mutter findet, muss sie eine schwere Entscheidung treffen. Denn Yujun zu lieben, könnte sie ihre neu gewonnene Familie kosten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 530
Ähnliche
Das Buch
Hara hat sich in ihrem Leben noch nie irgendwo richtig zugehörig gefühlt. Sie ist zwar in den USA aufgewachsen, wurde aber in Seoul geboren. Als ihr Adoptivvater stirbt, beschließt sie, dass es an der Zeit ist, ihre Wurzeln zu erforschen. Sie reist nach Seoul und ist überwältigt von dieser modernen und irgendwie magischen Stadt. Hier passt sie äußerlich rein, hat allerdings keine Ahnung von Kultur und Sprache. Zum Glück lernt Hara den charmanten Choi Yujun kennen. Er wird nicht nur ihr persönlicher Stadtführer, sondern gibt ihr das Gefühl, dazuzugehören. Mehr und mehr verliebt sich Hara in Seoul – und in Yujun. Als sie endlich ihre leibliche Mutter findet, muss sie eine schwere Entscheidung treffen. Denn Yujun zu lieben, könnte sie ihre neu gewonnene Familie kosten.
Eine große Liebesgeschichte und eine unvergessliche Reise nach Seoul
Die Autorin
Jen Frederick hat koreanische Wurzeln, wurde als Kind adoptiert und lebt heute mit ihrem Mann, ihrer Tochter und ihrem oft ungestümen Hund im Mittleren Westen der USA. Als Co-Autorin unter dem Pseudonym Erin Watt hat Frederick die NEW-YORK-TIMES- sowie die SPIEGEL-Bestsellerliste gestürmt.
Jen Frederick
WILHELMHEYNEVERLAGMÜNCHEN
Die Originalausgabe HEART AND SEOUL erschien erstmals 2021 bei Berkley, an Imprint of Penguin Random House LLC, New York.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe 01/2023
Copyright © 2021 by Pear Tree LLC
Copyright © 2023 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Lisa Scheiber
Umschlaggestaltung: bürosüd, www.buerosued.de
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-26044-6V001www.heyne.de
Für meinen Bruder Andrew, den einzigen Mensch in meiner Welt, der wie ich aussah
KAPITEL EINS
Als ich zehn war, machte mein Dad, Pat Wilson, den Witz, dass ich mir mit den Mandeln auch gleich die Tränenkanäle hätte herausoperieren lassen sollen.
Mir war klar, warum er das sagte. Ich habe früher ständig geweint. Ich habe geweint, wenn einer meiner Buntstifte zerbrochen ist. Ich habe geweint, nachdem die rote Schleife, die mein Lieblingsteddy um den Hals getragen hatte, verloren gegangen war. Ich habe geweint, als ich die Hintertür zur Garage kaputt gemacht habe. Wegen Letzterem vergoss mein Dad allerdings auch beinahe eine Träne. Hara, du bist acht Jahre alt. Wie in Gottes Namen hast du es geschafft, die Tür aus den Angeln zu reißen?
Ich weiß nicht mehr, wie ich es geschafft habe, die Tür kaputt zu machen, aber der Grund, warum ich mit zehn in Tränen ausgebrochen bin, ist mir noch lebhaft in Erinnerung. Warum mich ausgerechnet dieses Ereignis aus meiner Kindheit verfolgt, kann ich nicht sagen, aber Beschämung haftet an einem wie Alleskleber. Meine Grundschultage bilden ein Mosaik aus verlorenen Buchstabierwettbewerben, Röcken, deren Saum hinten in meiner Strumpfhose steckt, Pullis mit Erdnussbutterflecken, die ich den ganzen Tag nicht bemerke, der Tatsache, dass mein Schwarm am selben Tag, an dem ich ihm mein Viertklässlerinnenherz schenken wollte, einem anderen Mädchen seine Liebe erklärte, und dann noch das. Ich würde gerne sagen, dass all diese Dinge in der Vergangenheit wehgetan haben und ich inzwischen drüber hinweg bin, aber ich erinnere mich an jedes einzelne Ereignis, als hätte es gestern stattgefunden.
Es war sonnig, und das Schuljahr neigte sich dem Ende zu. Wir konnten es nicht abwarten, dass die Sommerferien begannen, und vielleicht war das der Grund, warum wir alle leicht reizbar waren. In der Pause fragten mich ein paar dämliche Kinder, ob mein Gesicht so flach sei, weil ich mit dem Gesicht nach vorn vom Hangelgerüst gefallen war. Erstens, ich war nie vom Hangelgerüst gefallen. Ich war schon damals, mit zehn, unglaublich stark und hangelte mich im Spurt die verdammten Streben entlang. Zweitens, mein Gesicht ist nicht flach. Wenn überhaupt, ist es zu rund. Mein Kinn ist geschwungen, und meine Wangen sind voll. Ich habe keine prominente Stirn oder tief liegende Augen, aber das ist nichts Schlimmes. Es ist etwas Asiatisches. Obwohl ich all das wusste, schämte ich mich für mein Gesicht, also weinte ich, weil das Zehnjährige nun mal tun, wenn ihre Gefühle verletzt werden.
Die Tränen störten meinen Dad.
Hara, weinst du wirklich, weil irgendein Kind gesagt hat, dass du ein flaches Gesicht hast? Das ist doch keine große Sache. Tränen werden kein anderes Kind davon abhalten, sich über dich lustig zu machen. Ellen, sag ihr, dass sie aufhören soll zu weinen.
Er hatte recht. Das Weinen änderte absolut nichts, und ein Jahr später schlossen sich meine Tränenkanäle und haben seitdem nie wieder funktioniert. Nicht mal dann, wenn sie es tun sollten. Wenn der Held oder die Heldin in einem Buch stirbt, obwohl alles nach einem Happy End aussah. Oder wenn Allie in Wie ein einziger Tag sich erinnert, dass es Noah war, der ihr die Geschichten vorgelesen hat. Oder wenn ich im Bestattungsunternehmen sitze, in dem Dads Körper in einem Sarg im Raum nebenan liegt.
Selbst wenn ich auf Kommando Tränen produzieren könnte, hätte ich heute kaum Grund zu weinen. Seit meinem elften Lebensjahr hatten Dad und ich keine besonders innige Beziehung. Das war, nachdem er beschlossen hatte, dass das ganze Vaterexperiment für ihn nicht wirklich funktioniert. Er war damit beschäftigt gewesen, sich selbst zu finden, was dazu führte, dass er Männerurlaube unternahm, die er sich eigentlich gar nicht leisten konnte, mit Frauen flirtete, die halb so alt waren wie er, und ganz generell dafür sorgte, dass es Mom nicht gut ging. Ich war froh, dass er auf Distanz ging; jegliche Interaktion zwischen meinen Eltern führte nämlich dazu, dass meine Mutter in eine Negativspirale geriet. Einmal machten wir einen Witz, dass sie genug für zwei Leute weinte, aber es war nicht nur ein Scherz. Sie wünschte sich, dass ich mehr weinte, und ich wünschte mir, dass sie es seltener tat. Ab einem gewissen Zeitpunkt habe ich mich offensichtlich in meinen Dad verwandelt. Wie deprimierend.
»Trink das, du siehst aus, als hättest du Durst.« Mom drückt mir einen Becher in die Hand.
»Nein danke.« Allein beim Gedanken, irgendetwas hinunterschlucken zu müssen, fängt mein Magen an zu rebellieren. Nicht nur, dass die Leiche meines Vaters in einer Holzkiste nebenan liegt, in diesem Gebäude werden Tote hergerichtet. Ich würde eher meine eigenen Zehen essen, als etwas von diesem Beerdigungsfraß zu mir zu nehmen.
»Du hast den ganzen Tag noch nichts getrunken oder gegessen. Ich verstehe ja, dass dir übel ist, aber nimm wenigstens Flüssigkeit zu dir.«
Ich tue so, als würde ich an dem Becher nippen. Auf einer Beerdigung über eine Tasse heißes Wasser zu streiten, scheint mir nicht die beste Vorgehensweise. Es ist einfacher nachzugeben.
»Dein Eyeliner ist verschmiert.«
Das kommt davon, dass ich zu Beginn dieser Veranstaltung versucht habe, Tränen zu produzieren, indem ich mir einen Finger in die Augen gebohrt habe. Es hat nicht funktioniert, nur wehgetan.
Mom befeuchtet einen Finger und fährt mir damit unter dem Auge entlang, als wäre ich wieder ein kleines Mädchen, das Dreck im Gesicht hat.
Die feuchte Stelle oberhalb meiner Wange stört mich, aber ich widerstehe dem Drang, sie abzuwischen, weil ich nicht möchte, dass Mom sich zurückgewiesen fühlt. Sie steht ohnehin schon am Rande eines Zusammenbruchs. Also lasse ich mein Gesicht an der Luft trocknen.
»Dein Dad ist wahrscheinlich wütend wegen dem hier.« Sie deutet auf den Tisch, den irgendjemand aufgebaut hat und auf dem ein großer Rahmen mit Fotos steht. »Es ist so billig. Und dann die wenigen Leute …« Sie schnalzt mit der Zunge. »Er wäre am Boden zerstört. Ich kann nicht glauben, dass Geoff Kaplan nicht gekommen ist. Die beiden waren Geschäftspartner, verdammt noch mal.«
Gescheiterte Geschäftspartner, wenn ich mich richtig erinnere, aber Mom hat absolut recht. Dad wäre mit der Veranstaltung unzufrieden. Wenn das hier Geoffs Beerdigung wäre, stünde Dad jetzt mit einem Golfkumpel da drüben in der Ecke und würde verkünden, dass dieses Event hier sowohl stinklangweilig als auch geschmacklos sei. Auf dem Büfetttisch steht ein Kuchen aus dem Supermarkt, daneben vegetieren Käsehäppchen auf einem Plastiktablett vor sich hin, auf dem ein Aufkleber mit Barcode prangt. Dazu weiße Wegwerfbecher, literweise Softdrinks und zwei Edelstahlkannen mit Kaffee und Tee.
Dad würde das alles hier mit seinem Gesellschaftslächeln aufnehmen – dem Verkäufergrinsen, das sich so dauerhaft in sein Gesicht gegraben zu haben schien wie die Narben beim Joker –, aber innerlich würde er vor Wut kochen. Die Teilnehmerzahl an der Totenwache ist spärlich, und niemand klingt, als würde er ihn vermissen. Selbst die zweite Mrs. Wilson ist damit beschäftigt, ihr Kleinkind davon abzuhalten, das Getränkebüfett vollzusabbern, anstatt still in ihrem schwarzen Kleid dazusitzen und dezent in ein Taschentuch zu schluchzen. Die letzten Strohhalme sind der Sonnenschein und die gelb-rosa Tulpen, die in den Blumenbeeten entlang des Gehwegs zur Trauerhalle hinauf blühen. Pat hätte sich Klagelaute und Regen und eine Szenerie gespickt mit schwarzen Regenschirmen gewünscht. Er war ein Fan von dramatischen Auftritten und liebte Aufmerksamkeit, was der Grund dafür war, dass er bei Nina Mathews landete. Meine Mutter besitzt Handtaschen, die älter sind als Nina.
Die zweite Mrs. Wilson war Kellnerin in einer Bar, in die Dad regelmäßig ging. Eins führte zum anderen, und sie war schwanger. Ich wurde per SMS informiert: Hey, Sportsfreundin. Frisch deine Babykenntnisse auf. Du bist bald eine große Schwester.
Dass er zum zweiten Mal Vater wurde, musste ihn so in Panik versetzt haben, dass sein Herz aussetzte. Das und die Tatsache, dass seine Arterien so hart wie Beton gewesen waren.
»Alles wirkt so unglaublich … geschmacklos«, erklärt Mom mit gerümpfter Nase. »Aber was soll man von einer wie der auch erwarten. Billig kennt eben nur billig.«
Ich zucke zusammen. Mom war Dads neuer Frau gegenüber nicht immer so feindselig eingestellt. Bis zum gestrigen Tag hat sie für die aktuelle Mrs. Wilson vor allem eins empfunden: Mitleid. Das arme Mädchen sollte besser anfangen, das Haushaltsgeld zu verstecken oder Sie verschwendet ihre Jugend an den Mann. Aber am vergangenen Abend hat die neue Mrs. Wilson verkündet, dass Dad eine Hypothek hinterlassen hat, die deutlich höher ausfällt, als das, was ihr kleines Zweizimmerapartment, in dem sie zusammen gewohnt haben, wert ist, und außerdem Leasingraten für ein Auto, mit denen er drei Monate im Rückstand war. Ach ja, und eine Lebensversicherung in Höhe von zwanzigtausend Dollar. Mom hat darauf bestanden, dass ich die Hälfte davon erhalte. Dad hat keinen Letzten Willen hinterlassen, und per Gesetz steht mir anscheinend ein gewisser Anteil zu. Mrs. Wilson hielt dagegen, dass dies alles sei, was für den Collegefonds von Klein-Ryder zurückgelegt werden könne. Du warst schon auf dem College und hast einen Abschluss, hat Nina gesagt, wobei ihr schmales Gesicht noch verkniffener als sonst ausgesehen hat. Sei nicht egoistisch. Mom hat lautstark protestiert und darauf bestanden, dass Patrick Wilsons Tochter ihr gerechter Anteil zusteht. Darauf machte Nina den Fehler zu verkünden, dass Ryder das Erbe mehr verdient habe, weil er Pats richtiges Kind sei. Ich hab Mom rausschleifen müssen, bevor sie einen Mord beging, so wütend war sie. Wie kann es diese Schlampe wagen, so über dich zu reden? Natürlich bist du sein richtiges Kind!
Was Nina damit gemeint hat – was alle damit meinen, wenn sie sagen, ich sei nicht Pat Wilsons richtiges Kind –, ist, dass ich adoptiert bin. Ich sehe meinen Eltern nicht das kleinste bisschen ähnlich, was nicht selten für Verwirrung gesorgt hat, wenn irgendwelche dämlichen Fremden meine Mom fragten, wo denn meine richtigen Eltern seien. Mom antwortete darauf immer kurz und knapp, dass sie meine richtige Mutter sei. Richtige Mutter, weil ich dich aufgezogen habe. Es spielt keine Rolle, wer dich zur Welt gebracht hat. Ich habe dich ausgewählt. Ich habe dich unterstützt.
Und das hat sie getan. Sie hat mir die Tränen weggewischt, mir Pausenbrote eingepackt, mich zu Arztterminen gefahren, meine Collegegebühren bezahlt, mir ein Auto gekauft und sogar dabei geholfen, die Anzahlung für das Apartment zusammenzubekommen, um das mich all meine Millennial-Arbeitskollegen beneiden. Sie ist der Grund, aus dem es mir gut geht, und ich brauche die andere Hälfte der Lebensversicherung nicht, auch wenn meine Freundinnen mir raten würden, das Geld zu nehmen und damit einen wilden Partyurlaub zu machen.
Ich schiele auf meine Handtasche, in der eine ausgedruckte E-Mail steckt. In letzter Zeit habe ich darüber nachgedacht zu verreisen … Aber nein, wenn ich diese Reise wirklich mache, dann bezahle ich sie von meinen eigenen Ersparnissen.
Nina ist auf die Versicherungssumme angewiesen, weil Sparen nicht gerade eine Stärke meines Dads war. Verfügbares Geld in leichtsinnige Geschäfte wie die Eröffnung eines Taco-Franchise zu stecken, obwohl es bereits zwei in derselben Gegend gab, und einen Haufen Biotech-Aktien auf Grundlage eines Tipps kaufen, den er beim Mittagessen gehört hatte, das waren die Dinge, in denen er gut war. Auch wenn Mom für den Rest ihres Lebens sauer auf Nina sein sollte, ist es für mich also vollkommen in Ordnung, wenn ich nichts erbe. Es wäre sogar okay für mich, nicht Pat Wilsons richtige Tochter zu sein, wenn das bedeuten würde, dass ich sofort gehen könnte. Der leicht chemische Geruch in diesem Gebäude, die gedämpften Unterhaltungen und der Sarg nebenan lösen ein Jucken zwischen meinen Schulterblättern aus. An dieser ganz bestimmten Stelle, an die ich weder von oben noch von unten drankomme.
»Ellen, meine Güte, ich habe mich gefragt, ob du überhaupt kommst. Wie geht es dir?« Eine dicke Frau mit einem Zinken von einer Nase in einem schwarzen Kleid mit Blumenmuster beugt sich herunter, um meine Mutter zu umarmen. Ich atme eine Wolke Lavendel und Eukalyptus ein, wobei sich mir mein leerer Magen umdreht.
»Ich kann nicht glauben, dass Patrick von uns gegangen ist, und dann auch noch in so jungen Jahren. Es war ein Herzinfarkt, habe ich gehört?«
»Ja, beim Rasenmähen, kannst du dir das vorstellen? Seine Arterien waren vollkommen verstopft. Ich habe ihm immer gesagt, dass er auf seinen Cholesterinspiegel achten soll.«
»Andererseits, wie hätte er das machen sollen, solange er mit dir verheiratet war? Du hast immer die besten Desserts gemacht. Unsere Abendessen, bei denen alle etwas mitbringen, sind seit deiner und Pats Scheidung nicht mehr dieselben. Machst du manchmal noch deine Mousse au Chocolat? Du hast mir schon mal dein Geheimnis verraten, aber ich habe es wieder vergessen.«
»Kälte«, erklärt Mom, offensichtlich froh über die Ablenkung. »Alles muss eiskalt sein. Ich lege sogar den Schneebesen, mit dem ich das Eiweiß schlage, vorher ins Gefrierfach. Das ist übrigens auch der Schlüssel zu einer knusprigen Pie-Kruste. Kalte Butter. Viele Leute vergessen das. Ich habe dieses Kochbuch, auf das ich nichts kommen lasse, auch wenn ich weiß, dass man heute alles online findet.«
»Ich liebe meine Kochbücher auch!«, verkündet die andere Frau.
Die beiden vertiefen sich in eine Unterhaltung über Printkochbücher versus Rezepte aus dem Internet – die Onlineversionen können nicht mithalten.
Da Mom beschäftigt ist und ich Angst habe, dass ich mich wirklich übergeben muss, wenn ich noch länger diesen überwältigenden Parfümgeruch einatme, beschließe ich, mich zu bewegen. Über den Kopf der Frau hinweg deute ich auf meinen so gut wie unberührten Tee und gebe meiner Mutter stumm zu verstehen, dass ich mir einen weiteren holen gehe. Mom schenkt mir ein ermutigendes Lächeln und bedeutet mir mit einer Geste, dass sie verstanden habe.
Ich werfe meinen Becher in den nächsten Mülleimer und schlendere zum Andachtstisch rüber. Neben dem Rahmen mit den vielen Fotos steht ein Monitor, auf dem in Dauerschleife eine Diashow mit Bildern und Videos aus Dads Leben läuft. Nina hat sie zusammengestellt, deswegen wundert es mich nicht, dass ein großer Teil von Dads Leben unterrepräsentiert ist, trotzdem tauche ich auf. Eine Reihe Babybilder von mir sind zu sehen. Dann eine Collage aus Schulfotos: Dad mit einem Baseballschläger in der Hand und mit einem Football. Dad bei einem Leichtathletikwettkampf. Es gibt ein Foto von ihm, auf dem er gegen einen hellblauen Sedan gelehnt steht, und ein anderes beim Abschlussball, gefolgt von einem, auf dem ein junger Patrick seinen Absolventenhut in die Luft wirft.
»Was für eine Schande, die Sache mit Patrick, nicht wahr?«, sagt eine Frau hinter mir. »Er hat kaum eine Sache im Leben richtig hinbekommen, und nun hinterlässt er eine junge Witwe und ein Baby.«
»Er hatte endlich ein Kind, nachdem er es jahrelang probiert hat. Immerhin war er mit einer Sache erfolgreich, bevor er gestorben ist«, erwidert ein Mann.
Ich frage mich, ob Kritik am Verstorbenen Gegenstand normaler Unterhaltungen auf einer Beerdigung ist. Es hat einen schalen Beigeschmack, auch wenn die Aussagen zutreffen.
Nach seiner SMS lud mich Dad damals zum Essen ein. Über einem Teller Nudeln gab er zu, ein schlechter Vater gewesen zu sein, der zudem die meiste Zeit durch Abwesenheit geglänzt hatte. Seine genauen Worte lauteten: Ich hab mich wie ein Vollidiot aufgeführt, als du ein Kind warst, Hara. Ich habe bei dir alles falsch gemacht, und ich denke, dass ich meine Fehler wiedergutmachen sollte, indem ich für meinen Sohn da bin. Ich nickte und sagte ihm, dass das in Ordnung sei. Und selbst wenn es das nicht gewesen wäre, hätte ich es gesagt, denn Dad ist – ich meine, war – ein Verkäufer, und wenn er ahnte, dass ich ihm nicht zustimmte, würde er versuchen, mir seinen Plan »zu verkaufen«. Diese anstrengende Erfahrung wollte ich mir ersparen.
»Hatte er nicht ein Kind aus seiner ersten Ehe?«
»Ich glaube schon, aber kein richtiges. Anscheinend konnte seine erste Frau keine Kinder bekommen. Oder sie hat eins bekommen, bevor sie Pat geheiratet hat, sie hat nämlich eine Tochter. Wie dem auch sei, dies ist sein erstes richtiges Kind. Und Gott sei Dank ist es ein Sohn.«
Ich möchte weitergehen. Es macht keinen Sinn, sich weiter diese Unterhaltung anzuhören. Ich blicke auf meine Füße und befehle ihnen stumm, sich zu bewegen, aber sie scheinen mit dem Boden verwachsen zu sein.
»Als ich gehört habe, dass er ein Baby bekommt, habe ich ihm mein Beileid ausgesprochen. Ich meine, wer will denn bitte mit fünfzig ein Kleinkind zu Hause haben? Aber Pat war vollkommen außer sich vor Freude. Er meinte, dass er die ganzen Milchflaschen-Windel-Geschichten nicht erlebt habe und dass er es nicht erwarten könne.«
»Verrückt. Ich würde mich die nächsten fünf Jahre ins Bad einschließen, wenn mir meine Frau sagen würde, dass sie schwanger ist.«
»Ich auch. Aber Pat hat sich richtig gefreut.« Die Frau gibt einen Ts-ts-Laut von sich. »Sehr schade. Das ist alles so furchtbar tragisch.«
Genug Beerdigung für heute, beschließe ich. Es ist nicht allein die Unterhaltung, die mich nervös macht; außer meiner Mom, Nina und Ryder kenne ich hier niemanden. Ich habe keine Ahnung, in welcher Beziehung diese Leute zu meinem Vater standen. Waren sie Kollegen? Golfpartner? Mitglieder eines Swingerclubs? Ich habe keinen Schimmer, und je länger ich darüber nachdenke, desto stärker werden meine Kopfschmerzen. Wenn ich noch eine Minute in diesem bedrückenden Raum mit seinem blechernen Klassik-Soundtrack und den boshaften Extras bleibe, könnte es sein, dass ich auf einen Tisch klettere und darum bitte, einbalsamiert zu werden.
Ich drehe mich um, um mich von meiner Mutter zu verabschieden, als eine Schar Kolleginnen und Kollegen von mir durch die Tür kommt und mir so den Fluchtweg versperrt.
»Hara, meine Güte, wie geht es dir?« Meine Vorgesetzte, Lisa, schließt mich in die Arme, bevor ich es verhindern kann. »Warum hast du uns nicht gesagt, wann die Beerdigung von deinem Vater ist? Wenn Kelly nicht zufällig den Nachruf gelesen hätte, hätten wir es nie erfahren!«
Kelly, die hinter Lisa steht, zuckt zusammen und formt mit den Lippen ein stummes »Sorry«. Immerhin weiß sie, dass ich mit Absicht nichts gesagt habe. Ich hasse es, im Rampenlicht zu stehen, egal in welcher Hinsicht. Manchmal fragen mich Leute, ob ich gerne selbst schreiben würde, aber das will ich nicht. Ich bin glücklicher als Lektorin, die auf Details achtet, denn als Autorin eines Werkes, bei dem mein Name in der Verfasserzeile steht. Es hat etwas Sicheres und Geborgenes, hinter den Kulissen zu arbeiten.
»Ich kann nicht glauben, dass du gestern zur Arbeit gekommen bist. Du hättest mir sagen sollen, dass dein Vater gestorben ist. Ich hätte dir zwei weitere Tage Urlaub gegeben.« Lisa gibt sich mütterlich. »Wir haben Blumen mitgebracht. Jeffrey, wo bist du?«
»Hier. Wir sind draußen deiner Schwester begegnet.« Er drückt mir ein Bouquet mit Lilien in die Hand.
»Schwester?« Ich habe keine Schwester.
»Das war ich.« Boyoung Kim tritt hinter meinen Kolleginnen und Kollegen hervor und hebt eine Hand.
»Ihr seid keine Geschwister?«, fragt Jeff. »Seid ihr nicht beide Chin…«
»Koreanerinnen«, unterbricht ihn Kelly. Mit einem Blick fleht sie mich an, das nicht weiter zu kommentieren. Wir wissen beide, dass Jeff eher in die Kategorie der Ignoranten denn der Arschlöcher fällt. »Die beiden sehen sich kein bisschen ähnlich. Hey, Boyoung, schön dich wiederzusehen.«
»Es tut mir so leid, Hara.« Boyoung senkt den Kopf und reicht mir einen weißen Umschlag. Dabei streckt sie eine Hand aus, während sie mit der anderen ihren Ellbogen stützt. Eine koreanische Höflichkeitsgeste, die ich Boyoung schon bei vielen Gelegenheiten habe ausführen sehen. Unter anderem an der Supermarktkasse, wenn sie ihre Kreditkarte zum Bezahlen überreicht.
»Dann seid ihr so was wie Cousinen? Aus Korea?«
»Sie sind nicht verwandt«, zischt Kelly. »Na los, lass uns reingehen.« Sie packt Jeff am Arm und zerrt ihn hinter sich her.
Während sie sich entfernen, höre ich Jeff fragen: »Sie sehen sich ähnlich und sind beide aus Korea. Ich meine, das ist doch ein Riesenzufall, oder?«
Boyoung und ich tauschen ein trockenes Grinsen. Es ist nicht das erste Mal, dass wir als Schwestern bezeichnet werden, dabei kennen wir uns noch gar nicht so lange; leider sehen wir Asiaten für die meisten Leute hier in der Gegend alle gleich aus, obwohl Boyoung und ich uns nicht mehr unterscheiden könnten, wenn eine von uns gestreift und die andere gepunktet wäre.
Boyoung ist klein, sie reicht mir gerade bis zur Nase. Sie hat große Augen, die sie immer ein wenig so aussehen lassen, als sei sie überrascht. Einmal hat sie mir gestanden, dass sie sich manchmal überlegt, sich die Lider operieren zu lassen, weil jeder sie für sehr viel jünger als sechsundzwanzig hält. Sie trägt die Haare in einem kinnlangen Bob. Ihre Unterlippe ist im Gegensatz zu ihrer Oberlippe sehr schmal und tendiert dazu, ganz zu verschwinden, wenn sie keinen Lipgloss trägt.
Mit meinen fast ein Meter siebzig bin ich ziemlich groß für eine Koreanerin. Meine Haare sind lang und dick, und manchmal, wenn ich die Energie dafür übrig habe, drehe ich sie mit dem Lockenstab zu Beach Waves. Ich habe wirklich viel Haar. Meine Augen haben eine Falte, worum mich Boyoung beneidet. Sie sind nicht mandelförmig – ich kenne keinen Asiaten, dessen Augen mandelförmig sind, und ich habe keinen Schimmer, wie dieses Gerücht entstanden ist –, nahe meinem Nasenrücken sind sie leicht nach innen geschwungen. Boyoung behauptet, dass sie wie die Augen eines Drachen aussehen. Sie hat immer die nettesten Umschreibungen für meine Gesichtszüge.
»Die Vorlesung hat länger gedauert, deswegen konnte ich nicht früher kommen«, erklärt meine Freundin, während sie mir weiterhin den Umschlag hinhält.
Widerwillig nehme ich das Geld an. Boyoung ist klein und spricht leise, aber es gibt bestimmte Dinge, die für sie unumstößlich sind, und dazu gehören Geschenke. In Korea ist es Tradition, zu jeder Gelegenheit ein Geschenk mitzubringen.
»Danke, dass du überhaupt gekommen bist.« Ich gehe rein, um das Geschenk und die Blumen auf dem Andachtstisch abzulegen. »Das hättest du nicht tun müssen.«
»Ich wollte aber. Geht es dir gut?« Boyoung legt den Kopf leicht schräg, sodass ihre glänzenden schwarzen Haare zur Seite rutschen wie ein dunkler Vorhang.
»Hab ich was im Gesicht? Meinen Eyeliner, oder?« Vielleicht hat meine Mutter bei ihrer Wegwischaktion nicht alles erwischt. Augen-Make-up aufzutragen, ist für mich bis heute ein Buch mit sieben Siegeln. In anderen Dingen bin ich nicht schlecht. Mein Apfelkuchen ist der Hammer. Und ich bin eine ziemlich gute Lektorin. Ich habe festgestellt, dass mein langer Oberkörper und meine kurzen Beine super in hochtaillierten Hosen aussehen. Ich weiß ganz genau, welche Lippenstiftfarbe perfekt zu meinem Teint passt. Letzteres herauszufinden, hat mich fünf Jahre und Hunderte Dollar gekostet. Aber das Augen-Make-up bleibt mir ein Mysterium. Irgendwann muss ich Boyoung um Hilfe dabei bitten. Ihr Lidstrich ist mörderisch.
»Nein. Nein. Es ist ein …« Sie reibt mit einem Finger unter ihrem Auge herum.
»Fleck?«, schlage ich mit einem Lächeln vor. Ich weiß, dass sie gerne neue Worte lernt.
»Ja, ein Fleck«, ruft sie, ein wenig lauter als gewöhnlich.
Einige Köpfe drehen sich in unsere Richtung. Boyoung zuckt zusammen, aber mir ist es egal. Ich bin froh, dass sie hier ist. Es hat etwas Tröstliches, nicht die einzige Asiatin im Raum zu sein. Dadurch fühle ich mich weniger alleine hier. Auf der Beerdigung meines Vaters.
KAPITEL ZWEI
»Du solltest irgendwo hinfahren«, sagt Kelly und zieht an ihrer Vape. »Bermudainseln oder so. Sonderurlaub im Trauerfall sollte heißen, dass man eine Woche lang Ferien machen kann, wo man will.«
»Ich würde nach Vail in Colorado fahren«, sagt Jeff.
»Es ist Mai, Jeff«, erinnert ihn Kelly.
»Na und? Sterben im Winter etwa keine Leute?« Er beugt sich vor und nimmt ihr die Juul aus der Hand. Die beiden streiten sich so häufig, dass ich manchmal vergesse, dass sie ein Paar sind.
Kelly verdreht die Augen und wendet sich an den Rest von uns. »Zum hundertsten Mal: Bitte entschuldigt Jeffs primitive Aussagen.«
Ich bin daran gewöhnt, und falls es Boyoung stört, zeigt sie es auf jeden Fall nicht. Sie ist damit beschäftigt, jemandem zu texten.
Nach der Beerdigung sind wir zu viert bei Denny’s gelandet, nachdem wir einstimmig der Meinung gewesen waren, dass im Haus eines Verstorbenen zu essen schlimmer ist, als zu verhungern. Die Überbleibsel unseres Pancake-Frühstücks haben wir in die Tischmitte geschoben.
»Wo würdest du hinfahren, Boyoung?«
»In den Urlaub?« Sie sieht von ihrem Handy auf. »Vielleicht nach Hawaii?«, antwortet sie zögerlich. Falls sie sich wundert, dass wir über Post-Beerdigungs-Reisen sprechen, lässt sie es sich nicht anmerken.
Ich frage mich, wie Beerdigungen in Korea ablaufen. Gibt es eine Totenwache? Eine Erdbestattung? Sargträger? Als in der Highschool die Tante einer jüdischen Freundin von mir starb, hat die Trauerfeier eine ganze Woche gedauert.
»Zwei für Sonne …«
»Und einer für Spaß«, fällt Jeff Kelly ins Wort.
Sie ignoriert ihn und sieht stattdessen mich an. »Wo würdest du Urlaub machen?«
»Korea.« Ich platze mit dem Wort raus, ohne lange darüber nachgedacht zu haben.
»Korea?«, wiederholen die anderen drei synchron.
Ihre Überraschung wundert mich. Ich sehe mich in der Runde um. »Was? Warum kann ich nicht in Korea Urlaub machen?«
»Du hast noch nie erwähnt, dass du mal nach Korea möchtest«, sagt Kelly und nimmt Jeff die Juul aus der Hand.
»Ich weiß. Es ist nur so eine Idee.« Eine, die ich anscheinend nicht mehr aus dem Kopf bekomme.
»Warum ausgerechnet dahin?« Jeff runzelt die Stirn.
»Weil sie von dort stammt, du Idiot.« Kelly schnippt gegen Jeffs Ohrläppchen.
»Aber du hast keine Ahnung von Korea, oder Hara? Aua, das tut weh, Kells!« Jeff reibt sich den Bizeps – gegen den ihn Kelly geboxt hat, nachdem sie sein Ohr malträtiert hat. »Wisst ihr noch das eine Mal, als ich sie gefragt hab, wann der Koreakrieg vorbei war, und ihr mir alle beinahe ins Gesicht gesprungen seid, so nach dem Motto, das sei rassistisch und ich könne sie nicht als Lexikon missbrauchen und dass nur, weil sie Koreanerin ist, das nicht heißt, dass sie etwas über Korea wissen muss?«
»Du kannst nicht automatisch vom einen aufs andere schließen«, erwidere ich ein klein wenig bissig, und vielleicht liegt es daran, dass Jeff mich langsam nervt, oder meine abwehrende Reaktion rührt daher, dass er recht hat. Ich habe keine Ahnung von Korea. Als ich letztens was im Internet nachsehen wollte, ist mir klar geworden, dass ich nicht mal einen Satz auf Koreanisch eingeben kann, weil ich keine koreanische Tastatur auf meinem Computer habe. Mein Wissen über mein Geburtsland würde kaum einen Fingerhut füllen.
»Nur weil Hara koreanisch aussieht, heißt das nicht, dass sie eine richtige Koreanerin ist. Nicht so wie Boyoung«, sagt Kelly. »Hara ist Amerikanerin.«
Autsch. Schon wieder die Sache mit dem »richtig«. Aber habe ich wirklich das Recht, deswegen sauer auf Kelly zu sein, wenn ich selbst immer versucht habe, mich so weit wie möglich von meinem Asiatisch-Sein zu trennen? Ich werde häufig genug gefragt, wo ich herkomme, und meine Antwort lautet jedes Mal »von hier«, was nie ausreicht, weil »von hier« nicht die Antwort ist, die die Menschen, die diese Frage stellen, hören wollen. Die Frage hat einen Kontext, der lautet: »Du siehst anders aus als ich, also musst du woanders herkommen.« Mir ist vollkommen klar, wie die Frage gemeint ist, aber ich hasse sie, also wiederhole ich stumpf meine Antwort. Ich komme von hier. Aus Iowa. Aus Amerika. Genau wie du. Außerdem fühle ich mich nicht koreanisch – wie auch immer sich das anfühlen soll –, aber ich weiß, dass die Unterschiede zu Boyoung deutlich sind.
Es geht nicht um die Sprache. Boyoung unterscheidet sich grundsätzlich von mir, angefangen bei der Art, wie sie sich kleidet (immer sehr schick), über ihr professionelles Make-up (ich habe versucht, Boyoungs Eyeliner-Technik anzuwenden, was dazu geführt hat, dass ich aussah, als hätte ich ein blaues Auge), bis hin zu ihren Manieren (zeige beim Lachen, Essen oder Lächeln niemals deine Zähne). Um ehrlich zu sein, habe ich gar nicht gewusst, wie wenig koreanisch ich tatsächlich bin, bis ich Boyoung kennengelernt habe.
»Ich wusste nicht, dass du nach Korea willst«, sagt Boyoung leise.
»Wie gesagt, nur so ein Gedanke.« Ein Gedanke, der von einer überraschenden E-Mail, dem plötzlichen Tod meines Vaters und dieser Unsicherheit, die mich schon viel zu lange umtreibt, herrührt. Es ist, als ob mein Leben eine frühere Lieblingsjacke von mir ist, die ich zu heiß gewaschen habe und die deswegen jetzt an den Oberarmen spannt und bei der außerdem der Reißverschluss klemmt. Es bedeutet nicht, dass die Jacke auf jeden Fall richtig sitzen wird, wenn ich nach Korea reise, aber vielleicht ist es an der Zeit, einen Versuch zu wagen.
»Was würdest du da machen?«, fragt Jeff. Er ist verwirrt. »Ich hab mal ein Video gesehen, auf dem die noch lebenden Tintenfisch essen.«
»Der hat nicht mehr gelebt.« Ich habe dasselbe Video gesehen, das in den sozialen Medien die Runde macht. Darin wird Sojasoße auf einen toten Tintenfisch gegossen, und wegen irgendeiner chemischen Reaktion zwischen dem Salz und dem Kopffüßer bewegt er sich in der Schlüssel, aber aufgrund der Reaktionen auf das Video meint man, es hätte das reinste Massaker stattgefunden.
»Das war japanisch«, murmelt Boyoung.
»Was?«
»Sie hat gesagt, dass es ein japanisches Video war«, wiederholt Kelly genervt. »Asien ist nicht gleich Asien, aber in gewisser Weise hat Jeff vielleicht recht. Du sprichst kein Koreanisch, oder?«
Boyoung versteift sich merklich.
»Oder doch?«
»Nein.« Meine Freundin entspannt sich wieder. Ich klopfe ihr beruhigend die Schulter. »Keine Angst, ich hab kein Wort von einem deiner Telefonate verstanden.« Nicht, dass ich sie so viel auf Koreanisch hätte telefonieren hören, aber ein paarmal ist es vorgekommen, dass ich dabei war, wenn sie mit jemandem in Korea gesprochen hat. Ich habe keine Ahnung, ob dort alle so schnell reden wie sie, aber ich könnte nicht mal sagen, wo die Sätze anfangen oder aufhören.
»Wie würdest du dich zurechtfinden? Wie würdest du was bestellen oder nach dem Klo fragen?«
»Alles gute Fragen«, antworte ich Kelly.
»Und?«
»In der U-Bahn gibt es auch Beschilderungen auf Englisch«, kommt mir Boyoung zu Hilfe. »Und in touristischen Gegenden laufen Helfer rum, die Englisch und Chinesisch sprechen. In vielen Restaurants gibt es Speisekarten auf Englisch, und in Itaewon leben viele … Wie sagt ihr dazu noch mal? Expats?«
Jeff klatscht in die Hände. »Vielleicht sollten wir alle hinfliegen.«
»Wohin?«
»Korea.« Jetzt ist es an Jeff, genervt zu klingen. »Wir machen alle zusammen da Urlaub, und danach darf mich keine von euch mehr als ignorant bezeichnen.«
»Das kann ich mir nicht leisten«, jammert Kelly und rutscht so weit auf der Sitzbank herunter, dass sich ihre Schultern auf Höhe mit der Tischkante befinden. »Ist Korea nicht teuer, Boyoung?«
»Nein. Essen kann günstig oder teuer sein, je nachdem, wo man hingeht. Das ist genau wie mit den Wohnungen. In Seoul gibt es sowohl arme als auch sehr reiche Viertel.«
»Wie ist es dort?«, fragt Jeff.
Wir alle beugen uns neugierig vor.
Boyoung schweigt eine ganze Weile, bevor sie sagt: »Schön.«
Und einfach so fügt sich ein frei schwebendes Teil meines Herzens mit einem hörbaren Klick an die richtige Stelle.
Einen Monat nach der »Hey Sportsfreundin«-SMS habe ich mich bei einem DNA-Analyse-Service angemeldet. Kelly war an dem Tag in die Arbeit gekommen und hatte verkündet, laut den Ergebnissen des DNA-Tests, den sie hatte vornehmen lassen, zu einem Sechzehntel Inuit zu sein und eventuell Cousins und Cousinen zweiten Grades in Kanada zu haben. Sie war total aufgeregt und riet mir, auch einen Test zu machen, um herauszufinden, aus welchem Genmaterial ich bestehe, und sei es nur aus gesundheitlichen Gründen. Ich hatte ihr mal erzählt, dass ich mit dem Ausfüllen der Formulare beim Arzt immer total schnell bin, weil ich keine der Fragen zur Familienhistorie beantworten kann. Als ich noch ein Kind gewesen war, hatte meine Mutter überlegt, mein Erbgut untersuchen zu lassen, aber Dad hatte behauptet, das sei zu teuer. Nach der Scheidung hatte Mom andere Sorgen, und das Thema war nie wieder aufgekommen.
Aber mit vierundzwanzig war ich neugierig, also nahm ich einen Abstrich vom Inneren meiner Wange und schickte ihn an ein Labor. Ein paar Wochen später kam ein Umschlag mit den Ergebnissen, die mir bescheinigten, zu 98,2 Prozent koreanischer und zu 1,8 Prozent japanischer Abstammung zu sein. Es gab keine genetischen Warnzeichen und keinerlei Hinweis auf Übereinstimmungen mit DNA-Ergebnissen einer Person anderswo auf der Welt. Ich war ein wenig enttäuscht. Ich wollte es nicht zugeben, aber tatsächlich hatte ich gehofft, dass es vielleicht irgendwo einen weit entfernten Verwandten gab, der sich ebenfalls in die Datenbank hatte eintragen lassen. Ich hatte gelesen, dass sich adoptierte Geschwister wiedergefunden hatten, von denen einer in den USA und der andere in Frankreich lebte. Eine französische Schwester zu haben wäre toll. Ich wollte schon immer mal nach Frankreich. Aber es waren nun mal keine verschollenen Geschwister gefunden worden, also begrub ich meine Erwartungen in der gedanklichen Kiste mit der Aufschrift »Dinge, die ich besser vergessen sollte« – zusammen mit dem Traum meines Vaters, dass ich mich als Ausnahmeathletin herausstellen würde, und der Fantasie meiner Mutter, ich könnte die nächste Gillian Flynn sein.
Die Wahrheit ist, dass ich eher tollpatschig bin, meine Tage damit verbringe, Fakten zu überprüfen und zu lektorieren und eine größere Chance habe, im Lotto zu gewinnen, als Informationen über meine biologische Familie zutage zu fördern. Es ist nicht so, dass ich etwas über die Leute wissen möchte, die mich vor fünfundzwanzig Jahren an einer Straßenecke in Seoul ausgesetzt haben. Ich bin nur … neugierig, ob ich Geschwister habe. Vielleicht Tanten und Onkel. Ich bin als Einzelkind eines Einzelkindes aufgewachsen. Die Mutter meiner Mom ist vor vierzehn Jahren gestorben, und es waren immer nur wir zwei gegen den Rest der Welt, seit Mom Dad rausgeschmissen hat. Zu wissen, dass ich eine erweiterte Familie habe, wäre cool, oder zumindest versuche ich, es so vor mir selbst zu begründen. Und als nichts daraus wurde, als sich keine Nachrichten in meinem Postfach befanden, als aus Wochen des Schweigens Monate und schließlich ein Jahr wurden, hatte ich es irgendwann so gut wie vergessen.
Bis zu jenem Morgen vor drei Monaten, als ich eine E-Mail zwischen viel zu vielen Newslettern entdeckte, von denen ich mich nicht erinnern kann, sie jemals abonniert zu haben, und den Spam-Nachrichten, die trotz des sogenannten Filters in meiner Inbox landen. Ich brauchte einen Moment, bevor ich kapierte, dass die Betreffzeile in Hangul verfasst war und es keine willkürliche Reihung von Buchstaben war, die meinen Spam-Filter überlisten sollte. Ich kopierte den Satz in ein Übersetzungsprogramm im Internet, aber die englischen Worte, die dabei herauskamen, ergaben keinen wirklichen Sinn. Nach einer kurzen Recherche erfuhr ich, dass digitale Übersetzungen ungenau und irreführend seien. Zusammengefasst, ich konnte mich nicht darauf verlassen.
Aber ich kannte auch keine menschlichen Übersetzer. Ich lebte in Des Moines in Iowa, einer so homogenen Stadt, dass mit meiner Adoption der Anteil der asiatischstämmigen Einwohner vermutlich um einen ganzen Prozentpunkt angestiegen war.
Das war, bevor ich in einem Café in der Nähe meines Büros Boyoung begegnete. Nachdem ich sie kennengelernt hatte, kam es mir falsch vor, gleich beim ersten Treffen – oder auch beim sechsten – die E-Mail aus der Tasche zu ziehen. Hey, neue Bekannte, die von der anderen Seite des Ozeans kommt, wir kennen uns zwar kaum, aber könntest du vielleicht das hier für mich übersetzen? Es schien mir unhöflich, also hab ich sie nie darum gebeten. Bis jetzt.
KAPITEL DREI
Es vergeht eine weitere Woche, bevor ich es schaffe, mich mit Boyoung zum Mittagessen zu verabreden. Ich rede mir ein, dass es nicht daran liegt, dass ich Angst vor dem Inhalt der E-Mail habe, sondern dass ich eine angemessene Trauerzeit einhalte, um nach dem Tod meines Vaters keine überhasteten Entscheidungen zu treffen. Ich belüge mich also nicht selbst, sondern betreibe Selbstfürsorge.
Ich bin dreißig Minuten zu früh in der Einkaufspassage, weil ich vor Panik halb durchdrehe. Ich weiß nicht, ob ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Schon seit Tagen schwanke ich zwischen zwei Redewendungen: »Unwissenheit ist ein Segen« und »Wissen bedeutet Macht«. Letztere gewinnt in der Regel die Oberhand; vor allem aus dem Grund, dass ich bereits ein paar Dinge weiß. Meine Unwissenheit hat einen Riss, seit ich die E-Mail in meinem Posteingang entdeckt habe. Oder vielleicht seit ich ihren Inhalt ins Übersetzungsprogramm eingegeben habe. Was ich glaube zu wissen, nagt an mir. Die Redewendung sollte »Umfassendes Wissen bedeutet Macht« lauten; Halbwissen treibt einen nämlich lediglich an den Rand des Wahnsinns.
Ich versuche, die Zeit rumzubringen, indem ich durch die Geschäfte in der Nähe des Restaurants schlendere. Vor allem der Kosmetikladen hat es mir angetan.
»Möchten Sie ein Cut-Crease-Tutorial?«, fragt mich eine ambitionierte Mitarbeiterin. »Es ist kostenlos.«
Wer würde ein kostenloses Angebot ausschlagen? Ich zumindest nicht.
»Ja klar, gerne.«
»Gibt es einen bestimmten Look, den Sie gerne einmal ausprobieren würden? Zum Ausgehen oder für die Arbeit?«, fragt mich die Verkäuferin, während sie mich zu einem Kosmetiktisch führt.
»Ich bin ziemlich hilflos im Umgang mit Lidschatten. Ich glaube, ich weiß nicht mal wirklich, was ein Cut Crease ist.« Ich klettere auf den Stuhl, der vor einem hell erleuchteten Spiegel steht. Bei meinem Anblick stelle ich fest, dass er zu gut beleuchtet ist. Ich kann die Poren in meiner Nase zählen.
»Oh, ein Cut Crease ist für Sie perfekt, da Ihre Lidfalte nicht besonders ausgeprägt ist. Mit einem Cut Crease können Sie Definition erzielen, indem Sie auf Farben setzen.« Die Verkäuferin sucht ein paar Utensilien zusammen, trägt dann eine Grundierung auf und beginnt anschließend damit, mit einem kleinen Applikator Farbe auf meine Lider aufzutragen. »Haben Sie eine Verabredung? Oder ist es was Berufliches? Schließen Sie die Augen.«
»Ich treffe mich mit einer Freundin«, antworte ich, während ich die Lider senke.
»Cool. Sie wird sie beneiden. Dieses Braun steht Ihnen fantastisch. Okay, öffnen Sie die Augen.«
Ich will gerade tun, wie mir befohlen, als die Frau hastig sagt: »Stopp! Sorry, doch noch nicht.«
Der Prozess nimmt ein paar weitere Minuten in Anspruch. Die Verkäuferin murmelt vor sich hin, dann spüre ich, wie sie mit einem feuchten Wattebausch über meine Lider fährt.
»Ich glaube, das Braun war doch nicht die richtige Farbe. Ich probiere was anderes aus.«
Ich muss mein Spiegelbild nicht sehen, um die Bestätigung zu bekommen, dass das hier nicht gut für mich läuft, aber ich tue es trotzdem. Die Farbe, die jeder anderen Person garantiert hervorragend gestanden hätte, lässt mich aussehen, als hätte man mir mit der Faust ins Gesicht geschlagen.
Die Verkäuferin begegnet meinem Blick im Spiegel. »Tut mir leid.« Sie verzieht entschuldigend das Gesicht. »Lassen Sie es mich noch mal versuchen. Diese Farbe hier passt normalerweise gut zu jedem Teint. Wenn Sie …«
Ich winke ab. »Schon gut. Ich muss sowieso los.«
Was stimmt. Inzwischen wartet Boyoung wahrscheinlich schon auf mich. Sie ist immer pünktlich.
Am Empfang des Tofu begrüßt mich eine Kellnerin mit einem koreanischen Hallo. Annyeonghaseyo. Ich versuche, den Gruß zu erwidern, aber ausgehend von der amüsierten Miene der jungen Frau liege ich mit der Aussprache mal wieder gründlich daneben. In dieser Stadt leben vielleicht gerade mal eine Handvoll asiatischstämmiger Menschen, und ich habe es geschafft, mich vor jedem einzelnen von ihnen zu blamieren.
Boyoung sitzt an einem Tisch in der Nähe des Fensters, das zum Parkplatz rausgeht. Ein leichtes Lächeln umspielt ihre Lippen.
»Hast du das gehört?« Ich setze mich ihr gegenüber.
Boyoung nickt. »Deine Aussprache wird besser«, flunkert sie.
»Sie ist schrecklich, aber danke, dass du mich nicht auslachst. Irgendwann werde ich es schaffen, das Wort perfekt auszusprechen. Und wenn es das einzige Wort ist, das ich jemals auf Koreanisch kann, ich werde wie eine Muttersprachlerin klingen, wenn ich es sage.«
»Das stimmt nicht. Du klingst wie eine Muttersprachlerin, wenn du ottoke und ppalli ppalli sagst.«
»›Was soll ich tun‹ und ›beeil dich‹ – ich würde mich ohne Probleme in Seoul zurechtfinden«, witzele ich.
Boyoung muss kichern. Schnell hebt sie eine Hand vor den Mund.
»Wie war’s in der Uni?«, erkundige ich mich, während wir auf unsere Pizza warten.
Pizza ist Boyoungs Lieblingsessen, aber sie mag sie nur in diesem koreanischen Restaurant, in dem es das beste frittierte Hühnchen und eine superkäsige Pizza aus dem Holzofen gibt. In Korea schmeckt die Pizza ganz anders, wiederholt Boyoung jedes Mal. In den Monaten, seit ich sie kenne, war sie jede Woche mindestens einmal Pizza essen, und zwar immer die gleiche: Ananas, Käse, Schinken.
»Gut. Ich hab meine Stipendienunterlagen beinahe fertig.«
Boyoung nimmt an einem kulturellen Bildungsaustausch des örtlichen College teil. Ein neues Programm für Studenten der höheren Semester, das diesen Frühling gestartet ist; meine koreanische Freundin war eine der ersten Teilnehmerinnen. Wenn Boyoung über ihr Projekt spricht, fühle ich mich jedes Mal wie eine stolze Mutter. Sie ist aus Korea hergekommen, um hier, im Mittleren Westen der USA, ein College zu besuchen.
Boyoung fasziniert mich. Ich kenne nur wenige Koreanerinnen und Koreaner. Da ist das Paar, dem einer der drei asiatischen Supermärkte in der Stadt gehört. Ich bin immer ein wenig verlegen, wenn ich den Laden betrete, weil ich bei der Hälfte der Produkte, die in den Regalen stehen, keine Ahnung habe, um was es sich dabei handelt. Mithilfe des Internets habe ich versucht zu entschlüsseln, was Mom mir gekocht hat, als ich jünger war, wie zum Beispiel das Gericht mit Fadennudeln, getrockneten Pilzen und kimchi-jjigae in einer Brühe aus getrockneten Sardellen und Algen – was schrecklich klingt, aber eines meiner Lieblingsgerichte ist. Ich war mit Boyoung in dem Laden, und sie hat mir eine Menge Dinge erklärt und sogar ein paar Zutaten gekauft, damit ich sie probieren kann. Eine bestimmte Ramen-Sorte sei die beste, meinte sie, und ob ich sie schon mal mit Käse gegessen hätte? Nein, nie, und sie war beinahe schockierend gut. Mikrowellenreis schlägt Instantreis um Längen. Das Currygemüse aus der Kühltheke ist gar nicht mal so schlecht. Außerdem hat sie mich in die Welt des koreanischen Theaters eingeführt, und ich habe die beiden Serien Kingdom und Signal konsumiert wie Drogen. Was sie in gewisser Hinsicht sicher auch sind. Mit jeder Minute, die ich mit Boyoung verbringe, bereue ich mehr, wie ich mich aufgeführt habe, als ich jünger, unreifer und, nun ja, dümmer war.
Als Kind nahm mich Mom mit zu koreanischen Kulturprogrammen in Minneapolis. Oder vielmehr, sie schleppte mich dorthin. Ich hasste diese Veranstaltungen, und die gesamten fünf Stunden – oder wie lange auch immer die Fahrt dorthin gedauert haben mochte – tat ich so, als ob ich es interessanter fände, im Vorbeifahren Kühe zu zählen, als auf eine von Moms Bemühungen einzugehen, eine Unterhaltung mit mir zu führen. Ich hab mich aufgeführt wie ein verzogenes Gör. Die Musik, die auf den Veranstaltungen gespielt wurde, klang seltsam und fremd. Der Geruch des Essens schien noch Tage später in meiner Kleidung zu hängen. Wenn ich in der Schule gefragt wurde, was ich am Wochenende gemacht hatte, log ich. Das Traurige war, dass diese Veranstaltungen die einzigen waren, bei denen ich von Menschen umgeben war, die wie ich aussahen. Ich hätte mich also wohler dort fühlen sollen, aber es erinnerte mich nur daran, wie sehr ich mich von meinen Freundinnen und Freunden unterschied. Irgendwann hörte Mom damit auf, mich hinzuschleppen.
Ich hatte mit voller Absicht meine Augen und Ohren verschlossen, und nun bezahlte ich dafür. Wäre ich weiter zu den Kulturveranstaltungen gegangen, hätte ich vielleicht ein wenig Koreanisch gelernt und müsste Boyoung heute nicht um Hilfe bitten.
Aber so ist es nun mal, also greife ich in meine Tasche und nehme die E-Mail heraus, die ich heute ausgedruckt habe. Den alten Ausdruck habe ich so lange mit mir rumgeschleppt, dass er vor lauter Knicken kaum noch lesbar war. Aber Boyoung muss alle Zeichen lesen können. Es ist wichtig, dass ihre Übersetzung perfekt ist.
»Ich muss dich um einen Gefallen bitten.«
»Natürlich.« Mit einem Lächeln bedeutet sie mir weiterzureden.
Ich hole tief Luft und lege das Blatt Papier vor sie auf den Tisch. Ich habe keine Ahnung, warum ich so nervös bin, aber ich bin froh, dass ich noch keine Pizza im Magen habe. Vermutlich würde sie mir sonst wieder hochkommen.
»Es geht um eine Übersetzung. Ich hab versucht, online was rauszufinden, aber du hast mal gesagt, dass die maschinellen Übersetzungen nicht verlässlich sind, also … Würde es dir was ausmachen?«
»Nein, überhaupt nicht.« Sie nimmt den Ausdruck in die Hand und überfliegt den Inhalt.
Die E-Mail ist kurz, sie besteht lediglich aus ein paar Sätzen. Während Boyoung liest, gehe ich im Kopf die Übersetzung aus dem Internet durch. Ich weiß, dass sie fertig ist, als ihr die Kinnlade runterklappt und sie ihre großen braunen Augen aufreißt. Seltsamerweise beruhigt mich ihre Reaktion. Es bedeutet, dass meine eigene Übersetzung inhaltlich von ihrer nicht allzu stark abweicht.
»Die Mail ist von meinem Vater. Meinem leiblichen Vater, oder?«
Meine Freundin nickt langsam und stammelt: »Wie hast du … Wo … Wann …« Sie klingt genauso verwirrt und überrascht, wie ich mich gefühlt habe, als ich die Mail in meinem Posteingang gesehen habe.
»Vor einer Weile …«, beginne ich vage und breche ab. Es fällt mir schwer zuzugeben, dass mich Pats Ankündigung, ein leibliches Kind zu erwarten, in meinem Alter in Panik versetzt hat. »Vor einer Weile habe ich mich bei einem DNA-Service im Internet registriert. Wo man herausfinden kann, ob irgendwo in der Welt jemand mit einer ähnlichen DNA lebt. Man schickt eine Speichelprobe und alle Infos hin, die man zu seiner Adoption hat, und wenn beide Parteien dem vorher zugestimmt haben, wird man kontaktiert, wenn es eine Übereinstimmung mit einer anderen Person in der Datenbank gibt. Ich hab zuerst keine Rückmeldung bekommen, deswegen dachte ich, dass es entweder keine Übereinstimmung gibt oder meine leiblichen Eltern einer Kontaktaufnahme nicht zugestimmt haben.« Ich ziehe das Blatt Papier unter Boyoungs Hand weg und fahre mit dem Finger über das Schriftzeichen am Ende. Lee Jonghyung. Der Name meines Vaters. Meines leiblichen Vaters. Mein Hirn setzt das Adjektiv jedes Mal nachträglich an die Stelle, als könnte ich es sonst vergessen. Meine Mutter würde ihn als »Samenspender« bezeichnen. »Ich dachte, dass es keine Übereinstimmung gibt, weil sie mich … na ja … ausgesetzt haben.«
Boyoung nickt wieder. Kurz nachdem sie meine Mutter kennengelernt hatte, hab ich ihr meine Geschichte erzählt. Ihre Augen waren voller Fragen gewesen, aber sie war zu höflich, zu gut erzogen, um auch nur eine einzige davon zu stellen; ganz im Gegensatz zu Jeff, der einmal quer durch den Pausenraum gebrüllt hatte, aus welchem Babyautomaten Ellen mich eigentlich gezogen habe. Dafür gab es eine Verwarnung, aber ich sagte der Personalabteilung, dass es kein Problem sei. Was es tatsächlich nicht war. Es war nicht die erste dämliche Frage, die mir im Laufe der Jahre über meine Beziehung zu Ellen gestellt worden war. Es machte mir nichts aus. Nicht wirklich. Oder zumindest nicht viel. Doch während ich Jeff niemals die Umstände meiner Adoption offenbaren würde, sprudelten die Worte bei Boyoung geradezu aus mir heraus. Nach einem Abendessen bei mir zu Hause holten wir uns noch ein Eis, und bei einem riesigen Bananensplit erzählte ich ihr, dass man mich, als ich nur wenige Wochen alt gewesen war, in der Nähe einer Polizeistation in Mapo-gu zurückgelassen hatte. Ein lebhafter und zentral gelegener Stadtteil Seouls. Ein Polizist fand mich und brachte mich in ein Waisenhaus, von dem ich in eine Pflegefamilie gegeben wurde. Dort blieb ich, bis ich mit einem Jahr von den Wilsons adoptiert wurde.
»Dein abeoji, ich meine, dein Vater hat zugestimmt, dass diese Information an dich weitergegeben wird?« Boyoungs helle Stimme rutscht vor lauter Unglauben noch eine Oktave höher. Sie räuspert sich. »Du solltest vorsichtig sein. Ich liebe mein Land, aber schlechte Menschen gibt es überall. Vielleicht will dich dieser Mann nur ausnutzen. Viele Leute in Korea denken, dass alle aus dem Westen reich sind, vor allem Amerikaner.«
»Er hat nicht zugestimmt. Er hat sich nicht selbst an mich gewendet. Es gab ein Datenleck, deswegen hat mir das System seinen Namen und seine Kontaktinformation geschickt.«
Lee Jonghyung. Das würde bedeuten, ich bin eine Lee. Hara Lee klingt ziemlich asiatisch. Um genau zu sein, müsste es Lee Hara heißen. Boyoung hat mir erklärt, dass der Nachname – der Clan-Name einer Person – immer zuerst genannt wird, weil dies dem konfuzianischen Ideal entspricht. Die Familie steht an erster Stelle. Aber offensichtlich nicht immer. Sonst hätte man mich nicht an einer Straßenecke ausgesetzt, und ich wäre nicht adoptiert worden. Manchmal steht also jeder Mensch – und jedes Kind – für sich selbst.
Ich bin weder verbittert noch nachtragend. Ich habe kein Recht dazu. Ich habe eine großartige Mutter. Ich habe einen Job, ein Apartment, ein zehn Jahre altes Auto, eine gute Krankenversicherung und keine Schulden. Das ist ziemlich viel für eine Millennial. Nein, ich bin nicht verbittert, und wenn ich mir das weiter einrede, dann verschwindet dieses säuerliche Gefühl, das beim Gedanken an meine Geschichte in mir aufsteigt, vielleicht irgendwann von selbst.
»Ich habe gewartet. Ich habe die Nachricht gelöscht.« Ich lächele bei der Erinnerung. »Aber ich habe die Mail wieder aus dem Papierkorb geholt und ihm geschrieben. Das hier ist seine Antwort.«
Ich bin Lee Jonghyung. Mit zwanzig hat mir meine Liebschaft gesagt, dass sie schwanger von mir ist. Ich habe ihr nicht geglaubt, dass das Baby von mir ist, und sie weggeschickt. Aber jetzt frage ich mich, ob das du warst. Mein Herz ist schwer, und ich habe Angst, dass meine Vorfahren mich nach meinem Tod zurückweisen werden, wenn ich diese Sache nicht in Ordnung bringe. Ich würde dich gerne kennenlernen.
»Was, wenn er nicht dein Vater ist? Du hast gesagt, dass du den Kontakt durch ein Datenleck bekommen hast. Dieser Mann könnte jeder sein. Warum hast du mich nicht um Hilfe gebeten?«
Boyoung ist erschüttert. Ernsthaft erschüttert. Ihre Besorgnis treibt meinen Blutdruck in die Höhe.
»Ich … Ich dachte, dass ich das alleine schaffe.«
Und ich war nicht bereit, es mit jemandem zu teilen. Ich bin immer noch nicht bereit, aber ich war so unsicher, was meine eigene Übersetzung angeht, und ich vertraue dem Internet nicht, also bin ich damit zu dir gekommen.
Boyoung presst die Lippen zu einer missbilligenden Linie zusammen, bevor sie die Hand ausstreckt. »Gib mir die E-Mail. Ich recherchiere ein wenig für dich. Wenn ich rausgefunden hab, wer der Mann ist, helfe ich dir dabei, eine Antwort zu schreiben. Ich will nicht, dass dich jemand ausnutzt.«
Ich umklammere das Blatt Papier, als ob die E-Mail nicht in meinem Posteingang gespeichert wäre und ich sie nicht immer und immer wieder ausdrucken könnte. »Schon gut. Ich werde nichts überstürzen, Boyoung. Ich war nur neugierig.«
Ich meine, ja, ich habe Flüge nach Korea gesucht, aber ich habe kein Ticket gekauft. Vielleicht habe ich auch einen Reisepass beantragt, der bisher noch nicht in der Post war. Bisher habe ich nichts Konkretes unternommen. Das alles sind nur Träume und Hirngespinste.
Ich falte den Ausdruck zu einem winzigen Quadrat und schiebe ihn zurück in meine Tasche.
»Antworte nicht, ohne vorher noch mal mit mir gesprochen zu haben«, bittet Boyoung mich. »Versprochen?«
Die Kellnerin, die unsere Pizza bringt, bewahrt mich davor, meine Freundin anzulügen.
KAPITEL VIER
»Und nachdem Karen und ich uns bei der Trauerfeier begegnet sind, dachten wir, es wäre gut, wenn wir uns wiedersehen. Anscheinend sind Pats Kollegen auch keine großen Fans von Nina. Jeder ist der Ansicht, dass dein Dad ein absoluter Idiot war, neu zu heiraten und in seinem Alter noch ein Kind zu bekommen. Karen hat immer wieder gefragt, was Pat sich dabei gedacht hat, aber das ist ja gerade das Problem. Er hat nicht gedacht. Zumindest nicht mit seinem Kopf.« Mom verstreicht die Creme auf dem Honig-Zitronen-Kuchen, den sie macht.
Bei der Anspielung auf den Penis meines toten Vaters zucke ich zusammen und beschließe, dass von diesem Statement aus kein Übergang zu dem Geständnis möglich ist, das ich zu machen gedenke. Es ist nicht die Reise, wegen der Mom ausflippen wird, sondern der Grund dafür. Ich habe kurz darüber nachgedacht, wie ein Feigling zu lügen, dass ich einen Urlaub im Osten mache, aber das würde eine komplexe Fantasiegeschichte nach sich ziehen, die ich garantiert innerhalb der ersten vierundzwanzig Stunden komplett durcheinanderbringen würde. Abgesehen davon, kann man seine Mutter überhaupt anlügen? Mütter verfügen über einen sechsten Sinn, was ihre Kinder angeht. Es ist mir kein einziges Mal gelungen, meiner Mom was vorzumachen, und wenn sie zurzeit nicht so sehr mit Dads Tod und der anderen Mrs. Wilson beschäftigt wäre, hätte sie längst gemerkt, dass ich vollkommen neben mir stehe.
Ich beuge den Kopf über das Wachspapier vor mir und steche weiter die gedrungenen Körper der Schokoladenbienen aus, mit denen Mom den Kuchen dekorieren will. »Karen war schockiert, dass unsere Namen nicht als Erste in der Trauerrede genannt wurden. Ich hätte eigentlich an erster Stelle kommen müssen, dann du, dann sie und dann dieses Kind. Wie viele Leute, habe ich noch mal gesagt, kommen?« Moms plötzlicher Themenwechsel irritiert mich nicht weiter. Ich bin daran gewöhnt. Meine Nervosität habe ich von ihr – nicht biologisch geerbt, aber durch das achtzehnjährige Zusammenleben mit ihr. Man übernimmt die Gewohnheiten derjenigen Menschen, von denen man umgeben ist. Ich bin mir sicher, Erziehung toppt Abstammung.
»Dreizehn. Und er heißt Ryder.«
»O mein Gott, lass mich bloß nicht von dem Namen anfangen. Wer nennt seinen Sohn bitte Ryder?« Sie tippt mir aufs Handgelenk. »Mach die Bienen möglichst fett. Jeder mag gerne einen großen Happen Schokolade zur Zitrone.«
Immer noch besser als Hara, denke ich, während ich extra dicke Bienen aussteche und anschließend Mandelflügel an die runden Körper klebe.
Jeder Schuljahresbeginn war das reinste Vergnügen, wenn ich dabei zuhören musste, wie die neuen Lehrer meinen Namen massakrierten. Es heißt Ha-rah, nicht Hair-a. Ich hätte mir ein Schild basteln und es mir auf die Brust kleben sollen. Leider bewahrten mich die vergleichsweise harmlosen Erlebnisse in der Schule nicht vor der großen Peinlichkeit, als ich auf dem College von einer asiatischen Austauschstudentin erfuhr, dass ich meinen Namen mit einer berühmten koreanischen Pornodarstellerin teile. Jedes Mal, wenn ich an einem meiner wenigen asiatischstämmigen Mitstudenten vorbeikam, meinte ich, ein leises Kichern zu hören, deswegen hatte ich nie etwas mit einem von ihnen zu tun. Nicht, dass sie jemals auf mich zugekommen wären. Ausländische Studenten glucken häufig sehr eng zusammen. Sie sprechen alle mindestens zwei Sprachen, wenn nicht mehr, und jedes Mal, wenn sie etwas auf Koreanisch zu mir gesagt haben, bestand meine Antwort aus einem dümmlichen, leeren Starren. Ich gehörte nicht zu dieser Gruppe, und das lag nicht nur an meiner Unfähigkeit, mit ihr zu kommunizieren. Ich verstand ihre Wortspiele nicht. Ich hatte keine Ahnung von dem Essen, über das sie sprachen, oder von den Sehenswürdigkeiten. Lotte World Tower? Myeong-dong? Gwanghwamun-Platz? Jegliche kulturelle Anspielung entging mir. Ich war in ihrer Gegenwart ebenfalls anders. Die einzige Gemeinsamkeit, die wir hatten, waren unsere ähnlichen Gesichtszüge. Boyoung ist meine erste asiatischstämmige Freundin.
»Er wird den Namen seine ganze Schullaufbahn für jeden einzelnen Lehrer buchstabieren müssen. Nicht, dass sie in der Lage sein wird, für seine Ausbildung zu bezahlen, dafür reicht die mickrige Versicherungssumme nicht aus. Gut, dass du einen Job hast; sonst wäre das ein weiter Punkt auf der langen Liste der Dinge, mit denen er dich im Stich gelassen hat.«
Ich halte den Mund. Mom will gar nicht, dass ich meine Meinung dazu abgebe.
Und wie erwartet, plappert sie weiter. »Es gibt drei verschiedene Sorten Sandwichs, aber ich bin mir nicht sicher, wie viele ich insgesamt machen soll. Zwei pro Person? Das wären dann … Wie viele Leute, hab ich gesagt, kommen?« Sie geht zum Kühlschrank und holt Gurken, Frischkäse und Lachsaufstrich heraus.
»Dreizehn.« Ich schnappe mir die Tüte mit der weißen Schokolade und verteile die schmalen Streifen auf den Rücken der Bienen.
»Dreizehn. Stimmt. Das ist keine gute Zahl. Ich hätte eine Person mehr einladen sollen. Aber hab ich überhaupt genug Stühle? Vielleicht sind dreizehn Gäste sogar zu viele. Was ist mit Getränken? Es gibt natürlich Tee, aber sollten wir auch Dessertwein anbieten? Trinkt man um diese Zeit überhaupt Dessertwein?« Sie legt die Gurken und die Aufstriche auf die Küchenanrichte und schnappt sich ihr Handy.
Ich verstaue die Kuchendekoration im Gefrierfach und schaffe Platz für die Pies im Kühlschrank. Nachdem die Desserts damit fertig wären, nehme ich die Sandwichs in Angriff. Zumindest gibt es etwas, bei dem ich helfen kann. Bei der letzten Party wollte sie vier verschiedene Sorten selbst gemachte Nudeln mit Kürbis und Spinat anbieten. Wir standen stundenlang zusammen in der Küche, bevor ich aufgab und zum nächsten Supermarkt fuhr, um Fertigpasta zu kaufen.
»Oh, Sekt natürlich. Wir machen Mimosas. Habe ich Orangensaft da? Du musst bitte noch Sekt besorgen, Hara. Ich hab nur noch eine der billigen Flaschen von Silvester da; den kann ich den ehemaligen Kollegen deines Vaters unmöglich anbieten.«
Ich beschließe, die Sandwichs zu machen und anschließend zu beichten. Nein, nicht zu beichten, weil das klingt, als hätte ich etwas falsch gemacht. Und es kann nicht falsch sein, dass ich mehr über meine Vergangenheit erfahren möchte. Das ist vollkommen normal. Selbst Boyoung, die mir die ganze vergangene Woche immer wieder eingetrichtert hat, ich solle vorsichtig sein, was fremde Menschen im Internet angeht, hat nichts dagegen, dass ich den Kontakt mit meinem leiblichen Elternteil suche. Aber sie ist besorgt, dass mich jemand über den Tisch zieht. Verständlich. Vor ein paar Tagen hat sie mir einen Haufen Schriftzeichen geschickt mit der strengen Anweisung, sie in das Antwortfeld meines E-Mail-Accounts zu kopieren. Was ich nicht getan habe. Die digitale Übersetzung klang nach einer wütenden Zurechtweisung, begleitet von der Aufforderung, mich nie wieder zu kontaktieren.
Mom wird nicht denken, dass es sich um einen Hochstapler handelt, aber sie wird verletzt sein. Sie wird es als Angriff auf ihre Fähigkeiten als Mutter auffassen, auch wenn ich sie durch eine Reise nach Seoul, um Lee Jonghyung kennenzulernen, natürlich nicht verrate.
»Hör mal, Mom.«
»Wie viel Sekt sollten wir besorgen? Drei Flaschen? Oder vielleicht nur zwei? Karen bringt bestimmt eine Flasche Wein mit, meinst du nicht? Sie gehört zu den Leuten, die überall Wein mit hinbringen. Und Macy vielleicht auch. Sie hat gesagt, dass sie gerne helfen …«
»Mom …«
»Drei ist eine gute Zahl. Irgendwann werde ich wieder Gäste haben. Wenn wir die drei Flaschen also diesmal nicht trinken, hab ich fürs nächste Essen schon eine da.«
Mit reden allein werde ich nicht weiterkommen. Ich lasse die Sandwichs Sandwichs sein und nehme meiner Mutter das Handy aus der Hand.
Sie sieht auf. »Was ist?«
Natürlich, jetzt wo ich ihre Aufmerksamkeit habe, fällt mein Mut in sich zusammen und sammelt sich in einer armseligen Pfütze zu meinen Füßen. »Ich … Ich …« Ich breche ab, um mich zu räuspern.
Mom runzelt die Stirn. »Du bist doch nicht krank, oder?« Sie hebt eine Hand, um sie an meine Wange zu legen.
»Nein. Es geht um was anderes. Es ist so … Ich habe da diese E-Mail bekommen.« Ich greife um sie herum, um meine Handtasche auf der Kücheninsel zu mir heranzuziehen; dabei rutscht der Ausdruck heraus.