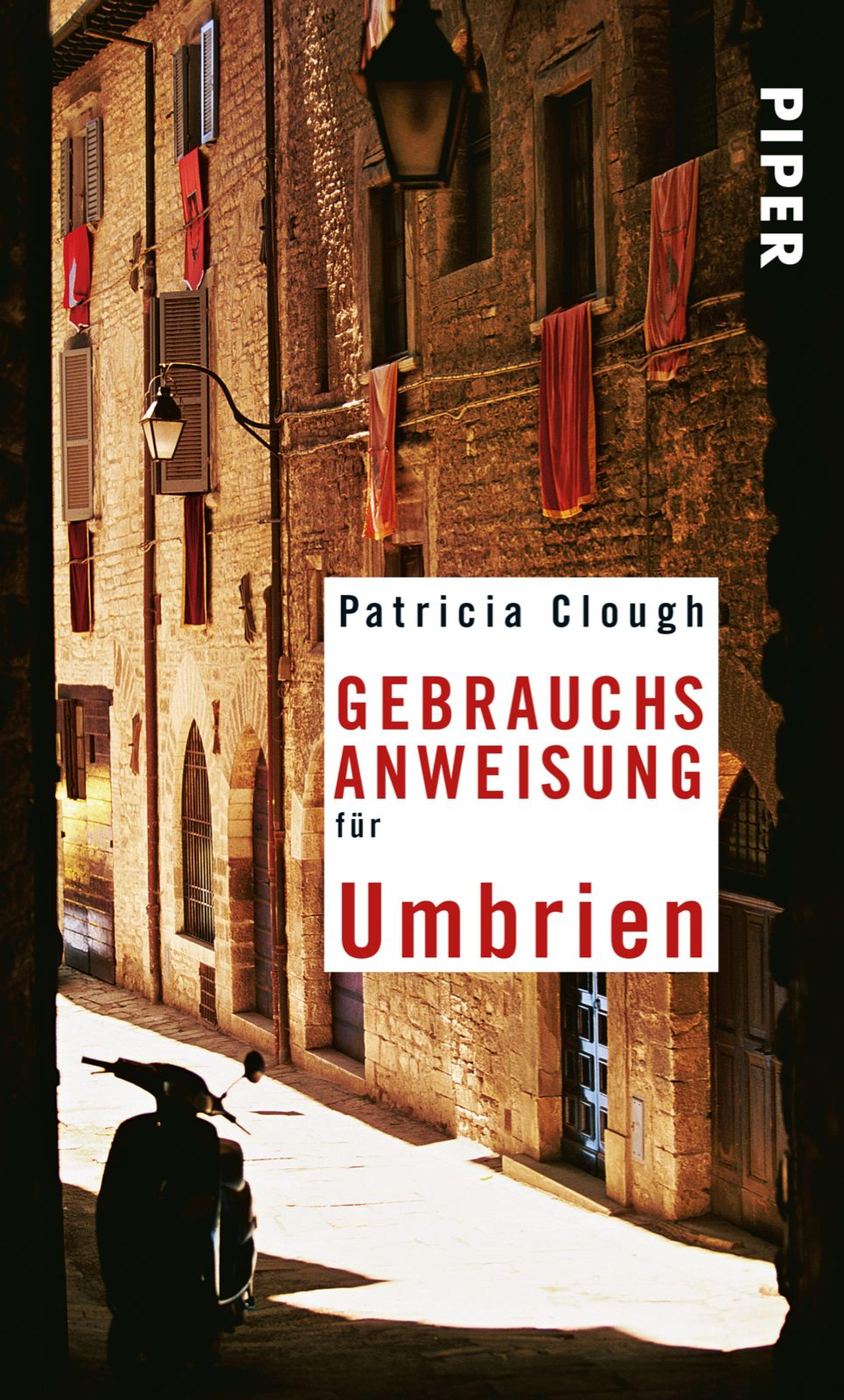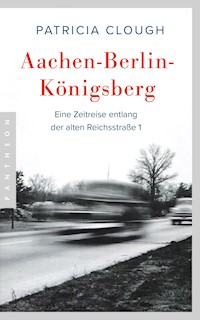
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Pantheon Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Jetzt wieder lieferbar: Patricia Cloughs spannende Reise entlang der alten Reichsstraße 1
»Königsberg 1000 km« – so der Text auf einem alten Straßenschild in der Nähe von Aachen. Als die englische Journalistin Patricia Clough es vor vielen Jahren auf einer ihrer ersten Reisen nach Deutschland sah, wollte sie wissen, was es damit auf sich hat. Das Schild verwies auf den Anfang der Reichsstraße 1, die einmal die wichtigste West-Ost-Verbindung Deutschlands war und sich quer durch die Weimarer Republik bis ins damalige Ostpreußen erstreckte. Patricia Clough hat sich auf eine ebenso unterhaltsame wie informative Zeitreise entlang dieser Straße begeben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 266
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Zum Buch
»Königsberg 1000 km« - so der Text auf einem alten Straßenschild in der Nähe von Aachen. Als die englische Journalistin Patricia Clough es vor vielen Jahren auf einer ihrer ersten Reisen nach Deutschland sah, wollte sie wissen, was es damit auf sich hat. Das Schild verwies auf den Anfang der Reichsstraße 1, die einmal die wichtigste West-Ost-Verbindung Deutschlands war und sich quer durch die Weimarer Republik bis ins damalige Ostpreußen erstreckte. Patricia Clough hat sich auf eine ebenso unterhaltsame wie informative Zeitreise entlang dieser Straße begeben.
Zur Autorin
Patricia Clough, 1938 in England geboren, hat viele Jahre als Korrespondentin für große britische Tageszeitungen wie die Times und den Independent aus Deutschland berichtet. Sie ist Autorin zahlreicher Bücher, darunter Hannelore Kohl. Zwei Leben (2002) und In langer Reihe über das Haff. Die Flucht der Trakehner aus Ostpreußen (2004). Patricia Clough lebt in Umbrien.
Patricia Clough
Aachen – Berlin – Königsberg
Eine Zeitreise entlang der altenReichsstraße 1
Aus dem Englischenvon Dietmar Zimmer
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © dieser ergänzten Ausgabe 2022
by Pantheon Verlag, München
Copyright © 2007 by DVA, München
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Übersetzung des Nachworts: Dr. Antje Korsmeier, München
Karten/Fotos: Peter Palm, Berlin
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München, nach einem Entwurf von independent Medien-Design, München
Umschlagfoto: Bettmann/Getty Images
ISBN 978-3-641-29424-3V001
www.pantheon-verlag.de
Für Peter,
mit den besten Wünschen
für seine eigene Reise
Inhalt
KAPITEL 1
Ein Straßenschild
KAPITEL 2
Im Rheinland
KAPITEL 3
Spionage als Beruf
KAPITEL 4
Und wo sind sie geblieben?
KAPITEL 5
Eine Furt an der Elbe
KAPITEL 6
Vom Wannsee zum Potsdamer Platz
KAPITEL 7
Kunst, Musik und Trommelfeuer
KAPITEL 8
Unterwegs im Zeitraffer
KAPITEL 9
Königsberg/Kaliningrad
KAPITEL 10
Neusiedler und Dinosaurier
KAPITEL 11
Fehlende Kilometer
KAPITEL 1
Ein Straßenschild
Vor vielen Jahren, als ich einmal mit dem Auto bei Aachen von den Niederlanden über die Grenze nach Deutschland fuhr, sah ich am Straßenrand ein schlichtes weißes Schild. Darauf stand einfach: »KÖNIGSBERG 1000 km«.
Wie bitte? Als junge Besucherin aus Großbritannien hatte ich damals nur eine eher verschwommene Vorstellung von der Nachkriegsgeografie des Kontinents. Aber immerhin wusste ich, dass Königsberg jetzt nicht mehr Königsberg genannt wurde, dass ich bis dorthin mehrere ziemlich garstige Grenzen zu überwinden hätte und außerdem ohnehin nicht hineingelassen würde, weil die Stadt nun militärisches Sperrgebiet war. Warum also sollte ich oder überhaupt irgendjemand noch wissen wollen, wie weit es nach Königsberg war? Merkwürdiges Volk, diese Deutschen, dachte ich und fuhr weiter.
Erst mehrere Jahre später wurde mir klar, dass dieses Straßenschild etwas damit zu tun haben musste, dass die Straße, auf der ich damals nach Deutschland gekommen war, einmal die Reichsstraße Nummer 1 gewesen war. Diese war eine Zeit lang die längste Straße des Landes, berühmt für ihre enorme Reichweite – 1392 Kilometer von der holländischen Grenze im Westen bis zur damaligen Grenze zur Sowjetunion im Osten. Noch berühmter aber waren die 1000 Kilometer, die angeblich Aachen von Königsberg trennten. Obwohl dies eine plausible Erklärung für jenes Schild war, kam mir die ganze Geschichte immer noch ziemlich seltsam vor.
Denn sie ereignete sich in den frühen 1960er Jahren, und wer wollte damals schon an das Deutsche Reich geschweige denn an das Dritte Reich erinnert werden, an das Schicksal von Königsberg oder überhaupt etwas mit dieser Vergangenheit zu tun haben? Von meinen Besuchen als Austauschschülerin wusste ich bereits, dass die deutsche Geschichte scheinbar erst in den späten 1940er Jahren begonnen hatte. Alles musste neu und anders sein, die Tische nierenförmig statt quadratisch, Fotoalben und Schreibblöcke im Rautenzuschnitt und nicht rechteckig, da gab es futuristische Einrichtungsstoffe oder einfach diese unglaublich entspannte, demokratische Atmosphäre in den Klassenzimmern statt der strikten Disziplin, wie ich sie immer noch aus meiner Schule in England kannte. Von der Vergangenheit, insbesondere der jüngsten, sprach man kaum und wenn, dann nur sehr zögerlich, mit feierlichem Tonfall in der Stimme und begleitet von einem traurigen, gedankenvollen Kopfschütteln, wie wenn man von einem schrecklichen Unglück in der Familie erzählt. Es schien, als müsse man unter die jüngste Geschichte mit ihrem unermesslichen Grauen, all den Verbrechen, Leiden, Entbehrungen, Umwälzungen und Verlusten einen Strich ziehen, sie wegsperren in die Vergangenheit und so weit wie möglich vergessen.
Zu dieser Zeit war aus der Reichsstraße 1 die Bundesstraße 1 geworden. Und die endete schon nach etwa 460 Kilometern an jenem verminten Stacheldrahtstreifen, der damals die Grenze zwischen Ost- und Westdeutschland markierte. Dahinter – falls sie überhaupt befahrbar war, was mir ziemlich unwahrscheinlich vorkam – wurde sie zur Fernstraße 1 bis zur Oder, dann zu den polnischen Straßen Nummer 132, 22 und 504 bis Gronowo (dem ehemaligen Grünau) und schließlich zur russischen A 194 und A 229, bis sie letztendlich nahe des früheren Eydtkuhnen, jetzt Tschernyschewskoje, an der innersowjetischen Grenze zwischen dem sogenannten Kaliningrader Gebiet und der Sowjetrepublik Litauen endete.
Die Nachkriegsverträge zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Sowjetunion bestanden noch nicht, aber Kaliningrad »Königsberg« zu nennen und in irgendeiner Weise an ein einstmals größeres Deutschland zu erinnern, galt – um es vorsichtig zu formulieren – als »politisch nicht korrekt«, und man lief Gefahr, als Revanchist, Unbelehrbarer oder Schlimmeres gebrandmarkt zu werden. Welche Kommunal- oder Straßenbaubehörde hegte da heimlich großdeutsche Gefühle? Diese Frage drängte sich geradezu auf. War nicht ein solches Straßenschild mit dieser ganz und gar überflüssigen Information politischer Sprengstoff? Das war wirklich der Fall.
Schon der Name »Reichsstraße 1« lässt, zusammen mit der eindrucksvollen Länge der Straße, die einige Jahre lang die größte West-Ost-Entfernung im Deutschen Reich markierte, an Hitlerschen Größenwahn denken. Tatsächlich erfanden die Nationalsozialisten nur diesen Namen für eine Straße, die schon einige Jahre zuvor zu Zeiten der Weimarer Republik eingerichtet worden war und bis dahin »Fernstraße 1« hieß. Und die Straße selbst – genauer gesagt die Verkehrsverbindung, denn sie wurde nie als Gesamtprojekt geplant oder gebaut – existierte bereits gut und gerne zweitausend Jahre vor dem Dritten Reich. In der Weimarer Zeit wurde lediglich der deutsche Teil dessen, was schon immer eine der wichtigsten West-Ost-Landverbindungen Europas war, mit einer Nummer versehen.
Während über Jahrhunderte die großen nordwärts fließenden Ströme wie Rhein und Elbe den Hauptteil des Nord-Süd-Verkehrs aufnahmen, mussten sich Reisende zwischen Ost und West aus Mangel an entsprechenden Wasserstraßen ihren Weg über Land bahnen. Erst kamen römische Soldaten, dann die Handelsreisenden des Mittelalters, Kaiser mit ihrem Gefolge, Missionare, Ritter und Siedler auf dem Weg nach Osten, preußische Beamte, die es nach Westen zog, und über all die Jahrhunderte Reisende, Postkutschen und Armeen in die eine wie die andere Richtung. Einige kamen aus Ländern des Westens auf dem Weg in die fernen Weiten Russlands, andere waren unterwegs in die Gegenrichtung. Mit ihnen kamen Ideen, Kultur und Unterdrückung, Zerstörung und Befreiung. Sie alle reisten an den Rändern der nördlichen Mittelgebirge entlang, dort, wo diese in die Norddeutsche Tiefebene übergehen, wo der Boden fest und ohne Moore und Sümpfe war, keine bedeutenden Steigungen zu überwinden waren und Furten und später Brücken die Querung der Flüsse ohne allzu große Mühen erlaubten – und so entwickelte sich allmählich ein Handelsweg.
Die Geschichte der Nummerierung dagegen lässt sich genau datieren – auf den 10. Mai 1926, als der Reichstag einen Entschluss verabschiedete, die Regierung solle »ein einheitliches Netz wichtiger Landstraßen« ausarbeiten. Denn mittlerweile war das Zeitalter des Automobils angebrochen, und die Zahl der Personen- und Lastkraftwagen stieg in – für damalige Verhältnisse – schwindelerregende Höhen. Die Straßen mussten sicherer gemacht werden, und die Kraftfahrer, die immer schneller immer weitere Strecken zurücklegten, brauchten Orientierungshilfe, um sich im Land zurechtzufinden.
Das war keine leichte Aufgabe. Die Verantwortung für Deutschlands Straßen lag, so errechnete damals eine Zeitung, bei nicht weniger als 60 000 verschiedenen Behörden. Kleine und größere Städte kämpften darum, an die Hauptrouten angeschlossen zu werden. Es handelte sich bei diesen Verbindungen immer noch um einfache Landstraßen, die keineswegs besonders gut ausgebaut waren. Die Nummerierung ließ noch nicht auf die Qualität der Strecken schließen, die tatsächlich oft noch viel zu wünschen ließ. Die Reichsregierung musste auch erst die Länder zur Kooperation bewegen, denn diese waren letztlich verantwortlich für Bau und Unterhalt von Straßen. Schließlich wurden einheitliche Standards erlassen, darunter eine Mindest-Fahrbahnbreite von sechs Metern. Autobahnen wurden geplant, viele Pläne blieben allerdings aus Geldmangel in den Schubladen liegen. Zugleich arbeitete die Regierung auch an einer ersten Straßenverkehrsordnung und hatte dabei eine Flut von Anregungen und Einsprüchen der unterschiedlichsten Stellen zu berücksichtigen. Für das Reichsverkehrsministerium war es sicher eine arbeitsreiche Zeit.
Schließlich wurde am 17. Januar 1932 nach mehr als fünf Jahren Vorbereitung das neue Fernverkehrsstraßennetz eingeführt. 1934 wurden die Fern- zu Reichsstraßen umbenannt, und erstmals waren die kleinen gelben Schilder an den Straßen zu sehen, mit denen die deutschen Bundesstraßen bis heute gekennzeichnet werden. Die ersten Fernstraßen mit einstelliger Nummer durchzogen Deutschland von einer Grenze zur anderen und bildeten das Grundgerüst für das Wegenetz. In dieses wurden die Straßen niedrigerer Ordnung mit den zwei- und dreistelligen Nummern eingepasst. Nach Ausbruch des Krieges wurde die Straßennummerierung einfach in den von der Wehrmacht besetzten Ländern weitergeführt.
Die bürokratischen Hintergründe für die genaue Trassenplanung der R1 konnte ich nicht herausfinden, aber es scheint natürlich, dass sie jener alten Handelsstraße folgte, die Kaufleute wie Armeen schon seit Jahrhunderten nutzten. Sie begann an der niederländischen Grenze in der Nähe von Aachen, verlief nordöstlich nach Jülich und Neuss, überquerte den Rhein nach Düsseldorf und führte weiter durch Essen und Dortmund. In den ersten Jahren ging sie dann weiter nach Hannover. Aber zwischen 1936 und 1938, als die Streckenverläufe einiger Reichsstraßen korrigiert wurden, verlegte man sie von Hameln über Hildesheim nach Braunschweig. In Magdeburg überquerte sie die Elbe und führte weiter nach Brandenburg/Havel, Potsdam und Berlin. Östlich von Berlin ging es bei Küstrin über die Oder und weiter leicht nördlich nach Landsberg an der Warthe und Deutsch Krone. Zwischen 1939 und 1945 führte sie ohne Unterbrechung weiter über den früheren polnischen Korridor durch Konitz (Chojnice) und Dirschau (Tczew), überquerte die Weichsel und lief weiter über das Gebiet der Freien Stadt Danzig nach Marienburg, Elbing, Königsberg, Insterburg und Gumbinnen, um schließlich in dem Grenzstädtchen Eydtkuhnen zu enden.
Gegen die Streckenführung gab es jede Menge Proteste.»Schwerin wird wieder umgangen!«, empörte sich eine mecklenburgische Zeitung. Köln engagierte sich ganz besonders in dem Konflikt und machte geltend, es sei »eine Lebensnotwendigkeit«, an der R1 zu liegen. Der damalige Verkehrsminister Gottfried Treviranus meinte jedoch, Köln sei »in keiner Weise gefährdet« und führte aus, »daß eine nachträgliche Änderung aufgrund der erhobenen Einwände zahlreiche andere Interessenten mit ähnlichen Ansprüchen auf den Plan rufen würde«. Die preußische Landesregierung, die ebenfalls in die Diskussion hineingezogen wurde, stellte sich auf die Seite des Reichsministeriums und erklärte, schließlich sei die Qualität der Straßen wichtiger als ihre Nummern, und erinnerte die Kölner daran, dass ihre Stadt bereits an nicht weniger als neun Fernstraßen angeschlossen sei, darunter die wichtigen F 8 und F 9, und demnächst sogar einen Autobahnanschluss bekommen sollte.
Schon bald war das gesamte deutsche Straßenverkehrswesen zentralisiert. Die nationalsozialistische Regierung trieb den Bau von Autobahnen voran, die schließlich die Hauptverkehrslast von den Reichsstraßen übernehmen sollten. In den folgenden Jahren wurde das Netz der Reichsstraßen immer weiter und weiter ausgebaut, doch der Verlauf der R1 blieb im Wesentlichen unverändert.
Aber kehren wir zunächst noch einmal zurück zu diesem Schild an der Grenze. Wer hatte es dorthin gestellt? Anfragen bei allen möglichen Kommunal- und Landesbehörden führten ins Leere. Man kannte das Schild, das heute dort steht, aber nicht das aus den 1960er Jahren, an das ich mich erinnerte. Dann fand ein freundlicher Mitarbeiter des Archivs der Aachener Zeitung heraus, dass »mein« Straßenschild – KÖNIGSBERG 1000 km – schon seit der Umbenennung der R1 in den 1930er Jahren dort gestanden hatte, im Krieg abgebaut oder zerstört und danach wieder hingestellt worden war. Doch wer hatte ein Interesse daran, es unter den dramatisch veränderten Bedingungen der Nachkriegszeit wieder aufzustellen, und warum? Mit meinen Nachforschungen kam ich zunächst nicht weiter.
Schließlich erhielt ich zu meiner Überraschung auf eine Kleinanzeige hin einen Brief und eine in Aachen abgestempelte Postkarte. Sie stammten von zwei Damen, die eine Tochter eines Vertriebenen aus Schlesien, die andere ein Mitglied des Laurensberger Heimatvereins. Laurensberg war eine Grenzgemeinde im Umland von Aachen, die inzwischen in die Stadt eingemeindet ist. Dank der freundlichen Hilfe der beiden zeichnete sich bald ein Bild der Geschehnisse ab: Flüchtlinge und Vertriebene aus dem Osten, entwurzelt und heimwehkrank, hatten es irgendwie geschafft, die Behörden zum Wiederaufstellen des Schildes zu bewegen. Ob es sich dabei um reine Nostalgie handelte, sie sich selbst und andere an die verlorenen Gebiete erinnern wollten oder ob gar ein Anspruch auf diese und damit ein politisches Programm repräsentiert werden sollte, das lässt sich im Nachhinein nur schwer sagen. Schon bald zeigte sich, dass das Schild, so politisch fragwürdig es auch gewesen sein mochte, geradezu harmlos war im Vergleich zu dem viel größeren Schild, das später an der gleichen Stelle errichtet wurde. Auf diesem stand nämlich Folgendes zu lesen:
BUNDESSTRASSE 1
Führt zu den ostpreußischen Städten
KÖNIGSBERG
INSTERBURG
EYDTKUHNEN
Was sollte ein ausländischer Autofahrer damit anfangen? Einem aus dem Westen Kommenden dürfte es, gelinde gesagt, seltsam vorgekommen sein. Den wenigen aus Osteuropa, die es hätten sehen können, hätte es die Haare zu Berge stehen lassen, was exakt die Intention der heimischen kommunistischen Propagandamaschinerie war, hieß es dort doch immer, die Deutschen (die aus dem Westen natürlich) stünden unter dem Einfluss geifernder Flüchtlings- und Vertriebenenfunktionäre, von Revanchisten und Kriegstreibern. Auch vielen Einwohnern der Region schien dieses Schild zu weit zu gehen. Viele meinten, es schade Aachens Ansehen im Ausland. In mehr als einer Familie gab es heiße Debatten zwischen Flüchtlingen und ihren in der Nachkriegszeit aufgewachsenen Kindern. Das Schild wurde mehrmals übermalt und irgendwann gestohlen. Erst zwei Jahre später tauchte es wieder auf. Die Übeltäter wurden wegen Zerstörung öffentlichen Eigentums bestraft, obwohl manche der Meinung waren, die eigentlichen Schuldigen seien diejenigen gewesen, die das Schild aufgestellt hatten. In der Hoffnung, die Verwendung der Vergangenheitsform könne das Problem lösen, wurde schließlich ein drittes Schild aufgestellt. Nun stand dort zu lesen:
BUNDESSTRASSE 1
Führte zu den ehemaligen ostpreußischen Städten
KÖNIGSBERG
INSTERBURG
EYDTKUHNEN
Aber nein – die Angriffe gingen weiter. Anwohner demonstrierten für einen Abbau. Sprayer gingen ans Werk, und 1997 verschwand das Schild erneut. Diesmal wurde es in Stücke zersägt, die man nacheinander vor der russischen Botschaft in Bonn, dem Haus der Vertriebenen in Aachen und der Geschäftsstelle einer rechtsgerichteten Gruppierung, ebenfalls in Aachen, fand. Eine Gruppe, die sich selbst »Zelle Phönix« nannte und bereits früher bei Anschlägen auf das Schild in Erscheinung getreten war, bekannte sich schriftlich zu der Tat und beschimpfte den Vertriebenenverband als »Kriegshetzer« und als »Sprachrohr des faschistischen Mobs«.
Schließlich, 1999, möglicherweise inspiriert durch eine hervorragende Ausstellung in Essen, die zeigte, dass die R1 Teil einer bedeutenden alten europäischen Handelsstraße gewesen war, die zwischen Brügge im heutigen Belgien und Novgorod im heutigen Russland verlief, plädierten und zahlten die Heimatvertriebenen für ein viertes und politisch akzeptableres Schild. Am 19. November 1999 wurde es im Rahmen einer großen Zeremonie mit vielen internationalen Gästen enthüllt. Verziert mit den Wappen von Aachen, Berlin und dem früheren Königsberg zeigte es nun den folgenden Text:
Bundesstraße 1
Als preußische Staatsstraße und später Reichsstraße 1
verband sie Aachen mit Berlin und Königsberg
in Preußen. Sie ist Teil der längsten und
ältesten West-Ost-Verbindung Europas
von Brügge nach Nowgorod,
die durch acht Staaten führt.
Es gab eine Feier mit Käse aus den Niederlanden, Buletten aus Berlin, Bärenfang-Schnaps nach Königberger Tradition und jeder Menge Bier. Schließlich war Ruhe. Endlich schienen alle zufrieden, und so steht das Schild dort heute immer noch.
Ich kehrte noch einmal an die deutsch-niederländische Grenze zurück, um nachzusehen, wie es da heute aussieht. Ehrlich gesagt: Abgesehen vom Wechsel der Farbe des Fahrbahnbelags (Rot in Holland, Grau in Deutschland) würde es kaum auffallen, dass man von einem Land in ein anderes fährt, so unbedeutend sind Grenzen inzwischen im Kernland der Europäischen Union geworden. Auch nach einem Zollhäuschen sah ich mich um, einem, das vielleicht schon vor 140 Jahren dort gestanden haben könnte. Alles, was ich fand, war eine moderne Konstruktion von höchst bescheidenem architektonischem Reiz, geschlossen und eingezäunt, die ausgesprochen überflüssig wirkte. (Inzwischen soll ein Getränkemarkt daraus geworden sein.) Eigentlich hatte ich hier jenen Ort besichtigen wollen, wo ein gewisser deutscher Reisender namens Heinrich Heine anno 1843 nach zwölf Exiljahren in Paris den Zoll passierte. Damals waren die Zöllner preußisch, und der besagte Reisende führte Ideen mit sich, die mit der kuriosen Abfolge von Straßenschildern an dieser Stelle mehr als hundert Jahre später in einem merkwürdigen Zusammenhang stehen.
Anders als heutigen Reisenden wurde Heine eine komplette Zollabfertigung in traditioneller Manier zuteil, und so – wie er später in »Deutschland, ein Wintermärchen« festhielt –,
»… ward von den preußischen Douaniers
mein Koffer visitiret.
Beschnüffelten alles, kramten herum
in Hemden, Hosen, Schnupftüchern;
sie suchten nach Spitzen, nach Bijouterien
auch nach verbotenen Büchern.
Ihr Toren, die Ihr im Koffer sucht!
Hier werdet Ihr nichts entdecken!
Die Contrebande, die mit mir reist,
die hab ich im Kopfe stecken …
Und viele Bücher trag’ ich im Kopf!
Ich darf es Euch versichern,
mein Kopf ist ein zwitscherndes Vogelnest
von konfiszirlichen Büchern.
Glaub’ mir, in Satans Bibliothek
kann es nicht schlimmere geben;
sie sind gefährlicher noch als die
von Hoffmann von Fallersleben!«
Heine war nicht der erste Reisende, der »gefährliche« Ideen über diese Straße nach Deutschland hereinbrachte. Seit über fünfzig Jahren schon waren Vorstellungen von Freiheit, Gleichheit und Menschenrechten, entstanden während der Französischen Revolution, über diese Grenze gelangt, nicht zuletzt mit französischen Armeen, die zumindest einige von diesen Vorstellungen in mehreren deutschen Regionen durchgesetzt hatten. Mit ihnen kam auch die Idee, dass ein Nationalstaat und eine moderne, reformierte Verwaltung Vorteile hatten gegenüber all den muffigen Grafschaften, Herzogtümern und sonstigen Mini-Staaten, in denen die Deutschen seinerzeit lebten. Doch die Hoffnungen, dass die Befreiungskriege gegen Napoleon zu einem vereinten, modernen Deutschland führen würden, waren gescheitert, und die Menschen hatten sich in eine behagliche, unpolitische Häuslichkeit zurückgezogen, das Biedermeier.
Es war sinnlos, nach besagtem alten Grenzposten zu suchen, denn, wie ich inzwischen weiß, das Zollamt, an dem die preußischen Douaniers Heines Gepäck durchsuchten, lag gar nicht hier, sondern mehrere Kilometer westlich und war erst nach dem Ersten Weltkrieg an die heutige Stelle gerückt. Zu diesem Thema der ständig wandernden Grenzen Deutschlands werden wir noch zurückkommen.
Ein berühmtes Gedicht voller Sehnsucht nach einem neuen Deutschland. Drei Schilder als Zeugen, wie sich dieser Traum erfüllte und dann auf schreckliche Weise fehlschlug. Und nun ein viertes als Zeichen des Aufgehens des Nationalstaates in einer überstaatlichen Gemeinschaft … Ich kenne keine andere internationale Grenze wie diese.
Wir sind am Beginn unserer Reise, und schon dieser Ort wird geprägt von dem Leitmotiv Vaterland.
Willkommen in Deutschland.
* * *
Das ist also der Anfang der Reichsstraße 1, heute, in gekapptem Verlauf, der Bundesstraße 1. Was ist so besonders an dieser Straße, dass man ein Buch darüber schreiben möchte? Es faszinierte mich nicht nur, dass sie einmal für kurze Zeit die gesamte Breite des damaligen Deutschland durchzog, sondern auch, dass mit ihr so viele Ereignisse, Menschen, Ideen und Mythen verbunden sind, die auf die eine oder andere Weise zu dem Deutschland beitrugen, das wir heute kennen. Entlang der alten R1 zieht sich die deutsche Geschichte wie ein roter Faden. Straßen verbinden ja nicht nur Menschen und Orte in einem geografischen Sinn, sondern auch in einem historischen. Es ist, als besäßen sie eine vierte Dimension. Und diese wollte ich erfahren und zur Sprache bringen.
Ich habe versucht, jeden Kilometer der ehemaligen R1 abzufahren. Das war nicht leicht, denn vielerorts wurde die alte Landstraße durch moderne Schnellstraßen oder Autobahnen ersetzt, zugeschüttet oder einfach überbaut. Früher führte sie durch Ortsmitten und Stadtzentren, die heute Fußgängerzonen sind, und der Verkehr wird auf Umgehungsstraßen umgeleitet. Ebenso wenig konnte ich die ganze Reise in einem Stück zurücklegen. Einige Strecken sah ich im Sommer, andere im Winter oder Frühling. So manche Kilometer habe ich mehrmals bereist. Meist war ich von West nach Ost unterwegs, aber zwischen Königsberg und Elbing fuhr ich in umgekehrter Richtung. Dieses Buch ist jedoch kein Reiseführer geworden. Noch interessanter als die Orte und Gebäude auf der Strecke schienen mir die Menschen und ihre Geschichten.
Natürlich sind im Laufe der gut 2000 Jahre, seitdem es diesen Verkehrsweg gibt, viele Millionen hier entlanggereist und unzählige Ereignisse geschehen. Also musste ich ein kleines bisschen wählerisch sein. Es handelt sich um eine sehr persönliche Auswahl, denn für mich war diese Reise auch eine persönliche Suche nach Aufklärung. Als Germanistikstudentin saß ich Ende der 1950er Jahre an der Universität Bristol zu Füßen des in Österreich geborenen Professors August Closs und seiner Stellvertreterin, Dr. Estelle Morgan, und ich sog wie alle ihre Studenten der beiden große Liebe für die deutsche Literatur in mich auf. Erst im Nachhinein fiel mir auf, dass abgesehen von wenigen Ausnahmen die Literatur des 20. Jahrhunderts praktisch überhaupt nicht behandelt wurde. Und was noch verblüffender war: Wir hatten so gut wie nichts über die politische Geschichte Deutschlands erfahren – jenen Kontext, in dem all diese Werke entstanden waren und den man ebenfalls verstehen muss. Ich kann den beiden heute keine Vorwürfe machen. Erstens neigt man in Großbritannien ohnehin dazu, Literatur und Geschichte als vollkommen getrennte Bereiche zu betrachten, und soweit es unsere eigene Literatur betrifft, ist das vielleicht auch kein schwerer Fehler. Wichtiger jedoch war, nehme ich heute an, dass angesichts des grauenhaften Krieges, der den Menschen noch in frischer Erinnerung war, unsere Lehrer uns die großen und unsterblichen Aspekte der deutschen Kultur vermitteln und den Rest einfach vergessen wollten.
Zwischen 1966 und 1996 kam ich viermal als Korrespondentin nach Deutschland, zuerst für die Nachrichtenagentur Reuters und dann nacheinander für drei verschiedene britische Zeitungen. Insgesamt habe ich zwölf Jahre lang aus Nachkriegsdeutschland berichtet – einem Deutschland, das weit entfernt war von dem, dessen Sprache und Literatur ich an der Universität studiert hatte. Wie waren diese beiden Deutschlands miteinander in Einklang zu bringen? Inwieweit hingen sie miteinander zusammen? Antworten auf diese Fragen zu finden, dafür hatte ich als Korrespondentin nie genug Zeit gehabt. Nun erhoffte ich mir dies von meiner Reise entlang der R1.
Das Problem einer Reise in Raum und Zeit besteht darin, dass unweigerlich eines der beiden Elemente die Oberhand gewinnt. Da es sich bei meinem Forschungsobjekt um eine Straße handelte, schien es logisch, ihrem geografischen Verlauf zu folgen, auch wenn es auf Kosten der chronologischen Ordnung ging. Deshalb stößt man immer wieder auf Ereignisse, bevor man ihren Urhebern begegnet, und entdeckt Auswirkungen früher als deren Ursachen. Aber vielleicht ist das ja auch gar nicht so tragisch, denn es hilft zu verstehen, dass bei allen Verwerfungen, Umbrüchen, Teilungen und Zäsuren die Geschichte Deutschlands und der Deutschen letztendlich doch ein gemeinsames Ganzes ergibt.
KAPITEL 2
Im Rheinland
Jecken und Preußen
Was Heine über Aachen schrieb, war nicht bloß Ausdruck dichterischer Freiheit, es war einfach ungerecht. Für ihn war die Stadt »ein langweiliges Nest«, wo selbst die Hunde träge in den Gassen lägen: »Sie flehn untertänig; / gib uns ein’ Fußtritt, o Fremdling, das wird / vielleicht uns zerstreuen ein wenig.« Natürlich passte das wunderbar zu seinem Thema »Deutschland im Winterschlaf«, aber sollte er wirklich nicht gewusst haben, dass Aachen und andere Städte in der preußischen Rheinprovinz die Vorreiter bei jenen Unruhen waren, die fünf Jahre später in der – leider erfolglosen – Revolution von 1848 gipfelten? Und dass ein bekannter Aachener Geschäftsmann, David Hansemann, einer der exponiertesten öffentlichen Vertreter von Reformen war?
Noch giftiger reagierte Heine auf die Preußen, die ihm überall in der Stadt auffielen, Leute, die aus vielen hundert Kilometern Entfernung hergekommen waren, die sich sehr von ihren lebenslustigen Untertanen unterschieden und die der Dichter für Deutschlands politische Stagnation verantwortlich machte. »Noch immer das hölzern pedantische Volk, / noch immer ein rechter Winkel / in jeder Bewegung und im Gesicht / der eingefrorene Dünkel«, spottete er. Auch die Aachener mochten die Preußen nicht. Sie hielten sie nicht nur für Besatzer, sondern auch für rückständig und archaisch. Die Abneigung beruhte auf Gegenseitigkeit. Die preußischen Junker jener Tage verachteteten rheinische Unternehmer, Industrielle, Händler und Geschäftsleute als neureiche Emporkömmlinge. Rheinländer, so wird erzählt, durften nicht in preußische Adelskreise einheiraten oder in Preußen ein Rittergut kaufen. Für viele Beamte und Offiziere galt eine Abordnung ins Rheinland als Strafversetzung, während die Einheimischen mitleidig auf sie herabsahen und sie wegen ihrer kümmerlichen Gehälter als »arme Litauer« bezeichneten.
Heine war im November in Aachen, das behauptete er zumindest. (Historiker meinen, es sei tatsächlich Oktober gewesen, aber dieser oft sonnige und farbenprächtige Monat hätte wohl nicht den passenden düsteren Hintergrund für ein »Wintermärchen« abgegeben.) Wäre er später, im ausklingenden Winter, zur Karnevalszeit, gekommen, hätte sich sein Text vielleicht auch ganz anders angehört, denn der rheinische Karneval war damals ganz zweifellos eine subversive Veranstaltung, balancierte – ähnlich wie später das Kabarett in der DDR – immer wieder hart am Rande der Legalität und lief dabei Gefahr, verboten zu werden.
Karneval – eine subversive Veranstaltung? Das war eine echte Überraschung. Wie viele Ausländer hatte auch ich diese närrischen Tage vor der österlichen Fastenzeit einfach für »typisch deutsch« gehalten. Und »deutsch« war für uns daran, dass Frohsinn und Heiterkeit an einem ganz bestimmten Tag im Jahr ein- und an einem anderen wieder abgeschaltet werden. Die außerordentlich strukturierte, ordentliche Art und Weise, Spaß zu haben, mit all diesen »Sitzungen«, »Komitees« und bestens organisierten Umzügen, mit als Soldaten verkleideten Teilnehmern, Blaskapellen und unendlichen Mengen an Bier. Und die faszinierende Entschlossenheit, was das Feiern anbelangt, so dass sogar das politsche Leben der früheren Bundeshauptstadt zum Erliegen kam – was der Chefredaktion in London nicht immer leicht zu vermitteln war.
Mir erschien das alles als ein schöner, harmloser Spaß, vor allem für die Kinder. Meine einzigen Bedenken hatten mit den ungeheuren Mengen Süßigkeiten zu tun, die von den Karnevalswagen in die Menge geschaufelt wurden und schließlich im Magen meiner kleinen Tochter landeten. Aber subversiv?
Schuld daran war das »hölzern pedantische Volk« – die Preußen. Nachdem sie 1815 in den Besitz der Rheinprovinz gelangt waren, trauten sie ihren neuen Untertanen keinen Zollbreit über den Weg, verfügten eine strenge Zensur, verboten jegliche politische Betätigung, schränkten öffentliche Versammlungen ein und installierten überall Polizei und Geheimdienstspitzel. So wurde allmählich der Karneval zu einer Demonstration des Missfallens, bei der sich die Menschen in Liedern, Reden und Umzügen unter dem (relativen) Schutz der Narrenkappe über die Preußen lustig machen konnten.
Der durchschnittliche ausländische Besucher, der sich mit einem Glas Bier in der Hand durch das Ritual der Sitzungen schunkelt, würde wohl kaum vermuten, dass die Aachener oder Kölner Jecken jahrhundertelang einfach nur fröhlich maskiert durch die Straßen gezogen sind, ganz spontan und undiszipliniert allen möglichen Unfug veranstalteten und sich über ihre Herren lustig machten. Die Franzosen, die vor den Preußen das Rheinland besetzt hielten, mochten zwar aufgeklärter und populärer gewesen sein, den Karneval aber hatten sie einige Jahre sogar ganz verboten. Die Preußen konnten ihn nicht ausstehen, aber sie ließen die Narren immerhin gewähren aus Furcht, anderenfalls könnte der Missmut der örtlichen Bevölkerung außer Kontrolle geraten. Allerdings verboten sie Masken und schritten oft scharf ein, wenn sie den Eindruck hatten, der Frohsinn ginge zu weit.
Tatsächlich waren es gar nicht die preußischen Behörden, die dem Karneval seine heutige Form aufzwangen, zumindest gibt es keine derartigen Hinweise. Es scheint vielmehr, dass zuerst die Kölner selbst und dann 1829 die Aachener sich Satzungen gaben, um dem Karneval jene Ordnung und Disziplin zu verpassen, die die Preußen verstanden, um so einem vollständigen Verbot zuvorzukommen.
Enthielten diese Satzungen vielleicht noch einen verborgenen politischen Hintersinn? Denn gerade zu Karneval bekamen ja die »Jecken« genau das, was sie auch sonst im Staat forderten: Selbstbestimmung, freie Wahlen, Gleichheit und Demokratie. Die Karnevalskomitees bestanden aus Menschen unterschiedlicher Bevölkerungsschichten, die alle gleichermaßen zur Wahl des »Elferrates« berechtigt waren, jenes Vorstandsgremiums, dessen Mitgliederzahl der traditionellen Zahl des Karnevals entspricht.
War die Narrenfreiheit erst einmal errungen, wogegen konnte sie sich trefflicher richten als gegen den preußischen Militarismus und sein Faible für Orden und Ehrenzeichen, Flaggen und Uniformen, Tressen und blankpolierte Uniformknöpfe ebenso wie für ewiges Paradieren, Exerzieren und Herumstolzieren? Es musste aufregend gewesen sein auszuprobieren, wie weit man gehen konnte, ohne Schwierigkeiten zu bekommen.
Auf der Suche nach dieser halbvergessenen subversiven Seite des Karnevals fand ich mich schließlich am Aachener Marschiertor. Als eines von nur zwei erhaltenen Toren der alten Stadtmauer hat dieses Bauwerk die Wirren von siebeneinhalb Jahrhunderten überstanden, einschließlich der Brandbomben von 1943. Zu verschiedenen Zeiten diente es als Waffendepot, Rumpelkammer, Obdachlosenheim, Jugendherberge und Heim der Hitlerjugend. Schließlich beherbergt es seit 1964 das Hauptquartier der »Oecher (= Aachener) Penn«, die für Aachen das Gleiche bedeuten wie die berühmten »Funken« für Köln – Parodien preußischer Soldaten, die die städtischen Rosenmontagszüge anführen und von den verschiedenen Karnevalsveranstaltungen nicht mehr wegzudenken sind. Sie tragen friderizianische Uniform – weiße Westen und Hosen, rotbesetzte blaue Mäntel, schwarze Stiefel und Dreispitz auf dem Kopf – und schultern Waffen, in deren Läufen Blumen stecken. Dank ihres Zuspruchs zum örtlichen Bier ist ihr Gang vielleicht nicht ganz so korrekt und ihre Einstellung zur Disziplin überhaupt ganz und gar unpreußisch.
Mein Fremdenführer ist Josef Lüttgens, ein pensionierter Orgelbauer und eine Aachener Frohnatur. Er ist eine der tragenden Säulen der »Penn«, obwohl er beteuert, er sei »noch gar nicht so lange dabei, erst 48 Jahre«. Bei Herrn Lüttgens sammelt sich die Vereinsgeschichte an, er verwaltet die Tradition und ist bereit, mir das Allerheiligste des Vereins zu präsentieren.
Das Tor wirkt nicht gerade einladend, aber einmal innerhalb der dicken Mauern und die steilen, dunklen Treppenstufen hinaufgeklettert, ist man in einer anderen Welt. Die alten, spartanischen Räume sind warm, gut ausgeleuchtet und bemerkenswert gemütlich eingerichtet. Die schweren, rustikalen Möbel sehen aus, als stünden sie hier schon seit Jahrhunderten, doch tatsächlich sind sie erst in den letzten Jahren aufgestellt worden. Die »Penn«, so erklärt Herr Lüttgens, sind benannt nach der Aachener Stadtgarde, die vergeblich versucht hatte, die Stadt vor Napoleons Armee zu verteidigen. Ihre Mitglieder waren so schlecht bezahlt, dass sie ihren Sold damit aufbessern mussten, »Holzpinnchen« zu schnitzen, die zum Besohlen von Schuhen verwendet wurden. Aus Pinn wurde Penn, und der Name blieb. 1857 wiedergegründet unter den strengen Augen der Preußen als Verein zum »Kampf gegen Griesgram und Muckertum«, blieben die »Penn« ein wesentlicher Bestandteil des Aachener Karnevalsprotests.
Als der Verein das Marschiertor übernahm, war es nur noch ein Gemäuer voller Scherben und Müll. Doch weil unter den 350 Mitgliedern praktisch jeder Beruf vertreten ist, konnten sie sich liebevoll selbst um das alte Gemäuer kümmern, installierten, größtenteils aus eigener Tasche, Strom- und Wasserleitungen, Fußböden, Heizung und Mobiliar. Heute gibt es einen großen, überwölbten Waffensaal für Partys und einen gut ausgestatteten Weinkeller für den gemütlichen Plausch. Und überall, vor allem im ehemaligen Raum des Torkommandanten, findet sich das unverzichtbare Zubehör für Aachens antipreußische Satire – Flaggen über Flaggen, Wimpel, unzählige unterschiedliche Medaillen, Orden und Urkunden. Schließlich führt mich Herr Lüttgens zur Garderobe, die einen perfekten preußischen Schneiderladen abgeben könnte: bis zur Decke voll von Schachteln mit kupfernen Knöpfen, Litzen und Epauletten, Schnallen und Hüten.
Das Marschiertor ist zu einem gemütlichen Heim geworden, das das ganze Jahr über für die »Penn« und den Geist des Karnevals offen steht. Was gestern politische Satire war, ist heute bunte Folklore; in einer Zeit der Meinungsfreiheit hat die Spannung von einst längst anderen Gefühlen Platz gemacht. Die Preußen mögen kommen und gehen, der Karneval aber bleibt.
Selbst wenn die steifen preußischen Offiziere und Beamten sich ihren Abzug aus Aachen hätten ausmalen können, wäre ihnen doch sicher nicht in den Sinn gekommen, dass das Schicksal 130 Jahre nach ihrem ersten Eintreffen in der Stadt eine erneute Wendung nehmen und wiederum Preußen nach Aachen bringen würde. Doch diesmal nicht als Herren, sondern als bettelarme, heimatlose Flüchtlinge.
Ganz in der Nähe des Marschiertors steht ein reizloses Nachkriegsgebäude, das »Haus des deutschen Ostens«, das Organisationen jener Vertriebenen und Flüchtlinge aus Preußen und anderen früheren deutschen Ostgebieten beherbergt, die sich nach dem Krieg in Aachen niederließen. Meine Recherchen unter diesen Vertriebenen führten mich eines Tages in einen Vorort von Aachen, zu einem Besuch bei Herrn und Frau Kelch.