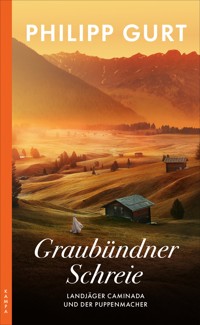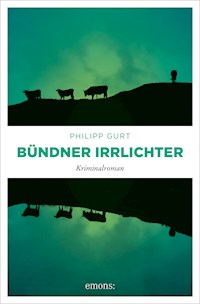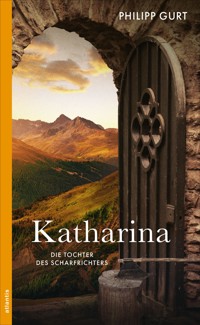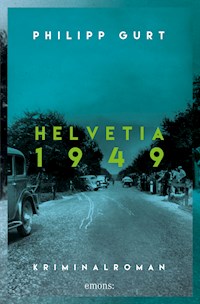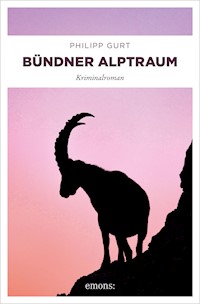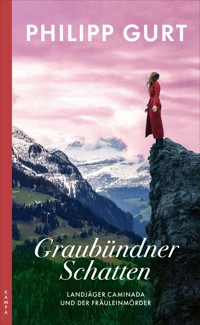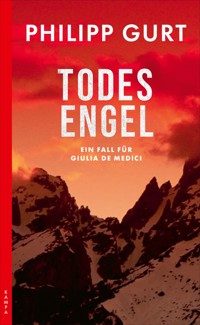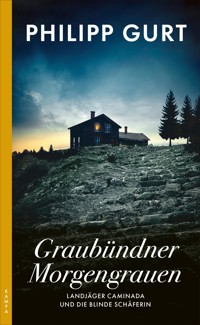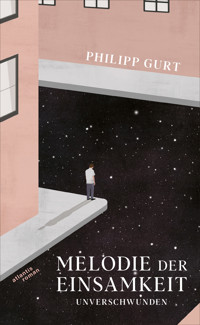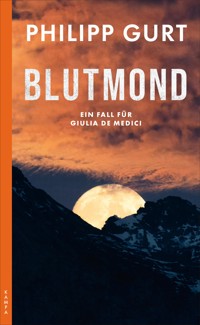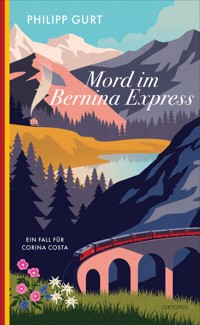13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Giulia de Medici
- Sprache: Deutsch
Das Abendrot spiegelt sich im See am Fuße des Haupterhorns. Während das Vieh friedlich weidet, blickt eine junge Frau ins Wasser. Sie sieht ein Gesicht, ihr eigenes, doch sie erkennt sich nicht. In der Hand hält sie ein blutiges Messer - und weiß nicht, warum ... Giulia de Medici, Chefermittlerin der Kantonspolizei Graubünden, wollte ein paar Tage in ihrer Hütte im Hochtal Sapün verbringen, in der Abgeschiedenheit der Berge, auch um ihre große Liebe Erkki zu vergessen. Doch dann steht mitten in der Nacht eine verstörte Frau mit einem blutverschmierten Messer vor Giulias Tür: Woher kommt sie? Ist sie Täterin oder Opfer? Braucht sie Hilfe, oder will sie Giulia etwas antun?Noch in derselben Vollmondnacht begeben sich Giulia und ihre Kollegin Nadia Caminada auf Spurensuche. Schnell wird klar, dass die Alpweiden nicht so verlassen sind, wie sie scheinen: Die Polizistinnen geraten in Lebensgefahr, und ihre Ermittlungen führen sie zurück bis ins Jahr 1984, als der Linthebene-Mörder im Unterland Angst und Schrecken verbreitete.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 438
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Philipp Gurt
Abendrot
Ein Fall für Giulia de Medici
Kampa
Für Elisabeth und Andri Ventura
in großer Dankbarkeit für all die schönen Stunden, die ich als Kind in eurer Familie verleben durfte.
Prolog
»Nein, nein, neeeein!« Verzweifelt raufte er sich die Haare, als er sie mitten in der lauwarmen Sommernacht vor sich im pechschwarzen Hochmoor liegen sah. »Das ist unmöglich«, hörte er sich leise sagen.
Bei ihrem Anblick hämmerte sein Herz eine uralte Angst in ihm hoch. »So eine verreckte Sauerei aber auch!«, zischte er nicht minder verzweifelt und vergrub sein Gesicht in den großen Händen.
Die junge Frau trug ein dunkles Top mit schmalen Trägern und lag bäuchlings im Moor, das sich am Ufer des kleinen Bergsees Lai Neir ausbreitete. Es sah aus, als wäre sie am Ufer stehend, wie ein gefällter Baum, vornübergefallen. Ihre hellen Fußsohlen zeigten in den schwarzen Himmel und etwas abseits lag, wie hingeworfen, ein umgekippter pinker Turnschuh. Ihr schwarzes Haar zerfloss im sumpfigen Wasser. Die Jeans war nach unten gerutscht und hing ihr mittig über dem Hintern, der sich heller aus dem Morast wölbte als ihre schmalen Schultern, die, bereits tiefer versunken, kaum noch hervorlugten. Luftblasen blubberten neben ihrem Kopf an die Wasseroberfläche, als atmete sie ein letztes Mal aus. Einzelne verfingen sich in ihrem Haar, während sie kaum merklich versank.
Knorrige Legföhren wie eine Horde Berggeister umschlossen den runden Schwarzsee auf zweitausend Meter. Auf seiner Oberfläche strahlten die Sterne in ihrer Unverrückbarkeit Gleichgültigkeit aus.
Der Mann blickte sich verzweifelt um.
In Gedanken versunken machte er sich auf den Rückweg, wobei er versuchte, seine großen Fußabdrücke im aufgeweichten Boden mit den Fußspitzen zu verwischen, als ihn ein Geräusch aus dem Wald aufschreckte.
1
Mit unsicheren Schritten ging sie durchs Abendrot, das flammend ihr Gesicht und die Felswand hinter ihr erglühen ließ, deren Fuß sie talwärts gefolgt war, ehe sie die steilen Bergweiden erreicht hatte. Ihr linker Arm baumelte wie ein Stück fremdes Fleisch an der Schulter, ihr unverletztes Auge spiegelte stummes Grauen.
Unvermittelt blieb sie stehen, als wollte sie die Schönheit der Bergwelt bestaunen. Die weitläufigen Alpweiden atmeten lauwarm die Tageshitze aus, das Läuten der Glocken und Schellen war das einzige Geräusch in der Stille dieser Abgeschiedenheit. Ihr Blick wanderte talwärts über die Sommerweiden, durch die ein Wildbach purzelnd einen Trichter gezogen hatte. Ein paar Mutterkühe weideten mit ihren Kälbern nahe dem weiter unten gelegenen Bergsee, der, in einer Mulde eingebettet, die grellen Farben des Himmels einfing. Auf der anderen Seite des Baches graste das Galtvieh; zahlreiche Rinder, Jungstiere und Ochsen. Gemeinsam mit den Jährlingen und den Färsen punkteten sie dunkel das Grün.
Wieso sie Namen dafür wusste, war ihr schleierhaft, ebenso, warum sie sich inmitten dieser ihr fremden Bergwelt befand und vor allem, weshalb sie ein blutiges Messer umklammert hielt.
Was war geschehen?
Diese Frage wiederholte sich in ihrem Innersten wie das stetige Tropfen eines Wasserhahns. Und so wie jeder Tropfen nichts von dem davor gefallenen wusste, so wusste auch sie nicht, dass sie sich diese Frage schon viele Male gestellt hatte.
Sie blickte an sich herunter, so als gehörte dieser Körper nicht zu ihrem fragenden Geist; gebräunte Beine ragten aus kurzen Jeans, Füße steckten in leichten Bergschuhen, das linke Knie war aufgeschlagen. Ihr apricotfarbenes Shirt war dreckig und verzogen. Wer immer ich auch bin, dachte sie, ich muss sportlich und noch recht jung sein. Weshalb sie ihren linken Arm nicht bewegen konnte, wusste sie nicht. Beim erneuten Versuch ihn zu heben verspürte sie einen brennenden Schmerz in der Schulter.
»Vielleicht ist sie ausgekugelt?«, fragten ihre aufgeschwollenen Lippen stumm. Sie hob ihre rechte Hand mit dem Messer vors Gesicht und starrte es mit dem rechten Auge an, denn das linke war zugeschwollen. Ihre Gedanken und ihr Geist waren in einem Käfig eingesperrte Vögel, die vergeblich flatterten. Zudem war ihr übel und schwindlig, sodass sie sich übergeben musste.
Mit unrhythmischen Schritten und gefolgt von ihrem wachsenden Schatten, der sich mit dem Verschwinden des bergwärts kletternden Sonnenlichts allmählich hinter ihr auflöste, stieg sie die Flanke zum kleinen See hinab. In der baumlosen Weidenlandschaft setzte sie sich am seichten Ufer ins sattgrüne Gras. Nur noch mattorange leuchteten die lichten Anhöhen über ihr, während die Schattenberge bedrohlich anwuchsen, als wollten sie den Tag vollends verschlingen.
Unwillig legte sie das Messer zur Seite, beugte sich übers Wasser, das ihr Spiegelbild als dunkle Silhouette wiedergab, und trank gierig aus der hohlen Hand. Danach umklammerte sie sofort wieder den Schaft der Waffe, nur beäugt von zwei Kühen und deren Kälbern, die in gebührendem Abstand zu ihr standen und wegen der sie umschwirrenden Fliegen mit den Ohren wackelten.
Das Hirn der jungen Frau schien sich mitsamt ihrem Zeitgefühl verflüssigt zu haben. Sie kriegte keinen Gedanken zu fassen, während sie bewegungslos am Ufer saß. Nur ein tief in ihr verborgenes Gefühl schwappte zaghaft hoch, als die Dämmerung wie aus einer riesigen Salzmühle über die Szenerie gestreut wurde. Dabei überkam sie so etwas wie Friede, der sie an irgendetwas weit Entferntes erinnerte.
Erst als sich die Nacht wie ein Film auf ihre Haut legte, das Gras feucht vor Tau wurde und die Sterne auf dem rabenschwarzen Seelein so lebendig schimmerten, als fehlten sie am Himmel, trieb ihr Instinkt sie wieder auf die Beine.
Auf der anderen Uferseite angekommen, dort wo der See in den Wildbach abfloss, stieg schräg hinter ihr der Mond über einer Felswand hoch und warf ihr ihren Schatten vor die Füße. Sie drehte sich um. Verstörend schnell wuchs die Kuppe zu einem Vollmondriesen an, der die Bergwelt mit seinem Glanz versilberte. Geblendet schloss sie das Auge, nur für einen Moment, wie ihr schien, da prangte die gleißende Scheibe seltsamerweise bereits eine Handbreit höher.
Nun folgte die junge Frau ihrem blassen Nachtschatten talwärts, als leite sie ein stummer Berggeist, um sie vor den Irrlichtern der Bergwelt zu bewahren. Das Plätschern des Wildbachs und das vereinzelte Läuten der Schellen begleiteten sie, bis sie in den ruhenden Matten eine Hütte ausmachte. Es roch vertraut nach Kaminfeuer.
Mit geweiteter Pupille, das Messer umklammert, näherte sie sich dem Maiensäß, aus dessen geschlossenen Fensterläden gelbliches Licht schimmerte.
Giulia de Medici war allein. Die dreiunddreißigjährige Ermittlerin der Kantonspolizei Graubünden hatte die hölzernen Fensterläden und die Haustür ihrer Berghütte verriegelt.
Erst am Nachmittag war sie an diesem Montag hier oben angekommen, nachdem sie Chur am späten Vormittag bei brütender Sommerhitze verlassen hatte. Während der kurvenreichen Fahrt das Schanfigg hoch plätscherten ihre Gedanken dahin wie das Programm des Regionalsenders.
Den Eingang zum Hochtal Sapün erreichte sie gegen Mittag. Danach folgte sie der Straße weiter bergwärts und fuhr am Dörfli vorbei. Auch hinten, im kleinen Tobel, war es kaum kühler. Durch das offene Schiebedach wehte der warme Duft der Tannen herein. Diese krallten sich, wo immer sie konnten, an den steilen Wänden fest, während tief unter Giulia der Sapünerbach kräftestrotzend durch die Enge rauschte.
Hinter dem Tobel öffneten sich zur Linken wieder die Alpweiden, die sich sanft an die Bergflanken schmiegten, als hätte es die Schlucht nie gegeben. Nur das massige Bett des Sapünerbachs, in das vereinzelt Steinmuren aus den stetig näher zusammenrückenden Bergflanken stürzten, teilte das Tal. Der in dieser Höhe lichter werdende Bergwald wuchs nur noch an der steilen Westflanke etwas geschlossener, bevor er auch dort der mächtigen steinernen Chüpfenflue weichen musste, deren Gipfel, wie der des Haupterhorns gegenüber, schneebedeckt war.
Beim jahrhundertealten Berggasthaus Heimeli angekommen, parkte Giulia ihren knallroten Audi Q5 unter dem einzigen Baum am Ende der Bergstraße.
Nachdem sie auf der Sonnenterrasse unter einem der verblichenen Sinalco-Schirme gegessen und eine Schorle getrunken hatte, saß sie vor ihrem Cappuccino. Gut gelaunt trat die junge Wirtin, Babina Candraia, an den Zweiertisch.
»Und, Giulia, wie hat dir heute dein Essen geschmeckt?«
»Soll ich wie immer ehrlich sein?«
»Was meinst du, warum ich ausgerechnet dich frage?«
»Nicht, dass ich hier früher schlecht gegessen hätte, doch das Menü heute war schlicht großartig. Wie kommt’s?«
Babina, die ein schickes, blaues Dirndl trug, lächelte. »Ich hatte gehofft, das zu hören, denn ich durfte in der Zwischensaison einem bekannten Koch über die Schultern schauen und habe einige Menüs mit ihm zusammengestellt. Das hier war nur eines davon.«
»Schön, das freut mich für dich und auch für mich.« Giulia wusste, dass Babina erst seit drei Jahren Eigentümerin des Berggasthauses war und in der ersten Saison Probleme gehabt hatte, was die warme Küche betraf.
Giulia zahlte, gab ein gutes Trinkgeld und schulterte den schweren Rucksack mit den Vorräten drin. Danach stieg sie durch die Weiden den Berg hoch. Der kornblumenblaue Himmel, mit den wenigen schneeweißen Schönwetterwolken, spiegelte sich in ihrer Sonnenbrille. Ihr schwarzes Haar trug sie zu einem Pferdeschwanz gebunden, der ihr aus dem Cap ragend eine Handbreit über die Schulter fiel. Bis auf das Läuten der Schellen und das leise Brummen eines Doppeldeckers, der in der Ferne im Blau entschwand, war es still. Hin und wieder blieb sie stehen und blickte in die Weite der Berglandschaft. Dabei erspähte sie durch ihr Fernglas in den steinernen Planggen der Chüpfenflue ein Rudel Hirsche, das sich mühelos auch im steilsten Gelände fortbewegte.
An diesem Tag stellte sich das Gefühl, in den Himmel zu steigen, nicht wie sonst bereits beim Aufstieg ein, während die Berggipfel um sie mit jedem Höhenmeter schrumpften. Doch sie wusste, es würde kommen, denn hier oben galten andere Gesetzmäßigkeiten als im Tal.
Nach einer Dreiviertelstunde Aufstieg erreichte sie am Nachmittag ihre Hütte. Sie liebte den Geruch im Innern, wenn sie nach längerer Abwesenheit die uralte Tür aufstieß: Es roch nach Holz und der Asche aus dem gusseisernen Herd, den sie fürs Kochen oder Heizen einfeuern musste.
Als Erstes entriegelte sie, dem immer gleichen Ritual folgend, die roten Läden, stieß sie nach außen auf und ließ die drei Fenster sperrangelweit geöffnet, ehe sie die kleine Solaranlage, die auf dem Dach installiert war, überprüfte, den Minikühlschrank einschaltete und die Vorräte verstaute.
In Gedanken versunken richtete sie weiter alles her und kontrollierte den steinernen Brunnentrog neben der Hütte, der unter dem einzigen Baum hier oben, einer uralten Arve, stand. Das Quellwasser plätscherte munter aus dem rostfarbenen Hahn, der Überlauf versickerte nach zwanzig Metern im aufgeweichten Boden, so wie immer. Sie beugte sich vor und trank das sprudelnde Nass. Beim Aufrichten wischte sie sich mit dem Handrücken über den Mund, blickte auf die Hütte und dachte an ihren Ex-Freund Erkki Korhonen, der Mitte März nach Norwegen gereist war, weit in den Norden, in die hellen Nächte. Er hatte Arkon, ihren gemeinsamen Schäferhund, mitgenommen, was zu einer heftigen Diskussion geführt hatte, weil er erst Ende Sommer mit ihm zurückkehren würde.
Erkki war mit seiner Neuen, dieser Hedda Åkesson, verreist, einer schwedischen Psychologin und Mentaltrainerin. Die beiden feierten am heutigen Tag bestimmt mit ihren Familien das Mittsommerfest, so wie Giulia und Erkki es früher getan hatten. Und wie früher würde dieser Spaß bestimmt bis weit in den nächsten Tag hinein dauern.
Vor seiner Abreise hatte Erkki angedeutet, dass es ihn zurück in seine Heimat zöge, möglicherweise für immer. Dabei spielte diese Hedda Åkesson eine Rolle, da war sich Giulia sicher, sagte ihm gegenüber aber natürlich nichts. Nur, dass sie sich für ihn freue, was nicht gelogen, aber auch nicht die ganze Wahrheit war. An so Quatsch wie »Wir bleiben für immer beste Freunde« glaubte sie nicht. Seine Neue, was für ein Mensch sie auch sein mochte, hatte einen Anfang mit ihm ohne sie im Hintergrund verdient. Nach dem Streitgespräch wegen Arkon hatte Giulia Heddas Webseite aufgerufen. Die Frau war nicht nur ausgesprochen attraktiv, die blonde Sportlerin und Psychologin strahlte auch Persönlichkeit aus, blickte im Großformat selbstsicher aus dem Display, als würde ihr Blick nur Giulia gelten, so, als hätte sie gewusst, dass sie sich hier zum ersten Mal begegnen würden.
»Nobody is perfect …« Mit diesem Gedanken hatte Giulia das Bild weggeklickt und dachte, dass es bestimmt einen Grund gab, warum diese Hedda ausgerechnet Psychologin geworden war.
Mittlerweile war es im Sapün Abend geworden und Stille lag über dem Hochtal. Seit über einer Stunde versuchte Giulia in ihrem Lieblingssessel zu lesen. Sie war barfuß und trug eine schlabbrige dunkle Trainerhose. Auf ihrem weißen Shirt war in Hellblau das Emblem samt Krone der Columbia University aufgedruckt. Die rot karierte Schirmlampe aus den Fünfzigern, die über dem hölzernen Küchentisch in der Ecke hing, spendete ihr weiches Licht, während im Herd, auf dem eine Kupferpfanne stand, die Reste des Feuers züngelten.
Giulia hatte diese Einsamkeit in den Bergen gesucht. Erst zwei Tage zuvor, am Samstag, war sie aus Italien zurückgekehrt. Sie hatte ihren Sommerurlaub genutzt, um in die Toskana zu fahren, ins Familienhotel Oceano Blu, das ihr Papa Lorenzo seit dem Tod ihrer Mamma Sophia gemeinsam mit ihrem Bruder Massimo und dessen Frau Adriana führte. Letztere hatten sie vor wenigen Wochen zur Zia gemacht und Giulia hatte sich gefreut, ihre Nichte Stella zum ersten Mal zu sehen.
Die Kleine hatte ein gar süßes Näschen und einen Mund zart wie eine rosa Knospe, fand Giulia, die manchmal an den Nachmittagen mit dem schlafenden Baby im Arm im Schatten der großen Pinie auf der Veranda saß. Liebevoll küsste sie immer wieder die Stirn der Kleinen, die warm nach Karamell und Milch duftete, während sie sich fragte, was im Leben alles auf das kleine Bündel zukommen würde, oder ob sie, Giulia, eine gute Mamma abgäbe.
Beim Anblick von Stella war Giulia einerseits traurig, dass ihre verstorbene Mamma ihre Enkelin nie sehen würde, andererseits brachte die Kleine endlich neues Leben in die Familie und Nonno Lorenzo blühte sichtlich auf, was Giulia freute. Denn nur Monate zuvor, bei ihrem letzten Besuch zu Hause, durchtränkte die Trauer alles. Mamma hatte eine große Lücke hinterlassen. Sie war plötzlich fort gewesen, als hätte jemand einen Lichtschalter gedrückt, doch sie hatte ihre Liebe und ihre unbändige Lebensfreude zurückgelassen.
»Alles hat seine Zeit, mia cara.« Das hatte Sophia ihrer schon immer rebellischen Tochter so oft mit einem liebevollen Lächeln gesagt, als diese in ihrer Ungeduld Berge versetzen wollte, wo manchmal nicht mal welche waren. Diese Worte trug sie seither mit sich, wie den Ring, den Mamma ihr vererbt hatte.
Auch während dieser Ferien hatte Giulia wie immer im Ristorante und an der Rezeption des Familienhotels mitgearbeitet. Täglich joggte sie im ersten Morgenlicht am Meer entlang und hinterließ ihre Spuren im Sand, die von den Wellen weggespült wurden. Mit Musik oder den Geräuschen der Natur in den Ohren raubte das Laufen Schwerem seine Kraft und verwandelte es in positive Energie. Nach einem erfrischenden Bad in den Wellen saß sie danach mit feuchten Haaren auf der Terrasse des Oceano Blu und frühstückte mit der Familie, bevor sie bis in die frühen Nachmittagsstunden im Hotel arbeitete.
In ihrer Freizeit legte sich Giulia an den Strand oder fuhr mit dem Motorboot, das ihr Bruder Massimo sich letztes Jahr zugelegt hatte, weit hinaus. Einmal schaltete sie weit draußen den Motor aus. Nur noch der Kompass zeigte ihr an, in welcher Richtung sich das Ufer befinden musste. Sie legte sich in ihrem weißen Bikini auf den Bug. Ihre gebräunte Haut duftete nach Kokosmilch-Sonnencreme, eine leichte Brise ging, die Wellen wiegten sie sanft, und vereinzelt kreischte eine Möwe. Aus der Ferne schwappte leises Brummen anderer Schiffsmotoren zu ihr.
Wie sie da in der Sonne lag, musste sie an das denken, was zweieinhalb Monate davor geschehen war und ihr Leben im wahrsten Sinne des Wortes gezeichnet hatte. Am einundzwanzigsten März war sie beim Sportklettern gestürzt, wie viele Male zuvor auch, doch bei diesem Sturz verlief nicht alles wie sonst. Sie war ein Wochenende lang mit drei Freundinnen im Alpsteingebiet unterwegs gewesen, sie hatten campiert, am Lagerfeuer gesessen und gemeinsam eine gute Zeit gehabt. Am Sonntagnachmittag, auf der letzten Tour, fiel sie beim Vorstieg ins Seil und schlug mit ihrem Gesicht unglücklich an einen der Kletterhaken. Dabei zog sie sich eine breite Risswunde zu, die, wie sich später im Krankenhaus herausstellte, bis auf den Wangenknochen ging. Wie der behandelnde Arzt prophezeit hatte, blieb eine deutlich sichtbare Narbe zurück, die über ihren Lippen begann und schräg zum Wangenknochen hoch verlief.
Deshalb war Giulia Anfang Juni zu einer Spezialistin nach Zürich gereist. Die schlug ihr eine neuartige Laserbehandlung vor, die Wunder bewirken könne, sodass mit einem dezenten Make-up kaum mehr was zu sehen wäre. Doch das Einzige, was Giulia seither unternommen hatte, war die Narbe vor der Sonne zu schützen.
Auch wenn die Narbe so auffällig in ihrem Gesicht prangte wie eine zweite Nase, ging Giulia in Italien abends so selbstbewusst aus wie eh und je. In ihrem Zimmer, das Papa stets für sie bereithielt, machte sie sich vor dem Spiegel ihrer Mamma zurecht. Da sie sich meist nur dezent schminkte, auch die Sommersprossen um die Nase herum selten überdeckte, tat sie es auch mit der Narbe nicht. Stattdessen schmiss sie sich in ein apricotfarbenes Sommerkleid, das von der Hüfte aus locker bis eine Handbreit über die Knie fiel. Als sie das Zimmer verließ, trug sie das Paar Schuhe mit Korksohlen, das im Sommer so zu ihr gehörte wie ihre Füße selbst.
Der Wind hatte noch nicht gedreht, eine warme Brise kam vom Meer, als sie in der Abenddämmerung das Hotel verließ. Die dunkle Sonnenbrille hatte sie in ihr offenes Haar hochgeschoben. Die letzten Farben des Sonnenuntergangs schwebten tief am Horizont und schimmerten auf ihrem dunklen Teint, von dem sich nur die Narbe hellrosa abhob.
Mit Gracia, einer Angestellten des Hotels, mit der sie sich gut verstand, feierte sie eine Stunde später auf einer Strandparty. Petroleumfackeln steckten im Sand und eine bunt leuchtende Lichterkette umschloss kitschig die kleine Tanzfläche. Die beiden Frauen zogen viel Aufmerksamkeit auf sich, während sie tanzten, tranken und lachten, als wären sie ineinander verliebt. Zu Giulias Freude spielte der alte, aber aufgedrehte DJ Songs aus den Achtzigern. Sie gab sich ganz der Musik hin, und es war, als schwebten all die schweren Gedanken wie Nachtvögel davon.
Am Ende eines weiteren Songs strich sich Giulia das Haar zurecht und ging barfuß zur Strandbar, ihre Schuhe baumelten in ihren Händen. Die Blicke, die an der Bar wiederholt einen Tick zu lange an ihrer Narbe hängen blieben, waren ihr egal. Es gab anderes, das sie störender fand, und das wäre auch mit einer Laserbehandlung niemals wegzukriegen.
Bei diesem Gedanken und nach einem Lächeln in die Runde nahm sie einen Schluck von ihrem Fruchtdrink, der mit einem Schirmchen und einem Schnitz Kiwi dekoriert war. Ihr kam dabei das Gespräch mit ihrem Papa von vor zwei Jahren in den Sinn. Nachdem er damals von ihr erfahren hatte, dass es aus war mit Erkki, hatte er mit einer Mischung aus Erstaunen und Mitgefühl gesagt: »Mamma mia, was ist denn los, cara mia? Der war doch ein guter Kerl.«
»Die nordische Gelassenheit auf mein südländisches Temperament hat eben nicht gereicht«, meinte sie achselzuckend. »Papà. Che cosa vuoi? È la vita.«
»Ja, was will man machen, das Leben macht manchmal, was es will, und du ja sowieso …« Er lächelte sie an, wie nur ein stolzer, liebender Vater es vermag, und nahm ihre Hand. »Es wird der Richtige kommen, amore mio. Ganz bestimmt sogar, denn du bist was ganz Besonderes. Glaub mir, irgendwann werde ich dich als wunderschöne Braut sehen.«
Sie sagte ihm nicht, dass sie nicht mal sicher sei, ob sie überhaupt heiraten wolle. Sie brauchte keinen Mann, um sich zu vervollständigen, und an kurzen Treffen war sie noch nie interessiert gewesen. Sie wollte geliebt werden, wie wahrscheinlich alle anderen auch, und zwar genau so, wie sie war, und damit basta. Doch so, wie sie war, schien eine Beziehung auch für die Guten unter den Männern nicht auf Dauer möglich zu sein. Ihr Lebensstil war sicherlich anstrengend, das wusste sie, und genau das hatte Erkki auf der Türschwelle betont und noch mehr …
»Giu, du machst es einem verdammt schwer und manchmal unmöglich, eine gemeinsame Beziehung mit Zukunft aufzubauen. Ich liebe dich noch immer, aber du hättest dich irgendwann für uns entscheiden müssen – nicht nur für dich und deinen Job. Weißt du, du kommst mir vor wie eine wunderschöne, aber einsame Wölfin. So hin- und hergerissen bist du und nirgends richtig daheim.«
Und sie? Was hatte sie geantwortet? Sie hatte gewusst, dass es stimmte, dass sie sich für jeden ihrer Fälle mehr ins Zeug gelegt hatte als für Erkki – als für ihre gemeinsame Zukunft, wie er richtig erkannt hatte. Doch er hatte nie verstanden, dass sie mit ihrem Herzen dennoch immer nah bei ihm gewesen war, auch dann, wenn sie sich tagelang bei Ermittlungen rumtrieb und sich manchmal danach so kaputt fühlte, als läge ihr Leben in Scherben. Sie hatte Erkki ihre Liebe auf ihre Art geschenkt, aber ihren Lebensrhythmus hatte sie weder opfern wollen noch können. Ihm dies in Worten zu erklären, darin war sie nie gut gewesen, obschon sie den schlimmsten Verbrechern in jedem Verhör unerbittlich gegenüberstehen konnte. Doch sie war sich sicher, dass Erkki es hätte merken können, denn die ehrlichsten Formen der Liebeserklärung sind stumm, glaubte sie zu wissen. Ihr kamen verschiedene Momente in den Sinn, wie jener, als sie mitten in der Nacht, nach einer gescheiterten Ermittlung, in der sie grob zu Boden gestoßen worden war, zu ihm ins Bett geschlüpft war. Da hatte sie sich in seine starken Arme gekuschelt und damit wortlos gesagt: »Schön, dass es dich gibt. Du bist jetzt mein Fels.« Diese Schwäche gegenüber einem Mann zuzulassen war doch ein sehr großer Liebesbeweis, fand sie.
Außerdem konnte sie nie richtig mit ihm streiten. Dafür war Erkki zu ruhig, zu gefasst. Aber wenn sie ihn mal endlich aus der Reserve geholt hatte, warf er ihr in seiner für sie provozierenden Gelassenheit vor, eine Egoistin zu sein, während sie ihm ausgesprochen temperamentvoll Paroli bot. Sie stemmte dann immer wütend die Hände in ihre Taille und musste sich zusammenreißen, um ihm nicht dauernd reinzureden oder ihn anzubrüllen.
»Weißt du, Giulia …« Er nannte sie nur dann beim vollen Vornamen, wenn er wütend war. »Genau darum bist du in deinem Job die Beste. Weil alles andere hintenanstehen muss. Wirklich alles! Und nach jedem gelösten Fall kommt ein neuer und das Ganze beginnt von vorne. Das hat kein Ende. Aber was ist mit uns beiden? Und Arkon gibst du immer dann mir ab, wenn du glaubst, er hätte es besser bei mir, und deine Erklärungen dazu klingen stets plausibel.«
»Ja und?« Giulia kochte. »Wenn ich irgendwo tagelang ermittle und Arkon dabei nicht zum Einsatz kommen kann, soll er dann etwa den ganzen Tag in der Box hocken, nur damit du nichts zu motzen hast?«
»Giulia. Ich bin auch dann für ihn da, wenn’s mir gerade nicht passt, und richte mich danach – für ihn! Auch als Bergführer hat man Verpflichtungen. Verstehst du? Aber während deiner Ermittlungen lebst du mit Tunnelblick!«
»Aber er hat es ja in dieser Zeit auch besser bei dir als bei mir.«
»Willst du nicht verstehen? Er könnte es auch in solchen Momenten bei dir gut haben! Du müsstest dann halt Kompromisse eingehen.«
»Ach ja? Sag das doch einem Verbrecher! Er soll bitte auf mich warten, meinem Hund zuliebe …« In ihrer Stimme schwang Sarkasmus.
Sie hätte ihm damals noch viel dazu sagen können, beispielsweise, dass die wenigen Momente, die Erkki und sie gemeinsam hatten, für sie genau deshalb so intensiv und voller Leben waren, weil sie so selten waren. Sie hätte auch noch sagen können, dass eine Beziehung allein sie nicht erfülle und dass sie nicht der Typ Frau sei, die in eine Schublade passe, und dass er vielleicht aus seiner Sicht recht habe, aber dass es im Leben manchmal zwei Wahrheiten gebe und deshalb in diesem Fall niemand im Recht oder Unrecht sei. Doch in diesen Diskussionen verlor sie immer wegen ihres Temperaments. Am Ende verließ sie einmal mehr wütend die Wohnung und ging joggen. Noch auf der Türschwelle hätte sie ihn am liebsten angeschrien: »Erkki, verdammt, ich kann doch nichts dafür. So ist mein Leben nun mal und wir haben deshalb beide verloren! Ich weiß. Wegen mir. Okay? Und jetzt verschwinde in dein perfektes Leben. Und ja, es tut mir leid – irgendwie –, aber es gäbe verdammt noch mal auch einen Weg mit mir.«
Das Aus war mittlerweile über zwei Jahre her.
Am Vorabend ihrer Abreise aus Italien hatte Giulia mit Stella im Arm am Familientisch gesessen und die Zeit, den Moment genossen. Papa Lorenzo setzte sich mit einem Grappa in der Hand und einem Lächeln im Gesicht zu ihnen. Er strich seiner Enkelin übers Haar, das schon üppig und pechschwarz war, dann blickte er Giulia an. In seinen warmen Augen sah sie, was sie für ihn war. Er liebte sie nicht nur, er platzte auch vor Stolz, dass sie es zur Chefermittlerin der Kantonspolizei Graubünden gebracht hatte. Er mochte ihren Kampfgeist, das hatte er schon viele Male gesagt, und dass sie auch in der größten Verzweiflung nie aufgab. Als er sie mal in der Schweiz waffentragend gesehen hatte, lächelte er und sagte scherzhaft: »Meine schöne Ballerina!«
Adriana und Massimo gesellten sich ebenfalls an den Tisch. Stella musste, kaum saßen sie, mehrmals so herzhaft niesen, dass ihr ganzer Körper dabei zuckte, worauf alle lachten.
»Giulia, bleib doch noch ein paar Tage hier. Es ist so schön, bist du da, und Stella mag dich sehr. Du kümmerst dich so liebevoll um die Kleine«, sagte Adriana und Giulia dachte, dass weder Papa noch Massimo gefragt hatten, weil sie die Antwort bereits kannten. Sie war bereits zehn Tage hier gewesen und wollte die letzte Woche ihres Urlaubs in die Berge fahren, ohne die sie genauso wenig leben konnte wie ohne das Meer. Doch das war nicht der einzige Grund – es war diese Unruhe, die sie weitertrieb.
Nach dem Abendessen fuhr sie mit Papa Lorenzo nach Genua. Die Sonne schimmerte golden über dem Mittelmeer. Es war noch immer brütend heiß, und die Stadt war gefüllt von Lärm und Gerüchen aller Art. Erst in den engen Gassen der Altstadt wurde es etwas leiser, das Leben beschaulicher, die Düfte der kleinen Ristoranti mischten sich mit denen der restlichen Stadt.
Sie gingen schweigend nebeneinander zur Piazza di Carignano. Dort stand die Basilika di Santa Maria Assunta. Mamma hatte sich nur ein schlichtes, weißes Kreuz gewünscht und eine weiße Madonna, die ihre Hände zum Gebet gefaltet und den Blick zum Himmel gerichtet hatte. Während Giulia vor dem Grab stand und im Stillen ein Gebet und danach mit ihrer Mamma sprach, spielte ihre rechte Hand mit dem Ring an ihrer Linken. Sie vermisste ihre Mamma, der sie wie aus dem Gesicht geschnitten war. Papa wies sie mit Erstaunen auf ihre Ähnlichkeit hin, als hätte er es eben zum ersten Mal bemerkt. Und es stimmte. Giulia hatte die alten Fotoalben durchgeblättert. Sie und ihre Mamma waren im jeweiligen Alter, abgesehen vom Kleidungsstil, kaum zu unterscheiden. Von ihrer Mamma hatte Giulia auch die leicht heisere, kraftvolle Stimme Süditaliens geerbt. Früher hatten sie bei jedem Familienfest zusammen gesungen, und das, seit Giulia ein kleines Mädchen war. Und wenn Mamma mal sang und ihrem Temperament entsprechend dazu tanzte, dann konnte das dauern.
Giulia konnte sich besonders gut an ein Familienfest auf Sizilien erinnern, dort, wo ihre Mamma aufgewachsen war. Ihre Nonna, sie lebte noch immer dort, am südlichsten Zipfel, feierte damals ihren siebzigsten Geburtstag. Giulia war neun Jahre alt gewesen, als sie und Mamma auf der kleinen Holzbühne mitten im Olivenhain »Azzurro« und »L’Italiano« sangen. Es war heiß gewesen, strahlende Gesichter überall, und Nonna Emilia sang und klatschte dabei vor lauter Lebensfreude, während sie Schaffleisch grillten und Rotwein tranken.
Nachdem Giulia Papa zurück ins Oceano Blu gefahren hatte, umarmte sie ihn lange und verließ Genua mit der untergehenden Sonne Richtung Mailand. Sie trug eine legere, kurze Jeanslatzhose über einem hellen Shirt und Sandaletten. Dank des Haarreifs fielen ihr die langen Haare nicht ins Gesicht.
Einige Kilometer außerhalb der Stadt, auf einer Anhöhe des ansteigenden Apennins, hielt sie an und saß fast eine Stunde lang unter einer Akazie auf einer von der Sonne gewärmten Natursteinmauer mit Blick aufs Mittelmeer. Von dort aus schaute sie zu, wie sich das Licht in ein helles Violett verwandelte und schließlich nur noch als gelboranger Streifen am Horizont schwebte. Ihr Herz schmerzte, auch wegen ihrer Mamma.
Wieso, fragte sie sich, tat Fortgehen immer so weh, wenn es sie doch immer wie ein Sog von dort wegzog, wo sie gerade war. Sie wischte sich eine Träne von der Wange und nervte sich gleichzeitig über diesen Weichspülgang, wie sie solche Momente nannte.
Erst als die Lichter der Hafenstadt und der großen Schiffe im Hafen in der Dämmerung zu schimmern begannen und ein letztes Violett, gemischt mit einem Hauch Orange, dort am Horizont schwebte, wo man glauben könnte, die Erde wäre zu Ende, stieg sie in ihren Wagen und fuhr zurück in die Schweiz.
Das war vorgestern gewesen. Nun saß sie allein in ihrer Hütte und versuchte zu lesen. Als sie einen Schluck Kaffee aus der roten, weiß gepunkteten Tasse nahm, schlug etwas dumpf von außen gegen die Holzwand. Da es schon den ganzen Nachmittag über windstill war, vermutete Giulia erst ein Wildtier, das auf der Suche nach Futter umherstreifte. Dennoch blieb sie wachsam, denn vorgestern hatte ihr ihre Ermittlerkollegin und beste Freundin Nadia Caminada eine SMS geschickt und sie darüber informiert, dass eine rumänische Einbrecherbande am Heinzenberg im Domleschg und auch hier in der Gegend ihr Unwesen trieb. Und mit denen war bestimmt nicht zu spaßen.
Ein dreimaliges, rhythmisches Schlagen, das ein Tier kaum zustande brächte, ließ sie nur eine Minute später ihr Buch zur Seite legen und aufstehen, wohl im Wissen, dass jemand sie mit diesem Geräusch nach draußen locken könnte. Sie zog das weiße Shirt aus, streifte sich ein dunkles über und band ihr Haar flüchtig zu einem Pferdeschwanz zurück, bevor sie die sicher verstaute Schusswaffe hervorholte und entsicherte. Die Taschenlampe hielt sie ausgeknipst in der linken Hand bereit.
Da war es schon wieder, dieses Tok, Tok, Tok. Sie löschte das Licht, bevor sie vorsichtig den rechten Fensterflügel öffnete und danach den hölzernen Laden eine Handbreit nach außen schob, was beides nicht geräuschlos vonstattenging.
Sie beäugte durch den schmalen Ausschnitt den Eingangsbereich, der im Schatten des Vollmonds lag. Sie hörte nur das leise Plätschern des Brunnens. Es rührte sich minutenlang nichts, ehe es wieder dreimal an die Hüttenwand klopfte, diesmal, so schien es ihr, kam es von der fensterlosen Rückseite. Sie musste rausfinden, wer oder was das war, denn ohne Klärung würde sie später keine Ruhe finden, erst recht nicht ohne Arkon, der sie immer mit seinem Leben beschützt hatte und auch hier oben stets ihre Alarmanlage gewesen war. Sie musste unbedingt nochmals mit Erkki reden, Arkon war schließlich auch ihr Hund.
Barfuß schlich sie sich zur über dreihundert Jahre alten, massiven Eingangstür, die einst zu dem Walserhaus gehört hatte, das weiter unten im Hochtal gestanden hatte, ehe es im Lawinenwinter 1951 zerstört wurde. In der von der Sonne dunkelbraun gegerbten Holztür hatte sie ein Sicherheitsschloss eingebaut, das nur leise klickte, als sie es aufschloss.
Giulia zog mit erhobener Waffe langsam die Tür nach innen auf und verharrte in der Dunkelheit. Wieder klopfte es an die Rückseite der Hütte. Womöglich wollte man sie glauben lassen, dass nur ein Eindringling ums Haus schlich und die Vorderseite in diesem Moment sicher war. Wer auch immer hier ums Haus schlich, erwartete eine Reaktion von ihr, die Giulia auf ihre Weise nun geben würde.
Sie kannte jeden Stein, jede Unebenheit rund um ihr Maiensäß, und würde diesen Vorteil jetzt nutzen. Nach einem tiefen Atemzug rannte sie so leise und doch so schnell wie möglich aus der Tür und legte sich erst nach zwanzig Metern in die dort abschüssige Weide. Sie starrte zur Hütte zurück, deren Steindach mit dem kleinen Solarpanel im Mondlicht schimmerte. Ihre ausgezeichneten Augen konnten nirgends eine Bewegung ausmachen. Wer auch immer sich versteckt hielt, tat dies auf der Rückseite der Hütte.
Die gezogene Waffe in der rechten und die Taschenlampe in der linken Hand haltend, umging sie das Maiensäß in gebührendem Abstand, um den besten Winkel nutzen zu können. Sie achtete darauf, dass sie nicht vor dem Brunnen durchschlich, da sie sonst dessen Plätschergeräusch für einen Moment verdeckt hätte, was eine aufmerksame Person in dieser Totenstille sofort hätte hören und sie damit hätte orten können. Außerdem war sie sich ziemlich sicher, dass sich die Person hinter dem mannshohen Holzstoß versteckt hielt, den sie vor Jahren auf der Rückseite des Hauses aufgeschichtet hatte.
Giulias Sinne liefen auf Hochtouren und sie fühlte, barfuß, wie sie war, jeden Zentimeter Boden, auf dem sie ging. Immer wieder warf sie einen kurzen Blick zurück, doch da lag nur die vom Vollmondlicht erhellte Weide, in der sie eine dunkle Gestalt längst hätte ausmachen können.
Wenige Meter vor dem Holzstoß blieb sie mit gezückter Waffe stehen, als langsam eine mit einem Messer bewaffnete Frau dahinter hervorkam. Giulia knipste die Taschenlampe an, um die Frau zu blenden. Diese wies, wie sie sofort erkannte, erhebliche Gesichtsverletzungen auf.
»Kantonspolizei Graubünden! Lassen Sie sofort das Messer fallen, wir sind bewaffnet«, forderte Giulia die dunkelhaarige Frau auf, die aber keine Anstalten machte, ihrem Befehl Folge zu leisten, und sich auch nicht nach weiteren Beamten umsah.
»Ich fordere Sie nochmals auf, legen Sie sofort das Messer zur Seite, damit wir unsere Schusswaffen nicht einsetzen müssen.« Giulia benutzte bewusst nochmals das Wir, damit, falls sich noch jemand versteckt hielt, derjenige nicht wusste, mit wie vielen Beamten er es hier zu tun hatte. Doch statt die Waffe niederzulegen, kam die Frau weiter auf Giulia zu, Schritt für Schritt, das Messer auf Brusthöhe nach vorne gerichtet. Das grelle Licht schien ihr dabei nichts auszumachen.
Jetzt wäre ein Taser oder wenigstens ein Pfefferspray hilfreich, dachte Giulia und warf nochmals einen schnellen Blick zurück, bevor sie die Frau wieder ansah. Diese schien verwirrt zu sein und damit unberechenbar, eine äußerst heikle Situation, denn die Klinge war blutig.
»Mein Name ist Giulia de Medici, ich bin Ermittlerin der Kantonspolizei Graubünden. Legen Sie jetzt das Messer weg. Meine Dienstwaffe ist auf Sie gerichtet.« Ihre Stimme klang fest und ruhig, während sie Schritt für Schritt zurückging, um den Abstand zur Frau zu wahren.
Giulia lief die Zeit davon. Sie musste alles unternehmen, um den Einsatz der Waffe zu verhindern, aber gleichzeitig und in erster Linie ihr eigenes Leben schützen. Außerdem wusste sie noch immer nicht, ob sich nicht noch ein Angreifer irgendwo versteckt hielt. Bewusst hielt sie sich deshalb weiter seitlich von der Hausecke entfernt, um beide Seiten der Hütte im Sichtfeld zu behalten. In ihrem Rücken lagen die vom Mondlicht überfluteten Alpweiden.
Die Frau schritt unbeirrt auf Giulia zu, sodass diese handeln musste. Instinktiv feuerte sie einen Warnschuss in die Luft, der krachend die Nacht im Hochtal zerriss. Die Frau zuckte so heftig zusammen, als wäre sie getroffen, dann senkte sie den Arm und ließ das Messer aus der Hand gleiten.
»Das haben Sie richtig gemacht«, kommentierte Giulia in lobendem Tonfall. »Und nun kommen Sie bitte langsam näher. Ich tue Ihnen nichts, und ich bin sicher, dass wir gemeinsam eine Lösung finden werden.« Giulia wollte die Frau von dem am Boden liegenden Messer weglocken. Jetzt erst senkte sie den Lichtkegel seitlich zu ihren Füßen, damit die Frau sie erkennen konnte. Mit ruhiger Stimme fragte sie: »Was ist denn passiert? Wie kann ich Ihnen helfen?«
Schweigen.
Giulia schätzte die schwarz gelockte Frau auf etwa dreißig und hielt sie aufgrund ihrer Kleidung und ihres Aussehens für jemanden, der oft in den Bergen unterwegs war, so wie sie selbst. Da sank die Frau plötzlich unvermittelt seitlich zu Boden, so wie jemand, der in einem Laientheater eine Ohnmachtsszene schlecht vorspielte.
Angespannt lief Giulia um die Liegende herum, fasste das hinter ihr auf dem Boden liegende Messer mit spitzen Fingern und warf es in den dunklen Hang, ehe sie mit erhobener Waffe zum Haus zurückging. Von außen verschloss sie die Tür, falls sich ein anderer Angreifer mittlerweile darin versteckt haben sollte.
Danach kniete sie sich sofort vor die Frau, die leise stöhnte und scheinbar etwas sagen wollte, aber kein verständliches Wort rausbrachte. Giulia zog ihr Handy aus der Jogginghose und wählte die 1414, die Rettungsflugwacht, welche dank Giulias installierter Ortungs-App sofort den exakten Standort übermittelt bekam. Den Vorfall meldete Giulia unverzüglich via Notrufzentrale auch der Kantonspolizei und forderte Verstärkung und eine Hundestaffel an. Irgendwoher musste die Frau ja gekommen sein, und dort war offensichtlich ein Verbrechen geschehen.
Bis zum Eintreffen der Rettung brachte Giulia die Frau in eine stabile Seitenlage, die verletzte Schulter nach oben gerichtet, nachdem sie bemerkt hatte, dass diese der Frau Schmerzen bereitete. Die Unbekannte trug außerdem eine große Beule am Hinterkopf, wie Giulia feststellte, als sie vorsichtig deren Kopf richtig positionieren wollte. Möglicherweise hatte die Frau in ihrer Verwirrung den Kopf an die Hüttenwand geschlagen.
Die Nacht war trotz der Höhenlage von über zweitausend Meter über Meer recht mild. Dennoch begann die Verletzte wie Espenlaub zu zittern. Obwohl Giulia nicht wissen konnte, ob vor ihr eine Täterin oder ein Opfer lag, redete sie ihr gut zu: »Der Hubschrauber ist in wenigen Minuten hier. Es wird Ihnen bald besser gehen und bis dahin kümmere ich mich um Sie. Einverstanden?«
Die eingeschaltete Lampe lag am Boden, sodass sie nicht blendete, aber ihre Gesichter gut füreinander erkennbar blieben. Noch immer hatte die junge Frau ihr gesundes Auge starr geöffnet, blinzelte nur vereinzelt und antwortete auf keine Frage.
»Jetzt versuche ich einen Ausweis von Ihnen zu finden, damit ich und die Rettung wissen, wer Sie sind«, erklärte Giulia und tastete vorsichtig sämtliche Taschen der kurzen Jeans ab. Weder ein Handy noch eine Identitätskarte noch einen Notfallausweis, den Giulia selbst immer bei sich trug, wenn sie in den Bergen unterwegs war, konnte sie finden. Da die Frau noch immer zitterte, überlegte Giulia, eine Decke in der Hütte zu holen, als die Verletzte wieder etwas sagen wollte, diesmal eindringlicher als zuvor.
»Ich kann Sie nicht verstehen. Tut mir leid. Ich hole Ihnen schnell eine Decke. Bin gleich zurück.« Bevor Giulia sich aufrichtete, beschlich sie schlagartig ein ungutes Gefühl. Sie drehte sich ruckartig herum und sah, wie eine schwarze Gestalt hinter der Hausecke verschwand. Giulia war sich nicht sicher, ob diese wusste, dass sie eben gesehen worden war, oder ob man sie auf diese Weise von der Frau wegzulocken versuchte.
»Keine Angst, bin gleich zurück«, flüsterte sie und schaltete die Lampe aus. Sie nahm ihre Waffe in die Hand, die sie, da sie kein Holster trug, am Rücken in den Bund der Jogginghose gesteckt hatte. Sie entsicherte die Glock. Jetzt durfte sie keinen Fehler machen.
In entgegengesetzter Richtung zur flüchtenden Gestalt schlich sie die wenigen Schritte zur anderen Ecke der Hütte. Erneut war nur das leise Plätschern des Brunnens in der Stille der Nacht zu hören. Der Boden unter ihren nackten Füßen war kühl. Sie wollte soeben ums Hauseck spähen, da schrie die Verletzte hinter ihr auf. Giulia blickte zurück, doch da war niemand. Als sie sich wieder umdrehte, kam eine kräftige Gestalt mit einem Satz um die Hausecke direkt auf sie zugesprungen. Blitzschnell versetzte Giulia ihr einen kräftigen Tritt in den Bauchraum. Zeitgleich verspürte sie selbst einen heftigen Schlag seitlich am Hals, sodass sie taumelte und sich mit der Hand an der Wand abstützen musste. Alles drehte sich, die Hütte schien durch die aufgestützte Handfläche zu kippen, in ihrem linken Ohr rauschte es. Sie sackte auf die Knie. Schlagartig wurde ihr bewusst, dass sie sich schneller als der Angreifer aufraffen musste, sonst würde sie womöglich getötet.
Gegen und mit ihrem Körper zu kämpfen, das hatte sie auch in all den Biathlon-Wettkämpfen gelernt. In den vielen Trainingsstunden hatte sie sich geformt, und als sie auf Rollskis allein alle Engadiner Pässe bezwungen hatte, oder in den harten Wettkämpfen, in denen sie das letzte bisschen Kraft aus ihrem Körper quälen musste, lernte sie, bis an ihre Grenzen und darüber hinaus zu gehen. Deshalb schaffte sie es trotz des Schwindels, sich taumelnd zu erheben. Sie versuchte sich zu orientieren und fiel nochmals zur Seite. Im fahlen Mondlicht erkannte sie dabei verschwommen einen Mann, der gekrümmt am Boden lag. Beim zweiten Versuch richtete sie sich diesmal nur auf die Knie auf. Wankend zielte sie auf den Mann, während sie sich mit der linken Hand am Boden abstützte.
»Kantonspolizei! Einen Zuck bloß und es war Ihr letzter«, zischte sie außer Atem. Doch der Mann rang weiter nach Luft und wand sich dabei. Giulia sah, dass der Holzstock, den er gehalten hatte, für ihn unerreichbar hinter ihm lag. Sie streckte sich seitlich zur Taschenlampe, die ihr aus der Hand gefallen war, und richtete sich langsam vollständig auf. Breitbeinig baute sie sich vor dem Kerl auf, hielt sowohl die Waffe wie auch das gleißende Licht auf ihn gerichtet und sammelte weiter ihre Kräfte.
»Wer sind Sie und warum haben Sie mich angegriffen?« Noch immer war ihr schwindlig.
Der Mann drehte sich zur Seite, ging auf alle viere und übergab sich heftig, bevor er sich wieder wie ein nasser Sack zu Boden sinken ließ. Gequält antwortete er: »Ich bin doch nur … der Hirt … hier oben, der Andreas … Kammerhofer.« Nochmals krümmte er sich und kotzte Galle.
»Und wo ist Rosa?« Giulia war misstrauisch, denn sie kannte die Hirtin, die in den letzten Jahren die Tiere hier oben behirtet hatte. Erst letzten September hatte Giulia sie nach dem Alpabzug in der Festwirtschaft getroffen. Sie hatten draußen am selben Tisch gesessen, Roten getrunken und eine Fleischplatte mit Alpkäse verdrückt. Da hatte Rosa ihr gesagt, dass sie sich bereits auf den nächsten Alpsommer freue, so wie immer.
»Rosa?« Er setzte sich auf und wischte mit dem Ärmel seinen Mund sauber. »Die ist beim Alpauftrieb gestürzt. Trägt einen Gips am rechten Scheichen und humpelt durch die Gegend wie ein altes Weib. Da hat man kurzfristig mich geholt.« Andreas setzte sich auf. »Und was für ein Teufel sind denn Sie? Als hätte mich ein Gaul getreten.«
»Charmant sind Sie also auch noch? Besser Sie sagen mir sofort, warum Sie auf mich losgegangen sind!« Giulia ließ keinen Zweifel offen, wer in dieser Situation die Hosen anhatte und die Waffe in der Hand hielt.
»Ich war ganz in der Nähe, um das Vieh vor dem Wolfsrudel zu schützen, das sich noch immer herumtreiben soll, und da habe ich den Schuss gehört. Wilderer machen im Moment ja das Tal unsicher. Vor zwei Tagen erst hat einer einen Wolf drüben in der Chüpfenflue geschossen. Da wollte ich nachschauen, was hier los ist, und als ich Ihren Schatten über der liegenden Frau gesehen habe, dachte ich, da braucht jemand Hilfe. Ich lief um die Hütte, da schrie plötzlich jemand, alles ging so schnell. Ich holte mit dem Knüppel aus … konnte ja nicht wissen …«
»Tragen Sie einen Ausweis bei sich?«
»Glauben Sie denn, ich muss mich bei meinen Tieren ausweisen?« Der Mann schien sich langsam erholt zu haben. Erst jetzt nahm Giulia den Geruch von Alkohol wahr. »Haben Sie getrunken?«
»Leider. Eine halbe Flasche besten Roten. Dank Ihnen habe ich ihn mir nun nochmals durch den Kopf gehen lassen«, murrte der Kerl, der nicht auf den Mund gefallen zu sein schien.
»Ja dann nochmals Prost und ich bitte um Verständnis, dass ich nicht anstoßen mag. Und jetzt setzen Sie sich da hinten an die Arve, bis ich sage, dass Sie gehen können. Haben Sie das verstanden?«, befahl Giulia. Der Hirt nickte und erhob sich langsam. »Aber erst mache ich ein Foto von Ihrem Gesicht.« Giulia hielt ihr Handy vor den verdutzten Kerl, der wie ein geschlagener Hund in die Linse blickte. »Nur für den Fall, dass Sie auf dumme Gedanken kommen.« Sie tippte etwas ins Telefon. »Mit diesem Foto würden meine Kollegen Sie schnell identifizieren, falls Sie mir unwahre Angaben gemacht haben und verschwinden sollten«, sagte sie und drückte auf Senden. »Das Foto ist nun in der Einsatzzentrale«, ließ sie ihn wissen, während sie das Gerät einsteckte. »Jetzt muss ich mich erst um die verletzte Frau kümmern. Den Rest klären wir später mit Rosa.«
In diesem Moment vernahm sie das entfernte Klopfen der Rotoren der Rettungsflugwacht, die, vom Churer Rheintal kommend, nur Minuten später anschwebte.
Giulia trat vor die Hütte, die vom grellen Lichtkegel eingefasst wurde. Der Abwind riss an ihr, das Dröhnen füllte das Tal. Sie hatte die Einsatzzentrale bei ihrem Anruf darüber informiert, dass sich fünfzig Meter oberhalb ihrer Hütte ein ebenes Stück Weide im Hang befand, gerade groß genug, um darauf zu landen.
Wie ein stählernes Insekt senkte sich die Maschine, das Positionslicht blitzte rot-weiß, der Lärm war ohrenbetäubend. Notarzt und Flughelfer duckten sich im Rotorabwind und kamen in roten Overalls mit Koffern in den Händen auf Giulia zu, die sie unverzüglich zur Verletzten führte.
Die junge Frau wurde notversorgt und wenige Minuten später auf der Trage in den Helikopter geschoben. Der Notarzt wandte sich danach Giulia zu und deutete auf ihren Hals. Die Wunde war stark geschwollen und blutete. Er desinfizierte die Verletzung und legte einen großen Klebeverband darüber. Kurze Zeit später hob der Heli bereits wieder ab.
Nachdem sich der Lärm gelegt hatte, ging Giulia zum Brunnen. Der Hirt saß noch immer an derselben Stelle. Er fragte: »Kann ich einen Schluck Wasser vom Brunnen haben?«
»Für so was braucht ja niemand zu fragen«, antwortete sie verwundert, als ihr Handy klingelte.
Nadia Caminada, ihre Ermittlungspartnerin, war dran: »Giulia, wir sind auf der Fahrt das Schanfigg hoch. Im Moment befinden wir uns bereits bei Peist. Alles gut bei dir?« Giulia bejahte. »Und was ist das für ein Mann auf dem Foto, das du mir geschickt hast? Der sieht aus, als wäre er einen Tag lang nur Achterbahn gefahren.«
»Na ja, es ist fast alles in Ordnung.« Giulia entfernte sich einige Schritte vom Brunnen. »Die unbekannte Frau wurde soeben ins Kantonsspital nach Chur geflogen. Personendaten konnte ich keine von ihr feststellen. Und der Typ auf dem Bild soll der neue Hirt hier oben sein, dem ich zur Begrüßung einen Tritt verpassen musste. Genaueres später.«
»Alles klar, Giulia. Pass auf dich auf. Wir sind gemäß Navi in etwa zwanzig Minuten beim Heimeli. Meinrad Cahenzli ist auch dabei und bringt seinen besten Spürhund mit.«
»Gut. Beim Heimeli könnt ihr die Fahrzeuge abstellen. Dann müsst ihr zu Fuß den Berg hoch. Findest du den Weg noch?«
»Ich finde ihn. War zwar nur einmal bei dir oben …«
»Eben, und damals war es heller Tag.«
»Du hast ja die Standortbestimmung auf deinem Handy aktiviert. Ich sehe somit deine Position auf der Karte und laufe einfach darauf zu, ist ja alles nur Weide, wenn ich’s recht in Erinnerung habe. Ich rechne mit einer Dreiviertelstunde Fußweg.«
»Stimmt genau, und es ist ja heute Vollmond. Wenn ihr’s nicht findet, rufst du mich einfach noch mal an.«
Nachdem Giulia von Andreas Kammerhofer die Nummer von Rosa erhalten und diese aus dem Bett geklingelt hatte, erhielt sie von ihr die Bestätigung, dass es sich bei dem Kerl tatsächlich um den neuen Hirten aus dem Ötztal handelte.
»Tut mir wirklich sehr leid.« Kammerhofer zeigte an Giulias Hals. »Sie können ja grob einstecken, das muss man Ihnen lassen. Und wenn ich das sagen darf: Sie sind auch mit geschwollenem Hals noch eine wunderschöne Frau«, flirtete er.
»Na ja, für ein Pferd geht’s noch. Wie wär’s beim nächsten Mal mit ›Hallo, was tun Sie da?‹ oder so was in der Art?«
»Sie vergessen den Schuss. Ich konnte doch nicht wissen, warum und von wem dieser abgefeuert wurde. Was hätte ich denn mit dem Hirtenstock gegen einen bewaffneten Verbrecher ausrichten sollen? Ich musste also in den Angriff übergehen, aber hätte ich gewusst, auf welche Schönheit ich treffe, hätte ich stattdessen Alpenröslein mitgebracht.«
»Genug mit dem Süßholzgeraspel. Ist angekommen, Sie finden mich aufregend, das weiß ich schon längst.« Sie wusste, mit dem Schuss, da hatte er nicht unrecht. Sie sagte: »Vergessen wir’s, wir werden uns zu einem späteren Zeitpunkt darüber unterhalten. Wir müssen Sie zur Sache später noch vernehmen. Ich habe jetzt Ihre Nummer. Es wird sich jemand vom Kommando melden.«
Kammerhofer murrte etwas, das Giulia als widerwillige Zustimmung interpretierte, dann verschwand er mit schweren Schritten im Silbergrau der ruhenden Matten, die Rechte hielt seinen Hirtenstock, die Linke war tief in der Hosentasche vergraben.
Giulia blieb allein zurück. Plötzlich war es wieder ganz still. Die Einsamkeit hier oben umhüllte sie erneut und sie fühlte sich gut, trotz der schmerzenden Wunde am Hals.
2
1. August 1984
Carmen Keller hörte »Self Control« von Laura Branigan auf ihrem Walkman. Ausnahmsweise hatte der DRS3-Moderator während der Hitparade am letzten Sonntagnachmittag nicht in den Nummer-eins-Hit geplappert und so hatte sie das Lied endlich auf Kassette aufnehmen können.
Es war ein ausgesprochen heißer Tag. Die Neunzehnjährige radelte in der sengenden Nachmittagshitze von Rapperswil auf dem Seedamm zur anderen Uferseite und fuhr, dem linken Ufer des Oberen Zürichsees folgend, weiter Richtung Lachen. Seit ein paar Monaten arbeitete sie dort in der Dorfmetzg Feller hinter der Fleischtheke. Doch für heute hatte Heinz Feller, der Bruder des Metzgers und Wirt des Ochsen, sie als Serviertochter angefragt, da es wegen des Nationalfeiertags viel zu tun gebe. Sie kannte den Ochsen gut und bezog dort oft eine günstige Kammer, wenn sie tags darauf bereits um sechs Uhr früh in der Metzg stehen musste, um das Fleisch zu rüsten und die Auslage vorzubereiten. Aber es war nicht nur der vierzigminütige Arbeitsweg, der ihr so erspart blieb.
Seit ihr Vater, Ernst Keller, vor einem Jahr aus dem Gefängnis entlassen worden war und seither keine Arbeitsstelle mehr fand, saß er im fleckigen, weißen Rippunterleibchen auf dem schmalen Balkon und versoff das bisschen Geld, das ihre Mutter mit Putzen verdiente und das das Sozialamt nicht in Lebensmittelgutscheinen auszahlte.
Carmen konnte seinen Anblick nicht mehr ertragen, wenn er an einer der Bierflaschen nuckelte, rauchte und dreckige Sprüche klopfte, kaum dass er sie sah. Fünf Jahre hatte er gesessen, eine Ewigkeit für die damals Dreizehnjährige. Seit er zurückgekommen war, schlug er Carmens Mutter, und das wusste bald jeder im Block. Auch die Polizei war mehrmals angerückt, alarmiert von wem auch immer. Mutter spielte dabei aus Angst alles runter, doch ihre Ausreden waren leichter durchschaubar als die schlecht geputzten Fensterscheiben hinter dem nikotingelben Vorhang in der Küche, in der sich die leeren Bier- und Weinflaschen in Denner-Taschen stapelten.
Riccardo, Carmens älterer Bruder, war vor wenigen Monaten ausgezogen, wohnte jetzt in Rüti und ließ sich nie mehr blicken. Auch Carmen wollte ihr Elternhaus bald verlassen, hatte aber ein schlechtes Gewissen, die Mutter alleine zu lassen. Um von zu Hause ausziehen zu können, musste sie aber erst volljährig werden, was in wenigen Monaten endlich der Fall wäre. Eine für sie bezahlbare Wohnung würde sie mit Sicherheit finden, denn sie hatte kaum Ansprüche. Sauber hätte sie es gerne, aber dafür könnte sie ja selbst sorgen. Und für das benötigte Mietdepot würde sie zusätzlich weitere Arbeiten übernehmen, so wie an diesem ersten August in der Gartenbeiz Ochsen am See.
Heinz, der Wirt, hatte sie mit einem Lächeln vorgewarnt, dass die Terrasse brechend voll sein würde bei so einem Prachtwetter und dass es Zweifränkler als Trinkgeld regnen würde. Hin und wieder, wie in anderen Jahren auch, vielleicht sogar Fünfliber obendrein, denn sie sei eine gar Hübsche und wenn sie besonders nett lächle, dann lägen dreihundert Stützli Trinkgeld mindestens drin, wahrscheinlich sogar mehr. Deshalb solle sie ihre hübschen Tüti gut büscheln, denn ein schön verpackter Busen sei, wie ein mit Geranien geschmückter Balkon, ein regelrechter Hingucker. Und da die Feier bis spät in die Nacht dauern werde, habe sein Bruder, der Alois, ihr erlaubt, morgen erst um zehn Uhr zur Arbeit zu kommen. Leider sei aber wegen des Feiertags ihre Kammer im Ochsen belegt. Er brauche diese für seine Schwester Angela, die samt den drei Saugoofen und dem Nichtsnutz von Schwager aus dem Emmental anreisen werde, ließ Heinz Carmen wissen.
Der Ochsen lag direkt am Oberen Zürichsee. Er war mit roten Geranien geschmückt und wie an vielen Häuser hing zur Feier des Tages eine große Schweizerfahne an der Fassade. Das Gartenrestaurant war dekoriert mit Wimpel-Girlanden und Lampions, bedruckt mit Kantonswappen.
Bereits um halb sechs war jeder Stuhl besetzt, als Carmen, die Servierschürze umgebunden, mit dem vollen Tablett zwischen den Tischen hin und her sauste. Mit der Bluse, die sie trug, schien Heinz zufrieden. Nur der Rock hätte ein wenig kürzer sein können, aber die langen Beine reichten auch so bis zum Boden, hatte er gewitzelt und sie angestiert.
Die Stimmung am See war ausgelassen. Ein Cervelat nach dem anderen verließ den Grill in der Gartenbeiz, die Humpen schäumten über vor Bier, die Kinder bekamen reichlich Glacé und Säckli mit Pommes Chips, eine Ländlerkapelle spielte lüpfig und nimmermüde auf, und es wurde heiter getanzt. Die Rivella- und Sinalco-Sonnenschirme bewegten sich kaum in der windstillen Hitze, in der nur wenig kühle Luft vom See her wehte. Auch auf dem Wasser war einiges los: Die geschmückten Kursschiffe, vollgepackt mit Ausflüglern, zogen den Lärm der Feiernden samt der Musik mit dem Kielwasser hinter sich her.