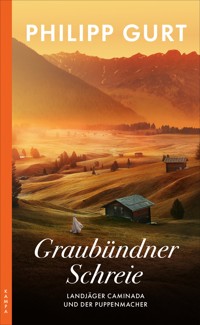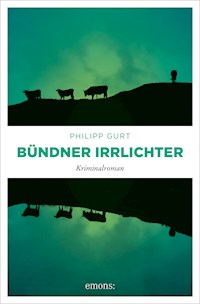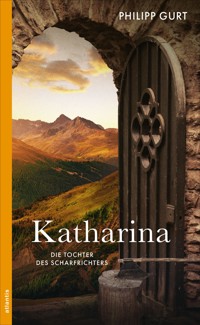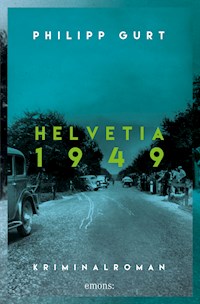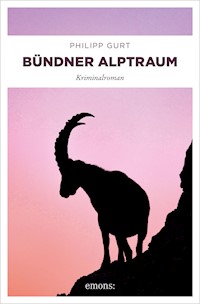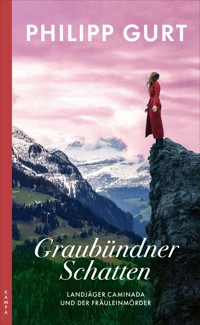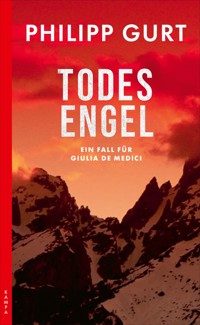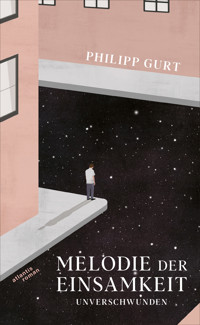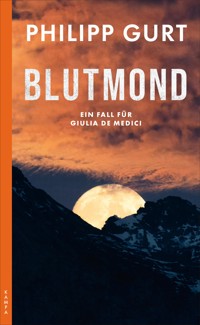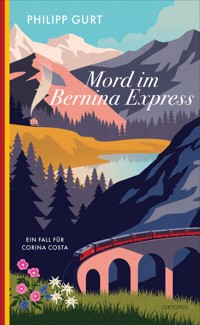Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Landjäger Caminada
- Sprache: Deutsch
Chur zu Beginn der 1950er-Jahre. Die ganze Gegend ist in heller Aufruhr, nachdem der rotbärtige Zoltan aus der Nervenheilanstalt, dem Trakt für »geisteskranke Triebtäter«, ausgebrochen ist. Keine zwei Tage später, im Morgengrauen eines Maitages, müssen Landjäger Caminada und sein Freund Leutnant Marugg ausrücken: Ein unbekannter Anrufer hat mit verstellter Stimme dem Polizeiposten gemeldet, dass auf der Schafsweide am Rande von Chur ein grausames Verbrechen geschehen sei. Die beiden Schäferinnen, es sind Schwestern, lägen tot im kniehohen Gras – aber da sei noch mehr ... Dann hat er aufgelegt. Der Tatort zeugt von Schrecklichem. Unter Hochdruck wird weiter nach dem mächtigen Zoltan gefahndet, denn das Verbrechen passt zu einem, das er dreizehn Jahre zuvor im Schanfigg begangen hat. Eine andere Spur führt Caminada und Marugg in den »Wilden Mann«, eine Spelunke mit zwielichtigen Gestalten.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Philipp Gurt
Graubündner Morgengrauen
Landjäger Caminada und die blinde Schäferin.
Roman
Kampa
Gegen das Vergessen
Prolog
Als Anna zu sich kam, lag sie seitlich verdreht in derWeide. Mit einem leisen Stöhnen drehte sie sich im kniehohen Gras auf den Rücken. Ihr benommenes Denken sammelte sich wie ihre Schafherde, die in der finsteren Nacht im Pferch hinter ihr noch näher zusammenrückte. Leise vernahm sie von irgendwoher das Wimmern ihrer Schwester Mara.
Was ist passiert, fragte sie sich, während sie sich mit ihrer linken Hand in ihren schwarzen Lockenschopf griff. Zaghaft zog sie ihre Finger zurück, sie waren klebrig von Blut. Das Wimmern erhob sich nun etwas lauter aus der Weide. Dass sie es zuvor bereits mehrmals gehört hatte, wusste die junge Schäferin in diesem Moment nicht mehr.
Anna setzte sich auf. Erst nach mehrmaligen Versuchen gelang es ihr, sich ganz aufzurichten. Sie stand wankend in der Weide, wie eine Blume im launigen Frühlingswind, während sie mit gebeugten Knien und nicht gänzlich ausgestreckten Armen versuchte, sich in der Dunkelheit zu orientieren. Der bleiche Mond hing schräg über ihr im Westen, eine Handbreit über dem dunklen Calandamassiv, und sah aus wie die knöcherne Sichel des Sensenmanns. Er legte seinen blassblauen Schimmer über die Grashalmspitzen der Schafweide und den ruhenden Wald, der sich die Flanken des Pizokel emporwand. Das alles sah Anna nicht.
Sie hörte das Wimmern ihrer Schwester nun deutlicher und erinnerte sich auch daran, dass es sich wiederholt hatte. Doch noch immer rang sie um Orientierung, versuchte sich zu erinnern, was geschehen war. Sie blieb weiter leicht nach vorn gebeugt stehen, die Schultern etwas hochgezogen, den Kopf nach vorne gestreckt, um zu horchen, denn das Wimmern bewegte sich. Die 24-Jährige schloss daraus, dass ihre Schwester auf allen vieren durch die Weide kroch.
»Mara?«, rief sie und ihre glockenhelle Stimme schwebte für einen Moment über der nächtlich ruhenden Weide. »Mara?«
Nur das klägliche Wimmern war zu hören und im Hintergrund die unruhigen Schafe und das helle Bimmeln einiger Glöcklein.
Annas Gehör war normalerweise besser als nur hervorragend, aber in dieser Nacht brummte ihr der Kopf. Wie ein tosender Wasserfall durchtränkte das Brummen ihre Geräuschwelt. Auch ihr Geruchssinn war getrübt; vom Blut, das ihr aus der Platzwunde am Kopf durch die schwarzen Locken über die Stirn und die Augen hinunter zu Nase und Mund gelaufen war und das nun alles verklebte. Der schwere Geruch nach dunkler Erde, Stein und Eisen vermischte sich mit dem der Nachtweide.
Anna wankte wie betrunken einige Schritte in die Richtung, in der sie ihre Schwester vermutete.
»Mara? So antworte doch, damit ich dich finden und dir helfen kann«, flehte sie eindringlich und blieb stehen.
Plötzlich war es totenstill. Auch von den Schafen war nichts mehr zu hören, als wären sie zu Stein erstarrt. Einzig ein zarter Nachtwind strich vom Geschehen unbeeindruckt von Annas rechter Seite her kommend über die Weide. Die Natur ließ sich eben vom Menschengeschehen nicht beirren, das wusste sie längst.
»Blumen blühen auch im Krieg!«, pflegte ihre Mutter damals zu sagen, als der Schrecken begonnen hatte. Diese Worte waren ein Vermächtnis gewesen, auch wenn sie und ihre Schwester es erst viel später verstanden, als ihre Mutter schon längst tot war. Deshalb spürte Anna auch jetzt die Natur, fühlte, wie die Härchen auf ihren nackten Armen den Nachthauch einfingen, während sie weiter in die Dunkelheit horchte. Doch das Wimmern und das Atmen ihrer Schwester waren verstummt.
Die junge Schäferin ging weiter behutsam barfuß durchs Gras, Schritt für Schritt, als könnte sie aus Versehen etwas zertreten, und lauschte immer wieder dann, wenn ihre Silhouette in der Dunkelheit für einen Moment schwankend verharrte. Sie hielt dabei ihren Atem an, drehte den Kopf hin und her, die blutige Nasenspitze zum Himmel gerichtet. Ihre Augen mit den übergroßen pechschwarzen Pupillen in den außergewöhnlich blaugrün schimmernden Iris blickten starr aus dem von getrocknetem Blut dunkel gefärbten Gesicht, während das Rauschen in ihrem Kopf langsam leiser wurde.
»Mara?«, flüsterte sie fordernd und drehte sich ängstlich in alle Richtungen, die Arme schräg nach vorne ausgestreckt, als müsste sie etwas abwehren. Doch Mara schwieg.
Vielleicht wäre es auch für mich besser, still zu sein, dachte Anna, als sie endlich ein leises Atmen hörte.
Nun war sie sich sicher, die Richtung und auch die Entfernung ausgemacht zu haben. Etwa 23 Schritte vor ihr musste ihre Schwester hilflos und verängstigt im Gras liegen. Mit ihren seltsam leblos wirkenden Augen starrte Anna in die Dunkelheit und schritt beherzt auf ihre Schwester zu, als diese plötzlich wie am Spieß zu schreien begann!
1
Chur, Montag, 25. Mai 1953
Um 4:52 Uhr schrillte im Haus von Landjäger Cami-nada der Affenkasten, wie er das schwarze Wandtelefon im schmalen Flur nannte. Er war es seit je gewohnt, zeitig aufzustehen, und das nicht nur, um die Tiere zu versorgen. So war er auch an diesem Morgen bereits auf den Beinen.
Schnell hob er ab, damit seine Liebsten, seine Frau Menga und das fünfjährige Töchterlein Lena, nicht vom nervtötenden Klingeln geweckt wurden.
»Caminada«, sagte er mit gedämpfter Stimme, denn die Tür zum Zimmer seiner Tochter lag nur drei Schritte hinter seinem Rücken. Er wusste sofort, dass dieser Anruf nichts Gutes verheißen konnte, erst recht, da zwei Tage zuvor, in den frühen Morgenstunden des Samstags, der Rote Zoltan, ein geisteskranker Triebtäter, aus der Nervenheilanstalt oberhalb von Chur ausgebrochen war.
Der diensthabende Wachtmeister, Toni Gruber, war in der Leitung: »Walter, ein grausiges Verbrechen soll geschehen sein. Drei Tote! Das wurde mir soeben vermeldet.«
»Wurde der Rote Zoltan mittlerweile gefasst?«, war Caminadas dringlichste Frage. Denn bevor er sich spät am Vorabend ins Näscht gelegt hatte, war er mit zwei anderen Landjägern auf der Suche nach dem Flüchtigen gewesen. Erfolglos. Sie waren 14 Stunden auf den Beinen gewesen, so auch einige weitere Suchtrupps des Landjägerkorps und des städtischen Polizeiamtes. Vergeblich hatten sie nach dem rotbärtigen Ausbrecher gesucht, der groß und kräftig wie drei war und gefährlicher als ein tollwütiger Stier.
»Nein!«, sagte Gruber. »Der scheint weiter wie vom Erdboden verschluckt.«
Caminada hatte es befürchtet.
»Wer sind die Opfer, und wo ist es passiert?« Caminada zog die geringelte Telefonschnur am Hörer noch mehr in die Länge, um weiter weg von der Zimmertür seiner Tochter sprechen zu können.
»Die Blinde Madonna und ihre Schwester.«
»Die beiden jungen Schäferinnen, die ihre Tiere im Gebiet Kalkofen behirten?«, fragte Caminada nach, denn er konnte es kaum glauben.
»Ja, Mara und Anna Süss. Die eine ist ja blind, wie du weißt, und die andere hinkt etwas.«
Caminada konnte sich gut an die beiden besonderen Fräuleins erinnern. Fast jeder in Chur kannte die beiden Schwestern mittlerweile, und das aus verschiedenen Gründen, obwohl sie erst vor vier Jahren, im Frühling 1949 aus Basel zugezogen waren. Er kannte sie, weil die beiden Schwestern kurz nach ihrer Ankunft von drei Betrunkenen auf dem Wochenmarkt am Kornplatz bös angegangen worden waren, sodass die Landjägerei alarmiert werden musste. Hauptmann Fässler, der heutige Major und Kommandant, und er waren gemeinsam ausgerückt und hatten die drei Angriffslustigen aus dem Sarganserland bodigen müssen. Eine rechte Keilerei war deswegen ausgebrochen, doch sie hatten denen schon gezeigt, wo der Bartli den Most holt. Die würden das Bündnerland gewiss nicht so schnell wieder vergessen. Wie sich danach herausstellte, hatten die drei Ungehobelten die jungen Frauen als Missgeburten beschimpft und auch noch versucht, sie zu begrabschen, bis Mara dem einen die Nase blutig geschlagen hatte.
»Und das dritte Opfer?« Caminada blickte hinter sich, die Zimmertür seiner Tochter war noch immer geschlossen. Er wollte auf keinen Fall, dass sie solches jemals zu hören bekam.
»Es ist ein Mann. Mehr Angaben zu seiner Person habe ich nicht erhalten. Der Anrufer, der das Ganze gemeldet hat, wollte seinen Namen nicht nennen. Vielleicht bloß ein Schabernack, denn er hat offensichtlich seine Stimme verstellt. Das komplette Städtli ist ja wegen des roten Teufels in Aufruhr, vielleicht wollte jemand die Sache nur noch mehr anheizen.«
»Das glaube ich weniger. Denn uns wird ja so mancher Vorfall anonym gemeldet, selbst wenn nur ein Huhn gestohlen wurde, weil gewiss niemand freiwillig mit uns was zu tun haben will. Außerdem ist es Montagmorgen und nicht mehr Wochenende, wenn die einen betrunken und vor lauter Übermut und Bier im Grind nicht mehr wissen, wie blöd sie tun sollen.«
»Der Zoltan also, ha?!« Toni Gruber schien seine Meinung gemacht zu haben.
»Dann gute Nacht am Seksi«, brummte Caminada. »Der wird gewiss nicht freiwillig aufhören. Der hat ja mehr Stimmen im Grind als der Kirchenchor im Vatikan zu Ostern. Aber verzell, habt ihr Leutnant Marugg bereits informiert?« Caminada wusste, sein Freund war morgens vor 8 Uhr kaum wach zu kriegen, dafür arbeitete er oft bis tief in alle Nacht hinein; brütete über den lästigen, geradezu grausig hohen Aktenbergen, und das auch noch speditiv.
»Ich habe nicht einen einzigen Mann mehr hier. Die, welche wie du gestern auf der Suche waren, liegen alle noch im Näscht, um dann um 7 Uhr diejenigen abzulösen, die jetzt unterwegs sind. Anfunken kann ich ja keinen. Wie auch, ohne Funkgerät? Den Leutnant anrufen geht ebenfalls nicht, denn auf unserer Telefonliste ist er noch nicht verzeichnet. Ich nehme an, der arme Kaib muss wohl noch lange auf die Telefonleitung der PTT warten.«
»Kein Wunder«, sagte Caminada und dachte, dass die Post-, Telefon- und Telegrafengesellschaft etwa so emsig war wie das faulste Murmeltier im Winterschlaf.
»Ich übernehme das, Toni. Ich setz mich gleich auf mein Velotöffli, hole Peter aus dem Bett und fahre mit ihm direkt vor Ort. Wir rapportieren dann, sobald wir zurück sind, weil wir ja Gopferdeckel, wie du eben sagtest, noch immer keine Funkgeräte haben. Richte das dem Fässler aus, falls wir um 7 Uhr noch nicht im Landjägerkommando sind, ja? Sofern das stimmt, was der Anrufer gemeldet hat, schaffen wir es mit Bestimmtheit erst später zurück ins Kommando.«
Menga hatte ihren Mann telefonieren gehört. Sie schnürte ihren Morgenmantel zu, während sie aus dem Schlafzimmer trat und auf ihn zuging. »Musst du schon wieder in den Dienst?« Sie wirkte noch etwas verschlafen.
»Leider, leider, meine Liebe. Mord. Die jungen Schäferinnen, die beiden Schwestern, meine ich, die vor der Stadt draußen leben … Sie liegen tot in der Weide und mit ihnen ein toter Mann. So zumindest hat es eben ein unbekannter Anrufer unserem Wachtposten gemeldet.«
»Ach du meine Güte! Meinst du, es war der Rote Zoltan?« Die 45-jährige Menga strich sich ihr langes pechschwarzes Haar nach hinten, das von einzelnen grauen Strähnen durchzogen war und ihr damit in Caminadas Augen eine schöne Reife verlieh.
»Ich befürchte es.« Caminada nickte. »Trurigi Sach, ganz traurige Sache.« Er griff über dem Affenkasten in das schmale Oberschränkchen, wo sein Waffenhalfter mit dem Revolver bereitlag. Er band sich die Waffe mit eingeübten Handbewegungen übers hellbraune Hemd und zog dann den Tschoopa drüber.
»Du hast ja bestimmt noch nichts zum Zmorga gegessen?«, sagte Menga mit Blick in die kleine Stube, wo die Pendeluhr hing, deren Ticken leise zu hören war, und zupfte ihm kurz am Revers.
»Noch nicht.«
»Nimm doch wenigstens schnell einen Schnifel Käse und eine Scheibe Brot mit einer Tasse Milch dazu. Das könnte heute ein langer Einsatz werden«, schlug Menga fürsorglich und aus Erfahrung vor. »Um dir einen Kaffee zu kochen, reicht’s wohl nicht, oder?«
Caminada trank in der kleinen Küche, in der nur ein Tisch für zwei Personen Platz gefunden hatte, im Stehen ein großes Glas Milch und steckte sich einen rechten Bissen Brot mit etwas Käse in den Mund.
»Konnte die Tiere noch nicht versorgen«, sagte er kauend und in Gedanken schon beim bevorstehenden Einsatz, wie Menga an seinem Gesichtsausdruck erkannte.
»Macht nichts. Ich erledige das später mit Lena, bevor sie in den Kindergarten geht. Sie hilft ja immer so gerne und fleißig mit. Außerdem muss ich ja erst morgen wieder arbeiten.«
Menga war Ärztin und hatte es tatsächlich geschafft, auch dank besten Verbindungen zu Professor Dr. Weidmann im Kreuzspital, dass für sie eine Teilzeitstelle geschaffen wurde. Sie arbeitete jeweils an drei Vormittagen in der Woche und war die einzige Mutter in der gesamten Ärzteschaft. Sie musste aber im Gegenzug die Dienste übernehmen, die kein männlicher Kollege machen wollte: die Sprechstunde in der Nervenheilanstalt, deren Gebäude abgelegen am Stadtrand oberhalb von Chur lagen, und auch die Sprechstunde für randständige Frauen im Frauenspital Fontana, das ebenfalls im Hang zwischen Rebbergen und Gärten eingebettet lag. Menga machten diese Dienste nichts aus, denn sie machte keinen Unterschied zwischen den Patienten. Sie hatte schon vor ihrer Hochzeit in der Nervenheilanstalt gearbeitet und nur deshalb überhaupt ihren Walter kennengelernt.
Schnell wickelte sie ihm etwas Brot mit ein wenig Speck darin in eine Doppelseite der gestrigen Ausgabe der Neuen Bündner Zeitung und steckte das Päcklein in eine der Seitentaschen seines Tschoopa.
»Pass auf dich auf, mein Lieber. Der Rote Zoltan …, du weißt«, sagte sie auf der Türschwelle und gab Caminada einen zärtlichen Kuss, nachdem sie zuvor gemeinsam einen Blick ins Zimmer von Lena geworfen hatten.
Das Verrückte an der ganzen Sache war, dass sie sich ausgerechnet wegen dieses geistesgestörten Triebtäters überhaupt kennengelernt hatten. Der Rote Zoltan hatte Caminada damals 1947, als dieser im Rahmen eines Einsatzes in der Nervenheilanstalt war, hinterrücks heftig in die Schulter gebissen. Daraufhin versorgte Menga als diensthabende Ärztin seine Wunde noch in der Anstalt. Er würde im Leben nie den Moment vergessen, als er sie zum ersten Mal gesehen hatte. Als wäre der Frühlingswind in ein kaltes dunkles Tal geweht, während zeitgleich die Sonne aufging, so hatte er sich gefühlt. Und sie hatte nach Bergblumen geduftet, wie auch heute noch.
»Wie könnte ich nicht auf mich achtgeben, meine schöne Engadinerin, wenn ich doch gesund zu euch nach Hause kommen möchte?«, sagte er und umarmte sie, blickte voller Liebe in ihre dunklen Augen. »Ich melde mich, sobald ich kann.«
Caminada, der zweifellos ein schöner, wenn auch einfacher Mann war, verließ das Haus. Zurück blieb der Duft seines Rasierwassers Pitralon. Auch wenn er an diesem Morgen keine Zeit mehr gefunden hatte, sich zu rasieren, hatte er es dennoch benutzt.
Draußen vor dem Haus, die Gipfelregion des Calanda leuchtete grell über dem schattigen Tal, schob er sein Velotöffli, ein Modell aus den frühen vierziger Jahren, aus dem Holzschopf auf die Loëstrasse und warf den kleinen Hilfsmotor erst abseits vom Haus an, um sein Töchterlein Lena nicht zu wecken.
Die morgenfrische Mailuft mit all ihren süßen Gerüchen wehte dem Landjäger um die Nase, während er die fünf Minuten hinaus nach Ober-Masans fuhr, an den nördlichen, kaum besiedelten Stadtrand von Chur, über dem die Nervenheilanstalt wie eine mächtige Burg thronte, umrahmt von alten Bäumen und weitläufigen Gärten zur Selbstversorgung. Dahinter erstreckten sich der Fürstenwald und die Flanken der gezackten Berge im Osten, deren schimmernde Silhouetten von der dahinter aufsteigenden Sonne kündeten.
Vor Maruggs Haus angekommen, schaltete Caminada den Motor aus. Marugg und seine Ehefrau Martina hatten sich im letzten Jahr einen alten Hof mit einem ordentlichen Obstgarten und Umschwung gekauft und mittlerweile wacker in Schuss gebracht, wie Caminada überrascht festgestellt hatte. Doch in der Zwischenzeit hatte sich beim jungen Ehepaar, beide waren 35 Jahre alt, Entscheidendes getan. Die blonde Martina, die auf jedem Parkett eine gute und selbstbewusste Figur abgab, war vor drei Monaten ausgezogen. Sie, die bis Ende Februar als persönliche Sekretärin des Stadtpräsidenten geamtet hatte, zog es schon immer in die großen Städte, wie im Grunde genommen ja auch Peter. Sie hatte bei der Zürcher Kantonalbank eine Stelle angetreten, war alleine nach Zürich gezogen.
Caminada hatte schon immer den Eindruck gehabt, dass die beiden eine gar lockere Ehe führten, aber das hatte bis anhin ja gut funktioniert und beide waren damit einverstanden gewesen. Martina, so wusste er es von seinem Freund, hatte Peter letztlich vor die Wahl gestellt: Er konnte mit ihr mitgehen, um in Zürich ein neues Leben mit ihr anzufangen, oder sie mussten getrennte Wege einschlagen. Marugg und Caminada hatten lange darüber geredet, denn Peter suchte Rat beim lebenserfahreneren Landjäger. Selbstverständlich wäre die Zürcher Kantonspolizei mehr als nur dankbar gewesen, einen so wackeren Erkennungsfunktionär in ihre Reihen aufzunehmen, und Peter hätte gute Aufstiegschancen gehabt, da war sich Caminada sicher. Das hatte er Marugg auch gesagt, aber im nächsten Atemzug ausdrücklich betont, dass es doch in erster Linie nur um eines ging: Liebe oder nicht Liebe?
Peter war in Graubünden geblieben. Nun wohnte er allein in dem kleinen schmucken Hof.
Zu dieser frühen Morgenstunde lag noch eine tiefe Ruhe über der Stadt, sodass Vogelgezwitscher aus den vielen Gärten weit übers Land erklang, als Caminada von seinem Velotöffli stieg. Er hatte sich darauf eingestellt, gleich Poltergeist zu spielen, und tschäberte daher ordentlich an die Haustür. Doch zu seiner Überraschung streckte keine halbe Minute später im Stock darüber sein Freund seinen braunroten Haarschopf aus dem Fenster.
»Heilandsack, Peter, hast du Schlafstörungen?«, versuchte Caminada ihn gleich aufzumuntern.
»Auch dir einen guten Morgen, Walter. Ja, kein Wunder. Das ganze Bauernhaus hat ja gerade gewackelt, als hättest du mit einer Abrissbirne angeklopft. Was gibt’s?«
»Komme leider nicht für einen gemütlichen Morgenschwatz bei dir vorbei. Möglicherweise hat der Rote Zoltan bereits zugeschlagen, denn leider geht’s um Mord. Zwei junge Fräuleins sind dem Anschein nach umgebracht worden, draußen auf der Schafweide im Kalkofengebiet, an der Flanke des Pizokel. Und auch ein Mann soll dem Täter zum Opfer gefallen sein, aber mehr weiß man noch nicht. Also, beeil dich, auch wenn der, der das verbrochen hat, bestimmt längst über alle Berge ist.«
»Ach, die beiden jungen Schäferinnen? Die Blinde Madonna der Berge und ihre Schwester?«
Caminada nickte, und Maruggs Kopf verschwand, das Fenster wurde geschlossen. Der Landjäger drehte der Haustür den Rücken zu, machte ein paar Schritte zur Seite und blickte in den schönen alten Obstgarten, während er sich mit einem Schwefelzündholz eine Villiger-Krumme anzündete. Die Apfelbäume hatten dieses Jahr wegen des warmen Winters früh in der Blust gestanden, und auch der weiße und der schwarze Holunder blühten bereits in ihrer ganzen Pracht, wie auch der lila Flieder, der gleich neben Caminada seinen Duft verströmte. Und mit einem Blick auf den Calanda und die umliegenden Berge stellte Caminada fest, dass selbst in den Höhen kaum mehr Schnee lag.
Der stets neumodisch gekleidete Leutnant setzte sich zehn Minuten später auf sein Fahrrad und gähnte wiederholt so herzhaft, dass Caminada ihn fragte, ob er ein Nilpferd verschluckt habe.
Sie fuhren nebeneinander hinunter auf die Masanserstrasse, folgten der Hauptstraße in die Stadt, an den dichten Häuserreihen der Altstadt vorbei, übers schlafende Obertor hinein ins Welschdörfli, bevor sie wenig später die letzten Häuser von Chur hinter sich ließen.
Zu ihrer Linken erstreckte sich hinter der Markthalle, die am Rande des Welschdörfli lag und in der auch der Stierenmarkt abgehalten wurde, die weitläufige Schafweide den steilen Anhang des Pizokel hoch.
Knappe zwei Kilometer folgten sie der Kasernenstrasse, die nach den letzten Häusern und der Militärkaserne nur noch durch Felder führte, hin zum Kalkofenweg, der etwa in der Mitte der vier Kilometer langen Schafweide in diese einbog. Hier wurde die Landstraße zum Fußweg, daher stellten sie ihre Vehikel ab. Caminada hatte den kleinen Hilfsmotor am Lenker seines Velopfüpflis bereits bei der Militärkaserne ausgeschalten. Er pflegte in solchen Momenten stets zu sagen, dass er sich ja nicht immer schon von Weitem anmelden müsse.
Caminada und Marugg blickten sich um. Die Weide zog sich in einem weiten Bogen an der Bergflanke des Pizokel entlang. Es war noch früh; 5:28 Uhr. Die Sonne tauchte mittlerweile die Berge im Westen bis fast zum Talboden in ihren Schein. Ein seltsamer Friede lag über der Weide. Leise war hin und wieder eine der Glocken der Tiere zu hören, aber kein Mensch war weit und breit zu sehen. Auch unterwegs waren ihnen nur gerade zwei Fuhrwerke entgegengekommen. Bauern, die ihre Milch in die Stadt, in die Toni-Molkerei, karrten und zum Gruß die Hand hoben.
Caminada suchte mit seinem Blick die unübersichtliche Weide ab, die von kleinen Anhöhen und mehreren Bacheinschnitten durchzogen war, an deren Verläufen Bäume und üppiges Gesträuch wuchsen, vor allem Schwarzer Holunder, wilder Flieder und Brombeeren.
Das alte gedrungene Bauernhaus der Schäferinnen und der Stall waren gut auszumachen. Sie standen schräg oberhalb auf einem der vielen Bödeli. Kurz dahinter zog sich die Flanke zunehmend steiler den Hang hoch, bevor sie in einen bewaldeten Schluchteinschnitt mündete. Wegen dieser besonderen Lage am Berg fand im Winter jeweils während Monaten kein Sonnenstrahl den Weg in dieses Gebiet, als wäre es mit einem Fluch belegt. Im Frühling hockte deshalb der Schnee noch lange in den schattigen Flanken, während die weitläufigen Wiesen vor den Toren der Stadt bis hinunter zum Rhein bereits im warmen Sonnenschein grün schimmerten. Umso schöner aber waren die anderen Jahreszeiten an diesem einsamen Ort, dann, wenn die Sonne alles von früh bis spät in ihr Licht tauchte, als hätte sie etwas wiedergutzumachen.
Wo in dieser weitläufigen Schafweide nun aber die Leichen liegen sollten, davon hatte der Anrufer nichts gesagt, auch nicht, was er selbst um diese Zeit überhaupt hier getrieben hatte. Dieser Umstand allein warf schon Fragen auf.
»Gehen wir hoch zum Bauernhaus, sonst wachsen wir noch an«, schlug Caminada vor. »Und wenn wir dort nicht fündig werden, steigen wir dahinter den Hang bis zum höchsten Punkt hoch, um wenigstens den Teil der Weide hier und den Richtung Felsberg überblicken zu können.«
Der Landjäger trug wie immer bei solchen Einsätzen sein gutes Schuhwerk, solide Bergschuhe. Mit Blick auf die glänzenden braunen Lederschuhe von Marugg meinte er ein wenig spöttisch: »Peter, hast du noch geschlafen, als du die Schuhe angezogen hast, oder willst du bei den Schafen Eindruck schinden? Vielleicht das eine oder andere Schäfchen gar zum Tänzli einladen?«
Er klopfte ihm freundschaftlich auf die Schulter. Er wusste, sein Freund war als Kind von seinem Vater abgelehnt, dann sogar verlassen worden. Als Nichtsnutz und Sohn einer Hure hatte der Vater den Neunjährigen wiederholt beschimpft, und das nur, weil weder er noch Peters Mutter rotbraunes Haar trugen. Nach der letzten dieser argen Beleidigungen hatte der Vater die Familie verlassen, das wenige Geld auch noch mitgenommen, die Haustür zugeschlagen und ward seither nimmermehr gesehen.
Arm waren Peter und seine Mutter danach erst recht gewesen. Sie wurde schwer krank, litt an Tuberkulose, verlor ihre Arbeit in der Tuchfabrik. Peter arbeitete deshalb nach der Schule hart, um seine von ihm so verehrte Mutter unterstützen zu können. Später schaffte der Junge sogar die Kantonsschule, und das mit Bravour. Caminada war sich deshalb sicher, dass Peter durch seine Kleidung zu den Mehrbesseren gehören wollte, damit er nie wieder an die Tage der Armut erinnert würde. Das alles störte den Landjäger nicht, tat der Freundschaft keinen Abbruch, weil er Peter so nahm, wie er war. Dass er ihn hin und wieder wegen seiner Kleidungsallüren hochnahm, sollte ihn nur daran erinnern, dass er dies alles gar nicht nötig hatte, da er doch ein feiner und zuverlässiger Kerl war, egal in welchen Hudara er stecken mochte.
Während sie durch das taufeuchte, stellenweise kniehohe Gras schritten, dachte Caminada laut darüber nach, was denn der Zeuge zu dieser frühen Stunde überhaupt auf der Weide verloren haben könnte. Oder wie der Mann sonst von der Tat hätte wissen können. War er womöglich gar nicht selbst vor Ort gewesen? Wann die Toten von wem entdeckt worden waren, darüber hatte er kein Wort verloren, sondern ohne Rückfragen zu beantworten wieder aufgelegt. Es galt ferner zu bedenken, dass es seine Zeit brauchte, um von der Schafweide zum nächsten Telefonapparat zu gelangen.
Caminada zündete sich die Villiger-Krumme wieder an, die er vor der Fahrt ausgedrückt hatte, da ihm vor einigen Wochen die Glut vom Fahrtwind schmerzhaft in die Augen getrieben worden war. Der lange, dünne und extra krumm gedrehte Zigarillo verströmte nun wieder seinen aromatischen Geruch, der Caminada erdete, denn sollte das, was der Zeuge berichtet hatte, tatsächlich stimmen, würden sie gleich auf mehrere Tote stoßen. Darunter zwei Fräuleins, tote Fräuleins … damit hatte Caminada so seine grausame Mühe. Außerdem konnte er sich noch gut an das Gesicht der Schäferin Anna erinnern. Denn wer einmal in die seltsamen blaugrünen, ja beinahe heilig wirkenden Augen dieser Blinden Madonna der Berge geblickt hatte, vergaß diese nie wieder. Genaueres über die beiden Schwestern wusste Caminada jedoch nicht, nur dass das Leben den beiden arg mitgespielt hatte, sie bis vor einigen Jahren in Basel gelebt hatten, aber Bündner Dialekt sprachen.
Caminada und Marugg gingen den sanft ansteigenden Hang hoch zum Bauernhaus und erreichten es nach zehn Minuten. Die Sonne hatte weit hinter ihnen nun schon die Rheinauen am Fuße des Calanda erreicht. Caminada schritt kraftvoll und mit wachem Blick voran, Marugg hinter ihm her. Die Waffe trug der Landjäger griffbereit, denn sollten sie hier tatsächlich auf den Roten Zoltan treffen, würden seine Fäuste allein kaum etwas ausrichten können.
Der Geruch der Schafe, die im Pferch eingezäunt munter grasten, wehte mit dem Morgenwind in Schüben zu ihnen, als Caminada die Hand hob und abrupt stehen blieb. Er deutete nach vorne. Marugg musste sich seitlich recken, denn er war kleiner als der über 1,80 Meter große Caminada.
Das Gras war an der Stelle, auf die Caminada zeigte, niedergedrückt. Etwas Dunkles lag dort. Sie erkannten Kleidung, eine Schulter. Vorsichtig näherten sie sich und entdeckten schließlich einen Mann, der vornübergekippt in der Weide lag, und das mit einem zünftigen Tätsch im Hinterkopf! Seitlich neben ihm lag ein Holzprügel.
»Der Anrufer hat also die Wahrheit gesagt …«, murmelte Caminada, dann richtete er seinen Hut und blickte sich um. Marugg tat es ihm gleich. Sie mussten vorsichtig sein, denn im hohen Gras könnte selbst einer wie der Rote Zoltan unbemerkt auf der Lauer liegen. Und von dem wollte gewiss niemand hinterrücks überrascht werden.
Der junge Leutnant trat an das Opfer. »Lass mich das machen, Walter«, sagte er, kniete sich zum Regungslosen runter und prüfte dessen Lebenszeichen, ehe er sich wieder erhob und die Hände in die Hüfte stemmte. »Er ist tot. Unschwer zu erkennen hat er einen zünftigen Schlag auf den Grind bekommen. Ich nehme an, der war auf der Stelle mausetot.« Dann deutete er auf den Prügel aus Holz. »Vielleicht war das hier auch gleich die Tatwaffe.«
»Oder er hat sich damit geweht. Oder es zumindest versucht.« Caminada hatte seinerseits die Linke in die Seite gestemmt und paffte einen Zug, während er sich konzentriert umschaute. »Ich glaube, dort hinten liegt noch jemand.« Er deutete mit einer Kopfbewegung in die entsprechende Richtung. »Aber Vorsicht, das Gras ist an manchen Stellen auch hier hoch.«
»Lass uns sowieso hintereinandergehen, damit wir nicht zu viele Spuren im Gras legen«, schlug Marugg vor.
Sie zogen beide ihre Waffen; Marugg die Ordonnanzpistole, Caminada seinen unverwüstlichen Revolver, dessen Durchschlagskraft berühmt-berüchtigt war. Dann gingen sie los.
Leider bewahrheiteten sich ihre schlimmsten Befürchtungen. Sie fanden Mara. Seitlich verdreht lag sie in der Weide. Zweifellos war sie ebenfalls erschlagen worden. Während Caminada die Lage mit seinem Revolver sicherte, kniete sich Marugg vor das Opfer.
Er schüttelte den Kopf. Auch sie hatte keine Lebenszeichen. Ihre verzerrten Gesichtszüge trugen aber noch den Schrecken der Tat. Im Unterschied zum männlichen Opfer trug sie offensichtlich zwei Wunden am Kopf.
»Peter, wir suchen erst noch das dritte Opfer, ehe du Fotografien machen kannst. Aber wir müssen gut Obacht geben, wegen des Roten Zoltan«, mahnte Caminada erneut und blickte sich wachsam um, denn er wusste, wie schnell ein Angriff tödlich enden konnte. Er fügte an: »Weit kann Anna aber bestimmt nicht gekommen sein, sonst hätte der Zeuge sie nicht gesehen. Außerdem ist sie ja blind, was eine Flucht schwierig macht.«
»Schauen wir doch zuerst kurz im kleinen Hof nach«, schlug Marugg vor, da sie keine Spuren im Gras entdeckten, die Annas Fluchtrichtung angedeutet hätten. Caminada nickte.
Die Haustür war unverschlossen, nicht mal richtig ins Schloss eingeschnappt.
Mit der Waffe im Anschlag trat Caminada ein. Marugg blieb vor der Tür stehen, gab ihm Rückendeckung.
Jemand Ungebetenes war hier gewesen, das erkannte der Landjäger sofort, denn es herrschte ein entsprechendes Durcheinander in dem einfachen alten Bauernhaus. Caminada beschränkte sich fürs Erste darauf, die vier Räume nach Personen zu durchsuchen. Mit dem Revolver im Anschlag bahnte er sich einen Weg. Doch niemand war im Haus.
»Da war jemand drin, scheint was gesucht und Lebensmittel gestohlen zu haben. Wir müssen aber später alles genauer in Augenschein nehmen«, sagte Caminada zu Marugg, der die Umgebung im Auge behalten hatte. »Lass uns jetzt im näheren Umkreis des Bauernhauses suchen. Anna könnte überall liegen. Finden wir sie nicht, holen wir Verstärkung.«
Marugg war einverstanden.
Anna war aber auch im weiteren Umkreis des Bauernhauses und der beiden Leichen nicht zu finden. Doch plötzlich entdeckte Peter eine kaum sichtbare Spur in der Weide, die seitlich in den Hang Richtung Chur führte.
»Das ist jemand langgegangen. Vielleicht der Täter, vielleicht aber auch Anna«, sagte Peter und folgte der Spur, die sich im Zickzack durch die Weide wand, was zu einer Blinden passen könnte.
Erst eine halbe Stunde später, sie hatten zwischenzeitlich die Spur immer wieder mal verloren, entdeckten sie endlich eine weibliche Person im Gras. Das Fräulein lag regungslos am Waldrand.
Wieder war es Marugg, der sich sofort zu dem leblosen Körper runterkniete, um ihn zu untersuchen. Das blutverschmierte Gesicht und die Wunde oberhalb der Stirn des jungen Fräuleins ließen ebenfalls Schlimmstes befürchten.
»Walter, das Fräulein lebt ja noch!«, rief Peter überrascht und blickte erfreut zu seinem Freund hoch. »Aber sie ist schwer verletzt und bewusstlos.«
»Und wir stehen da wie Schulbuben in kurzen Hosen, denn wir haben Sakrament noch mal noch immer keinen Funk, um den Krankenwagen zu rufen.« Caminada blickte den Hang hinunter Richtung Chur zu der außerhalb gelegenen Kaserne. »Bleib du beim Fräulein, während ich zum Pfüpfli laufe und damit zur Kaserne fahre. Die haben ein Telefon. Aber halt mir ja Abstand zum Waldrand, behalt die Waffe im Anschlag und zögere nicht, sie zu gebrauchen.« Er blickte Marugg eindringlich an. »Bei dem weiß niemand, was er denkt oder was er vorhat. Sei also schneller!«
Marugg nickte. »Werde ich sein.« Die Anspannung war ihm anzusehen.
»Dann gib ordentlich Obacht. Bis gleich«, sagte Caminada und folgte mit schnellen Schritten den Spuren im Gras zurück und danach weiter hinunter zu seinem Vehikel.
Eine knappe Viertelstunde später:
»Den Telefonapparat finden Sie hier, Landjäger Caminada«, sagte der diensthabende Wachtmeister und führte Caminada in einen spartanisch eingerichteten Raum, in dem nur ein Holztisch und ein Regal, beides aus ein und demselben Holz gefertigt, standen.
Nachdem Caminada den schweren Hörer zurück auf die Gabel gelegt hatte, fragte der Wachtmeister mit dem breiten Kiefer und einem Nacken wie ein Muni, was denn los sei.
»In den letzten Stunden ist ein Verbrechen mit mehreren Opfern verübt worden. Oben in der Schafweide. Falls jemand von euch etwas Auffälliges beobachtet oder gehört hat, dann bitte sofort melden. Auch wenn es in den Tagen zuvor gewesen sein sollte.« Caminada sagte dies in einem Ton, der dem Wachtmeister klarmachen musste, dass hier und jetzt nicht mehr Details zum Fall zu erfahren waren.
»Wenn mir was zu Ohren kommt, werde ich es umgehend an das Landjägerkorps vermelden«, versprach der Wachtmeister in zackigem, militärischem Ton und begleitete Caminada zur Hauptpforte, vor der sich der große Exerzierplatz erstreckte. Caminada kannte die Kaserne nur allzu gut. Er selbst hatte hier schon mehrfach gedient, als einfacher Soldat so manche Nachtwache geschoben.
Nun eilte er zurück zur Weide. Auch wenn er wusste, dass der Krankenwagen zu dieser Stunde, es war erst 6:45 Uhr, bestimmt nicht sofort angefahren käme. Er musste dennoch parat sein, um den Helfern den Weg durch die Weide zu weisen.
Es dauerte tatsächlich eine Weile, ehe der hellgraue Kastenwagen, ein zeitlos wirkender grauer Chevrolet mit runden Radkappen und Blinklicht auf dem Dach, um kurz nach 7 Uhr angefahren kam. Weder das Blinklicht noch das Horn waren eingestellt. Beides wurde nur selten gebraucht und war ohnehin defekt. Der zweite Krankenwagen, das bessere Modell, sei gestern spät in eines der Seitentäler gerufen worden und noch nicht wieder zurück, erfuhr Caminada vom Fahrer. Er sei halt nur der Hilfsfahrer und habe heute Morgen daher kurzfristig aufgeboten werden müssen, entschuldigte sich der Mann, der außergewöhnlich buschige Augenbrauen hatte und eine schwarze Schirmmütze trug.
Ein Doktor war nicht mitgefahren, aber zwei kräftige Sanitäter, die eine sperrige Bahre hinter Caminada durch die Weide trugen.
Die Sonne hatte die Weide nun erreicht, die Vögel zwitscherten noch immer munter aus den vereinzelt in der Wiese stehenden Bäumen und aus dem nahen Wald, als das Gespann bei Marugg oben ankam.
»Sie ist mittlerweile zu sich gekommen, aber ist noch ziemlich benommen«, sagte der junge Leutnant, während er die letzten Schritte auf die Sanitäter und Caminada zuging. Marugg hatte die Verletzte in der Zwischenzeit in eine stabile Seitenlage gebracht, aber sie war wirklich in keinem guten Zustand. Die Sanitäter kümmerten sich sofort um das Fräulein. Da sie nirgends mehr blutete, wurde sie kurzerhand vorsichtig auf die Trage gehievt.
»Hören Sie bitte«, sagte der kräftigere der beiden Sanitäter in erstaunlich mitfühlendem Tonfall zu Anna. »Wir tragen Sie nun hinunter zu der Landstraße und bringen Sie mit dem Krankenauto ins Kantonsspital. Keine Sorge, es wird schon alles recht kommen. Gällend Sie?«
Anna nickte, die milden Sonnenstrahlen legten sich sanft auf ihr Gesicht. Sie schien etwas sagen zu wollen, war aber zu schwach. Ihre geheimnisvoll schimmernden blaugrünen Augen starrten ins Leere. Dann drehte sie unvermittelt den Kopf zu Caminada, dahin, wo sie zuvor seine Stimme gehört haben musste. »Was ist passiert? Wo ist meine Schwester?«
»Hören Sie mir jetzt bitte gut zu, Fräulein Süss. Sie müssen sich schonen, wegen Ihrer Kopfverletzung. Wir beide«, er zeigte auf Marugg, als könnte sie es sehen, ehe er den Fehler bemerkte, »… also Leutnant Marugg, der neben mir steht, und ich, wir kommen heute noch zu Ihnen ins Spital, und dann reden wir, falls es der Doktor erlaubt. Dann wissen wir bestimmt auch schon mehr. Aber jetzt können Sie sich erst mal etwas erholen.«
»Aber meine Schwester!« Annas Stimme wurde bestimmter. »Geht’s ihr gut? Ist sie verletzt?« Ihre Augen schrien förmlich fragend ins Leere.
Caminada hätte ihr diesen Moment gerne erspart. Doch er sah im Gesicht des Fräuleins, dass sie befürchtete, was er schon wusste, und das bestimmt auch, weil er so holprig um den heißen Brei geredet hatte.
Er legte ihr die Hand väterlich auf die Schulter. Sie verstand, ließ ihren Kopf sinken. Ihre sorgenvollen, blutverklebten Gesichtszüge waren angespannt.
»Fräulein Süss, was genau passiert ist, das wissen wir noch nicht. Jemand hatte aber arg Böses im Schilde geführt, hier auf der Weide. Und dieser jemand hat Sie niedergeschlagen und auch Ihre Schwester Mara. Leider aber kam für Ihre Schwester jede Hilfe zu spät, und das tut uns furchtbar leid.«
Anna schloss ihre Augenlider nicht, wie es Sehende in diesem Moment wahrscheinlich für einen kurzen Moment getan hätten. Sie bewegte nur fassungslos den Kopf langsam hin und her, als wollte sie die Wahrheit nicht annehmen.
»Im Spital wird bestimmt auch der Herr Pfarrer nach Ihnen sehen«, sagte Caminada mit seiner warmen, tiefen und dennoch bestimmten Stimme. Dann gab er den beiden Sanitätern das Zeichen, und sie setzten sich mit der Verletzten in Bewegung, denn es gab in diesem Moment nichts, was Caminada noch für das bedauernswerte Fräulein hätte tun können.
Nachdem die drei außer Hörweite waren und Caminada seine Villiger-Krumme nochmals neu angezündet und sich den gelben Kiel zwischen die Backenzähne geklemmt hatte, richtete er seinen Blick auf Marugg.
»Peter, hast du in der Zwischenzeit irgendwas von ihr erfahren, was uns helfen könnte?« Er wartete die Antwort gar nicht erst ab. »Herrgottsack, wir haben doch ganz vergessen, den beiden Sanitätern zu sagen, dass sie den Dr. Bargätzi verständigen sollen, wegen der beiden Leichen.«
Er eilte den Männern hinterher und richtete es ihnen so aus, dass es für Anna nicht verständlich war. Dann kam er zu Marugg zurück. »Also, hast du etwas von ihr erfahren?«
»Gesehen hatte sie ja ohnehin nichts, aber auch wenn sie nicht blind wäre, so hat der Schlag auf den Kopf ihr die Erinnerungen wohl geraubt. Sie weiß nämlich zumindest zum jetzigen Zeitpunkt rein gar nichts von dem, was passiert ist.«
»Im besten Fall nur eine zünftige Hirnerschütterung und die Erinnerungen kommen wieder«, sinnierte Caminada laut vor sich hin. »Der Angreifer muss sie für tot gehalten haben, oder sie ist ihm nach dem Angriff entwischt. Letzteres ist wahrscheinlicher, denn die Spur, die durch die Weide zu ihr geführt hat, die stammt bestimmt einzig und allein von ihr«, sagte er und verströmte mit seiner Villiger-Krummen einen aromatischen Geruch.
Marugg nickte. »Genau. Wahrscheinlich ist sie nach dem Niederschlag wie tot auf dem Boden gelegen und flüchtete, nachdem sie zu sich gekommen war, hier hoch. Dann wurde sie aber erneut bewusstlos.«
Marugg trug seine schwarze dicke Hornbrille, der neuste Schrei, die sich in seinem hellen Gesicht mit den Sommersprossen markant abhob. »Gut möglich, dass sie als Blinde in der Dunkelheit sogar einen Vorteil hatte auf ihrer Flucht. Das mal nur so am Rande erwähnt, aber lass uns nun gescheiter an die Spurensicherung gehen, bevor der Bargätzi kommt.«
»Vielleicht wurde sie ja gar nicht mehr verfolgt. Nehmen wir an, der Täter glaubte, sie wäre tot, genau wie die beiden anderen, und Anna kam dann erst nach einer gewissen Zeit wieder zu sich, als der Täter schon weg war.«
»Das ist auch möglich.« Marugg trug bereits seinen sauteuren Fotoapparat an Lederriemen um den Hals. Er hatte, als Caminada auf dem Weg zur Kaserne gewesen war, einige Bilder von der bewusstlosen Anna geschossen. Diese waren nun auf einem Schwarz-Weiß-Film gebannt, den er des Kontrastes wegen benutzte.
Zu zweit gingen sie nun schräg hinunter zurück zum kleinen Bauernhaus.
Der Mann, den sie als Erstes aufgefunden hatten, lag etwa 30 Meter südöstlich des Bauernhauses im Gras. Im Gegensatz zu Mara hatte er nur einen einzigen, aber dafür umso härteren Tätsch auf den Hinterkopf bekommen. Die Totenflecken bestätigten beim genaueren Untersuchen seinen Tod, den sie schon bei ihrer Ankunft festgestellt hatten. Es zeigte sich, dass er erst vor wenigen Stunden umgebracht worden war. Marugg maß, um den Todeszeitpunkt näher zu bestimmen, sowohl bei ihm als auch bei der toten Mara die Körpertemperatur; beide waren fast identisch. Auch bei ihr waren die blaurötlichen bis lilafarbenen Totenflecken, die Livores mortis, entsprechend noch schwach ausgeprägt. Aufgrund der milden Nacht, in der die Körpertemperatur eines Verstorbenen in dieser Umgebung zwischen 0,5 und 0,8 Grad pro Stunde sinkt, sowie der Tatsache, dass erst eine kaum wahrnehmbare Totenstarre eingetreten war, die sich nur im Bereich der Augen und des Nackens zeigte, errechnete Marugg, dass die Morde erst nach Mitternacht geschehen sein konnten. Aber Dr. Bargätzi würde dies noch bestätigen oder allenfalls berichtigen müssen. Doch mittlerweile wusste Marugg, dass der Doktor ihm vertraute, dies nach anfänglichem und allzu offensichtlichem Misstrauen, das dieser ihm, dem jungen Leutnant und Erkennungsoffizier, entgegengebracht hatte. Irgendwann hatte Dr. Bargätzi aber seine Fehleinschätzung eingesehen und Marugg als einen blitzgescheiten jungen Mann betitelt. Das war ein schöner Zug von ihm gewesen, fand auch Caminada.
Der Tote trug leider weder Geldsäckel noch Ausweis bei sich. Das war jedoch gar nicht ungewöhnlich, denn dies war keinem Schweizer vorgeschrieben. Doch wenn er ein Tagelöhner gewesen wäre, hätte es trotzdem der Fall sein können, da einige größere Firmen gelegentlich die Ausweisnummer für die Quittungen der Lohnabrechnungen verlangten, wenn auch selten. Caminada und Marugg schätzten das Alter des Mannes auf etwa 30. Seinen Händen nach zu urteilen, war es keinesfalls ein Bürolist. Die einfache Kleidung deutete darauf hin, dass er eher ein Holzknecht oder Arbeiter war, möglicherweise ein herumziehender Tagelöhner.
»Passt das Spurenbild zum Roten Zoltan?«, fragte Marugg neugierig. »Du warst ja damals bei den ersten seiner Verbrechen im Schanfigg vor Ort. Und sag, wann war das noch mal genau?«
»Das kann ich dir ganz präzis sagen. Vor 14 Jahren, Ende Sommer 1939. Nur wenige Tage bevor am 1. September der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist.«
»Du warst damals dabei, und du wurdest ja später sogar von ihm gebissen. Also, was denkst du zu alledem?«
»Das mit dem Biss, das passierte ja erst acht Jahre später, 1947. Aber was kann man über so einen wie ihn sagen?« Caminada ließ seinen Blick über die Weide schweifen, hoch zu der Schafherde, die es irgendwie aus dem Pferch geschafft hatte und sich in Richtung Waldrand bewegte. »Der Rote Zoltan ist ein schwer Geisteskranker, getrieben von Stimmen, die in seinem Kopf hocken und ihm gar Grausiges befehlen. Wie und was genau, vermag keiner zu erkennen. Gesehen habe ich ihn zuletzt damals 1947 im Trakt für geistesgestörte Triebtäter, oben in der Heil- und Nervenanstalt. Ein gar trauriges Bild. Tagein, tagaus hockte er in der kleinen Zelle, menschenunwürdig, aber dennoch zwingend notwendig, denn man darf ihm nicht mal für einen Moment den Rücken zudrehen. Und kein Arzt, keine Medizin konnte ihn bisher heilen.«
Die Narbe vom Biss an Caminadas Schulter war erst nach und nach etwas verblasst. Nachdenklich blies er den Rauch über die Weide, die wie verzaubert in der Morgensonne lag, die sich aus dem Schanfigg erhoben hatte, als gäbe es kein schöneres Erwachen; wären da nicht die beiden Leichen gewesen. »Im Schanfigg oben hatte er damals zugeschlagen.«
Caminada reiste nur ungern in Gedanken an alte Tatorte zurück, doch er erzählte Marugg: »Das erste Opfer war das Annali, ein junges Fräulein, zart wie eine Blume und immer gut gelaunt. Wollte Krankenschwester werden. Der Rote Zoltan hat die 19-Jährige, getrieben von seinem Wahn, brutal vergewaltigt und oberhalb des Dorfes Peist im Farbtobelbach ertränkt. Als sie am Abend noch immer nicht nach Hause gekommen war, holte man den Landjäger des Tales, der in Castiel wohnte. Das ganze Dorf war auf den Beinen und machte sich auf die Suche nach ihr, und das bis in alle Nacht hinein. Kurz vor Polizeistunde drang der Rote Zoltan im Dörfli Peist in das Gasthaus und Restaurant Zum Rössli ein. Niemand außer der Serviertochter war zugegen, alle waren sie auf der Suche nach dem Annali.« Caminada kratzte sich kurz an der Stirn, schob dadurch seinen Hut etwas hoch. »Auch sie hat er geschändet. Sie versuchte zu entkommen, doch er hat sie auf der Straße vor dem Gasthof mit dem Holzbein eines Stuhls erschlagen und in den Brunnen auf der gegenüberliegenden Straßenseite geworfen.« Erst jetzt holte Caminada seinen Blick aus der Vergangenheit zurück, richtete ihn auf Marugg. »Deshalb traue ich so jemandem jedes Verbrechen zu. Und jetzt hör gut zu, Peter: Der Kerl ist so riesig und kräftig wie drei wackere Schwinger, aber das ist nicht die einzige und eigentliche Misere. Der Riese kann sich unsichtbar machen wie niemand sonst, und das obwohl er rote Haare und einen mächtigen Bart hat. Du verstehst?«
Marugg schüttelte den Kopf. »Aber der muss doch auffallen wie ein bunter Hund?«
Caminada nickte. »Ich weiß, ist schwer zu begreifen. Aber wir haben ihn damals viele Tage lang gejagt, nirgends eine Spur von ihm gefunden. Niemand schien ihn gesehen zu haben, als jagten wir einem längst Verstorbenen hinterher. Auch deshalb graut’s mir vor diesem Fall. Wir müssen ihn so schnell wie möglich finden. Aber ob dies hier wirklich seine Taten sind … Ich weiß es nicht. Es spricht dagegen, dass die Fräuleins nicht geschändet wurden, oder zumindest sieht es auf den ersten Blick nicht danach aus. Aber eben, wer weiß denn schon, was in einem so kranken Hirn los ist?«
»Und wie habt ihr ihn damals am Ende gekriegt?«
»Das war ganz kurios. Ein Jäger fand ihn Tage später in der Weide auf dem Mittenberg über Chur. Er traute seinen Augen nicht. Der Rotbärtige lag splitternackt auf dem Rücken im Gras wie ein versteinerter Hampelmann und schien durch das Blätterwerk in den Himmel zu starren. Der Jäger eilte hinunter in die Stadt, alarmierte uns. Zu sechst eilten wir hoch, mit einem Netz und bewaffnet bis auf die Zähne. Als wir oben ankamen, lag der Kerl noch immer in der milden Herbstsonne, war nicht ansprechbar, hatte nur diesen Blick, als hätte er sich im Blätterwerk und dem Himmel darüber verloren. Wir hielten die Waffen im Anschlag, befürchteten Gegenwehr, doch er ließ sich wie ein Schlafwandler Handschellen anlegen, als befände er sich nicht mehr in seinem Körper. So führten wir ihn damals ab. Doch kurz bevor wir den erst 20-Jährigen ins Irrenhaus einliefern konnten, wich diese Starre und wir hatten alle Hände voll zu tun, den Kerl irgendwie zu bodigen. So was habe ich weder davor noch danach je wieder erlebt.«
»Verrückte Geschichte und traurig in einem«, sagte Marugg, nahm seine Blechdose aus der Innentasche seines Anzugs und steckte sich eine Pfefferminzpastille in den Mund. »Wir müssen aber jetzt noch auf den Dr. Bargätzi und den Abtransport der Leichen warten, bevor wir dem Major rapportieren. Danach können wir hoffentlich im Kantonsspital mehr von Anna in Erfahrung bringen.«
2
Zwei Tage zuvor, Samstagmorgen, 23. Mai, 3:32 Uhr
Im Trakt für geisteskranke Triebtäter roch es stechendnach Urin, Schweiß und dem Reinigungsmittel, mit dem der Flur vor den Zellen gewischt worden war. Die sieben stählernen Zellentüren, von denen der Lack abblätterte, waren wie immer geschlossen. Das Essen der Insassen wurde hier durch eine Klappe auf Knöchelhöhe in die Zelle hineingeschoben, und auch nur, wenn sich die Häftlinge zuvor an die hintere Wand gestellt hatten und die Hände über den Kopf hielten. Durch das eingebaute Guckloch konnte dies von einem Wärter überprüft werden, während ein anderer das Essen reinschob.
In der Nacht von Freitag auf Samstag ließ sich das Morgengrauen noch einen Moment Zeit. Die großen Gärten und die Bäume rund um die Heil- und Nervenanstalt Waldhaus schlummerten noch in der Dunkelheit, als Wasser unter der Zellentür mit der Nummer 7 austrat. Es rann schon länger und wurde zunehmend mehr, bahnte sich seinen Weg über den Flur hinein in die anderen Zellen. Der Rote Zoltan hatte in einem Anfall das gemauerte WC in seiner Zelle zerschlagen, mit bloßen Fäusten, als wären es zwei eiserne Vorschlaghämmer.
Erst beim halbstündlichen Rundgang alarmierte die Nachtwache die anderen Pfleger. Sechs der sieben Zellen waren belegt, nur der Bunker war leer, die Zelle mit der Nummer 1, in der es nichts gab außer einer Matratze, den nackten Wänden und der Stahltür, die sich nahtlos in die dicke Mauer einfügte.
In den belegten sechs Zellen fristeten sechs Ungeheuer ihr Dasein. Geisteskranke Verbrecher aus der gesamten Eidgenossenschaft, die die abscheulichsten Taten begangen hatten.
Jeder, wirklich jeder, der in diesem Trakt zu tun hatte, wusste: So unterschiedlich diese Gefangenen rein äußerlich auch sein mochten, so einte sie ihre unberechenbare Gefährlichkeit, sodass es einen schaudern konnte. Bleich und schmächtig mit einer Hühnerbrust der eine; klein und stämmig mit wilder pechschwarzer Lockenpracht der andere; dick und behäbig ein weiterer. Der in Zelle 4 hatte ein haarloses Haupt mit Vollmondgesicht, nass glänzenden schwulstigen Lippen und Doppelkinn. Er war einfältig und geschwätzig. Dies ganz im Gegensatz zum Professor in Zelle 3; ein hochintelligenter Mann mit gepflegter, unaufgeregter Sprache. Er hatte sieben reiche Frauen erst um viel Geld und dann um ihr Leben gebracht. Und einer dieser sechs Gefangenen war der Rote Zoltan, der seit 14 Jahren in der Zelle mit der Nummer 7 saß.
Die Pfleger rückten wegen des Wassers an. Alles kräftige Männer, mit Oberarmen so dick wie anderer Leute Oberschenkel. Da es in der Zelle 7 kein Licht gab, Zoltan hatte in der Vergangenheit jede Glühbirne sofort zerschlagen, leuchteten sie mit einer Militärtaschenlampe ins Höllloch, wie die Zelle 7 unter ihnen hieß: Zoltan stand an der gegenüberliegenden Wand mit dem Rücken zur Tür, seine Arme mit den riesigen Fäusten ließ er hängen, sein Kopf war leicht nach vorn gebeugt, als lehnte er mit seiner Stirn an der Wand.
Noch immer sprudelte das Wasser wie bei einem Rohrbruch aus dem zertrümmerten WC, während einer der Pfleger unterwegs war, um den Hausmeister aufzuwecken, damit dieser die Hauptzuleitung abdrehen konnte.