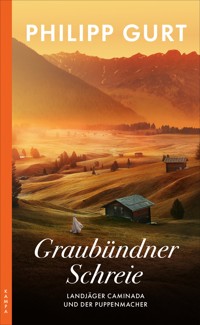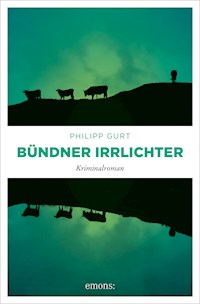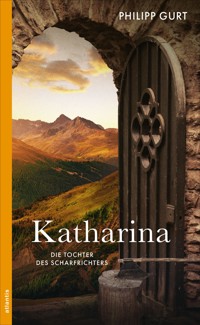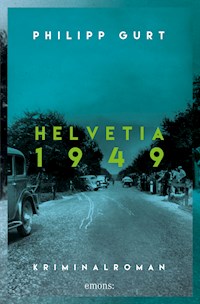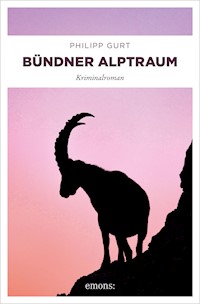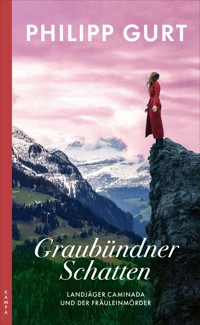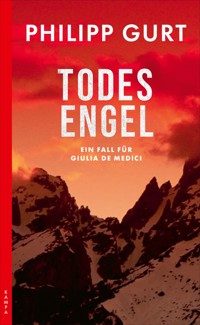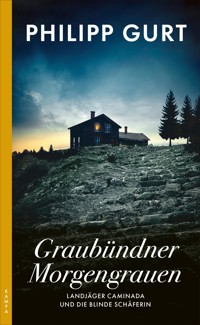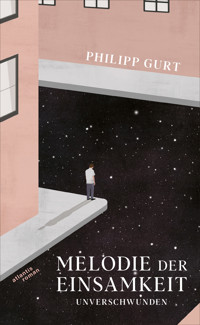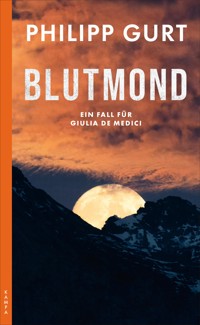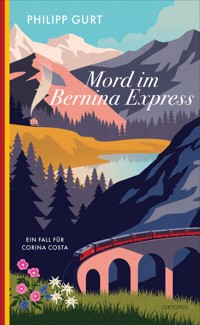12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Dreh dich nicht um - lauf! Herbst im Schweizerischen Nationalpark: Die Bergwälder leuchten verschwenderisch. Das Vieh kehrt von den Alpweiden ins Tal hinab. Friede schwebt über allem. Wären da nicht die einsamen Schreie der flüchtenden jungen Frau, die verzweifelt versucht, die Talsohle zu erreichen. Wie schon im letzten Jahr treibt zur Jagdsaison ein Unbekannter sein grausames Spiel in der Region. Giulia de Medici, Ermittlerin der Kapo Graubünden, nimmt die Spur des Täters auf und stößt auf ein düsteres Geheimnis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 464
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Philipp Gurt wurde 1968 als siebtes von acht Kindern in eine Bergbauernfamilie in Graubünden geboren. Er wuchs in verschiedenen Kinderheimen auf. Früh begann er mit dem Schreiben. Zwölf seiner Bücher wurden bisher veröffentlicht, darunter mehrere Schweizer Bestseller. 2017 erhielt er den Schweizer Autorenpreis. Er lebt in Chur im Kanton Graubünden.
www.philipp-gurt.ch
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
Lust auf mehr? Laden Sie sich die »LChoice«-App runter, scannen Sie den QR-Code und bestellen Sie weitere Bücher direkt in Ihrer Buchhandlung.
© 2019 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: mauritius images/BY
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Irène Kost, Biel/Bienne, Schweiz
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-497-1
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmässig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Für dich und mich
Die Hölle ist leer,und alle Teufel sind hier.
William Shakespeare
Prolog
Mächtig erhob sich der Munt la Schera an jenem farbenprächtigen Morgen in den blauen Himmel empor. Überall in den Bündner Bergen hatte der Herbst bereits Einzug gehalten. Die Luft war klar und beinahe winterlich kalt im Unterengadin, als nach einer sternenklaren Nacht die ersten Sonnenstrahlen den vulkanartig geformten Gipfel in Sonnenschein tauchten. Der Wald, der sich die immer steiler ansteigenden Flanken hoch bis auf zweitausend Meter Höhe erstreckte, umschloss einen grossen Teil der steppenähnlich ausgedehnten, wie platt gedrückten Gipfelregion. Der Berg sah aus, als hätte jemand dessen Spitze in einer Höhe von zweitausendfünfhundert Metern mit einem stumpfen Eierköpfer weggeschnitten.
Mit dem ersten Einfallen der Sonnenstrahlen in den Wald aus Lärchen, Arven und Bergföhren entzündete sich sein goldenes Leuchten. Nur vereinzelt war der krächzende Schrei eines Vogels zu hören, der flatternd aus einer Baumkrone aufstieg, bevor dieser immer leiser werdend am Horizont entschwand. Ansonsten herrschte eine tiefe Ruhe im Nationalpark.
Diese Stille durchbrachen, noch bevor die ersten Sonnenstrahlen die Talsohle erreicht hatten, verzweifelte Laute einer dunkelhaarigen jungen Frau, die durch den dichten Wald hetzte. Sie atmete in panischer Angst, während sie immer wieder den Kopf zurückwarf, um ihren Verfolger zu sehen. Das dichte Unterholz zerkratzte ihre nackten Beine und Arme, Zweige schlugen ihr hart ins Gesicht. Orientierungslos stürzte sie sich barfüssig, nur mit einem hellblauen Höschen und einem weissen T-Shirt bekleidet, weiter talwärts. Immer wieder strauchelte sie, einen gellenden Aufschrei dabei ausstossend, raffte sich auf und hetzte weiter durch den Wirrwarr aus Bäumen, ohne zu wissen, was sie dort unten erwartete. Ihre Lungenflügel brannten, als atmete sie Feuer, ihr Herz raste. Der Tunnelblick vermittelte ihr ein Bild eines Labyrinthes aus wankenden Bäumen und vorbeisausenden Ästen.
Endlich hatte sie eine Lichtung in der herbeigesehnten Talsohle erreicht, doch was sie sah, liess ihre aufkeimende Hoffnung gleich wieder schwinden: Da war nur Wald, umrahmt von einem Panorama aus Berggipfeln, weder ein Weg noch eine Strasse führten den Bergkämmen folgend aus dem schmalen Taleinschnitt. Sie versuchte ihren Atem zu beruhigen, um nach Lärm von Zivilisation zu horchen – einer Strasse vielleicht. Doch sie hörte nur das Pochen ihres Blutes in den Ohren und ihren eigenen gehetzten Atem. Nach einigen Minuten wurde sie äusserlich etwas ruhiger, sie hatte den Verfolger abschütteln können, als sie Geräuschfetzen vom Rauschen eines Baches aufschnappte.
Als sie diesen erreichte und ihren Durst mit dem glasklaren, eisig kalten Wasser gelöscht hatte, wusch sie sich die tiefsten Kratzer an Füssen, Beinen und Armen damit aus. Die Kälte spürte sie kaum. Ihr Atem wölkte sich in den ersten milden Sonnenstrahlen, die nun über die ausgedehnte Gipfelregion des Munt la Schera geklettert waren. Sie blieb einen Moment am Rande des Bachbettes stehen, suchte dabei angestrengt mit ihren Augen die Umgebung ab, bevor sie diesem in südlicher Richtung folgte. Ihr Verfolger würde es für wahrscheinlicher halten, dass sie flussabwärts floh, so hoffte sie.
Vor ihr erstreckte sich eingebettet der glitzernde Bachlauf. Mal war der Fluss wild aufschäumend in sein Bett gepfercht, dass sie kaum in Ufernähe, barfüssig, wie sie war, sich einen Weg bahnen konnte, mal war er breit und träge wegen eines weiteren Zuflusses, der mit seinem Geschiebe ein kleines Delta geschaffen hatte. Öfters musste sie kleine Umwege über die Bergflanken hindurch in Kauf nehmen, da in Ufernähe ein Vorankommen nicht möglich war. So war sie gezwungen, auch einen stotzigen Murenabgang zu durchklettern, der sich über ihr erstreckte. Ihre Augen suchten nach einem Weg hindurch, bis sie glaubte, einen schmalen Pfad darin entdeckt zu haben. Als ihr Blick der schluchtähnlichen Verengung folgte, die nach einhundert Metern scharf nach rechts verlief, da war sie sich sicher – es war ein Trampelpfad, den die Wildtiere nutzten. Diesen in steilem Gelände zu erklettern wäre zwar schwierig, doch die nächsten fünfzig Meter fielen die Bergflanken beidseitig der Ufer derart steil ins Bachbett, dass sowieso kein Durchkommen war. Zuvor hatte sie vergeblich versucht, sich am Berghang abstützend gegen die Strömung zu stemmen. Chancenlos. Das beinahe hüfthohe Wasser drückte zu stark. Deshalb kletterte sie, ihren Blick immer nur nach oben gerichtet, die etwa dreissig Meter zum Pfad empor.
Es war ein gutes Gefühl, einem kleinen Sieg ähnlich, plötzlich auf einem wenn auch nur fussbreiten Trampelpfad gehen zu können. Mühsam hatte sie zuvor der wilden Natur Meter um Meter abringen müssen, und nun konnte sie rasch diesen Abgrund durchlaufen. Ihr Blick fiel dabei auch auf das wilde Wasser tief unter ihr, das durch die verengte Stelle rauschte, als ein Schuss die Luft krachend zerriss. Zeitgleich fühlte sie einen harten Einschlag in ihrer linken Schulter, dann flammte ein stechender Schmerz darin auf.
Entgeistert griff sie sich an die verletzte Schulter. Warm klebte Blut an ihrer rechten Hand.
In heller Panik hetzte sie durchs Moränenfeld, um im nahen Wald Deckung zu finden. Ihr T-Shirt färbte sich dabei weiter rot. Weitere Schüsse krachten, die Berge warfen ihr Echo drohend zurück.
Der schmale Pfad hatte nur wenige Meter durch den Wald geführt. Das Tal öffnete sich wieder, der Verfolger würde sie einholen, wenn sie in der kargen Deckung verharrte. Ausserdem brauchte sie dringend ärztliche Hilfe. Sie fühlte, dass da etwas tief in ihrer Schulter steckte.
Als hoch über der nächsten, sanfteren Flussbiegung noch ein Schuss die morgendliche Stimmung zerriss, stolperte sie und fiel den Geröllhang hinunter in den Fluss, der sie sofort einige Meter zurückriss. Die Kälte des Wassers raubte ihr für einen Moment den Atem. Gekonnt liess sie sich trotz ihrer Verletzung von der Strömung auf die gegenüberliegende Seite mitreissen. An dieser Stelle flossen Uferregion und Wald beschaulich ineinander. Im Schutz der Bäume folgte sie im Schockzustand dem Fluss weiter bergwärts. So schaffte sie es, dem Talverlauf bis zur nächsten Biegung zu folgen. Kaum lag der Blick frei auf das Tal dahinter, riss sie mit Erstaunen ihre Augen auf.
Eine mächtige Staumauer erhob sich völlig unerwartet nur knappe zweihundert Meter vor ihr empor, als wäre sie eine Fata Morgana. Auf der linken, im Schatten liegenden Bergseite führte in mehreren Spitzkehren eine schmale asphaltierte Strasse zur Talsohle hinab. Mit letzter Kraft und tanzenden Schatten vor Augen, die sie immer schwerer in Schach zu halten vermochte, schleppte sie sich dahin.
1
Giulia de Medici hatte an diesem Freitagnachmittag soeben ihren schwarzen Pferdeschwanz festgezurrt, als ihr Handy klingelte. Es war die Umzugsfirma, die mit gehöriger Verspätung und all den Umzugskartons und Möbeln endlich eintraf. Im Lürlibad, am Stadtrand oberhalb von Chur, ganz in der Nähe des altehrwürdigen Gebäudes der seit vielen Jahren stillgelegten Frauenklinik, hatte sie das Glück in Form einer Dachwohnung mit Terrasse angelacht. Die Sicht über die bald vierzigtausend Einwohner zählende Hauptstadt Graubündens und das Churer Rheintal war grandios, und das alles zu einem bezahlbaren Preis. Das Gebäude selbst versprühte den Charme einer längst vergangenen Epoche. Innen war es sanft renoviert worden, Vergangenheit und Moderne verschmolzen so zu etwas Besonderem. Das fast klerikal wirkende Treppenhaus mit dem geschwungenen hölzernen Handlauf und den handgeschmiedeten Staketen sowie der Fussboden aus Fliesen im Stile früherer Zeit, gepaart mit den kalksteinweissen Wänden, versprühten die Atmosphäre von Zeitlosigkeit, die Giulia auf Anhieb gefiel. Lift gab’s keinen, die Möbelpacker mussten alles die fünf Stockwerke hochschleppen.
Die Dreissigjährige stand in der Wohnung, in der die Sonne schräg einfiel, und dirigierte, was wohin abgestellt werden musste. Dabei hüpfte ihr Pferdeschwanz wie ein Springseil. Noch nie hatte sie sich derart auf ein Zuhause gefreut. Es schien ihr, als wären die Vier-Zimmer-Wohnung und sie wie füreinander geschaffen. Sicherlich auch deshalb, weil damit ein Neuanfang in ihrem Leben verbunden war. Sogar ihr Belgischer Schäferhund Arkon war für den Vermieter kein Problem gewesen. Den zweijährigen Rüden hatte sie, seit dieser Welpe war, gut erzogen, und er war ihr ans Herz gewachsen.
Dennoch konnte sie an diesem Nachmittag einen Anflug von Schmerz nicht unterdrücken. Erkki Korhonen, ihr norwegischer Ex-Freund, fehlte ihr noch immer, auch wenn sie sich weiter einredete, es sei besser so, wie sie es ja schliesslich selbst entschieden hatte. Ein Jahr war dies mittlerweile her. Mit der neuen Wohnung wären zumindest die Erinnerungen an ihr altes Zuhause nicht mehr jeden Tag präsent. Sie würde, sie müsste ihn einfach vergessen, und mit diesen Gedanken packte sie eine weitere Schachtel und stapelte sie ins Wohnzimmer.
Als die Sonne so tief stand, dass sie jeden Moment hinter der dunklen Bergsilhouette des Calanda versinken würde, war es mit dem letzten der Kartons endlich geschafft. Im Stehen nahmen all die Helfer und sie einen währschaften Bündner Zvieri auf der Terrasse ein: Silserkranz, Bündnerfleisch, Salsiz und Käse aus dem Safiental hatte sie aufgetischt. Dazu gab’s eine Tasse Kaffee mit Engadiner Nusstorte und, wer mochte, ein kühles Calanda Bräu.
Bis spät in die Nacht räumte Giulia Karton um Karton aus, bevor sie sich nach einem letzten Blick aufs schlafende Chur unter ihr, dessen Lichter von Bergen umrahmt tiefe Ruhe ausstrahlten, schlafen legte.
***
Über der Greina-Hochebene funkelten die Sterne aus einem klaren Himmel. Mario Capeder, seine Hände hinter dem Rücken gefesselt, strauchelte durch die Nacht. Er trug nur ein T-Shirt und keinen Penis mehr. Die frische Wunde war fachmännisch versorgt worden – ein Wundverband überdeckte die dicke Naht. Seine Augen hätten sich längst an die Dunkelheit gewöhnt, hätte er denn sehen können. Sie waren ihm sorgfältig mit silberfarbenem Industrie-Klebeband überklebt worden. Er hatte keine Ahnung, wo und warum er in dieser Situation steckte. Es war ihm aber bewusst, es musste Nacht sein, der Kälte wegen, und irgendwo weit abseits. Wer nicht sehen kann, muss hören, spüren und riechen.
Vorherrschend empfand Capeder zu Anfang nur diese Stille und ein seltsames Gefühl im Schritt – als wäre sein bestes Stück betäubt. Nicht mal das Rauschen eines Baches war zu hören. Es gab weder Bäume noch Sträucher, denn er lief im scheinbaren Nichts. In den Bergen musste er sein, das sagte ihm der Duft, den er in tiefen Zügen mehrmals zur Orientierung eingesogen hatte, und die Kälte. Wie konnte er wissen, wann sich ein Abgrund, eine Felswand vor ihm auftun würde? Deshalb blieb er vorsichtig – Schritt für Schritt.
Erst nach gefühlten zwei Stunden traute er sich, leise, dann immer lauter zu rufen: «Haaaallooo?» Dabei horchte er angestrengt in die Nacht, als könnte sein Ohr mitsamt den Tönen ins Unbekannte schweben.
Stille.
Wer auch immer ihn hier ausgesetzt hatte, schien fort zu sein, hatte ihn zurückgelassen im Wissen, was nun passieren würde. Er versuchte angestrengt, sich zu erinnern, wie er in diese Lage gekommen war, doch da war nichts ausser dem Gefühl, in einem leeren Raum eine Erinnerung zu suchen.
«Haaaaaallooooo? Ist da jemand?» Immer lauter rief er in die Nacht, und je lauter er rief, umso verzweifelter empfand er die wiederkehrende Stille in seiner ihm aufgezwungenen Dunkelheit. Weiter nahm er Schritt um Schritt, denn er musste sich der Kälte wegen bewegen. Immer wieder fiel er hin, dann, wenn sich ein kleiner Graben durch die Ebene zog oder ein Stein auf seinem Weg lag. Wenn es bergauf ging, drehte er sich seitlich weg, denn wo immer er sich befand, es war bestimmt besser, in der Ebene zu gehen – glaubte er zu wissen.
Die Kälte kroch langsam bis in seine Knochen, liess seine Muskeln steif werden. Die hinter seinem Rücken festgeschnürten Hände waren unmöglich zu befreien und taten weh. Im Schritt begann das seltsame Gefühl in Schmerzen überzugehen, aber er konnte sich keinen Reim darauf machen. Die dunkle Zeit dehnte sich zu einem endlosen Band ohne Anfang und Ende. Er strauchelte wieder und fiel bäuchlings hin, dass sein Kopf auf etwas Hartes schlug; bestimmt auf einen Stein. Benommen setzte er sich mühsam auf, fühlte, wie das warme, klebrige Blut über seine zugeklebten Augen hinweg das Gesicht hinunterrann. Nach wenigen Minuten war die Blutung von allein gestillt, auf jeden Fall glaubte er dies.
Noch vorsichtiger als zuvor schon ging er weiter. Immer wieder blieb er kurz stehen, horchte in diese elendige Schwärze. Dass Stille so einnehmend sein konnte – ja einen zu erdrücken vermochte, dass man deshalb laut schreien musste, hätte er nicht für möglich gehalten. Also schrie er, so laut er konnte, und je mehr er schrie, umso grösser wurde seine Angst, bis er erschöpft auf die Knie sank, als befände er sich vor einem Altar und flehte zu Maria, Muttergottes.
Irgendwann vernahm er leises Plätschern.
Ganz in der Nähe musste ein Rinnsal fliessen. Bald spürten seine zwar von der Kälte fast tauben Füsse nassen Untergrund, als er im selben Moment vornüber ins Wasser fiel. Zum Glück war es nur knöcheltief. Vom ersten Schreck etwas erholt, kniete er sich so hin, dass er vornübergebeugt seinen Durst stillen konnte.
Er versuchte zu spüren, in welche Richtung das Wasser floss, doch es war zu wenig Strömung darin. Er musste weiter.
Öfters blieb er stehen, horchte erneut intensiv in die Dunkelheit, die sich mit tiefer Verzweiflung und Wut mischte. Und Wut hatte einen grossen Vorteil: Wut und Angst konnte kein Mensch zur selben Zeit fühlen. So wurde er lieber wütend, als dass die vernichtende Angst sich noch weiter seiner bemächtigt hätte. Auch wenn er auf dem Teller des Teufels gehen und dieser bereits mit seinem Dreizack ausholen würde, so schnell gäbe er nicht auf. Farbenfrohe Bilder seiner Frau Marietta und seines innig geliebten fünfjährigen Sohns Laurin tauchten auf, als würde er in einem Fotoalbum blättern. Für sie müsste er stark bleiben und um sein Leben kämpfen. Seine weiteren, fast trotzigen Rufe verschluckte die Nacht genauso, wie er sich verschluckt fühlte, als wäre er im Bauch eines riesigen Wales gestrandet.
Dennoch ging er vorwärts – wie er glaubte. Die Berge, die ihn wie stumme Betrachter umgaben, standen duldsam da. Sie hatten alle Zeit dieser Welt, Zeit, die nur Berge besassen.
Als er sein Bein an einem weiteren Stein anstiess, nutzte er diesen und rieb ein Auge daran, um das Klebeband wegzuschaben. Vergebens. Es klebte zu stark.
Irgendwann begann er zu zählen, um sich wenigstens in ein Zeitgefüge einordnen zu können: einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig … So reihte er Zahlen zu einer Zeitkette, die Minuten zu Stunden.
Hoffnung keimte in ihm auf, als er die wärmenden Strahlen der Morgensonne auf seiner Haut fühlte.
Es war also endlich Tag geworden.
Auch wenn diese dicken Augenkleber nichts, nicht mal einen blassen Schimmer, durchsickern liessen, so wusste er nun, dass er gesehen werden konnte. Noch nie hatte er die wärmenden Strahlen der Sonne so bewusst angenommen. Einer gefesselten Blume gleich reckte er sich nach ihr. Die Wärme tat ja so unglaublich gut auf seiner kalten Haut, die sich mittlerweile anfühlte, als wäre sie in der Dunkelheit zum Fisch mutiert. Er drehte sich langsam wie ein Braten am Spiess, um auch seinen Rücken aufzuwärmen. Einzig die Schmerzen im Schritt nahmen mit der Wärme stetig zu, doch das Adrenalin drückte sie in den Hintergrund.
Die Sonne spendete ihm zwar die lebensnotwendige Wärme, doch damit hatte sich nur die Temperatur seines Gefängnisses geändert. Ziellos irrte er weiter im Zickzackkurs durch die Hochebene. Die Luft duftete frisch und erfüllt mit einer Prise aus Alpenkräutern, Flechten und Moosen. Die Oktobersonne brannte sich in den nächsten Stunden in seine Haut, als er wie aus dem Nichts heraus in der Ferne das Bellen eines Hundes hörte.
Er versuchte aus voller Kehle, um Hilfe zu rufen. Immer wieder versagte dabei seine Stimme, da er das Wasser nicht mehr gefunden hatte. Seine Zunge klebte am Gaumen und war aufgeschwollen, mehr als ein heiseres Krächzen ertönte nicht.
Das Gebell wurde lauter. Es waren mehrere Hunde. Oder nur einer? Seine Sinne spielten ihm Streiche.
«Holt ihn!», hörte er in der Ferne eine Männerstimme rufen, bevor das Gebell der Hunde anschwoll.
Scheisse!
Wer auch immer die waren – es mussten die sein.
Er drehte sich um und versuchte, ohne Rücksicht auf das Gelände und mit noch weniger logischen Gedanken zu fliehen.
Es war sein letzter Überlebensfunke, der ihn blindlings davonstürzen liess.
Das drohende Gebell wurde immer lauter, undefinierbare Männerstimmen peitschten die Szene weiter an. Er fiel hin, rappelte sich wieder auf und fiel wieder hin, kurz bevor die Hunde ihn erreicht hatten. Er krümmte sich zusammen und wartete wimmernd auf das erste Zubeissen. Der Wirrwarr aus Gebell und Stimmen erreichte ihn. Er zog die Schultern hoch, als sich ihm eine feuchte Hundenase ungestüm ins Gesicht drückte.
«Oh mein Gott, was ist denn mit dem passiert?», schrie hell eine Frauenstimme auf.
«Geht zur Seite!», ordnete eine sonore Männerstimme an, die aus dem Hintergrund wie ein Gipfel alle anderen überragte.
Er spürte, wie jemand seine Fesseln durchschnitt und ihm, unter die Schultern greifend, vorsichtig zum Aufstehen verhalf.
Erstarrt vor Angst, liess er sich wie eine Schaufensterpuppe aufstellen und sich ein Hemd überziehen. Vorsichtig versuchten sie, ihm die Klebestreifen von den Augen zu ziehen. Nur ein kleines Stück davon vermochten sie zu lösen. Das Sonnenlicht schoss bis in die letzte seiner Hirnwindungen. Schnell hielt er sich die Hände vor das Auge und senkte dabei seinen Kopf, als hätte jemand eine Blendgranate in seinem Hirn gezündet.
Hände stützten ihn, damit er sich auf einen grossen Stein setzen konnte. Ein Gewirr aus Licht, Händen und Tönen überflutete ihn. Eine Trinkflasche wurde ihm an seine rissigen Lippen gereicht. Das kühle Nass erlöste seinen trockenen, wunden Mund. Gierig trank er, bis ihn eine Frauenstimme eindringlich mahnte, es langsamer angehen zu lassen, und er die Flasche absetzte. In seinen dursterfüllten Gedanken wäre er am liebsten in einen See aus Quellwasser gesprungen und hätte alles in sich reingesoffen – bis auf den letzten Tropfen.
Nur langsam nahm er im gleissenden Licht detaillierter seine Umgebung wahr, als die Rotoren eines Helikopters in der Luft pulsierten.
Wie ein riesiger metallener Bergadler schwebte die Rettungsfluchtwacht Rega ein. Eine taffe Notfallärztin und ein Bergretter stiegen gebeugt unter dem reissenden Abwind der Rotoren aus. Sofort kümmerten sie sich um ihn, wollten als Erstes wissen, ob er allein unterwegs gewesen sei. Nach der Erstversorgung verschwand er wie in einem Traum im Inneren des Helikopters. Nach dem Abheben hob er nur kurz den Kopf und warf einen Blick auf die lichtdurchflutete Greina-Ebene unter ihm, die zu seiner Hölle geworden war. Mit seiner Rechten griff er langsam unter dem weissen Tuch in seinen Schritt. Eine verstörend greifbare Leere durchwallte ihn.
2
Giulia hatte die erste Nacht in ihrem neuen Zuhause überraschend gut geschlafen. Vielleicht lag es an ihrem neuen Bett aus Arvenholz, das seinen heimeligen Duft im Schlafzimmer verströmte. Arkon lag im Wohnzimmer auf seiner Decke und erhob sich sofort, als er Giulia aus dem Zimmer kommen hörte, um sie wedelnd zu begrüssen.
Barfüssig, mit T-Shirt und einer ihrer Lieblingsjogginghosen bekleidet, dazu eine Tasse Kaffee in der Hand, bahnte sie sich einen Weg durch all das noch Einzuräumende. Auf der Terrasse umhüllte sie die Frische der morgendlichen Herbstluft. Grosse Teile von Chur und die Westhänge des Bündner Rheintals lagen bereits im milden Sonnenschein.
Was für ein schöner Start in meinem neuen Zuhause, dachte Giulia und schob den Gedanken beiseite, dass Erkki die Wohnung sicherlich auch gefallen hätte. Ein freies Wochenende lag vor ihr, das sie mit Bestimmtheit nicht nur zum Einräumen und Einrichten nutzen würde. Es zog sie wie so oft magisch hinaus in die Wunderwelt Graubündens oder, wie sie bei so strahlendem Wetter auch spasseshalber sagte – Blaubünden. Der heisse Kaffee dampfte in der Kälte der Luft und verströmte angenehm sein Aroma, während sie ihn genüsslich trank und weiter in Vorfreude schwelgend die geplante Bergtour durchdachte, die am nächsten Tag in der Früh mit einer Freundin gestartet würde.
Eine Stunde später, um kurz nach zehn Uhr, nachdem sie mit Arkon draussen gewesen war und ihr Früchtemüesli verdrückt hatte, surrte ihr Handy. Zwischen Schachteln und Frotteetüchern fand sie es aufblinkend. In der Leitung war der Leiter der Einsatzzentrale, Werner Kübler.
«Entschuldigung, Giulia, für die Störung. Wir haben einen speziellen Fall reinbekommen. Du glaubst es nicht. Genau wie die letzten beiden Jahre geht er wahrscheinlich unter die Kategorie ‹Herbstlaub›. Die Tat ist vor etwa einer Stunde im Unterengadin auf dem Gebiet des Nationalparks geschehen.»
«Was? Ist jetzt aber nicht dein Ernst.»
«Doch. Leider Tatsache, und ich dachte, das interessiert dich mit Sicherheit auch an deinem freien Tag. Es geht um eine angeschossene junge Frau, die ausschliesslich mit einer Beamtin reden will und dich anscheinend vom Biathlon her kennt. Sie liegt seit wenigen Minuten aufgrund einer Schussverletzung in ihrer linken Schulter im Kantonsspital. Sie schwebt nicht in Lebensgefahr, doch wer weiss, wie lange sie nach der Operation nicht vernehmbar ist.»
Werner Kübler, der als ein sehr besonnener Einsatzleiter galt, musste sich kurz räuspern. «Für die zeitnahe Fahndung nach der Täterschaft ist aber eine kurze Befragung wichtig. Also übernimm du das bitte. Es sind per Helikopter bereits zwei Hundestaffeln in das Gebiet unterwegs, in dem das Opfer aufgefunden wurde. Ein hervorragender Mantrailer und ein Bayerischer Gebirgsschweisshund kommen auch zum Einsatz. Unterstützung bekommen wir ausserdem von zwei Parkwächtern des Nationalparks, die das Gebiet bestens kennen und bereits auf dem Weg sind. Also, jede Information kann wichtig sein. Gib uns so schnell wie möglich mehr Details durch. Im Moment wissen wir nur, dass das Opfer im Unterengadin, beim Lago di Livigno, am Fusse der Staumauer Punt dal Gall, aufgefunden worden ist und berichtet hat, dass es von jemandem regelrecht gejagt worden sei. Die Frau war total verwirrt und brauchte in erster Linie notfallärztliche Hilfe. Die Täterschaft muss entgegen den alten Fällen noch in der Nähe des Fundorts des Opfers sein. Das ist diesmal unser Vorteil, den wir nutzen müssen.»
Giulia schlüpfte in eine Jeans und warf kurz einen Blick in den Spiegel, während sie eilends ihre Zähne putzte. Gewohnheitsmässig wie bei jeder Ermittlung schnallte sie ihr Holster um. Die Waffe darin hatte sie gestern sorgsam und getrennt von der Munition verwahrt. Sie zog sich eine hellblaue, dünne Mammutjacke über, um das Holster zu verdecken, und eilte die Treppe hinunter. Beinahe hätte sie Arkon vergessen: also nochmals zurück, um für ihn die Terrassentüre einen Spaltbreit offen zu lassen.
In ihrem weissen Dienstwagen, einem Audi Q5, fuhr sie hinunter zum Kantonsspital, parkierte direkt vor dem Haupteingang und legte ihre Spezialparkbewilligung hinter die Frontscheibe. Die Zeit drängte.
Beim Eingang wurde sie bereits von einem ihrer Kollegen erwartet, der sie hinunter in den Notfallbereich führte, dorthin, wo das Opfer auf die bevorstehende Operation wartete.
Die junge Frau mit etwas blassem, aber vor allem arg zerkratztem Gesicht und Armen lag mit einem weissen Tuch bedeckt auf einem Spitalbett. Giulia hatte sich im Treppenhaus von ihrem Kollegen sagen lassen, dass es sich um Ladina Demarmels handelte, eine Fünfundzwanzigjährige, die ehemals auch Mitglied des Kaders der Schweizer Biathlonmannschaft gewesen war. Giulia wusste sofort, wer gemeint war, da auch sie einst zum selben Kader gehört hatte. Sie war bis vor wenigen Jahren erfolgreiche Biathletin gewesen, bevor sie sich für die Karriere als Ermittlerin entschieden hatte. Ladina hatte drei Jahre später mit dem aktiven Sport aufgehört, wenngleich aus völlig anderen Gründen.
Giulia begrüsste Ladina mitfühlend, dass sich ihr Gesicht mit den wenigen Sommersprossen um die Nasenpartie dezent erhellte, und legte ihr vorsichtig und freundschaftlich die Hand auf die gesunde Schulter.
«Allegra, liebe Ladina. Es tut mir ausserordentlich leid, was dir widerfahren ist. Ich bin da, um dich zu unterstützen und vor allem um schnellstmöglich die Verantwortlichen zu ermitteln. Du wolltest mit mir unter vier Augen reden? Du kannst mir natürlich alles sagen, aber ich werde aus ermittlungstaktischen Gründen das Gespräch mit diesem kleinen Gerät aufzeichnen. Lass dich davon nicht irritieren. Ist bloss Routine. Einverstanden?»
«Giulia, ich danke dir sehr für dein Kommen. Ist ja schon länger her, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ich glaube, an dem Tag warst du schneller als ich.» Ein gequältes Lächeln huschte über Ladinas Gesicht.
«Ach, das war bei meinem Plausch-Abschiedsrennen auf der Lenzerheide. Du warst die Schnellere auf der Loipe, und ich habe dafür besser am Schiessstand getroffen. Schon eine Weile her. Leider hast du mich nicht deswegen gerufen. Was ist denn passiert?»
«Ehrlich gesagt weiss ich nicht so genau, was wirklich passiert ist. Ich habe eine grosse Befürchtung und bitte dich, dafür zu sorgen, dass dies so frauenfreundlich wie möglich untersucht wird.» Dabei zog sie das weisse Laken zur Seite, dass ihre zerkratzten Beine und geschundenen Füsse zum Vorschein kamen. «Ich bin nur in diesem hellblauen Höschen aufgefunden worden, das nicht mal mir gehört …», fügte sie an und warf einen vielsagenden Blick zu Giulia.
Giulia nickte, denn ihr war klar, was sie damit sagen wollte.
Ladina Demarmels’ zerzaustes Haar war schwarz, schulterlang und gekämmt steckengerade. Ihre rehbraunen Augen sassen in einem symmetrisch schön geschnittenen Gesicht. Angst und Unsicherheit waren darin geschrieben. Es war seltsam für Giulia, sie so zu sehen. Bis anhin hatte sie sie nur als liebenswerte, fröhliche, aber auch als extrem verbissene und fokussierte Sportlerin an Trainings oder Wettkämpfen kennengelernt, die alles für ihren Sport getan und für diesen gelebt hatte.
«Wie soll ich es dir bloss erklären? Plötzlich erwachte ich und fühlte, wie ich rannte. Verstehst du, als ob ich mitten in einem Film aufgewacht wäre, in dem ich die Hauptrolle spiele und gleichzeitig auch die Kameraperspektive bin. Es muss sich abgefahren anhören, aber als hätte ich zuvor wie ein Roboter funktioniert und wüsste daher von nichts. Da waren auf einmal meine Beine und Arme und dieser Waldboden und Äste und das ganz bestimmte Gefühl, von jemandem verfolgt zu werden. Doch ich konnte niemanden erkennen, nur hören, wie er hinter mir her war und nach mir rief, dass ich verdammt noch mal sofort stehen bleiben solle.»
«Kannst du dich an den Moment davor, also bevor alles passiert ist, erinnern?», fragte Giulia. «Wo warst du da? Das ist für uns wichtig zu wissen, denn dort muss dir der Täter aufgelauert haben oder begegnet sein.»
«Heute ist Freitag?»
«Samstag, 7. Oktober», klärte sie Giulia auf.
«Samstag? Samstag, sagst du?» Ladina versank einen Moment irritiert in ihren Gedanken. «Samstag also, sagst du? Das heisst, ich kann mich nur noch an Donnerstagabend erinnern. Ich war im Training auf der Lenzerheide. Du weisst ja, in der Biathlon Arena. Erst Lauftraining, dann Schiesstraining mit den Juniorinnen und …» Sie versuchte angestrengt, gedanklich an die Vergangenheit anzuknüpfen. «Tut mir leid, da ist nichts mehr. Dann kam schon dieser Wald. Oh mein Gott, was ist bloss mit mir passiert?»
«Schon gut. Beruhige dich erst mal, denn genau dafür bin ich ja da, um das zu klären. Okay? Kannst du mir noch kurz was dazu sagen, was du auf der weiteren Flucht gesehen oder gehört hast? Den Rest können wir in aller Ruhe später besprechen, nachdem du dich etwas vom Geschehen und der Operation erholt hast.»
«Ich versuch’s ja. Weisst du, mein Kopf fühlt sich seltsam unordentlich an. Wie gesagt, ich sah mich rennen. Meine Beine, genau, die sah ich und diese vielen Bäume, und irgendwie habe ich es ins Tal geschafft, bevor ich auf einem Tierpfad angeschossen wurde und trotzdem wie durch ein Wunder bis zur Staumauer gekommen bin. Es fühlt sich alles so irrational und bruchstückhaft an. Die Arbeiter beim Staudamm haben dann die Polizei und den Notarzt alarmiert. Und so bin ich hier. Warum ich das dir als Frau sagen will, ist nicht nur der Umstand, dass wir uns schon Jahre kennen, es ist auch, weil ich nur so», dabei zog sie mit dem unversehrten Arm das Laken erneut etwas hoch, dass neben dem blauen Höschen auch eine grosse, alte Narbe am linken Bein zu sehen war, «zu mir gekommen bin. Ich kann dir nicht sagen, wieso ich keine Hose mehr trage, wo die geblieben ist, und auch nicht, was mit mir da unten geschehen ist. Genauso wenig, wem dieses hellblaue Höschen gehört. Ich brauche Gewissheit darüber, aber auf umsichtige Art und Weise», wiederholte sich Ladina und schien bereits vergessen zu haben, dass sie Giulia wenige Minuten zuvor darum gebeten hatte.
Giulia versprach ihr erneut, sich darum zu kümmern. Deshalb sprach sie mit dem behandelnden Chirurgen und bat die Forensikerin, die bereits vor Ort war, zu einem kurzen Gespräch herein.
In einen spurenfreien Beutel wurde die hellblaue Panty gesteckt. Die Rechtsmedizinerin Dr. Kaspezky nahm vorsichtig mehrere Abstriche aus dem Genitalbereich von Ladina und suchte sie dabei auf Verletzungen ab. Um an mögliches Genmaterial des Täters zu kommen, wurden mittels spezieller breiter Klebestreifen, die auf die Haut gelegt wurden, Abdrücke von dieser genommen, auch im Wissen, dass Ladina kurzzeitig im Flusswasser gewesen war. Mit einem kleinen Instrument wurde jede Fingernagelunterseite vorsichtig herausgeputzt, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich das Opfer durch Kratzen gewehrt hatte. Auf den ersten Blick war kein sexueller Übergriff zu erkennen, auf jeden Fall keiner, der mit körperlicher Gewalt einhergegangen wäre. Den Rest würden die Laborauswertungen zeigen. Dr. Kaspezky suchte, so gut es wegen der Schussverletzung möglich war, den Rest des Körpers ab. Der vielen Kratzer an Armen und Beinen wegen war es schwierig, sich ein Bild zu machen, was ihr allenfalls durch den Täter zugefügt worden war und was durch die Flucht selbst. Einige der Prellungen und Blutergüsse würden erst noch richtig zum Vorschein kommen. Mit Sicherheit konnte nur die Schussverletzung dem Täter zugeordnet werden.
Ladina wurde für die Operation abgeholt. Giulia blieb einen Moment im leeren Zimmer stehen, ihre Gedanken begannen zu kreisen: Schon wieder brach das Unglück über diese junge Frau herein. Vor zweieinhalb Jahren war sie während eines Trainings auf den Rollskiern von einem Wagen angefahren worden. Sie und ihren Freund liess der Unfallverursacher einfach bewusstlos am Strassenrand liegen. Die Verletzungen wogen bei Ladina so schwer, dass sie nie mehr an die Weltspitze aufschliessen hätte können – sie musste ihre Karriere beenden und wechselte in den Trainerstab der Juniorinnen. Und nun auch noch das. Das Schicksal meinte es nicht gut mit der sympathischen Ladina.
Wieso Ladina Demarmels? Was war auf dem Munt la Schera geschehen? Und da Ladina möglicherweise auf der Lenzerheide vom Täter überrascht worden war, wieso brachte er sie dann so weit weg in den Nationalpark, nahe der italienischen Grenze?
Im Büro der rechtsmedizinischen Abteilung wechselte Giulia etwas später ein paar Worte mit Dr. Kaspezky, einer gebürtigen Polin, die erst seit einem Jahr als Pathologin im Kantonsspital tätig war und im Teilpensum als Forensikerin für die Bündner Kantonspolizei arbeitete. Giulia war dies mehr als nur recht, denn der Leiter der Abteilung, Dr. Alexander Hiltbrunner alias Dr. Schmuddel, wie sie diesen wegen seines Auftretens nannte, war gar nicht ihr Fall. Der Typ hatte noch immer nicht begriffen, dass sie, wenn sie sein mit Fachzeitschriften und irgendwelchen ekligen Exponaten überquellendes Büro betrat, keinen Kaffee trinken wollte. Aus dem einen Grund nicht, weil er jedes Mal unter einem Stapel erst eine Tasse suchen musste, in der nicht noch Kaffeeringe vom Vorgänger zu sehen waren oder gar Lippenstift.
Auch Frau Dr. Kaspezky hatte was Schauerliches an sich, fand Giulia. Sie wirkte wie eine Wachspuppe, bei der man mit Erstaunen feststellt, dass sie sprechen kann. Sie hatte nichts Lebendiges an sich, als hätten sich über die Jahre hinweg die Atmosphären der Leichenhallen über sie gestülpt. Wenigstens ass sie keine Salamisandwiches wie Dr. Schmuddel, der diese während der Leichenschau nur auf der Ablage zwischendeponierte und sofort weiterass, sobald er seine Ausführungen beendet hatte. Eine durchsichtige Plastikbox mit Salat stand dafür auf ihrem Schreibtisch. Daneben lag eine dieser billigen weissen Plastikgabeln, die viel zu schnell brachen.
Dr. Kaspezky, die in den USA die beste kriminalistische Forensikerausbildung absolviert hatte, versprach Giulia zum Schluss, sich wegen allfälliger Spuren sofort zu melden.
Als Giulia um halb zwölf vor dem Kantonsspital in die mittägliche Sonne trat, tauchte das Gesicht von Ladina in ihrem Geiste nochmals auf. Natürlich durfte sie solche Schicksale nicht zu nahe an sich heranlassen, doch sie hoffte sehr, dass kein Sexualdelikt hinter der Tat stand oder es zumindest nicht so weit gekommen war. Irgendwie war Ladina ja die Flucht geglückt – vielleicht noch rechtzeitig, falls es überhaupt ein passendes Wort dafür gab und wenn man in Betracht zog, was schon angerichtet worden war. Doch wie bei allen Taten stand die Skala nach oben offen, sogar dann, wenn scheinbar das Schlimmste schon geschehen war.
Giulia fuhr nach Hause, um Arkon zu holen, der sich wie immer freute, wenn Frauchen heimkam. Unweit ihrer Wohnung lief sie mit ihm über die Prasserie, die sich am Stadtrand oberhalb von Chur als Wiesen und Felder bis hoch zum Fürstenwald erstreckte und von vielen in der Region als Naherholungsgebiet geschätzt wurde. Währenddessen erstattete sie an den Einsatzleiter Werner Kübler telefonisch Bericht, dies mit der Bitte, sie sofort zu informieren, wenn sich am Fall etwas täte.
Nachdem Giulia einen ausgedehnten Abstecher in den Fürstenwald unternommen hatte, fuhr sie um kurz nach vierzehn Uhr zu ihrer Dienststelle im Hansahof, in dem nur die Fahndung untergebracht war. Das Hauptquartier der Kantonspolizei Graubünden lag am südlichen Ende der Stadt.
Da es Samstag war, war es ruhig im Hansahof – der Pikettdienst war unterwegs. Sigron, ihr Ermittlungskollege, mit dem sie sich ein Zweierbüro teilte, hatte an diesem Wochenende Dienst und nahm seit bald zwei Stunden mit Kollege Caplazi einen Einbruch in der Ems-Chemie auf.
Giulia hatte sich kaum gesetzt, da rief Werner Kübler erneut aus der Einsatzzentrale an. Noch ein skurriler Fall wurde soeben gemeldet, berichtete er. Ein fast nackter Mann, ohne Penis, gefesselt und mit zugeklebten Augen, sei vor etwa einer halben Stunde in schlechtem Allgemeinzustand von einer Gruppe Wanderer in der Greina-Ebene aufgefunden worden. Dieser sei soeben ins Kantonsspital geflogen worden.
Als hätte Giulia ein Déjà-vu, betrat sie erneut das Krankenhaus, sogar dasselbe Zimmer in der Notfallstation. Das Opfer, sie schätzte den Mann auf den ersten Blick auf knapp vierzig, hatte zwei Infusionsbeutel angehängt und lag auf einem Bett, dessen Kopfteil hochgestellt worden war. Er wartete auf die weiteren medizinischen Untersuchungen, um die nötigen chirurgischen Eingriffe über sich ergehen zu lassen. Um seinen Kopf war ein Verband angebracht worden. Sein Gesicht trug Rötungen von den Augenklebern und vermutlich vom Sonnenbrand. Sein Körper steckte unter einem weissen Laken. Er blickte starr nach vorne, auch währenddessen Giulia sich kurz vorstellte.
Mario Capeder war sein Name, Alter achtunddreissig, verheiratet, ein Kind, wohnhaft in Chur und von Beruf Rechtsanwalt.
Da das Opfer schwach sei, müsse sie sich kurzfassen und sich auf wenige Fragen beschränken, hatte der Stationsarzt sie eindringlich vor dem Betreten des Zimmers gebeten.
«Herr Capeder, können Sie mir sagen, was genau passiert ist?», fragte Giulia.
«Ja, wenn ich das könnte, wäre es auch für mich einfacher zu verstehen, was passiert ist. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Wie bei einem Filmriss bin ich mitten in der Nacht in dieser Dunkelheit erwacht und habe versucht zu überleben. Verstehen Sie? Ich dachte tatsächlich, das sei das Ende.» Er liess seinen Kopf tiefer ins Kissen sinken und atmete hörbar aus, während sein Blick weiter geradeaus an Giulia vorbei zur Decke gerichtet blieb.
«Also verstehe ich richtig? Sie standen urplötzlich gefesselt und nur mit Shirt bekleidet in der Greina?»
«Natürlich wusste ich nicht, wo ich mich befand. Doch es wurde mir mit der Zeit klar, es musste in den Bergen sein. Diese Stille, die Art des Bodens, der Geruch und die Kälte der Nacht sagten es mir. Ich bin in einem Bergdorf im Safiental aufgewachsen, wissen Sie.»
«Und Sie haben keine Erinnerungen an das Davor? Wie sie dahingekommen sind?»
«Nein. Rein gar nichts. Als wäre mein Hirn ein leerer Eimer. Da ist nichts. Das Letzte, an das ich mich erinnern kann, ist, dass ich im Restaurant Oldtimer in Chur, meiner Lieblingspizzeria, gegessen habe, und ich glaube, noch gezahlt zu haben, aber das weiss ich nicht mehr so genau, und das war’s. Jemand muss mir etwas verabreicht haben.»
«Und wann war das?»
«Das war gestern am frühen Abend. So um achtzehn Uhr.»
«Also Freitag?»
«Ja.»
«Und nur ganz kurz bitte schön: Warum hat Sie Ihre Frau bis jetzt nicht als vermisst gemeldet?»
«Die ist mit dem Kleinen bis Sonntag zu ihren Eltern gefahren. Die wohnen in der Nähe von Bern. Ihr Vater hat Geburtstag und kann mich nicht ausstehen. Mein Geschenk an ihn war deshalb, dass ich nicht mitging.»
«Und können Sie sich vorstellen, wer hinter alledem steckt? Haben Sie einen offenen Konflikt mit jemandem oder sonst eine Idee?»
«Ich sag’s Ihnen, Frau de Medici. Es ist alles so unwirklich. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das hier echt ist. Ich meine, dass ich mit Ihnen rede. Vielleicht erwache ich gleich im Bett und habe alles nur geträumt. Das wäre mir eigentlich am liebsten. Nein, ich habe keine Ahnung und mag jetzt echt nicht mehr weiterreden. Bitte lassen Sie mich in Ruhe.» Erschöpft schloss er seine Augen, sein Kopf versank im voluminösen Kissen.
«Danke, dies reicht auch fürs Erste. Die Ärzte haben Ihnen ja strenge Bettruhe verschrieben. Wir werden uns später unterhalten, wenn es Ihnen besser geht. Falls Ihnen vorher etwas Wichtiges in den Sinn kommt, so melden Sie sich bitte umgehend unter dieser Nummer. Egal, um welche Uhrzeit. Ich lasse Ihnen meine Karte da.»
Giulia war klar, dem Mann war die ganze Tragweite der Tat noch gar nicht bewusst. Wie auch, der menschliche Geist, so wusste sie aus anderen Fällen, schützte sich auf diese Weise.
Giulia liess sich weitere Personenangaben aus der Zentrale auf ihr Handy übermitteln. Auch Mario Capeders Handynummer, um rasch einen Antrag auf ein Bewegungsprofil stellen zu können, denn weder er noch Ladina wussten, wo sich ihr Handy befand. Mit den Daten der Mobilfunkbetreiber würden sie mindestens in Erfahrung bringen, wann und wo es jeweils ausgeschaltet worden war.
Sie machte sich erneut in den Hansahof auf. Sie wollte rasch handeln können, wenn ihre Kollegen sich von einem der beiden Fundorte meldeten.
3
Ein paar Tage zuvor
Hannes Camenisch hatte am späteren Abend ein kleines Feuer entfacht, dessen Schein sicher nicht zu sehen wäre, da sich die Feuerstelle in einem grösseren Erdloch direkt neben dem Eingang seiner Behausung befand und umgeben war von dichtem Baumbestand.
Diese Ruhe.
Nur das Knistern und Knacken trockener Holzscheite und der Funkenflug umgaben ihn. Die Funken stiegen wie Glühwürmchen aus dem Feuer hoch ins Dunkel der Nacht, um darin zu erlöschen, als hätte es sie gar nie gegeben.
Er mochte keine Menschen.
Das war auch sein grosser Nachteil, dass er selbst ein Mensch war. Lieber wäre er eines der Tiere im Wald gewesen: ein Hirsch, ein Murmeltier, ein Fuchs, Wolf, Steinbock oder Dachs. Hauptsache, ein Tier, das wäre wunderbar gewesen. Doch er war dazu verdammt, ein Mensch und sich dessen auch noch gewahr zu sein. Welche Ironie des Schicksals.
Er strich durch seinen mächtigen schwarzen Bart. Diesen hatte er seit vielen Jahren nicht mehr geschnitten, genauso wie sein Haar, das lang und kräftig in Wellen über seinen Rücken floss, als wäre es sein Fell. Wenn er schon kein Tier sein konnte, so teilte er wenigstens den Lebensraum mit ihnen. Den Nationalpark hatte er sich dazu ausgesucht. Ein Zuhause, auf das er achtgeben musste, denn er hatte bereits mehr als eines verloren. Dieses hier würde er deshalb weiter verteidigen. Und das nicht nur gegen diese verfluchten Tagestouristen, die immer wieder auf den Munt la Schera kamen und ihren Unrat achtlos liegen liessen und sich einen Dreck um die Verhaltensregeln im Nationalpark kümmerten.
Dieses elendige Pack! Bestimmt eine Horde von Kraut- und Rübenfressern, die einen wie ihn, der hin und wieder Kleinwild erlegte, dafür steinigen und als Barbaren, als fleischfressende Bestie beschimpfen würden. Laut plappernd war diese Bande von fettbäuchigen Sonnenhutträgern in ihren kurzen Wanderhosen und mit bleichen Waden unterwegs und hatte bestimmt am Abend einen Mordssonnenbrand. Dieses Pack war niemals imstande, die Natur zu schätzen, zu ehren oder wenigstens zu respektieren. Und das Schlimmste: Diese Pseudo-Pflanzenfresser waren genau diejenigen, welche in einem Supermarkt Billigfleisch einkauften und glaubten, das Tier sei vor lauter Glücklichsein freiwillig ins Schlachthaus gerannt. Was Mensch und Natur verband, davon hatten sie keine Ahnung. Einzig die Parkwächter, vor denen er sich ebenfalls in Acht nehmen musste, verstanden, wie wertvoll diese Region wirklich war, und hielten die abtrünnigen Touristen in Schach.
Hannes war seit Tagen auf der Hut.
Etwas tat sich am Berg, davon war er überzeugt, und das nicht nur, weil er zwei Fremde gesehen hatte, die sich vor etwa vierzehn Tagen seltsam am Berg verhalten hatten. Das waren keine gewöhnlichen Wanderer gewesen, denn diese verliessen den einzigen freigegebenen Wanderweg nur selten, und wenn, dann nie so weit wie die beiden. Vielleicht war es jemand von der Behörde gewesen, auf der Suche nach ihm. So oder so, Ärger war vorprogrammiert, das spürte er, und es löste Unbehagen in ihm aus.
Mit diesen Gedanken legte er sich das schön angebratene Stück Gamsfleisch auf einen Blechteller, dazu ein paar gekochte Kartoffeln. Ein paar Wildkräuter hatte er am Nachmittag gesammelt und mit seinem Messer zerkleinert. Diese verteilte er nun über den Kartoffeln. Aus einer Kunststoffbox klaubte er sorgsam ein wenig grobkörniges Salz und streute es über sein Essen, als wäre es weisses Gold. Es duftete wunderbar.
Sein Blick schweifte durch die Stille zum nahen Gipfel des Munt Buffalora und hoch in einen prächtig von Sternen übersäten Nachthimmel. Wie schön war doch sein Graubünden!
Seine Waffe lag gesichert in seiner Höhlenbehausung.
4
Keine halbe Stunde nachdem Ladina in den Operationssaal geschoben worden war, erreichten die beiden Hundestaffeln ihr Einsatzgebiet am Munt la Schera.
Der Mantrailer, ein toptrainierter Belgischer Schäferhund, nahm beim Parkplatz, am Fusse der Staumauer Punt dal Gall, sofort die Fährte des Opfers auf. Der Hundeführer mit dem Bayerischen Gebirgsschweisshund folgte ihm im Abstand von fünfzig Metern. Er würde später systematisch Teilbereiche der Bergflanken absuchen, um Spuren des Täters wittern zu können.
Noch war unklar, von wo dieser geschossen hatte. Der Mantrailer seinerseits würde absolut unbeirrt, wie dies ihm jahrelang antrainiert worden war, nur dem Geruchsprofil des Opfers folgen, um herauszufinden, wo dessen Flucht begonnen hatte. Nichts, weder Lärm noch andere Tiere oder noch so intensive Gerüche, könnten den Mantrailer dabei aufhalten.
Schnell war die Stelle gefunden, an welcher die Frau aus dem Wasser gestiegen war. Entsprechend wurde diese mit einem Markierungsfähnchen gekennzeichnet und die GPS-Position gespeichert. Da das Opfer auf der gegenüberliegenden Flussseite ins Wasser gefallen war und sein Fluchtweg von dort zurückführte, drehten die Suchteams, um via die Talsohle der Staumauer auf die andere Seite zu gelangen. Nur gerade fünfzig Meter, so fanden sie heraus, hatte es das Opfer flussabwärts getrieben. Nach etwa einer weiteren halben Stunde war klar, wo der Schuss die Frau getroffen hatte, denn auch nach über einhundert Metern dem Fluchtpfad weiter folgend wurden keine Blutspuren mehr gefunden. Arno Spescha, der als Einsatzleiter mit einem Beamtenkollegen den Hundestaffeln folgte, liess seinen Blick in die Umgebung schweifen.
Wo etwa könnte der Täter gestanden haben? Die Bergflanke war hinter dem Moränenfeld wieder dicht bewaldet, und nur einige Felsstrukturen erhoben sich hie und da aus dem Wald. Der Trampelpfad schlang sich unübersichtlich dem Gelände entlang. Der Täter konnte überall zum Schuss angesetzt haben.
Sie beschlossen, dass der Mantrailer mit einem zusätzlichen bewaffneten Beamten die Spur des Opfers weiter zurückverfolgen sollte, während der Bayerische Gebirgsschweisshund das unwegsame Gelände ober- und unterhalb des Wanderwegs auf Spuren des Verfolgers absuchte. Ein Polizeihelikopter flog gleichzeitig aus der Luft das Gebiet weiträumig ab.
Die Sonne wärmte kräftig. Die Hunde standen derart unter Trieb, dass sie nur kurz gierig Wasser soffen, als hätten sie keine einzige Sekunde zu verschwenden.
Am Nachmittag, nachdem sie dem gesamten Fluchtweg des Opfers gefolgt waren, stand das Team mit dem Mantrailer vor einem Rätsel. Nur etwa fünfzig Meter oberhalb der Waldgrenze des Munt la Schera hörte die Spur des Opfers abrupt auf. Exzellente Schweisshunde konnten bis zu vier Wochen noch letzte Geruchsmoleküle erkennen und so einer Spur folgen. Und diese Spuren hier waren doch erst ein paar Stunden alt und zudem in einer Umgebung hinterlassen worden, in der normalerweise kein Mensch durchkommt. Die Spur löste sich dennoch offenbar mitten im kurzen mattbräunlichen Gras auf. Sie suchten eine geschlagene Stunde die Umgebung ab, bis in die flache Gipfelregion hoch, und fanden nichts. Arno Spescha sprach sich mit den Hundeführern ab. Es hatte keinen Sinn, weiterzusuchen – da war nichts, wo eigentlich eine Spur hätte sein müssen.
Von woher und vor allem wie das Opfer und der Täter an diese Stelle gelangt waren, warf grosse Fragen auf. Hier musste nämlich die Jagd begonnen haben, denn das Opfer konnte nicht aus dem Nichts hier aufgetaucht sein. Zeitgleich mit dieser Erkenntnis erhielten sie per Polizeifunk die Meldung, dass der Gebirgsflächen-Suchhund eine Fährte aufgenommen hatte.
***
Zeitlich versetzt spuckte Mitte Nachmittag ein Militärhelikopter eine andere Hundestaffel samt einem Bergführer in der Greina-Ebene aus. Wieso ausgerechnet das zweite Opfer, Mario Capeder, derart abseits ausgesetzt worden war, verwunderte die Beamten. Die sechs Kilometer lange und einen Kilometer breite Hochgebirgslandschaft lag zwischen der Val Lumnezia und dem Val Sumvitg im Norden und dem Bleniotal im Süden, das Graubünden mit dem Kanton Tessin verband. Diese drei Täler waren seit jeher nur über die Greina-Ebene miteinander verbunden. Weder Strassen noch Bergbahnen verknüpften die Regionen miteinander, und deshalb war diese Tundren-Landschaft seit vielen Jahrhunderten unberührt erhalten geblieben. Egal von welchem der drei Täler aus der Täter den Zustieg gewählt hatte, es bedeutete immer mehrere Stunden anstrengenden Fussmarsch, und es gab genau fünf Routen. Auf einem dieser Wege ein Opfer hochzutragen musste erstens gut organisiert gewesen sein und war zweitens unmöglich von einer Person allein zu schaffen.
Auf der Greina versperrte kein naturbelassener Wald die Sicht auf die Bergflanken, das machte das Vorankommen einfach, wenngleich durch die Weite die Distanzen schlecht einschätzbar wurden. Gemäss der gespeicherten GPS-Position der Rettungsflugwacht setzten sie den Mantrailer exakt dort an, wo der Helikopter das Opfer aufgenommen hatte.
In verwirrendem Zickzack schien das Opfer orientierungslos durch die Nacht geirrt zu sein, da sich seine Spur immer wieder kreuzte. Der Stein, an dem es sich den Kopf blutig geschlagen hatte, war schnell gefunden. Seine Spur verlor sich aber im seichten Ufer des Rein da Sumvitg. Von irgendwoher musste das Opfer dorthin gebracht worden sein.
***
Giulia wurde offiziell die Leitung des Falls übertragen.
Die Akte «Herbstlaub» erhielt höchste Priorität. Somit war ihr klar: Die Bergtour morgen Sonntag musste warten. Sie würde somit aus anderen Gründen in der hiesigen Bergwelt unterwegs sein. Ihr Ermittlertrieb war hell entbrannt, und so war die Absage an ihre Freundin mehr als nur zu verschmerzen. «Berge laufen niemals davon», pflegte sie in solchen Situationen zu sagen.
Zwei Jahre lang war ein Ermittlerkollege in den sogenannten Herbstlaubfällen nicht vorangekommen. Im Team wurde die Faktenlage zwar einige Male besprochen, doch sie wusste, zu sehr durfte sie sich nicht in andere Fälle von Kollegen einmischen. Das Skurrile dieser Taten interessierte sie schon seit deren Beginn. Da der am Fall arbeitende Ermittler vor Wochen bereits intern eine neue Aufgabe gesucht hatte und nächstens antreten würde, fiel der Fall sozusagen ihr in den Schoss, und aus «Herbstlaub» wurde die Akte «Bündner Treibjagd».
Im Hansahof setzte sie sich hinter ihren Schreibtisch und ging die Vernehmungsprotokolle der vier alten Fälle der vergangenen zwei Jahre durch. Eine Frau und drei Männer waren die Opfer: Gepeinigt, teils wiesen sie sogar Folterspuren auf, um dann irgendwo in der Bergwelt Graubündens halb nackt ausgesetzt zu werden. Bis dato wurden keine Motive gefunden, und seit den Taten wurden die Opfer auch nicht mehr angegangen, so die Schnellübersicht. Verbindungen unter den Opfern konnten bisher ebenfalls keine festgestellt werden, weder räumliche noch persönliche.
Draussen verabschiedete sich ein weiterer Tag in einem Farbenmeer. Die wenigen Wolkenschleier entzündeten sich von Südwesten her. Das glimmende, fast unwirklich scheinende Rotorange tauchte Menschen, Gebäude und die Natur gleichermassen ein und warf lange Schatten. Giulia sah aus ihrem Fenster im zweiten Stock. Das Glühen der Bergkämme zu sehen liess sie einen Moment den Fall vergessen. Vergangenen Sommer war sie während einer Bergtour ein paar Tage im Wolfsboden gewesen, einer Alp tief im Schanfigg. Es waren glutheisse Tage gewesen, und sogar in dieser Höhe, in der nur noch die höchsten Gipfel die Bergweiden wie eine steinerne Krone umschlossen, waren die Abende noch warm gewesen. Das Alpenglühen, die letzten Sonnenstrahlen auf den Felswänden der Ostflanken, kam ihr nun angenehm in den Sinn. Auf vieles würde sie verzichten können, aber darauf nicht. Sie war ein Kind der Berge und würde es für immer bleiben. Das hatte sie so auch Erkki gesagt und damit den Anfang vom Ende ihrer Beziehung eingeläutet.
Sie zurrte ihren Pferdeschwanz zurecht, als das Display ihres Handys aufleuchtete und sie ins Hier und Jetzt zurückklingelte: Gegen zwanzig Uhr würden sich die leitenden Ermittler der Suchtrupps im Hansahof zu einer Sitzung einfinden. Ausserdem habe die Presse bereits Wind von den Fällen bekommen und wolle Informationen, hörte sie den Chef der Kriminalpolizei Erich Hartmann am Telefon sagen.
Hartmann tauchte wie immer mit einem Becher Kaffee in der Hand auf, als sich zehn Personen erst gegen halb neun am Abend in dem Sitzungsraum scharten.
Giulias Blick ruhte kurz auf ihm: Hartmann und sie würden mit Sicherheit nie Freunde werden. Sie mochte die raubeinige Art ihres Vorgesetzten genauso wenig wie dessen langweilige Krawatten, seine O-Beine und seinen perfekt geschnittenen grau melierten Schnurrbart.
Hartmann hatte seine weissen Hemdsärmel zurückgekrempelt und kippte den letzten Schluck seines Kaffees in den Mund, bevor er den Becher in einem kleinen Bogen in den Abfallkorb warf und seinen Schnauz, wie so oft, zurechtstrich. Giulia sass in der vordersten Reihe und wartete gespannt auf die konsolidierte Faktenlage, zu der auch sie ihren Teil beitragen würde. Hartmann begann mit der Zusammenfassung.
Viel Neues hatte sich nicht ergeben, dachte Giulia, als er damit fertig war. Aber sie wusste aus Erfahrung, dass Fälle meist erst durch viele Details gelöst werden. Die neuen Fälle warfen wiederum mehr Fragen als Antworten auf. Immerhin, eine interessante Spur wurde durch die Fährtensuche am Munt la Schera gefunden. Der Bayerische Gebirgsschweisshund hatte seinen Hundeführer samt begleitenden Beamten zu einer einfachen Behausung an der südwestlichen Bergflanke geführt. Hartmann hatte einige Bilder synchron zu seinen Ausführungen via Beamer eingespielt, welche die Situation vor Ort aufzeigten. Nach ersten Erkenntnissen war die Behausung aktiv bewohnt. Doch es konnte niemand angetroffen werden. Der oder die Bewohner, so schien es, hatten sich aus dem Staub gemacht. Deshalb würden sie in den nächsten Tagen das ganze Gebiet nochmals absuchen – Naturschutzgebiet hin oder her, die Parkverwaltung würde sie dabei unterstützen müssen. Hartmann hatte bereits das Militär um Gebirgsgrenadiere ersucht. Eine Truppe von fünfzig Mann und einige ihrer eigenen Beamten würden am nächsten Morgen mit der Durchforstung der Bergflanken starten. Giulia wäre gerne mit dabei gewesen, doch Hartmann hatte ihre Frage diesbezüglich unleidig abgewinkt mit dem Kommentar, dass sie die Opfer detaillierter befragen und sich erst in die Akte «Bündner Treibjagd» vertiefter einarbeiten solle, da sie den Fall ja sozusagen erst vor ein paar Stunden zugeteilt bekommen habe.
Was den Fall in der Greina-Ebene anbelangte, blieben fast nur Fragezeichen zurück. Die Flugraumüberwachung hatte ihnen bestätigt, dass keine Flugobjekte, weder über der Greina noch über dem Munt la Schera, auf ihren Radarschirmen aufgetaucht waren. Da Giulia mehrmals die Greina durchwandert hatte und die Täler gut kannte und aufgrund der Ausgangsposition der ersten Spuren von Mario Capeder und des engen Zeitfensters, in der die Tat geschehen sein musste, ging sie stark davon aus, dass die Täterschaft von Runcahez hergekommen war. Aber auch auf dieser Route gab es Abschnitte, auf denen es schwierig wäre, ein Opfer hochzubringen.
Sie erinnerte sich an ihre letzte Tour: Bis Runcahez wäre der Transport mit einem Fahrzeug möglich gewesen, für Touristen fuhr sogar ein Bus. Zu Beginn folgte sie damals der rechten Flussuferseite des Rein da Sumvitg hinein ins Val Sumvitg – vor sich die beiden Dreitausender Piz Vial und Piz Valdraus mit ihren Gletschern. Nach dem Passieren der Alp da Tenigia und der Überquerung des Rein da Sumvitg lief sie weiter taleinwärts. Das Gesicht des Flusses veränderte sich nun: Er wurde wilder und bahnte sich aufschäumend einen Weg über Steilstufen. Von diesem Moment an wurde auch dieser Richtung Crest la Greina zunehmend steiler und führte in engen Steilkehren den Berg hoch. Bei den exponierten felsigen Passagen wurde er zudem mit Ketten gesichert. Durch diese Abschnitte, zu zweit oder auch zu dritt, das Opfer hochzutragen stellte sich Giulia schwierig vor. Wenn das alles geschafft war, müssten sie noch zur Terrihütte hoch und an dieser ungesehen vorbei, bevor sie endlich die Greina erreichen würden.
Was die Amnesie beider Opfer betraf, so erwarteten sie rasch den Bericht des rechtsmedizinischen Gutachtens, doch es war mit Sicherheit zu erwarten, dass es sich um die bisherige von dem Täter verwendete Mixtur handeln musste. Im Moment hiess es, die Presse mit dem zu füttern, was nötig war, um nicht noch mehr Neugierige in die Gebiete zu locken. Die erste Story war bereits online im Boulevardblatt erschienen. Ein Mitglied der Wandergruppe, welche das männliche Opfer aufgefunden hatte, war gesprächig gewesen. Sogar Fotos vom Opfer, wenn auch das Gesicht unkenntlich gemacht worden war, waren im Netz zu finden. Immerhin gab’s keine Toten, das verschaffte ein wenig Luft. Hartmann präsentierte noch die Schlagzeile: «Entmannter Gefesselter in der Greina ausgesetzt!»
Da es zwei Opfer an einem Tag gab, passten sie offenbar den Untertitel an, erklärte er: «Blutbünden erneut Tatort!»
Giulia verliess, kaum war das Meeting zu Ende, den Hansahof. Sie war sauer. Hartmann wusste, dass sie erst am Montagnachmittag die Opfer erneut befragen durfte. So war es mit den Ärzten vereinbart worden. Und ebenfalls erst Montagnachmittag würden die ersten Laborbefunde zur Verfügung stehen. Kurz und bündig: Hartmann hatte sie zu ihrer ungeliebten Büroarbeit verdonnert.
Giulia fuhr zum Fürstenwald hoch, damit Arkon nochmals genügend Auslauf fand. Die dunklen Berge umrahmten die beleuchtete Stadt, als wären sie eine Gruppe Riesen, die um die Glut eines Feuers sitzt. Es roch nach umgepflügter Erde, die Luft war kühl. Arkon lief perfekt bei Fuss und blickte immer wieder zu ihr hoch.
Ein aussergewöhnlicher, ein phantastischer Hund. Kraftvoll und von gutem Wesen, dabei hervorragend in seiner Triebeigenschaft und unglaublich treu. Arkon war ein wunderbarer Freund, der alles für sie tun würde, das wusste sie.
Keine Frau ging gerne nachts allein am Waldrand oder im Wald spazieren. Dank Arkon an ihrer Seite und ihrem Selbstbewusstsein, sich überdies jederzeit sehr gut selbst zu verteidigen zu wissen, konnte Giulia diese abendlichen, manchmal sogar nächtlichen Spaziergänge geniessen.
Zu Hause angekommen, legte sich Arkon nach dem Fressen im Wohnzimmer auf seine Decke. Giulia stocherte in einem Pouletbrustsalat herum und hörte dabei leise Musik. Sie hing ihren Gedanken nach, wobei sie diejenigen um ihre private Situation zur Seite schob, als wären es verwaiste Einkaufswagen, die den schmalen Gang zwischen den Regalen versperren. Sie würde den Sonntag dazu nutzen, um alle bisherigen Akten durchzugehen und die Akte so aufzubauen, wie sie es von ihrer Arbeitsweise her als gut befand. Sobald neue Fakten auftauchen sollten, wäre sie bereit.
***
Zur selben Zeit richtete Hannes Camenisch sich sein neues Lager ein, nachdem er vor einigen Stunden vor der Polizeihundestaffel hatte flüchten müssen. Eine alte Petroleumlampe spendete ihm spärliches Licht und verbreitete den typischen Geruch, den Hannes seit frühsten Kindheitstagen sehr mochte.