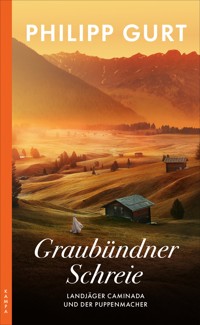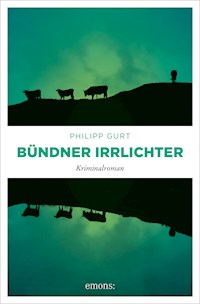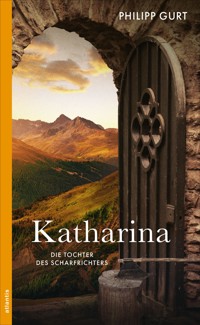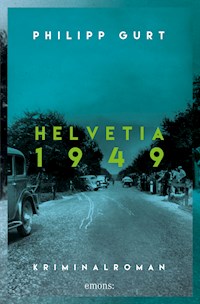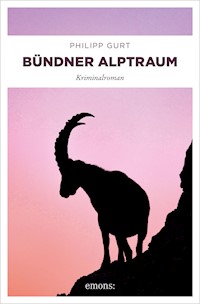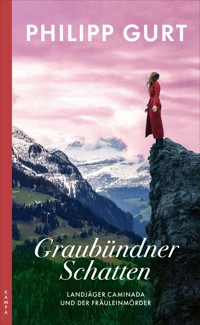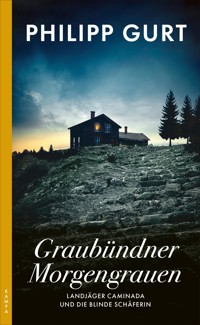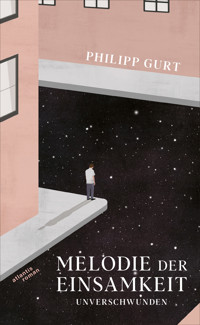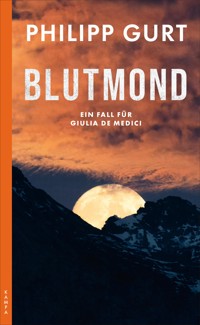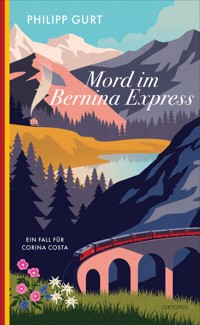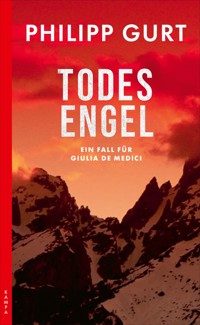
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Giulia de Medici
- Sprache: Deutsch
Ein rätselhafter und nicht minder verstörender Mord an einer 29-jährigen Frau in Chur erschüttert nicht nur Graubünden. Das Opfer wurde am Waldrand auf einer Parkbank drapiert, als lebe es noch, in seinem Mund steckt ein seltsamer Gegenstand. Giulia de Medici, die erfahrene Chefermittlerin der Kantonspolizei Graubünden, übernimmt den Fall. An ihrer Seite steht wie immer Nadia Caminada, ihre beste Freundin und eine renommierte Profilerin. Gemeinsam nehmen sie die Ermittlungen auf und stoßen auf eine schaurige Parallele: Im Sommer 1983, während des berüchtigten Emmentaler Blutsommers, wurde eine der drei getöteten jungen Frauen auf exakt die gleiche Weise inszeniert. Könnte derselbe Mörder am Werk gewesen sein, oder haben sie es mit einem Nachahmungstäter zu tun? Während Giulia und Nadia händeringend nach Spuren und Verbindungen zwischen den beiden Fällen suchen, wird der malerische, in herbstlichen Farben leuchtende Crestasee zum Schauplatz eines weiteren Verbrechens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 484
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Philipp Gurt
Todesengel
Ein Fall für Giulia de Medici
Roman
Kampa
Für Miriam Cahannes und David Bucher
und für das gesamte Team vom Buchhaus Lüthy in Chur
Diese Zeit weist jedem Influencer seinen Thron,
jedem Clown seinen Zirkus,
und ich weise jedem seinen Tod!
Prolog
1986
»Engel?« Eine alte Holztür ging auf. Vom Treppenhausfiel Licht in den großen Raum. »Ich hätte es mir ja denken können, dass ich dich hier finde.« Der Mann hatte eine warme Stimme. »Es ist friedlich hier unten, nicht wahr, mein kleiner Engel?«
Die Elfjährige nickte, während sich der alte Mann neben sie auf das grüne Samtsofa setzte. Nur eine einzige Kerze erhellte den Raum, in dem viele Kinderzeichnungen an den Wänden hingen.
»Weißt du, mein liebes Kind, das können nur wir beide erkennen, das mit diesem Frieden. Das Leben kann hier unten niemandem auch nur irgendetwas mehr anhaben. Das Schöne ist erlebt, das Schwere durchlebt.« Er legte seine Hand auf ihre schmalen Schultern. »Der sogenannte Tod, mein Engel, ist auch hier unten nicht das Ende. Aber auch nicht der Anfang, denn es gibt weder Anfang noch Ende, weder Geburt noch Tod. Alles bloß ein Übergang. Stell dir vor, Babys könnten gleich nach der Geburt schon mit uns reden. Sie würden uns erzählen, dass sie glaubten, sterben zu müssen, während die Wehen ihrer Mutter sie rauspressten. Doch auch dies ist bloß ein weiterer Übergang im ewigen Kreislauf, dem wir uns anvertrauen dürfen.«
Das blonde Mädchen nickte, Tränen glänzten in seinen Augen. »Meinst du, ich finde sie irgendwann wieder, Großvater?«
Er lächelte warmherzig. Falten durchfurchten seine ledrigen Gesichtszüge, die davon zeugten, dass er viel erlebt hatte. »Ganz bestimmt sogar. Wie gesagt, es gibt nur Übergänge. Sag, siehst du denn nicht, wie verlassen diese Tote hier wirkt? Ihr Geist ist ausgezogen, der Körper wurde zurückgelassen, wie der Kokon einer Raupe. Und so hat auch sie sich verwandelt.« Er strich ihr übers Haar. »Darum bist du doch so viel hier unten. Um genau das zu erkennen.«
Das Mädchen blickte auf die von Verletzungen gezeichnete Leiche der ihr unbekannten Frau vor sich, nickte und lächelte. Doch immer, wenn sie zu lächeln versuchte, passierte es; ihre jungen Gesichtszüge fingen an, sich gummiartig zu verziehen. Als würde sie ihren Unterkiefer ausrenken, wurde ihr liebliches Gesicht schiefer und schiefer, sogar die Augen schienen nicht mehr auf derselben Höhe zu stehen, das Gesicht, als falle es gleich vom Knochen, wurde zu einer Fratze!
Ihr Großvater lächelte, während es passierte. Seine schwielige Hand fuhr nochmals liebevoll über ihr Haar, das er küsste, und sagte: »Ich fühle dein Lachen, und das ist schön, sehr schön sogar, so wie du.« Er zog die verzerrte Fratze seiner Enkelin an seine Brust, fühlte, wie sehr sie litt. Sie wusste, dass sie niemals vor ihm verbergen könnte, dass etwas mit ihr nicht stimmte, und das lag nicht an ihrem Gesicht. Doch in ihrem Großvater fand sie einen Verbündeten.
1
Freitag, 1. November 2024, Allerheiligen, 23:17 Uhr
Schon seit Wochen war es viel zu warm für die Jahreszeit. Dazu war im Laufe des Tages Südföhn aufgekommen. Dieser trieb die Temperaturen noch höher, auf über 20 Grad, und ließ sie in dieser noch mondlosen Nacht auch nicht mehr darunter fallen. Mit seinem Tosen füllte er das Tal.
»Wer einzig mit dem Herzen die Menschen sieht, der bleibt auf dem entscheidenden Auge blind … Hmm, sag, ist dem nicht so?«, flüsterte eine sanfte Männerstimme in das Ohr, das in diesem Moment die letzten Geräusche dieser Welt einfing. »Ach, stimmt ja, du kannst ja gar nicht mehr sprechen. Wie unhöflich von mir. Aber noch kannst du mich hören … ich sehe es doch an deinen erlöschenden Augen.«
Diese standen regungslos geweitet offen. Die kleinen Ohranhänger der Sterbenden, geformt wie goldene Büroklammern, wackelten noch kaum merklich. Noch vor wenigen Minuten war das ganz anders gewesen.
»Weißt du, nach jedem Sturm muss die Ruhe einkehren. Zwangsläufig. In deinem Fall sogar die dich erlösende Ewigkeit. Doch dann wird dein Tod für mich sprechen«, flüsterte die warme Stimme weiter.
Der Mann stand nach vorne gebeugt unmittelbar neben der Frau, als wollte er ihr beistehen. Sein Gesicht lag im weichen Schein zweier Laternen, die neben der Frau auf dem Boden standen, rundherum wölbte sich die rauschende Dunkelheit.
Sanft küsste er ihre Stirn, so sanft wie ein Liebender. Ihre Augen schlossen sich dabei träge, als wollte sie sich dadurch von allem abwenden. Seine Lippen lösten sich zögerlich, während in der Dunkelheit über ihnen der Wind das Blätterdach schüttelte.
Zweifellos ging es mit der 29-Jährigen zu Ende, deren geschlossene Augenlider plötzlich hektisch flatterten, als bedeckten sie zwei eingesperrte Vögelchen.
Ihr verzweifeltes Reißen an der Fesselung hatte für den Mann erfreulicherweise länger gedauert als erhofft, doch nun war ihre Kraft erlahmt. Leider musste das Ende ja immer irgendwann kommen.
»Ja, ja, so ist es nun mal. So ist halt der Lauf deiner Zeit.« Sein Blick verharrte in ihrem Gesicht. »Du bist die Saatfrau, ich bin der Schnitter. Dein Schnitter, der in dieser Nacht deine Ernte einfährt.«
Er betrachtete sie beinahe ungläubig, dann beugte er sich noch näher zu ihr, brachte seine Lippen so nahe an ihr Ohr, dass er ihre Hitze spürte, und flüsterte: »Sag, ist das nicht verrückt? Man steht am Morgen auf und glaubt, man hätte noch alle Zeit der Welt, ja sogar eine kleine Ewigkeit.« Er richtete sich etwas auf. Er schien amüsiert zu sein, das zumindest deutete sein Lächeln an. »Ach ja, die Menschen. Aber dann, wenn sich das Leben seinem Ende zuneigt, nur noch Momente bleiben, dann verliert vieles, an das man sich sein Leben lang krampfhaft geklammert hat, schlagartig an Wert und Wichtigkeit. Aber dann, dann rückt das wahre Glück ins Zentrum der unsterblichen Seele.« Er nickte. »Ach, könnte man dieses Wissen doch als Noch-nicht-Sterbender bewahren und das Leben damit zu würdigen wissen, so wie ich es immer wieder aufs Neue versuche.« Er lächelte schon wieder, diesmal resigniert. »Aber eben, dieser Alltag, dieser kleine, unscheinbare, hinterhältige Dieb, ist schon ein Schlingel …«
Erst nach dem Verklingen dieser Worte richtete der schwarz gekleidete Mann sich zur Gänze auf, beinahe unschlüssig, als falle es ihm schwer, sich von der Frau zu lösen, machte einige Schritte rückwärts ins Dunkel, versank langsam darin wie in einer schwarzen öligen Flüssigkeit. Einzig sein Gesicht hob sich hell daraus ab, als schwebte es körperlos in der Nacht. Dabei ließ er die Frau vor sich aber keinen Augenblick aus den Augen, betrachtete deren Gesicht, das gespenstisch im schwachen Licht der beiden alten Petroleumlaternen lag. Diese standen links und rechts von ihr auf dem Boden und beschienen die Szene, die wirkte wie ein verstörendes Kunstwerk im nächtlichen Wald, während der Wind den Wald wiederholt zum Tosen brachte.
Sein Augenpaar verharrte auf seinem Werk. Ein Abbild des komponierten Grauens bot sich ihm. Zufriedenheit zeigte sich in seinem Blick, denn es war wirklich so gut geworden wie erhofft, nein, sogar noch einen Tick besser.
Kaum zu glauben, dachte er; erst vor einer halben Stunde hatte er der jungen Frau, der weiterhin seine Blicke galten, in einer bedrohlichen Unaufgeregtheit eröffnet, dass sie jetzt erst leiden, dann sterben werde; dass sie in diesen Momenten zwar Angst vor dem Tod verspüren werde, was ja nur mehr als verständlich sei, aber dass er ihr versprechen könne, dass es nicht lange dauern würde, bis sie diesen sogar herbeiflehen werde. Denn sterben, das hatte er gekonnt pointiert zu ihr gesagt, sei immer schlimmer als der Tod an sich. Gestorben werde auf so viele Arten, und die meisten davon seien gewiss nicht schön. Doch der Tod an sich trage keinerlei Schuld.
Er hatte ihr dies höflich gesagt, vor einer halben Stunde, im Fürstenwald oberhalb von Chur, der sich hinter der Frau wie ein Heer aus dunklen Baumgestalten die sanft ansteigende Bergflanke hochzog. Die beiden Petroleumlaternen hatte er zuvor bedächtig angezündet und in ruhigen Bewegungen beidseitig neben sie gestellt. So ein Moment erfordere die dafür notwendige Aufmerksamkeit und den nötigen Stil, meinte er zu ihr. Die Schwefelzündhölzer hatte er danach vor ihren Augen ausgeschüttelt, als löschte er damit zwei kleine Leben aus.
Sie saß währenddessen auf einer tagsüber beliebten Parkbank, panisch und verwirrt starrte sie ihn mit großen Augen an. Zwischen zwei Baumstämmen und dem fast blätterlosen Gesträuch hindurch konnte sie in der Düsternis die Grabfelder des Friedhofs einige Meter weiter unten erahnen, der unmittelbar an den Waldrand angrenzte und an dessen äußerstem rechten Rand sie sich befand – somit weit weg vom geschlossenen Haupteingangstor. Die vielen tiefdunkelroten Totenlämpchen, die anlässlich Allerheiligen die Gräber zierten, erschienen ihr wie regungslose Glühwürmchen. Schräg zu ihrer Linken funkelten in der Senke die Lichter der südwestlichen Quartiere der Stadt Chur mit ihren Hochhäusern, und dahinter im Süden lag Domat/Ems, dort, wo sich die Berge der Surselva erhoben. Doch der lang gezogene quadratische Bau der Abdankungskapelle, der in etwa 70 Metern Entfernung schräg links von ihr den Friedhof prägte, verwehrte ihr den Blick auf weitere Teile der Stadt.
Das Tosen des Südwindes in dieser mondlosen Herbstnacht war für sie erdrückend. Einzig nach ihrem markerschütternden Schrei herrschte für einen Moment Totenstille im Wald, als hätte sie für einen Moment die ganze Welt zum Schweigen gebracht. Doch das Böse selbst schwieg nicht. Sie saß noch immer auf der Parkbank, ihr angespanntes Atmen war auch während der nächsten Böe gut zu hören.
Sitzen war etwas zu viel gesagt, obwohl sie mit dem schlanken Oberkörper kerzengerade auf der Parkbank saß, wie eine auf ihre Haltung bedachte Person. Auch ihren Kopf hielt sie dabei steif gerade, als müsste sie etwas darauf balancieren. Aber dies war nicht ihre selbst gewählte Sitzhaltung: An die Lehne der Holzbank waren zwei Kanthölzer angeschraubt worden, sodass sie als erhöhte Lehne für ihren Kopf fungierten. Mittels Spannsets war sie nahezu bewegungslos an diese und die Parkbank fixiert worden, und dies noch bevor sich ihr erster Schrecken in Grauen verwandelt hatte.
Jemand hatte ihr davor ein feuchtes Tuch an Mund und Nase gehalten, das süßlich gerochen hatte. Erst als irgendwann später ihr Denken wieder etwas aufklarte und der Mann mit ihr sprach, erkannte sie ihre Lage; sie wurde soeben zum Opfer einer ungeheuerlichen Intrige! Die Polizei würde niemals dahinterkommen, denn wie sollte sie auch, ohne das zu wissen, was sie nun wusste, aber wie zum Hohn mit in den Tod nehmen musste. Tote sprechen nicht, und der Friedhof vor ihren Augen war der einzige Zeuge!
Eine halbe Stunde war seither vergangen, und ihre Augen standen nach seinem Kuss auf ihre Stirn wieder weit offen, als hätte sie diese mit ihrem versammelten Überlebenswillen ein allerletztes Mal aufgerissen. In diesem Starren lag ihr innigster Wunsch, diesem Grauen zu entfliehen, ihren Geist loszulösen, um durch die lichten Baumreihen vor ihr davonzuschweben; über die dunklen Gräber mit den roten Lichtern hinweg, vom Wind getragen über das Tal. Dann wäre sie keine Gefangene mehr in ihrem Körper, der vergebens um Sauerstoff rang, weil er noch nicht akzeptieren konnte, wie zwecklos die Lage war. Doch sie wusste, sie würde dem Grauen nur entfliehen können, indem sie starb. Der Mann hatte schon recht, wenn er behauptete, mit der Unverrückbarkeit des nahen Todes vor Augen würde dieser leichter werden.
Die Schminke der jungen Frau war in übertriebener Weise verschmiert, wie bei einem weinenden Clown. Der knallrote Lippenstift war tölpelhaft über die vollen Lippen geschmiert worden. Das blonde Haar sah aus, als hätte ein Blinder es erst geschnitten und danach im Drogenrausch frisiert. Sie trug Jeans und eine weite Bluse mit Schulterpolstern, die in den achtziger Jahren in Mode gewesen war. Der rote Spanngurt, der über ihrer Stirn festgezurrt ihren Kopf an die Kanthölzer fixierte, sah aus wie ein Stirnband, das man damals beim Aerobic trug. Als sie ihre letzten Atemzüge nahm, setzte der Mann ihr einen Walkman auf. Er drückte Play, und die Rädchen der Kassette begannen sich zu drehen.
Doch da war noch etwas anderes an ihr, oder besser gesagt in ihr. Etwas Wertvolles steckte in ihrem Mund, und das war nicht gut für sie, ganz und gar nicht gut!
2
Nur Stunden davor … 17:45 Uhr
»Sabrina, ich glaube, der Kerl hinter uns verfolgt uns tatsächlich. Ich bilde mir das nicht ein«, wiederholte Lora angespannt, nachdem sie nochmals einen Blick über ihre linke Schulter geworfen hatte und dabei kurz aus ihrem Laufrhythmus gefallen war.
»Kein Wunder! Wenn ich dieser Mann wäre, ich würde haargenau dasselbe tun. Ich meine, wir beide haben ja leider nie das Glück, unseren eigenen Hintern nachzurennen, aber der guten Figur. Oder glaubst du, ich trage dieses Outfit für Blinde?« Sabrina behielt das lockere Tempo bei, das der Kondition und zeitgleich der Fettverbrennung dienen sollte, die sie anstrebte. »Aber wenn du noch öfter zurückblickst, kriegst du garantiert wieder dein Seitenstechen, und dann«, sie senkte die Stimme übertrieben und verlieh ihr einen bedrohlichen Ton, als erzähle sie einem Kind ein Schauermärchen, »ja, dann wird er dich holen kommen! Uaaaa!« Sie lachte hell, und ihre glasklaren blauen Augen glänzten.
Die herbstlich gefärbten Bäume im Fürstenwald oberhalb von Chur saugten sich weiter mit der hereinbrechenden Dämmerung dieses Herbstabends voll, während die beiden jungen Frauen weiterliefen. Das Rauschen des Windes in den Wipfeln über ihnen steigerte sich im böigen Aufbäumen des Südwindes, Blätter tanzten zu Boden.
Sie waren heute ausnahmsweise später dran als sonst. Das Leuchten des Blätterwerkes war daher längst aus dem Wald verschwunden, wie die letzten Gäste eines zuvor rauschenden Festes. Bis auf den Mann, der nun hinter ihnen lief, waren sie seit einer Viertelstunde niemandem mehr begegnet. Vor etwas mehr als einer Dreiviertelstunde hatten sie kurz nach dem Loslaufen das Geläut der Abdankungskapelle gehört, das war um Punkt 17 Uhr gewesen, kurz bevor die Totenmesse gelesen wurde. Daher hatte es vor dem Friedhof von Menschen nur so gewimmelt, und die wenigen Parkplätze waren alle längst voll gewesen, als sie um kurz vor 17 Uhr mit dem Auto ankamen. Deshalb hatte Lora genervt ihren Wagen an den Straßenrand gestellt, ins Parkverbot.
Sabrina wusste um Loras dünnes Nervenkostüm, wenn sie im Wald joggen gingen. Die Gute las zu viele Kriminalromane, und zu allem Übel auch noch solche, die sich in der Region abspielten. Deshalb reichte schon ein bewölkter Himmel zur Mittagszeit, um sie in Sorge zu versetzen. Lora würde daher am liebsten nur in einer Zehnergruppe laufen gehen, und das bei hellstem Sonnenschein und von einem Team von bis auf die Zähne bewaffneten Polizeigrenadieren begleitet. Sabrina hingegen lief tagsüber öfters und gern auch allein durch den Wald, und das vorwiegend mit Musik in den Ohren. Sinnigerweise aber nicht in der Dunkelheit, denn auf einem Silbertablett würde sie sich bestimmt keinem dieser Perverslinge servieren wollen, die zweifelsohne tatsächlich in dieser Welt existierten. Aber zu zweit in der Dämmerung; darin sah sie kein Problem. Deshalb hatte sie Lora heute auch überredet, ausnahmsweise später loszulaufen, sich dieser einengenden Angst zu stellen, um sich endlich davon zu befreien. Außerdem trug diese ja eine Uhr am Handgelenk, mit der sie sogar telefonieren konnte.
Noch hatten die beiden gut eineinhalb Kilometer vor sich, als Lora schon wieder damit anfing, dass der Mann noch immer 30 Meter hinter ihnen joggte. Sie stufte wirklich alle Männer, die ihr im Wald über den Weg liefen und keinen Kinderwagen neben ihrer hochschwangeren Frau schoben, als gefährlich ein.
»Lora, der wird genauso wie wir beide auf dem Rückweg zum Waldhausstall sein, weil dort die Parkplätze sind; Velos, Autos, Bushaltestelle. Fliegen kann auch der wahrscheinlich nicht. Also mach dir nicht ins Höschen«, hielt Sabrina dagegen und warf dennoch einen Blick zurück. Sie fand rein gar nichts Verdächtiges an dem Kerl. Ein Jogger halt, und er schien in der Dämmerung und auf den ersten Blick ganz okay auszusehen. Mitte 30 vielleicht, dunkelhaarig, sportlich und groß. Die Gesichtszüge waren aber nicht erkennbar, es war bereits zu dunkel.
»Wir hätten doch besser nicht so spät noch loslaufen sollen. Das war ein Fehler. Es ist ja beinahe so dunkel wie in der Nacht«, beklagte sich Lora bereits zum dritten Mal, als würde das etwas an der Situation ändern, und versuchte angestrengt, weiter den Rhythmus zu halten. Doch keine zwei Minuten später drehte sie sich wieder um und sagte: »Hey, Sabrina, was ist denn mit dem jetzt los?«
»Was ist denn?«
»Er ist weg! Einfach verschwunden!«, sagte sie aufgeregt und wäre beinahe gestolpert.
»Oh mein Gott, Lora! Der arme Kerl kann es dir aber auch nicht recht machen. Ist er hinter uns, passt es dir nicht, ist er weg, ebenfalls nicht.«
»Es gab ja keine Weggabelung in der Zwischenzeit. Wir beide kennen die Wege hier ja in- und auswendig. Also?«
»Na und? Vielleicht hat ihn dein ständiges Zurückblicken zum Nachdenken gebracht und er ist ein Gentleman; geht extra wegen dir ein bisschen langsamer, um dich nicht noch mehr zu verunsichern.« Sie lachte. »Und was passiert? Das Gegenteil! Aber ja, vielleicht macht er auch kurz ein paar Dehnübungen, was weiß ich«, sagte sie und erschrak, kaum hatte sie das letzte Wort ausgesprochen, denn ein Mann stand nur knappe 20 Meter vor ihnen hälftig hinter einem Gebüsch und duckte sich reflexartig, als sie ihn erblickten. Sabrina stoppte so abrupt, als hätte sich ein Loch im Boden vor ihr aufgetan. »Okay, das finde ich nun ausnahmsweise auch spooky«, sagte sie, blickte angestrengt zurück, dann nach vorne. »Kann dir nicht sagen, ob es tatsächlich der Kerl ist, der eben noch hinter uns lief. Mir scheint, der hier sah aber älter aus, ziemlich älter sogar. Aber ich habe ihn ja kaum gesehen.«
Lora zuckte hilflos mit den Schultern. Ihre Gesichtszüge waren wie versteinert, sie atmete oberflächlich und zu schnell, blickte sich dauernd um.
»Anyway, an dem will sogar ich nicht vorbei.« Sabrina blickte in alle Richtungen und horchte. Außer dem Rauschen des Windes über ihnen war es still. Sie sagte Lora natürlich nicht, dass sie langsam befürchtete, dass sie beide möglicherweise von zwei Männern in die Zange genommen worden waren, die sie vielleicht beim Waldhausstall loslaufen gesehen und ihnen nun aufgelauert hatten. Stattdessen sagte sie mit gespielt selbstsicherer Stimme: »Komm, Lora, lass uns hier mitten durch den Wald laufen, dann kommen wir auf den unteren Weg, der nachher am Friedhof vorbei ebenfalls zum Waldhausstall führt, ja? Heute Abend hat es ja um diese Zeit massenhaft Leute dort, die nach der Messe zu den Gräbern gehen, um die Lichter anzuzünden. Nicht umsonst haben wir keinen Parkplatz mehr gefunden.«
Das wusste Sabrina genau, denn seit drei Jahren zündete auch sie zu Allerheiligen eine Kerze an, eine Kerze der Erinnerung und der Mahnung. Auch wenn das nicht viele verstanden; sie fand den Anblick der vielen Grabkerzen zusammen mit den Lichtern der Stadt in der Senke dahinter kraftvoll. Der Friedhof Fürstenwald war für sie deshalb ein schöner Platz geworden, und sie wollte irgendwann mal selbst dort beerdigt werden. Doch daran dachte sie jetzt nicht. Sie zog die total verängstigte und erstarrte Lora am Arm. »Komm jetzt, wir müssen los!«
Noch war in diesem Herbst kaum was vom Blattwerk gefallen. Ein milder und ruhiger September und warmer Oktober lagen hinter ihnen. Doch nun tanzten und wirbelten die Blätter im böigen Südwind zu Boden. Das Knacken von trockenem Unterholz ertönte im düsteren Wald, während die beiden sich zwischen Baumstämmen und Gesträuch durchschlugen. Dabei hörten sie plötzlich, dass ihnen jemand folgte. Wer immer dies auch war, er schien es nicht verbergen zu wollen, zu ungestüm hörte sich sein Laufen an.
»Verdammt, lauf schneller«, stieß Sabrina aus, da Lora sich immer wieder umblickte, aber den Verfolger dennoch nicht ausmachen konnte. »Schau nur nach vorne. Dann sind wir schneller. Bald haben wir’s ja«, versuchte sie Lora und sich selbst zu beruhigen.
»Aber er kommt!«, schrie Lora grell auf und strauchelte in der Dunkelheit, raffte sich wieder auf und hetzte Sabrina hinterher, während der Verfolger sich hinter ihnen durchs Dickicht pflügte.
Die Angst fuhr nun beiden heiß und schwer in die Glieder. Loras Aufkreischen erfüllte den Wald, während sie hinter Sabrina endlich und völlig außer Atem den breiten Waldweg erreichte, auf dem an den sonnigen Wochenenden unzählige Spaziergänger ihre Ruhe und Entspannung suchten.
»Lora, nur noch etwa 300 Meter, los!«, keuchte Sabrina, denn ihre Freundin schien zunehmend lahm vor Angst zu werden. »Komm, das schaffen wir!«
Sie waren aber noch keine 30 Meter weit auf dem Waldweg gekommen, als hinter ihnen eine dunkle Gestalt wie ein wildes Tier aus dem Dickicht brach.
In diesem Moment ertönte das Geläut der Abdankungskapelle, es war 18 Uhr. Der Südwind trug es zu den Flüchtenden, suggerierte dabei, dass der Friedhof näher sei, als es in Wirklichkeit der Fall war.
»Beim Friedhof hat es viele Leute.« Sabrina rang um Atem. »Los!«
Lora taumelte, als wäre sie angeschossen worden, und blieb stehen. Die Art, wie sie es tat, zeigte Sabrina, dass ihre Freundin am Ende war. Dann schrie Lora plötzlich wie am Spieß auf, ihre Arme hielt sie dabei seitlich schräg nach hinten durchgestreckt und den Kopf nach vorne gebeugt, wie Wettkampfschwimmer auf dem Startblock, bevor sie wieder um Luft rang. Obwohl auch Sabrina längst in Panik geraten war, registrierte sie dennoch für einen Moment den Gedanken, dass sie niemals gedacht hätte, dass ein Mensch derart laut schreien könnte. Doch Lora schien nun wie von Sinnen und schrie erneut, erfüllte den Wald damit, als stünde hinter jedem Baum versteckt eine Lora und allesamt schrien sie gemeinsam nun zu Tausenden, sodass sie sogar das Tosen des Windes übertönten.
Sabrina blieb wenige Meter von Lora entfernt stehen und drehte um, lief auf sie zu, um sie aus der Starre zu befreien. Sie wusste, sie hatten die entscheidenden Sekunden bereits verloren, um es wenigstens zum äußersten Rand des Friedhofs zu schaffen, und sie hatten nichts, womit sie sich hätten verteidigen können. Also begann auch sie, um Hilfe zu schreien, als einzige Waffe, um den Täter abzuschrecken, und in der Hoffnung, dass man es bis zum Friedhof hören konnte.
Nach zwei lang gezogenen, gellenden Schreien tauchten überraschenderweise Lichter von Lampen in der Düsternis auf dem Weg Richtung Waldhausstall auf.
»Hilfe!«, schrie Lora nun wie aus der Starre befreit, als sie die Lichter erkannte. Für sie war es, als hätte jemand in einem pechschwarzen Raum eine Tür geöffnet, hinter der die Sonne schien. Zuvor war sie auf die Knie gesunken, doch nun raffte sie sich auf und strauchelte auf die Lichter zu, ehe sie immer schneller darauf zulief.
Sabrina blieb ihr dicht auf den Fersen, mit der scheußlichen Angst im Nacken, dass der Verfolger sie doch noch jeden Moment packen könnte.
Während die beiden Freundinnen sich weiter den Lichtern näherten, hörten sie eine tiefe und kräftige Männerstimme aus der Richtung rufen: »Wir sind gleich bei euch!«
Sie versuchten noch schneller zu laufen, als sich der Friedhof seitlich rechts am Waldrand entlang in die Länge streckte.
Lora schrie kurz auf und sank dann zu Boden, kniete sich hin, während grelles Licht sie einfing. Mit verzerrten Gesichtszügen starrte sie hoch ins Licht. Nur wenige Schritte hinter ihr stolperte nun Sabrina heran, der ebenfalls die Luft ausging. Auch sie ging auf alle viere und keuchte.
Die grellen Stirnlampen gehörten zu drei Joggern; zwei Männer und eine Frau. Die tiefe Männerstimme, die zuvor gerufen hatte, fragte besorgt: »Was ist passiert?«
»Wir wurden verfolgt … ein Mann … hinter uns …« Lora bekam die Worte kaum aus dem Mund. »Er will uns was tun.« Dann sank sie seitlich zu Boden und rang nach Luft.
Die Frau in der Gruppe nahm geistesgegenwärtig sofort ihr Handy, das sie am Oberarm umgeschnallt trug, und wählte den Notruf, während der kräftigere der beiden Männer sich beschützend aufbaute. »Jetzt passiert euch beiden nichts mehr! Ich bin Kampfsportler.« Er beleuchtete den verlassenen Weg vor sich, auf dem die Frauen gekommen waren.
Sabrina blickte, dem Lichtkegel des Mannes folgend, ins Dunkle hinter ihr und atmete noch immer schwer. »Jetzt ist er natürlich weg! Aber … das war echt verdammt knapp!«
»Sollen wir nachschauen gehen?«
»Nein, bitte, bleibt alle hier!«, bat Lora verängstigt und richtete sich langsam auf. »Bitte, könnt ihr uns nicht einfach zu meinem Wagen begleiten? Ich muss hier weg. Jetzt!«
»Selbstverständlich«, sagte der kräftig gebaute Mann, der etwa 30 Jahre alt war und einen breiten Kiefer hatte wie ein Türsteher, aber eine freundliche Stimme. »Ihr beide kommt am besten in unsere Mitte.«
In diesem Moment hörten sie jemanden vom Friedhof aus seitlich zu ihnen hochrufen: »Braucht ihr noch Hilfe? Das hintere Tor ist verschlossen. Wir können aber über das Haupttor raus.«
»Alles im Griff. Wir bringen die Frauen jetzt aus dem Wald«, antwortete erneut der kräftigere der beiden Männer.
»Die Polizei ist bereits unterwegs«, rief die Frau mit heller Stimme hinterher.
Auf dem Weg zum Parkplatz eilte ihnen eine Schar von Friedhofsbesuchern entgegen, die, von den Schreien aufgeschreckt, nach dem Rechten schauen wollten. Daraus löste sich eine Gruppe von fünf Männern, die mit den Lichtern ihrer Handys tiefer in den Wald vordrangen, den die drei Helfer mit den beiden Frauen in dem Moment verließen.
Sogar der Pfarrer, der vor zehn Minuten in der Abdankungskapelle noch Folgendes gesagt und dabei den Österreicher Henning Klingen zitiert hatte: »Allerheiligen und Allerseelen führt nicht in erster Linie den eigenen Tod vor Augen, sondern es führt an den äußersten Punkt der Verzweiflung, den Tod des Anderen, vor dessen Grab man sich einfindet«, war aus dem Friedhof geeilt und sah soeben die Geflüchteten aus dem Wald kommen. Deren Blicke sprachen Bände.
Für Sabrina war es, als hätten sie nun eine neue Welt betreten. Keine fünf Minuten Fußweg trennten sie von dem völligen Ausgeliefertsein im dunklen Wald und den hier überfüllten Parkplätzen, die sich vor dem alten großen Stall der Straße entlang in die Länge zogen. Außerdem war es hier draußen weniger dunkel als im Wald, die Lichter der Stadt schimmerten matt in der Senke unter ihnen, und das Aufrauschen der Bäume hörte sich plötzlich nicht mehr so bedrohlich an. Es roch nach Herbst, nach Abend. Die weitläufigen Felder der angrenzenden Prasserie ruhten, eines war frisch umgepflügt, die Scholle lag grob gebrochen da, der Geruch nach Erde lag darüber. Im spärlich beleuchteten roten Bushäuschen, neben dem ein Brunnen laut plätscherte, scharten sich die Leute, als in dem Moment der innen hell beleuchtete Stadtbus angefahren kam und nach einem pneumatischen Zischen die Fahrgäste verschluckte.
Lora hatte ihren blauen VW-Golf am Straßenrand abgestellt. Ein Bußenzettel klemmte unter einem der Scheibenwischer. Sie lehnte sich noch immer aufgewühlt an das Heck, beruhigte sich aber allmählich, als die Streife der Kantonspolizei mit Blaulicht angebraust kam.
Ein Mann und eine Frau stiegen aus dem Einsatzfahrzeug. »Sie haben uns alarmiert?«, fragte der männliche Beamte. Der blaue Lichtschweif legte sich über die Szenerie und auf die Tannen am nahen Waldrand.
Sabrina kam sich plötzlich blöd vor. Der erste Verfolger, wenn er denn wirklich einer war, hatte ihnen ja nicht gedroht, ja, nicht mal etwas gesagt. Er war schlicht und einfach hinter ihnen hergelaufen, und das im Abstand von ungefähr 30 Metern, und war dann verschwunden. Und was den zweiten Mann betraf, wer immer dies auch sein mochte, der nahm vielleicht, warum auch immer, bloß dieselbe Abkürzung durch den Wald. Aber auch er hatte weder gedroht noch sie gar gepackt. Vielleicht hatte Lora sie mit ihrer Angst nur angesteckt. Oder war da doch eine Bedrohung gewesen? Keine nur gefühlte, sondern eine echte? Sie konnte es nicht mehr sagen.
Sie erklärte sich den beiden Beamten. Bereits am Blick der Beamtin erkannte sie dabei, dass zumindest die sich fragte, ob Lora und sie sich in der Dunkelheit nicht bloß in etwas reingesteigert hatten. Die Beamtin gab, nachdem sie sich alles angehört hatte, deshalb zu bedenken, dass der Mann, der ihnen durch den Wald gefolgt war, vielleicht geflüchtet sei, weil ihre Schreie ihn zwangsläufig zu einem Verfolger gemacht hätten. Wie hätte er sich denn auch erklären sollen, falls er tatsächlich unschuldig war?
»Aber er verschwand ja, kaum waren wir in der Nähe der Gruppe, das muss doch auch etwas heißen, oder?«, versuchte Sabrina an Boden zu gewinnen. Doch plötzlich kam ihr eine plausible Erklärung in den Sinn, die sie beide zudem nicht als hysterische Frauen dastehen ließ. »Vielleicht war alles ein saublöder Halloween-Scherz, wenn auch einen Tag verspätet? Das würde doch alles erklären, oder?«
»Das wäre sehr gut möglich«, sagte die Beamtin. »Wäre aber wirklich mehr als nur geschmacklos.«
Die explizite Nachfrage, ob sie den zweiten Mann überhaupt hinter sich gesehen hatten, mussten Lora und Sabrina verneinen. Sie waren sich aber sicher, ihn hinter sich gehört zu haben. Eine genauere Beschreibung hatten sie somit nur von dem ersten Mann. Doch da wichen ihre Beobachtungen voneinander ab: mittelgroß oder groß, braun- oder schwarzhaarig, sportlich, eher gut aussehend. Möglicherweise trug er einen Dreitagebart.
Während sie Auskunft erteilten, wuchs die Traube der Neugierigen weiter an. Die Polizei ließ das zu, denn sie wollte danach noch Zeugen finden, die rund um den Vorfall möglicherweise Beobachtungen gemacht hatten.
»Okay, wir haben Ihre Aussagen. Und wir haben nun auch Ihre Personalien«, sagte die Beamtin mit klarer Stimme. »Wir beide werden uns hier noch etwas umsehen, den einen oder anderen zum Fall befragen, denn es hat wegen Allerheiligen ja allerhand Leute hier. Und Sie beide steigen nun am besten gemeinsam ins Auto und fahren nach Hause. Wir, die Polizei, werden uns melden, falls eine weitere Befragung nötig sein sollte oder sich Hinweise zu dem Fall verdichten sollten. Einverstanden?«
Sabrina nickte. Lora sagte etwas kleinlaut: »Danke schön.« Sie war noch immer blass vom Schrecken. Sie reichte Sabrina den Autoschlüssel, damit die sich hinters Steuer setzte.
»Einen Moment noch«, die Beamtin klopfte an die geschlossene Fahrerscheibe und deutete auf die Parkbuße an der Frontscheibe, die sie in den Wagen reichte, »fahren Sie vorsichtig und am besten auf direktem Weg nach Hause.«
Sabrina nickte. »Das werden wir. Für heute sind wir beide bedient.« Sie blickte zu Lora auf dem Beifahrersitz, die es sichtlich kaum erwarten konnte, endlich hier wegzukommen.
»Gut, und wie gesagt, wir melden uns, sobald wir Neuigkeiten haben.«
3
Samstagmorgen, 2. November 2024,
Allerseelen
Luzia Berger war längst pensioniert, aber sie stand nochimmer zeitig in der Früh auf, so wie schon in all den Jahrzehnten davor. Und wie immer machte sie auch an diesem Samstagmorgen in aller Herrgottsfrühe einen Spaziergang im Fürstenwald, und das, ebenfalls wie immer, mit ihrem kleinen Hund Melchior, der etwa so schlecht zu Fuß war wie sie selbst. Somit gaben die beiden ein passendes sechsbeiniges Gespann ab. Auch wenn beide schlecht zu Fuß waren, gemeinsam schafften sie es immerhin, mit kurzen Unterbrüchen 40 Minuten lang zu gehen. Weit kamen sie in dieser Zeit zwar nicht, aber es reichte, um sich danach jeweils auf die eine Parkbank im Fürstenwald zu setzen und mit Blick durch die lichte Baumreihe am Waldrand dem Erwachen des Morgens beizuwohnen. Sie und ihr Hündlein schauten dabei immer auch zum Grabfeld, wo ihr Mann Alfred lag. Luzia war sich sicher, dass auch Melchior wusste, dass dort sein Herrchen lag, das ihn mehr als alles andere auf der Welt vergöttert hatte. Sie aber dachte beim Anblick des Grabs: Gut, habe ich den sturen Saubock überlebt! Sie genoss jedes Mal ihren Triumph, denn Alfred hatte vor drei Jahren endlich das Zeitliche gesegnet, und das auf eine saublöde und kuriose Art und Weise, fand sie schadenfroh. Aber die Wege, die zur Himmelspforte führten, waren weiß Gott so vielfältig wie die Menschen einfältig. Das hatte vor vielen Jahren mal dieser schöne Herr Pfarrer gesagt, damals, als sie noch jeden Sonntag auch nach der Predigt an seinen Lippen hing, und das im wortwörtlichen Sinne.
Es war ein verhängnisvoller Frühlingsabend gewesen, als Alfred zu Tode kam. Nach dem Zubettgehen las er nochmals die Tageszeitung, als hätte er das erst am Morgen Gelesene über den Tag schon wieder vergessen, was zum großen Teil ja auch stimmte, und legte diese erst zur Seite, nachdem er auch die letzte Seite durchhatte. Im Nachhinein zeigte sich: Es war sogar die allerletzte Seite gewesen, die er in seinem Leben gelesen hatte.
Danach löschte er die alte Nachttischlampe, bevor es ihm in den Sinn kam, doch noch kurz auf Toilette zu gehen. Ein Männerleiden zwang ihn häufiger dazu. Er fand das hängende Kabel der Nachttischlampe mit dem Schalter nicht auf Anhieb und versuchte daher, Licht bei der Tür zu machen, denn es war stockdunkel im Zimmer, da die Fensterläden wie immer geschlossen waren. Luzia hatte nämlich schreckliche Angst vor Einbrechern. Dennoch zog die Sendung Aktenzeichen XY … Ungelöst sie magisch an; die alte Decke auf dem noch älteren Sofa zog sie dabei bis unters Kinn, sodass ihre wenigen struppigen Barthaare sie kitzelten. Alfred tapste an jenem Abend unsicher im Dunkeln umher, als es plötzlich grauenhaft zu stinken begann.
Er wird mir ja wohl nicht schon wieder in die Pyjamahose geschissen haben?, fürchtete Luzia. Die Glühbirne ihrer Nachttischlampe war seit ein paar Tagen kaputt, sie selbst konnte daher kein Licht machen, aber sie sagte mit bestimmtem Tonfall: »Alfred? Mach jetzt Licht, und geh auf direktem Weg aufs WC.«
»Würde ich ja, wenn ich diesen verflixten Schalter finden könnte …« In dem Moment stolperte er. Zeitgleich ertönte ein kurzes Aufjaulen, und Luzia hörte, wie Alfred hart gegen das kantige Nachttischchen stieß.
»Herrjemine, Alfred, was machst du auch für einen Riesenkrach?« Luzia setzte sich erschrocken auf. »Alfred?«
Doch ihr Mann gab keine Antwort. Nur ein Röcheln ertönte. Luzia schlug die Decke zurück und stieg aus dem Bett. Die Arme vor sich ausgestreckt, suchte sie einer Nachtwandlerin gleich nach der Tür, als sie in etwas Warmes, Weiches trat. Oh nein, auch das noch, der gute Teppich. Das stinkende Malheur musste Alfred diesmal wohl oder besser gesagt übel aus der schlabbrig sitzenden Pyjamahose gerutscht sein. Pfui, wie eklig, dachte sie.
Als Luzia endlich den Lichtschalter neben der Tür ertastete und den alten Lampenschirm zum Leben erweckte, sah sie Alfred regungslos bäuchlings auf dem Boden liegen. Dabei entdeckte sie auch den Rauhaardackel Melchior, der unter dem Bett schuldbewusst hervorlugte, und dies nicht nur, weil Alfred im Dunkeln über ihn gestolpert war, sondern auch, weil er es gewesen war, der den stinkenden Haufen auf dem Boden hinterlassen hatte, in den Luzia soeben barfuß getreten war.
Die alte Frau versuchte humpelnd, um nicht alles im Haus zu verteilen, den Telefonapparat an der Wand vor der Küche im unteren Stockwerk zu erreichen. Das war aber alles andere als einfach, denn ein Eisenträger war beweglicher als sie.
Alfred war längst tot, als die Rettungssanitäter das alte Stiegenhaus hochkamen, in dem schwer der Gestank von Hundekot, gemischt mit dem von Sauerkraut vom Abendessen, lag.
Melchior hockte neben dem noch immer auf dem Bauch liegenden Herrchen, als wüsste er ganz genau, was geschehen war. Luzia hatte Alfred in den letzten Monaten mehrmals und eindringlich zu verstehen gegeben, dass Melchior mal einen gehörigen Sparz brauche, denn nur mit einem kräftigen Tritt in den Hundehintern würde das Tier endlich begreifen, dass es ihnen beiden rechtzeitig aus dem Weg gehen musste. Das brachte der überaus sture Alfred aber nicht übers Herz. Lieber ließ er das Tier weiter den Herrn im Hause spielen. Das hatte er jetzt davon.
Alfred hatte das Tier dessen Leben lang nach Strich und Faden verwöhnt und derart überfüttert, dass der Dackel zeitweise so dick war, dass er den gewölbten Ranzen am Boden nachgezogen hatte.
Diese Zeiten waren für Luzia Berger nun seit drei Jahren vorbei, zum Glück, wie sie fand. Mittlerweile ging Melchior ihr artig aus dem Weg. Dafür waren aber drei Tritte nötig gewesen. Sie war sich im Nachhinein sicher, hätte sie den dritten Tritt dem Hund zuerst verpasst, hätte es nur diesen einen gebraucht. Aber offen gesagt, hatten ihr alle drei Genugtuung verschafft, wenn auch nur für eine Weile.
Jetzt war Melchior gefügig. Doch der letzte Tritt war auch dafür verantwortlich, dass der Vierbeiner nun genauso schlecht zu Fuß war wie sie. Nur schade, dass Alfred das nicht mehr miterlebte, fand Luzia hin und wieder, denn Schadenfreude war am schönsten, wenn man sie mit demjenigen teilen konnte, den sie betraf. Nach diesem letzten Tritt hatten sich der Hund und sie irgendwann zwangsweise aneinander gewöhnen müssen: Hinken und hinken lassen war nun ihre Devise, denn viel Zeit hatten sie beide sowieso nicht mehr auf dieser Welt, davon war Luzia überzeugt.
An diesem Samstagmorgen von Allerseelen erwachte Luzia, als es noch stockdunkel war. Sie brühte sich einen Kaffee in der kleinen Küche und aß ein wenig Brot und Käse. Es war ein zu weicher Käse, sodass ihr Gebiss mehrmals daran kleben blieb, aber er war würzig und gut. Nachdem sie ihre dritten Zähne mit etwas Spülmittel am Schüttstein gewaschen hatte, trat sie in den kleinen Vorgarten des Hauses. Noch immer war es dunkel. An die Zeitumstellung von vor einer Woche hatte sie sich noch nicht gewöhnt, da war es erst später hell geworden.
Es war ihr mehr als recht, in aller Herrgottsfrühe allein im Fürstenwald unterwegs zu sein, denn diese Radfahrer waren elende Rüpel, allesamt! Dieses Saupack raste nicht selten so rücksichtslos an ihr vorüber, dass sie befürchtete, es reiße ihr vom Luftzug gleich die Dritten raus. Jedem Einzelnen hätte sie gerne einen so gehörigen Sparz, und das mit voller Inbrunst, in den Hintern gegeben wie damals dem Melchior. Immerhin, dem einen Rüpel hatte sie mal Schimpfwörter hinterhergerufen, bevor er weg war. Doch der hatte nichts Besseres zu tun gehabt, als sich während der Fahrt kurz umzudrehen, ihr den Stinkefinger zu zeigen und dreist zu rufen: »Wo und wann hat man dich denn ausgegraben? Oder haben die auf dem Friedhof neuerdings Tag der offenen Tür?«
Doch als er wieder nach vorne blickte, überschlug es ihn wegen eines Steins und er fiel kopfüber zu Boden. Wie ein Häufchen Elend hatte er dagesessen, als sie ihn eingeholt hatte, und sich dabei an die obere Zahnreihe gegriffen, wo ein Loch klaffte. Sie hatte sich neben ihn gestellt, mit dem Gehstock auf ihn gezeigt und schadenfroh gesagt: »Die einen haben nicht mehr alle Tassen im Schrank und die anderen nicht mehr alle Zähne im Mund, wie ich sehe.«
Luzia war sich sicher: Die Welt war voll von schlechten Menschen. Dennoch, der Gedanke, dass ihr eines Tages auf dem frühmorgendlichen Weg im Fürstenwald ein Unhold in der Dunkelheit auflauern könnte, wie es ihre Schwester, Vreni Baumann, der die andere Hälfte des Doppelhauses gehörte, ja beinahe mahnend heraufzubeschwören versuchte, brachte sie nur zu einem müden Lächeln. Das böse Weib war doch nur neidisch, weil sie mittlerweile so gekrümmt im Garten über die Beete gebeugt jäten musste, als wäre sie mit ihrem knorrigen Birnenbaum verwandt. Einzig vor Einbrechern hatte Luzia höllisch Angst. Deshalb schloss sie, noch bevor es dunkel wurde, immer alle Fensterläden und kontrollierte die Türen sorgfältig, und dann noch mal, bevor sie ins Bett ging.
Aber Angst vor einem Unhold im Wald? Was um Himmels willen hätte so ein Lüstling mit ihr auch anstellen wollen? Sex in ihrem Alter empfand sie als Sterbehilfe. Das hatte sie auch Alfred gesagt, als er vor fünf Jahren diese blaue Pille geschluckt hatte und mit beängstigend ausgebeulter Pyjamahose neben ihr Bett getreten war. Seine Äuglein hatten dabei bedrohlich geglänzt, und sein Kopf war zündrot gewesen, bestimmt von der Pille. Doch sie hatte Alfred durch einen einfachen Trick von sich abhalten können. Einen Trick, den ihre Mutter ihr früh beigebracht hatte und der in ihrem Leben immer funktionierte, wenn es brenzlig wurde; sie hatte angefangen, lauthals zu lachen. Ein echtes Auslachen war es gewesen, und das war nicht mal schwer gewesen, denn sein Anblick hatte sie mehr als nur dazu angespornt. Schnell wurde ihm die Beule in der Hose sichtlich peinlich, und er verzog sich wortlos ins Wohnzimmer, wo er die Nachrichten einschaltete. Zwei Stunden hatte sie ihn leise jammern gehört, weil ihm die Pfeife wehtat, bis er sich beruhigt hatte. Er hätte bloß auf sie hören sollen, denn ihr hatte die Zweisamkeit mit ihm mehr als genügt, und sie wollte auch nicht riskieren, dass sie sich übermütig noch irgendwas ausrenkte.
Luzia war außerdem abergläubisch. Seit Alfreds Tod las sie keine Zeitung mehr, erst recht nicht die letzte Seite, und deswegen auch keine Todesanzeigen. Aus diesem Grund verpasste sie die meisten Beerdigungen, was ihr ihre Schwester immer mal wieder über den Gartenzaun hinweg vorwurfsvoll vorhielt. Die hatte doch noch immer und überall ihre krumme Nase drin stecken, und das, obwohl sie nur selten einen Schritt aus dem Garten ging. Dafür hockte sie den lieben langen Tag im Haus am Telefon, fand Luzia. Sie entgegnete ihrer Schwester Vreni dann und wann auf diesen Vorwurf, dass sie, Luzia, nur bei all jenen auf die Beerdigung gehe, die auch auf ihrer gewesen seien. Außerdem, wenn sie zum Grab ihres verstorbenen Alfreds ging, was nur selten der Fall war, dann sah sie immer die frischen Grabreihen durch nach ihr bekannten Namen. Bei denen, welche sie nicht gemocht hatte, blieb sie länger vor den Kreuzen stehen. Ihr Jahrgang, 1941, war immer mehr vertreten, wie sie feststellen musste. Das gab ihr zu denken, denn sie wusste, dass das letzte Hemd keine Taschen hatte.
Der Samstagmorgen erwachte erst langsam, als das hinkende Gespann um 6:10 Uhr über die Felder der nahen Prasserie ging wie das Fähnlein der letzten halb Aufrechten. Die Luft war würzig und frisch, bevor der kleine Melchior einen Haufen mitten auf den Weg machte, der sich aber sehen ließ und der sich an Ort und Stelle bestens machte, wie Luzia fand. Außerdem, falls jemand reintreten sollte, konnte der Tag für denjenigen danach nur noch besser werden, und somit war Hundekacke liegen zu lassen eine gute Tat.
Das erste Licht war noch scheu und zart, als sie eine Viertelstunde später beim Waldhausstall ankamen. Die Ziegen waren noch im großen Stall. Der Geruch und ihr Trampeln verrieten es ihr, ein Geruch, den sie mochte, der sie an ihre Kindheit erinnerte. Sie ging an den letzten gähnend leeren Parkplätzen vorbei und verschwand im morgendlichen Wald.
Auf dem gesamten Hinweg hatte sie niemanden gesehen. Nicht mal eine von diesen angefressenen Joggerinnen, die auf Irrpfaden einer besseren Figur nachrannten, obwohl ja jeder wusste, dass aus einem Nilpferd niemals eine Stute würde. Über diese Frauen konnte Luzia nur den Kopf schütteln.
Luzias Augen waren noch erstaunlich gut, dies im Gegensatz zu ihrem Gehör. Nach wenigen Minuten blieb sie auf dem Waldweg stehen, nachdem sie zuvor an einer Weggabelung vorbeigekommen war, die in vier Richtungen verzweigte. Sie blieb stehen und blickte auf die Parkbank, die 20 Meter vor ihr stand und auf die sie sich wie gewohnt setzen wollte. Doch etwas war anders als sonst, denn zwei Lichter, die auf dem Boden schwach schimmerten, hatten ihre Aufmerksamkeit geweckt. Schemenhaft erkannte sie zu ihrem Erstaunen, dass bereits eine Person auf der Bank saß, und dies zu dieser frühen Stunde. Unerhört, das war ja noch nie vorgekommen.
Vielleicht so eine dieser Yoga-Tanten mit einer Selbstfindungsstörung, dachte sie spöttisch. Das würde zu den Lichtern und dieser regungslosen Sitzhaltung passen. Wobei Letzteres auch zu einem Beamten der kantonalen Verwaltung passen würde, dachte sie ebenso spöttisch. Immerhin schien die Frau keinen Hund dabeizuhaben. Luzia ging näher, denn ihre Neugierde war größer als die Abneigung, um diese Zeit Menschen sehen zu müssen, die womöglich sogar mit ihr reden wollten. Vögel zwitscherten in einer Tanne, als würden sie Luzias Gang zu der Parkbank kommentieren. Durch den lichten Waldrand zu ihrer Linken waren Teile des Friedhofs zu erkennen.
Als Luzia sich auf wenige Schritte der Sitzenden seitlich genähert hatte, packte sie ihr freundlichstes »Grüazi wohl« aus, und das mit erstaunlich klarer Stimme, die gar nicht zu ihrer tattrigen Gestalt passte. Doch es kam keine Antwort von der Frau, die weiter nur kerzengerade nach vorne starrte. Wie unhöflich aber auch, fand die Alte. Die Lichter hatten sich mittlerweile als zwei Laternen herausgestellt, die links und rechts neben der Frau auf dem Boden standen und einen angenehmen Geruch nach Petroleum verströmten.
Während Luzia verdutzt auf die seitlichen Konturen der Frau blickte, die einen kleinen Kopfhörer trug und vielleicht deshalb keine Antwort gegeben hatte, tippelte Melchior an die Parkbank heran und benahm sich ungehörig, er pinkelte an eine der beiden Laternen auf dem Boden.
»Äxgüsi, dass er so ungezogen ist! Das tut mir leid.« Luzia starrte entgeistert ihren Dackel an. »Das hat er noch nie gemacht.« Ihr Blick signalisierte dem Hund, dass er noch was zu hören und fühlen bekäme. Doch die Frau saß weiter nur an Ort und Stelle, als ginge sie das alles rein gar nichts an. Wirklich alles andere als höflich, fand Luzia und schritt langsam seitlich vor die Frau, um ihr Gesicht sehen zu können. Dabei beschlich sie bei jedem Schritt ein seltsameres Gefühl.
»Geht’s Ihnen gut?« Sie redete etwas lauter, falls die Frau Musik hörte, und trat noch einen Schritt näher. Obwohl sich die fortschreitende Morgendämmerung im Wald nur zögerlich breitmachte, erkannte Luzia das Grauen auf den ersten Blick.
»Um Himmelherrgotts willen, das ist doch das Gesicht …«, würgte sie heraus.
Eine knappe halbe Stunde später, kurz nach 7 Uhr:
Es muss die Ironie des Schicksals gewesen sein, dass ausgerechnet der leidenschaftliche junge Biker, der sich vor Jahren bei einem Velounfall ganz in der Nähe die Vorderzähne ausgeschlagen hatte, an diesem Morgen plante, mit seinem E-Bike den Mittenberg hochzufahren. Beim Brunnen neben der Bushaltestelle wollte er wie immer sein Bidon mit dem quellklaren kalten Wasser auffüllen.
Schon Meter davon entfernt sah er einen kleinen Hund auf der Straße herumirren und reduzierte vorsorglich sein Tempo. Diese Hundehalter, dachte er, haben einfach keinen Respekt gegenüber uns Fahrradfahrern. Lassen die Tiere ohne Leine überall frei herumlaufen und behaupten immer: »Ja, der tut doch niemandem was.« Dass es Leute gibt, die auch vor einem Dackel Angst haben, das verstehen die nicht oder wollen es nicht verstehen.
Der kurze Ärger verflog schnell, denn was ihm nun ins Auge stach, war, dass jemand vornübergebeugt im Brunnen lag, als tauchte er nach etwas.
Der Biker bremste abrupt, lehnte sein Fahrrad gegen das Bushäuschen und eilte die paar Schritte zum Brunnentrog. Das Wasser plätscherte munter, als sei alles bestens, doch im Wasser lag eine alte Frau. Der Boden rund um den Brunnen war nass gespritzt, als hätte jemand im Wasser gezappelt.
Er zog die grauhaarige Seniorin, von der er nur den Hinterkopf und Rücken sah, rasch aus dem Wasser, legte sie neben sich auf den Boden und wählte sofort den Notruf.
Die Rettung hatte nur knapp zwei Kilometer entfernt in der Loëstrasse ihren Stützpunkt. Keine Minute nachdem der junge Mann sein Handy eingesteckt hatte, hörte er bereits das sich nähernde Signalhorn.
Die Retter waren somit sehr schnell vor Ort. Doch sie mussten sofort erkennen, dass für sie da nichts mehr zu machen war. Die Frau schien ertrunken zu sein. Deshalb entschied der Notfallarzt, die Polizei zu alarmieren.
Es dauerte zehn Minuten, ehe ein Streifenwagen an Ort und Stelle war. Es war mittlerweile 7:30 Uhr und hell, und der knapp 3000 Meter hohe Calanda trug bereits eine Mütze aus sanft rotem Sonnenschein.
Kaum waren die beiden Beamten ausgestiegen und hatten sich der Liegenden genähert, ereilte sie ein im ersten Moment verwirrender Funkspruch: Ein Mann habe soeben im Fürstenwald beim Waldhausstall eine tote Frau gefunden, hieß es von der Zentrale. Erst durch Nachfragen erfuhren die Beamten vor Ort, dass es sich nicht um die alte Frau handeln konnte, sondern dass ein Jogger eine andere Tote, eine junge Frau, auf einer Parkbank im nahen Wald entdeckt hatte!
4
Giulia de Medici, die Chefermittlerin der Kantonspolizei Graubünden, bekam an diesem Samstagmorgen um 7:43 Uhr einen Anruf auf ihr Handy.
Sie war bereits seit 6:30 Uhr auf den Beinen und hatte mit Gian die Tiere auf dem kleinen Hof Mättali in Malix versorgt. Seppa-Toni, das Minihausschwein, war mittlerweile nicht mehr das einzige Schwein auf dem Hof, Trudi-Schnitzel leistete ihm seit Kurzem Gesellschaft und wollte ebenfalls gefüttert werden. Die Kuh Miss Helvetia, die im September von der Alp gekommen war, konnte Giulia mittlerweile gekonnt von Hand melken, denn für eine einzelne Kuh brauchte es keine Melkmaschine. Giulia genoss jedes Mal beim Melken die Zeit alleine im Stall, hörte dem rhythmischen Zischen zu, wenn die Milch in den Kessel spritzte und dabei Schaum bildete. Ein kleines Radio hing seitlich oben in der Decke zwischen verstaubten Spinnweben, leiser Swing ertönte. Vom Heustock darüber duftete es nach der Heuernte, die sie Ende Sommer mit Gian eingebracht hatte. Auch Nadia, ihre beste Freundin, und deren Mann Mark hatten tatkräftig mitgeholfen. Brütend heiß war es an jenem Tag gewesen, der Schweiß war in Strömen geflossen.
Nach getaner Arbeit hatten sie alle noch lange gemeinsam draußen auf der Terrasse gesessen, reichlich gegessen und getrunken. Auch Nadias Mutter Lena war unter ihnen gewesen, hatte auf ihre 22 Monate alte Enkelin Amira achtgegeben, von der Giulia die Taufpatin war.
Ein Tier war Giulia besonders ans Herz gewachsen: Aus dem Altdeutschen-Schäferhund-Welpen Lux war in den letzten Monaten ein eindrucksvoller Hund geworden, wenngleich er noch lange nicht zur Gänze ausgewachsen war. Das Tier war aber bereits überaus klug und schützte den Hof.
Giulia und Gian waren seit dem Sommer vor einem Jahr zusammen. Gian hatte von Beginn weg keine Zweifel daran gehabt, mit Giulia die Richtige fürs Leben gefunden zu haben. Giulia fühlte zwar gleich, aber da war noch Erlebtes, das sie nicht so einfach vergessen konnte. Das lag an ihrer letzten Beziehung, die fatal geendet hatte, und damit auch an ihren Selbstzweifeln, die sie nie zur Gänze losbekam. Sie verbrachte aber viel Zeit auf dem Mättali, Gians schönem kleinen Hof, der unterhalb von Malix einsam und friedlich in einer Mulde lag, mit Blick auf die Berge ringsum. Gian, der neben der Arbeit auf seinem Hof als begnadeter Schreiner und Zimmermann selbstständig für seine Holzwerkstatt arbeitete, seine Einmannfirma, schrieb dann und wann an seinem dritten Roman weiter, denn er war auch noch Schriftsteller. So lebten sie in den letzten 15 Monaten ihre junge Liebe und lernten sich immer besser kennen.
Giulia wohnte dennoch weiterhin in Chur, das eine Viertelstunde entfernt unter Malix im Churer Rheintal lag. Sie wollte ihre geliebte Dachwohnung mit Blick auf die Stadt und über das Tal nicht aufgeben. Auch wenn sich mit Gian alles richtig, sogar wunderbar anfühlte, ihre Liebe und Leidenschaft füreinander lichterloh brannten, so war es auch schön, wenn sie wohnlich ungebunden war. Wobei Giulia genau genommen irgendwie bereits auch schon auf dem Hof wohnte. Spätestens seit Gian dort zusammen mit ihr einen Schrank für ihre Sachen geschreinert hatte, der nun mit Kleidern und anderem von ihr gefüllt war, war es so.
Gian war zudem ein ausgezeichneter Koch, und für sie war es schlichtweg ein Geschenk, sich nach einem aufreibenden Tag am Abend an einen gedeckten Tisch setzen zu dürfen und sich bekochen zu lassen. Er tat dies gerne, wie sie sich vergewissert hatte, und sie aß gerne. Den Abwasch machten sie dann jeweils gemeinsam. Gian hatte in der modernen Küche bewusst auf einen Geschirrspüler verzichtet, weil er fand, dass die Zeit, die sie für den gemeinsamen Abwasch brauchten, keine verlorene sei. Und es stimmte, wie Giulia bald einsah, denn gute Gespräche kamen dabei immer wieder zustande, die manchmal mit einem guten Glas Wein und schöner Musik ihre Fortsetzung auf der Terrasse fanden oder erst nach einem Spaziergang durch die Weiden endeten. Nicht wenige Sommer- und Herbstabende hatten sie im letzten Jahr genau so verbracht. Oft hatte Giulia nach einem aufreibenden Tag aber auch im Liegestuhl gelesen, während Gian neben ihr am Tisch seinen Roman weitergeführt hatte. Nachdem sie beide dann in der Dämmerung die Tiere alle gut versorgt hatten, kehrte diese Ruhe ein im Mättali, und Giulia und Gian zog es in ihr Liebesnest.
An diesem Samstagmorgen hatte Giulia frei, so wie das gesamte Wochenende und ausnahmsweise am folgenden Montag. Sie hatte soeben mit Gian gefrühstückt und die Tasse Kaffee nach dem letzten Schluck abgestellt und weitere Pläne für den Tag und das verlängerte Wochenende geschmiedet, als ihr Handy klingelte. Sie hatte zwei SIM-Karten im Gerät und hörte anhand des Klingeltons sofort, dass es die Einsatzzentrale war. Sie hob vielsagend die Augenbrauen, als sie das Handy aus der rechten Gesäßtasche ihrer Jeans zog und das Gespräch annahm.
Sie hörte erst nur zu, fragte dann: »Wer ist alles aufgeboten worden? … Okay. Ich werde mich in 10 Minuten auf den Weg machen, das heißt«, sie blickte auf ihre große Armbanduhr, »vor 8:30 Uhr dort sein.«
Dann legte sie das Handy vor sich auf den Tisch, trommelte mit den Fingern der rechten Hand auf das Display und blickte Gian an. »Ich muss leider sofort los, mein Lieber. Gleich zwei Mordfälle sind geschehen. Und wie ich ebenfalls gerade erfuhr, kam es gestern am frühen Abend beim Friedhof Fürstenwald während der Messe zu Allerheiligen zu einem seltsamen Vorfall, der mit den Morden in Zusammenhang stehen könnte. Es wird daher wohl eine Weile dauern. Mehr darf ich dir nicht sagen.«
Sie stand auf und band ihr pechschwarzes Haar zu einem Pferdeschwanz zurück, während sie Richtung Badezimmer lief, wo sie nach nur drei Minuten wieder herauskam.
Giulia und Gian hatten sich einen kleinen Tresor für Giulias Waffe zugelegt. Sie tippte die Kombination ein und entnahm ihre Glock und das Magazin, das sie separat gelagert hatte. Sie band sich für diesen Einsatz das Schulterholster über ihr weißes tailliertes Damenhemd, dessen Ärmel nur knapp über die Ellbogen reichten, und steckte die nun geladene Waffe ein.
Im Flur schlüpfte sie in ihre Adidas-Turnschuhe, band diese sorgfältig, prüfte die Schnürsenkellänge und nahm ihren dünnen graublauen Parka vom Haken der Garderobe. Irgendwie musste sie ja die Waffe verdecken, auch wenn es draußen gemäß Wetterbericht viel zu warm werden würde für die Jahreszeit. Südwind war gestern im Laufe des Tages aufgekommen, der die ganze Nacht nicht nachgelassen hatte und wohl noch eine ganze Weile andauern würde.
»Du siehst beeindruckend und attraktiv zugleich aus«, sagte Gian mit Blick auf die einsatzbereite Giulia, die als Letztes ein schwarzes NY-Cap aufsetzte, eines ihrer Markenzeichen.
»Danke, Gian, und es tut mir echt leid wegen unserer Pläne.« Sie warf ihm einen entschuldigenden Blick zu, küsste ihn sanft auf die Lippen und streifte ihm gleichzeitig mit den Fingern ihrer tätowierten linken Hand übers Gesicht. Sie wusste, dass er absolutes Verständnis für ihren Beruf aufbrachte, denn es war nicht das erste Mal, dass sie Hals über Kopf alles hier liegen lassen musste. »Eine tote Seniorin in einem Brunnen und eine ermordete junge Frau unweit davon im Wald … Hört sich nach einem brutalen Gewaltverbrechen an. Ich muss und will also hin. So, jetzt habe ich doch wieder zu viel geplappert. Ich melde mich, okay?«
Sie blickte ihn voller Liebe an und erinnerte sich für einen Moment an das, was sie gefühlt hatte, nachdem er ihr zum ersten Mal begegnet war. Ob sie wollte oder nicht, ihr ging damals danach der strahlende Gesichtsausdruck dieses Gian Manetsch nicht mehr aus dem Sinn. Zugegeben, er sah auf eine besondere Art und Weise verdammt gut aus. Er war mit 1,85 Metern wenige Zentimeter größer als sie selbst, seine Gesichtszüge waren männlich, aber nicht zu kantig, trugen eine Milde in sich, wie auch seine schieferblauen Augen, die eine innere Zufriedenheit ausstrahlten. Der Mann schien dort angekommen zu sein, wo er immer schon hingewollt hatte, dachte sie. Oder was war es sonst, das dieses Lächeln ausdrückte? Erst später verstand oder besser gesagt fühlte sie es: Gian hatte sie anders angeschaut, als es alle anderen Männer zuvor getan hatten. Sie mochte keinen Kitsch, aber sie fühlte es: Er hatte sie wirklich gesehen, etwas in ihr erkannt, das über das Verstehen hinausging. Auch wenn sie es im ersten Moment nicht wahrhaben konnte oder wollte: Es war gegenseitige Liebe auf den ersten Blick gewesen!
Als ob Gian Giulias Gedanken von ihren Augen ablesen könnte, zog er sie für einen Moment ganz nah an sich, küsste sie sanft auf ihre linke Halsseite, seine Hände lagen dabei kurz auf ihrem Hintern, bevor er in ihre dunklen Augen blickte. »Pass auf dich auf, Bella.« Dann umarmten sie sich.
Als sie sich lösten, sagte sie: »Mein Lieber, genieß du deinen Tag halt ohne mich, okay? Das Wetter wird in den Bergen phantastisch sein, denn wir beide mögen ja den Wind.«
Gians Zwillingsschwester Gianna, die Zimmerfrau war, wäre am Mittag für zwei Tage aus der Innerschweiz hergefahren und hätte auf dem Mättali nach dem Rechten geschaut, damit die beiden ins Engadin hätten fahren können, nach Pontresina, dahin, wo Giulia aufgewachsen war, denn der Herbst im Engadin war unglaublich schön. Doch sie mussten es verschieben.
Gian trat auf den großen gekiesten Vorplatz vor dem Haus, der sich zwischen Stall, Scheune und der kleinen Schreinerei ausbreitete, während Giulia in ihren weißen PS-starken Allrad-BMW stieg und winkend davonfuhr.
Während der Fahrt hinunter nach Chur, dessen südwestliche Quartiere in der Morgensonne lagen, die aus dem Taleinschnitt des Schanfiggs ihren Weg zwischen den Bergen bereits gefunden hatte, rief Giulia Nadia an, ihre beste Freundin und Ermittlerkollegin. Viel gab es noch nicht zu bereden, denn mehr Informationen hatte auch sie von der Einsatzzentrale nicht erhalten. Giulia wusste aber, um welche Parkbank es sich handeln musste, denn sie war bereits unzählige Male daran vorbeigejoggt auf ihrer Runde von Chur in die Trimmiser Rüfe und zurück, und das nicht selten zusammen mit Nadia. Der Rapport vom gestrigen Einsatz am Waldhausstall sei in der Datenablage zu finden, hatte es seitens der Zentrale geheißen. Giulia hatte ihr Notebook dabei und wollte sich diesen Bericht nachher im Beisein von Nadia vor Ort anschauen. Sie wusste aber bereits, dass sich zwei Joggerinnen im Wald verfolgt gefühlt hatten.
Ihre Sonnenbrille legte Giulia auf den Beifahrersitz, als sie, in Chur angekommen, Richtung Waldhausstall fuhr, der im Schattenwurf des Bergkranzes lag, an dessen Flanken sich der Fürstenwald emporwand.
Wie erwartet war die Zufahrtsstraße längst oben abgesperrt worden, wie auch jene, die von der anderen Seite hochführte, durch die Felder vom Waisenhaus. Ebenso der beliebte Spazierweg über die Prasserie. Dieser war mittels rot-weißer Absperrbänder mit der Aufschrift Polizei blockiert worden, die im ruppigen Südwind geräuschvoll hektisch flatterten.
Giulia hielt bei der Straßensperre und ließ die Seitenscheibe hinuntergleiten. Sie begrüßte die Beamtin, die sich ans Fenster beugte. Da es niemanden im Kommando gab, der die Chefermittlerin nicht kannte, musste Giulia ihren Dienstausweis nicht vorzeigen und wurde umgehend durchgelassen.
Giulia parkte weiter vorne auf der Straße neben dem Stall, holte ihre Tasche vom Rücksitz, in der auch das Notebook war, und ging auf ein Grüppchen Leute zu, in dem sie Nadia erkannte. Ein Krankenwagen stand neben dem Brunnen, die Lichter blinkten orange. Neben Nadia standen drei Personen von der Rettung und zwei Polizisten in Uniform. Giulia hatte sich schon vor der Wegfahrt eine Oberarmbinde umgelegt, auf der Polizei