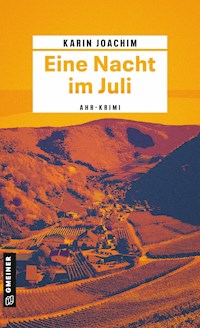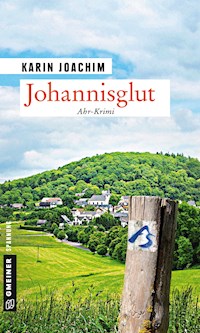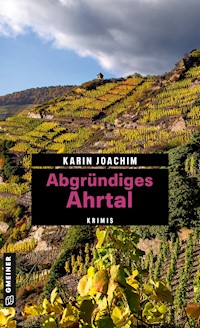
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kriminelle Freizeitführer im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
Unzählige Flussbiegungen bieten Schutz vor unliebsamen Zeugen und Verfolgern, schroffe Felsen laden dazu ein, lästig Gewordenes unbemerkt loszuwerden - im Ahrtal ist nicht nur die Landschaft abgründig: Ein Mann kehrt Jahre nach einem tödlichen Unglück in seinen Heimatort Blankenheim zurück und erhält abstruse Botschaften, eine von der Brücke in Rech verschwundene Steinfigur gibt einem launigen Polizisten Rätsel auf und ein Skelettfund im Wald bei Lommersdorf entpuppt sich als großer Segen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 286
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Karin Joachim
Abgründiges Ahrtal
Krimis
Zum Buch
Krimis aus dem Ahrtal Elf Krimis, so vielfältig wie das Ahrtal selbst – vom Ursprung der Ahr in Blankenheim, ihrem Weg durch hügeliges Bergland, Wiesen und Wälder, ihren Schluchten und schroffen Felshängen und ihrer Mündung zwischen Sinzig und Kripp in den Rhein: Ein Mann kehrt Jahre nach einem tödlichen Unglück in seinen Heimatort zurück und erhält abstruse Botschaften, eine von der Brücke in Rech verschwundene Steinfigur gibt einem launigen Polizisten Rätsel auf und ein Skelettfund im Wald bei Lommersdorf entpuppt sich als großer Segen. Kommissar Gerhard Zenner will eigentlich Urlaub machen und muss unfreiwillig auf einem Weingut an der Mittelahr ermitteln. Eine Wanderung auf dem Rotweinwanderweg nach Mayschoß endet tödlich und ein Mann, der schon vor Jahren gestorben ist, stellt das Leben eines Ahrweiler Architekten völlig auf den Kopf. Eine Kündigung bringt in den 1930er-Jahren das Fass in Bad Neuenahr zum Überlaufen und ein Auftragsmord mit Komplikationen lässt das Leben eines Bad Bodendorfer Sozialarbeiters aus den Fugen geraten.
Karin Joachim wurde in Bonn-Bad Godesberg geboren und lebt heute im Ahrtal. Sie studierte Germanistik und Anglistik an der Universität Bonn und leitete ein archäologisches Museum, bevor sie sich ganz dem Schreiben widmete. In ihrer Freizeit ist sie mit ihrem Border Terrier unterwegs, mit dem sie die Natur erkundet. Besonders gerne besichtigt Karin Joachim historische Orte sowie Parks und Gärten im In- und Ausland.
Mehr Informationen zur Autorin unter: www.karinjoachim.de
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2023 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Julia Hermann / stock.adobe.com
ISBN 978-3-8392-7626-6
»Morgen bist du tot«
Als Harry Kellermann im ersten Licht des Tages in den Gassen unterhalb der Burg unterwegs war, fegte ein böiger Wind durch die Häuserschluchten. Ein feiner feuchter Schleier Tau ließ die Pflastersteine glänzen. Harry setzte behutsam einen Fuß vor den anderen, um nicht auszurutschen. Seit einigen Tagen fühlte er sich ein wenig geschwächt, was er auf die Tatsache zurückführte, dass er sich in seinem alten Heimatort einfach nicht wohlfühlte. Es war ihm so, als starrten ihn nicht nur die Menschen an, sondern auch die Mauern der Gebäude, die er aus seiner Kindheit kannte. Nicht viel hatte sich in Blankenheim verändert, dem Ort, in dem die Ahr entsprang, seit er ihn vor Jahrzehnten verlassen hatte. Er vermied es, tagsüber nach draußen zu gehen, auch wenn er eigentlich kaum noch einem bekannten Gesicht begegnete. Aber er wusste, dass sie alle es wussten.
Wie damals wimmelte es bereits zur späten Morgenstunde in der Stadt mit der weithin sichtbaren Burg, deren Ursprünge bis ins zwölfte Jahrhundert zurückreichten, nur von Touristen. Sie staunten über das Gildehaus mit dem Eifelmuseum, das Hirtentor, die kleinen Häuser am Zuckerberg, die spätgotische Hallenkirche und das Georgstor und hatten stets ihre kleinen Fotokameras oder Handys griffbereit. So mancher Tourist kam ins Schlittern auf den steilen Wegen. Als Kind war Harry unbekümmert und trittsicher durch die Straßen gerannt, hatte nur wenig Rücksicht auf die Fremden genommen, nicht aus bösem Willen, sondern einfach weil es Wichtigeres gab. Gemeinsam mit den anderen Kindern und Jugendlichen war er um Häuserecken gelaufen, hatte mit ihnen gelacht, Schimpfwörter gerufen, sich stark und unantastbar gefühlt. Damals in den Siebzigerjahren. Sehr zum Unmut der Erwachsenen. Noch mehr ärgerten diese sich, wenn sie mit ihren Fahrrädern Wettrennen veranstalteten. Rund um die Kirche, durch die Tore und entlang der alten Fachwerkhäuser – manchmal nur haarscharf um die Kurven. Meist befand sich ihr Ziel direkt vor der Ahrquelle, die im Keller eines alten Fachwerkhauses entsprang. Es kam vor, dass sie erst kurz vor einer der weiß getünchten Häuserwände zum Stehen kamen. Nicht selten trugen sie blaue Flecken davon. Das Geschrei in den Gassen war groß, und meistens ging eines der umliegenden Fenster rund um den kleinen Platz auf, worauf eine verärgerte Frau oder ein wütender Mann zu ihnen herunterrief: »Jetzt ist aber Schluss da unten! Sonst werde ich mich bei euren Eltern beschweren!« Mancher hatte ihnen sogar eine Tracht Prügel angedroht.
Als Harry älter war, hatte er das Mofa gegen sein Fahrrad eingetauscht. Besonders nachts ließ er den frisierten Motor aufheulen. Aus Trotz, um gegen die Enge der Kleinstadt aufzubegehren, aber auch um die Mädchen des Ortes zu beeindrucken. Der Hall in den Gassen war ohrenbetäubend. Er liebte den Geruch des Zweitakters, für ihn war er der Inbegriff von Freiheit. Harry hatte Sehnsucht nach einer Welt, die ihm so weit weg erschien. Die wenigen Häuser unterhalb des Burgberges wirkten auf ihn oft wie eine unüberwindbare Mauer, eine Grenze, die er nicht überschreiten durfte. Wenn er doch nur endlich erwachsen wäre, hatte er damals gedacht. Er wollte fort. Jeder kannte jeden, nichts blieb geheim. Das Staunen der Touristen, die vom Sommer bis in den frühen Herbst hier einfielen, konnte er nicht nachvollziehen. Was fanden sie an diesem Örtchen nur so spannend? »Wie idyllisch!«, riefen sie, wenn sie aus ihren Bussen stiegen und im Pulk zur Ahrquelle zogen. Gut, sie brachten dem Ort Geld. Für manchen Einwohner bedeutete dies ein Zubrot, für manche sogar die Grundlage ihrer Existenz. Aber was war im Winter? Nicht immer erreichte dann die Sonne jeden Winkel, manche Häuser standen im Winterhalbjahr sogar ganztägig im Schatten. Und nur der eisige Wind zog durch die Gassen.
Harry hätte damals alles darum gegeben, den Ort zu verlassen, aber nicht unter den Umständen, die ihn letztendlich dazu brachten. Er war viel herumgekommen, hatte viele Länder bereist. Dennoch war die Einsamkeit in seinem Innern sein Leben lang sein Begleiter. Und die Schuldgefühle, die ihn nicht ständig, aber doch wie ein dunkles Geheimnis belasteten. Erst vor ein paar Tagen war er zurückgekehrt. Aber nicht, um zu bleiben.
Der Wind wehte immer noch, aber hatte merklich nachgelassen. Harry atmete die kühle Luft ein und seufzte. Er blieb stehen, schirmte seine Hände mit dem Rücken ab und zündete sich eine Zigarette an. Er rauchte zu viel. Sein Arzt hatte ihm attestiert, dass Lunge und Gefäße sich nicht im besten Zustand befanden. Harry sog den Rauch ein, musste husten und beschloss, mit dem Rauchen aufzuhören, wenn er alles hinter sich gelassen hatte. Es war nicht mehr viel zu erledigen seit dem Tod seiner Mutter. Der Himmel hellte sich auf, die Sonne zeigte sich zaghaft. Einzelne Fensterscheiben reflektierten das Licht. Plötzlich, wie von Geisterhand, erhob sich eine kleine Windhose, die das Laub aufwirbelte, das in der Gasse lag. Die Windhose veränderte ihre Richtung. Er folgte ihr mit seinen Augen, als er etwas Weißes bemerkte, das von ganz oben den Burgberg herunter durch die Luft nach unten trudelte. Es kam auf ihn zu und landete schließlich vor seinen Füßen. Es war ein weißes Blatt Papier, nicht größer als eine Postkarte. Er hob es auf, um es zu entsorgen. Instinktiv drehte er das Blatt um und blickte wie versteinert auf die Worte, die darauf mit Schreibschrift geschrieben waren. Seine Hand begann zu zittern. Der Wind nahm Fahrt auf und pfiff um ihn herum. Ihm wurde fast schwindelig.
»Morgen bist du tot«, stand da geschrieben. Sein Atem ging schneller, sein Herz raste, ohne dass er etwas dagegen tun konnte. Wer machte nur solch makabre Scherze, dachte er. Fast schon wütend knüllte er das Papier zusammen und warf es in den nächsten Papierkorb. Dann ging er weiter. Er sah nicht, wie eine Windböe in den Papierkorb fuhr und den zerknüllten Zettel wieder heraushob. Dieser kullerte noch einige Meter hinter ihm her, blieb mehrere Male für eine kleine Weile an der Pflastersteinkante liegen, bevor er sich in einer Regenrinne vor einem Haus verfing.
Harrys Weg führte ihn zu einer kleinen Bäckerei, in der er jeden Morgen einen Kaffee mit Zucker zu sich nahm. Jeden Morgen seitdem er zurückgekehrt war. Den Namen des Inhabers hatte er noch nie zuvor gehört und hoffte, dass jener nichts von den Ereignissen mitbekommen hatte, dass ihm niemand etwas erzählt hatte, was vor fünfunddreißig Jahren geschehen war. Heute tat der heiße Kaffee besonders gut, weil ihm fröstelte. Außer dem Bäcker selbst war nur noch ein Handwerker in Arbeitskleidung im Laden. Er hatte bereits sein Brötchen verspeist, nickte dem Bäcker zu und ging zur Tür hinaus. Nun war er mit dem Inhaber, einem Mann seines Alters, allein. Harry bestellte, der Mann reichte ihm lächelnd den Kaffee, Harry stellte sich an einen der Tische, trank hastig aus und verließ den Laden mit einem leisen Gruß auf den Lippen. Als er die Glastür gegen den Druck des Windes öffnete, ertönte ein unangenehmes Pfeifen, und die Seiten der auf einem der Tische liegenden Zeitung bewegten sich durch den Luftzug. Er war irritiert durch die Geräusche, die der Wind erzeugte und in denen die Worte des Bäckers untergingen.
Auf dem Nachhauseweg, schon außerhalb des historischen Ortskerns, kam er an der Stelle vorbei, an dem einst das Fachwerkhaus gestanden hatte, dessen Anblick sich für immer in sein Gedächtnis eingebrannt hatte. Nun befand sich dort ein Neubau. Aus den 1980er-Jahren vermutlich. Er zwang sich dazu, weiterzugehen und nicht wieder an jene Nacht zu denken. An jene Nacht, die sein Leben und das seiner Eltern für immer verändert hatte. Gravierend verändert hatte. Seit den verhängnisvollen Tagen war er nie wieder zurück an diesen Ort an der Ahr gekehrt. Bis vor ein paar Tagen. Es war keine gute Idee gewesen, und doch konnte er nicht anders, denn er hatte seiner Mutter die letzte Ehre erweisen müssen. Ein Anwalt hatte ihn informiert. Er habe seine Telefonnummer von der Auskunft erhalten, hatte er Harry mitgeteilt. Zum ersten Mal war er froh darüber gewesen, dass er sich keine Geheimnummer zugelegt hatte, obwohl er mit dem Gedanken gespielt hatte, um für niemanden aus seinem früheren Leben erreichbar zu sein. Der Anwalt kannte sicher auch Methoden, die ihn ebenfalls auf Harrys Spur gebracht hätten, aber so war es einfacher gewesen. Seit dem Ableben seiner Mutter war erst wenige Zeit verstrichen, sodass Harry an ihrer Beisetzung hatte teilnehmen können.
Er hätte danach gleich wieder in sein richtiges Leben zurückkehren können, vielleicht auch sollen. Doch er brachte es nicht übers Herz, es dem Anwalt zu überlassen, den Nachlass seiner Mutter zu regeln. Es ging um keinen umfangreichen Besitz, einzig ein paar Formalitäten erforderten etwas Aufwand. Er war das seiner Mutter schuldig. Ja, die Schuld ließ ihn nicht los. Am Nachmittag kümmerte er sich weiter um ihre Habseligkeiten, die sich über die Jahrzehnte angesammelt hatten. Erstaunlich ordentlich war es in dem kleinen Häuschen, das sich seit Jahrhunderten im Familienbesitz befand. Hatte sie jemanden gehabt, der sich um sie kümmerte? Er musste sich eingestehen, dass er es nicht wusste. Er hatte sich gewundert, dass sie ihn nicht schon längst enterbt hatte. Die Todesnachricht hatte Harry zunächst bestürzt, dann hatte er sich traurig gefühlt, weil er annehmen musste, dass seine Mutter vereinsamt gestorben war und vielleicht eine Aussprache mit ihrem Sohn ersehnt hatte. Dann fühlte er sich plötzlich erleichtert. Sie war die einzige lebende Verbindung hierher gewesen. Mit ihrem Tod war diese Verbindung gekappt. Für einige Tage hatte er sich so leicht und unbeschwert gefühlt. Endlich konnte er leben, ohne Schuldgefühle zu haben. Doch dann holte ihn alles wieder ein. Er musste die Sache zum Abschluss bringen, sich endlich seiner Vergangenheit stellen. Die Beerdigung seiner Mutter war ein seltsames Erlebnis für ihn gewesen. Am Grab hatten viele alte Bekannte gestanden, deren Gesichter er zwar noch kannte, aber trotzdem hatte er große Schwierigkeiten, diesen Gesichtern auch Namen zuzuordnen. Keiner hatte mit ihm gesprochen oder ihm sein Beileid mitgeteilt. Stumm waren sie an ihm vorbeigegangen, so, als gäbe es ihn nicht. Er fragte sich einige Male, dort am Grab seiner Mutter stehend, ob er das wirklich alles erlebte oder ob er nicht in einem Albtraum stand. Aber es war kein Albtraum, es war real. Fünfunddreißig Jahre waren vergangen, aber hier im Ort gingen die Uhren anders, langsamer. Man hatte nichts vergessen. Kein Gras war über den Unfall von damals gewachsen. Während alle anderen gealtert waren, so war er für sie der Teenager geblieben, der schuld daran war, dass eine ganze Familie nach und nach ausgelöscht worden war. So empfand er es. Denn niemand warf ihm etwas vor. Doch das war auch gar nicht nötig, denn der Ort selbst war ein einziger Vorwurf. Wenn Väter oder Mütter nicht mehr lebten, so hatten ihre Söhne oder Töchter, Enkel oder Urenkel die ungeheure Tat dennoch miterlebt. In unendlich vielen Erzählungen.
Er hatte gehofft, etwas Versöhnliches in den Unterlagen, Briefen, Schriftstücken seiner Mutter zu finden. Einen Brief oder eine Notiz, vielleicht sogar an ihn persönlich gerichtet, die ihm Vergebung zollte. Je mehr er sich in die alten Unterlagen einarbeitete, desto mehr wurde ihm klar, dass er in diesem Haus schon lange nicht mehr existierte, denn es fand sich kein einziges Foto von ihm, weder an der Wand noch in einem Album. Er erinnerte sich plötzlich daran, dass seine Mutter ihn eines Tages an seiner Ausbildungsstelle angerufen und ihm unter Tränen berichtet hatte, dass sein Vater alle Fotos vernichtet hatte, auf denen er zu sehen gewesen war. Nun wurden seine Augen feucht, und eine Träne kullerte über seine Wange.
Die Erinnerung schmerzte ihn so sehr, dass er beschloss, gleich morgen abzureisen und den Anwalt darüber zu informieren, dass er das Erbe nicht antreten würde. Sollte der sich um alles kümmern. Harry wollte nur weg. Wieder zurück in sein Leben, das nichts mehr mit dem Ort unterhalb der Burg zu tun hatte. Er hatte sich der Vergangenheit gestellt, er hatte es zumindest versucht. Die Menschen jedoch kannten keine Vergebung, noch nicht mal ein Vergessen. Er fürchtete sich davor, dass sie ihn zur Rede stellen würden, ihn mit seiner Schuld konfrontierten. Wenn jemand ihn anlächelte oder ihn anredete, so waren es Fremde oder gerade erst Zugezogene.
Es war Abend geworden. Von seinem Fenster aus konnte er etwas entfernt zwar, aber doch deutlich den Neubau sehen. Jedes Mal, wenn seine Mutter in die Altstadt gegangen war, hatte sie hier, an jenem Platz, an dem zunächst eine Ruine gestanden hatte, vorbeigemusst. Was hatte sie dabei gedacht und empfunden? Was hatte sie überhaupt durchgemacht in all den Jahren? Hatte sie die Vorwürfe, die Blicke der Einwohner ertragen können? Oder hatten sie allesamt seine Mutter geschnitten? Einige Jahre nach Harrys Weggang war sein Vater gestorben. Ab da war sie allein gewesen. Vom Tod seines Vaters hatte Harry nur durch Zufall erfahren, weil er auf einer Messe einen alten Klassenkameraden getroffen hatte. Damals hatte er beinahe ein wenig Genugtuung empfunden, darüber, dass sein hartherziger Vater ausgerechnet an einem Herzinfarkt gestorben war. Aber Gedanken um seine Mutter hatte er sich nicht gemacht. Jetzt fragte er sich zum ersten Mal, wie sie das alles nur ausgehalten hatte. Er wusste es nicht. Er fühlte Scham. Scham darüber, dass es ihn bis zum heutigen Tag nicht interessiert hatte, dass er keinen Gedanken daran verschwendet hatte.
Er musste wieder an jenen Abend denken, der alles verändert hatte. Voller Übermut waren er und seine Kumpels mit ihren laut knatternden, frisierten Mofas durch die Gassen gerast. War das ein Spaß gewesen! Die Luft war geschwängert vom Gestank aus den Auspuffen. Wie blaue Wolken hingen die Abgase in den Gassen. Zum Knattern der Motoren und dem Quietschen der Reifen kamen ihre Rufe hinzu. Ein ohrenbetäubender Lärm! Aber er war glücklich gewesen, und für einen Moment empfand er wieder wie damals. Sie hatten ein wenig Alkohol getrunken, aber nicht zu viel, nur ein wenig. Einen Helm trug keiner von ihnen. Auch nicht das schöne Mädchen, das auf seinem Gepäckträger Platz genommen hatte und sich an ihn schmiegte. Seine Hormone fuhren Achterbahn. Er war verliebt und fühlte sich wie ein Held. Er wurde immer schneller, immer mutiger. Zunächst lachte sie noch, dann wurde sie stiller, schließlich begann sie zu rufen, dass er langsamer fahren solle. Aber er war so besoffen von der ganzen Atmosphäre, vom Spaß, von der Kraft, die er verspürte. Sie schrie, immer wieder, dass er vorsichtiger fahren solle. Die Reifen quietschten, der Motor heulte, er gab Gas, wieder und wieder. Die Kurve nahm er noch ein wenig enger als zuvor. Und dann, dann passierte es. Irgendetwas lag plötzlich auf dem Weg. Eine Katze? Eine Mülltüte? Er wusste es bis heute nicht. Er bremste hektisch, kam aber nicht mehr zum Stehen. Das Vorderrad berührte den Rinnstein, das Mofa geriet in Schieflage. Er hörte für einen kurzen Moment auf zu atmen, hielt die Luft an. Dann war es auch schon passiert. Sie fielen auf die Seite, wobei das Mofa mehrere Meter auf dem Pflaster weiterrutschte. Harry ließ den Lenker los, schlitterte noch weiter. Dann kam er zum Liegen, bemerkte gleich sein verdrehtes Handgelenk. Der Schmerz ereilte ihn erst später. Aber diese Stille, diese Stille dröhnte in seinen Ohren.
Obwohl er sich ein wenig benommen fühlte, zog er die Beine an und versuchte aufzustehen. Sein Handgelenk schmerzte langsam. Und dann war da plötzlich diese Angst, denn er konnte seine Freundin nicht sehen. Das spärliche Licht in der Gasse erlaubte es ihm nicht, weiter als einige Meter zu überblicken.
Wo war sie? In der Ferne hörte er die Mofas der anderen, ganz weit weg. In seinen Ohren hämmerte das Blut. Um ihn herum erschien alles wie in Watte verpackt. »Wo bist du?«, hatte er verzweifelt gerufen. Immer wieder. Er bekam keine Antwort. Er kroch mehr, als dass er ging. Dann stieß er an etwas, das auf dem Boden lag. Es war weich. Es war SIE! Er berührte sie ganz sachte, sie reagierte nicht. Er rüttelte an ihrem Arm, sie bewegte sich nicht. Er zog an ihrem Oberkörper, sie blieb regungslos. Was danach geschah, wusste er nicht mehr. Er konnte sich nur noch an das Blaulicht erinnern, das von den Häuserwänden reflektiert wurde. Schreie, da waren Schreie. Und dann ein Satz, den sein Vater zu ihm sagte: »Ich will dich nie wieder sehen. Sieh zu, dass du hier weggehst, und komm nie wieder!«
Das hatte er auch getan. Harry war am nächsten Morgen am Bahnhof aufgewacht, neben ihm eine große Leinentasche mit seinen Habseligkeiten. Sein Handgelenk verbunden. Er hatte den ersten Zug genommen und war nie wieder zurückgekehrt. Seinen Eltern hatte er seine ersten Aufenthaltsorte mitgeteilt. Seine Mutter schrieb ihm heimlich Briefe, und sie war es auch, die ihn darüber informiert hatte, dass seine Freundin, dort auf dem Pflaster, gestorben war. In einem späteren Brief berichtete sie ihm vom Brand des Hauses, das der Vater seiner Freundin nur ein Jahr später aus Kummer und Verbitterung angezündet hatte. Den Brand hatten er und seine Frau nicht überlebt, nur der Sohn. Das Haus war nicht mehr zu retten gewesen und wurde abgerissen. Aber auch der spätere Neubau änderte nichts daran, dass die Ereignisse von damals niemals vergessen wurden. Nach dem Erhalt dieser Nachricht hatte Harry beschlossen, dass es besser für seine Eltern war, wenn er ihnen nicht mehr mitteilte, wo er wohnte, wenn er den Kontakt ganz abbrach. Aber insgeheim wollte er sich damit nur schützen, alles von sich fernhalten, was mit seiner Vergangenheit in Beziehung stand. Er konnte und wollte keine weiteren Hiobsbotschaften mehr ertragen und er wollte nicht schuldig gesprochen werden. Nicht für alles, was in diesem Ort geschah, wollte er die Verantwortung übernehmen. Es war ein tragischer Unfall gewesen, aber er war kein Verbrecher und auch kein Mörder.
Die Nacht war hereingebrochen. Er machte Licht. Nur noch einmal wollte er sich im Haus umsehen und dann schlafen gehen. Morgen würde er zurückkehren in sein Leben. Irgendetwas aber wollte er mitnehmen, irgendeine Erinnerung an seine Kindheit, die bis zu jenem verhängnisvollen Abend zwar aufgrund der Zornesanfälle seines Vaters nicht einfach gewesen war, aber auch nicht allzu belastend für ihn. Er blickte in Schubladen, öffnete Schranktüren, schaute in Regalen. Endlich fand er etwas: Im Kleiderschrank seiner Mutter stand eine kleine Schachtel mit einem aufgedruckten Rosenmuster. Er öffnete sie mit zittrigen Fingern. Sein Herz schlug schneller. Er konnte es kaum fassen: Seine Mutter hatte Fotos von ihm aufbewahrt. Sogar einen Zeitungsartikel über ihn fand er, in dem über ihn als Trainer einer Jugendfußballmannschaft berichtet worden war. Das war vor über zwanzig Jahren gewesen, als er längst nicht mehr in Blankenheim lebte. Ganz unten lag ein Kuvert, an ihn adressiert. Darin ein handgeschriebener Brief. Es war eigentlich kein Brief. Auf einem Zettelchen standen nur wenige Zeilen:
»Mein lieber Sohn! Du hast es richtig gemacht. Vergiss die Vergangenheit. Ich habe Dich nie verurteilt. Deine Mama.«
Er musste schlucken, dann kullerten ihm Tränen über die Wangen.
Am anderen Morgen verschloss er die Haustür für immer. Er nahm seinen Koffer und ging aus dem Ort. Nur ein letzter Kaffee, dachte er. In der Bäckerei trank er diesen jedoch nicht ganz aus. Ihm war ein wenig seltsam zumute. Sein linker Arm kribbelte. Er öffnete die Tür und stellte freudig fest, dass es heute nicht windete. Er packte sich an die aufgenähte Tasche seines Hemdes. Dort hatte er den Brief seiner Mutter verwahrt. Plötzlich spürte er einen Stich in der Herzgegend. Er musste sich an der Hauswand festhalten. Urplötzlich erhob sich eine Windböe, und ein zerknülltes Papier kullerte vor seine Füße.
»Diese dummen Jungen!«, hörte er jemanden hinter sich schimpfen. »Wann hören die endlich auf, ihre Botschaften von der Burgmauer herunterzuwerfen?«
Harry drehte sich um und erkannte den Bäcker in der Eingangstür. Doch seine Erscheinung wurde immer undeutlicher.
»Was ist mit Ihnen?«, hörte er ihn noch sagen, dann sackte er zusammen. Aber er wurde gehalten, bevor er mit seinem Körper auf dem Pflaster auftraf.
»Wir rufen den Notarzt«, sagte der Bäcker. »Setzen Sie sich hierher auf die Treppe.«
»Ich …«, murmelte Harry. »Ich hätte auf meinen Hausarzt hören sollen.«
»Sind Sie herzkrank?«, fragte der Bäcker besorgt, während er sein Handy zückte.
»Ich bin schuld …«, stammelte Harry und meinte im Blick des Bäckers ein Flackern zu bemerken.
»Woran?«
»Kennen Sie mich nicht?«, fragte Harry mit dünner Stimme. »Die ganze Stadt hasst mich.«
Für einen Augenblick war es Harry so, als überlagere das Gesicht seiner verstorbenen Jugendfreundin das des Bäckers. Eine Familienähnlichkeit etwa?
»Sind Sie ihr Bruder?«, stammelte er.
»Ich habe keine Schwester«, sagte der Bäcker. »Nun schonen Sie Ihre Kräfte. Was immer Sie getan haben, Schuldgefühle sind ein schlechter Ratgeber. Alles wird gut!«
Harry seufzte.
Rückepferd Mini
Seitdem Peter vor drei Tagen aus dem Wald zurückgekehrt war und vor Aufregung beinahe vergessen hatte, seinem Rückepferd Mini nach der schweren Arbeit seine übliche Extraportion Hafer zu geben, hatte sich die Stimmung auf dem alten Hof verändert. Der Hof, der sich seit über hundert Jahren im Familienbesitz befand und auf dem Peter mit seiner Mutter Christiane lebte, lag zwischen Lommersdorf und Aremberg, gerade noch eben in Nordrhein-Westfalen. Hinten im Wald, östlich von ihrem Besitz, verlief die Grenze zu Rheinland-Pfalz. Früher, zu Lebzeiten seines Großvaters und seines Vaters, hatte der Hof ihnen ein erquickliches Einkommen ermöglicht. Ein wenig Weidevieh, ein wenig Landwirtschaft. Sie waren gut über die Runden gekommen, weil sie schon immer auf Qualität geachtet hatten. Immer mehr Vorschriften und EU-Vorgaben hatten ihrem Betrieb allerdings in den letzten Lebensjahren seines Vaters wirtschaftlich stark zugesetzt. Von all dem hatten Peter und seine Schwester Alexandra jedoch in ihrer Jugend kaum etwas mitbekommen. Sie empfanden den elterlichen Hof als das Paradies auf Erden, die Wälder ringsum als Orte voller Magie und den Bachlauf im Wald als ein großes Experimentierfeld. Sie gingen täglich auf Expeditionsreise, nachmittags nach der Schule. Diese Zeiten lagen allerdings schon über zwei Jahrzehnte zurück. Alexandra lebte längst mit Mann und Familie in der Großstadt, war in ihrem Beruf als Bankerin erfolgreich. Peters Vater war vor vielen Jahren verstorben, nachdem er lange seine Krankheit für sich behalten hatte. So war er für alle Familienmitglieder überraschend und nur nach wenigen Krankentagen im Bett gestorben. Innerhalb von zwei Wochen, nachdem er zum ersten Mal sein gewohntes Arbeitspensum nicht mehr geschafft hatte. Erst auf seiner Beerdigung erfuhr die Familie durch den alten Hausarzt vom Leiden des Vaters. Daraufhin war seine Mutter zusammengebrochen und hatte sich einige Wochen nur zwischen Schlafzimmer und Küche hin und her bewegt, nicht aber, um wie all die Jahre zuvor für alle zu kochen, sondern sich lediglich einen Kräutertee zuzubereiten. Alexandra hatte bald nach dem Tod des Vaters darauf gedrängt, den Hof zu verkaufen, doch Mutter Christiane war derart entsetzt von diesem Ansinnen, dass sie ihre Tochter kurzerhand des Hofes verwies. Die Wogen hatten sich jedoch bald geglättet, nachdem Peters Mutter eingesehen hatte, dass Alexandra nur ihr Bestes gewollt hatte. Also schmiedete man Monate später gemeinsam im Familienrat einen Plan, wie man den Hof durch die schwierigen Zeiten würde manövrieren können. Peter gab zu, kein begeisterter Landwirt zu sein, und so verkleinerte man den Betrieb, führte einige Umbauten durch, sodass gestresste Städter für eine Weile in einer der drei Ferienwohnungen ihren hektischen Alltag auf dem Hof der Familie Griesbach in der Eifel vergessen konnten.
Und dann trat eines Tages Mini in Peters Leben. Er mochte schon immer Pferde, weshalb er bereits vor einer Weile einem alten Pony und einem zerzausten Esel aus einer Auffangstation ein Zuhause gegeben hatte. Eine Facebook-Bekannte hatte vor einigen Jahren auf die Not von Kaltblüter Mini hingewiesen, der einer ihrer Freundinnen gehörte. Eigentlich deren Mann, der ihn als Rückepferd führte, aber aufgrund einer Parkinsonerkrankung dazu nicht mehr in der Lage war. Peter hatte keinerlei Erfahrung mit großen, schweren Kaltblütern und schon gar nicht mit Rückepferden. Mini war zu jung, um in Rente zu gehen, also stellte sich Peter darauf ein, mit ihm weiterzuarbeiten. Er hatte sich längst in den dunkelbraunen Burschen verguckt. So ließ er sich ausbilden und stellte mit Verwunderung fest, wie talentiert er sich dabei anstellte. In den Eifelwäldern hatte sich der Klimawandel auf eine unschöne Weise bemerkbar gemacht. Ganze Bergrücken bestanden nur noch aus braunen Fichten. Eine ideale Arbeitsstätte für Mini, der bodenschonender als jede Maschine größere Äste und Stämme auf die Wege oder zum Polterplatz ziehen konnte. Peter achtete dabei penibel darauf, Mini nicht zu überfordern, gestattete ihm viel mehr Pausen, als es vorgeschrieben war. Außerdem setzte er ihn maßvoll ein, selbst wenn Peter dann weniger verdiente. Mini dankte ihm seine Fürsorge mit einer großen Zutraulichkeit, die jeden verwunderte, vor allem wenn Peter erzählte, dass er mit Mini seinen ersten Kaltblüter besaß.
Vor drei Tagen waren die beiden in einem Waldstück in unmittelbarer Nähe der Landesgrenze beschäftigt gewesen. Die Arbeit war nicht schwer, das Gelände hügelig, aber keineswegs gefährlich steil. Ein Harvester hätte hier problemlos eingesetzt werden können, doch Julian Weidemann, der Waldpächter, war darauf bedacht, die Böden zu schonen, denn schweres Gerät verdichtete sie auf Jahre. Regenwasser würde nicht eindringen, sondern ablaufen und ins Tal stürzen, was Überschwemmungen mit sich brächte. Julian Weidemann hatte bislang noch nicht mit Peter und Mini zusammengearbeitet. Ihm waren die beiden von einem anderen Waldbauern empfohlen worden. Peter wiederum kannte Weidemann nur flüchtig. Auch war ihm dieser Teil des weitläufigen Waldgebietes fremd, und als er sich fragte, warum eigentlich, fiel ihm das Verbot seines Vaters ein, der ihm und seiner Schwester Alexandra untersagt hatte, auch nur einen Fuß in diesen Wald zu setzen. Peter erinnerte sich noch gut daran, seinen Vater damals nach den Gründen gefragt zu haben. Doch eine Antwort war ihm dieser schuldig geblieben. Peters Neugier war damit erst so richtig entfacht worden, aber da er gespürt hatte, wie wichtig es seinem Vater gewesen war, hatte er sich an diese Anweisung gehalten, zumal er ohnehin an anderen Orten lieber gespielt hatte und für dieses verbotene Abenteuer einen zeitintensiven Umweg hätte in Kauf nehmen müssen. So war die Angelegenheit bald schon wieder vergessen.
Die Arbeit auf dem neuen Territorium war nicht schwer, aber kniffelig, wie so oft, denn um zu den abgesägten Stämmen zu gelangen, mussten sie tief ins Unterholz vordringen. Nach den ersten Durchgängen machten sie etwas abseits der Rückegasse eine Pause. Peter setzte sich auf einen Findling, der ihm hier an dieser Stelle ein wenig fehl am Platze vorkam. Er trank einen Schluck Wasser aus seiner Aluflasche und entdeckte an seinem Oberarm eine Zecke, die er mit dem Zeigefinger wegschnippte. Mini scharrte mit einem Vorderhuf im Boden. Zunächst achtete Peter nicht weiter darauf, doch plötzlich blieb sein Blick an etwas Undefinierbarem hängen. Er stellte die Wasserflasche auf den Stein und sah sich das, was Mini da aus dem Erdreich ans Tageslicht befördert hatte, genauer an. Zunächst hielt er den Knochen noch für den eines größeren Säugetieres. Doch diese Annahme wich der Gewissheit, dass es sich um menschliche Überreste handelte. Er brachte Mini dazu, von der Stelle abzulassen, und inspizierte den Fund eingehender. Wenn er ihn mit der Länge seines Oberarmes verglich, war eine Übereinstimmung mit der menschlichen Anatomie nicht von der Hand zu weisen. Peter dachte kurz an einen Arbeitsunfall, aber wer verlor dabei schon einen vollständigen Armknochen im Wald? Er überlegte, ob er möglicherweise auf die Überreste eines Römers gestoßen war, denn hier in der Gegend standen noch einige römische Villen und unweit von hier die Reste einer römischen Straße. Aber wie wäre nach so langer Zeit der Erhaltungszustand des Knochens? Gab es an dieser Stelle noch mehr davon? Peter wurde es ganz seltsam ums Herz.
Er musste den Fund unverzüglich melden und rief den Waldpächter an, der sich in der Nähe aufhielt und wenig später bei ihm eintraf.
»Das ist unglaublich«, sagte Julian Weidemann sichtlich geschockt, als er den Knochen betrachtete.
»Ob da im Erdreich ein Mensch liegt?«, fragte Peter. Er blickte auf den Findling und dachte, dass dieser vielleicht als Markierung hierher verbracht worden war. Als Grabstein möglicherweise, kam ihm der Gedanke.
Julian Weidemann schüttelte den Kopf, aber wohl nicht, weil er damit auf Peters Frage einging.
»Das gibt Probleme«, sagte er.
Er überlegte noch einige Augenblicke, bevor er zum Telefon griff und die Polizei verständigte.
Bis die Polizei am Fundort auftauchte, verstrich eine Stunde, in der die beiden Männer kaum ein Wort miteinander sprachen. Und Mini begann, sich zu langweilen. Doch sie konnten unmöglich weiterarbeiten. Welche Spuren würden sie zerstören, wenn hier vielleicht ein Verbrechen vorlag? Aber dieses musste bereits einige Zeit zurückliegen, wenn man den Zustand des aufgefundenen Knochens in Betracht zog.
Nachdem Peter den Beamten berichtet hatte, wie er den menschlichen Überrest entdeckt hatte, entließen sie ihn nach Hause. Er verständigte sich mit Julian Weidemann darauf, morgen weiterzuarbeiten. Ob sich im Boden tatsächlich ein komplettes menschliches Skelett verbarg, wusste er zu dem Zeitpunkt noch nicht, als er seiner Mutter aufgeregt von dem ungewöhnlichen Fund im Wald erzählte. Bereits am folgenden Tag erfuhr er mehr. Julian Weidemann sagte am Telefon, dass die Spurensicherung nach und nach weitere Knochen geborgen und in die Gerichtsmedizin hatte bringen lassen. Soviel man derzeit wusste, handelte es sich nicht um einen Fund aus grauer Vorzeit. Ein Verbrechen also, schlussfolgerte nicht nur Peter. Auch der Waldpächter war derselben Ansicht. »Und das in meinem Wald«, seufzte er. »Wir arbeiten heute nicht, ich muss das erst einmal sacken lassen«, sagte Weidemann, bevor er das Telefonat beendete. Peter hatte das Gespräch in der Wohnstube des Hofes geführt. Im Beisein seiner Mutter. Diese verschwand daraufhin wortlos in ihrem Schlafzimmer. Peter wusste nicht, was er mit dem Tag anfangen sollte, und begann einige längst überfällige Reparaturen im Haus durchzuführen. Aus einem unerfindlichen Grund scheute er sich davor, nach seiner Mutter zu sehen. Er ging dennoch zur Tür ihres Zimmers, hörte sie darin und beschloss, das Mittagessen vorzubereiten. Er schälte Kartoffeln, brachte Wasser zum Kochen, stellte die Flamme klein, entnahm aus dem Kühlschrank Reste des Bratens vom Vortag und raspelte eine Gurke, zu der er ein Dressing bereitete. Die Kartoffeln waren längst gar, als seine Mutter plötzlich in der Tür stand. Ihre braunen Haare, die einige wenige graue Strähnen durchzogen, fielen auf ihre Schultern. Ein Anblick, der allein ihm schon den Atem raubte, hatte er seine Mutter doch in den letzten Jahren nur mit streng zurückgekämmten und zu einem Dutt zusammengefassten Haaren gesehen. Dazu trug sie eine hellblaue Bluse mit einem dezenten Blumenmuster. Es war jenes Kleidungsstück, das Alexandra ihr vor einigen Monaten zu ihrem sechzigsten Geburtstag geschenkt hatte. Getragen hatte seine Mutter diese seither kein einziges Mal.
»Ich fahre einkaufen«, sagte sie.
»Mitten am Tag? Willst du nichts essen?«
»Ich fahre nach Adenau.«
»Heute ist doch kein Markt«, gab Peter zu bedenken.
»Mach’s gut, mein Junge«, sagte sie, ohne auf Peters Bemerkungen einzugehen.
Er folgte ihr in einiger Entfernung und blieb in der offenen Haustür stehen. Er beobachtete, wie sie das Garagentor öffnete und ihren Kleinwagen herausfuhr, den sie ab und an nutzte, um Besorgungen zu erledigen, vor allem wenn sie Sonderwünsche der Feriengäste zu erfüllen hatte. Sie war nie lange weggeblieben. Aber das lag vor allem daran, dass sie gewohnheitsmäßig nur ins nahe gelegene Blankenheim fuhr, nicht aber ins weiter entfernte Adenau im Nachbarkreis.
Nachdenklich aß Peter zu Mittag, packte die übrig gebliebenen Reste in eine Frischhaltebox und legte sie in den Kühlschrank. Wenn seine Mutter später nach Hause kam, hatte sie bestimmt Hunger. Den Nachmittag verbrachte er damit, eine der Ferienwohnungen zu reinigen und herzurichten. Am Wochenende würden neue Gäste eintreffen. Danach schaute er nach Mini und den anderen Tieren, die er bereits am frühen Morgen gut versorgt hatte. Seit der Abfahrt seiner Mutter hatte Peter ungefähr jede halbe, manchmal sogar jede Viertelstunde auf seine Armbanduhr geschaut. Jetzt war es beinahe halb sieben, und von seiner Mutter gab es immer noch kein Lebenszeichen. Sie war bereits seit über sechs Stunden fort. So lange wie noch nie. Peter wurde unruhig, doch er konnte nichts weiter tun, als zu warten, denn seine Mutter besaß kein Handy, auf dem er sie hätte erreichen können. Er überlegte, ob sie jemanden in Adenau kannte, doch ihm fiel einfach niemand ein. Eine alte Freundin vielleicht? Peter war versucht, in ihrem Schlafzimmer nach einem Hinweis zu suchen. Doch was erhoffte er sich, dort zu finden? Am Telefon, das auf einem Eichenholztischchen in der Diele stand, lag ein altes Adressverzeichnis. Dieses existierte, solange er denken konnte. Peter blätterte es durch, sah Namen, die durchgestrichen waren, entdeckte Telefonnummern, die mehrfach geändert worden waren. Hinter so mancher Adresse prangte ein großes Fragezeichen. Die meisten Einträge stammten noch von seinem Vater. Die unverkennbar zarte Handschrift seiner Mutter war nicht oft vertreten. Unter dem Buchstaben »E« fand sich eine ganz neue Erwähnung:
»Manfred Effert, Ortschronist Aremberg.«