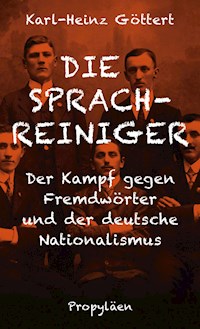12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Die umfassende Bestandsaufnahme der Rolle der deutschen Sprache in der Welt! Wie steht es um die deutsche Sprache? Wird sie zunehmend von englischen Ausdrücken dominiert? Verliert sie an Einfluss in der Welt und der Wissenschaft? Welche Rolle spielt sie in Europa und den europäischen Institutionen? Wie wichtig ist Deutsch für die Wirtschaft? Welche Sprachpolitik ist sinnvoll? Karl-Heinz Göttert unternimmt eine umfassende Bestandsaufnahme des Deutschen: Historisch informiert, politisch engagiert und unter Rückgriff auf Zahlen und Fakten beantwortet er alle Fragen rund um die Stellung des Deutschen in Zeiten der Globalisierung – und ganz besonders die eine: Müssen wir uns Sorgen machen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 476
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Karl-Heinz Göttert
Abschied von Mutter Sprache
Deutsch in Zeiten der Globalisierung
FISCHER E-Books
Inhalt
Vorbemerkung: Zweimal 19. Jahrhundert
Weltzeit und Eisenbahnspurbreiten
Im Jahre 2008 veröffentlichte die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) eine repräsentative Umfrage zum Thema »Wie denken die Deutschen über ihre Muttersprache und über Fremdsprachen?« Die Antwort auf die allerletzte Frage hat mich wie keine sonst erstaunt. Es ging um Bejahung oder Ablehnung einer Einheitssprache für die Länder der EU. Wie viel Prozent würden zustimmen und damit die Verdrängung sämtlicher Sprachen außer einer befürworten? Ich tippte auf höchstens ein oder zwei und die auch noch womöglich als Folge eines Missverständnisses: Vielleicht dachte man an die Verwendung einer einzigen Sprache in den Institutionen der EU. Aber nein, die Frage war eindeutig formuliert und die Antwort fiel so hoch aus, dass man bloße Missverständnisse ausschließen kann. Ganze 13 Prozent votierten für eine europäische Einheitssprache, 11 Prozent davon für Englisch, 2 Prozent für Deutsch. Und dann kamen auch noch 9 Prozent Unentschiedene hinzu. Für den Erhalt der Sprachen stimmten also 78 Prozent – 22 Prozent, fast ein Viertel, konnte sich demnach ein einsprachiges Europa vorstellen oder wäre nicht davon schockiert gewesen. Spiegelt sich darin ein Trend, den kaum jemand bemerkt? Gehen wir wirklich auf ein einsprachiges Europa zu, was ja wohl bedeutet: ein Englisch sprechendes Europa? Wird Deutsch an den Rand gedrängt, zum bemitleidenswerten Dialekt verkümmern oder gar aussterben?
Natürlich kennt niemand die Zukunft. Und natürlich können sich Einstellungen ändern. Aber so viel steht fest: Es gibt seit längerem einen weltweiten Trend zu mehr Einheit, zu mehr Vereinheitlichung. Nehmen wir die Weltzeit. Wer sich heute in ein Flugzeug setzt und nach Japan fliegt, stellt entspannt seine Uhr 7 Stunden vor und lebt bei seiner Ankunft 13 Stunden später in Ortszeit. Seit wann eigentlich? Seit der internationalen Meridiankonferenz 1884 in Washington. Damals wurden die 24 Zeitzonen à 15 Längengraden mit Nullmeridian in Greenwich beschlossen und weltweit rasch angenommen. In Deutschland sprach sich Generalfeldmarschall von Moltke im Reichstag aus militärischen Gründen dafür aus. Frankreich übernahm die standard time erst 1911, als sich der Standort der Pariser Sternwarte als Nullmeridian nicht länger verteidigen ließ. Auch Indien hatte trotz stärksten britischen Drucks lange die kulturelle Eigenzeit verteidigt. Greenwich profitierte (gegenüber etwa dem als »neutral« gehandelten Jerusalem) davon, dass es traditionell in der Seefahrt und von daher im amerikanischen Eisenbahnverkehr benutzt wurde. Die weltweite Verbreitung war zuletzt so einhellig, dass Frankreich nicht einmal das vorgeschlagene Geschäft durchsetzen konnte: die Anerkennung von Greenwich gegen die britische Übernahme der französischen Maße und Gewichte.
Oder nehmen wir das noch einschlägigere Beispiel von Vereinheitlichung: die Kalenderreform. Der julianische Kalender, den einst (Julius) Cäsar durchgesetzt hatte, war nicht perfekt gewesen, das Jahr etwas mehr als 11 Minuten zu lang geraten. Papst Gregor XIII. entschloss sich nach vielen Vorgefechten seit dem 13. Jahrhundert zur (gregorianischen) Reform, indem er 1582 vom Donnerstag, dem 4., auf Freitag, den 15. Oktober überging und den 1. Januar als Jahresbeginn festlegte. Die katholischen Länder machten sofort mit, 1700 folgte auch das protestantische Deutschland, dann Dänemark samt Färöer-Inseln und Island sowie die protestantischen Niederlande. Großbritannien schloss sich mit seinen Kolonien 1752 an, Finnland und Schweden 1753, im 18. Jahrhundert gab es die letzten Nachzügler von katholischen Staaten bzw. Stadtstaaten wie Florenz und Pisa. Damit bot zunächst Europa ein einheitliches Bild, wenn man vom kurzfristigen Ausscheren Frankreichs 1793–1806 und Italiens von 1922–1943 absieht. 1872 stellte Japan um, China 1912, Russland 1918 (weshalb die Oktoberrevolution von 1917 nach dem eigenen, nämlich julianischen Kalender auf den 8. November fiel), Jugoslawien 1919, Rumänien 1920, Griechenland 1923, die Türkei 1927, Ägypten 1928. Das letzte große Ausscheren fand in der Sowjetunion 1929–1940 statt. Inzwischen aber hat die Welt ihren einheitlichen Kalender, neben dem die überkommenen Kalender nur noch einen Sonderstatus mit religiösem oder kulturellem Hintergrund besitzen. Seither können sich Menschen auf dieser Welt mit jedem anderen verabreden, ohne Gefahr zu laufen, mit dem Datum Verwirrung zu stiften.
Wer will, kann die Geschichte der Vereinheitlichungen in Jürgen Osterhammels Buch Die Verwandlung der Welt weiter studieren, zum Beispiel beim Postwesen oder den Eisenbahnspurbreiten, eingerichtet wie Weltzeit und Kalender im Wesentlichen im 19. Jahrhundert. Und schon erscheinen die eben zitierten 13 Prozent bei der Befürwortung eines einsprachigen Europa irgendwie anders. Sie liegen tatsächlich in einem Trend. Auf die Zunahme von Komplexität hat die Reduzierung von Komplexität geantwortet, gegen die Vielfalt half Vereinheitlichung. Dies gilt jedenfalls für den Verkehr. Wer sich mit der Kutsche oder zu Fuß durch die Lande bewegte, konnte verschiedene Einteilungen der Zeit oder des Kalenders verkraften. Mit Zügen und später Flugzeugen war das anders. Jetzt drohte der Zusammenbruch des Systems. Und mit den Sprachen? Stellen sie nicht ebenso ein Hindernis des Verkehrs dar, nur eben des kommunikativen? Wäre es nicht praktischer, wenn alle eine einzige Sprache sprächen? Und könnten nicht die Bedenken verfliegen, die vielen Sprachen zur nostalgischen Erinnerung werden wie die alten Kalender oder unterschiedlichen Meridiane? Sind die Sprachen etwa nur die Nachzügler der großen Einheit, die das 19. Jahrhundert irgendwie vergessen hat und die das 21. Jahrhundert nun nachholt? Ist die Einheitssprache vielleicht überhaupt der letzte Schritt zu einer Welt, die nach einigem Vorgeplänkel im 19. Jahrhundert endgültig beschlossen hat, sich vom Kult bornierter Eigenbrötelei zu verabschieden und funktionierender Homogenität den Vorzug zu geben?
Abstammung und Narzissmus
Wer solche Fragen mit einem Nein beantwortet, muss das Nein gut begründen. Nicht dass es keine Einwände gegen die Einheitssprache gäbe. Im Gegenteil: Wo vom Vorrücken des Englischen die Rede ist, herrscht in der Regel blankes Entsetzen. Das gehobene Feuilleton war in diesem Punkt von Anfang an konservativ, pflegte einen auflagensteigernden Alarmismus. Weil sich die für Sprachfragen zuständige Wissenschaft der Linguistik zurückhielt, traten Sprachpfleger als selbsternannte Sheriffs auf den Plan, die im Eindringen allein schon von Anglizismen die Vorboten des drohenden Untergangs witterten. In den großen Institutionen des Goethe-Instituts, des Deutschen Akademischen Austauschdiensts, des Instituts für Deutsche Sprache, der Gesellschaft für Deutsche Sprache wurden hektisch Tagungen organisiert, deren Verlautbarungen sich inzwischen zu Papiertürmen stapeln. Dabei war die Diskussion oft zwiespältig, schwankte zwischen konservativen und liberalen Positionen, zwischen deutlicher Abwehr alles Englischen als der Sprache der Vereinnahmung bzw. des Einerleis und einem Plädoyer für vorsichtige oder auch uneingeschränkte Öffnung. Mit der Angst vor einem Bedeutungsverlust der deutschen Sprache aber ging die vor einem Bedeutungsverlust Deutschlands einher. Von einem Paradies der Einsprachigkeit träumen vielleicht immer noch 13 Prozent. Dazu kommen Unentschiedene. Dem großen Rest graut vor Einsprachigkeit, seine Vertreter blasen bei entzündbarem Temperament zum linguistischen Bürgerkrieg, um die nationale Würde Deutschlands zu verteidigen.
Was aber steht hinter diesen Vorstellungen? Die Antwort lautet: ebenfalls das 19. Jahrhundert. Denn das 19. Jahrhundert war nicht nur die Zeit der beginnenden Globalisierung (mit der Tendenz der Vereinheitlichung). Es war auch das Jahrhundert des Nationalismus (mit der Tendenz der Abgrenzung). Während an gemeinsamem Kalender und gemeinsamen Eisenbahnspurbreiten gearbeitet wurde, entwickelte sich eine Doktrin von der Nation als Abstammungsgemeinschaft, die ihre Gemeinsamkeit auf keine Weise besser belegen kann als mit der gemeinsamen Sprache. Während im Mittelalter und auch noch in der frühen Neuzeit die Menschen in der Religion und der Bindung an Herrscherhäuser ihre Einheit fanden, traten nun Territorien und ihre Sprachen an deren Stelle. Die Welt wurde nicht nur immer einheitlicher, sie wurde auch immer narzisstischer. Der Aufklärung mit ihrem Humanismus und Kosmopolitismus, gestützt auf Einheitssprachen wie Latein und Französisch, folgte eine Romantik, die im je eigenen »Volk« nach den Kräften der Integration suchte und die je eigene »Volkssprache« gegen das einheitliche Idiom der Gelehrten ausspielte. Statt einer Gleichgültigkeit gegenüber den Sprachen, die noch kaum als wirkliche Einheitssprachen im eigenen Land ausgebildet waren, herrschte Bewunderung und die Erwartung eines Quells von Wissen und Wahrheit. Wer einer Nation die »Größe« ihrer Sprache absprach, erzeugte das Gefühl der Demütigung, der Wut. Ohne Festhalten an der Sprache, so die Überzeugung, gehe das Land unter.
Würde es das wirklich? Natürlich kann kein Land existieren, in dem die Kommunikation nicht funktioniert. Aber man merkt auch, dass wir uns von einigen Voraussetzungen dieser Forderung im Augenblick in großen Schritten entfernen. Moderne Nationen sind jedenfalls nicht mehr als Vaterländer in dem Sinne konstruiert, dass sie auf einer Abstammungsgemeinschaft beruhen. Nationen beziehen ihre Einheit eher aus der Zusammenarbeit der Beteiligten, wo immer sie herkommen. Der Nationalstaat moderner Prägung versteht sich als republikanisches Projekt, wie es besonders eindrucksvoll in den Vereinigten Staaten als »amerikanischer Traum« bei Wahlen regelmäßig die Rhetorik bestimmt. Und es gibt ebenfalls keine Nationen mehr, die (wenn auch nur als Ideal) eine einzige Muttersprache benutzen. In Deutschland werden zurzeit weit über 100 Sprachen gesprochen. Die biologistische Auffassung einer Verbindung von Vaterland und Muttersprache als Vater Land und Mutter Sprache ist hoffnungslos veraltet, trifft die Lebenswirklichkeit nicht mehr. Diese neuen Nationen bleiben mit ihrer sprachlichen Vielfalt im Übrigen nicht allein, sondern setzen sich mit neuer sprachlicher Vielfalt auf der nächsten Ebene auseinander. Neben der nationalen Identität zeichnet sich in unsern Regionen trotz aller Krisen, Kehrtwenden oder Rückfälle eine europäische ab. Welche Rollen sollen oder können dabei die Sprachen spielen? Gibt es eine europäische Identität nur mit einer einzigen Sprache so wie bei den einzelnen Nationen? Oder muss man nicht ohnehin die EU anders konstruieren als einen Nationalstaat?
Kein Wunder, dass die Sprachenfrage bei diesen Schwierigkeiten zum Tabu wird. In der EU, jedenfalls für die internen Belange, lautet seit langem die Devise: Nicht daran rühren. Die Engländer tun es nicht, weil sie ohnehin am meisten von der Dominanz ihrer Sprache profitieren. Und die Deutschen tun es nur nach Neuwahlen, wenn der Außenminister den rituellen Brief mit Bitte um verstärkte Berücksichtigung des Deutschen schreibt. So ist es auch sonst. Die Wirtschaft richtet sich auf die jeweiligen Verhältnisse ein und spricht die Sprache, die Erfolg bringt. Die Wissenschaft macht es genauso, überall werden Wege gefunden, um den kommunikativen Kollaps abzuwenden. Häufig schlägt es zur Weltsprache hin aus. Eine Regel ist nicht erkennbar, es sei denn, die Regel heißt: Pragmatismus, um nicht zu sagen: Durchwursteln. Eine merkwürdige Situation also: Auf der einen Seite das Zündeln mit dem Ende der Sprachenvielfalt, belegt in fast einem Viertel Zustimmung oder wenigstens Gleichgültigkeit und weiter belegt im unterschwelligen Wunsch geplagter Praktiker. Und auf der anderen Seite eine überschäumende Verteidigung mit dem Pathos des Gralswächtertums, der Entschlossenheit des letzten Gefechts.
Ziele dieses Buches
Geht es auch anders? Davon handelt dieses Buch. Es stellt die Frage, wie es zu den unterschiedlichen Auffassungen gekommen ist und wie man sie überwinden kann. Viel hängt davon ab, wieweit sich unsere Idee vom Nationalstaat von Traditionen des 19. Jahrhunderts befreien kann. Vielleicht ist überhaupt die Sprachenfrage der große Test auf die Fähigkeit der europäischen Nationen, sich vom überkommenen ethnischen Denken zu lösen und ihr Selbstbewusstsein auf andere oder weitere Voraussetzungen zu gründen als auf die gemeinsame Sprache. Bei Olympischen Spielen zeigen junge Sportler aller Nationen in Interviews, wie mit der Beherrschung der Weltsprache ein beträchtlicher Nationalstolz einhergeht. Warum also Sprachenvielfalt und Weltsprache in einen Gegensatz bringen, der den gegenwärtigen Weltverhältnissen krass zuwiderläuft? Warum geht nicht ein Sowohl-als-auch statt Entweder-oder, wenn die Verwendung und Entwicklung der Sprachen diskutiert wird? Warum kann man nicht das Richtige und Unverzichtbare am 19. Jahrhundert, die Nationenbildung mit ihrer Lösung für die sozialen, wirtschaftlichen und auch sprachlichen Probleme im Inneren, und die große Tendenz zur Zusammenarbeit in der Welt kombinieren? Es spricht bei Lichte betrachtet nichts dafür, dass Europa einsprachig wird, dass Englisch die anderen Sprachen einschließlich des Deutschen verschlingt. Es spricht aber auch nichts dafür, dass wir es uns in unsern Traditionen bequem machen und so tun, als könnten wir den Weltlauf mit pausbäckigen Sprüchen aufhalten.
Sowohl als auch also. Woher kommen da die Argumente? Man muss sie nicht lange suchen, sie liegen vor. Man kann sich heute detailliert informieren über die Sprachen in der Welt und in Deutschland sowie über die Frage, wie es um »Chancen« und »Probleme« steht. Man kann nachlesen, wie bei uns und den andern Sprach- bzw. Sprachenpolitik gemacht wurde und gemacht wird. Allein zu den Anglizismen gibt es eine breite linguistische Forschung, die über vermeintliche Gefahren und normale Vorgänge unterrichtet. Zur internationalen Stellung der deutschen Sprache haben Sprachsoziologen reiches Material angehäuft und ausgewertet. Wir wissen, wie sich das Deutsche behauptet und wo es mit der Weltsprache Englisch kollidiert. Genauso sind wir über das Fortschreiten des Englischen in den (Natur)wissenschaften im Bilde, wo wir es mit dem ersten und wichtigsten Fall einer wirklichen Internationalisierung samt Umstellung auf die Weltsprache zu tun haben. Wer sich für Sprachenfragen in den Institutionen der EU interessiert, braucht nur etwa das Europäische Dokumentationszentrum der Kölner Universitätsbibliothek zu besuchen. Auch die Diskussion über ein mehrsprachiges Europa der Bürger jenseits nationalistischer Verengungen ist in der Politikwissenschaft weit fortgeschritten.
Das Wissen über die Sprachenfrage, so möchte ich resümieren, ist auf vielen Einzelfeldern da. Aber es muss auch benutzt werden, statt sich in unfruchtbaren Behauptungen zu verzetteln oder überholten Illusionen nachzulaufen. Ich möchte etwas über diese Lösungen vor- bzw. zusammentragen, auch dem Unergiebigen nachgehen, soweit es für zukünftige Lösungen lehrreich ist. Dabei handelt es sich um viel Forschung in Büchern, Sammelbänden, Zeitschriften, teilweise von Tagungen, an denen ich selbst aktiv teilgenommen habe. Ich möchte gelegentlich auch meinen eigenen Lernprozess einbeziehen, Hinweise auf Gelesenes geben, das mir als wichtige Anregung diente oder neue Blicke auftat. Dabei bezieht sich dieses Lernen am meisten auf das Sowohl-als-auch. Nicht nur Politiker und Journalisten bejubeln lieber eindeutige Entscheidungen. Muskulöse Rhetorik in Form von Jeremiaden über den Untergang oder heroische Rechthaberei beim Durchschlagen des Gordischen Knotens finden trotz eines bekannten und beliebten Bibelworts über das, was dem Kaiser, und das, was Gott zusteht, eher Zustimmung als Versuche des Abwägens. Aber auf Abwägen kommt es in diesem Fall an. Nationalsprache und Weltsprache lassen sich nur um den Preis überzogener Ansprüche vereinseitigen, nur mit dem Aufwärmen fundamentalistischer und längst widerlegter Klischees gegeneinander ausspielen. Nationalsprache und Weltsprache sind beide da und haben beide ihr Recht. Wo genau und wie im Einzelnen – das ist die einzig spannende Frage.
Kapitel 1 Zahlen und Zeiten
Sprachen in der Welt
Von Sprachenzählen und Sprachensterben
Man kann nur staunen, dass es Forscher gibt, die sich tatsächlich die Sprachen der Welt als Thema vornehmen – alle Sprachen. In Deutschland ist es Harald Haarmann, der dazu eine Reihe von Büchern geschrieben hat, in denen das Datenmaterial aufbereitet und kommentiert ist. Wie viele Sprachen kommen danach zusammen? Haarmann zählte im Jahre 2001 bei knapp 200 (in der UNO vertretenen) Staaten 6417. Wer zum Vergleich den aktuellen UNESCO Atlas oft he World’s Languages in Danger aufschlägt, der im Netz leicht zugänglich ist und sogar eine interaktive Version enthält, stößt auf ca. 2500. Durch die Literatur geistern noch andere Zahlen. Hat sich hier jemand verrechnet oder über- bzw. untertrieben? Die Unterschiede erklären sich anders. Sie beruhen darauf, dass oft unklar bleibt, ob eine »Sprache« als selbständig gilt oder als Dialekt einer größeren zu fassen ist. In Indien beispielsweise wurden 19711652 Sprachen angegeben, 20 Jahre später nur noch 418. Woran liegt es? Daran, dass zum Beispiel Hindi in der einen Liste als eine einzige Sprache auftaucht, in der anderen in Dutzende »Dialekte« aufgesplittert ist, die sich tatsächlich sehr viel mehr unterscheiden als bei uns etwa Schwäbisch und Sächsisch. Auch bei den Benennungen gibt es Probleme. Für die mehr als 6000 Sprachen existieren ca. 4000 verschiedene Namen – reichlich Möglichkeiten für Überschneidungen oder Verwechslungen.
Interessanter als die »richtige« Zählung ist ohnehin etwas anderes. Aus europäischer Sicht stellen wir uns Sprachen in einer irgendwie normalen regionalen und quantitativen Verbreitung vor und denken an Französisch, Englisch, Italienisch oder unser Deutsch. In der Welt sieht es aber anders aus. Die meisten Sprachen werden von nur wenigen Tausend gesprochen, nur gerade einmal 300 sind Millionensprachen. Und dann kommen erst die Klein- und Kleinstsprachen. In Papua-Neuguinea gab es 1996 bei gut vier Millionen Einwohnern drei Amtssprachen (Englisch, Tok Pisin und Motu), aber insgesamt 826 Klein- und Kleinstsprachen. Haarmann listet sie penibel auf, und zwar nach Sprechergruppen von 900–1000, 800–900 und so fort bis zehn und weniger (mit fünf Fällen), dazu noch neun ausgestorbene Sprachen. In Australien, nach Haarmann dem größten »Sprachenfriedhof« der Welt, beträgt die Gruppe der Sprachen mit zehn und weniger Sprechern 105, bei einer langen Liste von Sprachen mit nur noch einem einzigen Sprecher (als ausgestorben sind 32 angegeben).
Wer diese Zahlen liest, wird leicht Prognosen trauen, die den »Sprachentod« in gigantische Höhen treiben. 90 Prozent sollen es noch in diesem Jahrhundert sein, angetrieben von der Globalisierung im Allgemeinen und der Weltsprache Englisch im Besonderen. Der Tod letzter Sprecher ist den Zeitungen oft eine Meldung wert, verbunden mit der untergründigen Frage, wann auch wir so weit sind. Einmal abgesehen vom baren Unsinn dieser rein der Sensationslust geschuldeten Unterstellung (bei derzeit mehr als 100 Millionen deutschen Muttersprachlern), legen unvoreingenommene Beobachtungen etwas anderes nahe. Gewiss, Sprachen sterben, nach Haarmann könnten es im 21. Jahrhundert tatsächlich 40 Prozent sein, darunter natürlich besonders jene Kleinstsprachen mit wenigen oder nur einem einzigen Sprecher, der sich tatsächlich nur noch mit seinen Ahnen unterhalten kann.
Aber Sprachen sterben nicht nach abstrakten statistischen Gesetzen. Nicht nur, dass totgesagte Sprachen wiederbelebt wurden wie etwa das zuletzt nur noch rituelle Sanskrit in Indien (das nun sogar in Filmen verwendet wird) oder das Hebräische als das moderne Hevrit in Israel. Die Sprachenpolitik von Großmächten, die so häufig in der Geschichte auf Nivellierung und Verdrängung aus war, ist häufig auch gescheitert. Die Sowjetunion etwa, um ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit zu nehmen, betrieb eine systematische Sprachenplanung angesichts der zahlreichen Sprachen in ihren asiatischen Teilen. 1970 sprachen 41,8 Prozent ihrer Bürger Russisch als Zweitsprache, neun Jahre später bereits 61,2 Millionen. Aber ein Land wie Kasachstan, in dem Russisch erste Amtssprache war, hat sofort nach der Perestroika das Ruder herumgeworfen. Nach dem Zerfall des Warschauer Paktes regten sich überall die lokalen Sprachen und fanden zurück zur Verwendung als alleinige Amtssprachen (wie etwa in Estland).
Ein anderer Wettstreit beim Eurovision Song Contest
Die Globalisierung, das ist die wichtige Botschaft, tendiert zur Vereinheitlichung, fördert die eine Weltsprache Englisch. Aber die Globalisierung erzeugt auch einen gegenläufigen Trend: die Regionalisierung, die sich sprachlich als Selbstbehauptung äußert und dazu die Sprache als ein Merkmal oder Symbol benutzt. Dies geht so weit, dass neue Sprachen entstehen wie im Falle des Serbischen und Kroatischen. Hier schrieben die Serben lange Zeit das gemeinsame Serbokroatisch lediglich in kyrillischer (russischer) Schrift, die Kroaten in lateinischer. Heute sind daraus zwei verschiedene Sprachen entstanden oder befinden sich in der Auseinanderentwicklung. Kein Zweifel, dass sich damit Tendenzen des 19. Jahrhunderts auch im 21. wiederholen, dass sich hier Vaterländer und Muttersprachen zur Einheit verbinden, Sprachen also wieder einmal oder immer noch Politik machen. Und es gibt sogar das noch bedrohlichere Erbe des 19. Jahrhunderts, den (auch) durch Sprachen bedingten Krieg, wie wir ihn im Kosovo kennengelernt haben. Die hier lebenden Albaner waren von der serbischen Sprache dominiert, so dass Albanisch zum Symbol des Widerstands wurde.
Welche Folgerungen soll man daraus für die Sprachenvielfalt in der Welt ziehen? Sind die vielen Sprachen ein Hindernis für ein Zusammenleben, ein Keim von Konflikten? Im Extremfall ja, aber es gibt auch andere Antworten auf das Problem. Im ehemaligen sowjetischen Machtbereich ist man von Unterdrückung zu vorsichtiger Förderung übergegangen. Ein anderes Beispiel wäre Australien, wo ebenfalls eine Politik der Dominierung der indigenen Sprachen von einer Politik ihrer Anerkennung und Unterstützung abgelöst wurde. Die Sprache der Aborigines wird mittlerweile in den Schulen unterrichtet. Haarmann berichtet vom Extremfall des Saamischen (der sogenannten »Eskimos«) als einer Kleinsprache im Norden Europas, die in der finnischen Provinz Lappland bei 2400 Sprechern Amtssprachenstatus genießt und (weltweit einmalig) bei schriftlichen Zulassungsprüfungen an Universitäten verwendet werden darf. Auch die Abstimmung der Schweizer über die Anerkennung des (dem Lateinischen nahestehenden) Rätoromanischen im Jahre 1938 als vierte Amtssprache gehört zu diesem offenbar weltweiten Trend einer Anerkennung von Sprachen in Analogie zu den Menschenrechten.
Die Sprachenvielfalt – so ließe sich zusammenfassen – ist ein Faktum, das auf absehbare Zeit unsere Welt prägen wird. Die Konsequenzen daraus sind unterschiedlich, sie reichen vom Sprachenkampf bis zu Anerkennung und Förderung. Auf jeden Fall ist die Welt vielsprachig und sucht Lösungen für diese Vielsprachigkeit. Der eine Megatrend liegt in der Annäherung der Sprecher in Form einer Entscheidung für Zweisprachigkeit, in der Regel für das Erlernen der Lingua franca oder Brückensprache Englisch. Der andere Megatrend liegt in der Behauptung der je eigenen Sprache als Begründung von Identität, von lokaler Kultur, die das Sozialverhalten steuert und künstlerische Kreativität fördert. Beim Eurovision Song Contest 2012 in Baku (Aserbaidschan) konnte man nicht nur den Wettkampf der Sängerinnen und Sänger, sondern auch den zwischen den beiden Megatrends beobachten. Der erste Platz ging an die Schweden, die wie die meisten Kandidaten (auch die deutschen) auf Englisch sangen. Den zweiten Preis aber heimsten die Buranowskije Babuschki ein, die Großmütter aus Buranowo in Udmurtien westlich des Ural, die ihre vom Aussterben bedrohte finno-ugrische Sprache nicht nur benutzten, sondern mit dieser Benutzung für sie warben. 120 Millionen hatten das Ereignis am Bildschirm verfolgt und abgestimmt. Die größere Verbreitung genießt zweifellos der erste Megatrend, die größere Sympathie aber gehört ebenso zweifellos dem zweiten.
Sprachen in Deutschland
Zahlen vom Statistischen Bundesamt
Man kann es auch so sagen: Die vielen Sprachen stören und sind doch unverzichtbar. Wie löst man das Dilemma?
Schauen wir uns dazu einige Fakten in unserer direkten Umgebung an. Gut, die Welt ist vielsprachig, in fernen Kontinenten vor allem. Schon in Europa sieht es besser aus, auch wenn man über die vielen Sprachen etwa im Balkan einmal hinwegsieht, die die Gesamtzahl in Europa nach Haarmann immerhin auf 143 hinauftreiben (anderswo rechnet man mit 70). Aber Europa ist auch noch insofern eine Ausnahme, als hier die meisten Sprachen miteinander eng verwandt sind. Während zum Beispiel die vielen Sprachen in Papua-Neuguinea völlig unterschiedlichen Sprachstämmen angehören, dominiert in Europa eine gemeinsame Wurzel, die als Indogermanisch oder Indoeuropäisch bezeichnet wird. Man nimmt an, dass Europa von Völkern besiedelt wurde, die aus dem alten Zweistromland (dem heutigen Irak) stammten und sowohl nach Norden (Europa) wie nach Süden (Indien) vordrangen. Die Verwandtschaft wurde im 19. Jahrhundert entdeckt und führte zu einer Blüte der Sprachwissenschaft. Auf einfachste Weise merkt man die Zusammenhänge an Wortgleichungen wie der Zahl »drei« mit englisch three, französisch trois, italienisch tre usf. Es gibt heute den neuen Forschungszweig einer Eurolinguistik, der nicht mehr nach der gemeinsamen Herkunft der Sprachen fahndet, sondern ihre gemeinsame Entwicklung beobachtet: eine Art Herausbildung von Eurisch für Europa. Wir leben jedenfalls in Europa in einer sprachlich vergleichsweise homogenen Weltgegend.
Nur darf man sich nicht täuschen: Selbst in einem einzelnen europäischen Land wie Deutschland ist die Sprachenvielfalt groß, größer, als es sich die meisten wohl vorstellen. Dies hängt mit den modernen Migrationsverhältnissen zusammen, die Deutschland zu einem multikulturellen und eben auch multilingualen Land gemacht haben wie andere große Industriestaaten auch. Das Statistische Bundesamt bzw. der Ausländerbeauftragte der Bundesregierung legt regelmäßig Zahlen vor, die die schwer zu handhabende Charakterisierung von »Menschen mit Migrationshintergrund« differenzieren. Nach dem Stand vom Dezember 2011 sind es 15,3 Millionen, ohne Berücksichtigung derjenigen in zweiter oder dritter Generation. 6,7 Millionen davon sind »Ausländer« (Personen ohne deutschen Pass), die Deutsch sprechen oder lernen, auf jeden Fall aber auch ihre eigene Sprache mitbringen. 31 Prozent stammen aus EU-Ländern: 520159 Italiener, 468481 Polen, 283684 Griechen, 223014 Kroaten, um nur die größten Gruppen zu nennen. Dabei sind die Herkunftsländer oft mit mehr als nur einer Sprache vertreten. Bei den Italienern gibt es Albanischsprecher und Sizilianer mit jeweils ausgeprägten Dialekten. Bei den Spaniern haben die Katalanen den Rang einer eigenen Amtssprache bei der EU durchgesetzt. Natürlich bringen auch Personengruppen aus dem EU-Raum, die ganz jenseits einer »Gastarbeiter«-Tradition stehen, ihre Sprachen mit: Franzosen, Engländer, Belgier, Niederländer (zum Beispiel im Rahmen militärischer Verbände).
Von den »Gastarbeitern« (Personen mit deutschem Pass also nicht mitgerechnet) stammen die meisten nicht aus der EU. Die größte Gruppe wird mit gut 1,6 Millionen von den Türken gebildet. Mit 63037 Marokkanern und 23610 Tunesiern kommen »kleinere« Gruppen hinzu. In allen diesen Fällen aber sind die sprachlichen Verhältnisse äußerst kompliziert. Unter den Sprechern mit türkischem Pass befinden sich zum Beispiel Azeri, Kurden und Personen mit iranischen Sprachen wie die Zaza. Die Kurden mit ihrer indogermanischen Sprache (die also keinerlei Verwandtschaft zum Türkischen aufweist) machen allein ca. 500000 Personen der türkischen Bevölkerung in Deutschland aus. Weiter sind unter den Türken Aramäer mit einer semitischen oder Lazen und Tscherkessen mit einer kaukasischen Sprache vertreten, schließlich noch Armenier. Unter Inhabern eines marokkanischen Passes verbergen sich Berber, die traditionell zweisprachig sind, neben der (nur von etwa 50 Prozent beherrschten) hocharabischen Schriftsprache ein marokkanisches Arabisch sowie Französisch sprechen. Zu diesem Personenkreis kommen Bürgerkriegsflüchtlinge: Albaner (meist aus dem Kosovo, also dem ehemaligen Jugoslawien), Bulgaren, Makedonier, Rumänen, Slowaken, Slowenen, Tschechen, Ungarn – überwiegend mit einigen Zehntausend Personen (die Rumänen mit 159222).
Aus unterschiedlichen Gründen sind zahlreiche weitere Gruppen mit teilweise wenigen tausend Mitgliedern vertreten, die nur kurz aufgezählt seien: aus Nordeuropa Esten, Finnen, Letten, Litauer; aus dem Nahen Osten Libanesen, Ägypter, Iraker, Jordanier, Palästinenser; aus Afrika Algerier, Äthiopier, Eritreer, Somalier, Bewohner des Tschad; aus dem Kaukasus Georgier und Armenier. Indogermanische Sprachen außerhalb Europas sprechen Iraner, Afghanen, Pakistaner, Chilenen, Kolumbianer, Bolivianer, Brasilianer. Aus China werden Mandarin sowie Kantonesisch genannt. Von den Philippinen und Indien bringen Sprecher die außerordentliche Sprachenvielfalt ihrer Herkunftsländer mit. Weiter sind zu nennen: Japaner, Koreaner, Tamilen, Thailänder, Vietnamesen (diese allein mit 83830 Vertretern). Aus zahlreichen afrikanischen Ländern stammen englisch-, französisch- oder portugiesischsprachige Personen sowie Vertreter mit Afrikaans. Schließlich werden Israelis, Kanadier, Norweger, Schweizer und US-Amerikaner aufgeführt.
Als letzte Gruppe gibt es die »Volksdeutschen«, die in den Statistiken nicht als Fremdsprachler geführt werden, obwohl sie vielfach (vor allem in der zweiten Generation) das Deutsche nicht oder nicht ausreichend beherrschen: insgesamt vier Millionen vor allem aus Russland und Polen. Auch hier vergrößert sich die Sprachenvielfalt, wenn man ins Detail geht und Weißrussisch, Ukrainisch sowie Vertreter einiger Turksprachen mit einbezieht. Insgesamt sind in Deutschland Menschen aus etwa 140 Staaten registriert, wobei die Zahl der gesprochenen Sprachen aus den genannten Gründen noch höher liegt. Deutschland ist also eines der großen Einwanderungsländer der Welt und hat sich im Zuwanderungsgesetz von 2004/05 zu einer »nachholenden Integration« verpflichtet. Die Frage stellt sich natürlich: Welche Folgen hat eine solche Sprachenvielfalt für das Einwanderungsland? Wo liegen die Probleme und wie kann man damit möglichst sinnvoll umgehen?
Loyalitätsprobleme und Hybridkulturen
Um das Wichtigste vorwegzunehmen: Auch wenn die Gleichung »ein Land, eine Sprache« weder in Deutschland noch in vergleichbaren Ländern nie stimmte – man denke nur an die Dänischsprecher in Schleswig-Holstein oder die Sorben in Sachsen –, hat es wohl auch noch nie eine derartige Durchmischung mit Sprachen aus (fast) aller Welt in einem Land gegeben. Nur: Diese Sprachenvielfalt ist Ergebnis und Ausdruck der gesellschaftlichen Entwicklung moderner Industrieländer mit entsprechender Anziehungskraft und Arbeitskräftebedarf. Dabei treten nun ganz verschiedene Probleme auf. Die Sprachloyalität zur Herkunftssprache und die Lernbereitschaft für die Gastgebersprache können zum Beispiel höchst unterschiedlich ausfallen. Man hat bei türkischen Frauen beobachtet, dass nach einer ersten Phase des Spracherwerbs der weitere Ausbau ins Stocken gerät oder gar rückläufig ist, wenn zu Hause weitgehend Türkisch gesprochen und in der näheren Umwelt eine stark reduzierte Sprachfähigkeit akzeptiert wenn nicht geradezu erwartet wird (polemisch: »Tarzan-Deutsch«). Auch bei der Generationenfolge verläuft der Erwerb der deutschen Sprache wiederum bei Türken oft nicht erwartungsgemäß. Während die zweite Generation als »Lerngeneration« gilt, können bei der dritten angesichts mangelhafter gesellschaftlicher Integration auch die Sprachbiographien zwiespältig ausfallen – mit teilweiser Rückkehr zum Türkischen.
Es gibt also einen gravierenden Unterschied zu traditionellen Migrationsverhältnissen, die in der Regel mit einem Bruch gegenüber der Herkunftsgesellschaft verbunden waren. So kennt man es etwa von den (nach der letzten polnischen Teilung aus der preußischen Provinz Posen stammenden und deshalb mit deutschem Pass versehenen) »Ruhrpolen«, die im 19. Jahrhundert angeworben wurden und sich so stark integrierten, dass heute kaum mehr als die Namen überlebten. Die moderne Migration lässt sich eher unter dem Begriff der »Transnationalität« fassen: einer Überbrückung des Nationalen, die das frühere Entweder-Oder ablöst. Dabei tauchen Probleme nicht nur für das Einwanderungs-, sondern auch für das Herkunftsland auf. Wiederum das Türkische ist ein Beispiel für das »Diaspora«-Phänomen: die allmähliche Trennung von der Sprachentwicklung im Herkunftsland mit der Folge eines »Auslands«-Türkisch, das im Nahbereich der Familie überlebt bzw. in der Form der Sprachmischung aufrechterhalten wird. Man sieht an diesem Punkt einmal mehr, dass sich das traditionelle Konzept von Vaterland und Muttersprache unter Migrationsbedingungen auflöst bzw. tiefgreifend verwandelt. Man kann von Hybridkulturen, entsprechend von verschiedenen »Ausbaustufen« von Sprachen sprechen: Im Nahbereich der Familie wird anders gesprochen als auf der Straße und wieder anders als in Behörden. Daran muss sich das Lernangebot in den Schulen ausrichten, an vorhandene Kenntnisse anschließen und neue ermöglichen.
Das sind schwierige und schon sehr spezielle Probleme. Unser Fazit fällt im Augenblick bescheidener aus: Deutschland ist kein einsprachiges Land. Nach dem Motto »Deutschland schafft sich ab« ist das als Bedrohung an die Wand gemalt worden. Nach dem Blick auf die Sprachenverteilung in der Welt liegt eine andere Folgerung nahe: Deutschland ist ein normales Land unter Bedingungen von Modernität und Globalisierung. Die Hausaufgaben sind in diesem Punkt zweifellos noch nicht erledigt. Aber es droht ja eine andere und womöglich größere Gefahr. Sie liegt nicht in der inneren Mehrsprachigkeit, sondern in der Konfrontation mit der Weltsprache Englisch. Das Deutsche wird möglicherweise weniger von innen ausgehöhlt als von außen in seinem Status geschmälert. Dann heißt es: Deutsch war einmal eine geachtete und auch im Ausland vielbenutzte Sprache. Jetzt spricht man draußen fast nur noch Englisch. Nicht das im Inneren vielsprachige Deutschland ist also das Problem, sondern die von Deutschen draußen akzeptierte Dominanz der Weltsprache. Deutsch trocknet nicht unbedingt in Deutschland aus, sondern in Europa bzw. der Welt. Kann oder soll man da entgegensteuern? Seit Jahrzehnten wird diese Frage öffentlich diskutiert. Ungezählt die Kolloquien, Verlautbarungen, Artikel. Ich greife eine Diskussion heraus, an der ich selbst teilnahm.
Eine Online-Diskussion über die Chancen des Deutschen
Experten für die deutsche Sprache
Im April 2008 erhielt ich von der FAZ einen Anruf, ob ich Interesse hätte, an einer Online-Diskussion teilzunehmen. Thema: Jutta Limbachs Buch Hat Deutsch eine Chance? Die ehemalige Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts, nach dem Ausscheiden aus dem hohen Amt für ein paar Jahre Vorsitzende des Goethe-Instituts, hatte Alarm geschlagen. Weltweit gehe es mit dem Deutschen bergab, in Brüssel spiele es trotz ständiger Versprechungen eine immer geringere Rolle. Keine Frage: Englisch war Weltsprache geworden, Deutsch drohte das Abstellgleis, Gegenwehr schien das Gebot der Stunde. Limbach machte dazu Vorschläge. Nein, kein Lamentieren über die Anglizismen, sogar Vorsicht mit der Aufnahme eines Deutsch-Paragraphen ins Grundgesetz (mit der Folge endloser Klagen). Aber Mobilmachung, vor allem in Brüssel: Statt der immer weitergehenden Alleinherrschaft von Englisch drei oder vielleicht fünf Sprachen, darunter auf jeden Fall Deutsch. Schluss mit der Leisetreterei, Aufstand der Eliten statt Flucht in Anpassung, ja Anbiederung. Die Begründung folgte in sechs Großkapiteln, etwa unter dem Titel »Das Deutsche in offener Weltgesellschaft«, dazwischen eine Menge Zahlen aus dem Goethe-Institut: über Deutschlernen in der Welt, neuerdings bereits abgeschlagen hinter Mandarin. Auch etwas über die wirtschaftliche Stärke unseres Landes war zu lesen und nicht zuletzt der Wink mit dem Zaunpfahl: unsere hohen Beitragszahlungen nach Brüssel.
Ich erhielt das Buch noch vor seinem Erscheinen als PDF, überflog es zunächst einmal in ein, zwei Abendstunden am Bildschirm. Ja, das Interesse sei vorhanden, war meine Antwort. Die Vorgänge in Brüssel, die Zahlen in der Welt waren mir weitgehend unbekannt, aber die Argumentation erinnerte mich an meine Studentenzeit, als Sprachgeschichte noch mit Humboldt gemacht wurde, mit dem Blick auf das je eigene »Weltbild« einer Sprache, das Sprecher prägt – nicht falsch, aber hoffnungslos vereinseitigt in einer Nachfolgediskussion, die die Sprache förmlich zum gedanklichen Gefängnis machte. Hatte Jutta Limbach neben ihrem Jurastudium auch einmal in einer solchen Vorlesung gesessen und danach nichts Neues mehr kennengelernt? Vor allem ein Kapitel deutete darauf hin: »Die Muttersprache als geistig-seelische Heimat«. Hier war sie also noch immer: die Muttersprache als Mutter Sprache. War das die Wurzel der Argumentation, ja der Panik? Und wie würde sich die Diskussion dazu stellen? War der Ausgangspunkt bei einem vereinseitigten Humboldt immer noch Standard?
Wenig später lernte ich meine Mitstreiter kennen. Die FAZ hatte ganze Arbeit geleistet, die Riege der Präsidenten bzw. Vorsitzenden vieler bedeutender Institutionen in Deutschland war vertreten: die Deutsche Forschungsgemeinschaft mit Wolfgang Frühwald, die Akademie für Sprache und Dichtung mit Klaus Reichert, die Gesellschaft für deutsche Sprache mit Rudolf Hoberg. Als gestandener Literaturwissenschaftler nahm Gerhard Schulz teil, lange an australischen Universitäten tätig, also mit Blick von außen ausgestattet. Von der Sprachwissenschaft waren Jürgen Schiewe und Jürgen Trabant dabei, von Deutsch als Fremdsprache Helmut Glück. Alle Genannten hatten Bücher zum Thema vorzuweisen, Hoberg etwa Sprechen wir bald alle Denglisch oder Germeng? Vertreter von Nachbarfächern, die sich irgendwann einmal in die Diskussion eingeschaltet hatten, gab es ebenfalls, zum Beispiel den Historiker Christian Meier mit seinem Buch Sprache in Not? Zur Lage des heutigen Deutsch. Mit Paul Kirchhof war ein Rechtswissenschaftler vertreten, damals noch nicht der von Bundeskanzler Schröder im Wahlkampf 2009 für seine Vorschläge zur Steuerreform karikierte »Professor aus Heidelberg«. Eine Schulleiterin, ein Verleger, ein Journalist von der FAZ kamen hinzu und nicht zuletzt der »frechste« Mitstreiter von allen, der Schriftsteller Feridun Zaimoglu, wohl wegen seines Durchbruchs mit dem Buch Kanak Sprak. Die Sopranistin Edda Moser, deren »Königin der Nacht«-Arie Bestandteil des berühmten Kulturprogramms in der Weltraumkapsel ist, stand ebenfalls auf der Liste, beteiligte sich dann aber doch nicht.
Dafür hatte man einige wirkliche Kenner nicht eingeladen oder nicht zum Mitmachen überreden können, den Soziolinguisten Ulrich Ammon vor allem. Auch ein Vertreter der Mehrsprachigkeitsforschung fehlte, Utz Maas zum Beispiel. Dass es ein journalistischer Rechtsaußen wie Thomas Paulwitz in die Runde geschafft hatte, der selbst beim hochkonservativen Verein Deutsche Sprache als Mitglied ausgeschlossen worden war (und dann am fleißigsten mitschrieb), bleibt ein Rätsel.
Ich war also Teilnehmer und fand alle paar Tage eine Frage unter meinen E-Mails, die sich an eine These von Jutta Limbachs Buch anlehnte. Dann galt es, Stellung zu nehmen, sehr kurzfristig. Die erste Runde wurde am 24. April 2008 veröffentlicht, die letzte am 26. Mai. Insgesamt kamen elf Termine zusammen. Die Leser konnten online Kommentare abliefern und taten es eher zurückhaltend. Demgegenüber fielen die Zahlen beim Anklicken unerwartet hoch aus. Ob es ein Fazit gab? Was Jutta Limbach zur Verbesserung der Chancen des Deutschen vorgebracht hatte, fand insgesamt ein eher pessimistisches Echo. Es würde wohl nicht mehr viel werden mit dem Deutschen, las man am häufigsten. Ich gehörte zur wesentlich kleineren Gruppe der Optimisten, die gegenzusteuern versuchten. Ja, Englisch dominiere in der Welt, aber Deutsch in Deutschland floriere ebenfalls – also keine Panik. Ich fand das Ganze zu konservativ, zu steif, zu apokalyptisch. Mir imponierte am meisten Zaimoglu mit seinen drastischen Äußerungen. Aber ich muss auch zugeben: Ich hatte damals noch nicht allzu viel zum Thema gelesen, mir fehlte es an Argumenten.
Freizeitsprache und Dummdeutsch
Die allererste Frage lautete: »Verkümmert Deutsch zur Freizeitsprache?« Das ist sie, die Reizfrage für die meisten, und die Antwort ist oft ein klares Ja. Es existiert in verschiedenen Verpackungen, »Freizeitsprache« ist noch ziemlich harmlos. Man hört oder liest auch von der Reduzierung auf einen »Dialekt«, von »Rückständigkeit« und vielem anderen. Gemeint ist stets: Angesichts des Englischen als einziger Weltsprache rücken alle anderen Sprachen ins zweite Glied. Das stimmt natürlich, nur ist damit die Bewertung nicht erledigt. Ist oder wird eine Sprache wertlos, wenn sie nicht (die) Weltsprache ist? Ist nur die Weltsprache eine »richtige« Sprache, der Rest im Grunde Abfall, abgemildert eben: etwas für die Freizeit? Für mich eine absurde Vorstellung.
Die Antworten fielen entsprechend aus. Noch harmlos, wenn angesichts der zunehmenden Verbreitung des Englischen »Gedankenlosigkeit« angeprangert wurde, schärfer klang »mangelnde Solidarität«, schon überdeutlich, wenn die Rede war vom »obwaltenden Unsinn« und der damit verbundenen Gefahr für die Demokratie, über »leichtfertiges Verspielen« des »Erbes« gehe ich hinweg. Auch an Motivsuche fehlte es nicht, zum Beispiel an der typisch deutschen »Mentalität der Unterlegenheit« oder gar einer dümmlichen Art, nach dem Motto zu handeln, »es geschehe schon nichts«. Die Gegenwehr duckte sich. Der Vorsitzende der Gesellschaft für deutsche Sprache suchte mit neueren Zahlen dagegenzuhalten, die vorsichtigen Optimismus signalisierten. Typisch politisch demgegenüber die Parole von der »Globalisierung als Chance«. Schon fast rührend der Hinweis darauf, dass in der ganzen Welt wenigstens auf dem Gebiet der Musik die deutsche Sprache bestens vertreten sei, wenn zum Beispiel Dietrich Fischer-Dieskau im Ausland Schubert-Lieder singe. Natürlich reagierte unser Enfant terrible mit einer Gegenprovokation. Nein, nicht das Englische bedrohe das Deutsche, der Feind hocke im eigenen Land – als das »Dummdeutsch« in den Medien, als »mediales Inzest-Deutsch«. Wer kann da schon mithalten?
Mir war etwas anderes eingefallen, vielleicht habe ich auch nur das Thema verfehlt. Irgendwo zitiert Jutta Limbach den in diesem Zusammenhang so unvermeidlichen Mythos von Babel, also das Alte Testament mit seinem allerersten Buch, Genesis, Kapitel 11. Als ordentlicher Kulturwissenschaftler hat man die Bibel zu kennen und auch das in diesem Zusammenhang auftretende kleine Problem. Der so wohlbekannten Stelle mit der Geschichte vom Hochmut der Menschen, die wie Gott sein wollten, deshalb diesen Riesenturm bauten und dafür mit der Verwirrung (das Lateinische ist in diesem Fall viel schöner: confusio) der Sprachen bestraft werden, geht nämlich eine andere Geschichte in Kapitel 10 voraus. Dort ist die Rede von der Entstehung der Menschheit nach der Sintflut mit den 70 Stämmen. Und siehe da: Sie unterschieden sich alle schon von Anfang an nach ihren je verschiedenen Sprachen. Umberto Eco, der nicht nur Kriminal- und andere Romane geschrieben hat, sondern auch ein schönes Sachbuch mit dem Titel Die Suche nach der vollkommenen Sprache, hob es klar hervor: Es gibt die Jahrtausende anhaltende Klage über die Sprachenvielfalt, die sich auf Kapitel 11 stützt, es gibt aber auch, vor allem seit dem 18. Jahrhundert, die Betonung der Selbstverständlichkeit und Unschädlichkeit der Sprachenvielfalt mit Berufung auf Kapitel 10. Mein Vorwurf an Jutta Limbach: Sie kennt nur Kapitel 11 und das mit ihm verbundene Szenario der Bedrohung. Warum sollen wir uns nicht auf Kapitel 10 stützen und einfach pragmatisch handeln? Kein Hochmut, keine Bestrafung, keine Verwirrung, nur eben Verschiedenheit. Warum soll es so schlimm sein, für die Belange in der Welt die Weltsprache zu sprechen und zu Hause Deutsch?
Klar, das war nicht wirklich eine ausreichende Antwort. Aber es gab ja auch noch mehr Fragen. Um sie zusammenzufassen: Drei Termine drehten sich um das Thema der Integration, also um Sprachprobleme nicht mit der Weltsprache, sondern mit der Sprache der Migranten. Außer den ständigen Beiträgern hatte man als Gäste den Grünen-Politiker Cem Özdemir und die Rechtsanwältin Seyran Ates eingeladen, die sich in ihrem Bestseller Der Multikulti-Irrtum zu den bisherigen Bemühungen um Integration kritisch geäußert hatte. Die Marschrichtung war insgesamt klar: Ohne Deutsch gehe nichts in Deutschland, daneben sollten Migranten ein Recht haben, ihre Herkunftssprache zu pflegen. Natürlich drückte sich Zaimoglu am klarsten aus: »Schluss mit dem Geschwätz [von Multikulti]«, »keine Dekrete bellen«, sondern allen Migrantenkindern Deutsch beibringen. Weil eine der Fragen lautete »Fordern wir zu wenig von den Migranten?«, war der damals noch aktuelle Eklat um die Anordnung von Deutsch auf dem Pausenhof an einer Berliner Schule ein Thema. Man betonte, dass die Schule richtig gehandelt hatte, zumal sich alle Beteiligten einig waren und das Unternehmen Erfolg hatte. Ich konnte mir nicht verkneifen, eine kleine Geschichte aus dem 17. Jahrhundert hinzuzufügen. Ein Kölner Jesuitengymnasium, über das ich einmal einen Krimi geschrieben hatte, hatte ebenfalls schon eine Sprache auf dem Pausenhof verbindlich gemacht, nämlich Latein. Auf Deutsch standen empfindliche Strafen: für die Reichen Geld, für die Armen Karzer.
Am Ende viel Fatalismus
Bei der Frage »Ist unsere Sprachförderung gut genug?« nahm ich mangels Kompetenz eine Auszeit. Ates schrieb über vernachlässigte »Förderung und Forderung«, ansonsten wurde die Schuld an Missständen eher bei den Migranten gesucht: »Die falsche Parabolantenne«, »Die dritte Generation macht Sorge« usf. Bei der Frage »Gibt es ein Grundrecht auf Muttersprachen?« dozierte Kirchhof über das Benachteiligungsverbot nach Art. 3 Grundgesetz, das auf Migrantensprachen nicht anwendbar sei. Eine grundrechtliche Verankerung forderte auch keiner derjenigen, die selbst einen Migrationshintergrund hatten, Ates warnte ausdrücklich vor »Separatismus«. Und wieder trug Zaimoglu am klarsten vor: Die Hinweise auf den Nutzen der Bilingualität in den (Sonntags)reden der Politiker fertigte er damit ab, dass es sich um ausgesprochene Werte der Mittelklasse handle, die auf die Unterschicht nicht anwendbar seien – hier gelte ein striktes Deutschgebot (»nicht den beleidigten Nischenheiligen spielen«). Ich wusste damals noch nicht, dass genau dies das Ergebnis eines siebenhundertseitigen wissenschaftlichen Wälzers zum Thema war. Utz Maas erörtert darin die Sprachsituation der Migranten mit dem Fazit, dass Deutsch in Deutschland Vorrang habe, die »Muttersprachen« nichts zur notwendigen Mitarbeit im neuen Land beitrügen und insoweit auch keiner besonderen Pflege bedürften. Gleichzeitig las ich in der Forschung die These, dass es sinnvoll sein könne, die mitgebrachte Muttersprache zu fördern, um auf der Grundlage der Beherrschung dieser Sprache die neue (also Deutsch) leichter zu lernen.
Die nächste Frage lautete: »Eine neue sprachliche Weltordnung?« und zielte auf das Chinesische. Sollte etwa die Dominanz des Englischen nur vorübergehend sein und die nächste Form der Überrollung des Deutschen schon vor der Tür stehen? Die meisten Kombattanten winkten ab: Schon die chinesische Schrift würde das weltweite Lernen ausbremsen. Es war auch von der Chance fürs Deutsche die Rede, wenn denn das Englische zurückgestutzt würde. Andere verstanden die Frage erst gar nicht richtig und nahmen sie zum Anlass, nach der Politik zu rufen oder auf fünf vor zwölf zu verweisen. Auch die weiteren (guten) Fragen verplätscherten. In welchem Geist Weltsprachen wachsen, konnte niemand wirklich beantworten. Hinter der vermeintlichen kulturellen Macht stünden in Wirklichkeit Panzer, hieß es. Oder es war die Rede von der Sprachkiller-Wirkung des Englischen als »Globalesisch«.
Diese fatalistische Haltung kam dann auch bei der Wissenschaftssprache auf ihre Kosten. Die schärfste Formulierung stammte von Christian Meier, der sagte, das Deutsche befinde sich wegen »Unterernährung« bereits im »Invalidenheim«. Allerdings gab es auch Gegenwehr. Rudolf Hoberg als Vorsitzender der Gesellschaft für deutsche Sprache machte die Bemerkung, dass seine Unterstützung des Englischen ihm schon die polemische Bezeichnung eines »Vorsitzenden des Vereins für englische Sprache« eingebracht habe. Ich selbst suchte mein Heil in einer Trennung zwischen Natur- und Geisteswissenschaften, wollte Deutsch (nur) für die Geisteswissenschaften retten. Das sehe ich mittlerweile erheblich differenzierter und werde darüber ausführlich sprechen.
Um die letzten Fragen nur noch summarisch zu behandeln. Es gab viel Zuspruch für eine mehrsprachig statt englisch dominierte Welt, auch auf reichlich naive Weise im vertrauten Vokabular: »die Muttersprache neu entdecken«. Es gab Forderungen nach einer staatlich gelenkten Sprachpolitik. Es gab vor allem Widerspruch gegen die sprachliche Realität in Brüssel, auch mit deftigen Ausdrücken garniert wie der »Arroganz« der Anglophonen und der »Willfährigkeit« der eigenen Leute. Unser bester Mann machte übrigens zu diesem Zeitpunkt nicht mehr mit. Zaimoglu hatte wohl die Lust verloren. Irgendwie war das Thema zerredet. Schon die Frage, ob Limbachs Thesen überzeugten, fand keine rechte Antwort mehr. Obwohl die meisten doch immer wieder Limbach verteidigt hatten, gab es keine Zustimmung zum Ganzen. Selbstkritik wurde vermisst, zu viel Optimismus mitten im Pessimismus bemängelt. Ich selbst suchte ein Fazit mit der These, dass Limbach nicht wirklich analysiert, sondern moralisiert habe. Ich meinte damit den ständig erhobenen Zeigefinger, das Vokabular von »Flucht«, »Anbiederung« usf.
Wenige Monate nach der Veröffentlichung erhielten wir alle die Mitteilung, dass der »F.A.Z. Lesesaal« unter 72 Bewerbern mit dem bayerischen Printmedienpreis 2008 ausgezeichnet worden war. Grund: Zusammenführung von Printmedium und Internet. Auch unsere Debatte gehörte also dazu. Aber was konnte ein treuer Leser der Diskussion eigentlich entnehmen? Dass man das Deutsche retten könne oder erst gar nicht zu retten brauche? Dass es Schuldige gebe (die »Eliten«) und Sachzwänge (die Brüsseler »Bürokratie«)? Es fehlte einfach an Zusammenhängen. Die Frage nach der Rolle des Deutschen in der globalisierten Welt lässt sich nicht im Austausch von Behauptungen klären. Man muss tiefer ansetzen. Ich hatte kurz nach der Beteiligung an der Online-Diskussion die Gelegenheit erhalten, ein Buch über die Geschichte der deutschen Sprache zu schreiben. Und ohne einen wenigstens kurzen Blick auf diese Geschichte schien mir das Thema nicht behandelbar zu sein. Denn zu dieser Geschichte gehört erstens die durchaus »eigenartige« Entstehung des Deutschen, zweitens und vor allem aber die Herausbildung des Sprachnationalismus mit seiner Übersteigerung zum Chauvinismus im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Ohne diese Geschichte des Deutschen, also ohne die Geschichte der Betrachtung und Bewertung seiner Sprache, wäre Deutschland als Staat nicht entstanden. Mit ihr aber war auch eine Hypothek verbunden, die bis heute nachwirkt.
Die Herkunft der deutschen Sprache
Germanische Stämme, germanische Dialekte
Die Geschichte der deutschen Sprache ist sehr gut aufgearbeitet. Ein vierbändiges Handbuch Sprachgeschichte (1998–2004) informiert über sämtliche Facetten. Nicht alles lässt sich an dieser Geschichte abschließend, vieles nicht ohne Kontroversen klären. Trotzdem die Frage: Was sollte man darüber wissen, wenn man sich in Diskussionen wie der eben vorgeführten behaupten will? Denn ohne Wissen um die Herkunft des Deutschen drohen unnötige Wiederholungen von Überholtem, Banalitäten, die sich im Licht der Geschichte auflösen. Fragen wir also zunächst: Was ist das eigentlich: Deutsch? Gibt es irgendetwas an seiner Entwicklung, das sich von anderen Sprachen, speziell denen unserer Nachbarn, unterscheidet? Oder gibt es gar etwas, das zu einem Problem, vielleicht sogar Dauerproblem wurde?
Um so einfach wie möglich anzusetzen: Deutsch geht zurück auf Sprachen, die eine ganze Reihe von germanischen Stämmen aus den Tiefen einer schriftlosen Geschichte mitbrachten. Wir kennen diese Stämme, die teilweise bis heute in den Bezeichnungen unserer Bundesländer oder auch Landschaften aufbewahrt sind. Es handelt sich um die Franken, die Alemannen, die Bayern, die Hessen, die Thüringer, die (Nieder)sachsen, um die bekanntesten zu nennen. Während diese Germanen im Westen und Süden Europas mit der römischen Vorgängerbevölkerung verschmolzen und romanische Sprachen wie das Französische, Spanische, Italienische hervorbrachten, behielten die in der Mitte und im Norden Europas gelandeten Germanen ihre Sprachen bei bzw. entwickelten sie weiter als das Deutsche neben dem Englischen (bevor es im 11./12. Jahrhundert stark romanisiert wurde), Dänischen, Schwedischen, Norwegischen usf.
Deutsch stammt also aus dem Germanischen, aber nicht aus einer einzigen germanischen Sprache, sondern stellt ein Sammelbecken germanischer »Dialekte« dar, die in einem wichtigen Punkt eine Einheit bildeten: Sie setzten sich ab vom Latein der Vorgängerbevölkerung. Deutsch bedeutet nichts anderes als »volkssprachlich« (lateinisch theodiscus als Übersetzung des altdeutschen Wortes diutisk). Da spielte es keine Rolle, ob dieses Deutsch alemannisch, bayrisch oder sonst wie klang, es war jedenfalls die mitgebrachte, nicht die angetroffene Sprache. Diese Sprache, das Latein der Römer, das in früheren Zeiten in allen Provinzen gesprochen wurde, behielt allerdings eine wichtige Funktion: Es wurde die Sprache der Kirche. Weil diese Kirche eine entscheidende Rolle bei der Verwaltung spielte, bildete Latein die Klammer des Riesenreichs zuerst von Chlodwig im 6. Jahrhundert, dann von Karl dem Großen im 8./9. Jahrhundert. In der Phase, in der die germanischen Stämme unter Führung der Franken das erste große Nachfolgereich der Römer aufbauten, konnte man sich mit seinem germanischen Dialekt zu Hause und vielleicht bei den nächsten Nachbarn unterhalten. Mit Latein kam man, jedenfalls auf höherer Ebene, überall durch.
Warum all dies für die Geschichte des Deutschen so wichtig ist? Weil es »das« Deutsche von Anfang an in seiner Entwicklung einschränkte. Kein Mensch nahm Anstoß an den vielen deutschen Dialekten, niemand tat etwas für ihre Annäherung, weil nirgends die Notwendigkeit bestand. Es gab eben Latein. Den Rest erledigten Reiseführer. In einem von ihnen aus dem 9. Jahrhundert kann ein französischer Mönch nachschlagen, wie er bei bayerischen Bauern sein Pferd beschlagen lassen kann – und eine lateinunkundige Frau ins Bett bekommt.
Der lange Blick aufs Sächsische
Deutsch hatte also ein Entstehungsproblem. Nicht, was seine vielwurzlige Herkunft aus den Tiefen der Geschichte betrifft, sondern hinsichtlich seiner Konsolidierung als Einheitssprache im Mittelalter. Die frühesten Texte, die wir kennen (und mit denen sich Germanistikstudenten abplagen), sind nicht auf Deutsch im heutigen Sinne geschrieben, sondern zeigen den jeweiligen deutschen Dialekt ihres Entstehungsraums. Dies gilt für erste Bibeldichtungen des 9. Jahrhunderts ebenso wie für die großen Epen der staufischen Zeit eines Wolfram von Eschenbach oder des Nibelungenlieds.
Man kann ziemlich genau sagen, wann die große Wende einsetzte, weil ihr ein mediengeschichtliches Ereignis von Weltrang zugrunde liegt bzw. die Voraussetzung bildet: der Buchdruck. Was Gutenberg Mitte des 15. Jahrhunderts erfunden hatte, veränderte alles, weil plötzlich der Austausch andere Dimensionen annahm. Man darf dabei nicht an Gutenberg selbst denken, dessen größte Leistung der Druck einer lateinischen Bibel war, die man heute im Mainzer Gutenbergmuseum hinter Panzerglas in einem Tresorraum besichtigen kann. Seine Nachfolger aber begannen, Deutsch zu drucken. Das bedeutete immer noch dialektales Deutsch, aber mit immer größerer Reichweite. Drucker erwarben sich regelrecht Renommee mit Drucken, die in Großregionen verkauft werden konnten: im kaiserlichen Südosten, in der Mitte Deutschlands, im hohen Norden. Als Luther die Bibel übersetzte, überlegte er sich genau, in welcher »Sprache« er sie drucken ließ und entschied sich für das Sächsische der Meißnischen Kanzlei, für ein (ost)mitteldeutsches Deutsch also zwischen dem (geographisch) hochdeutschen Süden und dem niederdeutschen Norden. Mit dem ungeheuren Erfolg der Bibel ging so auch eine wichtige Vorentscheidung über die Einheit des Deutschen einher: Wichtigster Kandidat des Hochdeutschen (jetzt nicht geographisch, sondern normativ gemeint) wurde das Sächsische, das Schriftdeutsch der Meißnischen Kanzlei.
Aber man kennt ja Deutschland und die Deutschen, die beide nicht wirklich existierten. Deutschland nicht, weil es das Römische Reich deutscher Nation gab, in dem ein Kaiser herrschte, der wenig zu sagen hatte. Und die Deutschen nicht, weil es die Dialekte gab, in denen Deutsch mit unterschiedlichem Zungenschlag gesprochen wurde. Es gab jedoch wenigstens eine Marschrichtung, kein Mensch bestritt die Vorteile einer einheitlichen Sprache. Aber nun kommt ein anderes deutsches Talent ins Spiel: die Begeisterung für den Föderalismus. Jeder behauptete seine Eigenheit und war wenig willens, für die ersehnte Einheit Opfer zu bringen. Mit einer ebenso großen wie überraschenden Ausnahme: Diejenige Dialektregion in Deutschland, die sich am allermeisten von den anderen unterschied, der gesamte Norden, der nie die sogenannte Lautverschiebung mitgemacht hatte und damit in der Mitte und im Süden fremd klang (sofern man im Norden »op dat Rike« anstieß statt »auf das Reich«), lenkte im 16. Jahrhundert ein. Obwohl das Niederdeutsche längst eine wohlausgebaute Schriftsprache war und in Zeiten der Hanse von London bis Nowgorod verwendet wurde, verzichteten seine Sprecher bzw. Schreiber auf Integration in die Einheitssprache und wurden zweisprachig. Zu Hause sprach man weiter seinen niederdeutschen Dialekt, für die Kommunikation mit Fremden übernahm man das »Hochdeutsch« aus Meißen. Damit war der größte Stolperstein der Einheit ausgeräumt, aber das Rennen war nicht zu Ende, ja es kam erst in seine entscheidende Phase.
Denn jetzt traten Gelehrte auf, wenn auch mit allen typischen Nachteilen wie langatmigen Begründungen und viel Rechthaberei. Im Zeitraffer könnte man diese Geschichte folgendermaßen zusammenfassen: Im 17. Jahrhundert entstanden gegen das damalige Überhandnehmen des Französischen Sprachgesellschaften, die das Deutsche in seiner Eigenständigkeit verteidigten, unter anderem mit der Erstellung von Wörterbüchern und Grammatik. Im 18. Jahrhundert wurden die Gelehrten immer gelehrter und begründeten die Einheitssprache in dicken Wälzern: und zwar immer noch als die Mustergültigkeit des Sächsischen. Spitzenreiter war dabei der perückenbewehrte Gottsched, der als Professor in Leipzig (also Sachsen) saß, aber selbst aus dem hohen Norden stammte. Gottsched philosophierte also wortreich über die grundsätzliche Gleichberechtigung und auch Wichtigkeit aller Dialekte und vereinte dies ungerührt mit dem klaren Plädoyer fürs Sächsische. Der nächste große Sprachforscher, mit Namen Johann Christoph Adelung (und schon ohne Perücke), machte es nicht viel anders. Der Titel seines Hauptwerks lautet: Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart (erste Auflage 1774–1784, die zweite 1793 bis 1801).
Man kann dies nun weiterführend oder eine Mogelpackung nennen. Denn so viel kommt bei näherer Prüfung heraus: Adelung, wieder einmal ein gebürtiger Niederdeutscher (aus Pommern nämlich), preist wieder die Vielfalt der Dialekte, belässt es aber letztlich beim Sächsischen. Goethe etwa folgte dieser Autorität, sein Kollege Wieland in Weimar schrieb dagegen ein ausgewachsenes Pamphlet gegen die sächsische Vorherrschaft mit Hinweis auf das »bessere« Hochdeutsch im schwäbischen Süden – Wieland stammte aus Biberach.
Kunstprodukt Hochdeutsch
Worum geht es bei diesen Streitereien um die Vorherrschaft eigentlich? Letztlich um das, was man im Wörterbuch nachschlagen kann: Schreibweise und Wortschatz. Adelung hatte in seinen Wörterbuchartikeln immer genau gesagt, welche Wörter (seiner Meinung nach) »hochdeutsch« und damit gemeinsam bzw. verbindlich waren und welche bloßer Dialekt oder überhaupt kein Deutsch. Bei dieser Auswahl schwebte ihm eben immer noch das Sächsische vor, so wie es Luther vorgeschwebt hatte, auch wenn es ständig Ausnahmen gab. So hatte sich Luther beim Nebeneinander von Lippe und Lefze für die Lippe entschieden, obwohl dies niederdeutsch ist, womit die oberdeutsche Lefze dann zur Lippe des Hundes wurde.
Und so muss man sich Entscheidung für Entscheidung vorstellen. Das gemeinsame Hochdeutsch bildete sich also (bei aller Konzentration aufs Sächsische) nicht als das Deutsch einer vorbildlichen Region, so wie das Französische aus dem Dialekt der Île de France hervorging. Das gemeinsame Hochdeutsch hatte vielmehr ein großes und daneben eine Reihe kleinerer Zentren, die alle beitrugen (die Wissenschaft bezeichnet so etwas als polyzentrisch). Das Hochdeutsch der Goethezeit, bei dem tatsächlich erstmals in der deutschen Sprachgeschichte ein Schriftdeutsch mit großer Gemeinsamkeit entstand, war ein von Gelehrten geformtes Hochdeutsch. Und weil sich dieses Hochdeutsch auch noch vom Französischen des Adels absetzte, war es ein bürgerliches Hochdeutsch. Dieses Hochdeutsch war also nichts »Reines«, nichts »Natürliches«, sondern etwas »Gemachtes«. Das Hochdeutsch, das um 1800 erstmals ein einheitliches Deutsch darstellte, war ein reines Kunstprodukt. Literaten wie Wieland nörgelten nicht zu Unrecht, aber letztlich vergeblich daran herum.
Nur muss man wissen: Diese Einheit bestand in der Schriftlichkeit. In der Mündlichkeit herrschte damals nach wie vor der wirklich »natürliche« Dialekt fast wie in mittelalterlichen Zeiten. Goethe schrieb bestes Hochdeutsch (in dem nur ab und zu noch der Dialekt durchscheint wie im berühmten Reim »Neige, du Schmerzensreiche«), aber sprach glattes oder auch plattes Frankfurtisch. So wie Schiller Schwäbisch. Dabei blieb es mindestens hundert Jahre nach der Gewinnung der (schriftlichen) Einheit. Noch unser erster Bundespräsident, Theodor Heuss, schwäbelte (»Honoratiorenschwäbisch«), und unser erster Bundeskanzler, Konrad Adenauer, sprach Rheinisch (»Kanzlerdeutsch«). Die Einheit in der Mündlichkeit wurde erst am Ende des 19. Jahrhunderts als Problem gesehen und von Theodor Siebs in seinem Bühnendeutsch von 1898 erstmals an eine Lösung herangeführt. Vor allem im Zusammenhang mit der Entwicklung der Medien (des Rundfunks seit 1923) entwickelte sich diese Einheit weiter, um schließlich Bildungsmerkmal zu werden wie die korrekte Beherrschung der Schriftsprache.
Aber es sei betont: Wenn in Diskussionen auf »das« Deutsche oder die »Einheit« der deutschen Sprache gepocht wird, ist immer die Schriftsprache gemeint. Deren Einheit ist der »natürlichen« Sprache des mündlichen Verkehrs durchaus abgerungen, ja aufgedrungen. So einheitlich, wie es in den Auseinandersetzungen gerne als selbstverständlich daherkommt, war und ist das Deutsche also nie gewesen. Oder um es noch klarer zu sagen: Das Deutsche ist eine wundervolle Muttersprache, aber eine Mutter, die es einmal unverfälscht gesprochen und weitergegeben hätte, ist ein reiner Mythos.
Die Entstehung des Sprachnationalismus
Von Föderalisten und Idealisten
Der lange Weg zur Einheit der Nation nahm bei uns trotzdem den Weg über die Sprache. Wir sind nicht nur hoffnungslose Föderalisten, die alles tun, um die Einheit abzuschwächen, wir sind auch hoffnungslose Idealisten, was die Macht der Sprache betrifft. Man könnte dabei schon an unseren Namen anknüpfen. Denn es gibt in Europa kein anderes Volk, das sich nach seiner Sprache bezeichnet. Die Deutschen sind die »Deutschsprechenden«, auch wenn das letztlich bedeutet: die »Volkssprachlichen«. Unsere Nachbarn sind uns dabei nicht gefolgt: Die Franzosen bezeichnen uns als Allemands, reduzieren uns also auf den einen germanischen Stamm der Alemannen, die Engländer sind großzügiger und bezeichnen uns als Germans, lassen also keine anderen Germanen zu als uns (obwohl sie selber auch welche sind). Die deutsche Sprache, so die allgemeine Folgerung, ist uns also in die Wiege gelegt.