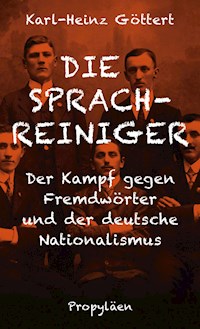14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Was Perikles und Obama wirklich eint – eine andere Geschichte der Rhetorik Menschliches Miteinander braucht Reden. In der Antike entstanden die ersten großen Vorbilder, begleitet von immer neuen Anleitungen, den Rhetoriken. Doch behandeln diese nicht die Redner selbst und ihre Reden, sondern bloß deren Theorie. Der bekannte Germanist und Sprachwissenschaflter Karl-Heinz Göttert geht dieser Redevergessenheit der Rhetorik nach, widmet sich der rednerischen Praxis und behandelt die europäische Tradition als Konstrukt mit eigenen Konturen, die auch anders denkbar sind. Er belegt dies, indem er die Geschichte der Rhetorik auf eine neue und ungewöhnliche Weise erzählt: Redner und Reden fernster Zeiten werden in überraschenden Paarungen nebeneinandergestellt. So gelingt ihm eine glänzende, anschauliche und lebensnahe Darstellung, in der sich ganz nebenbei die vielbeschworene »Macht der Rede« als kaum durchschauter Mythos entlarvt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 672
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Karl-Heinz Göttert
Mythos Redemacht
Eine andere Geschichte der Rhetorik
FISCHER E-Books
Inhalt
Prolog
Von der Redevergessenheit der Rhetorik
Dieses Buch wäre wohl nicht ohne Barack Obama entstanden. Wie viele politisch Interessierte habe ich seinerzeit den amerikanischen Wahlkampf des Jahres 2008 verfolgt, zuerst die Auseinandersetzung im eigenen demokratischen Lager mit Hillary Clinton, dann mit dem Republikaner John McCain. Zwischendurch war Obama im Juli nach Berlin gekommen und sprach vor der Siegessäule. Ich hatte nicht erwartet, in modernen oder gar postmodernen Zeiten mit einer Gestalt konfrontiert zu werden, die so sehr an die klassischen Redner erinnert. Entgegen den trübsinnigen Reflexionen über das Ende der Redekunst in der veränderten Medienwirklichkeit der Gegenwart meldete sich die Tradition zurück. Es gab sie also noch, die große Rede mit sprachlicher Kunst und perfekter Präsentation – ich weiß, in massenmedial inszenierter Form, und die Teleprompter waren anfangs ebenfalls kaum zu entdecken. Im charismatischen Auftreten eines bislang unbekannten Senators kehrten jedenfalls nach dem Augenschein Gestalten wie Cicero, Bernhard von Clairvaux, der ältere Pitt oder auch Luther, Bismarck, Lassalle wieder.
Denn dies war die eigentliche Entdeckung an Obama für mich als langjährigen Kenner der Rhetorik: Es gab nicht nur die Rhetorik, die die Redekunst beschreibt und die dann die Rhetoriker aller Zeiten mit ihren Alternativen beschäftigt hat. Es gab den Redner, der die Rhetorik in seinen Reden umsetzte. Außenstehende werden sich verwundert die Augen reiben. Aber man muss wissen: Wir verwenden das Wort Rhetorik in einer unhandlichen Doppeldeutigkeit, bezeichnen damit sowohl die Beschreibung der Redekunst wie die Redekunst selbst. Die Wissenschaft beschäftigt sich mit beidem, aber mit erheblicher Schlagseite. Wir besitzen mittlerweile eine perfekte Aufarbeitung der rhetorischen Fachliteratur von der Antike bis heute. Das im Tübinger Zentrum der Rhetorikforschung von Gert Ueding herausgegebene Historische Wörterbuch der Rhetorik (1992–2012) bietet all dies in zehn Folianten. Die ca. 1300 Artikel informieren über jede erdenkliche Variante rhetorischer Lehre, ordnen sie in den Kontext der politischen, sozialen, philosophischen Traditionen ein, und dies über die verschiedenen Kulturen mit ihren verschiedenen Sprachen hinweg (einschließlich fernöstlicher Kulturen). Wir wissen also über den theoretischen Aspekt der Rhetorik bestens Bescheid, nicht aber über den praktischen. Wir kennen die Rhetoriker und ihre Rhetoriken (einschließlich des Rednerideals, das Franz-Hubert Robling behandelt hat), viel weniger aber die Redner und ihre Reden selbst. Die Wissenschaft von der Rhetorik, so könnte man es etwas zugespitzt sagen, hat ihren zweiten Aspekt, ohne den es den ersten gar nicht geben könnte, weitgehend vergessen.
Dafür gibt es Gründe, auch verständliche. Außenstehende wissen in der Regel ebenfalls nicht, dass die rhetorische Theorie von großer Bedeutung für unsere Kultur im Ganzen war. Was in dieser Theorie über die Voraussetzungen künstlerischer Produktion und Produktivität beschrieben wurde, hatte Auswirkungen auf die Literatur, Musik, Architektur und Malerei bis zum 18. Jahrhundert. Erst danach kamen die Genies, die mit den vermeintlich unvermeidlichen Regeln nichts mehr anfangen konnten. Folglich spielte die Rhetorik keine Rolle mehr. Und folglich war deren Wiederentdeckung von größter Bedeutung für die historische Betrachtung. Nur hatte die Wiederentdeckung eben auch diese Misslichkeit. Weil es Philologen wie Robert Curtius oder Walter Jens waren, die an der Spitze standen, galt das Interesse der Rhetoriktheorie, nicht denen, für die diese Theorie einmal ausgearbeitet worden war. Untersuchungen, die sich mit Rednern und ihren Reden über größere Zeiträume hinweg beschäftigen, sind demgegenüber in Deutschland bzw. in deutscher Sprache selten. Die Kunst derpolitischen Rede in England von Hildegard Gauger bildet eine frühe Ausnahme. Die Antike behandelt neuerdings Wilfried Strohs Die Macht der Rede. Weiter gibt es Monographien wie besonders im Falle von Hitler (herausgegeben von Josef Kopperschmidt) oder knapp kommentierte Anthologien wie etwa Karl Heinrich Peters Reden, die die Welt bewegten (mit Ausgriff auf Reden aus aller Welt) oder Gert Uedings (speziellere) Deutsche Reden von Luther bis zur Gegenwart.
Aber es gibt auch in diesen ebenso kenntnis- wie hilfreichen Werken ein Manko. Es liegt in dem kaum wirklich begründeten, ich würde sogar sagen: kaum wirklich durchschauten Narrativ von der »Macht der Rede« (das Strohs Werk nicht zufällig als Titel führt). Wie nicht anders zu erwarten, stammt es aus der Rhetorik. Als Aristoteles gut hundert Jahre nach Perikles wissen wollte, wie Überredung unter Alltagsbedingungen zustande kommt, äußerte er einige wenig zusammenhängende Thesen, die wohl damals gängige Meinung waren. Wir glauben am meisten, »wo wir annehmen, dass etwas bewiesen sei«, liest man und dann weiter, dass »die Menschen von Natur aus für die Wahrheit hinlänglich begabt seien«, wie es ja merkwürdig wäre, »wenn wir mit unserer Körperkraft so viel erreichen, mit der Sprache aber nicht«. Dahinter steckt nun einmal nichts als bloßer Optimismus. Aber es kommt auch handfester: Zum Glaubhaftmachen trügen Schlussverfahren mehr bei als Beispiele, weil Schlussverfahren mehr »erregten«. Dabei verwässert Aristoteles dies wieder mit der Bemerkung, angesichts »der äußerst ungebildeten Art der Zuhörer« sei es am besten, sich an das zu halten, worüber sich diese »freuten«, zum Beispiel über bekannte Sentenzen, die »zufällig« zu einem »speziellen Fall« passten – bei einer Rede über missratene Kinder etwa die Sentenz über die Torheit, Kinder zu zeugen. Überhaupt überredeten Ungebildete das Volk besser als Gebildete, »weil die Gebildeten über Allgemeines und Allgemeingültiges sprechen, die Ungebildeten über das Naheliegende«. Aber das letzte Wort lautet doch klar: Mit Kunst komme man weiter, weil eine kunstvolle Rede Würde verleihe und Würde Vertrauen. Man solle solche Fähigkeiten nur nicht zu deutlich sehen lassen, weil sie dann Verdacht auslösten.
Aristoteles geht also von einer Macht der Rede aus, die auf Kunst beruht, auf Wissen um die Wirkung von Kunst. Cicero, der sich klar auf Aristoteles stützte (wer tat dies nicht?), sah allein schon in der Sprachfähigkeit des Menschen das Mittel der Vereinigung und in rhetorischer Kunst die Möglichkeit direkter Menschenführung – als Überwältigung des Hörers durch den überlegenen Redner, der den richtigen Weg weiß. Am Ende steht das Wort von Quintilian, dass nur ein moralisch Untadeliger wirklich reden könne, weil die Natur als Mutter und nicht Stiefmutter an uns gehandelt haben würde, »wenn sie wirklich die Redegabe als Helfershelferin bei Verbrechen, als Gegnerin der Unschuld und Feindin der Wahrheit erfunden (hätte)«. Dagegen ist immerfort, aber auch verdächtig leise protestiert worden, ohne dass der entscheidende Punkt und damit die eigentliche Mythenbildung in diesem Mythos bemerkt worden wäre: die Engführung von Redekunst und Natur. Nein, die Redekunst, die zur Macht führt, ist nicht »natürlich« und vor allem nicht von sich aus »moralisch«. Diese Redekunst, von der die besten Rhetoriken der Antike sprechen, ist ein (sehr eindrucksvolles) kulturelles Narrativ, eine durch und durch kulturell organisierte Form von Rede. Nur wer glaubt, Reden nach diesem Narrativ seien von vornherein und umstandslos auf Macht abonniert, muss irritiert sein, wenn er sieht, dass Reden tatsächlich keine Macht ausüben. Und statt über die Abnahme dieser Macht zu reflektieren – ohnehin irgendwie paradox bei der Grundannahme von einer der Rede schlicht innewohnenden Macht –, scheint es naheliegender, Krisen der Redekunst mit Problemen dieses Narrativs in Zusammenhang zu bringen. All dies aber bekommt man sehr viel besser zu Gesicht, wenn man statt von den Rhetoriken von den Rednern ausgeht.
Denn damit wird schlagartig ein weiteres Manko der allein oder vornehmlich rhetorikorientierten Betrachtung von Redekunst deutlich: die überaus einseitige, ja geradezu betriebsblinde Beurteilung einer Rede- und Rednergeschichte, in der es letztlich nach den demokratischen Griechen und republikanischen Römern überhaupt keine großen Reden und Redner mehr gegeben haben soll. Jedenfalls vor allem im politisch zerrissenen Deutschland nicht, wogegen die Engländer und Franzosen mit ihren Parlamenten noch eine gewisse Ausnahme bildeten. Walter Jens’ wirkmächtiger Aufsatz Von deutscher Rede bindet große Redekunst an genau das, was Rhetoriker wie Cicero als Voraussetzung zugrunde legten: die politisch »freie« Rede (»Herrscht das Volk, regiert die Rede; herrscht Despotismus, dann regiert der Trommelwirbel«) – woran gemessen die Deutschen »zwischen Konstanz und Kiel« rednerisch kaum wirklich Vorzeigbares zustande gebracht haben (konnten). Abgesehen davon, dass Demokratie weder in der Antike noch in der Moderne politische und/oder moralische rednerische Qualität verbürgte und in Monarchien höchst beachtlich geredet wurde (wovon in diesem Buch noch ausführlich Zeugnis abgelegt wird): Dass in den Archiven der Klöster noch heute zigtausende unentdeckte Predigten liegen, dass es kein einziges Jahr der Weltgeschichte gibt, in dem nicht Gerichte tagten, wird bei solchen Aussagen mehr oder weniger übersehen oder als irrelevant beiseitegeschoben. Alle diese Beispiele entsprechen eben nicht oder zu wenig der Vorstellung von »menschenwürdiger« Rede, die nur bei »republikanischer Freiheit« zustande komme. Aber das Urteil entbehrt jeder empirischen, will sagen: redegeschichtlichen Grundlage, es stammt geradewegs aus den Rhetoriken, die ihre eigenen Produkte desavouierten.
Womit schließlich ein drittes und vielleicht das größte Manko anzusprechen wäre, das mit dem Narrativ der Redemacht verbunden ist. Wer nämlich dieses Narrativ für etwas universell Gültiges hält, verschließt sich von vornherein den Blick für seine Bedingtheiten. Man kann aber fragen, ob es für die Vorstellung von der Redemacht nicht eine Erklärung historischer Art gibt, eine Erklärung, die die aristotelisch-ciceronianisch-quintilianische Selbstverständlichkeit in eine zeittypische Konstruktion überführt. Ich formuliere noch einmal den wichtigsten Punkt: Der Redner will sein Gegenüber beeindrucken, ihn regelrecht unterwerfen, indem er kunstvoll redet. Er übt Macht aus, natürlich nicht brachiale, aber intellektuelle, und findet Beifall für diese Macht. Das Modell läuft damit hinaus auf einen überlegenen Redner und einen sich der Überlegenheit unterwerfenden Hörer. Dieses Modell aber entspricht unverkennbar dem traditionellen Geschlechterverhältnis, ist ihm womöglich schlicht nachgebildet (vielleicht sogar am genauesten in der antiken Knabenliebe mit ihrem »pädagogischen« Grundzug). Der von den Rhetoriken anvisierte Redner ist danach jedenfalls »männlich« und rechnet mit einem Publikum »weiblicher« Art. Bei der Analyse von Hitler-Reden hat man auf den eigenartigen Kopulationscharakter hingewiesen, auf die »spitzen Schreie«, die dem Gebrüll des Diktators folgten. Man hat einfach nicht bemerkt, dass Hitler die Tradition nur etwas zu wörtlich nahm.
Kein Wunder, dass diese Form der Redekunst in dem Augenblick in Schwierigkeiten geriet, als sich das Geschlechterverhältnis neu formierte. Spezifisch »männliche« Elemente wie eine hochgestochene Argumentation verschwinden oder werden um »weibliche« Elemente ergänzt, wie sie von erzählerischen Einlagen ausgehen, die statt auf Bewunderung des Redners auf Empathie mit der vorgetragenen Sache ausgehen. Während diese Zeilen entstehen, höre ich von EU-Parlamentspräsident Martin Schulz, dass er seine Reden, in denen er sich um das Amt des Präsidenten der EU-Kommission bewirbt, mit dem Erzählen von »Stories« anreichert (»Dazu kann ich Ihnen eine Story erzählen …«). In der Knesset in Jerusalem handelte diese Story von einem palästinensischen Jungen, der ihn danach gefragt hatte, weshalb Israelis pro Tag über 70 Liter Wasser verfügten, Palästinenser nur über 17. Auch wenn sich hinterher herausstellte, dass die Zahlen stark übertrieben waren: Der andersartige Mechanismus von Überzeugungsarbeit durch Geschichten statt durch logische Schlussfolgerungen wird durchaus deutlich. Übrigens passt dies zu den Beobachtungen heutiger Neurowissenschaftler, die in ihren listigen Experimenten herausgefunden haben, dass Hörer vor zu direkt oder gar aggressiv vorgetragenen Argumenten zurückschrecken. Die argumentativ und/oder sprachkünstlerisch hochaufgerüstete Macht der Rede kann so gesehen geradezu kontraproduktiv sein, jedenfalls stellt sie sich als alles andere heraus denn eine Art Naturkonstante. Man muss sich eher darüber wundern, wie lange sich das Konzept in der europäischen Kultur behaupten konnte.
Letztlich hätte man schon lange gewarnt sein können. Überzeitlich Gültiges gibt es nicht allzu oft. Dafür viel Eurozentrismus, der von sich auf andere schließt, ohne die anderen auch nur der Erwähnung wert zu finden. Sollte das nicht auch für die Redekunst gelten, für die Rede vor großem Publikum, wie wir sie in der Politik, in den Gerichten, in den Kirchen kennen? So dass die Könner einer Tradition angehören, die in oder vielleicht sogar für Europa bzw. in der Folge für die europäische Kultur insgesamt erfunden und sehr lange weitergereicht wurde? Und das im Gegensatz zu anderen Traditionen, die wir nur nie wirklich kennengelernt, weil wir ihnen ohnehin nicht allzu viel zugetraut haben? Eine anstrengende Überlegung, die rasch verpuffen könnte, wenn man bedenkt, zu welchem Vergleich sie zwingt. Zum Vergleich etwa mit arabischen oder asiatischen Kulturen und all den anderen, die es auf dieser Erde gab und gibt. In diesem Buch wird aus Gründen beschränkter Kompetenz ein vorsichtigerer Weg eingeschlagen. Kein großangelegter Vergleich, aber auch kein allzu naiver Eurozentrismus. Ich suche nach einer Beschreibung der europäischen (immer mitgedacht: der von Europa beeinflussten wie etwa der amerikanischen) Redekunst als einer klar datierbaren Erfindung, die zum ebenso klar verfolgbaren Erfolgsmodell wurde und zuletzt noch Obama hervorgebracht hat. Aber ich bin vorsichtig, rechne mit Variationen, die letztlich mit dem nicht wirklich bewussten oder bewusst gewordenen Narrativ von der Macht der Rede zusammenhängen.
Die Redekunst europäischer Tradition – nur so viel sollte zunächst deutlich werden – ist nicht alternativlos, weil universalistisch, oder gar universalistisch und deshalb alternativlos. Diese Redekunst ist nur eine perfekt ausgebaute Redekunst mit einer großen Erfolgsgeschichte. Es geht nicht darum, diese Redekunst als einen Irrweg zu entlarven. Aber es scheint angebracht, sie einmal gewissermaßen von außen zu betrachten, jedenfalls von einem Standpunkt, der sie in ihrer Konstruktion zu verstehen sucht – und damit als Mythos ebenso enttarnt wie ernst nimmt. Denn dann zeigen sich neue Entwicklungen innerhalb dieser Kunst als Folgen von Einsichten, die an der Konstruktion eben doch gewisse Zweifel haben oder seine Möglichkeiten ausweiten wollen. Der alte, fast möchte man sagen: ewige Streit um etwas mehr oder etwas weniger Rhetorik in der Rede, in der Antike vorgeführt als Streit um Attizismus oder Asianismus, hat womöglich etwas zu tun mit dem Protest gegen ein zu aggressiv ausgelegtes oder auch ausgelebtes Überredungskonzept. Und die seit der Medienrevolution, speziell dem Fernsehen einsetzenden Veränderungen in Richtung einer mehr am Alltag, an der Konversation orientierten Rhetorik könnten sich als Kurskorrekturen an einem zu »männlich« gewordenen Ideal erweisen. Übrigens zeigt sich beim Hinweis auf den Parallelfall der Konversation, dass es auch in Europa immer schon eine »weibliche« Redekunst gab: Die Konversation wurde so gut wie nie als rhetorikfähig eingeschätzt, sondern als Sonderfall gesehen, in dem Kooperationsforderungen, ja Harmonieregeln galten, die jeder Form von Machtausübung misstrauen.
Es spricht also etwas dafür, die europäische Redekunst einmal im Ganzen zu betrachten: als Ringen mit ihrem von der Rhetorik zugeordneten, wenn nicht verordneten Narrativ. Ich stütze mich dabei stets auf die Redner und ihre Reden. Mir ist durchaus klar, dass diese Redner in der Regel in die Schule der Rhetorik gegangen sind und das Narrativ von der Macht der Rede von dort mitgenommen bzw. die wesentlichen Lehren verinnerlicht haben. Sie fanden zum Beispiel Hinweise auf eine nötige Sensibilität bei der Anwendung von Kunst, sofern der Redner in der Einleitung seiner Rede Wohlwollen erregen möge (ehe dann das eigentliche Unterwerfen beginnen kann). Aber die Umsetzung solcher Lehren zeigt eine Bandbreite, die die Lehrwerke niemals erreichten. Vor allem kann der entscheidende Punkt beim Blick auf die zeitgenössischen Rhetoriken nicht verstanden werden: nämlich die Art, wieweit sich die Redner das jeweils aktuelle Konzept der Kunst wirklich zu eigen gemacht haben. Es ist eine Sache, immer wieder eine Kunst des Redens auszubuchstabieren, die sehr alte Vorgaben auf den neuen Stand der Wissenschaft bringt. Und eine andere, mit den gelernten Vorgaben umzugehen, sie auf die Möglichkeiten der eigenen Persönlichkeit und der sozialen Bedingungen optimal abzustimmen. Die Überraschung liegt dann nicht unbedingt darin, dass Redner aktuelle Konzepte perfekt umsetzten, sondern darin, dass sie diese Konzepte kreativ handhabten. Dazu gehört die Beobachtung, dass selbst in Zeiten des theoretisch geäußerten Verdachts gegen Kunst die Kunst immer wieder dasjenige Element war, das in der europäischen Kultur offenbar unverzichtbar schien, wenn man Reden hielt.
Wer ins Inhaltsverzeichnis dieses Buches blickt, wird nach dem Voranstehenden vielleicht weniger irritiert sein, wenn er feststellt, dass ich die Redner nicht kontinuierlich aufführe, sondern in Pärchen. Der Kenner weiß, dass ich damit einer Idee folge, die Plutarch in seinen Parallelen Lebensbeschreibungen angewendet hat, wo er Alexander den Großen mit Caesar verglich oder Cicero auf Demosthenes folgen ließ. Plutarch (gestorben 125 n. Chr.) ging es darum, die Gleichwertigkeit oder Gleichrangigkeit der griechischen und römischen Kultur und damit letztlich die für ihn zusammengehörige antike Kultur als einzig denkbare zu demonstrieren. Mir kommt es darauf an, die europäische Redekunst über die verschiedenen Zeiten und Nationen hinweg in ihrer Besonderheit, ja in ihrer durch und durch historischen Sonderbarkeit herauszuarbeiten. Ich gebe zu, dass das eine oder andere Pärchen (wie bei Plutarch auch) etwas zusammengezwungen wirkt. Aber abgesehen vom auflockernden Effekt vermeidet diese Darstellung eine Konsequenz der Chronologie, die ich schlicht ausschließen möchte: die Suggestion von »Entwicklung«, das Erzählen einer »Geschichte« der Redekunst, die jedenfalls mit den von mir benutzten Quellen nur auf Willkür hinauslaufen kann. Ich interessiere mich nicht für eine irgendwie motivierte Abfolge der Redner und ihrer Reden, sondern für ihre immer neue Umsetzung der fixen Idee von Macht und Unterwerfung mit den Mitteln von Kunst. Statt zu kontinuierlicher Entwicklung hat dies im Übrigen eher zu überraschenden Wiederholungen oder eigenwilligen Schleifen geführt.
Die Betrachtung ist – zusammengefasst und zugespitzt – durch und durch historisch, sofern jede Rede (nach Maßgabe des hier zur Verfügung stehenden Platzes) möglichst sorgfältig in ihren Kontext eingebettet wird. Aber sie ist noch mehr systematisch, sofern das Interesse dem speziellen Punkt ihrer im Tiefen gelegenen Einheit über die Zeiten hinweg gilt. Plutarch interessierte sich ebenfalls nicht für Chronologie, sondern zeigte, wie vernarrt die Römer in die griechische Kultur waren. Ich möchte zeigen, wie vernarrt die europäische Redekunst in die Kunst war und sich nicht vorzustellen vermochte, dass Überredung auch anders zustande kommen kann als nach dem Konzept von Überwältigen und Sichunterwerfen. Was Aristoteles als Erster aus der zeitgenössischen Praxis herausgelesen hat, sollte sich zum immer weniger befragten Mythos verfestigen. Wir haben in der jüngsten Vergangenheit auf vielen Gebieten lernen müssen, dass selbstverständliche Gewohnheiten oder Praktiken kulturell geprägt sind. Selbst dem Gedächtnis sind soziale Voraussetzungen nachgewiesen worden, die in verschiedenen Kulturen variieren. Es darf eigentlich nicht verwundern, dass dies auf unsere Art zu reden ebenfalls zutrifft. Wir »bewohnen« (Jan Assmann) in den verschiedenen Kulturen nicht nur unsere Erinnerungen auf je spezifische Weise, wir »bewohnen« auch durchaus unterschiedliche Häuser des Redens. Wie das europäische Haus aussieht, was ihm an Umbauten nicht erspart blieb und worin möglicherweise seine Zukunft liegt, soll im Folgenden näher in den Blick gefasst werden.
Noch stärker zusammengefasst und zugespitzt: Es geht nicht darum, die Geschichte der Rhetorik »umzuschreiben«, sondern es geht um den Versuch, eine »andere«, weniger bekannte, vielleicht auch aufgrund der Materialfülle schwerer zugängliche Seite dieser Geschichte herauszuarbeiten: nämlich der rednerischen, nicht der theoretischen Rhetorik, der europäischen, nicht einer idealen oder idealisierten Rhetorik, schließlich um den für diese europäische Rhetorik so zentralen Aspekt der Macht, den man besser versteht, wenn man ihn nicht als naturgegeben hinnimmt, sondern als gemacht oder gar als Mythos. Die Anordnung des Stoffes in Pärchen statt in großen Linien mag die äußere oder äußerliche Form der Andersheit darstellen. Vielleicht können Leserinnen und Leser damit jedoch am leichtesten für den inneren oder tieferen Aspekt der Betrachtung gewonnen werden.
Ein griechischer »Sonderweg«?
Nach einem hübschen sprachlichen Bild, das Augustinus zugeschrieben wird (ich habe die genaue Stelle leider nie gefunden), geht der Anfang in allem Fortschritt mit. Es ist klar, was dies für das hier vorliegende Unterfangen bedeutet: Falls es eine europäische Redekunst mit eigener Kontur gegeben hat, ist der Anfang von größter Bedeutung. Dazu existiert eine vielzitierte These wiederum schon aus der Antike. Sie stammt von Cicero und steht in dessen Geschichte der Redner, dem Brutus. Dort liest man, die Redekunst sei als letzte aller Künste (also nach Dichtkunst, Musik, Tanz usf.) in Griechenland erfunden worden, und zwar im Zusammenhang mit der Entstehung der Demokratie in Zeiten des Friedens. Cicero nennt auch einen ersten Namen – es ist Perikles:
Diese Epoche also war es, die als erste in Athen einen nahezu vollkommenen Redner hervorgebracht hat. Denn nicht bei den Gründern eines Staates, nicht bei Kriegführenden, nicht bei Unterdrückten, die von tyrannischer Willkürherrschaft gefesselt sind, pflegt die Lust am Reden zu erwachen: des Friedens Gefährtin ist die Redekunst, Begleiterin der Ruhe, Zögling eines schon wohl geordneten Staatswesens.
Ich unterbreche kurz, um die wichtigsten Fakten in Erinnerung zu rufen. Perikles lebte von ca. 490 bis 429. Seine politische Tätigkeit fällt zusammen mit dem Ausbau der Demokratie in Athen, die wesentlich sein Werk war. 514 und 510 hatte der Adel die Söhne des letzten großen Tyrannen Peisistratos ermordet bzw. vertrieben und eine Adelsherrschaft (Oligarchie) eingerichtet. Dann radikalisierte sich das System. Immer mehr Rechte gingen an die (Voll)bürger, die in gewählten Gremien Gericht hielten und die Politik bestimmten. Der Adel verlor immer weiter an Einfluss, bis im entscheidenden Jahr 462/1 nur noch ein einziges Vorrecht übrig blieb: die Blutsgerichtsbarkeit im Areopag.
Damit hatte ein einzigartiger Prozess seinen Höhepunkt erreicht, den der Historiker Christian Meier in seinem Buch Athen. Ein Neubeginn der Weltgeschichte (1993) als »Sonderweg« bezeichnete: Eine kleine Stadt, die immerhin 490 bei Marathon und 480/479 bei Salamis und Platää die Perser besiegt hatte, organisierte sich selbst. Während ringsum Monarchien mit Einzelnen an der Spitze das Weltgeschehen prägten, entstand in Griechenland die erste Demokratie in einer (bloßen) Stadt. Ihre Ressourcen vergrößerte sie durch einen politischen Bund mit den in der Ägäis und am kleinasiatischen Ufer gelegenen Griechenstädten, und zwar unter dem (wie sich bald zeigte: vorgeschobenen) Motto des Schutzes gegen die Perser. Wenige Jahrzehnte gelang dies im Frieden mit dem Hauptkonkurrenten, nämlich Sparta. Dann wurde die Macht Athens so groß, dass selbst Perikles die Kräfte nicht mehr mit friedlichen Mitteln ausbalancieren konnte. 431 begann der Peloponnesische Krieg mit Sparta, bei dem sich Athen hinter seine Langen Mauern (rings um die Stadt mit Zugang zum Hafen) zurückzog und von See aus sein Überleben sicherte. 404 endete die Entwicklung in der Katastrophe, die die Demokratie in Athen hinwegfegte. Perikles war zu dieser Zeit längst tot. Er hatte den Kriegsausbruch nur wenige Jahre überlebt.
Was sagt Cicero? Dass die Kunst der Rede etwas mit Frieden zu tun habe, wofür die Demokratie die besten Voraussetzungen biete. Als Cicero dies schrieb, fand gerade das nächste große Experiment mit einem nichtmonarchischen Staat sein Ende: das republikanische Rom. Cicero setzt diesen Untergang in eins mit dem Untergang der Rede, der freien Rede, bei der »die Autorität und das Wort eines verantwortungsbewussten Bürgers den Händen wütender Mitbürger die Waffen noch entwinden konnte«. Die Macht der Rede ist danach nicht nur an die Potenz eines Redners, sondern auch an ein Publikum gebunden, das die Freiheit des Redens zulässt. Dies sei zum ersten Mal in Griechenland verwirklicht worden, in Athen. Aber nicht nur dort. Cicero fährt nämlich fort:
So sagt auch Aristoteles, es sei erst nach Vertreibung der Tyrannen in Sizilien gewesen, als nach langer Pause Privatansprüche wieder vor den Gerichten eingeklagt wurden: da hätten bei der scharfsinnigen, aber auch streitlustigen Anlage jenes Volkes zwei Sizilianer, Korax und Teisias, erstmals Regeln und Vorschriften verfasst. Zuvor sei nämlich noch niemand gewohnt gewesen, systematisch und kunstgerecht Reden zu halten.
Es gab also einen weiteren demokratischen Start in Griechenland, nach den Anfängen in Athen, aber vor der Radikalisierung von 462/1. Denn im sizilianischen Syrakus, einer von Korinth gegründeten Kolonie, hatte es drei Brüder gegeben, die als Tyrannen herrschten und beseitigt wurden, der letzte Bruder, Thrasybulos, im Jahre 466. Weil die Tyrannen viel Besitz an sich gerissen hatten, ging es nun um die Einklagung alter Ansprüche in ordentlichen Verfahren. Für Cicero liegt eine gewisse Pointe darin, dass dabei nicht nur geredet wurde, sondern kunstgerecht. Und dass weiterhin erste Lehrer auftraten, die dieses kunstgerechte Reden systematisierten. Um 466 gab es also nicht nur bereits Redner und Publikum, sondern auch eine systematisierte Redekunst in Form von (schriftlich fixierter) Rhetorik. Der zweite Fall, Syrakus, unterscheidet sich dabei vom ersten, von Athen, in einem wichtigen Punkt. Diesmal ist nicht von Politik die Rede, sondern vom Rechtswesen bzw. von Gerichten.
Was bedeutet das für die Erfindung der Redekunst? Stammt die Beredsamkeit nun aus der Politik oder aus dem Rechtswesen? Wer diesen Unterschied für weniger bedeutsam hält, weil in beiden Fällen wenigstens Friede zu den Voraussetzungen gehören, muss irritiert sein, wenn er von weiteren »Helden« der Beredsamkeit hört, die Cicero heranzieht. So heißt es, dass schon Homer etwas davon verstanden habe. Aber es folgt auch die Bemerkung, die Redekunst stamme nicht aus Griechenland, sondern aus Athen. Also doch nicht Homer in fernen Zeiten und unklarer Region, sondern diese konkrete Umgebung des demokratischen Stadtstaats. Ein ganzes Gemeinwesen stützt sich auf Reden, und es stützt sich dabei auf die Form von Rationalität, die sich bei Homer allenfalls andeutet: auf die Anerkennung von etwas Verbindlichem, das über bloßer Macht steht. Warum braucht man in Monarchien keine Reden? Weil ohnehin von oben und über alle Köpfe hinweg entschieden wird. Es wäre falsch zu glauben (und wird in diesem Buch ausführlich widerlegt), große Reden gebe es nur in Demokratien. Aber tatsächlich bilden Demokratien eine sehr günstige Voraussetzung für Reden, weil die politischen Entscheidungen ohne äußere Macht zustande kommen. Sie kommen eben durchs Reden zustande. Wie hat man sich dies näher vorzustellen?
Hören wir dazu etwas ausführlicher den Historiker Christian Meier mit seiner These vom Aufstieg Athens als »Sonderweg«. Inmitten monarchisch organisierter Staaten habe Athen den Nachweis erbracht, dass sich politische Macht auch anders organisieren lässt: eben verteilt auf im Prinzip alle – in diesem Fall scheiden universalistische Thesen von vornherein aus. Damit habe Athen allerdings eine Option eröffnet, die nicht mehr verlorenging, sondern im Gegenteil Europa prägen sollte. Athen machte eben den Anfang. Athen beschritt den Sonderweg. Wie konnte es dazu kommen? Einige der historischen Fakten kennen wir schon. Die Athener bauten seit Ende des 6. Jahrhunderts ihr politisches System Schritt für Schritt in Richtung Beteiligung der Bürger um. Es gab nur noch die Volksversammlung sowie die Gerichtsgremien – und Redner, die mit diesen Instrumentarien umgehen konnten. Derjenige, dem dies am besten gelang, wurde berühmt: Perikles. Einer, der ihn selbst erlebt hatte, war Thukydides, Verfasser der Geschichte des Peloponnesischen Krieges. Von ihm stammt auch das Urteil über die athenische Demokratie im Allgemeinen und Perikles im Besonderen. Sein berühmtes Fazit: Athen war »der Form nach eine Demokratie, in Wirklichkeit die Herrschaft des ersten Mannes«. Christian Meier hat das Urteil des Thukydides bestätigt. Und er hat Hinweise gegeben, worauf diese einzigartige Stellung beruhte. Sie beruhte tatsächlich auf einer überragenden Beredsamkeit. Wir wissen auch, wie dies genauer aussah. Perikles stand durchaus im Wettbewerb mit Konkurrenten, verdrängte sie aber und behauptete eine Ausnahmestellung. Sein einzig verbliebener Gegner war Kimon. Der hat es versucht, sich gegen die Macht von Perikles’ Beredsamkeit zu behaupten. Er ließ seine Anhänger in geschlossenen Blocks auftreten, um wirkungsvoller Beifall bzw. Missfallen auszudrücken. Aber gerade Kimon bezeugt die Redekunst von Perikles auf unvergleichliche Weise. Wenn er Perikles im Zweikampf niederringe, so Kimon, werde Perikles dies bestreiten, bis alle ihm glaubten.
Auf Perikles’ Beredsamkeit ist noch zurückzukommen. Zuvor aber im Zeitraffer mit der Hilfe von Meier die Fortsetzung der Geschichte Athens unter rednerischem Gesichtspunkt. Nach Perikles’ Tod gab es ein weiteres Duo, das die Geschicke der Stadt bestimmte: Nikias und Kleon. Nikias entstammte wie Perikles dem alten Adel, pflegte dessen Ideale, speziell eine betont ehrbare Lebensführung. Kleon gehörte dem neuen Typ des Geldadels an, war mit einer Gerberei reich geworden und benahm sich betont rüpelhaft. Und er biederte sich dem Volk an, nutzte dessen Schwächen aus, zum Beispiel den Blutdurst. Als sich im Krieg die Stadt Mytilene ergab, beratschlagte man in Athen über die Bestrafung. Kleon schlug gegen Nikias die Ermordung aller Männer sowie die Versklavung der Frauen und Kinder vor. Die Versammlung schwelgte in Rache, stimmte zu. Ein Schiff sollte den Beschluss übermitteln. Am nächsten Tag kam man zur Besinnung, hob das Urteil auf und schickte ein neues, das im letzten Moment das Schlimmste verhinderte. Kommentar von Thukydides: Das Volk fiel auf alles herein, beklatschte Pointen, bevor sie gefallen waren, wurde »Zuschauer der Worte«, unfähig, die Wirklichkeit wahrzunehmen. Als es später in brenzliger Situation wieder einmal um Krieg oder Frieden ging, setzte sich Kleon gegen Nikias mit Krieg durch und stellte (diesmal erfolgreich) den Antrag, eine eroberte Stadt zu zerstören und die Bürgerschaft hinzurichten. Erst als Kleon im Kampf fiel, kam es zum Frieden. Es ist der sogenannte Nikiasfrieden von 421, der für eine Zäsur im Peloponnesischen Krieg führte und Athen noch einmal die Vorherrschaft sicherte.
Aber die Geschichte ging weiter, und sie führte diesmal in die Katastrophe. Denn es gab ein letztes Duo mit einem noch gefährlicheren, weil noch klügeren Beteiligten: Nikias hatte es nun mit Alkibiades zu tun, einem Adligen vornehmster Abstammung mit ungezügeltem Machtstreben. Wieder einmal ging es um Krieg oder Frieden, zur Abstimmung stand das Ausgreifen nach Sizilien, nach Syrakus. Nikias war dagegen, aber Alkibiades wollte sich profilieren. Und er tat es mit dem Plädoyer für Krieg. Schon in der Auseinandersetzung mit der Insel Melos hatte Alkibiades nach dem Bericht des Thukydides seine Vorstellungen von Politik umschrieben: rücksichtslose Ausdehnung und Behauptung von Macht. In zynischster Weise wurden die Argumente der Melier zurückgewiesen, ihnen die Devise entgegengehalten, dass es Recht allenfalls bei gleichen Kräften geben könne, bei ungleichen nur pure Unterwerfung, auch und gerade mit der Folge von Hass (Machiavelli lässt grüßen). Alkibiades hatte damit bei der Volksversammlung Erfolg. Und er hatte es auch in der Frage der Expedition nach Sizilien, die erst scheiterte, als man ihn abgesetzt hatte. So nahm das Schicksal Athens endgültig seinen Lauf. Ohne rechte Führung ging der Peloponnesische Krieg verloren. 411 folgte ein Staatsstreich mit Auflösung der Demokratie und Herrschaft des Adels. Dann kam es unter Alkibiades, inzwischen rehabilitiert, zur Wiederherstellung der Demokratie. Aber das Chaos war komplett. Siegreiche Feldherren wurden wegen unterlassener Bergung eigener Leute zum Tode verurteilt. Die letzten Schlachten gingen verloren, Athen kapitulierte 404. Es folgte das Schreckensregiment der sogenannten 30 Tyrannen, ehe zuletzt erneut die Demokratie wiederhergestellt wurde.
Warum all diese historischen Fakten? Weil sich zeigt, dass es mit dem Zusammenhang von Demokratie und Redekunst komplizierter ist, als jedenfalls Cicero es andeutete (und Walter Jens wieder aufgriff). Die Demokratie kam nicht ohne Redekunst aus, aber sie lief auch aufgrund der Bindung an die Redekunst gründlich aus dem Ruder. Die Macht der Rede mochte in einzelnen Fällen groß sein, in anderen versagte sie oder zeigte gar ihre Kehrseite im Sieg der Unvernunft. Der griechische »Sonderweg« in die Demokratie war wohl wirklich weltgeschichtlich von unschätzbarer Bedeutung. Und mit diesem »Sonderweg« hängt auch der Aufstieg der Redekunst in einer ganz bestimmten Form zusammen. Nur garantierte die Demokratie keine Redekunst, in der Redner ihre Macht zum Besten der Allgemeinheit nutzten. Fast das Gegenteil ist der Fall. Die athenische Demokratie wurde ruiniert – durch Redner. Man kann allenfalls sagen, dass die Demokratie eine Redekunst hervorbrachte, die doppelgesichtig war, zum Guten ebenso ausschlagen konnte wie zum Schlechten. Das erste Experiment mit der Verlagerung von Macht ins Reden ging jedenfalls zwiespältig aus. Nicht nur monarchische Macht, die Macht des Befehls, kann Unheil anrichten, sondern auch rednerische Macht. Das ist das Ergebnis, wenn man auf die politische Entwicklung sieht.
Aber es gibt noch eine andere Erfahrung, die in Griechenland mit dem Reden gemacht wurde. Sie liegt in der Entdeckung der eigenartigen Form von Rationalität, die dem Reden zugrunde liegt bzw. auf die sich die Macht der Rede stützt. Auch in diesem Fall muss man sich wenigstens in groben Zügen die Entwicklung klarmachen.
Rationalitätsvertrag
Diese Entwicklung beginnt vor den demokratischen Zeiten, sie lässt sich erstmals bei Homer fassen. Zwar spielen in der Ilias und in der Odyssee, datiert auf die zweite Hälfte des 8. Jahrhunderts v. Chr., noch die Götter eine entscheidende Rolle, sofern sie willkürlich in das menschliche Schicksal eingreifen und Fragen nach Recht und Moral an den Rand drängen. Aber Einzelne lehnen sich gegen Willkür und Schicksal auf und haben auch Erfolg – davon wird noch die Rede sein. Den entscheidenden Schritt aus dieser Welt tat dann die Tragödie, die seit Anfang des 5. Jahrhunderts beim Fest der Großen Dionysien Jahr für Jahr vor der gesamten Athener Bürgerschaft aufgeführt wurde. Schon in der ersten erhaltenen überhaupt, in den 472 aufgeführten Persern des Aischylos (übrigens eines Mitkämpfers bei Marathon und ausgerechnet mit dem jungen Perikles als Chorführer), geht es um Maßhalten als eine Tugend, deren Verletzung in den Untergang führt. Vor den versammelten Athenern, die gerade dem Untergang durch die Perser mit knapper Not entgangen waren, zeigt das Stück Mitleid mit dem unterlegenen Angreifer. Und nicht dass Xerxes nach Athen zog, sondern dass er beim Übergang über den Hellespont das Meer geißeln ließ, als es sich gegen einen Brückenbau wehrte, gilt als Untat. Xerxes ist an seiner Hybris gescheitert, an einer Untugend, die sich an der Vernunft versündigt, was sich bitter rächen muss.
Die Tragödien zeigen an solchen Beispielen jedenfalls das Gegenbild. Bestehen können Menschen nur bei Befolgung von Tugenden, deren wichtigste vier (die späteren Kardinaltugenden) schon Aischylos selbst vor ihrer endgültigen Systematisierung bei Platon aufzählt: Weisheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Maß. Viele Tragödien buchstabieren diese Tugenden regelrecht aus. In der Orestie des Aischylos von 458 geht es etwa um die Gerechtigkeit. Dumpfer Mythos liegt zugrunde: Die Götter scheinen gnadenlos ein Geschlecht zu verfolgen. Agamemnon, der seine Tochter Iphigenie für guten Fahrtwind nach Troja opfern will (was nur die Götter verhindern), wird von seiner Frau ermordet, was wiederum der Sohn rächt, indem er die Mutter tötet. Dann kommt es zur Anklage vor dem Athener Blutgericht, dem Areopag (der gerade damals auf diese Funktion zurückgeschnitten worden war). Orest wird mit einer Stimme Mehrheit zum Tode verurteilt, irgendwie verständlich, er hat die Mutter umgebracht, gesteht es sogar. Aber irgendwie auch unverständlich, denn er tat es im Rahmen dieses furchtbaren Schicksals eines Hauses, an dem der Mord buchstäblich klebte.
Da tritt die Göttin Athene auf und gibt ihre Stimme ab: gegen die Verurteilung. Orest ist damit freigesprochen. Gerechtigkeit kann schwierig sein, auf jeden Fall etwas, was sich bloßer Willkür ebenso wie sturer Gesetzestreue entzieht. Und dieser Gerechtigkeit wurde nicht in einem Gewaltakt Genüge getan, sondern im freien Spiel der Kräfte, der Meinungen. Wie Homer kann auch die Tragödie diese Form von Rationalität (noch) nicht ohne Götter inszenieren. Aber die Rationalität ist da und durch nichts mehr wegzukomplimentieren. Nur ist sie immer gefährdet. Antigone geht in der gleichnamigen Tragödie des Sophokles (aufgeführt wahrscheinlich 442) in den Tod, weil sie sich gegen Kreon auflehnt, der den Bruder (wegen schlimmer Verfehlung) nicht beerdigen lassen will (was eine noch schlimmere Verfehlung wäre). In der Medea des Euripides von 431 beklagt der Chor das Schicksal der Medea, die mit ihren Kindern von Jason schmählich verlassen wurde. Glaube und Treue seien auf den Kopf gestellt, heißt es, als würden die Flüsse aufwärtsfließen. Und dann: »Der Eide Kraft schwand und die Göttin Scham / Weilt nicht mehr in dem griechischen Land. In den Himmel flog sie.« Man weiß also um die Tugenden, von denen hier wieder eine besonders grundlegende genannt wird. Und man weiß, dass ihre Rolle als Stütze der Zivilisation gefährdet ist.
Woher haben dies Aischylos, Sophokles, Euripides – die großen Tragödiendichter, die in der Zeit des Perikles und dann des Peloponnesischen Krieges die Athener in die Probleme der Rationalität einführten? Die Antwort ist seit langem klar, auch wenn man über Einzelheiten streitet: Es handelt sich um eine intellektuelle Strömung, an der viele beteiligt waren, die als sogenannte Sophisten, Weisheitslehrer, auftraten. Eine ungleiche, unübersichtliche Truppe. Ihre Wirkung verdankten sie einem Skandal: Sie lehnten die alten Göttergeschichten mit ihrer Unmoral ab. Ein besonders radikaler Reflex dieser Meinung findet sich in einer Tragödie des Euripides von 431. Dort heißt es: »Denn wer behauptet, etwas über die Götter zu wissen, weiß nur eins, nämlich wie man Leute mit Worten beschwatzt.« Anderswo, bei dem heute weniger bekannten Kritias, gibt es schon den Slogan von der Religion als Opium fürs Volk. Die Berufung auf die Götter diene als Mittel, damit sich die Menschen an Gesetze hielten, im Übrigen würden überall verschiedene Ordnungen gelten. Bei einigen Völkern verbrenne man die Leichen der Väter, bei anderen esse man sie. Scheinbar göttliche Gebote erwiesen sich demnach als bloß überkommen, was leicht hinausläuft auf eine Philosophie des Skeptizismus, die an jeder Vernunft zweifelt. Aber dies ist bei den Sophisten selten der Fall, im Gegenteil. Es gibt moralische Gebote, man muss und kann deren Prinzipien erkennen. Nur beim Herkommen gibt es Willkür. Es lässt sich vorstellen, zu welchen Spannungen dies führte.
Für uns von großer Bedeutung ist die Tatsache, dass einige Sophisten diese Überzeugungen mit der Redefähigkeit verknüpften. Wenn es keine Instanz außer der Vernunft gibt, rückt die Wahrheit in die Überzeugungskraft. Nur drohte hier der nächste Schock. Einige Sophisten taten nichts lieber, als den Beweis dafür anzutreten, dass mit entsprechender Kunst jedes Argument durchzusetzen ist, vor allem immer auch das Gegenteil. Als Gorgias aus Sizilien 427 nach Athen kam, brillierte er mit einer Rede zum Lob der Helena, die jeder mythosfeste Athener verabscheute, weil sie den Trojanischen Krieg ausgelöst hatte. Aber Gorgias deklinierte mögliche Gründe für Helenas Verhalten durch und siehe da: Sie wurde von Paris entführt, folgte nur einem Zwang, für den sie nicht zur Rechenschaft zu ziehen ist. Nicht ohne Begeisterung wurde Gorgias überall in Griechenland als Starredner engagiert, durfte bei den Olympischen Spielen auftreten und sogar im ansonsten kulturell weniger engagierten Sparta. Entsprechend gelangte er zu Reichtum, wie überhaupt Redner nun reich wurden. Hippias von Elis, ein Spezialist für einen Seitenzweig der Rhetorik, die Mnemotechnik (mit deren Hilfe er 50 Namen nach einmaligem Vorsprechen wiedergeben konnte), prahlte mit diesem Reichtum, was Platon dann ironisch als »Beweis« seiner »Weisheit« aufführt. Überhaupt hat sich Platon mit diesen Sophisten und Redelehrern auseinandergesetzt, zwei von ihnen, Gorgias und Protagoras, einen kompletten Dialog gewidmet – darüber später mehr.
Für uns am wichtigsten ist dabei Protagoras. Es sind zwei schwer interpretierbare und von Platon eher polemisch verzerrte Aussagen, die so schwer wiegen. Die eine spricht vom Menschen als Maß aller Dinge, was auf jeden Fall darauf hinausläuft, dass Normen nicht von oben kommen oder sonstwie Ewigkeitswert besitzen. Vielmehr werden sie im Für und Wider erstritten, zu jeder Behauptung existiert eine Gegenbehauptung. Folglich gibt es Gültigkeit nur im Streit oder auch Wettstreit der Meinungen. Hier wurzelt das, was man als das »Könnensbewusstsein« der Sophisten bezeichnet hat. Die andere Aussage wiegt noch schwerer und ist auch noch schwerer zu deuten: Sie spricht davon, dass sich der schwächere logos zum stärkeren mache lasse. Unter logos ist dabei eine vorgetragene »Meinung« oder ein »Argument« zu verstehen. Bei »schwächer« und »stärker« darf man nicht an »schlechter« und »besser« denken. Es geht also nicht darum, dass bei entsprechendem Können jede Dummheit erfolgreich vertreten werden kann. Was gemeint ist, sieht man eher am Beispiel des Perserkriegs mit einem stärkeren Feind (den Persern) und einem schwächeren Verteidiger (den Griechen). Schwächer bedeutet hier nämlich: auf den ersten Blick schwächer – wenn man nicht an Besonnenheit, Klugheit, Tapferkeit denkt. In der Rede kann der entsprechend »weise« Redner Irrtümer oder Falscheinschätzungen aufdecken. Ja, dazu ist die Rede eigentlich da. Sie ist das Dorado derjenigen, die sich nicht einschüchtern lassen, die im Tosen der Meinungen das »Richtige« finden. Oder anders ausgedrückt: Rationalität stellt sich nicht von selbst ein. Sie muss vertreten werden. Und vertreten wird sie durch Redner.
Dabei aber kommt nun etwas Entscheidendes ins Spiel, das besonders Aristoteles klar gesehen hat. Rationalität kann nicht allein für sich selbst betrachtet werden, sondern nur zusammen mit dem Publikum, für das sie entwickelt wird – jedenfalls in allen Fragen, die mit dem wahren Leben und seinen grundsätzlichen Unwägbarkeiten zu tun haben. In der Geometrie ist es anders, in der Geometrie überredet man nicht, sondern lehrt man, weil es klares Wissen gibt. In der Politik kann man davon nicht ausgehen, hier gibt es nur Wahrscheinlichkeiten. Und genau dafür gibt es nach Aristoteles eine Redekunst, ein methodisches Vorgehen auch auf Feldern, auf denen Methode etwas anderes bedeutet. Das muss man als Redner ebenso anerkennen wie als Publikum. Redner und Publikum schließen sozusagen einen Vertrag über die Anerkennung einer geminderten Form von Rationalität. Wonach die große Pointe folgt, nämlich mit der Ersetzung oder mindestens Stützung von Rationalität durch gewisse Hilfsmittel: durch die (Dreiheit von) Rednerpersönlichkeit, durch argumentatives Wissen und durch sprachliches Können. Weil auf gewissen Gebieten Rationalität nicht in ihrer wissenschaftlichen Idealform anwendbar ist, akzeptiert man die Macht der Redekunst. Persönlichkeit, Argumente und sprachliche Fähigkeiten ersetzen »objektive« Rationalität. Das ist der Vertrag: die Partnerschaft zwischen Redner und Publikum, das Einverständnis darüber, dass Meinungen mit Gründen vertreten werden und der Redner dabei zusätzliche, ja »unsachliche« Mittel einsetzen darf, diesen Gründen Gewicht zu verleihen.
Es ist schon eine durchaus eigenartige Idee, die Aristoteles als das Natürlichste von der Welt hinstellt. Es geht wirklich um »Überreden«, jemanden durch Reden zu etwas bewegen (als Sinn von lateinisch persuadere), um das Ausspielen von Macht beim Reden, die dann vom Publikum genossen werden kann. Der im humanistischen Gymnasium aufgerissene Abgrund zum angeblich allein wirklich rationalen »Überzeugen« ist ganz unhistorisch, knüpft an lateinisch convincere an, jemanden durch Zeugen zur Anerkennung einer Tatsache bringen. Nein, auch überreden ist rational, nur eben in dieser geminderten Form, die man anerkennen muss. Erst die Aufklärer entdeckten im persuadere die »Suada« und drehten darauf ihre polemischen Pirouetten. René Descartes spielt in den ersten Paragraphen der Regeln zur Ausrichtung der Erkenntniskraft aus dem Jahre 1628 mit dem Gegensatz von »erkennen« und »mutmaßen«, spricht beim Mutmaßen von einem »Aufputzen« von »Hirngespinsten mit Gründen« (Regel 2). Als Kant in seiner Kritik der Urteilskraft von 1790 (im berühmten § 53) die Rhetorik verurteilte, sprach er weder von »überreden« noch von »überzeugen«, sondern stellte der »Kunst, sich der Schwächen der Menschen zu seinen Absichten zu bedienen« das »ruhige Nachdenken« gegenüber. Wo dann doch einmal die Überredung ins Spiel kommt, fällt das Urteil vernichtend aus: »Hat [das Fürwahrhalten] nur in der besonderen Beschaffenheit des Subjekts seinen Grund, so wird es Überredung genannt.«
Aristoteles erhielt also seine Antwort, es hat lange genug gedauert. Nur haben sich die Redner wenig darum bekümmert. Sie interessierten sich ohnehin wohl nur in Ausnahmefällen für die Probleme der Rationalität, sondern folgten den Konsequenzen, die früh in Griechenland gezogen wurden. Und man muss sagen: Sie hielten sich erstaunlich genau an Aristoteles und seine Vorstellungen von dieser geminderten Form von Rationalität, mit der sich die realen Probleme in der Welt besser lösen ließen als mit einer Form von Wahrheit, die nur in der Geometrie durchzuhalten ist. Die Demokratie – so lässt sich zusammenfassen – war es nicht unbedingt und vor allem nicht allein, die am Anfang der Redekunst steht. Von mindestens gleicher Bedeutung war der beschriebene Rationalitätsvertrag, der letztlich in der Anerkennung von rednerischer Kunst als Ersatz besteht. Damit hat Europa seine Erfahrungen gemacht, gute und schlechte. Es war auf jeden Fall ein erfolgreiches Rezept, auch anpassungsfähig und von mancherlei Wandlungen geprägt. Man wüsste gerne, was genau zu seiner Auslösung und seinem so grandiosen Erfolg führte. Aristoteles hat es nicht gewusst, sondern sich mit dem Argument der Natürlichkeit herausgeredet. Dabei ist es dann bis heute mehr oder weniger geblieben.
Priamos und Häuptling Seattle
Es ist Zeit für einen Test mit konkreten Rednern. Ich sprach von einem europäischen Redner, der im Zusammenhang mit der griechischen Demokratie eine Art Rationalitätsvertrag mit seinem Publikum einging. Es ist klar, was fehlt. Es müsste eine Alternative aufgezeigt werden: ein nichteuropäischer Redner mit nichteuropäischer Redekunst. Wo wären Unterschiede zu erwarten? Ganz sicher nicht im Sinne eines Mehr oder Weniger an Rationalität, wie man es einmal unter kolonialistischen Vorzeichen ungeniert angenommen hat. Es könnte aber sein, dass es andere Anforderungen an das gibt, was ich notdürftig zusammenfassend als Rationalitätsvertrag bezeichnet habe. In welcher Richtung man dabei suchen könnte, möchte ich versuchsweise an einer kleinen Parallele zeigen.
Ich ziehe zunächst den Autor heran, den Cicero immerhin als allerersten bzw. allerfrühesten nennt: Homer. Es geht um die Ilias, das Epos, das den Kampf um Troja schildert, vor der Fortsetzung durch die Odyssee mit der Irrfahrt des Odysseus nach dem Sieg der Griechen. Die beiden Werke können nach heutigem Kenntnisstand nicht demselben Autor zugeschrieben werden, gehören aber in eine gemeinsame Tradition mit viel Bearbeitung der Texte. Mit diesem Doppelschlag beginnt auf jeden Fall im 8. vorchristlichen Jahrhundert die europäische Epik. Und sie beginnt unfassbar perfekt, mit großartigen Figuren und einer souveränen Handlungsführung (vom Kampf um Troja werden insgesamt nur 50 Tage berichtet, den Schluss mit der brennenden Stadt und den fliehenden Bewohnern erzählt Odysseus in der Odyssee). Und darunter immer wieder Reden oder redenartige Auftritte – sie machen mehr als die Hälfte des gesamten Textes aus.
Eine dieser Reden findet sich schon fast am Ende der Ilias. Der griechische Held Achill hat nach langem Schmollen in den Kampf gegen die Trojaner eingegriffen, weil sein Freund (und Geliebter) Patroklos gefallen war. Rasend vor Wut gerät er an den trojanischen Helden Hektor, besiegt ihn, tötet ihn. Aber damit nicht genug, bindet er den Leichnam an sein Pferd und umrundet auf diese schaurige Weise jeden Morgen das Grab von Patroklos. Zeus selbst, der den Tod von Hektor wollte, weil er von Anfang an auf Seiten der Griechen stand, kann dies nicht mehr mit ansehen und lässt Achill durch dessen eigene Mutter, die Göttin Thetis, um die Herausgabe des Leichnams bitten. Achill aber bleibt hart. So kommt es zum großen Showdown. Hektors Vater Priamos selbst geht in die Höhle des Löwen, zum Mörder seines Sohnes, und bittet ihn um die Leiche. Das geht nicht ohne Götterhilfe, in diesem Fall mit einem Geleit durch Hermes, der Priamos an allen Wachen vorbei in Fantasy-Manier durch die Lüfte ans Ziel bringt. Dann steht Priamos vor dem überraschten Helden, der gerade sein Mahl beendet hat (wundervoll wiedergegeben auf zahlreichen Vasenbildern), und muss sein Anliegen vortragen.
Wer kleinlich ist, wird das Folgende für ein Gespräch halten, denn es folgen Rede und Gegenrede. Aber Priamos’ Beitrag bietet Redekunst, verlässt sich auf sie. Priamos kommt nicht einfach mit einer Bitte oder gar einem Befehl. Damit hat Zeus es durch Thetis versucht, mit der ganzen Autorität des Obersten der Götter. Genau das hat nichts bewirkt. Priamos will jedoch etwas bewirken, er will die Leiche. Und so sagt er etwas, was auf dieses Gegenüber, auf dieses sehr kleine, aber sehr unangenehme Publikum namens Achill abgestimmt ist. Er sagt etwas, was Achills Meinung ändern, was Achill einsehen soll. Was ist dies? Nachdem er die Knie des Mörders umschlungen und seine Hände geküsst hat, heißt es:
Deines Vaters gedenk, o göttergleicher Achilleus,
Sein[er], der bejahrt ist wie ich, an der traurigen Schwelle des Alters!
Das hat Erfolg. Zwar bietet Priamos auch noch reichlich Lösegeld und jammert Achill vor, dass Hektor nur der letzte von insgesamt 50 Söhnen war, die er alle vor Troja verloren hat. Aber er endet mit diesem entscheidenden Argument, dem noch eine nicht unwichtige Nuance hinzugefügt wird:
Scheue die Götter demnach, o Peleid, und erbarme dich meiner,
Denkend des eigenen Vaters!
Die Erinnerung anden Vater soll ein Mitleid auslösen, das dem Willen der Götter entspricht. Im Griechischen steht hier ein entscheidender Begriff: aidos, übersetzt meist als »Scham«, als Anerkennung eines Gesetzes, das über menschlichen Einschätzungen steht und das man besser beachtet. Es gibt also (auch schon bei Homer) ein Gebot, das niemand gebietet, so dass sich auch ein Achill daran halten kann, ohne sein Gesicht zu verlieren.
Das funktioniert. Denn alsbald sitzen beide heulend nebeneinander, Priamos in Gram um seinen Sohn und Achill in Gram um den Vater, den er, der einzige Sohn, zehn Jahre nicht umsorgen konnte. Zwar wird es noch einmal gefährlich, als Achill zur Besinnung kommt und Priamos einen Vortrag darüber hält, dass er sich keineswegs als Einziger beklagen könne, auch nicht wegen dieser vielen verlorenen Söhne. Denn dahinter stünden nur die Götter, die gute und schlechte Lose verteilten, wobei ihm, Achill, auch nur der baldige Tod bestimmt sei. Nein, das Jammern rührt ihn überhaupt nicht, im Gegenteil, er droht, sich seine Milde noch einmal zu überlegen. Zeus’ Aufforderung hat schon nicht geholfen, Lösegeld noch viel weniger – dafür ist Achill zu reich und zu wütend. Es ist nur dieses Mitleid mit dem Vater, in dem Achill den eigenen sieht und das Gesetz anerkennt, dass man Väter zu achten hat. Es ist demnach wirklich rational, dies zu tun. Aber es ist auch rational, es gerade diesem wütenden Achill zu sagen, der sich normalerweise nichts sagen lässt. Priamos hat nicht mit der »Wahrheit« sein Ziel erreicht, sondern indem er den richtigen Nerv traf. Der große Achill gibt sich auf der ganzen Linie geschlagen. Er rückt nicht nur die Leiche heraus, sondern lässt sie von Spezialistinnen auch noch herrichten und gesteht Priamos schließlich zehn Tage Trauerzeit zu, während der alle Kämpfe vor Troja ruhen sollen.
Die Rede hatte also Erfolg, weil es eine kluge Rede war, eine rednerisch kluge. Kein Frieden, keine Demokratie, aber dieses Element von Rationalität, das die andere Seite einbezieht, auf die diese Form der Rationalität wirken soll. Das Nachsehen bei Homer wurde also belohnt. Cicero hatte recht mit dem Bezug, obwohl er nicht ganz zu seinem eigenen Konzept von Frieden und Demokratie passt. Darüber hinaus gibt es einen ganz anderen Pferdefuß, der den Wert dieser Rede einschränkt. Die alles entscheidende Idee nämlich kam nicht von Priamos. Es gab vielmehr einen Tipp von Hermes: Die Idee mit dem Vater war die Idee eines Gottes. Wenn also Redekunst, dann war sie an dieser wundervollen, aber auch sehr frühen Stelle keine menschliche. Sie verdankt sich noch dem Mythos, der ohnehin die Szenerie beherrscht. Aber man kann natürlich auch sagen: Die Stelle wurde nicht von einem Gott gedichtet, sondern von Homer. Der legte nur die Idee zu diesem Paradefall rednerischer Kunst einem Gott in den Mund. Fast 3000 Jahre später gibt es eine ähnliche Szene in Moskau, wo Bundeskanzler Adenauer über diplomatische Beziehungen mit der Sowjetunion verhandelt und unbedingt die deutschen Kriegsgefangenen heimführen will. Da wendet sich Carlo Schmid an Nikita Chruschtschow und appelliert statt an die »Gerechtigkeit« an die »Großherzigkeit des russischen Volkes« und hat damit Erfolg. Helmut Schmidt beruft sich auf Theodor Heuss in seiner Trauerrede auf Carlo Schmid, der die Szene so wiedergab: »Das sei das rechte Wort auf rechte Art gewesen, hat Chruschtschow entgegnet, nun könne man weitersprechen.«
So also halten Europäer Reden. Man kann nicht erwarten, dass dies eine erschöpfende Antwort ist. Das Beispiel enthält nur den Hinweis auf Rationales, auf den Redner als Publikums-Redner, als ein Redner, der seine Rede jedenfalls nicht in erster Linie an der Sache oder gar an der Wahrheit orientiert. Ganz von fern wird damit durchaus deutlich, worin Größe bei Rednern liegen könnte. Nicht im Erfolg, es hätte bei Achill auch schiefgehen können, wäre um ein Haar schiefgegangen. Aber im Anstreben von Erfolg mit bestimmten, und zwar auf keinen Fall auf bloßer Gewalt beruhenden Mitteln. Priamos hat das Überzeugende gefunden, sein Gegenüber (mit Hilfe eines Gottes) richtig eingeschätzt, seine Worte auf diese Einschätzung gebaut. Es hat gereicht. Die Dummheit mit dem Jammern hat Achill ihm nachgesehen. Im entscheidenden Moment aber bildeten Priamos und Achill eine gewisse Einheit des Verstehens. Ohne den Beitrag Achills hätte es kein Ergebnis gegeben. Priamos hat den Gedanken gefunden, Achill hat sich auf eine Formulierung eingelassen, die dieses Sicheinlassen ermöglichte. Europäische Reden beruhen auf einer Form von Rationalität, die statt auf Wahrheit auf dem Blick fürs Wirkungsvolle beruht. Noch kommt dieses Wirkungsvolle nur in einem Argument zur Geltung, noch ist es nicht das ganze Auftreten des Redners mit der aristotelischen Dreiheit von Autorität, logischen und sprachlichen Kunststücken. Aber es wird schon klar, dass es eines Zusammenspiels bedarf. Macht scheitert, wenn das Gegenüber mächtiger ist. Aber auch Rationalität scheitert, wenn das Gegenüber sich nicht auf sie einlässt, wenn sie nicht auf dieses Gegenüber abgestimmt ist. Redner verlassen sich auf Rationalität, aber nicht auf ihre. Der »gute« Redner weiß, was sein Gegenüber will.
Und nun die Gegenprobe mit einer garantiert nichteuropäischen Rede, wiederum nicht aus einer Blütezeit oder von einem besonders berühmten Redner. Im Jahre 1855 kam es in Washington zu einem denkwürdigen Auftritt. Der Präsident der Vereinigten Staaten, Franklin Pierce, hatte den indigenen Duwamish das Angebot gemacht, ihr Land zu kaufen und die Bevölkerung in einem Reservat unter Schutz zu stellen. Darauf wandte sich ihr Häuptling Seattle an den »großen Häuptling der Weißen« mit einer Rede, deren Übersetzung von dem amerikanischen Dichter William Arrowsmith in eine (von mir nicht beurteilbare) »authentische« Fassung gebracht wurde. Heute wird der Text an Schulen gelesen, wenn es gilt, sich Gedanken über Ökologie zu machen. Die Rede fungiert als bedeutendes und anrührendes Zeugnis eines Eintretens für die Bewahrung der Erde. Die folgende Interpretation will daran nicht das Geringste ändern, sondern nur eine zusätzliche Frage stellen: Worin unterscheidet sich Häuptling Seattle von europäischen Rednern?
Ich sehe die Antwort vor allem darin, dass diese Rede in geradezu provozierender Weise nicht auf Überredung angelegt ist. Sie hat durchaus eine klare Meinung, legt diese Meinung jedoch ohne Rücksicht auf das Gegenüber dar. Häuptling Seattle bedankt sich für das »freundschaftliche« Angebot, sichert zu, es sich zu überlegen, weiß aber, dass bei Nichtverkauf schlichte Gewalt droht. Seine Verhandlungspartner werden sich das Land mit ihren »Gewehren« nehmen. Dabei verweist er nicht auf das eklatante Unrecht, sondern auf sein Unverständnis des Ansinnens:
Wie kann man den Himmel kaufen oder verkaufen – oder die Wärme der Erde? Diese Vorstellung ist uns fremd. Wenn wir die Frische der Luft und das Glitzern des Wassers nicht besitzen – wie könnt Ihr sie von uns kaufen? Wir werden unsere Entscheidung treffen.
Diese Passage ist einer europäischen Argumentation deshalb nicht unähnlich, weil Vergleiche eine Rolle spielen. Aber es ist eben nicht so, dass das vorgetragene Argument auf den Verständnishorizont seines Hörers zielt. Es gilt vielmehr absolut. Häuptling Seattle hat ein klares Ziel. Er will nicht verkaufen oder nur deshalb verkaufen, um Schlimmeres zu verhüten. Das aber sagt er nicht bzw. deutet es höchstens an. Er sagt, warum das Ansinnen seiner Meinung nach »unmöglich« ist. Er vermittelt seine Auffassung, ohne Rücksicht darauf, wie diese Auffassung wirkt. Man denke noch einmal an Priamos vor Achill. Priamos will die Leiche seines Sohnes. Er sagt aber nicht oder jedenfalls nicht nur, was er für vernünftig, sondern was er (auf den Rat eines Gottes) für zielführend hält. Die Rede von Häuptling Seattle und ihre Wirkung auf uns beruht geradezu darauf, dass er dieser anderen Logik folgt: sich nicht auf Vorstellungen einzulassen, die ihm abwegig erscheinen. Häuptling Seattle will Erfolg ohne Eingehen auf den, der diesen Erfolg gewähren kann.
Von daher gibt es nicht nur keinerlei Schmeichelei gegenüber dem ungleichen Partner, sondern im Gegenteil klare Kritik:
Wir wissen, dass der weiße Mann unsere Art nicht versteht. Ein Teil des Landes ist ihm gleich jedem anderen, denn er ist ein Fremder, der kommt in der Nacht und nimmt von der Erde, was immer er braucht. Die Erde ist sein Bruder nicht, sondern Feind, und wenn er sie erobert hat, schreitet er weiter. Er lässt die Gräber seiner Väter zurück – und kümmert sich nicht. Er stiehlt die Erde von seinen Kindern – und kümmert sich nicht. Seiner Väter Gräber und seiner Kinder Geburtsrecht sind vergessen. Er behandelt seine Mutter, die Erde, und seinen Bruder, den Himmel, wie Dinge zum Kaufen und Plündern, zum Verkaufen wie Schafe oder glänzende Perlen. Sein Hunger wird die Erde verschlingen und nichts zurücklassen als eine Wüste.
Man kann angesichts dieser Ausführungen von einer Argumentation sprechen, die sich an logischer Stringenz kaum von einer europäischen unterscheidet. Die Beschreibung ist kraftvoll und unterstützt die Logik des Gesagten perfekt. Auch die Stilistik ist mit ihrer einprägsamen Bildlichkeit und den Wiederholungen so entwickelt, wie wir es von europäischen Reden her kennen. Eine besonders gelungene Stelle sei noch mitgeteilt:
Meine Worte sind wie die Sterne, sie gehen nicht unter. Jeder Teil dieser Erde ist meinem Volk heilig, jede glitzernde Tannennadel, jeder sandige Strand, jeder Nebel in den dunklen Wäldern, jede Lichtung, jedes summende Insekt ist heilig, in den Gedanken und Erfahrungen meines Volkes. Der Saft, der in den Bäumen steigt, trägt die Erinnerung des roten Mannes.
Aber man sieht: Die Wirkung ist anders berechnet. Sie ist nicht auf Überredung abgestellt, auch nicht in der Form einer Erregung von Mitleid (obwohl jedem heutigen Leser zum Heulen zumute sein dürfte). Sie ist überhaupt nicht an Erfolg orientiert, sondern eher an Würde. Es mag europäische Reden geben, für die man Ähnliches geltend machen kann. Aber dies ist nicht das, was wir an ihr als typisch erfassen. Umgekehrt dürfte Häuptling Seattle manchem europäischen Redner überlegen sein. Aber nicht in diesem wesentlichen Punkt einer Rede, die auf Wirkung berechnet ist und ein Ziel erreichen will.
Man könnte sich schließlich fragen, ob eine europäische Rede in diesem Fall erfolgreicher gewesen wäre, denn dem Häuptling war keinerlei Erfolg beschieden, das Volk der Duwamish hat nicht überlebt. Aber Erfolg ist immer das schlechteste Kriterium zur Beurteilung von Reden. Auch Demosthenes und Cicero hatten nicht immer Erfolg, gerade bei ihren wichtigsten Reden nicht. Redner mit deren Gaben dürften im Übrigen an diesem amerikanischen Präsidenten ebenfalls abgeprallt sein. Häuptling Seattle wirkt mit seiner Schlichtheit eher besser als die antiken Spezialisten. Eines aber sieht man deutlich: Der europäische Redner ist von Anfang an ein hohes Risiko eingegangen. Er hat darauf gesetzt, dass Rationalität als Kunst entwickelbar, ja bis zu einem gewissen Grade durch Kunst ersetzbar ist. Er hat sich von dieser Kunst Macht versprochen. Die Kalkulation ist weitgehend in Erfüllung gegangen, jedenfalls immer dann, wenn sich das Publikum auf den Pakt eingelassen hat. Der europäische Redner bietet so gesehen ein Experiment mit einer speziellen Form von bzw. des Umgangs mit Rationalität. An einer Figur wie Häuptling Seattle kann man immerhin erahnen, dass dieses Experiment nicht alternativlos war.