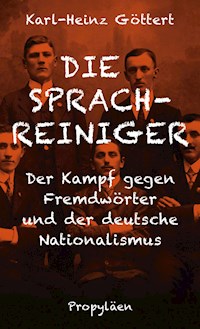
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Nirgendwo entwickelte sich der Sprachnationalismus des 19. Jahrhunderts so rigoros und militant wie in Deutschland. Und nirgendwo waren die Folgen derart fatal. Karl-Heinz Göttert liefert mit seiner historischen Studie des Allgemeinen deutschen Sprachvereins eine bittere Realsatire aus dem Giftschrank der deutschen Kulturgeschichte – mit hohem aktuellen Bezug. "Schmach über jeden Deutschen, der seine heilige Muttersprache schändet!" So wetterte Otto Sarrazin 1914 gegen alle, die es wagten, aus Fremdsprachen übernommene Lehnwörter zu verwenden. Er war der Vorsitzende des Allgemeinen deutschen Sprachvereins, der zwischen 1886 und 1943 versuchte, die deutsche Sprache von fremden Einflüssen reinzuwaschen. Unter viel Applaus fochten seine Mitglieder darum, Worte wie "Sauce" oder "Dame" aus dem Wortschatz zu entfernen. Dabei verband sich dieser Kampf mit einem Chauvinismus, der geradewegs in Fremdenhass mündete, den Kriegsausbruch als Chance auf Deutsch als Weltsprache begrüßte und schließlich den Rassismus der Nazis aufnahm. Der Germanist Karl-Heinz Göttert hat die so erfolglose wie unheilvolle Geschichte dieses dogmatischen Intellektuellenzirkels umfassend recherchiert. Sein Buch zeigt, wie vernunftbegabte Bildungsbürger auf nationalistische Abwege geraten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Das Buch
Nirgendwo entwickelte sich der Sprachnationalismus des 19. Jahrhunderts so rigoros und militant wie in Deutschland. Und nirgendwo waren die Folgen derart fatal. Karl-Heinz Göttert liefert mit seiner histori,schen Studie des Allgemeinen deutschen Sprachvereins eine bittere Realsatire aus dem Giftschrank der deutschen Kulturgeschichte – mit hohem aktuellen Bezug.
„Schmach über jeden Deutschen, der seine heilige Muttersprache schändet!“ So wetterte Otto Sarrazin 1914 gegen alle, die es wagten, aus Fremdsprachen übernommene Lehnwörter zu verwenden. Er war der Vorsitzende des Allgemeinen deutschen Sprachvereins, der zwischen 1886 und 1943 versuchte, die deutsche Sprache von fremden Einflüssen reinzuwaschen. Unter viel Applaus fochten seine Mitglieder darum, Worte wie „Sauce“ oder „Dame“ aus dem Wortschatz zu entfernen. Dabei verband sich dieser Kampf mit einem Chauvinismus, der geradewegs in Fremdenhass mündete, den Kriegsausbruch als Chance auf Deutsch als Weltsprache begrüßte und schließlich den Rassismus der Nazis aufnahm. Der Germanist Karl-Heinz Göttert hat die so erfolglose wie unheilvolle Geschichte dieses dogmatischen Intellektuellenzirkels umfassend recherchiert. Sein Buch zeigt, wie vernunftbegabte Bildungsbürger auf nationalistische Abwege geraten.
Der Autor
Karl-Heinz Göttert, geboren 1943 in Koblenz, war bis 2009 Professor für Germanistik an der Universität zu Köln. Seine Schwerpunkte sind Rhetorik, Stilistik und Konversation. Er hat historische Kriminalromane sowie Standardwerke über Sprache und Orgelmusik verfasst. Bei Ullstein erschienen von ihm Deutsch. Biografie einer Sprache und Alles außer Hochdeutsch. Ein Streifzug durch unsere Dialekte. Seine bei S. Fischer veröffentlichte Studie „Mythos Redemacht“ stand 2015 auf der Shortlist für den Preis der Leipziger Buchmesse.
Karl-Heinz Göttert
Die Sprachreiniger
Der Kampf gegen Fremdwörter und der deutsche Nationalismus
Propyläen
Besuchen Sie uns auch im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem Buch befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-2187-5
© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2019Lektorat: Carla SwiderskiTitelfotografie: © ullstein bild – imageBROKERUmschlaggestaltung: Morian & Bayer-Eynck, CoesfeldE-Book: Pinkuin Satz und Datentechnik, BerlinAlle Rechte vorbehalten
INHALT
Über das Buch und den Autor
Titelseite
Impressum
Prolog
»Pulver, Brot und Briefe waren die drei Hauptbedürfnisse«
»Hochemotionalisierter Rauschzustand«
»Lametta«
»Entsetzlich viel Mühe und Arbeit gemacht«
»Kriegserklärung gegen die französischen Eindringlinge«
»Abort«
»Nur der tief Gebildete kann Sprachreinigung üben«
»Mir fällt im Augenblick kein entsprechendes deutsches Wort ein«
»Blitzlicht« und »Drahtgruß«
»Unsere Altvorderen machten nicht viel Federlesens mit den fremden Ausdrücken«
»Fühlen die Unterzeichneten sich gedrungen, öffentlich zu erklären, daß sie solche Bevormundung entschieden zurückweisen«
»Giro«
»Wer es mit der deutschen Kultur überhaupt ernst nimmt, der stößt dabei auf die mannigfaltigsten fremden Einflüsse«
»Kein ehrlicher deutscher Mann kann das Bestreben rügen, echtgermanische Wörter vor Entfremdung und Entwendung zu bewahren«
»Signet«
»Überhandnehmende Sprachverseuchung im Gasthofs- und Vergnügungswesen«
»Um die Reinheit der Sprache in Meinem Heere zu fördern«
»Gymnastik«
»Von dem widerwärtigen Zustande, der ein Schandfleck ist auf dem Schilde deutscher Ehre«
»Franzosen und Amerikaner denken nicht daran, internationalen Rücksichten ihre Muttersprache zu opfern«
»Stahlskelettbau«
»Vollständig berechtigt, anstatt der verwelschten Sauce das Wort Salse zu brauchen«
»Auch in dieser Spracherscheinung treten die alten Erbfehler des deutschen Volkes hervor«
»Stadion«
»Das Fremdwort als Zeichen nationaler Stumpfheit und sprachlicher Versumpfung«
»Wieder einmal vom e«
»Knäckebrot«
»Weltbewährungsprobe deutscher Innerlichkeit«
»Die Saat, die der Allgemeine Deutsche Sprachverein ausgestreut hat, ist herrlich aufgegangen«
»telephonieren«
»Unter dem befreienden Einfluß des Krieges wagt hier mancher eine Änderung in unserm Sinne«
»Die Fremdwortverketzerung kommt den dunkelsten Instinkten des unwissenden Rohlings entgegen«
»Moral«
»Im deutschen Verfassungsgesetz überhaupt kein Platz für irgendwelche Undeutschheiten«
»Recht juristisches Deutsch«
»Autofriedhof«
»Diese hochgelehrten Herren können gar nicht mehr einfach sachlich denken und sich deutsch ausdrücken«
»Philosophie ist der systematische Mißbrauch einer eigens hierzu erfundenen Terminologie«
»ratifiziert«
»Die Fremdwörterei steht immer noch in Blüthe«
»Was kann widersinniger sein als Allegro, welches ein für alle Mal lustig heißt?«
»Jazz«
»Neben dem fetten Praha kaum halb so groß und in Klammern das dünne Prag«
»Der Gesamtverein und seine Zweigvereine sind nun durch die Wahl des Vorsitzers nationalsozialistischer Führung unterstellt«
»Sterilisation« und »Kastration«
»Der Deutsche Sprachverein ist die SA unserer Muttersprache«
»Schon aber hat die amtliche Sprachpflege begonnen«
»Rückwärtse«
»Von der überfremdeten, entleerten Allerweltslässigkeit zum deutsch-volkhaften Ursprünglichkeitswort«
»Blut und Boden, Rasse und Seele gelangen zum Ausdruck in dem Wunderwerk der deutschen Sprache«
»Fernseher«
»Die welschen Vornamen müssen wieder verschwinden«
»London vielleicht bald nur noch ein stinkender Trümmerhaufen«
»Heimaturlaub«
Epilog
Dank
Literaturverzeichnis
Feedback an den Verlag
Empfehlungen
Prolog
Ich bin als Kind viel mit dem Zug gefahren. Meine Eltern wohnten in Köln und meine Mutter zog es regelmäßig in ihr früheres Elternhaus in Ehrenbreitstein. Weil mein Vater bei der Bahn arbeitete, besaßen wir »Pfennigskärtchen« – pro Kilometer kostete die Fahrt einen Pfennig, was sie auch für die schmale Kasse eines bescheidenen Beamtenhaushalts erschwinglich machte. Meine ältere Schwester und ich mussten nicht besonders überredet werden, um mitzufahren. Das Reisen machte Spaß, auch wenn es mit dem »Bummelzug« lange dauerte und wir das Ende immer herbeisehnten. Richtung Ehrenbreitstein zählten wir zum Schluss die Stationen: Engers, Bendorf, Vallendar – raus. Und Richtung Köln war es, noch vor der Rheinbrücke mit Blick auf den Dom, die Reklame von 4711, deren Zahlen in riesige Buchsbaumhecken geschnitten die nahe Ankunft verhießen.
Aber noch etwas anderes ist in meiner Erinnerung haften geblieben. Mit der Reise per Bahn war ein gewisses Vokabular verbunden: Fremdwörter aus dem Französischen, die meine Mutter ganz selbstverständlich benutzte. Man löste also ein »Billett«, ging zum »Perron«, stieg in ein »Coupé«, bei Regenwetter bewaffnet mit einem »Parapluie«. Dies muss mir erst später aufgefallen sein, als sich alles geändert hatte und die vertrauten Wörter einen nachträglichen Glanz erhielten, eine unerwartete Exotik, die dem Reisen gut anstand. Ich hatte als Kind keine Ahnung, dass dieses Vokabular schon damals aus der Mode gekommen war. Am Mittelrhein wurde es aber in alter Anhänglichkeit noch gepflegt, obwohl an den Bahnhöfen die Schilder längst umgestellt waren, auf »Fahrkartenschalter« und »Bahnsteig« zum Beispiel. Es lag also etwas eigentümlich Subversives im Gebrauch dieser nur scheinbar harmlosen Bezeichnungen, was zu meiner Mutter eigentlich nicht passte. Sie war zwar selbstbewusst, rauchte auf alten Fotografien ihre Zigarette mit Silberspitze und trug gerne extravagante Hüte, doch Widerspruchsgeist, gar gegen den Staat, lag ihr völlig fern.
Dabei hatte dieser Staat schon ganze drei Generationen zuvor viel dafür getan, das Vokabular umzustellen. Zur Zeit der Reichsgründung 1871 gab es Ministererlasse, die anordneten, auf sämtlichen Schildern die gewohnten Vokabeln zu ersetzen. Man sieht an meinen Kindheitserlebnissen, wie schleppend eine solche Umstellung verlaufen kann. Was ich noch viel weniger wusste: Ein Verein hatte sich kurz nach jener großen Wende in der deutschen Geschichte gegründet, der sich der Verdeutschung aller Fremdwörter widmete und diejenigen, die sie trotzdem weiterverwandten, mit Hohn und Verachtung strafte. »Schämen« sollten sie sich, diese »Vaterlandsverräter«, »Sudler«, die sich am wichtigsten Gut überhaupt »versündigten«, an der »heiligen« Muttersprache. Hätte jemand im Zug meine Mutter auf diese Weise angegriffen, hätte ich wohl, meinem Alter entsprechend, mit Beißen und Kratzen darauf reagiert. Aber es war nie nötig. Die damaligen Mitreisenden sprachen nämlich die gleiche »verdorbene« Sprache. Sie verschwand erst, als auch der Verein knapp sechzig Jahre nach seiner Gründung sang- und klanglos untergegangen war.
Oder hatte er doch gewirkt? Das ist eine gute und nicht die einzige Frage, die sich heute stellt. Denn was bei Lichte betrachtet eigentlich sympathisch erscheint – wer sollte etwas gegen deutsche Begriffe haben –, ist mit einer höchst problematischen Geschichte verknüpft, die mit Sprache als solcher wenig zu tun hat. Der sinnvolle Einsatz fürs Deutsche verband sich nämlich von Anfang an mit einer Form von Nationalismus, die geradewegs in Fremdenhass mündete, den Ausbruch des Ersten Weltkriegs als Chance auf Deutsch als Weltsprache begrüßte und schließlich den Rassismus und Antisemitismus der Nazis aufnahm, ja sogar verstärkte. Das mag zunächst einmal unglaubhaft klingen, aber es ist gut dokumentiert. Große Bibliotheken besitzen heute noch die 58 Bände der Zeitschrift dieses Vereins, der sich »Allgemeiner Deutscher Sprachverein« nannte, sein Publikationsorgan zunächst als Zeitschrift des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins und dann unter dem Namen Muttersprache verbreitete, zwölfmal im Jahr, mit schwankendem Umfang. Zu Beginn und zuletzt waren es um die 200 Spalten pro Jahrgang, dazwischen auch mehr als 500. Von 1886 bis 1943 kamen fast 19 000 Spalten zusammen.
Dabei haftete dem Verein bis zum bitteren Ende etwas harmlos Operettenhaftes an, wenn man sein Thema »Sprachpflege« mit der großen Oper »Sprachwissenschaft« vergleicht. Die Akteure waren überwiegend keine Profis, drehten ihre immer gleichen Pirouetten mit der Forderung nach mehr Deutsch, nach »reinem« Deutsch als einzig denkbarem Fundament des soeben geeinigten Reiches. Nur dass es diesen Sprachreinigern weniger um Liebe als um Hass ging: um Hass auf alle, die ihre Art von Liebe zur Sprache nicht teilen wollten.
Wie ist das zu verstehen? Waren es überspannte Gefühle, exaltierte Torheiten? War es gar eine Art geistige Umnachtung? Jedenfalls spielt das Gefühl eine Rolle, selbst etwas Wesentliches verstanden zu haben, was andere unbegreiflicherweise nicht verstehen wollten: das »Wesen« der Sprache, ihre Funktion für Menschen, die nur Mensch sein können in einer dieselbe Sprache sprechenden Nation. Der Sprachreinigung, um die es ging, lag ein exaltiertes Sprachverstehen zugrunde, bei dem die Alarmglocken schrillten, sobald die vorgefundene Sprache diesem Verstehen widersprach. Dies war gepaart mit der Bereitschaft zum Widerstand, der rasch ins Kujonieren derjenigen ausartete, die nicht mitmachen wollten, nicht dem »Volk« zu dienen bereit waren, für das die gereinigte Sprache gedacht war.
Um es noch klarer zu formulieren: Die Sprachreiniger glaubten, ein einfaches Geheimnis verstanden zu haben, und rätselten, weshalb die anderen es nicht begriffen, nicht begreifen wollten. Dieses Geheimnis lautete: Die Gründung des Deutschen Reiches verlangt nicht nur eine gemeinsame Sprache, sondern eine eigene Sprache: eine Sprache, die alles Fremde abstößt und in ihrer Reinheit den Bestand der Ordnung garantiert. Noch deutlicher formuliert: die diese Reinheit nach einer Art Strafversetzung aus dem ehemaligen Paradies in germanischen Zeiten wieder garantiert. Eher nebenbei gesellte sich der weitere Gedanke hinzu, dass diese eigene Sprache die überhaupt beste aller Sprachen sei – was das Gebot der Reinhaltung noch steigerte. Die größtmögliche Steigerung war dann die »Heiligkeit« dieser Sprache aller Sprachen, die nicht nur als Garant eines in der Weltgeschichte neu aufgetauchten Großreiches diente, sondern jede Verteidigung rechtfertigte, ja zwingend erforderlich machte. Die Forderung nach einer »nationalen« Sprache führte also zu einem übersteigerten Nationalismus. Man könnte umgekehrt auch sagen: Kaum ein Medium nationalistischer Vorstellungen erwies sich zu deren Ausbildung als so geeignet wie die Sprache.
Natürlich war der Gedanke nicht neu und ebenso natürlich war er nicht nur in Deutschland aufgekommen. Alle europäischen Nationalismen des 19. Jahrhunderts und schon lange vorher zeigen mehr oder weniger deutliche Züge von Sprachnationalismen. Aber nirgendwo entwickelte sich dieser derart rigoros, ja militant wie in Deutschland, begleitet von dem unseligen Spruch, die Sprache sei lange Zeit das einzige Band gewesen, das diese Nation zusammengehalten habe. Zudem fand man noch heraus, dass sich kein anderes europäisches Volk nach seiner Sprache benannte: Das Wort »deutsch« bedeutet ja ursprünglich nichts anderes als »dem Volk zugehörig«.
Nachdem ein Laie in Sprachfragen die Initialzündung zur Gründung eines Vereins mit der Aufgabe von Schutz und Förderung der deutschen Sprache gab, wuchs das Unternehmen rasant. Widerspruch meldete sich durchaus, verhallte jedoch. Selbst die größten Schwächen – die Stupidität des Vorgehens, die ewig gleiche Nörgelei, die fadenscheinigen Argumentationen, wenn es um die Ersetzung auch geläufigster Fremdwörter wie »Dame« oder »Sauce« ging – sorgten nicht für Einhalt oder auch nur ein Absinken des Interesses.
Versuchen wir also, diese Sprachreiniger zu verstehen. Rekonstruieren wir die Geschichte des Vereins, der dies alles in die Welt setzte und damit auf einen Abgrund zusteuerte. Wir stoßen dabei auf ganz »normale« Persönlichkeiten, durchweg Gebildete bis in höchste Stufen der Universität oder der Verwaltung – Professoren und Ministerialdirektoren, in der überwiegenden Mehrzahl Gymnasiallehrer. Das Rätsel ist letztlich, wie sich solche Zeitgenossen radikalisierten beziehungsweise radikalisieren ließen, um mitzufiebern bei der großen Aufgabe. Wie konnte aus einem sinnvollen Programm der Sprachpflege ein bis zur Karikatur übertriebener Chauvinismus werden? Wie konnte die Frage nach einem zuträglichen Import von Fremdwörtern im Bermudadreieck von Reinheitsfantasien, Fremdenhass und zuletzt auch noch Antisemitismus untergehen? Wie konnten gebildete Persönlichkeiten in ein verbittertes Querulantentum verfallen, in einen erschreckenden Dogmatismus, in großspurige Angebote sinnbringender Erlösung? Wie konnte man fast sechzig Jahre lang mit ideologischem Stumpfsinn und sektiererischem Gesinnungsfanatismus ein ansehnliches Publikum bei der Stange halten, ja sogar begeistern?
Ich weiß nicht, ob sich auf all dies befriedigende Antworten geben lassen. Vielleicht liegt die interessantere Perspektive aber gar nicht im »Warum«, sondern eher im »Wie«. Vielleicht geht es primär um die Erinnerung an eine Realsatire, die deshalb wichtig ist, weil sie mittlerweile außerhalb unserer Vorstellungen zu liegen scheint und dem Gedächtnis allmählich abhandenkommt. Die wissenschaftliche Literatur kennt natürlich die wichtigsten Tatsachen, auch mit ihren Hintergründen. Aber in der historischen »Objektivierung« verschwindet viel vom Bizarren der Ereignisse. Die Wissenschaft verzichtet in der Regel auf Urteile, die jedoch gefällt werden müssen, wenn es neben der bloßen Erklärung letztlich darum geht, vor einer Wiederholung zu schützen.
Damit aber kommt weit mehr ins Spiel als ein Urteil über vergangene Irrwege. Es geht um die Aufdeckung von Parallelen zu unserer eigenen Gegenwart. Denn ganz so weit weg, wie es scheinen könnte, sind diese vergangenen Ereignisse nicht. Es gibt heute nicht nur einen neuen Sprachverein, der mit dem alten Verfolgungsfuror agiert. Vor allem lebt der gegenwärtige Nationalismus wieder in wesentlichen Zügen von Reinheitsfantasien: von der Idee, mit der Reinigung und dem Reinhalten der eigenen Kultur die Nation vor ungebetenen Gästen und deren unerbetenen Ideen, ja letztlich vor der gesamten restlichen Welt retten zu können.
Dieses Buch zeigt, wie ein bestimmter Blick auf die Sprache einmal zur Ausbildung des Nationalismus genügte und wie verheerend sich ein scheinbar harmloser Ansatz entwickeln konnte. Es zeigt aber auch, dass das, was diesem Ansatz zugrunde liegt, jederzeit in neuer Form aufflackern kann. Denn der Traum von der Reinheit muss sich nicht auf die Sprache beziehen, sondern kann sich neue Anknüpfungspunkte suchen. Er hat sie längst in Form von Herkunft oder Identität wieder gefunden.
»Pulver, Brot und Briefe waren die drei Hauptbedürfnisse«
Heinrich von Stephan
Stolp in Pommern, eine preußische Kleinstadt nahe der Ostsee, zwischen Stettin und Danzig gelegen. Hier erblickte im Jahre 1831 das Kind eines Schneiders und Betreibers einer Gastwirtschaft das Licht der Welt. Sein Name war Heinrich Stephan, eines von sechs Kindern, die die Mutter großzog. Wohl vom Vater ging der Ehrgeiz nach einer möglichst guten Schulbildung aus, zumindest soweit die finanziellen Möglichkeiten dies hergaben. Es reichte immerhin zur örtlichen Lateinschule, einem altsprachlichen Gymnasium, auf dem der kleine Heinrich Latein und Griechisch sowie Französisch lernte, wobei der Vater nebenbei für privaten Unterricht in Italienisch, Spanisch und Englisch sorgte. Die Sprachkenntnisse boten ein Sprungbrett aus der elterlichen Kleinbürgerlichkeit; im Falle des kleinen Heinrich versprachen sie eine Befreiung aus der Enge der preußischen Provinz.
Es fruchtete. Denn Heinrich, nebenbei auch noch musisch begabt, empfahl sich für eine Beamtenlaufbahn. Für ein Universitätsstudium reichte das Geld dann doch nicht. So trat er als Siebzehnjähriger in die Post ein, der er lebenslänglich angehören sollte, zuletzt als ihr oberster Dienstherr.
Es macht Spaß, diese ganz und gar unwahrscheinliche Biografie weiterzuverfolgen, die gleichzeitig viel Charakteristisches für die Zeit enthält. Mit all den Sprachen wurde Heinrich Stephan zunächst einmal »Schreiber« im Postamt der Vaterstadt. Die Prüfungen bestand er alle mit Auszeichnung. Er absolvierte den Militärdienst, ging dann nach Berlin, ins Zentrum Deutschlands. Dort schien nicht alles nach Plan gelaufen zu sein, denn man versetzte ihn nach Köln – schlimmer geht es nicht, weil die Preußen nirgendwo unbeliebter waren.
Aber Köln bedeutete Rheinprovinz, und in der herrschte einige Ungeordnetheit, was die Verwaltung betraf, zum Beispiel ein Tarifwirrwarr. Wer da den Durchblick behielt oder gar für solchen sorgte, fiel positiv auf. Stephan muss in dieser Hinsicht einiges geleistet haben, auch wenn er nebenbei Hobbys betrieb, zum Beispiel das Verfassen von Musik- und Theaterkritiken.
Ob an der nun folgenden Geschichte etwas dran ist oder nicht (sie wird in verdächtig voneinander abweichenden Versionen überliefert): Jedenfalls soll der Generalpostmeister Heinrich Schmückert beobachtet haben, wie er auf der Straße den Streit zwischen einer italienischen Dame und einem Kölner Kutscher schlichtete – auf Italienisch natürlich. Der beeindruckte Vorgesetzte ließ ihn daraufhin nach Berlin zurückkehren, und Stephan wurde Sekretär im Generalpostamt.
Das war 1856. Drei Jahre später erschien von dem zu diesem Zeitpunkt erst Siebenundzwanzigjährigen die Geschichte der preußischen Post von ihrem Ursprunge bis auf die Gegenwart, auf unfassbaren 800 Seiten, komplett aus den Archiven erarbeitet. Sein Vorbild, das er anerkennend nannte: Leopold von Ranke, das lebende Berliner Professorendenkmal. Und weil das Organisatorische sein Metier war, folgte im selben Jahr auch noch der Leitfaden für die schriftlichen Arbeiten im Postwesen, besser bekannt als Der kleine Stephan. Zu dieser Zeit war Stephan noch Postrat in Potsdam, 1863 wurde er dann Oberpostrat im Generalpostamt in Berlin.
Was man bedenken muss: In dieser Zeit, noch vor den Kriegen mit Dänemark, Österreich und Frankreich, die zur Gründung des Deutschen Reiches führten, existierten in »Deutschland« fünfzehn selbstständige Postverwaltungen, nur locker überdacht vom deutsch-österreichischen Postverein. Alle diese Verwaltungen hatten mit den anderen Ländern jeweils eigene Verträge. Das schrie förmlich nach Vereinfachung, überhaupt nach einer Abwicklung mit weniger Pannen, bei der die Post entweder gar nicht oder nur über leidige Umwege mit fast unkalkulierbarer Verspätung ankam.
Stephan muss klar gewesen sein, dass ein Neuanfang unabdingbar war. Und er ergriff die Chance zum Handeln, als sie sich bot. Dies war zunächst 1866 der Fall, als preußische Truppen in die ehemals Freie Stadt Frankfurt am Main einmarschierten, wo sich die Generaldirektion der alten Post befand. Sie gehörte dem Fürsten von Thurn und Taxis und beherrschte mit ihren kaiserlichen Privilegien seit 300 Jahren das Feld mehr schlecht als recht. Heinrich Stephan erhielt den Auftrag zu Verhandlung und Übergabe, an deren Ende ein einheitliches deutsches Postwesen im Rahmen des Norddeutschen Bundes stand – mit einer Entschädigung des Fürsten in Höhe von drei Millionen Talern. Verträge mit den süddeutschen Staaten, vor allem mit Württemberg und Bayern, folgten, und überall hatte Stephan das Sagen, in Absprache mit dem preußischen Ministerpräsidenten Otto von Bismarck, der den immer noch jungen Mann immer höher weiterempfahl, bis er 1870 schließlich auf die Stelle des Generalpostdirektors beim Generalpostamt des Norddeutschen Bundes gehoben wurde.
Ein Jahr später gab es das Deutsche Reich und mit ihm eine Post, die dem Reichskanzleramt zugeordnet war. Die weiter bestehenden 22 Bundesstaaten mussten eingegliedert werden, wobei Württemberg und Bayern auf einer Eigenständigkeit beharrten, die erst 1919 endete. Zusätzlich hatte Stephan während des Deutsch-Französischen Krieges von 1870/71 die Feldpost organisiert und in diesem Zusammenhang eine Erfindung gemacht, die erst heute langsam zu verschwinden droht: die Postkarte. Die damaligen militärischen Erfolge der Deutschen waren neben dem Einsatz der neuartigen Telefonleitungen auch dieser Form von Nachrichtendienst zu verdanken. Stephan selbst fasste es bemerkenswert prägnant zusammen, wenn er in seinem 1874 im Wissenschaftlichen Verein zu Berlin gehaltenen Vortrag Weltpost und Luftschifffahrt über diesen Krieg schrieb: »Pulver, Brot und Briefe waren die drei Hauptbedürfnisse.«
Als wäre all dies nicht genug, erfolgte der eigentliche Paukenschlag erst noch. In einer Denkschrift von 1868 hatte Stephan den Gedanken eines Weltpostvereins skizziert, mit störungs- beziehungsweise gebührenfreiem Transit und Erhebung der Kosten lediglich im Absenderland. Das ganz und gar Unwahrscheinliche gelang nach Kongressen in Bern 1874 und Paris 1878. Deren Vorsitz lag stets bei Stephan, dem Vielsprachler, der dank seiner Spanischkenntnisse seinen ersten internationalen Vertrag mit Spanien geschlossen hatte. Zunächst machten 22 europäische und außereuropäische Regierungen mit, aber die Zahl wuchs unaufhörlich. Der Durchbruch war jedenfalls erzielt und die Welt in einem wichtigen Punkt globalisiert. Der erbliche Adelsstand für den Initiator folgte als Belohnung für diesen Erfolg. Der Generalpostmeister war mittlerweile Wirklicher Geheimer Rat mit dem Titel Exzellenz, etwas später Staatssekretär, also Postminister, daneben Träger des Roten Adlerordens am Band. Ein Ölgemälde zeigt den einstigen Stolper Jungen in umwerfendem Flitter. Erst nach Bismarcks Rücktritt 1890 wurde es auch stiller um Stephan.
Hinzuzufügen wäre noch vieles, vor allem der Ausbau des Telegrafenwesens, das unter Stephans Leitung der Post eingegliedert wurde. Auch der mittlerweile auf 34 000 Meilen ausgebaute Schienenweg half bei der Postbeförderung, für die inzwischen täglich 2578 Eisenbahnzüge im Einsatz waren. In seinem Vortrag Weltpost und Luftschifffahrt glänzte Stephan mit diesen und noch viel mehr Zahlen, darunter die 250 000 ankommenden und abgehenden Briefe und Postkarten allein in Berlin, pro Minute 173. An Silvester des Vorjahres lagen in 311 Briefkästen der Stadt 547 377 Briefe und Postkarten – je ein Brief auf zwei »Seelen«, die nicht Schreib-, sondern, ihrem Alter entsprechend, lediglich »Schreifähigen« mit eingerechnet. Im Vorjahr wurden im gesamten Reich 500 Millionen Briefe verschickt, dazu 230 000 Millionen Zeitungen ausgeliefert, 45 Prozent davon privat, des Weiteren wurden zehn Millionen Telegramme zugestellt. Allein die Korrespondenz in Verbindung mit Verlobungen kam auf 350 000 Briefe pro Jahr, bei einem Finanzvolumen von zehn Millionen Talern, wobei der immer gut aufgelegte Stephan vorschlug, bei Liebesbriefen das Porto zu halbieren.
Voller Stolz nachgetragen wurden Zahlen um Zahlen über die »Gesamtcirculation im Reichspostgebiet«, im Vorjahr 800 Millionen Sendungen, pro Minute 1400. Die Korrespondenz ins Ausland zählte 95 Millionen Briefe, von den Fidschi-Inseln bis Grönland. Auf »Mutter Erde« insgesamt kämen jährlich um die 3,3 Milliarden Briefe an, jede Sekunde 100 Stück. Bei einer Gesamtbevölkerung von 1,3 Milliarden ergebe das pro Kopf durchschnittlich drei Briefe im Jahr. Russland wurde für seine Anstrengungen in seinem Riesenreich gelobt und bei Japan erwähnt, dass Verfehlungen wie die Unterschlagung von Briefen nicht unter siebzig Tagen Zwangsarbeit zur Folge hätten.
Und immer wieder dringt ein Hauptpunkt durch: das Weltweite, das die Nationen Überspannende, der Verkehr als wahrer Befrieder der Menschheit. Nein, nicht das Militär beherrscht diese Welt, sondern die Post. Die Menschen wollen sich nicht gegenseitig totschießen, sondern sich Karten, Briefe und Pakete zuschicken. Als Ausblick diente die allerneueste Beförderungsmöglichkeit, die sich ebenfalls bald in den Dienst der Post stellen lasse: die Luftschifffahrt. Natürlich gab es auch dafür eine Zahl: Die Gesamtsumme der in Europa und Amerika ausgeführten Luftfahrten betrage mittlerweile 3700.
All dies wäre nicht zu erzählen, wenn darauf nicht etwas folgte, das uns hier besonders interessiert. Denn Heinrich (nun: von) Stephan war bei seinen Vereinheitlichungsplänen etwas verhältnismäßig Harmloses als besonders störend aufgefallen: die unterschiedlichen sprachlichen Bezeichnungen im Postwesen, vor allem die große Zahl französischer Begriffe in einigen Regionen. Und so führte er kurzerhand Verdeutschungen ein und verordnete am 31. Dezember 1874 seinen Beamten die Ersetzung von 58 Fremdwörtern durch deutsche. So sollte fortan zum Beispiel »rekommandiert« durch »eingeschrieben« ersetzt werden, »Expressbote« durch »Eilbote«, »postrestante« durch »postlagernd«, »Couvert« durch »Umschlag«. Am 21. Juni 1875 kamen um die 700 weitere Ersetzungen hinzu. In einem Brief an Daniel Sanders, Professor der Germanistik und Herausgeber eines Fremdwörterbuchs, behauptete Stephan, auf ausdrückliche Anweisung Bismarcks gehandelt zu haben.
Der erst preußische, dann Generalpostmeister des Reiches war jedenfalls einer der ersten Sprachreiniger seiner Zeit. 1877 hielt Stephan den Vortrag Die Fremdwörter, in dem er nebst Warnung vor Übertreibung vor allem das Ziel der Verständlichkeit hervorhob. Witzig berichtete er von einem Bezirksarzt auf dem Lande, der eine Belehrung über die Maul- und Klauenseuche mit Wörtern wie »spontan«, »prophylaktisch«, »Exkretion«, »therapeutisch« und so fort garnierte. Er endete mit der Frage: »Muss der Bauer nicht glauben, die Maul- und Klauenseuche sei in die Sprache gefahren?« Aber Stephan wurde für seinen Einsatz nicht gelobt, sondern verspottet. Er möge doch bitte mit seinem eigenen »griechischen« Namen beginnen, las man in der Presse, sich also »Kranz« nennen. Außerdem wurde kritisiert, er habe Fremdwörter wie »Secretair« oder »Eleve« geschont. Weiter zog man gegen eine »neuerungssüchtige Post« zu Felde, gegen die Anmaßung eines Einzelnen, nicht zuletzt gegen die Nachteile beim Verzicht auf international geläufige Begriffe.
Der Angegriffene saß die Angriffe jedoch aus, so wie er schon den Angriff der Siegelmacher ausgesessen hatte, als er das fünffache Siegel auf den Geldbriefen abgeschafft hatte. Jeder Bürger, der sich der Post bediente, sollte nicht nur klare Tarife nach klaren Gewichtsvorgaben finden, sondern auch klare Bezeichnungen. 1887 erging eine Verordnung über Bauten der Postverwaltung, nach der in deren Planungen und Zeichnungen alle Fremdwörter fernzuhalten, die technischen Ausdrücke also durch deutsche zu ersetzen waren. Eine weitere Verordnung verlangte, die Aufschriften in den Post- und Telegrafengebäuden umzustellen: »Korridor«, »Etage« und »Portier« sollten durch »Gang«, »Geschoß« und »Pförtner« ersetzt werden. (Im Übrigen gebrauchten nur die Deutschen ein Wort wie »rekommandiert«, die Franzosen sagten dazu chargé, die Engländer und Amerikaner registered. Und nur die Deutschen kannten in diesem Zusammenhang das Wort »postrestante«, die Italiener benutzten dafür ferma in posta.)
Und siehe da: Als sich der Allgemeine Deutsche Sprachverein gründete und seine Fremdwörterkampagne begann, berief man sich auf ebendiesen Stephan, machte ihn sogleich standesgemäß, also auf telegrafischem Wege zum ersten Ehrenmitglied. Der Geehrte bedankte sich ebenso wohlwollend wie unmissverständlich: »An dem schönen Ziele, an der Wiederherstellung der Reinheit unserer herrlichen Muttersprache mitzuwirken, wird mir stets eine Freude sein.« Doch nicht nur das. 1889 schrieb Stephan einen kleinen Beitrag über die Sauce, die letztlich kein Fremdwort sei, weil sie auf salsa zurückgehe, ein mittelalterliches deutsches Wort, das direkt aus dem Indogermanischen stamme und damit aus derselben Wurzel wie das französische Wort. Das war eine problematische, wenn auch durch den Rückgriff auf die Indogermanistik wissenschaftliche Argumentation, die gnädig oder auch hilflos darüber hinwegsah, dass die »Salse« eben doch nachweislich aus dem Französischen übernommen worden war, genauso wie in einer zweiten Entlehnungsphase die »Sauce«. Doch dieser durch und durch gebildete Postler wollte nun einmal zeigen, dass er sein sprachliches Hobby auch auf höherem Niveau betreiben konnte.
Stephan, daran besteht kein Zweifel, fühlte sich wohl im Reich der Sprachreiniger und war dem in diesem Zeichen tätigen Verein gewogen. Mit etwas viel Pathos oder auch typisch wilhelminischem Schwulst rief er in seinem Vortrag Die Fremdwörter seinen Hörern zu: »Lassen Sie uns mit deutschem Ernst und deutscher Ausdauer, eingedenk unserer Pflicht, an dem vaterländischen Werke entschlossen fortarbeiten: jeder an seinem Teil in dem, was er spricht und schreibt, in Haus und Beruf, im Freundesverkehr wie in der Kindererziehung (…). Vom Flitterstaate befreit, wird die lichtvolle Verkünderin des deutschen Geistes ihre Strahlen verbreiten in alter Kraft und Herrlichkeit.«
Der Mann, der wie kaum ein anderer seiner Zeit für Globalisierung stand, stand zugleich für die Pflege der deutschen Sprache als Grundlage des nationalen Zusammenhalts, vor allem in der höchst praktischen Version einer einheitlichen Postsprache. Als Preuße, der der Reichsgründung so viel verdankte, wusste er, was Einheit bedeutete, und war bereit, sie als nationale genauso wie als internationale zu vertreten und zu verteidigen, als Einheitsporto genauso wie als Einheitssprache. In welche Enge dies einmal führen würde, ja, dass das Fremdwort gar der Kern allen sozialen und politischen Übels sein sollte, wird er nicht erahnt haben. Es gab ihn noch, den Nationalismus oder, besser gesagt, den Patriotismus ohne Misere. Doch nicht mehr lange.
»Hochemotionalisierter Rauschzustand«
1885
Als Herman Riegel 1885 den Allgemeinen Deutschen Sprachverein gründete, befand sich Deutschland immer noch in einem »hochemotionalisierten Rauschzustand«, wie Hans-Ulrich Wehler im 3. Band seiner Deutschen Gesellschaftsgeschichte bemerkt (an deren Kapitel zum Bürgertum ich im Folgenden anschließe). Das auslösende Ereignis lag nunmehr vierzehn Jahre zurück und bestand im Erringen der Einheit. Deutschland war nun Nationalstaat geworden, so wie die umliegenden Länder, die es meist schon lange vorher geschafft hatten: England und Frankreich vorneweg, zuletzt besonders spektakulär und daher als wichtigstes unmittelbares Vorbild Italien mit seinem risorgimento, der Wiedergeburt alter Größe.
Aber was bedeutete das nun, Nationalstaat? Ein Nationalstaat ist dem Wortsinn nach ein Staat, der sich auf eine Nation und nicht zum Beispiel auf eine Dynastie gründet, so wie umgekehrt eine Nation nach einem Staat verlangt. Kaum jemand sah darin das Fiktive, ja die meisten waren nur zu gerne bereit, die Fiktion zu ignorieren. Denn worin genau sollte die Nation eigentlich bestehen? Wieso gehörten die Bürger in Österreich-Ungarn nicht dazu, im Baltikum, in den Enklaven Ost- beziehungsweise Südosteuropas, wo zusammengenommen mehr als 24 Millionen Deutschsprachige lebten – wo es doch gerade die deutsche Sprache war, die immer als besonders wichtiger Grund für die Einheit genannt wurde? Und wer war eigentlich der Gründer und damit der Verantwortliche dieses Nationalstaats? Die Bürger hatten es 1848/49 in der Frankfurter Paulskirche nicht geschafft, ihn herbeizuführen, die Einheit war von oben gekommen, in einem Krieg, in dem der König und der Adel die Führung besaßen. Wieso dann der Jubel gerade bei den Bürgern, die sich mit einer Verfassung zufriedengeben mussten, die ihre Rechte einengte und ihre Beteiligung auf ein Parlament beschränkte, das nur bei der Steuer wirklich mitreden durfte?
Man kennt die wichtigste Antwort auf diese Fragen: Jeder sah, wie viel reibungsloser Nationalstaaten funktionierten, wie gut organisierte Wehr- und Wirtschaftsverbände das Wohl aller besser befriedigen konnten, als es kleinteilige Herrschaften mit ihren vielen Barrieren beim Zusammenwirken vermochten. Engländer und Franzosen hatten sich gerade die Welt aufgeteilt – die Engländer waren zuletzt erfolgreicher, als sie nach dem Bau des Sueskanals Ägypten den Franzosen wegschnappten. Deutschland war bei alldem lange Zeit, bis zur Aufteilung Südafrikas auf der Kongokonferenz in Berlin 1884/85, bloß Zuschauer gewesen. Ein Zuschauer wie Stephan, der bei der Eröffnung des Kanals als Generalpostmeister zu den eingeladenen Gästen gehört hatte und anschließend ein Buch über das moderne Ägypten schrieb. Wer wirkliche Erfolge haben wollte, musste mitmachen: bei der Ausgestaltung eines Staates, der seine Kräfte aus einer Nation bezog; bei der Vergrößerung zum Imperium, das nur mithilfe einer Nation gewonnen werden konnte.
Warum die Konzentration auf Größe? Weil sie Versorgung versprach, Teilhabe am reich gedeckten Tisch, der vor aller Augen immer verlockender wurde. Und noch ein weiterer Begriff wurde zum epochenspezifischen Schlagwort: Fortschritt. Permanent neue Erfindungen gaben den Takt vor, versprachen eine bessere, schönere Welt, eine glorreiche Zukunft.
Wer genau nahm teil? Auf jeden Fall die Bourgeoisie, das Großbürgertum, bestehend aus den neuen Industriellen und dem alten landbesitzenden Adel. Man weiß umgekehrt auch, wer nicht oder nur sehr eingeschränkt mit von der Partie war: das Heer der Arbeiter in den Fabriken, dem es in den rasch wachsenden Städten immer schlechter ging. Dazwischen befand sich die dünne, aber sehr artikulationsfreudige Schicht des Bildungsbürgertums: Bürger mit Abitur, die kaum mehr als 0,2 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachten und sich nur ganz allmählich vermehrten. Dieses Bildungsbürgertum hatte den gescheiterten Revolutionsversuch von 1848/49 getragen und ihm seine liberalen Ideen gegeben, die größtenteils aus der Aufklärung des 18. Jahrhunderts stammten und ihren Gipfel in der Französischen Revolution von 1789 fanden, nach dem Motto »Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit« oder auch im Sinne von Beethovens »Seid umschlungen Millionen«. Nach 1871 verwandelten sich diese himmelsstürmenden Ideen: Sie bezogen ihre Stoßkraft nun eher aus dem neuartigen Reichsnationalismus, nicht mehr aus den alten demokratischen Forderungen oder dem kosmopolitischen »Ballast«, der lediglich von den erfolgreich in Schach gehaltenen »Sozialisten« bewahrt wurde. Es genügte dem Großteil des Bürgertums, unter dem schützenden Dach eines Staates zu leben, der das garantierte, was als das Wichtigste angesehen wurde: Einheit als Voraussetzung für Ruhe und Wohlstand.
Der deutsche Nationalstaat entwickelte sich unter diesen Bedingungen als »alternativloses« Einheitsgebilde im Wettbewerb mit den anderen Nationalstaaten. Er setzte auf Stärke, um den Kampf zu gewinnen, bei gleichzeitigem Verzicht der meisten Mitglieder auf Teilhabe an der politischen Entscheidungsmacht, ja bei fast völligem Kritikverzicht.
Sofort nach der Reichsgründung kam es in dem noch unfertigen Gebilde zu schweren Wirtschaftskrisen, man musste erst das Instrument der Zölle verstehen, um Stabilität zu erreichen. Aber dann ging es stetig aufwärts. Die Planstellen für akademische Berufe wuchsen langsam an, die Zahl der Studenten stieg von 1871 bis 1890 auf das Doppelte. Nimmt man die Grenzen des Deutschen Reichs von 1871 zur Grundlage, so rechnete man um 1850 und bei knapp 34 Millionen Einwohnern mit insgesamt 230 000 bis 280 000 Angehörigen bildungsbürgerlicher Familien. 1870 waren es dann zwischen 240 000 und 300 000, was weniger als ein Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachte. Selbst 1914 handelte es sich mit 540 000 Personen immer noch um eine äußerst kleine Schicht, aber eben eine, die das intellektuelle Niveau bestimmte. Und dies mit einem höchst eigenartigen »Potenzial«: mit Bildung, humanistischer, altsprachlicher Schulbildung, mit Latein und gerne auch mit Griechisch – wie es zum Beispiel bei Heinrich Stephan der Fall war.
Man kann rückblickend noch gut beobachten, wie diese Intellektuellen den Nationalstaat mit ihren Mitteln und mit vollster Überzeugung förderten, wobei die Wissenschaft vor allem dank des Aufstiegs der Naturwissenschaften ein fast religiöses Ansehen genoss. Die Historiker schrieben eifrig Bücher zur antiken Geschichte, die nichts anderes als den Beweis für die Überlegenheit des Großstaates unter einheitlicher Führung liefern sollten. Johann Gustav Droysens Geschichte Alexanders des Großen erschien bereits 1833, seine Geschichte der preußischen Politik, deren erster Band 1855 herauskam, vollendete er 1886. Die drei Bände von Theodor Mommsens Römischer Geschichte wurden von 1854 bis 1856 veröffentlicht. In ihnen wird das Ende der römischen Republik mit einem völlig überforderten Cicero und dem Retter Caesar geschildert. Heinrich von Treitschke bot mit seiner Deutschen Geschichte im neunzehnten Jahrhundert, erschienen zwischen 1879 und 1894, die Begründung für die kleindeutsche Lösung mit einem Nationalstaat unter preußischer Führung.
Nicht nur die Wissenschaft, auch die Literatur sekundierte. Felix Dahns Ein Kampf um Rom von 1876 erzählt voll Mitgefühl vom heldenmäßigen Untergang der Goten, germanischer Brüder und Schwestern also, im Kampf gegen einen finsteren weströmischen Kaiser und einen intriganten Papst. Gustav Freytag beschrieb 1855 in Soll und Haben den Aufstieg Breslauer Kaufleute in die Adelswelt und entwarf mit dem von 1872 bis 1880 veröffentlichten Romanzyklus der Ahnen eine Familie, deren Geschichte er von den germanischen Zeiten mit ihren rivalisierenden Stämmen bis zur »Ankunft« in einem endlich geeinten Deutschen Reich verfolgt.
Ein wichtiges Instrument der Einheit waren Vereine, in denen das Programm des Nationalismus artikuliert wurde. Früh, bereits 1859, entstand nach dem italienischen Vorbild der Società Nazionale der Deutsche Nationalverein mit 25 000 Mitgliedern. Ein eher spätes Beispiel ist der 1902 gegründete Dürerbund, benannt nach dem großen Maler der Renaissance, mit dem Kunstwart als Organ. Er brachte es binnen kurzer Zeit auf 300 000 Mitglieder, die sich in ihrem Programm auf »echt deutsche«, »wahrhaft nationale« Kulturwerte zu besinnen versprachen. Bünde waren das Modell, unter dem sich so verschiedenartige »Bewegungen« wie der Wandervogel, der Deutsche Werkbund und weitere Volksbildungs- und Heimatvereine versammelten. In den Bayreuther Blättern meldete sich beispielsweise der erfolgreichste der Richard-Wagner-Vereine zu Wort und verherrlichte die deutsche Nationalkultur unter Berufung auf ihr musikalisches Leitbild. Julius Langbehn sollte 1890 mit seinem zunächst anonym publizierten Werk Rembrandt als Erzieher das erfolgreichste Kultbuch dieser »Bünde« liefern, ein regelrechter Religionsersatz in einer intellektuellen Welt, die noch stark reformatorisch geprägt war, aber ihre Verbindung zur Kirche immer weiter kappte.
Überhaupt traten die Künste das religiöse Erbe an. In den Konzertsälen lauschte man andächtig den Aufführungen der Klassiker und beobachtete genüsslich den Wettbewerb unter den zeitgenössischen Komponisten wie etwa Johannes Brahms und Richard Wagner. Auch die Museen füllten sich mit Betrachtern der klassischen Werke der Antike und ihren Nachfolgern, wobei sie immer öfter in neuen Prunkbauten untergebracht wurden wie etwa dem Neuen Museum in Berlin.
Die Avantgarde hatte es auf allen Gebieten schwer. Sie litt unter dem konservativen Geschmack des Publikums im musikalischen ebenso wie im künstlerischen Bereich. Auch die Literatur brachte neben den neuen Stars vor allem die Klassiker zur Geltung, die erst jetzt wirklich reüssierten. Als 1867 das Urheberrecht befristet und die Klassiker somit »gemeinfrei« wurden, erfand Philipp Reclam die Universal-Bibliothek und veröffentlichte als deren ersten Band Johann Wolfgang von Goethes Faust. Waren die Werke von Goethe und Friedrich Schiller in ihrer Entstehungszeit mit kaum mehr als 2000 Exemplaren auf den Markt gekommen, verkauften sich die Gesamtausgaben im 19. Jahrhundert in nicht enden wollenden Auflagen. Startete Schillers achtzehnbändige Gesamtauflage von 1822 bis 1824 mit 50 000 Exemplaren, kam die erneute Auflage von 1827 bis 1831 bereits auf 100 000.
Bildung wurde somit zur »Schlüsselindustrie« mit der Eigenschaft, nach oben hin für Integration zu sorgen, sofern auch der Adel sich nicht völlig ausgrenzen lassen wollte, und nach unten hin abgrenzend gegen allzu viele Aufsteiger zu wirken. Die neuen Funktionseliten rekrutierten sich aus diesem Pool: Verwaltungsbeamte und Pfarrer, Professoren und Juristen. Sie alle lebten in der gleichen Welt: in der des Neuhumanismus, mit der deutschen Eigenheit, dass besonders das Griechische betont wurde, da es aufgrund seiner zersplitterten Staatenwelt der deutschen Realität besonders nahezukommen schien. Geistige statt politischer Freiheit, das war die Losung, ebenso wie eine säkulare statt einer religiösen Grundierung des vom Idealismus geprägten Weltbilds – all dies letztlich verstanden als Bildung im nationalen Sinne. Goethes Idee der »Weltliteratur« war out, es lebten die nationalen Beglücker eines nationalen Publikums, das gar nicht genug Nationales erhalten konnte. Aus diesem widersprüchlichen Gemisch aus moralischem Pathos ohne Grenzen und Fixierung auf das Eigene ergab sich ein seltsam verkümmerter, domestizierter Idealismus, der sich im Nationalen artikulierte, aber auch austobte.
Blieb noch die Sprache, das Nationalste am Nationalen überhaupt. Natürlich hatte man sich sofort an die Aufgabe der Vereinheitlichung gemacht. Konrad Duden, Direktor des Königlichen Gymnasiums in Hersfeld, legte nach schwierigem Anlauf im Auftrag des preußischen Kultusministers 1880 das erste Vollständige Orthographische Wörterbuch der deutschen Sprache vor. Darin wurde zuerst einmal in den Schulen für amtliche Regelung gesorgt, nachdem man den Gebrauch von Schulbüchern aus Preußen und Bayern wechselseitig anerkannt hatte. An eine »Alleinherrschaft in ganz Deutschland« ließ sich zunächst nicht denken. Vorläufig musste man damit leben, dass man in Preußen »Litteratur« und »Wiederhall«, in Bayern »Literatur« und »Widerhall« schrieb. Ganz so einfach war das dann doch nicht mit der Einheit, denn allzu begeistert stimmte man nicht zu, wenn es konkret um die Preisgabe alter Gewohnheiten aus der Zeit der Kleinstaaterei ging. Die »theoretischen« Äußerungen klangen da ganz anders und deckten die Schwierigkeiten mehr zu, als dass sie sie beseitigten. Die großspurigen Bekundungen waren eben immer lauter als die praktischen Umsetzungen.
Wer diese Trommel schlug, konnte sich der Aufmerksamkeit jedenfalls in der Regel gewiss sein. Und dies besonders in der Abgrenzung von den »anderen«, die als gemeinsamer Feind oder wenigstens Störenfried ausgemacht wurden. In Dudens Vorwort zum Wörterbuch gibt es eine kleine Bemerkung zu den Fremdwörtern. Sie seien »Legion« und könnten deshalb nur mit dem »Nötigsten bzw. Gebräuchlichsten« aufgenommen werden, ohne nähere »Erklärung«, heißt es da. Und dann der aufschlussreiche Satz: Es wäre »eine Pedanterie gewesen, wenn der Verfasser solchen Eindringlingen, die unsere Sprache verunstalten, hätte ein Brandmal aufprägen und durch Angabe der entsprechenden besseren deutschen Ausdrücke vor ihrem Gebrauche warnen wollen«. Nein, keine Warnung, eher die Zuversicht, die Benutzer würden schon ihre nationale Pflicht erfüllen und vorsichtig sein im Umgang mit diesen Parvenus. Wieder einmal trat das übliche Schema auf: Einheit, sprich nationale Einheit: ja. Gleichzeitig wurden aber weiter die alten Eigenheiten gepflegt in der Hoffnung, dass schon zusammenwächst, was zusammengehört. Und auch das weitere Schema zeigte sich: der Versuch, die Schwierigkeiten mithilfe von Abgrenzung zu überdecken. Selbst an einer so empfindlichen Stelle des Baus einer geeinten Nation, bei der orthografischen Frage, reichte das Bedürfnis nach Einheit allein nicht aus.
Genau dieser Widerspruch forderte jemanden zu weiterem Engagement heraus. Er suchte wirkliche Einheit und glaubte, sie in einem scheinbar unwesentlichen Punkt zu finden, der dennoch allergrößte Wirksamkeit versprach. Vier Jahre nach Erscheinen des Duden’schen Wörterbuchs wollte er die »Eindringlinge« nicht nur verunglimpfen, sondern mithilfe eines ganzen Vereins sowie der Ausgabe einer eigenen Vereinszeitung, der Zeitschrift des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins, so weit wie möglich entfernen, ja »ausrotten«. Sein Name lautet Herman (tatsächlich mit nur einem n) Riegel.
»Lametta«
Wer hätte gedacht, dass es auch ein »Weihnachtsdeutsch« gibt, noch dazu ein problematisches? Ein Beiträger der Zeitschrift des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins behandelt unter diesem Stichwort, etwas verspätet, im Januarheft 1912 das »Christkind« und eine Reihe weiterer Fremdwörter, die ausnahmsweise zu tolerieren seien, weil das Bezeichnete schließlich »aus alten Kulturen« stamme. Aber eine Ausnahme wird doch angemahnt: »Lametta«. Hier empfehle sich eine beherzte Ersetzung, zum Beispiel durch »Christkindleins Haar«.
»Entsetzlich viel Mühe und Arbeit gemacht«
Herman Riegel
Herman Riegels Karriere verlief nicht so steil wie die des Generalpostmeisters. Aber auch sie war beachtlich. Riegel brachte es zum Museumsdirektor in Braunschweig. Und in einem Punkt glichen die beiden sich eben doch: Beide Herren hatten ein humanistisches Gymnasium durchlaufen und gehörten somit dem Bildungsbürgertum an, das im neu gegründeten Deutschen Reich außer in der Politik und beim Militär die Führungspositionen besetzte. Bildung bedeutete vor allem die Kenntnis antiker Sprachen und antiker Texte, einen ausgeprägten Humanismus sowie ein Verständnis von Wissenschaft im Sinne einer kritischen Herangehensweise, das Ganze gepaart mit oder umrahmt von einer an der Antike und ihrer Wiederbelebung orientierten Ästhetik. Stephan war mehr literarisch orientiert, liebte Horaz und gründete in Berlin einen Horaz-Club, der sich wöchentlich traf. Riegels Welt war die Kunst, vor allem die der italienischen Renaissance, aber auch die der damals berühmten deutschen Klassizisten wie Peter von Cornelius und Asmus Carstens. Persönlich begegnet sind sich Stephan und Riegel wohl nie, aber sie hätten sich sofort unterhalten können, aus Spaß vielleicht auf Italienisch.
Riegel hat eine Autobiografie verfasst, deren handschriftliche Fassung heute in zwei maschinenschriftlichen Abschriften vorliegt. Die erste ist von 1921 und besteht aus 107 eng beschriebenen Seiten. Sie wird im Braunschweiger Universitätsarchiv aufbewahrt. Man erfährt darin natürlich die wichtigsten Lebensstationen wie zum Beispiel die Herkunft der Familie aus dem Breisgau, wo der Großvater dreimal von französischen Truppen ausgeraubt und vertrieben wurde – eine damals nicht seltene ganz persönliche Grundlage der Abneigung gegen alles Französische. Weiter geht es mit Geburt und Aufwachsen in Potsdam, wo der Vater einen Kunstverlag betrieb, in dessen Räumen der Jugendliche unter anderem dem großen Karl Friedrich Schinkel begegnete, dem Architekten des Königs, von dem die wichtigsten Bauten in Berlin stammten, ebenso wie Christian Daniel Rauch, dem Schöpfer der Siegessäule in Hakenberg bei Fehrbellin. Immer wieder wurde Riegel vom Vater durch die gerade in wilhelminischem Glanz entstehende Berliner Metropole mit ihren repräsentativen Prachtbauten geführt.
Man erfährt auch etwas über seine politische Einstellung, wenn Riegel aus nächster Nähe die Revolution von 1848 schildert. Er berichtet von »Umsturz und Wahnsinn«, von »Pöbeltollwut« und einem Militär, das sich feigerweise nicht zu schießen traute, bis endlich die »Ordnung« wiederhergestellt worden sei. Zwar blickt er nicht ohne Missmut auf das »Viktoriatheater« nach dem siegreichen Krieg gegen Dänemark 1864, lobt aber rückhaltlos das »Aufleuchten des vaterländischen Bewusstseins«. Die Parade durchs Brandenburger Tor stärkte in ihm den Glauben an die »Zukunft Deutschlands«, dass »Kaiser und Reich wiedererstehen« würden. Auch 1866, beim Triumph über Österreich, notierte er »Begeisterung« beim »Nationalbewusstsein«. Im noch französischen Straßburg in der Zeit vor 1871 erlebte er den »Schmerz«, den ihm »das Franzosentum in der alten und so herrlichen Deutschen Reichsstadt verursacht hatte«, und begann »mit Verständnis deutsch zu fühlen«. Der Friedensschluss mit Frankreich nach dem nächsten großen Erfolg erschien ihm als zu geringe »Sühne« für die »Mordbrennereien und Zerstörungen, die Brandschatzungen und Blutsteuern«, die das Land seit Ludwig XIV. erdulden musste. Vorrang aber hatte das Gefühl, dass der »Traum der Jugend und die Sehnsucht der Nation« ihre Erfüllung in der staatlichen Einheit fand.
Riegel hat in dieser Zeit seine berufliche Laufbahn vorbereitet. Reisen durch fast ganz Europa, besonders in die Niederlande, gaben ihm einen lebendigen Einblick in die Kunstgeschichte, das Studium an der Berliner Universität und der Kunstakademie machte ihn zum Gelehrten. 1864 erschien der Grundriß der bildenden Künste, zwei Jahre später ein erstes Buch über Peter von Cornelius, 1883, lange nach dem Tod des Meisters, gab er eine ihm gewidmete Festschrift heraus. Cornelius gilt als Hauptvertreter der sogenannten »Nazarener«, benannt nach den Jüngern, die Jesus von Nazareth einst gefolgt waren. Es handelt sich um eine Kunstrichtung, die nach Erneuerung im Geiste des Christentums, besonders des Katholizismus, strebte und dabei einen neogotischen Klassizismus entwickelte, der den Gegnern schlicht als Kitsch erschien. Man kann auch gnädiger von einem Konservativismus sprechen, der von der beginnenden Moderne rasch überholt wurde. So setzte seit den 1860er-Jahren in Paris der weit stilprägendere Impressionismus ein.
Übrigens war die väterliche Familie von Riegel katholisch. Der Vater konvertierte dann in Berlin zum Protestantismus, wodurch der kleine Riegel von früh an protestantisch groß wurde, was er ausdrücklich als Geschenk betrachtete. Die ästhetische Vorliebe fürs »Gotische« verband sich also mit einer preußischen Grundtendenz hin zum Konservativismus als gemeinsamer Grundlage. Das war anscheinend keine schlechte Voraussetzung für den beruflichen Aufstieg.
Denn auf diesem Weg gab es sogleich Fortschritte. 1868 wurde Riegel Leiter des Städtischen Museums in Leipzig. Er habilitierte sich, um die Voraussetzungen für eine Professur zu erfüllen, mit einer Schrift Über die Darstellung des Abendmahles, besonders in der toscanischen Kunst. Anschließend hielt er Vorlesungen, die ihm Spaß machten, weil das Publikum zahlreich war. Schließlich wagte er den nächsten Schritt: 1871, mitten in der Reichsgründungsphase, wurde er Direktor des Herzoglichen Museums in Braunschweig, in einem der kleinsten der 22 Teilstaaten des Deutschen Reiches (zu dessen größtem »Verdienst« es zählt, dass ein Gymnasiallehrer namens Konrad Koch 1874 das Fußballspiel in Deutschland einführte). Daneben hielt Riegel als Professor wieder Vorlesungen an der Universität. Er sollte die Ämter 25 Jahre lang ausüben, obwohl die Bedingungen alles andere als erfreulich waren. Der Hof mit einem ungebildeten, in Fragen der Geschichte blamabel ahnungslosen Herzog aus dem Welfenhaus an der Spitze interessierte sich nicht für seine Arbeit. Er stimmte erst nach langem Ringen einem Museumsneubau zu, den Riegel mit einer Neuordnung seiner Exponate verband. Seine unmittelbaren Vorgesetzten, Adlige aus der höfischen Umgebung selbstverständlich, schnitten den »Bürgerlichen«. In den Vorlesungen war er gelegentlich allein.
Mitten in dieser Karriere aber ereignete sich etwas, was wir schon kennen: die Gründung des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins im Jahre 1885. Riegel behandelte dieses Lebenswerk in seinen Erinnerungen eher nebenbei, auch wenn es »entsetzlich viel Mühe und Arbeit gemacht« habe. Denn dem Kenner und Liebhaber von Kunst und Architektur war ein Gedanke gekommen, der wenig zu seinem bisherigen Lebenslauf passte. Auch der Start gelang nicht ohne Hindernisse. 1882 veröffentlichte er nach langer Suche nach einem Verleger in der national-konservativen Zeitschrift Die Grenzboten einen Aufruf mit dem altertümlichen Titel Ein Hauptstück von unserer Muttersprache. Mahnruf an alle national gesinnten Deutschen. Inhalt: das Aufbegehren gegen die grassierende Fremdwörterflut aus dem Französischen sowie das Wecken eines gefestigten »Deutschtums« auf der Grundlage von Sprachreinigung. All das wurde verbunden mit dem Vorschlag einer Vereinsgründung (so wie es für alles mittlerweile einen Verein gab). Als sich mehr Sympathisanten als erwartet meldeten, fühlte Riegel sich bestätigt. Am 10. September 1885 wurde in Dresden der erste Zweigverein gegründet. Das war der Durchbruch. Im April 1886 erschien das erste Heft der Vereinszeitung: die Zeitschrift des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins. In seinen Erinnerungen erwähnt Riegel nur das für ihn katastrophale Ende: seinen Rücktritt Ende 1889 nach zwei Jahren größter Unruhen.
Über diese Angelegenheit hatte er sehr ausführlich an anderer Stelle geschrieben, darüber später mehr. Aber hier zunächst die Frage: Wie passt das alles zusammen – Kunsthistoriker, Museumsdirektor, Mann mit europäischem Weitblick in seinem Fach, wenn auch mit einer gewissen Verengung auf Klassik und Klassizismus, und dann Gründer eines Sprachvereins? Warum verfällt ein Mann, der mit Leidenschaft die Bilder und Skulpturen seines Museums betrachtet, sie ordnet, über sie publiziert, ausgerechnet auf »Sprachreinigung«? Man kann zunächst einmal sagen: weil es sonst niemand tat. Die Sprachwissenschaft seiner Zeit, auf die noch ausführlicher einzugehen sein wird, hatte anderes im Blick, betrieb Sprachgeschichte mit wissenschaftlicher Begründung in Analogie zur zeitgenössischen Naturwissenschaft, suchte nach »Gesetzen« vor allem im Bereich des Lautlichen. Jacob Grimm hatte es in seiner Deutschen Grammatik vorgemacht. Alle Germanistikstudenten stöhnen noch heute unter den Lautverschiebungen, die sie büffeln müssen. So schrieb Hermann Paul das neue Grundlagenwerk, Prinzipien der Sprachgeschichte, das 1880 erschien, also unmittelbar vor Riegels Initiative. Grimm hatte der Sprachreinigung zu seiner eigenen Zeit mehr als skeptisch gegenübergestanden; von Paul ist eine abfällige Bemerkung ohne Nennung von genaueren Adressaten überliefert.
Mit Sprachwissenschaft, vor allem zeitgemäßer, hat diese Sprachpflege offenbar nichts zu tun, im Gegenteil, man kann eher von wechselseitiger Ignoranz sprechen. An Vorbildern hat es allerdings nicht gefehlt, sie lagen nur weiter zurück. Schon im 16. Jahrhundert gab es eine entsprechende Initiative im Zusammenhang mit dem übermächtigen Latein. Im 17. Jahrhundert entstanden förmliche Sprachgesellschaften, die das Deutsche von den massenhaften französischen Fremdwörtern reinigen wollten – die berühmte Fruchtbringende Gesellschaft zum Beispiel; zahlreiche Poeten traten ihr bei, sofern sie nicht eigene Gesellschaften gründeten. Am Ende des 18. Jahrhunderts war Sprachreinigung dann ein Dauerthema, am Laufen gehalten durch die Herausgabe von Wörterbüchern, die Ersetzungen für die Fremdwörter boten. Der bedeutende Pädagoge Joachim Heinrich Campe gehörte zu den Vorreitern. Er wollte nach dem Erlebnis der Französischen Revolution den selbstbewusst gewordenen deutschen Bürgern ein allen, nicht nur den Gebildeten verständliches Vokabular bieten. Im Zusammenhang mit den Befreiungskriegen zu Beginn des 19. Jahrhunderts nahm das Vorhaben dann eine andere Richtung an. Bei dem Lyriker und Geschichtsprofessor Ernst Moritz Arndt sowie bei »Turnvater« Friedrich Ludwig Jahn steigerte es sich zu einem ebenso unbändigen wie unflätigen Franzosenhass. Goethe und Schiller hingegen, aber auch die Gebrüder Grimm mit ihrem Unternehmen des Deutschen Wörterbuchs, suchten nach einem nationalbewussten Ausbau der deutschen Sprache ohne diese nationalistischen Auswüchse. Das alles war eine ganze Generation vor Riegel. Folgte nun eine bloße Wiederholung? Und wieso gerade jetzt?
Die letzte Frage ist am einfachsten zu beantworten und teilweise auch schon beantwortet worden: Riegel hat die genannten »Vorläufer« schemenhaft gekannt und versucht, sich mit dem Hinweis von ihnen abzusetzen, man habe früher alles durch Übereifer verdorben. Aber diese Vorläufer hätten im Prinzip die richtige Idee gehabt: die Nation auf einer einenden Sprache zu gründen. Und nun waren die Bedingungen ganz andere und bessere: Die Einheit sollte nicht durch die Sprache gewonnen werden, denn sie war ja bereits da. Nun konnte sie durch die Sprache vertieft werden. Als preußischer Museumsdirektor in der provinziellen Umgebung eines zum Deutschen Reich gehörenden Herzogtums hatte Riegel die Labilität der Einheit täglich vor Augen. Er hörte mit Entsetzen, wie man in seiner Umgebung vom mickrigen Braunschweig als »Nachbarstaat« Preußens sprach. Gab es nicht etwas Gemeinsames, das man pflegen konnte, um die große Gemeinsamkeit zu stärken? Und wenn es die Sprache wäre, fraglos das Gemeinsamste überhaupt, mit dem letztlich willkommenen Makel, dass sie verbesserungsfähig war? Und deren Verbesserung als bestmögliche Nebenwirkung die Gemeinsamkeit vertiefte?
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben:





























