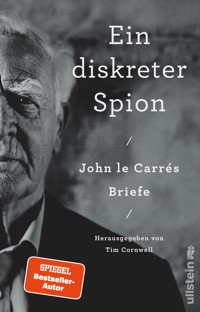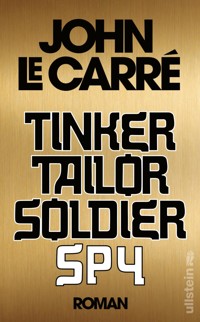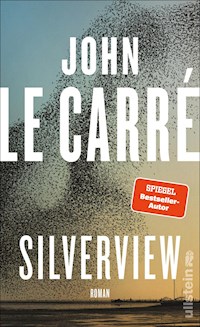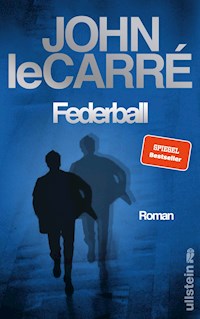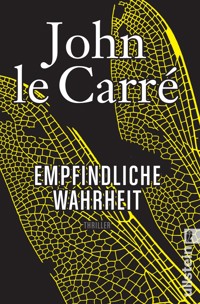8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Alle Romane von John le Carré jetzt als E-Book! - An das Spiel mit zwei Identitäten hat Ted Mundy sich nie gewöhnen können. Jetzt führt er endlich ein ruhiges Leben in Deutschland. Bis Sascha, ein Weggefährte aus Berliner Tagen, vor seiner Tür steht und ihn in die Untiefen der gegenwärtigen Zeitläufte lockt. Das brillante Porträt einer ungewöhnlichen Freundschaft vor dem Hintergrund der weltpolitischen Abgründe unserer Zeit. Große TV-Doku "Der Taubentunnel" ab 20. Oktober 2023 auf Apple TV+
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Das Buch
Ted Mundy ahnt, dass er in Schwierigkeiten steckt, als im Frühjahr 2003 Sascha vor ihm steht. Kennen gelernt hatten der schüchterne Engländer und der politische Charismatiker einander auf dem Höhepunkt der Studentenbewegung in Berlin – nur um sich nach den Tagen der Ernüchterung jenseits des Eisernen Vorhangs wiederzufinden: Sascha als vom Dogmatismus der DDR enttäuschter politischer Idealist, Ted als Reisender in Sachen britischer Kultur, der unversehens zum hochkarätigen Mitglied des Britischen Geheimdienstes wird. Erst der Fall der Mauer bringt die ungleichen Freunde auseinander. Bis Sascha Jahre später angesichts des Irakkriegs an Teds politisches Gewissen appelliert – und ihn mit einem rätselhaften und von großen Visionen beseelten Milliardär namens Dimitri zusammenbringt. Doch diesmal steht mehr auf dem Spiel als nur ihre Freundschaft. Denn die Welt hat sich grundlegend verändert und mit ihr das, was bislang als Wahrheit galt …
Der Autor
John le Carré, am 19.Oktober 1931 in Poole, Dorset, geboren, war nach seinem Studium in Bern und Oxford in den sechziger Jahren in diplomatischen Diensten u. a. in Bonn und Hamburg tätig. Sein Roman Der Spion, der aus der Kälte kam machte ihn 1963 weltbekannt. Zahlreiche seiner Bestseller wurden erfolgreich verfilmt. Der Autor lebt mit seiner Frau in Cornwall.
Von John le Carré sind in unserem Hause bereits erschienen:
Absolute Freunde · Agent in eigener Sache · Dame, König, As, Spion · Das Rußlandhaus · Der ewige Gärtner · Der heimliche Gefährte · Der Nachtmanager · Der Spion, der aus der Kälte kam · Der Schneider von Panama · Der wachsame Träumer · Die Libelle · Ein blendender Spion · Ein guter Soldat · Ein Mord erster Klasse · Eine Art Held · Eine kleine Stadt in Deutschland · Empfindliche Wahrheit · Geheime Melodie · Krieg im Spiegel · Marionetten · Schatten von gestern · Single & Single · Unser Spiel · Verräter wie wir
John le Carré
Absolute Freunde
Roman
Aus dem Englischen von Sabine Roth
List Taschenbuch
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-0841-8
1.Auflage September 2005
© für die deutsche Ausgabe Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2005
© 2004 für die deutsche Ausgabe by Ullstein Buchverlage GmbH/List Verlag
© 2003 by David Cornwell
Titel der englischen Originalausgabe:
Absolute Friends (Hodder & Stoughton, London)
Umschlaggestaltung: Sabine Wimmer, Berlin
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzung wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
E-Book: CPI – Clausen & Bosse, Leck
1
Am Tag, an dem er von seinem Schicksal eingeholt wurde, stand Ted Mundy auf einem selbst gezimmerten Podest in Schloss Linderhof, einen Bowler auf dem Kopf. Es war kein klassischer Bowler, eher Stan und Ollie als Savile Row. Es war auch kein englischer Hut, trotz des Union Jack, der in chinesischer Seide auf der Brusttasche von Mundys betagter Tweedjacke prangte. Dem speckigen Etikett an der Innenseite zufolge stammte er aus der Manufaktur Steinmatzky & Söhne in Wien.
Und da der Hut – wie Mundy umgehend jedem oder vorzugsweise jeder Leichtsinnigen versicherte, die Opfer seiner unendlichen Gesprächigkeit wurden – nicht ihm gehörte, diente er auch nicht der Selbstkasteiung. »Es ist meine Amtsmelone, Madam«, exkulpierte er sich in einer jener Suaden, die er jederzeit aus dem Ärmel schütteln konnte. »Ein historisches Juwel, mir vorübergehend anvertraut von Generationen von Vorgängern auf diesem Posten – fahrenden Scholaren, Dichtern, Träumern, Geistlichen, und jeder Einzelne von uns treuer Diener unseres König Ludwigs selig, jawoll!« – das Jawoll! womöglich ein unfreiwilliger Rückfall in den militärischen Ton seiner Kindheit. »Die Frage ist doch, was wäre die Alternative? Sie werden von einem Vollblutengländer ja kaum verlangen, dass er mit einem Regenschirm wedelt wie die japanischen Fremdenführer. Nicht in Bayern, alles, was recht ist! Nicht fünfzig Meilen von dem Ort, wo der gute Neville Chamberlain seinen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat. Nicht wahr, Madam?«
Wenn sich dann seine Zuhörerschaft, wie nicht selten der Fall, als zu hübsch herausstellt, um zu wissen, wer Neville Chamberlain ist oder von welchem Teufel hier die Rede sein könnte, so lässt der Vollblutengländer in seiner Herzensgüte sogleich die Anfängerversion des schändlichen Münchner Abkommens von 1938 folgen, nicht ohne darauf zu verweisen, dass selbst unserer hochheiligen britischen Monarchie, ganz zu schweigen vom Adel und der Tory-Partei hier auf Erden, praktisch jedes Zugeständnis an Hitler akzeptabler schien als ein Krieg.
»Hatten eine Heidenangst vor den Bolschewisten, die Briten«, redet er sich in Fahrt, in dem ausgefeilten Telegrammstil, der sich, wie das Jawoll!, in solchen Situationen seiner bemächtigt. »Amerikanische Führungskreise genauso. Hatten nie anderes im Sinn, als Hitler auf die Rote Gefahr zu hetzen.« Und daher bleibt Neville Chamberlains zusammengeklappter Regenschirm für die Deutschen bis zum heutigen Tage, Madam, das schmachvolle Symbol der britischen Appeasementpolitik gegenüber unserem geliebten Führer, wie Adolf Hitler bei Mundy immer noch heißt. »Ganz ehrlich, in diesem Land werde ich als Engländer lieber pitschnass, als dass ich mit Regenschirm herumlaufe. Aber deswegen sind Sie nicht hergekommen, hab ich Recht? Sie wollen das Lieblingsschloss Ludwigs II. besichtigen und sich nicht von einem alten Trottel von Neville Chamberlain vorschwafeln lassen. Hab ich Recht? Ganz meinerseits, Madam …« – dies mit einem selbstironischen Lüften des Huts, unter dem eine rebellische graumelierte Haartolle hervorschnellt wie ein Windhund aus seiner Startbox – »… Ted Mundy, Hofnarr des Märchenkönigs, stets zu Ihren Diensten.«
Und mit wem, denken sie, hatten sie es zu tun, seine Schäfchen – so sie sich denn etwas denken? Wie behalten sie Ted Mundy in Erinnerung, wenn überhaupt? Als Komödianten vor allem. Als eine verkrachte Existenz: ein professioneller englischer Witzbold mit Bowler und Union Jack, der jede Rolle spielt, nur nie sich selbst, fünfzig in günstigem Licht, kein übler Bursche, aber möchte man ihm seine Tochter anvertrauen? Und diese senkrechten Furchen über den Augenbrauen, wie feine Einschnitte eines Skalpells, das könnte Wut sein, das könnten Albträume sein: Fremdenführer Ted Mundy.
* * *
Es ist drei Minuten vor fünf, Ende Mai, und die letzte Führung des Tages steht an. Die Luft kühlt langsam ab, eine orangegelbe Frühsommersonne blitzt durch die jungen Buchen. Ted Mundy sitzt auf dem Balkon, die Knie angezogen wie ein riesiger Grashüpfer, den Bowler in die Stirn gedrückt gegen die grellen Strahlen. Er liest in einer verknitterten Süddeutschen, die er zusammengefaltet für solche Momente der Ruhe zwischen den Führungen in der Innentasche seiner Jacke trägt. Der Irakkrieg ist vor einem knappen Monat für beendet erklärt worden. Mundy, sein unversöhnlicher Gegner, studiert die kleineren Meldungen: Premierminister Tony Blair wird nach Kuwait fliegen, um dem kuwaitischen Volk seinen Dank für die Unterstützung bei der siegreichen Auseinandersetzung auszusprechen.
»Tss«, macht Mundy laut, mit gerunzelter Stirn.
Auf seiner Reise wird Mr Blair einen kurzen Zwischenstopp im Irak einlegen. Im Vordergrund wird dabei weniger der Sieg, sondern der Wiederaufbau stehen.
»Wär ja auch noch schöner«, knurrt Mundy. Die Stirnfalten vertiefen sich.
Mr Blair ist zuversichtlich, dass die irakischen Massenvernichtungswaffen in Bälde gefunden sein werden. Der amerikanische Verteidigungsminister Rumsfeld dagegen äußert die Vermutung, die Iraker könnten sie vor Kriegsbeginn zerstört haben.
»Also was jetzt, ihr Deppen?«, schnaubt Mundy.
Bis hierher hat sein Tag denselben verzwickten und staunenswerten Verlauf genommen wie immer. Punkt sechs steigt er aus dem Bett, das er mit seiner jungen türkischen Lebensgefährtin Zara teilt, um über den Flur zu schleichen, Zaras elfjährigen Sohn Mustafa zu wecken und anschließend sicherzustellen, dass Mustafa sich wäscht und die Zähne putzt, seine Morgengebete verrichtet und das aus Brot, Oliven, Tee und Nutella bestehende Frühstück isst, das Mundy ihm unterdessen aufgetischt hat. All dies geschieht quasi auf Zehenspitzen. Zara ist für die Spätschicht in einem türkischen Imbiss nahe dem Münchner Hauptbahnhof eingeteilt, und ihr Schlaf ist heilig. Seit sie nachts arbeitet, kommt sie immer erst gegen drei Uhr morgens heim, chauffiert von einem freundlichen kurdischen Taxifahrer, der im selben Haus wohnt. Die muslimischen Gepflogenheiten sehen für jemanden wie sie ein rasches Gebet vor Sonnenaufgang vor, gefolgt von den acht Stunden ungestörten Schlafs, die ihr Körper braucht. Aber Mustafas Tag beginnt um sieben, und Mustafa muss auch beten. Es bedurfte der vereinten Überredungskunst Mundys und Mustafas, sie davon zu überzeugen, dass Mundy die Morgenandacht ihres Sohns beaufsichtigen kann und sie sich solange ausschläft. Mustafa ist ein stiller, katzenhafter Junge mit einem Helm aus schwarzem Haar, ängstlichen braunen Augen und einer heiser scheppernden Stimme.
Von der Mietskaserne, einem schäbigen Kasten aus nässendem Beton, stapfen Mann und Junge zwischen Baustellen hindurch zu einem Bushäuschen, dessen Wände über und über mit Graffiti vorwiegend diffamierenden Inhalts vollgesprüht sind. Der Häuserblock ist das, was man heutzutage ein ethnisches Dorf nennt: Kurden, Jemeniten und Türken leben darin eng aneinander gepfercht. Andere Kinder sind bereits an der Haltestelle versammelt, einige mit ihren Müttern oder Vätern. Es spräche nichts dagegen, Mustafa in ihrer Obhut zu lassen, aber Mundy zieht es vor, mit ihm im Bus zur Schule zu fahren und ihm am Schultor demonstrativ die Hand zu schütteln; manchmal küsst er ihn auch ganz formell auf beide Wangen. In den grauen Jahren, bevor Mundy in sein Leben getreten ist, hatte Mustafa Demütigung und Furcht zu leiden. Er muss aufgebaut werden.
Für den Weg zurück zur Wohnung braucht Mundy mit seinen langen Schritten zwanzig Minuten, und er geht ihn halb in der Hoffnung, dass Zara noch schläft, halb, dass sie gerade aufgewacht ist, denn dann lässt sie sich, träge erst und dann immer leidenschaftlicher, von ihm lieben, bevor er in seinem uralten VW-Käfer die siebzigminütige Fahrt Richtung Süden antritt, nach Linderhof, zur Arbeit.
Die Fahrt ist ein Ärgernis, aber ein notwendiges. Vor zehn Monaten noch haben alle drei Mitglieder der Familie allein für sich gelitten. Jetzt sind sie eine Einheit im Kampf um ein besseres gemeinsames Leben. Wie es zu diesem Wunder kommen konnte, das ist eine Geschichte, die sich Mundy besonders gern ins Gedächtnis ruft, wenn der Verkehr ihm wieder einmal den letzten Nerv raubt:
Er ist am Ende.
Mal wieder.
Er ist praktisch auf der Flucht.
Egon, sein Geschäftspartner und stellvertretender Leiter ihrer krisengeschüttelten Sprachenschule, der Academy of Professional English, hat sich mit den letzten Geldreserven abgesetzt. Weshalb Mundy nichts anderes übrig bleibt, als seinerseits bei Nacht und Nebel aus Heidelberg zu verschwinden, mit nicht mehr, als in den Käfer hineinpasst, sowie 704 Euro kleinere Einnahmen, die Egon im Safe übersehen haben muss.
Als er frühmorgens in München ankommt, stellt Mundy den Käfer mit dem Heidelberger Kennzeichen in einer versteckten Ecke eines Parkhauses ab, für den Fall, dass seine Gläubiger Ansprüche darauf angemeldet haben. Dann macht er, was er immer macht, wenn das Leben ihm über den Kopf wächst: einen Spaziergang.
Und weil er zeit seines Lebens, aus Gründen, die weit in seine Kindheit zurückreichen, einen Hang zu ethnischer Vielfalt gehabt hat, führt sein Weg ihn beinahe ohne sein Zutun in eine Straße voller türkischer Läden und Lokale, die eben erst aufwachen. Die Sonne scheint, er hat Hunger, er wählt aufs Geratewohl ein Café aus, schachtelt seinen langen Körper vorsichtig in einen Plastikstuhl, der auf dem unebenen Pflaster unter Mundys Gewicht nicht stillhalten will, und bestellt einen großen, mittelsüßen türkischen Kaffee und zwei Sesamhörnchen mit Butter und Marmelade. Er hat kaum angefangen zu frühstücken, als eine junge Frau auf dem Stuhl neben ihm Platz nimmt und ihn, die Hand über der Oberlippe, in einem holprigen Gemisch aus Türkisch und Deutsch fragt, ob er gegen Geld mit ihr ins Bett gehen möchte.
Zara ist Ende zwanzig und unsäglich, untröstlich schön. Sie trägt eine dünne blaue Bluse mit schwarzem BH darunter und ein schwarzes Röckchen, das die nackten Schenkel frei lässt. Sie ist beängstigend mager – Drogen, nimmt Mundy fälschlicherweise an. Und schämt sich später dafür, wie auch dafür, dass er länger, als ihm lieb ist, drauf und dran war, auf ihr Angebot einzugehen. Er ist ein Mann ohne Schlaf, ohne Arbeit, ohne Frau und bald auch ohne Geld.
Aber als er die junge Frau, mit der er sich zu vergnügen gedenkt, näher betrachtet, meint er eine solche Verzweiflung in ihrem Blick zu entdecken, einen so wachen Verstand hinter ihren Augen und so wenig Vertrauen in sich und ihre Rolle, dass er sich eilig zusammenreißt und sie stattdessen zum Frühstück einlädt, worauf sie sich voller Argwohn einlässt, unter der Bedingung, dass sie die Hälfte mit nach Hause zu ihrer kranken Mutter nehmen darf. Mundy, ungemein dankbar dafür, einen Menschen gefunden zu haben, den es ebenfalls beutelt, hat eine bessere Idee: Sie isst das Frühstück ganz, und dann gehen sie zusammen in einen der vielen türkischen Läden entlang der Straße und kaufen für ihre Mutter ein.
Sie hört ihm ausdruckslos zu, mit niedergeschlagenen Augen. Mundy, verzweifelt zu jeder Einfühlung bereit, vermutet, dass sie nicht recht weiß, ob er ein Perverser ist oder einfach nur verrückt. Angestrengt versucht er, den einen wie den anderen Eindruck zu vermeiden, ohne Erfolg. Mit einer Gebärde, die ihm zu Herzen geht, zieht sie ihr Frühstück auf ihre Seite des Tisches, damit er es ihr nicht wieder wegnehmen kann.
Sie braucht beide Hände dazu, und er sieht ihren Mund. Alle vier Schneidezähne sind an der Wurzel abgebrochen. Während sie isst, schaut er sich nach einem Zuhälter um. Offenbar hat sie keinen. Vielleicht gehört sie zum Café. Er weiß nichts von ihr, aber sein Beschützerinstinkt ist erwacht. Als sie aufstehen, wird Zara erst klar, dass sie ihm kaum bis zur Schulter reicht, und sie rückt erschrocken von ihm ab. Er zieht den Kopf ein, macht sich kleiner, aber sie bleibt auf Abstand. Sie ist inzwischen das Einzige, was für ihn zählt im Leben. Seine Probleme sind nichts im Vergleich zu ihren. Im Halal-Laden kauft sie auf sein Drängen hin eine Lammkeule, Apfeltee, Kuskus, Obst, Honig, Gemüse, Halva und eine 400-Gramm-Stange Toblerone im Sonderangebot.
»Wie viele Mütter hast du?«, fragt er launig, aber der Scherz kommt bei ihr nicht an.
Beim Einkaufen bleibt sie misstrauisch und schmallippig, feilscht hinter ihrer Hand auf türkisch und zeigt mit spitzem Finger auf die Früchte – nicht die, nein, die da. Ihre Flinkheit beim Kopfrechnen beeindruckt ihn tief. Er mag sich in vielen Rollen heimisch fühlen, aber im Handeln ist er hoffnungslos. Als er ihr die Einkaufstüten abnehmen will – mittlerweile sind es zwei, beide gut gefüllt –, zerrt sie sie ihm mit wütendem Ruck aus der Hand.
»Magst ins Bett gehn mit mir?«, wiederholt sie ungeduldig, als sie die Tüten in Sicherheit gebracht hat. Die Botschaft ist unmissverständlich: Du hast für mich bezahlt, also nimm mich und scher dich zum Teufel.
»Nein«, antwortet er.
»Was willst du?«
»Dich sicher nach Hause bringen.«
Sie schüttelt heftig den Kopf. »Nicht nach Hause. Hotel.«
Er versucht zu erklären, dass seine Absichten freundschaftlicher und nicht erotischer Natur sind, aber sie ist zu müde, um ihm zuzuhören, und fängt mit unbewegtem Gesicht zu weinen an.
Er setzt sich mit ihr in das nächste Café. Die Tränen laufen ihr über die Wangen wie Regentropfen, aber sie beachtet sie nicht. Er nötigt sie, von sich zu erzählen, und sie gehorcht gleichgültig. Sie scheint über keinerlei Schutzmechanismen mehr zu verfügen. Sie kommt vom Land, aus der Ebene von Adana, die älteste Tochter einer Bauernfamilie, berichtet sie in ihrem gebrochenen Deutsch, den Blick auf den Tisch gesenkt. Ihr Vater hatte sie dem Sohn eines benachbarten Bauern zur Ehe versprochen. Der Junge, hieß es, sei ein Computercrack, der in Deutschland Geld scheffelte. Als er zu einem Besuch nach Hause kam, wurde eine traditionelle Hochzeitsfeier abgehalten, die beiden Höfe wurden zu einem erklärt, und Zara begleitete ihren Mann nach München zurück, nur um dort festzustellen, dass er keineswegs ein Computercrack war, sondern ein gewalttätiger zweiarmiger Bandit. Er war vierundzwanzig, sie siebzehn und schwanger von ihm.
»Es war eine Gang«, sagt sie bündig. »Alle Männer waren schlimme Verbrecher. Alle verrückt. Stehlen Autos, verkaufen Drogen, haben Nachtclubs, kontrollieren Nutten. Alle schlimmen Sachen. Jetzt er sitzt in Gefängnis. Sein Glück, weil sonst meine Brüder ihn umbringen.«
Er ist seit neun Monaten im Gefängnis, hat es sich aber nicht nehmen lassen, seiner Frau vorher noch rasch die Zähne auszuschlagen und seinem Sohn Todesangst einzujagen. Sein Urteil lautet auf sieben Jahre, weitere Verfahren sind anhängig. Ein Mitglied der Bande hat als Kronzeuge ausgesagt. Ihre Geschichte fließt in monotonem Gleichmaß dahin, während sie in Richtung Westend gehen, meist auf deutsch, mit türkischen Brocken dazwischen, wenn ihr Deutsch sie im Stich lässt. Manchmal weiß er nicht, ob sie sich seiner Gegenwart überhaupt noch bewusst ist. Mustafa, antwortet sie, als er sich nach dem Namen des Jungen erkundigt. Sie stellt ihm keine Fragen über ihn selbst. Sie trägt die Einkaufstüten, und er versucht nicht noch einmal, sie ihr abzunehmen. Um ihren Hals hängen blaue Perlen, und aus lang vergangenen Zeiten erinnert er sich, dass für abergläubische Muslime blaue Perlen vor dem bösen Blick schützen. Sie schnieft noch, aber die Tränen sind versiegt. Es kommt ihm vor, als setzte sie ein fröhliches Gesicht auf für jemanden, der nicht wissen soll, dass sie geweint hat. Das Münchner Westend hat wenig gemeinsam mit seinem vornehmen Londoner Pendant: schäbige graubraune Vorkriegsbauten, trocknende Wäsche in den Fenstern, Kinder, die auf einem räudigen Rasenviereck spielen. Ein Junge bemerkt sie, lässt seine Freunde stehen, hebt einen Stein auf und nähert sich ihnen drohend. Zara sagt etwas auf türkisch zu ihm.
»Was willst du?«, ruft der Junge Mundy entgegen.
»Am liebsten ein Stück von deiner Toblerone, Mustafa«, antwortet Mundy.
Der Junge starrt ihn an, wechselt ein paar Worte mit seiner Mutter, pirscht sich dann heran, den Stein noch in der Rechten, während er mit der Linken in den Tüten herumtastet. Wie seine Mutter ist auch er mager, mit Schatten unter den Augen. Wie seine Mutter hat auch er etwas Abgestumpftes an sich.
»Und eine Tasse Apfeltee«, fügt Mundy hinzu. »Mit dir und deinen Freunden.«
Angeführt von Mustafa, der sich der Tüten bemächtigt hat, und eskortiert von drei stämmigen dunkeläugigen Knaben, folgt Mundy Zara eine schmuddelige Steintreppe hoch in den dritten Stock. Sie erreichen eine eisenbeschlagene Tür, und Mustafa fischt mit besitzerischer Geste einen Hausschlüssel an einer Kette unter seinem Hemd hervor. Zusammen mit seinen Freunden tritt er über die Schwelle. Nach ihnen tritt Zara ein. Mundy wartet, bis er hereingebeten wird.
»Komm rein, bitteschön«, fordert ihn Mustafa auf. »Du bist sehr willkommen. Aber wenn du meine Mutter anrührst, machen wir dich kalt.«
* * *
Die nächsten zehn Wochen schläft Mundy im Wohnzimmer auf Mustafas Schlafsofa, bei dem ihm die Füße über den Rand hängen, während Mustafa bei seiner Mutter schläft, einen Baseballschläger griffbereit, sollte Mundy auf dumme Gedanken kommen. Die erste Zeit weigert er sich, zur Schule zu gehen, also geht Mundy mit ihm in den Tierpark oder spielt auf dem räudigen Rasenviereck Ball mit ihm, und Zara bleibt daheim und tritt ganz allmählich in jenes Stadium der Rekonvaleszenz ein, auf das Mundy seine Hoffnungen setzt. Schritt für Schritt übernimmt er seine neue Rolle als säkularer Vater eines muslimischen Kindes und platonischer Beschützer einer traumatisierten Frau im Stande religiöser Verfemtheit. Die Nachbarn überwinden ihr anfängliches Misstrauen und gewöhnen sich an diesen schlaksigen englischen Eindringling, der so viel herumkaspert, und er für seinen Teil tut, was er kann, um sich von dem Ruch der Kolonialmacht zu distanzieren, den er seinem Land noch immer anhaften fühlt. Zum Leben dienen ihnen der Rest seiner siebenhundert Euro und das bisschen Unterhalt, das Zara von ihrer türkischen Familie und dem Münchner Sozialamt bekommt. Abends kocht sie gern, und Mundy gibt den Küchenjungen. Erst will sie davon nichts wissen, dann erlaubt sie es murrend. Das gemeinsame Kochen wird zum Höhepunkt des Tages. Ihr seltenes, zahnloses Lachen ist wie ein Geschenk für ihn. Er erfährt, dass es ihr großer Traum ist, eine Ausbildung als Krankenschwester zu machen.
Nach den Sommerferien verkündet Mustafa, dass er nun wieder in die Schule gehen will. Mundy bringt ihn hin und wird von Mustafa stolz als sein neuer Vater vorgestellt. Noch in dieser Woche besuchen sie zu dritt Zaras Moschee. Mundy, der eine vergoldete Kuppel und ein Minarett erwartet hat, findet sich zu seinem Erstaunen in einem gekachelten Raum im Obergeschoss eines heruntergekommenen Hauses inmitten von Brautmodengeschäften, Halal-Schlachtereien und Läden wieder, die gebrauchte Elektrogeräte verkaufen. Von früher her erinnert er sich daran, dass er die Fußspitzen nicht so hinstellen darf, dass sie auf jemanden zeigen, und dass er keiner Frau die Hand geben darf, sondern die Rechte aufs Herz legen und respektvoll den Kopf neigen muss. Zaras Platz ist im Frauenraum, darum nimmt Mustafa Mundy bei der Hand und führt ihn zur Gebetsreihe der Männer, wo er ihn anweist, wann er aufzustehen hat und wann sich zu verneigen oder niederzuknien und die Stirn auf die schmale Binsenmatte zu drücken, die als Erdboden herhalten muss.
Mustafas Genugtuung ist immens. Bisher hat er immer oben bei seiner Mutter und den kleineren Kindern sitzen müssen. Dank Mundy darf er jetzt unten sein, bei den Männern. Und nach dem Beten dürfen Mustafa und Mundy allen Männern ringsum die Hand schütteln und jedem wünschen, seine Gebete mögen im Himmel gnädige Aufnahme gefunden haben.
»Strebe nach Wissen, und Gott macht dich weise«, rät der aufgeklärte junge Imam Mundy zum Abschied. »Wer nicht nach Wissen strebt, geht leicht gefährlichen Ideologien auf den Leim. Sie sind mit Zara verheiratet, ist das richtig?«
Mundy besitzt den Anstand zu erröten und murmelt etwas von Hoffnung und eines Tages.
»Das Äußerliche ist nicht entscheidend«, versichert ihm der Imam. »Auf die Verantwortung kommt es an. Übernehmen Sie Verantwortung, und Gott wird Sie belohnen.«
Eine Woche später bekommt Zara die Stelle in dem Kebab-Imbiss am Bahnhof. Der Geschäftsführer, glücklos in seinen Annäherungsversuchen, besinnt sich stattdessen auf ihre anderweitigen Qualitäten. Zara trägt ihr Kopftuch und ist schon bald seine Vorzeige-Angestellte, mit einem Schlüssel für die Kasse und einem baumlangen Engländer als Beschützer. Nach weiteren zwei Wochen findet auch Mundy seinen Platz in der Welt: als englischsprachiger Fremdenführer in Schloss Linderhof. Am nächsten Tag stattet Zara dem aufgeklärten jungen Imam und seiner Frau einen Besuch ab. Wieder daheim, berät sie sich eine Stunde lang hinter verschlossenen Türen mit Mustafa. Noch am selben Abend tauschen Mustafa und Mundy die Betten.
Mundy hat schon seltsamere Lebensphasen hinter sich, aber keine, da ist er sich sicher, hat ihn mit solcher Befriedigung erfüllt. Er liebt Zara über die Maßen. Mustafa liebt er nicht minder, und umso mehr dafür, dass er seine Mutter so liebt.
* * *
Der Pferch mit den englischsprachigen Besuchern öffnet seine Gatter, und heraus schiebt sich die übliche multikulturelle Touristenherde. Kanadier mit roten Ahornblättern auf ihren Rucksäcken, Finnen in Anoraks und karierten Golfmützen, Inderinnen in Saris, australische Schafzüchter mit ihren luftgetrockneten Frauen, ältliche Japaner mit Schmerzensgrimassen, die ihm immer wieder aufs Neue Rätsel aufgeben: Mundy kennt sie alle, von den Farben ihrer Reisebusse bis hin zu den Vornamen ihrer geschäftstüchtigen Betreuer, die ihre Schutzbefohlenen lediglich zu den Souvenirständen zu locken versuchen, zum Wohl ihrer Provisionen. Das Einzige, was im Aufgebot des heutigen Spätnachmittags fehlt, sind die Trupps von Teenagern aus dem Mittleren Westen mit Stacheldrahtgehegen um ihre Zähne, aber Amerika feiert seinen Sieg über das Böse, sehr zur Betrübnis der deutschen Tourismusbranche, zu Hause.
Die Melone über dem Kopf schwenkend, setzt Mundy sich an die Spitze seiner Herde und marschiert ihr zum Haupteingang voran. In der anderen Hand hält er sein Podest, ein Gestell aus Sperrholz, das er im Heizungskeller der Mietskaserne zusammengezimmert hat. Andere Fremdenführer benutzen die Treppe als Rednerpult. Nicht so Ted Mundy, unser Hyde-Park-Corner-Prediger. Ted Mundy knallt sein Podest vor sich hin und besteigt es zackig, so dass er sein Publikum um bald einen halben Meter überragt, den Bowler jetzt wieder auf dem Kopf.
»Alle, die englisch sprechen, bitte zu mir, danke. Die englisch zuhören, sollte ich wohl besser sagen. Auch wenn es mir um diese Tageszeit gar nicht unlieb wäre, Sie würden das Sprechen übernehmen. Nein, kleiner Scherz …« – die Stimme bewusst gesenkt an dieser Stelle, damit sie still sein müssen, um ihn hören zu können, – »noch geht mir die Puste nicht aus, keine Bange. Photoapparate sind erlaubt, Ladies and Gents, aber bitte keine Videokameras – nein, auch Ihre nicht, Sir, vielen Dank –, fragen Sie mich nicht, warum, aber meine Herren und Gebieter versichern mir glaubhaft, dass schon der leiseste Hauch einer Videokamera uns wegen Diebstahl geistigen Eigentums vor Gericht bringt. Die übliche Bestrafung ist Tod durch den Strang.« Kein Gelächter, aber das erwartet er auch noch nicht von einem Publikum, das vier Stunden lang in einen Bus gezwängt war und danach eine Stunde in der prallen Sonne anstehen musste. »Treten Sie näher, Ladies and Gentlemen, noch ein bisschen näher, wenn ich bitten darf. Jede Menge Platz hier vorn, meine Damen« – dies zu einem Grüppchen ernsthafter schwedischer Lehrerinnen –, »können die jungen Herren mich von da hinten hören?« – dies zu einem Häuflein knochiger Halbwüchsiger aus den neuen Bundesländern, die in den falschen Pferch geraten sein müssen, aber nun offenbar eine kostenlose Englischstunde mitnehmen wollen –, »Sie können? Wunderbar. Und können Sie mich sehen, Sir?« – an einen winzigen Chinesen gewandt –, »Sie können. Noch ein persönliches Anliegen, wenn Sie so gut sein wollen, Ladies and Gents. Ihre Handys, wie wir sie hier in Deutschland nennen, in der restlichen Welt als Mobiltelefone bekannt. Wenn Sie sich bitte vergewissern würden, dass sie ausgeschaltet sind. Alle aus? Dann machen Sie doch bitte diese Tür da hinter sich zu, Sir, und es geht los. Vielen Dank.«
Das Sonnenlicht ist ausgesperrt, eine Myriade von Kerzenbirnen, in vergoldeten Spiegeln vervielfältigt, erleuchtet eine künstliche Dämmerung. Mundys großer Moment – einer von acht an jedem Arbeitstag – ist gekommen.
»Wie die Aufmerksameren unter Ihnen bereits bemerkt haben werden, stehen wir hier in der vergleichsweise bescheidenen Eingangshalle des Linderhofs. Nicht Schloss Linderhof, wenn ich bitten darf, denn mit Hof ist im Deutschen ein Bauernhof gemeint, und das Schloss, in dem wir uns befinden, ist auf dem Grund erbaut, auf dem einmal der Linderhof stand. Aber was bedeutet Linder, fragen Sie jetzt vielleicht. Gibt es einen Philologen unter uns? Einen Etymologen? Einen Fachmann für alte Wortbedeutungen?«
Es gibt keinen, umso besser, denn Mundy setzt zu einer seiner fragwürdigen Improvisationen an. Er wählt jedes Mal einen neuen Aufhänger, warum, weiß er nicht recht zu sagen. Vielleicht ist es schlicht eine Schwäche von ihm. Zuweilen überrascht er sich selber, was durchaus therapeutische Wirkung haben kann, wenn er gegen andere, hartnäckigere Gedanken ankämpfen muss, an den Irak etwa, oder an den bedrohlichen Brief seiner Heidelberger Bank, der heute Morgen in der Post war, zusammen mit einer Mahnung von seiner Versicherung.
»Gut, es könnte natürlich auf einen Lindenbaum zurückgehen. Oder der Hof hat möglicherweise einfach einem Mr Linder gehört. Aber mir persönlich« – jetzt hebt er ab – »gefällt eine andere Herleitung besser, nämlich die von dem Verb lindern – beruhigen, beschwichtigen, begütigen. Und ich stelle mir gern vor, dass das die Deutung ist, die unserem armen König Ludwig am meisten zugesagt hat, zumindest unterschwellig. Der Linderhof war ein Ort der Linderung für ihn. Vergessen Sie nicht, Ludwig hatte kein ganz leichtes Leben. Er war neunzehn, als er den Thron bestieg, er hatte einen Vater, der ihn tyrannisierte, Hauslehrer, die ihn sekkierten, Bismarck deckelte ihn, seine Höflinge fielen ihm in den Rücken, korrupte Politiker benutzten ihn als Spielball, trampelten auf seiner Königswürde herum, und seine Mutter hat er kaum gekannt.«
Hat Mundy Ähnliches erdulden müssen? Seine bebende Stimme scheint darauf hinzudeuten.
»Was macht er also, dieser gut aussehende, übergroße, sensible, herumgestoßene, stolze junge Mann, der sich von Gott als Herrscher eingesetzt fühlt?«, fragt er mit der ganzen leidenden Autorität dessen, der weiß, was große Männer auszustehen haben. »Was macht er, als er sich systematisch der Macht beraubt sieht, in die er hineingeboren ist? Antwort: Er baut sich eine Handvoll Märchenschlösser. Und Recht hat er.« – er dreht immer mehr auf – »Schlösser mit einer Botschaft. Illusionen der Macht. Je schwächer sein Stand, desto grandioser die Illusionen, die er aufbaut – genau wie mein wackerer Premierminister Mr Blair, wenn Sie meine Meinung interessiert, aber bitte zitieren Sie mich nicht« – verdattertes Schweigen –, »weshalb ich persönlich Ludwig auch ungern als verrückt bezeichne. Den König der Träumer, so nenne ich ihn lieber. Den König der Eskapisten, wenn Sie so wollen. Ein einsamer Visionär in einer schäbigen Welt. Er lebte bei Nacht, wie Sie wahrscheinlich wissen. Mochte die Menschen allgemein nicht sehr, und die Damen gleich gar nicht. Guter Gott, nein!«
Gelächter von einer Gruppe Russen, die eine Flasche herumgehen lassen, aber Mundy überhört es geflissentlich. Erhöht auf seinem selbst gebastelten Podium, den Bowler über seiner widerspenstigen Tolle in die Stirn gezogen wie die Bärenfellmütze eines Gardisten, ist er in eine Sphäre eingetreten, die kaum weniger entrückt ist als die König Ludwigs. Vereinzelt nur schaut er flüchtig in die zu ihm aufblickenden Gesichter oder hält inne und wartet, bis ein Kind sich ausgeheult oder eine Rotte Italiener ihren Privatzwist beigelegt hat.
»In seiner Phantasie war Ludwig der Herrscher des Universums, jawoll! Niemand, aber gleich gar niemand, erteilte ihm Befehle. Hier im Linderhof war er die Reinkarnation des Sonnenkönigs, dieses bronzenen Herrn, den Sie auf dem Tisch dort drüben auf seinem Pferd sitzen sehen: Ludwig ist die deutsche Entsprechung von Louis. Und in Herrenchiemsee, nur ein paar Meilen von hier, hat er sich sein eigenes Versailles erbaut. In Neuschwanstein gleich um die Ecke war er Siegfried, der große deutsche Kriegerkönig des Mittelalters, den Ludwigs angebeteter Richard Wagner in einer Oper verewigt hat. Und für die ganz Sportlichen unter Ihnen gibt es das Jagdschloss Schachen hoch in den Bergen, wo er sich aus gegebenem Anlass selbst zum König von Marokko krönte. Er hätte sich auch zu Michael Jackson gemacht, wenn er von ihm gehört hätte, aber das hatte er Gott sei Dank nicht.«
Allgemeines Gelächter jetzt, von Mundy auch diesmal ignoriert.
»Und Seine Majestät hatte so seine kleinen Eigenheiten. Er ließ sich sein Essen auf einem goldenen Tisch decken, der durch ein Loch im Boden zu ihm hochgefahren kam, wie Sie gleich mit eigenen Augen sehen können – damit niemand ihm beim Essen zuschauen konnte. Seine Diener mussten die ganze Nacht auf Zack sein, und wenn ihm etwas nicht passte, befahl er, ihnen bei lebendigem Leib die Haut abzuziehen. Wenn er ungesellig aufgelegt war, saß er hinter einem Paravent, wenn er mit einem redete. Und vergessen Sie nicht: Wir reden hier nicht vom Mittelalter, sondern vom neunzehnten Jahrhundert! Draußen in der richtigen Welt werden Eisenbahnen und Schiffe aus Stahl und Dampfmaschinen und Maschinengewehre und Kameras gebaut. Nichts anno Tobak also, nichts graue Vorzeit! Außer für Ludwig natürlich. Ludwig hatte den Rückwärtsgang eingelegt. Er reiste zurück in die Geschichte, so schnell sein Geld ihn dort hinbefördern konnte. Was der kleine Haken bei der Sache war, denn es war auch das Geld des bayerischen Staats.«
Ein rascher Blick auf seine Uhr. Dreieinhalb Minuten um. Zeit für ihn, an der Spitze seiner Herde die Treppe zu erklimmen. Und auf geht’s. Durch die angrenzenden Wände hört er seine Kollegen, ihre Stimmen erhoben wie seine eigene: die herrische Frau Dr. Blankenheim, pensionierte Lehrerin und Doyenne des Literaturzirkels, seit neuerem zum Buddhismus konvertiert; der bleiche Herr Stettler, Fahrradfahrer und Erotomane; Michel Delarge aus dem Elsass, seines Amtes enthobener Priester. Und hinter Mundy, die Stufen hinaufdrängend: Welle um Welle unbezwingbarer japanischer Infanterie, angeführt von einer trippelnden Nippon-Schönheitskönigin mit einem rostbraunen Regenschirm, der mit dem Neville Chamberlains nichts mehr gemein hat.
Und irgendwo ganz in der Nähe, keineswegs zum ersten Mal in seinem Leben, der Geist Saschas.
* * *
Nimmt Mundy das vertraute Kribbeln im Rücken erst mals hier auf der Treppe wahr? Im Thronsaal? Im königlichen Schlafgemach? Im Spiegelsaal? Wo überkommt ihn die Gewissheit, hinterrücks wie eine alte Vorahnung? Ein Spiegelsaal ist eine erklärte Bastion gegen die Realität. Die vervielfachten Abbilder der Wirklichkeit verlieren beim Zurückweichen ins Unendliche an Wirkung. Eine Gestalt, deren Anblick im direkten Gegenüber schieres Entzücken oder Entsetzen hervorriefe, wird in ihren unzähligen Spiegelungen zur reinen Prämisse, einer vermuteten Form.
Zudem ist Mundy, der Notwendigkeit und seiner Schulung gehorchend, ein überaus wachsamer Mensch. Hier in Linderhof tut er keinen noch so kleinen Schritt, ohne sich zuvor in alle Richtungen umzuschauen, sei es nach unerwünschten Relikten früherer Leben, sei es nach missliebigen Figuren aus seinem jetzigen, als da wären: Kunstdiebe, mutwillige Zerstörer, Taschendiebe, Gläubiger, Gerichtsvollzieher aus Heidelberg, greise Touristen, die Herzinfarkten erliegen, Kinder, die auf unbezahlbare Teppiche kotzen, Damen mit in ihren Handtaschen versteckten Hündchen und neuerdings – auf das strikte Geheiß der Schlossverwaltung hin – suizidal gestimmte Terroristen. Nicht zu vergessen in dieser Ehrenliste die gelegentliche willkommene Abwechslung, selbst für einen so glücklich Liebenden: ein wohlgeformtes Mädchen, dessen Reize diskret bewundert sein wollen.
Mundys heimliche Helfer bei seiner Wache sind bestimmte zweckdienliche Standorte und Gegenstände: hier ein dunkles und praktischerweise verglastes Gemälde, das an ihm vorbei ins Treppenhaus hinunterblickt, dort eine Bronzeurne, die im weiten Winkel alle die erfasst, die rechts und links von Mundy stehen, und nun der Spiegelsaal selbst, mit einer Vielzahl gespiegelter Saschas in meilenlangen goldenen Korridoren.
Oder auch nicht.
Ist es doch wieder bloß ein phantasiegeborener Sascha, ein freitagabendliches Trugbild? Mundy hat, das ruft er sich hastig in Erinnerung, genügend Beinahe-Saschas gesehen in den Jahren, seit ihre Wege sich getrennt haben: bettelarme Saschas, die ihn von der anderen Straßenseite erspähen und, spinnenartig vor Hunger und Begeisterung, zwischen fahrenden Autos hindurchhumpeln, um ihm um den Hals zu fallen; wohlhabende, gepflegte Saschas mit Pelzkragen, die bühnenwirksam aus Hauseingängen hervorspringen oder die Treppen öffentlicher Gebäude herunterklappern, laut rufend: Teddy, Teddy, ich bin’s, dein alter Freund Sascha! Doch kaum bleibt Mundy stehen und wendet sich um, das pflichtgetreue Strahlen im Gesicht, hat die Erscheinung sich in Luft aufgelöst oder geht, plötzlich ein völlig fremder Mensch, still und heimlich in der Menge auf.
So dass es das schlichte Bedürfnis nach Klarheit ist, das Mundy nun dazu treibt, sich beiläufig umzustellen auf seinem Podest, zuerst mit rhetorischem Strecken des Arms und dann einer Drehung des ganzen Körpers, um seinen Zuhörern den Blick zu zeigen: den überwältigenden, den atemberaubenden Blick vom königlichen Schlaflager (nur immer meinem Arm nach, Ladies and Gents) auf den künstlichen Wasserfall am Südhang des »Hennenkopfs«.
»Stellen Sie sich vor, Sie liegen hier«, nötigt er sein Publikum mit einem Überschwang, wie er der grandiosen Kaskade gebührt, »neben sich einen Menschen, der Sie liebt – nun gut, in Ludwigs Fall wohl eher nicht« – Gekicher seitens des russischen Kontingents –, »jedenfalls liegen Sie hier, inmitten all dieses königlich-bayerischen Golds und Blaus! Und Sie erwachen an einem sonnigen Morgen und öffnen die Augen und schauen aus dem Fenster und sehen – ta-da!«
Und mit dem ta-da! hat er ihn festgenagelt: Sascha, Mann, wo zum Teufel hast du gesteckt? – nicht dass Mundy irgendetwas davon ausspräche oder auch nur mit einem Wimpernzucken ahnen ließe, denn Sascha, ganz im Wagnerschen Geist der Stätte, trägt seine Tarnkappe, wie sie früher bei ihnen hieß: die schwarze, streng in die Stirn herabgezogene Baskenmütze, die noch die leiseste Unbedachtheit verbietet, erst recht in Zeiten des Krieges.
Und für den unwahrscheinlichen Fall, dass Mundy die Grundregeln der Konspiration vergessen haben könnte, hält er zusätzlich einen nachdenklich gekrümmten Zeigefinger an die Lippen, nicht warnend, eher versonnen: ein Mann, der sich ausmalt, wie es sein müsste, an einem sonnigen Morgen aufzuwachen und aus dem Fenster auf die Kaskade zu schauen, die den »Hennenkopf« hinabrauscht. Die Geste ist unnötig. Nicht der schärfste Beobachter, nicht die empfindlichste Überwachungskamera der Welt hätte auch nur einen Hinweis auf ihr Wiedersehen auffangen können.
Denn ja, es ist Sascha. Sascha, der zwergenhafte Hüter des Schatzes, voller Leben selbst in der Bewegungslosigkeit, mit gerade dem richtigen Quäntchen Abstand zu seinem Nebenmann, um einem Größenvergleich zu entgehen, die Ellbogen leicht abgespreizt, als wollte er jeden Moment abheben, die glänzenden braunen Augen auf einen Punkt direkt über den Brauen seines Gegenübers gerichtet, selbst wenn dieses Gegenüber, wie Mundy, anderthalb Kopf größer ist: werbende, anklagende Augen, forschend und herausfordernd, Augen, die aufpeitschen, in Frage stellen und einem die Seelenruhe rauben – Sascha, so wahr mir Gott helfe.
Die Führung ist beendet. Die Hausordnung verbietet es, Trinkgelder einzufordern; die Führer dürfen sich jedoch an der Tür aufstellen, um ihre abziehenden Zuhörer mit freundlichem Nicken ins Sonnenlicht zu entlassen und ihnen einen guten und rundum wunderbaren Urlaub zu wünschen. Die Ausbeute war nie überwältigend, aber seit dem Krieg ist sie fast völlig vertröpfelt. Manchmal steht Mundy bis zum Schluss mit leeren Händen da, die Melone über die nächstbeste Büste gestülpt, damit auch ja niemand sie für etwas so Vulgäres wie einen Bettlerhut hält. Manchmal huscht ein Lehrer mit ungebärdigen Schützlingen oder ein händchenhaltendes ältliches Ehepaar herbei, drückt ihm schüchtern einen Geldschein in die Hand und bringt sich eilig wieder in Sicherheit. Heute Abend sind es ein leutseliger Bauunternehmer aus Melbourne und seine Frau Darlene, die Mundy unbedingt erklären müssen, dass ihre Tochter Tracey diesen Winter haargenau dieselbe Tour mitgemacht hat, mit haargenau demselben Reiseveranstalter, ist das nicht witzig?, und jede Minute davon traumhaft fand, vielleicht erinnert Mundy sich ja noch?, sie erinnert sich jedenfalls haargenau an den langen, dünnen Engländer mit dem ulkigen Hut. Blond, Sommersprossen und Pferdeschwanz, der Freund ein Medizinstudent aus Perth, Rugbyspieler? Und während Mundy so tut, als würde er sein Gedächtnis nach Tracey durchforsten – der Freund heißt Keith, vertraut ihm der Bauunternehmer noch an, falls ihm das auf die Sprünge hilft –, spürt er, wie eine kleine feste Hand sein Handgelenk umfasst, die Handinnenfläche nach oben biegt und die Finger über einem vielfach zusammengefalteten Zettel schließt. Im nächsten Moment sieht er aus den Augenwinkeln Saschas Baskenmütze in der Menge verschwinden.
»Nächstes Mal kommen dann Sie nach Melbourne, versprochen?«, dröhnt der australische Bauunternehmer und stopft eine Visitenkarte hinter Mundys Union Jack.
»Ich nehm Sie beim Wort«, droht Mundy mit einem fidelen Lachen und lässt dabei den Zettel flink in eine Seitentasche seines Jacketts gleiten.
* * *
Besser, du setzt dich erst einmal, ehe du eine Reise antrittst, noch besser auf dein Gepäck. So lautet eine russische Volksweisheit, aber als Regel eingeimpft hat sie ihm Nick Amory, Mundys langjähriger Mentor in puncto Selbsterhaltung: Wenn etwas im Busch ist, Edward, eine große Sache, und Sie hängen mit drin, dann atmen Sie um Gottes willen erst mal durch, bevor Sie sich reinstürzen – bezähmen Sie Ihr Ungestüm und atmen Sie durch.
In Linderhof ist der Tag um, Angestellte und Touristen streben dem Parkplatz zu. Wie ein betulicher Gastgeber steht Mundy auf der Treppe und verteilt vielsprachige Segenswünsche an seine davonziehenden Kollegen. Auf Wiedersehen, Frau Meierhof. Immer noch nichts aufgetaucht! Die Rede ist von den unauffindbaren irakischen Massenvernichtungswaffen. Fritz, tschüs. Und Grüße an die Frau Gemahlin! Grandioser Vortrag, den sie da gestern im Poltergeist-Club gehalten hat! – dem hiesigen Kultur- und Debattierverein, den Mundy gelegentlich besucht, um politischen Dampf abzulassen. Und an seine französischen und spanischen Kollegen gewandt, ein verheiratetes Schwulenpaar: Pablo, Marcel, nächste Woche gehen wir einen saufen. Buenas noches, bon soir, ihr beiden! Die letzten Nachzügler zuckeln davon in die Dämmerung, derweil er sich in den Schatten des Westparterres zurückzieht, eintaucht in die Schwärze eines Treppenschachts.
Auf die Treppe ist er rein zufällig gestoßen, kurz nachdem er mit der Arbeit hier begonnen hat.
Eines Abends, als er in den Schlossanlagen umherstreift – ein Mondscheinkonzert ist angesagt, und Mustafa hat ihm großzügig erlaubt, dazubleiben und es sich anzuhören –, entdeckt er eine bescheidene Kellertreppe, die nirgends hinzuführen scheint. An ihrem Fuß findet er eine rostige Eisentür und in der Tür einen Schlüssel. Er klopft, und da er nichts hört, schließt er auf und tritt ein. Für jeden anderen wäre der Raum, in den er kommt, nicht mehr als ein schmutziger Pflanzenkeller, ein Abstellplatz für Gießkannen, alte Gartenschläuche und kränkelnde Pflanzen. Kein Fenster, nur ein Gitterrost hoch oben in der Steinmauer. Die Luft dick von dem Gestank fauliger Hyazinthen, von nebenan das Gerumpel eines Boilers. Für Mundy jedoch ist es genau das, was König Ludwig vorgeschwebt haben muss, als er Linderhof erbauen ließ: eine Freistatt, eine Zuflucht vor all seinen anderen Zufluchtsstätten. Er sperrt wieder zu, steckt den Schlüssel in seine Tasche und wartet sieben Werktage ab, während derer er sein Zielobjekt fachmännisch observiert. Um zehn Uhr vormittags, wenn die Tore des Schlosses sich öffnen, sind sämtliche gesunden Pflanzen in den öffentlichen Räumen gegossen und die ungesunden entfernt. Der Transporter der Gärtnerei, ein mit Blumen bemalter Kleinbus, rückt spätestens um zehn Uhr dreißig ab; bis dahin ist alles kränkliche Grünzeug entweder in den Pflanzenkeller eingeliefert, oder der Bus bringt es ins Krankenhaus. An dem Verschwinden des Schlüssels hat sich niemand gestoßen. Das Schloss ist nicht ausgewechselt worden. Womit der Pflanzenkeller täglich ab elf Uhr Mundy allein gehört.
So auch heute Abend.
Unter der kargen Deckenlampe zu seiner vollen Größe aufgerichtet, zieht Mundy eine schmale Taschenlampe aus seiner Tasche, faltet den Zettel auseinander, bis er ein schmuckloses weißes Blatt Papier vor sich hat, und sieht, was er zu sehen erwartet: Saschas Schrift, wie sie war und immer sein wird – die vertrauten spitzen deutschen E’s und R’s, seine typischen sturen Unterstriche. Der Ausdruck auf Mundys Gesicht, während er liest, ist schwer zu deuten. Resignation, Unbehagen und Freude, alles spielt mit hinein. Das vorherrschende Gefühl ist eine wehmütige Erregung. Vierunddreißig Jahre, mein Gott. Wir kennen uns seit über drei Jahrzehnten. Wir kommen zusammen, wir fechten zusammen unseren Kampf aus, wir trennen uns für ein Jahrzehnt. Wir kommen wieder zusammen, und zehn Jahre lang können wir in unserem neuen Kampf ohne einander nicht sein. Wir trennen uns für immer, und zehn Jahre später kommst du zurück.
Aus seiner Jackentasche kramt er ein abgestoßenes Zündholzheftchen aus Zaras Café. Er bricht ein Hölzchen ab, streicht es an und hält den Zettel in die Flamme, erst an einer Ecke, dann an der anderen, bis nur ein verkrümmter Aschenwurm übrig ist. Den lässt er auf die Steinplatten fallen und zertritt ihn mit dem Absatz zu schwarzem Staub, ein unerlässliches Ritual. Er schaut auf die Uhr, rechnet nach. Eine Stunde und zwanzig Minuten muss er herumbringen. Sie anzurufen hat noch keinen Sinn. Ihre Schicht hat eben erst begonnen. Ihr Chef rastet aus, wenn das Personal während der Hauptgeschäftszeit Anrufe erhält. Mustafa wird mit Kamal drüben bei Dina sein. Mustafa und Kamal sind unzertrennlich, die Stars der rein türkischen Kricketmannschaft ihres Wohnblocks im Westend, deren Präsident ein gewisser Mr Edward Mundy ist. Dina ist Zaras Kusine und gute Freundin. Er tippt auf einem abgewetzten Mobiltelefon herum, bis er ihre Nummer gefunden hat, und drückt die Wähltaste.
»Dina. Sei gegrüßt. Ich hatte völlig vergessen, dass diese bescheuerte Schlossverwaltung für heute Abend eine Besprechung für die Fremdenführer angesetzt hat. Kann Mustafa bei euch übernachten, falls es bei mir spät wird?«
»Ted?« Mustafas Krächzstimme.
»Good evening to you, Mustafa! How are you doing?«, fragt Mundy ihn, langsam und betont. Seit einer Weile bringt er Mustafa Englisch bei.
»Mir geht’s – very – very – well, Ted.«
»Who is Don Bradman?«
»Don – Bradman – is – greatest Schlagmann der ganzen Welt, Ted!«
»Du übernachtest heute bei Dina, ja?«
»Ted?«
»Hast du verstanden? Ich hab heute Abend noch eine Besprechung. Es wird spät.«
»And – I – sleep – at – Dina.«
»Genau. Sehr gut. Du schläfst bei Dina.«
»Ted?«
»Was?«
Mustafa kann plötzlich kaum sprechen vor Gekicher. »You – very – bad – bad – man, Ted!«
»Und warum das?«
»You – love – other – woman! Das sag ich Zara!«
»Wie bist du mir auf die Schliche gekommen?« Das muss er wiederholen.
»I – know – this. I – have – big – big – eyes!«
»Hättest du gerne eine Beschreibung meiner Geliebten? Damit du sie Zara weitergeben kannst?«
»Wie?«
»Diese andere Frau, in die ich verliebt bin. Soll ich dir sagen, wie sie aussieht?«
»Ja, ja! Sag’s mir. You – bad – man!« Noch mehr Gekicher.
»Sie hat wunderschöne Beine.«
»Ja, ja!«
»Sie hat vier wunderschöne Beine, um genau zu sein – sehr haarige Beine –, und einen langen goldenen Schwanz – und sie heißt …?«
»Mo! Du bist in Mo verliebt! Das sag ich Zara, dass du in Mo verliebt bist!«
Mo, die herrenlose Labradorhündin, von Mustafa so getauft zu Ehren seiner selbst. Sie hat sich an Weihnachten bei ihnen einquartiert, zum anfänglichen Entsetzen Zaras, die in dem Glauben erzogen worden ist, dass, wer einen Hund berührt, unrein wird und nicht mehr beten darf. Aber das vereinte Flehen ihrer beiden Männer hat ihr Herz erweicht, und inzwischen lässt sie auf Mo nichts mehr kommen.
Er ruft daheim an und hört seine eigene Stimme vom Band. Zara liebt Mundys Stimme. Wenn sie tagsüber Sehnsucht nach ihm hat, sagt sie, spielt sie sich manchmal die Ansage vor. Es wird vielleicht spät, Schatz, spricht er ihr auf deutsch auf den Anrufbeantworter. Wir haben noch eine Mitarbeiterversammlung in Linderhof, das hatte ich glatt vergessen. Lügen dieser Art, Lügen, die dem Beschützerdrang und einem reinen Herzen entspringen, haben ihre eigene Integrität, sagt er sich und überlegt, ob der aufgeklärte junge Imam ihm beipflichten würde. Und ich liebe dich noch genauso sehr wie heute früh, setzt er streng hinzu: nur dass du’s weißt.
Er schaut auf seine Uhr – eine Stunde und zehn Minuten noch. Er holt sich ein wurmstichiges, ehemals vergoldetes Stühlchen und rückt es vor einen ramponierten Wandschrank. Auf dem Stühlchen kippelnd, tastet er hinter dem Schrankaufsatz herum und bringt einen uralten, dick mit Staub bedeckten Seesack aus Khakistoff zum Vorschein. Den klopft er ab, setzt sich auf das Stühlchen, stellt ihn sich auf die Knie, zieht die Gurtbänder mit einem Ruck aus ihren oxidierten Schnallen, schlägt die Klappe zurück und späht mit zweifelndem Blick in den Sack, als wüsste er nicht recht, was dort drinnen auf ihn wartet.
Behutsam leert er den Inhalt auf ein Bambustischchen: ein altes Gruppenphoto einer anglo-indischen Familie mit ihren vielen eingeborenen Dienstboten, alle miteinander auf der Vortreppe eines imposanten Kolonialhauses aufgereiht; ein braungelber Ordner, auf dessen Deckel AKTE steht, handschriftlich, mit aggressiven Großbuchstaben; ein Bündel in ungelenker Schrift geschriebener Briefe, etwa aus der gleichen Zeit; eine Haarsträhne, dunkelbraunes Frauenhaar, um einen verdorrten Heidekrautzweig gewunden.
Doch diese Gegenstände ziehen nur kurz seine Aufmerksamkeit auf sich. Was er gesucht und möglicherweise absichtlich bis zuletzt aufgehoben hat, ist eine Plastikmappe, in der nicht weniger als zwanzig ungeöffnete Briefe durcheinander liegen, an Herrn Teddy Mundy gerichtet c/o seiner Heidelberger Bankadresse, alle in derselben spitzen, schwarzen Tintenschrift wie die Nachricht, die er eben verbrannt hat. Es steht kein Absender drauf, doch es ist auch keiner vonnöten.
Schlaffe blaue Luftpostbriefe.
Grobe, mit Klebeband verstärkte Dritte-Welt-Umschläge, geschmückt mit Marken so bunt wie Tropenvögel, aus so fernen Städten wie Damaskus, Djakarta, Havanna.
Als Erstes ordnet er sie chronologisch nach dem Poststempel. Dann schlitzt er sie der Reihe nach auf, mit einem alten, ebenfalls dem Seesack entnommenen Klappmesser aus Blech. Er fängt zu lesen an. Doch wozu? Bevor Sie etwas lesen, Mr Mundy, fragen Sie sich immer zuerst, zu welchem Zweck. Er glaubt wieder die akzentgefärbte Stimme Dr. Mandelbaums zu hören, seines alten Deutschlehrers vor vierzig Jahren. Um eine Information zu erlangen? Das wäre ein Grund. Oder um Wissen zu bekommen? Information ist nur der Weg, Mr Mundy. Das Ziel ist Wissen.
Schon gut, ich wähle das Wissen, denkt er. Und ich verspreche, dass ich keinen gefährlichen Ideologien aufsitzen werde, fügt er mit einer geistigen Verbeugung vor dem Imam hinzu. Ich nehme es auf mich, zu erfahren, was ich nicht wissen wollte und eigentlich immer noch nicht wissen will. Wie hast du mich aufgespürt, Sascha? Warum darf ich dich nicht erkennen? Vor wem versteckst du dich diesmal, und warum?
Zwischen die Briefe gefaltet: Zeitungsausschnitte, voller Ungeduld herausgerissene Artikel mit Saschas Namen in der Verfasserzeile. Die Kernpassagen mit Leuchtstift markiert oder mit Ausrufezeichen versehen.
Eine Stunde lang liest er, dann packt er Briefe und Zeitungsausschnitte zurück in den Seesack und den Seesack zurück in sein Versteck. Die zu erwartende Mischung, resümiert er schweigend. Pardon wird nicht gewährt. Der Ein-Mann-Krieg geht weiter wie geplant. Alter ist keine Entschuldigung. War es nie und wird es auch nie sein.
Er trägt den Stuhl an seinen Platz zurück und setzt sich dann wieder hin. Er hat den Bowler noch auf, merkt er, also nimmt er ihn ab, dreht ihn um und schaut hinein, wie er es oft tut, wenn er nachdenkt. Der Hutmacher Steinmatzky heißt Joseph mit Vornamen. Von Söhnen ist die Rede, keinen Töchtern. Die Wiener Firmenanschrift ist Dürerstraße 19, über der Bäckerei. Oder vielmehr war sie es, denn der alte Joseph Steinmatzky hat seine Hüte gern mit der Jahreszahl versehen, und dieses Exemplar ist ein besonders erlesener Jahrgang: 1938.
Im Dunkel des Huts sieht er die Szene Gestalt annehmen. Das bucklige Gässchen, die kleine Werkstatt über der Bäckerei. Glassplitter überall, Blut in den Ritzen des Kopfsteinpflasters, als Joseph Steinmatzky, seine Frau und sehr viele Söhne unter dem lautstarken Beifall der bekanntermaßen unschuldigen Wiener Passanten weggezerrt werden.
Mundy steht auf, strafft die Schultern, lässt sie wieder locker, schlenkert die Handgelenke, um die Muskeln zu entspannen. Er tritt in den Treppenschacht, schließt die Tür ab und steigt die Steinstufen hinauf. Dunstschleier hängen über den Schlossgärten. Die Luft riecht nach frisch gemähtem Gras, feuchtem Kricketrasen. Sascha, du verrückter Kerl, was willst du diesmal?
* * *
Der Käfer rumpelt über den Betonbuckel an König Ludwigs goldenem Tor, und Mundy biegt auf die Straße nach Murnau. Wie sein Besitzer ist auch das Auto nicht mehr taufrisch. Der Motor keucht, müde Scheibenwischer haben Halbmonde in die Windschutzscheibe gewetzt. Ein selbst gebastelter Aufkleber am Heck, von Mundy auf Deutsch abgefasst, teilt der Welt mit: Der Fahrer dieses Wagens erhebt keine Territorialansprüche in der arabischen Welt. Zwei kleine Kreuzungen überquert er ohne Zwischenfall, dann schert, wie angekündigt, ein blauer Audi mit Münchner Kennzeichen vor ihm aus einem Rastplatz, am Steuer die geduckte Silhouette Saschas mit seiner Baskenmütze.
Fünfzehn Kilometer, soweit dem Kilometerzähler des Käfers zu trauen ist, fährt Mundy hinter dem Audi her. Die Straße fällt ab, taucht in einen Wald ein und gabelt sich. Ohne zu blinken, folgt Sascha der linken Abzweigung, und Mundy in seinem Käfer macht, dass er hinterherkommt. Eine schwarze Allee führt bergab zu einem See. Welchem See? Laut Sascha ist Mundys einzige Gemeinsamkeit mit Leo Trotzki sein, wie der große Meister selbst es genannt hat, topographischer Kretinismus. An einem Parkschild rollt der Audi eine Rampe hinunter und kommt ruckelnd zum Stehen. Mundy folgt seinem Beispiel, wobei er mit einem Blick in den Rückspiegel überprüft, wer alles hinter ihm herkommt oder langsam auf der Straße weiterfährt: niemand. Sascha, eine Plastiktüte in der Hand, hastet derweil mit seinen einknickenden Trippelschritten eine steinerne Treppe hinunter.
Sascha ist gesagt worden, es habe ihm im Mutterleib an Sauerstoff gefehlt.
Jahrmarktsklänge tönen ihnen entgegen. Durch das Laub blinken bunte Lichterketten. Ein Schützenfest ist im Gange, und Sascha hält darauf zu. Mundy, der Angst hat, ihn zu verlieren, beeilt sich, zu ihm aufzuschließen. Fünfzehn Meter beträgt der Abstand noch, als sie eintauchen in das lärmende Gewühl. Ein Karussell rülpst Leierkastengedudel hervor, ein Matador auf einem Heuwagen schwenkt die Hüften vor einem Pappstier und schmachtet dabei mit breitestem sächsischem Akzent etwas von amor. Bierselige Zecher lassen den Krieg Krieg sein und pusten einander federbesetzte Tröten ins Gesicht. Hier fällt keiner aus dem Rahmen, Sascha nicht, ich nicht. Für einen Tag sind wir alle Dörfler, und auch Sascha hat sein Handwerk nicht verlernt.
Über ein Megaphon befiehlt der Großadmiral eines flaggenstarrenden Fischerboots den Säumigen, ihre Sorgen zu vergessen und sich unverzüglich zur Romantikrundfahrt einzufinden. Eine Rakete explodiert über dem See. Bunte Sterne schauern aufs Wasser hinab. Angriff oder Abwehr? Fragt Bush und Blair, unsere beiden großen Kriegsherren, von denen keiner je den Krieg am eigenen Leibe erfahren hat.
Wo ist Sascha hin? Mundy schaut auf und entdeckt ihn zu seiner Erleichterung, wie er sich und seine Tüte himmelwärts hievt, auf einer eisernen Wendeltreppe, die außen an einer in waagerechten Streifen gestrichenen Gründerzeitvilla emporführt. Seine Bewegungen haben etwas Hektisches – hatten es immer schon. Es liegt an seiner Art, den Kopf einzuziehen, wenn das rechte Bein nach vorne schwingt. Ist die Tüte schwer? Nein, aber Sascha bugsiert sie sehr pfleglich um all die Kurven. Hat er vielleicht eine Bombe darin? Sascha doch nicht.
Nach einem weiteren beiläufigen Blick in die Runde, ob noch jemand mit von der Partie ist, klettert Mundy hinter ihm drein. VERMIETUNG NUR WOCHENWEISE, warnt ihn ein handgeschriebenes Schild. Wochenweise? Wen interessiert eine Woche? Diese Spielchen sind seit vierzehn Jahren aus der Mode. Er schaut rasch nach unten. Niemand ist ihm gefolgt. Die Türen zu den einzelnen Appartements sind blasslila gestrichen, jede von einer Neonröhre erleuchtet. Auf einem Treppenabsatz kramt eine hohlwangige Frau mit Zottelmantel und Handschuhen in ihrer Handtasche herum. Grüß Gott, sagt er atemlos. Sie ignoriert ihn, oder sie ist taub. Zieh die Handschuhe aus, Frau, dann findest du ihn vielleicht. Im Weitersteigen blickt er sehnsüchtig zu ihr zurück, als wäre sie fester Grund. Sie hat ihren Wohnungsschlüssel verloren! Sie hat ihr Enkelkind in der Wohnung eingesperrt. Kehr um, hilf ihr. Tu deine gute Tat und geh heim zu Zara und Mustafa und Mo.
Noch einen Stock höher. Die Treppe macht ihre letzte Kurve. Auf den Berggipfeln ringsumher glänzt ewiger Schnee im Schein des Halbmonds. Unter ihm der See, das Volksfest, der Radau – und nach wie vor keine Verfolger in Sicht. Und vor ihm, endlich, eine letzte blasslila Tür, angelehnt. Er drückt dagegen. Sie öffnet sich einen Spalt, aber er sieht nur Finsternis. Sascha? will er schon rufen, aber die Erinnerung an die Baskenmütze hält ihn ab.
Er lauscht und hört nichts als den Lärm des Schützenfests. Er tritt über die Schwelle, zieht die Tür hinter sich zu. Und macht in dem Halbdunkel Sascha aus, der mit Schlagseite strammsteht, die Tüte zu seinen Füßen. Seine Arme sind so gerade an den Körper gedrückt, wie es nur geht, mit starr nach vorne zeigenden Daumen wie bei einem kommunistischen Parteifunktionär auf Parade. Aber die Züge – Schillers Züge –, die glänzenden Augen, der ungeduldig vorgebeugte Körper, selbst in dem unsteten Dämmer, haben nie intensiver, nie wacher gewirkt.
»Du erzählst ja einen ziemlichen Scheiß dieser Tage, Teddy«, bemerkt er.
Dieselbe unterschwellig sächsische Klangfärbung, registriert Mundy. Dieselbe pedantische, messerscharfe Stimme, immer noch drei Nummern zu groß für ihn. Dieselbe Fähigkeit, augenblicklich Schuldgefühle zu entfachen.
»Deine etymologischen Exkurse sind Stuss, deine Charakteristik von Ludwig II. ist Stuss. Ludwig war ein chauvinistisches Arschloch. Genau wie Bismarck. Und wie du offenbar, sonst hättest du auf meine Briefe geantwortet.«
Sagt’s und hinkt auch schon auf ihn zu für die längst fällige Umarmung.
2
Der strudelnde Fluss, der von Mundys Geburt zu Saschas Auftritt in Schloss Linderhof mäandert, ist in keiner englischen Grafschaft entsprungen, sondern in den gottverlassenen Gebirgszügen und Schluchten des Hindukusch, aus denen in drei Jahrhunderten britischer Kolonialverwaltung die Nordwestliche Grenzprovinz wurde.
»Dieser junge Sahib hier neben mir«, verkündet Mundys Vater, der Infanteriemajor a.D., in der Bar des Golden Swan in Weybridge jedem, der das Pech hat, die Geschichte noch nicht gehört zu haben, oder sie bereits ein dutzend Mal hören musste, aber zu höflich ist, ihn darauf hinzuweisen, »ist eine historische Rarität, so wie er hier vor Ihnen steht, stimmt’s, Junge?«
Und indem er dem halbwüchsigen Mundy liebevoll den Arm um die Schulter legt, zerzaust er ihm noch schnell das Haar, bevor er ihn zur besseren Betrachtung ins Licht dreht. Der Major ist klein, feurig und wild. Seine Gesten, selbst die zärtlichsten, erinnern fatal an Boxhiebe. Sein Sohn ist eine Bohnenstange, schon jetzt einen Kopf größer als der Vater.
»Und ich will Ihnen auch sagen, was unseren Edward zu einer solchen Rarität macht, wenn Sie gestatten, Sir«, wendet er sich, auftrumpfend, an sämtliche Sirs in Hörweite, und an die Ladies ebenfalls, denn sie haben noch immer Augen für ihn und er für sie. »An dem Morgen, an dem mein Träger mir meldete, dass die Memsahib mir die Ehre antun würde, mich mit einem Kind zu beschenken – ja, mit dem Jungen hier, Sir –, ging über dem Regimentslazarett eine stinknormale indische Sonne auf.«
Eine Kunstpause, wie auch Mundy sie sich eines Tages angewöhnen wird, während gleichzeitig das Glas des Majors wie aus eigener Kraft zu seinen Lippen emporschwebt, die sich ihm entgegenneigen.
»Gleichwohl, Sir«, nimmt er den Faden wieder auf. »Gleichwohl. Als der junge Mann sich schließlich dazu herabließ, zur Parade zu erscheinen« – anklagend schwenkt er zu Mundy herum, aber der Blick in den feurigen blauen Augen bleibt zärtlich wie nur je –, »ohne Helm, Sir, vierzehn Tage Küchendienst, wie es bei uns hieß! –, als der junge Mann endlich zu erscheinen geruhte, da war diese Sonne dort oben keine indische Sonne mehr. Sie gehörte zum selbst regierten Dominium Pakistan. War’s nicht so, Junge?«
Worauf der Junge im Regelfall errötet und etwas hervorstottert wie: »Ja, das sagst du immer, Vater«, was freilich meist ausreicht, um ihm ein wohlwollendes Lachen einzutragen und dem Major einen weiteren Drink auf fremde Rechnung sowie die Gelegenheit, auf die Moral seiner Geschichte hinzuweisen.
»Höchst wankelmütiges Frauenzimmer, die Weltgeschichte«, doziert er, in dem Telegrammstil, den sein Sohn später von ihm übernehmen wird. »Können Tag und Nacht marschieren für sie, Sir. Sich die Seele aus dem Leib schwitzen für sie. Sich rasieren und parfümieren und den Schnurrbart einwichsen für sie. Nützt alles nichts. Kaum hat Madame die Nase voll von Ihnen, heißt’s raus. Geschasst. Müllhaufen. Punkt, aus.« Ein neues Glas tritt den Weg zu seinem Mund an. »Auf Ihr Wohl, Sir. Sehr generös von Ihnen. Auf unsere Queen und Kaiserin. Gott schütze sie. Aber nicht ohne den Pandschabi-Kämpfer. Bester Soldat der Welt, dem reicht keiner das Wasser. Vorausgesetzt, die Führung stimmt. Da liegt der Hund begraben.«
Worauf der junge Sahib mit etwas Glück ein Ingwerbier bekommt, während der Major, von Rührung übermannt, schwungvoll ein Khakischnupftuch aus dem Ärmel seiner abgetragenen Militär-Sportjacke zieht und damit erst seinen säuberlichen kleinen Schnurrbart in Form klopft und sich dann rasch die Wangen tupft, bevor er es abtreten lässt.
Der Major hat Grund zum Weinen. Der Tag, an dem Pakistan das Licht der Welt erblickte – die Gäste des Golden Swan wissen es nur zu gut –, dieser Tag kostete ihn nicht nur seine Karriere, sondern auch seine Frau, die es nach einem einzigen erschöpften Blick auf ihren überfälligen, überlangen Sohn dem Empire gleichtat und ihr Leben aushauchte.
»Was für eine Frau, Sir …« Es ist die abendliche Cocktailstunde, und der Major wird elegisch. »Da trifft nur ein einziges Wort: Klasse. Im Reitkostüm war sie, wie ich sie das erste Mal gesehen hab, nach einem Morgenritt mit ein paar Trägern. Fünf Hitzeperioden hatte sie in der Hochebene schon hinter sich und kam immer noch dahergeritten wie frisch vom Erdbeer-Picknick am Cheltenham Ladies’ College. Kannte ihre Flora und Fauna aus dem Effeff, viel besser als ihre Träger. Und sie wäre heute noch unter uns, jawoll, wenn dieser Dreckskerl von Regimentsarzt nur halbwegs nüchtern gewesen wäre. Auf sie! Auf die selige Mrs Mundy! Frei-weg!« Sein umflorter Blick richtet sich auf seinen Sohn, dessen Anwesenheit er kurzfristig vergessen zu haben scheint. »Mein Sohn Edward«, stellt er vor. »Der beste Werfer an seiner Schule. Wie alt bist du, Junge?«
Und der Junge, der sehnlich darauf wartet, den Vater heimbringen zu können, nuschelt: sechzehn.
Nicht dass der Major unter der Tragödie seines Doppelverlusts in die Knie gegangen wäre, o nein! Er hat die Zähne zusammengebissen, Sir! Er hat durchgehalten. Ein Witwer mit einem neugeborenen Sohn, dem die Trümmer der alten Herrschaft um die Ohren fliegen – nichts wäre nahe liegender gewesen, als den Union Jack einzuziehen und den Zapfenstreich zu spielen wie all die anderen Weichlinge auch, und heimzukehren in die Unbedeutendheit. Nicht der Major, Sir! Nie und nimmer. Da spült er seinen Pandschabis lieber die Scheißhäuser aus, ehe er irgend so einem schlappschwänzigen Kriegsgewinnler in seinen Zivilistenarsch kriecht, besten Dank.
»Ich hab meinen Derzi gerufen. Ich hab zu meinem Derzi gesagt: ›Derzi, du trennst mir die Majorskronen von meiner Uniform ab und nähst mir stattdessen den pakistanischen Sichelmond auf, aber juldi.‹ Und habe meine Dienste – solange sie dort gewürdigt wurden – einer Truppe zur Verfügung gestellt, die besser kämpft als alle Truppen der Welt, vorausgesetzt« – ein Zeigefinger bohrt sich dramatisch warnend in leere Luft –, »vorausgesetzt, Sir, die Führung stimmt. Da liegt der Hund begraben!«
Und da läutet gnädigerweise auch die Barglocke zur letzten Runde, und der Junge schiebt seinem Vater eine geübte Hand unter den Arm und dirigiert ihn heim nach The Vale Nr. 2, wo die Reste des gestrigen Currys warten.
* * *