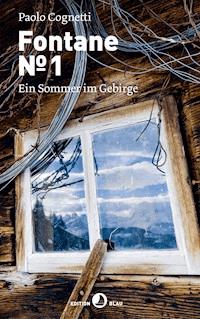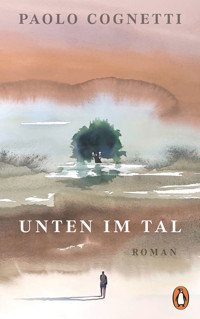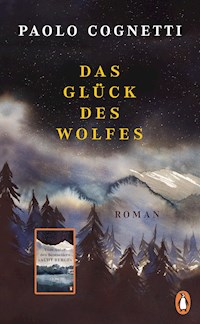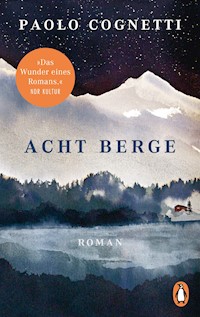
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Geschichte vom Aufbrechen und vom Wiederkehren
Wagemutig erkunden Pietro und Bruno als Kinder die verlassenen Häuser des Bergdorfs, streifen an endlosen Sommertagen durch schattige Täler, folgen dem Wildbach bis zu seiner Quelle. Als Erwachsene trennen sich die Wege der beiden Freunde: Der eine wird das Dorf nie verlassen und versucht die Käserei seines Onkels wiederzubeleben, den anderen drängt es in die weite Welt hinaus, magisch angezogen von immer noch höheren Gipfeln. Das unsichtbare Band zwischen ihnen bringt Pietro immer wieder in die Heimat zurück, doch längst sind sie sich nicht mehr einig, wo das Glück des Lebens zu finden ist. Kann ihre Freundschaft trotzdem überdauern?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Das Buch
Wagemutig erkunden Pietro und Bruno als Kinder die verlassenen Häuser des Bergdorfs, streifen an endlosen Sommertagen durch schattige Täler, folgen dem Wildbach bis zu seiner Quelle. Als Erwachsene trennen sich die Wege der beiden Freunde: Der eine wird sein Heimatdorf nie verlassen und versucht die Käserei seines Onkels wiederzubeleben, der andere zieht als Dokumentarfilmer in die weite Welt hinaus, magisch angezogen von immer noch höheren Gipfeln. Vor der ehrfurchtgebietenden Kulisse des Monte-Rosa-Massivs schildert Paolo Cognetti mit großer poetischer Kraft die lebenslange Suche zweier Freunde nach dem Glück. Eine eindringliche, archaische Geschichte über die Unbezwingbarkeit der Natur und des Schicksals, über das Leben, die Liebe und den Tod.
Vor der ehrfurchtgebietenden Kulisse des Monte-Rosa-Massivs schildert Paolo Cognetti mit großer poetischer Kraft die lebenslange Suche zweier Freunde nach dem Glück. Eine eindringliche archaische Geschichte über die Unbezwingbarkeit der Natur und des Schicksals, über das Leben, die Liebe und den Tod.
Die Autoren
Paolo Cognetti wurde 1978 in Mailand geboren und verbringt die Sommermonate am liebsten in seiner Hütte im Aostatal auf 2.000 Metern Höhe. Er hat Mathematik studiert, einen Abschluss an der Filmhochschule gemacht und Dokumentarfilme produziert, bevor er sich ganz dem Schreiben zuwandte. Sein preisgekrönter Bestseller Acht Berge erscheint in 40 Ländern und hat sich weltweit rund 1,5 Millionen mal verkauft. Acht Berge wird gegenwärtig verfilmt.
Christiane Burkhardt lebt und arbeitet in München. Sie übersetzt aus dem Italienischen, Niederländischen und Englischen und hat neben den Werken von Paolo Cognetti u. a. Romane von Fabio Geda, Domenico Starnone, Wytske Versteeg und Pieter Webeling ins Deutsche gebracht. Darüber hinaus unterrichtet sie literarisches Übersetzen.
»Die Beschreibung der Natur, ihrer Schönheit und Härte – und wie diese Freundschaft solche Gegensätze trägt: Bergwelt und Stadt, Bauer und Intellektueller – ist das leise, eindringlich nachwirkende Wunder dieses Romans.«NDR Kultur Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook
paolo cognetti
acht berge
Roman
Aus dem Italienischen von Christiane Burkhardt
Originaltitel: Le otto montagne
Originalverlag: Giulio Einaudi editore, Turin
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2016 by Paolo Cognetti
This edition published in agreement with the author
through MalaTesta Lit. Ag., Milano
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe
2017 by Deutsche Verlags-Anstalt, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: www.buerosued.de nach einem Entwurf von Designbüro Lübbeke Naumannn Thoben, Köln
Covermotiv: © Nicola Magrin
Gestaltung und Satz: DVA/Andrea Mogwitz
Verwendete Schrift: Fabiol
ISBN 978-3-641-29091-7V001
www.penguin-verlag.de
Fontane2014–2016
Diese Geschichte widme ich dem Freund, der mich zu ihr inspiriert und an Orte geführt hat, wo es keine Wege gibt.
Und dem Geschick und Glück, die ihn seit jeher beschützen,
in tiefer Zuneigung.
Leb wohl, leb wohl, du Hochzeitsgast!
Doch dieses sag’ ich dir:
Der betet gut, wer Liebe hegt
Für Vogel, Mensch und Tier!
S. T. Coleridge, Der alte Matrose
Quelle des Zitats: Samuel Taylor Coleridge, Der alte Matrose, 1798, aus dem Englischen von Hermann Ferdinand Freiligrath, Kindle-Edition 2011.
Mein Vater ging auf seine Art in die Berge: Er war weniger ein Mann der Meditation als ein Dickkopf und Draufgänger. Er begann den Aufstieg, ohne seine Kräfte einzuteilen, stets im Wettlauf gegen irgendwen oder was, und wenn ihm ein Weg zu lang war, nahm er eine Abkürzung. Bei ihm war es verboten zu rasten, verboten über Hunger, Kälte oder Erschöpfung zu klagen, dafür durfte man ein schönes Lied singen, besonders bei Gewitter oder dichtem Nebel. Und sich laut johlend die Schneefelder hinabstürzen.
Meine Mutter, die ihn schon von klein auf kannte, erzählte, dass er schon damals auf niemanden warten wollte, so wild war er darauf, jeden einzuholen, den er vor sich hatte. Deshalb musste man gut zu Fuß sein, um in den Augen meines Vaters Gnade zu finden. Mit einem Lachen gab sie mir zu verstehen, dass sie ihn so erobert hatte. Später zog sie es vor, keine Wettläufe mehr zu veranstalten, sondern sich auf einer Wiese niederzulassen, die Füße in einen kalten Wildbach zu hängen oder Kräuter und Blumen zu bestimmen. Auch auf dem Gipfel bewunderte sie am liebsten die Kuppen in der Ferne, dachte an die Berge ihrer Jugend zurück und versuchte sich daran zu erinnern, wann sie mit wem wo gewesen war, während mein Vater in diesem Moment nichts als Ernüchterung empfand und nur noch nach Hause wollte.
Zwei unterschiedliche Reaktionen auf dasselbe Heimweh vermutlich. Meine Eltern waren mit Anfang dreißig in die Stadt gezogen, fort aus dem ländlichen Veneto, wo meine Mutter geboren und mein Vater als Kriegswaise aufgewachsen war. Ihre ersten Berge, ihre erste große Liebe, waren die Dolomiten gewesen. Sie erwähnten sie manchmal in ihren Gesprächen, als ich noch zu klein war, ihnen zu folgen, aber manche Worte ragten eindeutig heraus, weil sie sonorer, gewichtiger waren: Rosengarten, Langkofel, Tofana, Marmolada. Es genügte, dass mein Vater einen dieser Namen nannte, und die Augen meiner Mutter begannen zu leuchten.
Das waren die Orte, an denen sie sich verliebt hatten, wie auch ich irgendwann begriff. Ein Pfarrer hatte sie in jungen Jahren mit dorthin genommen, derselbe, der sie später auch traute: am Fuß der Drei Zinnen, dort vor der kleinen Kirche, eines Morgens im Herbst. Diese Hochzeit im Hochgebirge war der Gründungsmythos unserer Familie – boykottiert von den Eltern meiner Mutter, ohne dass ich gewusst hätte, warum, gefeiert im Kreis weniger Freunde, mit Anoraks statt Hochzeitsgewändern und mit einem Bett in der Auronzohütte in ihrer ersten Nacht als Mann und Frau. Auf den Felsbändern der Großen Zinne glitzerte bereits Schnee. Es war ein Samstag im Oktober ’71, das Ende der Klettersaison – damals, aber auch noch für viele Jahre danach: Wenig später verfrachteten sie die ledernen Bergstiefel, die Kniebundhosen, ihren schwangeren Bauch und seinen Arbeitsvertrag ins Auto und zogen nach Mailand.
Gelassenheit gehörte nicht gerade zu den Tugenden meines Vaters, aber in der Stadt hätte er sie besser gebrauchen können als Ausdauer. Eine gute Aussicht hatten wir auch in Mailand; in den Siebzigern wohnten wir in einem Haus, das an einer breiten, stark befahrenen Allee stand. Unter dem Asphalt floss angeblich ein Fluss, die Olona. Tatsächlich führte die Straße an Regentagen Wasser, und dann stellte ich mir vor, wie der Fluss da unten im Dunkeln brodelte und anschwoll, bis er aus der Kanalisation kam. Doch es war der andere Fluss aus Autos, Transportern, Mopeds, Lastern, Bussen und Krankenwagen, der ständig Hochwasser hatte. Wir wohnten oben im siebten Stock, und die beiden identischen Häuserreihen, die unsere Straße säumten, verstärkten den Lärm. In manchen Nächten hielt es mein Vater einfach nicht mehr aus. Dann stand er auf und riss das Fenster auf, als wollte er die Stadt beschimpfen, ihr befehlen zu schweigen oder sie mit flüssigem Pech begießen. Minutenlang starrte er nach unten, um anschließend in seine Jacke zu schlüpfen und einen Spaziergang zu machen.
Aus diesen Fenstern sahen wir ein großes Stück Himmel. Ein eintöniges Weiß, egal zu welcher Jahreszeit, einzig und allein von Vögeln durchzogen. Meine Mutter ließ sich nicht davon abhalten, Blumen zu ziehen, auf einem von Auspuffgasen geschwärzten und von Dauerregen schimmlig gewordenen kleinen Balkon. Dort hegte sie ihre Pflänzchen und erzählte mir von Weinbergen im August, draußen auf dem Land, wo sie aufgewachsen war, von an Holzbalken aufgehängten Tabakblättern in den Trockenschuppen oder vom Spargel, der – um weiß und zart zu bleiben – geerntet werden muss, bevor er aus dem Boden sprießt, weshalb man einen besonderen Blick dafür braucht, ihn unter der Erde zu erkennen.
Jetzt nutzte sie diesen Blick auf andere Weise. Im Veneto war sie Krankenschwester gewesen, während sie in Mailand als Familienhelferin im Olmi-Viertel arbeitete, in den Sozialwohnungen am westlichen Stadtrand.
Das war ein noch ganz neuer Beruf, der gerade erst eingeführt worden war, genau wie die Beratungsstelle, für die sie arbeitete und die es sich zur Aufgabe gemacht hatte, Frauen während der Schwangerschaft zu unterstützen und Neugeborene während des ersten Lebensjahrs zu begleiten. Das war auch der Job meiner Mutter, der ihr gut gefiel. Nur dass man in ihrem Einsatzgebiet ein ziemliches Sendungsbewusstsein dafür brauchte. In diesem sogenannten Ulmen-Viertel gab es nämlich alles andere als Ulmen. Sämtliche Straßennamen in diesem Stadtteil, all die Erlen-, Fichten-, Lärchen- und Birkenwege, waren der reinste Hohn inmitten von zwölfstöckigen Mietskasernen, die von allen möglichen Problemen heimgesucht wurden. Zu den Aufgaben meiner Mutter gehörte es auch, das Umfeld zu kontrollieren, in dem ein Kind aufwuchs – es waren erschütternde Hausbesuche, die sie oft tagelang beschäftigten. In Extremfällen musste sie das Jugendamt informieren. Es war schwer für sie, sich zu so einer Entscheidung durchzuringen – von den vielen Beleidigungen und Drohungen einmal abgesehen. Trotzdem wusste sie, dass sie richtig handelte. Und damit war sie nicht allein. Sie fühlte sich den Sozialarbeiterinnen, Erzieherinnen und Lehrerinnen eng verbunden, so als hätten sie eine kollektive weibliche Verantwortung für diese Kinder.
Mein Vater hingegen war schon immer ein Einzelgänger. Er war Chemiker in einer Fabrik mit zehntausend Arbeitern, die fortwährend von Streiks und Entlassungen gebeutelt wurde. Doch egal, was dort vorfiel – er kehrte stets wutentbrannt zu uns zurück. Beim Abendessen schaute er stumm die Nachrichten, die Hände mit dem Besteck in der Luft erstarrt, so als rechnete er jeden Moment mit dem Ausbruch des Dritten Weltkriegs. Bei jedem gewaltsamen Tod, bei jeder Regierungskrise, bei jeder Benzinpreiserhöhung und bei jedem anonymen Bombenattentat fluchte er leise vor sich hin. Mit den wenigen Kollegen, die er zu uns nach Hause einlud, wurde fast nur über Politik diskutiert, was stets in Streit ausartete. Bei Kommunisten machte er einen auf Antikommunist, bei Konservativen einen auf radikal und bei jedem, der ihn zum Kirchen- oder Parteieintritt bewegen wollte, kehrte er den Freidenker heraus. Aber das war keine Zeit, in der man sich einer Gruppenzugehörigkeit verweigern konnte, deshalb dauerte es nicht lange, und die Arbeitskollegen stellten ihre Besuche ein. Trotzdem ging er weiterhin in die Fabrik, als müsste er jeden Morgen in den Schützengraben, schlief schlecht und wollte die Dinge erzwingen, griff zu Ohrstöpseln und Kopfschmerztabletten und bekam cholerische Anfälle. Dann trat meine Mutter auf den Plan, die es als ihre eheliche Pflicht betrachtete, ihn zu besänftigen, die Schläge im Kampf meines Vaters mit der Welt zu dämpfen.
Zu Hause sprachen sie nach wie vor den Dialekt des Veneto. In meinen Ohren war das ihre Geheimsprache, der Widerhall eines früheren rätselhaften Lebens. Noch so ein Überbleibsel aus der Vergangenheit wie die drei Fotos, die meine Mutter auf dem Flurtischchen aufgestellt hatte. Ich sah sie mir häufig an. Das erste zeigte ihre Eltern in Venedig, auf der einzigen Reise ihres Lebens – ein Geschenk meines Großvaters an die Großmutter, zur Silberhochzeit. Auf dem zweiten posierte die ganze Familie bei der Ernte: Die Großeltern saßen in der Mitte, drei junge Frauen und ein junger Mann umstanden sie, dazu drei Körbe mit Trauben bei der Tenne. Auf dem dritten der einzige Sohn, mein Onkel, lachend mit meinem Vater neben einem Gipfelkreuz, ein aufgerolltes Seil um die Schulter und in Bergsteigermontur. Er war früh gestorben, weshalb ich seinen Namen trug, auch wenn ich Pietro und er Piero genannt wurde. Trotzdem kannte ich keinen dieser Leute. Wir besuchten sie nie, und sie kamen auch nie nach Mailand. Ein paarmal im Jahr nahm meine Mutter samstagmorgens den Zug, um sonntagabends trauriger als bei der Abfahrt wieder zurückzukehren. Doch dann verflog ihre Traurigkeit, und das Leben ging weiter. Es gab einfach zu viel zu tun, zu viele Menschen, um die man sich kümmern musste, statt in Wehmut zu versinken.
Aber diese Vergangenheit machte sich bemerkbar, wenn man es am wenigsten erwartete. Im Auto, während der langen Fahrt, die mich zur Schule, meine Mutter zur Beratungsstelle und meinen Vater zur Fabrik brachte, stimmte sie morgens manchmal ein altes Lied an. Mitten im Verkehr sang sie die erste Strophe, woraufhin er mit einfiel. Diese Lieder spielten in den Bergen und handelten vom Ersten Weltkrieg: La tradotta, La Valsugana, Il testamento del capitano. Es waren Geschichten, die ich inzwischen auswendig kannte. Mit siebenundzwanzig Mann waren sie an die Front gezogen und nur zu fünft heimgekehrt. Unten am Piave harrte ein Kreuz auf eine Mutter, die es irgendwann aufsuchen würde. Und in der Ferne wartete sehnsüchtig die Braut, doch eines Tages war sie es leid und heiratete einen andern. Der Sterbende schickte ihr einen Kuss und wünschte sich eine Blume. Manche Worte waren im Dialekt, woran ich erkannte, dass meine Eltern sie aus ihrem früheren Leben mitgenommen hatten. Gleichzeitig spürte ich noch etwas anderes, noch Seltsameres, so als würden diese Lieder irgendwie auch von ihnen handeln. Von ihnen ganz persönlich, denn sonst wäre da nicht die klar erkennbare Rührung in ihren Stimmen gewesen.
An bestimmten Föhntagen im Herbst oder Frühling tauchten am Ende der Mailänder Straßen plötzlich die Berge auf. Hinter einer Kurve, über einer Überführung, vollkommen unerwartet, und dann eilte der Blick meiner Eltern sofort dorthin, ohne dass einer den anderen darauf aufmerksam machen musste. Die Gipfel waren weiß, der Himmel außergewöhnlich blau, ein echtes Wunder. Während es unten bei uns Fabrikrevolten, überfüllte Sozialwohnungen, Straßenkämpfe, misshandelte Kinder und minderjährige Mütter gab, glitzerte dort oben Schnee. Meine Mutter fragte dann immer, welche Berge das waren, woraufhin sich mein Vater umsah, als wollte er den Kompass an der Geografie der Großstadt ausrichten. Wo sind wir hier, auf dem Viale Monza oder dem Viale Zara? Dann ist das die Grigna, sagte er nach einigem Nachdenken. Ja genau, das muss sie sein! Ihre Legende kannte ich: Die Grigna war einst eine wunderschöne, aber grausame Kriegerin, die ihre Verehrer mit Pfeil und Bogen tötete, weshalb sie von Gott zur Strafe in einen Berg verwandelt wurde. Und jetzt war sie hier, innerhalb der Windschutzscheibe, und ließ sich von uns dreien bewundern, die wir alle stumm unseren Gedanken nachhingen. Dann sprang die Ampel um, ein Fußgänger eilte vorbei, und hinter uns hupte jemand, den mein Vater verwünschte, während er wütend den Gang einlegte und diesem Moment der Gnade davonfuhr.
Die Siebziger neigten sich dem Ende zu, und während in Mailand die Hölle los war, schnürten meine Eltern die Bergschuhe. Sie fuhren nicht nach Osten, in ihre Heimat, sondern nach Westen, als wollten sie ihre Flucht fortsetzen: nach Ossola, ins Valsesia und ins Aostatal, hin zu höheren, schrofferen Bergen. Erst sehr viel später sollte mir meine Mutter gestehen, dass sie sie beim ersten Mal als überraschend beklemmend empfunden hatte. Im Vergleich zu den sanften Silhouetten des Veneto und Trentino kamen ihr diese Täler eng, düster und unheimlich vor, so als wäre man in einer tiefen Schlucht. Der Fels war feucht und dunkel, und überall stürzten Wildbäche und Wasserfälle in die Tiefe. Was für Wassermassen! Hier musste es wirklich viel regnen. Ihr war nicht klar, dass all das Wasser einer besonderen Quelle entsprang, und auch nicht, dass mein Vater und sie schnurstracks darauf zumarschierten. Sie stiegen auf, bis sie in der Sonne liefen, und plötzlich öffnete sich die Landschaft, und der Monte Rosa tauchte vor ihnen auf. Eine arktische Welt, ein ewiger Winter, der bedrohlich über den Sommerweiden aufragte. Meine Mutter fand das beängstigend, doch mein Vater sagte, das sei, als entdeckte man eine neue Dimension, als käme man von den Bergen der Menschen, nur um sich dann in denen der Riesen wiederzufinden. Natürlich war es für ihn Liebe auf den ersten Blick.
Keine Ahnung, wo das damals gewesen ist. In Macugnana, Lagna, Gressoney oder Ayas? Damals fuhren wir jedes Jahr woandershin, folgten dem unsteten Nomadentum meines Vaters einmal um den Berg, der ihn erobert hatte. Noch mehr als an diese Täler erinnere ich mich an die Häuser, falls man sie überhaupt so nennen kann. Wir mieteten uns einen Campingplatzbungalow oder ein Zimmer in einem Landgasthof, in dem wir dann zwei Wochen blieben. Wir hatten nie genug Platz, um es uns dort gemütlich zu machen, und auch nicht die Zeit, eine echte Bindung aufzubauen, aber das interessierte meinen Vater auch gar nicht, er nahm es überhaupt nicht wahr. Kaum waren wir angekommen, zog er sich um, holte Karohemd, Cordhose und Wollpulli hervor und wurde in seinen alten Kleidern ein ganz neuer Mensch. Er verbrachte diese kurzen Ferien mit Wandern, verließ frühmorgens das Haus und kehrte erst abends oder am nächsten Tag zurück: voller Staub, sonnenverbrannt und erschöpft, aber glücklich. Beim Abendessen erzählte er uns von Gämsen und Steinböcken, von Nächten im Freien, Sternenhimmeln und vom Schnee, der dort oben selbst noch im August fiel. Und wenn er so richtig zufrieden war, endete er mit den Worten: Wie gern hätt ich euch dabeigehabt!
Doch meine Mutter weigerte sich, auf Gletscher zu gehen, sie hatte eine irrationale, unüberwindliche Angst davor. Für sie endeten die Berge bei dreitausend Metern, in der Höhe ihrer Dolomiten. Den dreitausend Metern zog sie die zweitausend vor – die Weiden, Wildbäche und Wälder. Auch die tausend Meter gefielen ihr sehr, das Leben in diesen Dörfern aus Holz und Stein. Wenn mein Vater fort war, ging sie gern mit mir spazieren, trank einen Kaffee auf der Piazza, setzte sich auf eine Wiese, um mir vorzulesen, und plauderte mit Passanten. Unsere ständigen Ortswechsel fand sie eher belastend. Sie wünschte sich ein Haus, das sie sich zu eigen machen, ein Dorf, in das sie zurückkehren konnte, und bat meinen Vater wiederholt darum. Der meinte, wir hätten kein Geld für eine doppelte Miete, bis sie ihm eine bestimmte Höchstsumme abrang und er ihr irgendwann erlaubte, sich auf die Suche zu machen.
Abends nach dem Essen breitete mein Vater eine Landkarte auf dem Tisch aus und plante seine nächste Tour. Daneben befanden sich das graue Büchlein des italienischen Alpenvereins und ein halb volles Glas Grappa, an dem er hin und wieder nippte. Meine Mutter genoss ihre Freizeit in einem Sessel oder auf dem Bett, wo sie sich in irgendeinen Roman vertiefte. Für ein, zwei Stunden verschwand sie komplett darin wie in einer anderen Welt. Dann kletterte ich auf den Schoß meines Vaters, um zu sehen, was er da machte. Ich erlebte ihn gut gelaunt und gesprächig – das genaue Gegenteil von dem Vater in der Stadt, den ich gewohnt war. Bereitwillig erklärte er mir die Karte und wie man sie liest: »Das hier ist ein Wildbach« – er zeigte darauf –, »das ein Bergsee und das hier sind Almhütten. An den Farben kannst du den Wald von Wiesen, Geröllfeldern und Gletschern unterscheiden. Diese geschwungenen Linien geben die Höhe an: Je dichter sie beieinanderliegen, desto steiler ist der Berg, bis er so steil wird, dass man ihn nicht mehr erklimmen kann. Hier, wo es weniger sind, ist die Steigung sanfter, und es gibt Wege, siehst du? Diese Punkte mit einer bestimmten Höhenangabe sind die Gipfel. Und die besteigen wir. Wir gehen erst wieder runter, wenn es nicht weiter raufgeht, hast du das verstanden?«
Nein, das ging über meinen Horizont. Ich musste sie mit eigenen Augen sehen, diese Welt, die ihn dermaßen glücklich machte. Als wir Jahre später damit begannen gemeinsam loszuziehen, erzählte mir mein Vater, er wisse noch genau, wann ich dem Ruf der Berge erstmals gefolgt sei. Eines Morgens, als er gerade aufbrechen wollte und sich die Stiefel schnürte, während meine Mutter noch schlief, habe ich plötzlich vor ihm gestanden: angezogen und aufbruchsbereit. Ich müsse mich im Bett fertig gemacht haben. Im Dunkeln hätte ich ihn erschreckt, so als wäre ich weitaus älter als meine sechs oder sieben Jahre. Schon damals war ich der, der ich einmal werden sollte, zumindest seinen Schilderungen nach: ein Vorgeschmack auf den erwachsenen Sohn, ein Gespenst aus der Zukunft.
»Möchtest du nicht noch ein bisschen schlafen?«, hatte er mich flüsternd gefragt, um meine Mutter nicht zu wecken.
»Ich will mit«, hatte ich erwidert, zumindest behauptete er das. Aber vielleicht war das auch nur ein Satz, an den er sich gern erinnern wollte.
teil i
BERGEDERKINDHEIT
EINS
Das Dorf Grana lag in einem Ausläufer dieser Täler, übersehen von allen, die daran vorbeikamen, und als uninteressant abgetan, oben begrenzt von bleigrauen Gebirgskämmen und unten von einem Felsen, der den Zugang versperrte. Auf diesem Felsen wachte eine Turmruine über längst verwilderte Felder. Ein von der Landstraße abgehender Schotterweg führte in steilen Kurven bis zum Fuß des Turms, anschließend wurde er sanfter, wand sich die Bergflanke entlang und führte auf halber Höhe in die Talschlucht, um dann fast eben zu werden. Es war Juli, als wir ihn nahmen, Juli 1984. Auf den Wiesen wurde gerade Heu gemacht. Die Talschlucht war breiter, als sie von unten aussah – nichts als Wald auf der Schatten- und Terrassenfelder auf der Sonnenseite. Weiter unten floss zwischen den Buschflecken ein Wildbach, den ich hin und wieder auffunkeln sah, und das gefiel mir schon mal an Grana. Damals las ich gern Abenteuerromane, und Mark Twain hatte mich mit seiner Flussbegeisterung angesteckt. Da unten konnte man bestimmt angeln, tauchen, schwimmen, einen kleinen Baum fällen und ein Floß bauen, und während ich mich solchen Fantasien hingab, nahm ich das Dorf gar nicht wahr, das gerade hinter einer Biegung auftauchte.
»Hier ist es«, sagte meine Mutter. »Langsam!«
Mein Vater fuhr nur noch mit Schrittgeschwindigkeit. Seit wir aufgebrochen waren, folgte er geduldig ihren Anweisungen. Er beugte sich nach links und nach rechts, hinein in den Staub, den das Auto aufwirbelte, und musterte die Kuh- und Hühnerställe, die Scheunen aus dicken Holzstämmen, die verkohlten Ruinen, Traktoren am Straßenrand und Ballenpressen. Zwei schwarze Hunde mit Glöckchen um den Hals schossen aus einer Hofeinfahrt hervor. Bis auf ein paar neuere Häuser schien das gesamte Dorf aus demselben grauen Gestein zu bestehen und wirkte dadurch selbst wie ein Felsauswuchs, eine einstige Steinlawine. Ein Stück weiter oben weideten Ziegen.
Mein Vater schwieg. Meine Mutter, die diesen Ort entdeckt hatte, ließ ihn auf einem kleinen Platz halten und stieg aus, um nach der Vermieterin zu suchen, während wir schon mal das Gepäck ausluden. Einer der Hunde kam uns bellend entgegen, und da tat mein Vater etwas, das ich noch nie bei ihm gesehen hatte: Er streckte die Hand aus, ließ sich beschnuppern, sprach beruhigend auf ihn ein und kraulte ihn zwischen den Ohren. Anscheinend konnte er besser mit Hunden als mit Menschen.
»Und?«, fragte er, während er die Spannseile vom Dachgepäckträger löste. »Was sagst du?«
»Genial!«, hätte ich am liebsten gerufen. Kaum war ich ausgestiegen, kam mir ein verheißungsvoller Duft nach Heu, Stall, Holz, Rauch und sonst noch was entgegen. Aber weil ich nicht wusste, was er von mir erwartete, sagte ich: »Nicht schlecht, oder?«
Mein Vater zuckte nur mit den Schultern. Er löste den Blick von unserem Gepäck und musterte den Schuppen vor uns. Er war ganz schief und wäre ohne die beiden Stützpfähle sicherlich längst eingestürzt. Darin türmten sich Heuballen, und obenauf lag ein Jeanshemd, das jemand ausgezogen und dort vergessen hatte.
»An so einem Ort bin ich aufgewachsen«, sagte er, ohne sich anmerken zu lassen, ob es sich dabei um angenehme oder unangenehme Erinnerungen handelte.
Er griff nach einem der Koffer und machte Anstalten, ihn herunterzunehmen, doch dann überlegte er es sich anders. Er sah mich an und schien sich insgeheim köstlich über etwas zu amüsieren.
»Na, was meinst du: Kann die Vergangenheit ein zweites Mal vergehen?«
»Das ist eine schwierige Frage«, sagte ich, um mir keine Blöße zu geben. Er gab mir oft solche Rätsel auf, glaubte eine ihm vertraute Intelligenz an mir wahrzunehmen, eine logisch-mathematische Begabung, und hielt es für seine Pflicht, sie auf die Probe zu stellen.
»Schau dir diesen Bach an. Siehst du ihn?«, fragte er. »Angenommen, das Wasser ist die vergehende Zeit. Wenn dort, wo wir stehen, die Gegenwart ist, wo ist dann deiner Meinung nach die Zukunft?«
Ich überlegte. Das schien nicht weiter schwer zu sein, und ich gab die nächstliegende Antwort: »Die Zukunft ist dort, wo das Wasser hinfließt, also da unten.«
»Falsch«, sagte mein Vater. »Zum Glück!« Und dann, als fiele eine schwere Last von ihm ab, »Hopp-la«, was er auch immer sagte, wenn er mich hochhob, woraufhin der erste von zwei Koffern mit einem dumpfen Knall zu Boden fiel.
Das Haus, das meine Mutter gemietet hatte, befand sich im oberen Teil des Dorfs. Es gehörte zu einem Hof, der eine Tränke umschloss. Man sah, dass die Gebäudeteile unterschiedlich alt waren: Das Mauerwerk, die Balkone aus schwarz gewordenem Lärchenholz, das mit bemoosten Steinschindeln gedeckte Dach und der große, rußgeschwärzte Schornstein stammten aus uralter Zeit. Der Rest war einfach bloß alt und aus einer Epoche, in der man die Steinböden mit Linoleum bedeckt, Blumenposter an die Wand gehängt und Hängeschränke und eine Küchenspüle eingebaut hatte – ausnahmslos längst angeschimmelt und ausgeblichen. Nur ein einziger Gegenstand hob sich von dieser Schäbigkeit ab: ein schwarzer gusseiserner Ofen, schwer und massiv, mit einem Messinggriff und vier Kochplatten. Er kam von woanders her, aus noch einer anderen Zeit. Aber meiner Mutter schien vor allem zu gefallen, was fehlte, denn sie hatte im Grunde kaum mehr als ein leer stehendes Haus gefunden. Sie fragte die Vermieterin, ob wir es ein wenig einrichten dürften, und die sagte nur: »Macht, was ihr wollt.« Sie hatte es schon seit Jahren nicht mehr vermietet und auch in diesem Sommer nicht damit gerechnet. Sie war wortkarg, aber nicht unfreundlich. Wahrscheinlich fühlte sie sich unwohl, weil sie gerade auf dem Feld gearbeitet hatte und nicht mehr dazu gekommen war, sich umzuziehen. Sie gab meiner Mutter einen riesigen Eisenschlüssel, erklärte ihr irgendwas zum warmen Wasser und protestierte kurz, bevor sie den vorbereiteten Umschlag entgegennahm.
Mein Vater war längst verschwunden. Für ihn war es ein Haus wie jedes andere, und schon am nächsten Tag musste er zurück nach Mailand ins Büro. Er stand auf dem Balkon und rauchte, die Hände auf der rauen Holzbrüstung und den Blick auf die Berge gerichtet. Er schien sie zu belauern, als wollte er ergründen, wo er genau zum Angriff übergehen sollte. Erst als die Vermieterin weg war, kam er wieder rein und vermied es somit, sie begrüßen zu müssen. Seine Stimmung hatte sich inzwischen merklich verdüstert. Er sagte, er wolle etwas fürs Mittagessen einkaufen und noch vor Einbruch der Dunkelheit zu Hause sein.
Kaum war er abgereist, wurde meine Mutter in diesem Haus zu einer völlig anderen Frau. Gleich morgens nach dem Aufstehen schichtete sie Holzscheite in den Ofen, knüllte etwas Zeitung zusammen und entzündete ein Streichholz am rauen Gusseisen. Dabei störte sie weder der Rauch, der sich anschließend in der ganzen Küche ausbreitete, noch die Decke, in die sie sich hüllen musste, bis es warm wurde, noch die Milch, die kurz darauf überkochte und auf der heißen Ofenplatte anbrannte. Zum Frühstück bekam ich geröstetes Brot mit Marmelade. Sie wusch mich direkt unterm Wasserhahn, Gesicht, Hals und Ohren, trocknete mich anschließend mit einem Geschirrtuch ab und schickte mich hinaus an die frische Luft, an die Sonne, damit ich endlich etwas von meiner städtischen Mimosenhaftigkeit verlor.
Damals wurde der Wildbach zu meinem Erkundungsgebiet. Aber über zwei Grenzen durfte ich mich nicht hinauswagen: Bergauf war das eine Holzbrücke, hinter der das Ufer steiler wurde und sich zu einer Klamm verengte, und bergab der Wald am Fuß des Felsens, wo das Wasser weiter in Richtung Talsohle floss. Das war der Bereich, den meine Mutter vom Balkon aus gerade noch überblicken konnte – aber dafür enthielt er einen ganzen Fluss. Der Wildbach floss in Stufen hinunter, in mehreren schäumenden Stromschnellen zwischen dicken Felsen, auf denen ich mich weit vorbeugte, um die silbernen Reflexe auf seinem Grund zu betrachten. Ein Stück weiter verlangsamte und verzweigte er sich, so als wäre er nicht mehr jung und ungestüm, sondern auf einmal erwachsen, und trennte von Birken besiedelte Inseln, über die ich bis ans gegenüberliegende Ufer hüpfen konnte. Noch ein Stück weiter bildete hölzernes Dickicht eine Art Schranke. Dort kam eine Schotterrinne herunter, und im Winter hatte eine Lawine die Baumstämme und Zweige mitgerissen, die jetzt im Wasser vor sich hin faulten. Aber von diesen Dingen hatte ich damals noch nicht die leiseste Ahnung. Für mich war das einfach nur der Moment im Leben des Bachs, in dem er auf ein Hindernis stieß, zum Stillstand kam und sich eintrübte. Immer wieder setzte ich mich dorthin und betrachtete die Algen, die knapp unter der Wasseroberfläche hin und her wogten.
Es gab einen Jungen, der an den Flusswiesen Kühe weidete. Von meiner Mutter wusste ich, dass es der Neffe unserer Vermieterin war. Er hatte stets einen gelben Plastikstock mit gebogenem Knauf dabei, mit dem er die Kühe hinauf ins hohe Gras trieb. Es waren sieben, braun gescheckt, jung und ruhelos. Wenn sie auf eigene Faust losmarschierten, schrie der Junge sie an, und es kam vor, dass er der einen oder anderen fluchend hinterherrannte, um auf dem Rückweg erneut den Hang hinaufzusteigen, sich umzudrehen und nach ihnen zu rufen, »Ho, ho, ho«, oder »He, he, he«, bis sie ihm widerstrebend zum Stall folgten. Auf der Weide setzte er sich ins Gras und behielt sie von oben im Auge, während er mit einem Taschenmesser an einem Stück Holz herumschnitzte.
»Du kannst hier nicht bleiben«, sagte er, als er ausnahmsweise einmal das Wort an mich richtete.
»Warum?«, fragte ich
»Du drückst das Gras platt.«
»Und wo kann ich dann hin?«
»Da!«
Er zeigte aufs andere Ufer. Ich wusste nicht, wie ich dorthin kommen sollte, wollte ihn aber auch nicht danach fragen oder darum bitten, quer über seine Wiese gehen zu dürfen. Deshalb watete ich ins Wasser, ohne mir vorher die Schuhe auszuziehen. Ich versuchte mich in der Strömung auf den Beinen zu halten und keine Sekunde zu zögern, als wäre es für mich das Selbstverständlichste von der Welt, durch Flüsse zu waten. Ich durchquerte den Fluss und setzte mich mit durchweichter Hose und klatschnassen Schuhen auf einen Felsblock. Aber als ich mich umdrehte, beachtete mich der Junge nicht weiter.
So verbrachten wir ganze Tage – er an einem Ufer und ich am anderen, ohne uns auch nur eines Blickes zu würdigen.
»Warum freundest du dich nicht mit ihm an?«, fragte meine Mutter eines Abends am Ofen. Das Haus hatte sich mit der Feuchtigkeit zu vieler Winter vollgesogen, daher machten wir abends ein Feuer und wärmten uns daran, bis es Zeit wurde, zu Bett zu gehen. Jeder von uns las in seinem Buch, und hin und wieder, kurz vor dem Umblättern, ließ sie die Flammen und das Gespräch aufleben. Der große Ofen hörte uns zu.
»Aber wie soll ich das anstellen?«, fragte ich. »Ich weiß nicht, was ich sagen soll.«
»Sag einfach Hallo. Frag, wie er heißt. Frag, wie seine Kühe heißen.«
»Okay, gute Nacht«, erwiderte ich und tat so, als wäre ich völlig in meine Lektüre vertieft.
Im Umgang mit Menschen war mir meine Mutter weit voraus. Weil es im Dorf keine Läden gab, hatte sie, während ich meinen Bach erforschte, einen Hof entdeckt, wo man Milch und Käse bekam, einen Nutzgarten, der Gemüse verkaufte, und das Sägewerk, wo sie Feuerholz besorgte. Sie hatte auch eine Vereinbarung mit dem jungen Mann von der Molkerei getroffen, der morgens und abends mit einem kleinen Laster vorbeikam, um die Milchkannen abzuholen und ihr Brot und Einkäufe vorbeizubringen. Und irgendwie hatte sie es bereits nach einer Woche geschafft, Blumenkästen ans Balkongeländer zu hängen und mit Geranien zu bepflanzen. Jetzt sah man unser Haus schon von Weitem, und ich bekam mit, wie die wenigen Einwohner von Grana sie mit Namen begrüßten.
»Außerdem ist es nicht weiter wichtig«, sagte ich kurz darauf.
»Was?«
»Dass ich hier Freunde finde. Ich bin gern allein.«
»Ach ja?« Meine Mutter schaute von ihrem Buch auf und sagte ohne zu lächeln, als handelte es sich um eine wirklich ernste Angelegenheit: »Meinst du wirklich?«
Sie beschloss, mir zu helfen. Auch wenn nicht alle dieser Meinung sind, war meine Mutter fest davon überzeugt, dass man sich einmischen darf. Einige Tage später fand ich in ebendieser Küche den Hirtenjungen vor, der auf meinem Stuhl saß und frühstückte. Genauer gesagt roch ich ihn, noch bevor ich ihn sah, da er den Duft nach Stall, Heu, geronnener Milch, feuchter Erde und Kaminrauch an sich hatte, den ich von nun an stets mit den Bergen verbinden würde und noch in jedem Gebirge dieser Welt wiedergefunden habe. Er hieß Bruno Guglielmina und hatte denselben Nachnamen wie alle in Grana, wie er uns erklärte. Doch er sei der Einzige, der Bruno heiße. Er war wenige Monate älter als ich, zwar schon ’72 geboren, aber im November. Er verschlang die Kekse, die meine Mutter ihm anbot, als hätte er noch nie welche gegessen. Wie sich herausstellte, hatte nicht nur ich ihn oben auf der Weide beobachtet, sondern er mich genauso, während wir beide so taten, als würden wir uns ignorieren.
»Du magst den Bach, stimmt’s?«, sagte er.
»Ja.«
»Kannst du schwimmen?«
»Ein bisschen.«
»Und angeln?«
»Eher nicht.«
»Komm mit, ich zeig dir was.«
Mit diesen Worten sprang er vom Stuhl. Das ließ ich mir nicht zweimal sagen. Ich wechselte einen kurzen Blick mit meiner Mutter und rannte ihm sofort hinterher.
Bruno brachte mich zu einer Stelle, die ich schon kannte. Dort floss der Bach im Schatten eines Stegs vorbei. Als wir das Ufer erreicht hatten, befahl er mir flüsternd, mich so still und unauffällig zu verhalten wie möglich. Anschließend beugte er sich auf einem Felsblock ein winziges Stück vor, gerade so weit, dass er darüber hinausspähen konnte. Stumm bedeutete er mir zu warten. Währenddessen ließ ich ihn nicht aus den Augen. Er hatte flachsblondes Haar und einen sonnenverbrannten Nacken. Er trug eine Hose, die ihm viel zu groß war, mit hochgekrempelten Hosenbeinen und einem viel zu tief hängenden Schritt – die Karikatur eines Erwachsenen. Er verhielt sich auch wie ein Erwachsener, seine Stimme und seine Gesten besaßen eine gewisse Ernsthaftigkeit. Mit einem Nicken befahl er mir, näher zu kommen, und ich gehorchte. Ich beugte mich auf dem Felsblock nach vorn, um zu sehen, was er sah. Ich wusste nicht, was mich erwartete. Dort hinten bildete der Bach einen kleinen Wasserfall sowie ein winziges schattiges Becken, vielleicht knietief. Die Wasseroberfläche war bewegt und brodelte wegen des tosenden Wasserfalls. Ein Fingerbreit Schaum hatte sich am Rand abgesetzt, und an einem großen stecken gebliebenen Ast fingen sich Gräser und modrige Blätter. Es war kein besonders aufregender Anblick, bloß Wasser, das einen Berg hinunterfloss, und trotzdem entzückte er mich immer wieder aufs Neue, ohne dass ich gewusst hätte, warum.
Nachdem ich eine Weile in das Becken gespäht hatte, sah ich, wie sich die Wasseroberfläche kurz teilte, und entdeckte etwas Lebendiges. Erst einen und dann zwei, drei, vier schmale Schatten, das Maul gegen den Strom gerichtet. Nur der Schwanz bewegte sich langsam hin und her. Manchmal schoss einer der Schatten davon und blieb woanders stehen, und manchmal tauchte ein Rücken auf, um gleich darauf wieder unterzugehen, stets mit Blick zum Wasserfall. Wir standen weiter talwärts als sie, deshalb hatten sie uns noch nicht bemerkt.
»Sind das Forellen?«, flüsterte ich.
»Fische«, sagte Bruno.
»Und die sind immer hier?«
»Nicht immer. Manchmal nehmen sie ein anderes Becken.«
»Aber was machen die da?«
»Jagen«, erwiderte er, als wäre es das Normalste von der Welt. Doch für mich war das völlig neu. Ich hatte stets gedacht, dass ein Fisch mit der Strömung schwimmt, weil das einfacher ist, und nicht, dass er seine Kraft darauf verschwendet, sich der Strömung entgegenzustellen. Die Forellen bewegten den Schwanz nur so schnell hin und her, dass sie an Ort und Stelle blieben. Ich hätte gern gewusst, worauf sie Jagd machten. Vielleicht auf die kleinen Fliegen, die knapp über der Wasseroberfläche tanzten, als hielte sie dort etwas gefangen? Ich beobachtete das Ganze und versuchte daraus schlau zu werden, bis Bruno auf einmal genug hatte. Er sprang auf und fuchtelte mit den Armen, woraufhin die Forellen sofort auseinanderstoben. Ich schaute näher hin: Sie waren aus der Beckenmitte in alle Richtungen geflohen. Ich spähte ins Wasser, doch alles, was ich sah, waren die weißblauen Kiesel auf dem Grund. Dann musste ich mich von ihnen losreißen, um Bruno zu folgen, der die Uferböschung auf der anderen Seite des Bachs hinaufrannte.
Weiter oben lag ein einsames Gebäude direkt am Wasser, eine Art Wärterhäuschen. Es verfiel zwischen den Brennnesseln, Brombeersträuchern und Wespennestern in der Sonne. Solche Ruinen gab es viele im Dorf. Bruno legte die Hände auf die Steinmauer, dort wo sie einen rissigen Vorsprung bildete, zog sich daran hoch und stand nach zwei Sätzen in der Fensteröffnung des ersten Stocks.
»Komm schon!«, rief er von oben. Doch dann vergaß er, auf mich zu warten, vielleicht weil er das kinderleicht fand oder gar nicht auf die Idee kam, ich könnte Hilfe brauchen. Oder aber weil er daran gewöhnt war, dass man alles allein schaffen muss, egal, wie leicht oder schwierig es ist. Ich tat es ihm nach, so gut ich konnte, und spürte den rauen, warmen, trockenen Stein unter den Fingern. Ich schrammte mir die Arme am Vorsprung des kleinen Fensters auf, spähte hinein und sah, wie sich Bruno von einer Falltür im Dachboden herabließ und auf eine Leiter stieg, die nach unten führte. Vermutlich war schon damals klar, dass ich ihm überallhin folgen würde.
Dort unten im Halbdunkel befand sich ein Raum, der von niedrigen Mauern in vier gleich große Bereiche unterteilt wurde. Sie erinnerten an Wannen. Es roch nach Moder und morschem Holz. Nachdem sich meine Augen langsam an die Dunkelheit gewöhnt hatten, sah ich, dass der Boden mit Dosen, Flaschen, alten Zeitungen, zerschlissenen Hemden, kaputten Schuhen und verrosteten Werkzeugteilen übersät war. Bruno beugte sich über einen großen glatten Stein. Er war weiß, hatte die Form eines Rads und lag im hintersten Winkel des Raums.
»Was ist das?«, fragte ich.
»Ein Mahlstein«, sagte er. Und dann: »Von der Mühle.«