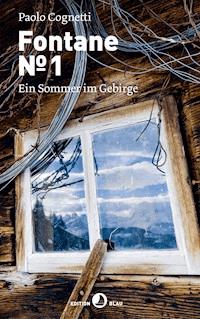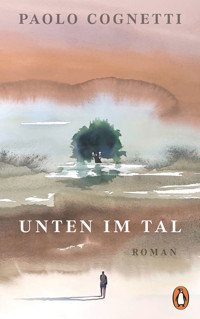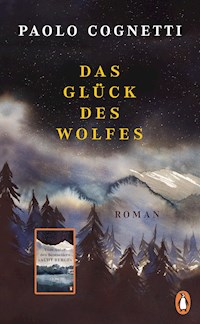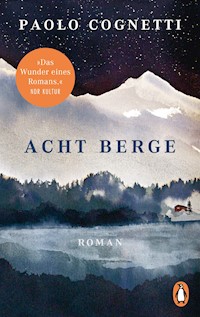9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auf der Suche nach Ruhe und Kraft - eine Reise durch die einsame Bergwelt des Himalaja
Paolo Cognetti nimmt uns mit auf eine atemberaubende Reise in die Ferne, die uns zu uns selbst zurückführt. Schon als Junge träumte er von den kargen Bergen Nepals, nun endlich macht er sich mit seinen zwei engsten Freunden auf den Weg. Sie überqueren 5000er Pässe, kommen an Herden von Blauschafen vorbei, an buddhistischen Klöstern, dem einsamen Hochland immer weiter entgegen. Doch nicht die entlegene Himalaja-Region Dolpo ist Cognettis eigentliches Ziel, auch der Gipfel des Kristallbergs nicht, sondern das Gehen ist seine Mission, sein Zeit- und Raummaß, seine Art zu denken. Mit jedem Schritt, mit jedem Atemzug schärft sich die Wahrnehmung für das Hier und Jetzt, für das, was wesentlich ist: Verbundenheit, Mitgefühl und Verantwortung.
Der Penguin Verlag dankt dem italienischen Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und internationale Kooperation für die großzügige Förderung der Übersetzung dieses Buchs.
Questo libro è stato tradotto grazie ad un contributo alla traduzione assegnato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 124
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Auf der Suche nach Ruhe und Kraft – eine Reise durch die einsame Bergwelt des Himalaja
Paolo Cognetti nimmt uns mit auf eine atemberaubende Reise in die Ferne, die uns zu uns selbst zurückführt. Schon als Junge träumte er von den kargen Bergen Nepals, nun endlich macht er sich mit seinen zwei engsten Freunden auf den Weg. Sie überqueren Fünftausender-Pässe, kommen an Herden von Blauschafen vorbei, an buddhistischen Klöstern, dem einsamen Hochland immer entgegen. Doch nicht die entlegene Himalaja-Region Dolpo ist Cognettis eigentliches Ziel, auch der Gipfel des Kristallbergs nicht, sondern das Gehen ist seine Mission, sein Zeit- und Raummaß, seine Art zu denken. Mit jedem Schritt, mit jedem Atemzug schärft sich die Wahrnehmung für das Hier und Jetzt, für das, was wesentlich ist: Verbundenheit, Mitgefühl und Verantwortung.
»Mehr als eine Reise nach Nepal ist es eine Reise ins Innere, zu sich selbst.« La Lettura
»Paolo Cognetti hat eine Reise in die spröde Schönheit der Natur unternommen.« La Repubblica
»Diese Reise ist ein beständiges Kreisen um Stille und Einsamkeit.« Il Messaggero
Paolo Cognetti, 1978 in Mailand geboren, verbringt seine Zeit am liebsten im Hochgebirge, und seine Erlebnisse in der kargen Bergwelt inspirieren den Mathematiker und Filmemacher zum Schreiben. Sein Roman »Acht Berge« (DVA, 2017), der ins Aostatal führt, erhielt u. a. den renommiertesten italienischen Literaturpreis, den Premio Strega, erscheint in 40 Ländern und hat sich weltweit rund 700.000-mal verkauft. In seinem neuesten Buch, »Gehen, ohne je den Gipfel zu besteigen«, erzählt Paolo Cognetti von seiner Reise in eine abgeschiedene Gegend im Himalaja.
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook
PAOLOCOGNETTI
GEHEN, OHNEJEDENGIPFELZUBESTEIGEN
Aus dem Italienischen von Christiane Burkhardt
»Heute Morgenwäre ich lieber Malerals Drechsler von Worten.Im Nebel heben sichdie Riesenrhododendrenmit ihren großen, moosbedeckten Armen ab.«
TIZIANOTERZANI
Inhalt
Kapitel 1
Den Fluss entlang
Kapitel 2
Am Fuß des heiligen Berges
Kapitel 3
Unterwegs zum Grenztal
Kapitel 4
In der Wüste
Dank
Ende 2017 und gegen Ende meines vierzigsten Lebensjahrs reiste ich mit ein paar Freunden in die Dolpo-Region, die auf einer Hochebene im Nordosten Nepals liegt. Dort wollten wir fünftausend Meter hohe Pässe überwinden; einen Monat nahmen wir uns Zeit für diese Trekkingtour unweit der Grenze zu Tibet. Tibet selbst blieb unerreichbar, wenn auch nicht wegen Grenzproblemen: Nachdem es 1950 von der chinesischen Armee überfallen, in den Sechziger- und Siebzigerjahren von der entfesselten Kulturrevolution zerstört und schließlich vom neuen kapitalistischen China gnadenlos kolonisiert worden war, gab es dieses uralte Reich der Mönche, Kaufleute und Hirtennomaden schlichtweg nicht mehr.
Doch wenn stimmte, was ich gehört hatte, gab es stattdessen so etwas wie ein kleines, von der Geschichte vergessenes Tibet auf nepalesischem Boden. Auch auf Karten wirkt das Dolpo wie eine Ausnahme: Dort, wo das nepalesische Staatsgebiet, das größtenteils südlich des Himalaja bleibt, den Gebirgszug überschreitet und in das riesige geografische Gebiet des Hochlands von Tibet vordringt, liegt oberhalb der Viertausend-Meter-Marke eine Region, die weder von Monsunen noch Straßen erreicht wird – die kargste, entlegenste und am dünnsten besiedelte des gesamten Landes. Vielleicht würde ich ja dort oben das verlorene Tibet, das niemand mehr je zu Gesicht bekommen wird, doch noch zu Gesicht bekommen? Genau so eine Reise wünschte ich mir zu meinem vierzigsten Geburtstag, um den Abschied von einem ganz anderen verlorenen Reich, nämlich der Jugend, zu feiern.
Aber das war nicht der einzige Grund. Ebenso wichtig war mir die Reisegruppe, mit der ich unterwegs sein würde. Man wandert nicht einfach durch den Himalaja: Um Hunderte Kilometer zwischen menschenleeren Bergen zurückzulegen, war eine ganze Expedition vonnöten, bestehend aus Führern, Trägern, Maultieren und Reisegefährten, aus Zelten, die abends auf- und morgens wieder abgebaut werden mussten.
Zu den neun, die mit mir aufbrachen, gehörte auch Nicola, mit dem mich eine beginnende Freundschaft verband. Wir kannten uns erst seit Kurzem, hatten Gemeinsamkeiten festgestellt und befanden uns noch in der Phase, in der man am jeweils anderen alles Mögliche entdeckt. Trotzdem waren wir beide fest davon überzeugt, dass Freundschaften nicht einfach so entstehen: Man muss sie bewusst eingehen, hegen und pflegen. Man muss gemeinsame Erfahrungen machen, die unvergesslich bleiben. So kam es, dass ich ihm das Dolpo eines schönen Frühlingstags am Telefon beschrieb und fragte: »Wollen wir zusammen dorthin fahren?«
»Ja«, erwiderte er. Inzwischen war es Herbst, ohne dass einer von uns einen Rückzieher gemacht hatte.
Der andere Reisegefährte war Remigio, der bisher engste und schwierigste Freund in meinem Leben. Während der zehn Jahre unserer Freundschaft war es mir nicht ein einziges Mal gelungen, ihn aus dem Bergdorf herauszulocken, in dem er geboren und aufgewachsen, und in das ich gezogen war. Ich wollte ihn da nicht rausreißen, aber zur Abwechslung mal etwas anderes mit ihm erleben: einen Ort, an dem wir beide fremd sein und das Gefühl haben würden, weit fort zu sein, etwas ganz Neues zu entdecken. Monatelang hatte ich ihn dahingehend bearbeitet, all meine Überredungskunst aufgeboten und nichts als Skepsis und ständige Meinungsänderungen geerntet. Es gab immer irgendein Knie, das nicht mehr mitmachte, Geld, das fehlte, ja, sogar das Auto spielte einmal verrückt. Aber irgendwann kam er dann doch zum Flughafen – als ich mich längst damit abgefunden hatte, dass er nicht mehr auftauchen würde.
»Du bist also mit von der Partie?«
»Sieht ganz danach aus«, erwiderte er achselzuckend.
Ich wusste, dass man in den Bergen stets allein ist, auch wenn man mit anderen unterwegs ist, freute mich aber darauf, meine Einsamkeit mit diesen Gefährten zu teilen.
Anfang Oktober, als es in den Alpen jeden Moment schneien konnte, brachen wir auf und landeten in einem staubigen, warmen Kathmandu, das gerade erst die Monsunzeit hinter sich hatte. Seit meinem letzten Besuch schien sich die Stadt in dem weitläufigen Tal noch mehr ausgebreitet zu haben. Es gab neu hinzugekommene Peripherieringe, Barackensiedlungen, Wohnviertel, streunende Hunde, Affen, Bettler, abgemagerte, mitten auf der Straße herumstehende Kühe und Kinder. Die hinduistischen und buddhistischen Tempelanlagen am Durbar-Platz, die das Erdbeben vor zwei Jahren beschädigt oder völlig zerstört hatte, lagen noch in Trümmern, Holzpfähle stützten die erhalten gebliebenen Mauern. Große Plakate verkündeten, dass sich die chinesische Regierung um den Wiederaufbau kümmern werde. China? Was hatte China auf dem bedeutendsten Platz Nepals zu suchen?
Ich war mit Fieber angereist, was meine Verwirrung noch steigerte, und als mich eine Frau überredete, ihr Säuglingsmilchpulver zu kaufen, ließ ich mir von ihr und ihrem Komplizen im Laden fast alle Rupien klauen. In den umliegenden dunkelroten Gassen boten Metzger blutige Ziegenköpfe feil, und in den kleinen Tempeln an jeder Straßenecke brachten Gläubige Blumen und Obst dar, das dort verfaulen würde. Im touristischen Thamel-Viertel voller Westler, die auf den Everest wollten oder das Kathmandu der Beatles suchten, machten wir die letzten Besorgungen für unsere Expedition, und zwar in einem dieser Second-Hand-Läden, die Windjacken, Pullis und haufenweise Bergschuhe auf den Verkaufstischen anbieten: alles Sachen, die Kunden ihren Trägern schenken, wenn sie sie in ihren kurzärmeligen Hemden und Flipflops sehen, und die selbige Träger weiterverkaufen, sobald sie ins Tal zurückgekehrt sind. Wir liefen zwischen Staub und verschwitzten Leibern umher, überall wurden uns bettelnde Hände entgegengestreckt, es wurde gehupt, und an der Straße strömten Abwässer entlang. Trotzdem hatte die Stadt etwas, das mich nach wie vor begeisterte.
Die besten Lokale lagen oben auf den Dachterrassen, wo man das Gefühl hatte, über die Nöte der Menschen erhaben zu sein. Während wir bei einem Bier über unsere Reise sprachen, ertappten wir uns dabei, nach Norden zu schauen: Von Kathmandu aus ist der Himalaja nicht zu sehen, das Tal wird von Hügeln und Wolken umschlossen. Dennoch konnten wir ihn uns vorstellen und wurden ganz ehrfürchtig. Wie das in Nepal so ist, wich das Gefühl, Zeit zu verlieren, dem, sich an ein ganz neues Zeitgefühl gewöhnen zu müssen.
Denn erst, wenn man sich damit abgefunden hat, kommt man in die richtige Reisestimmung. Dann trafen eines Morgens die Genehmigungen zum Betreten des Dolpo ein, und wir konnten endlich Richtung Berge aufbrechen.
Kapitel 1
Den Fluss entlang
In dem kleinen Flugzeug nach Norden fiel mir beim Anblick des aus dichten Tropenwolken hervorragenden Himalaja ein Buch wieder ein, das ich einst an einem Fiebertag von meinem Vater bekommen hatte – ich dürfte damals ungefähr neun gewesen sein. Es hieß Die schönsten Gipfel der Welt und hatte den Monte Rosa auf dem Umschlag, der für mich damals mein Ein und Alles war. Ich hatte bereits eine kleine Kostprobe von Fels und Eis bekommen, allerdings im Sommer. Im Winter waren die Berge bloß noch eine ferne Erinnerung, weshalb ich viele Stunden mit diesem Bildband im Bett verbrachte, um mich von meiner Grippe und der Sehnsucht nach ihnen zu erholen. Ich betrachtete die Umrisse des Everest, des K2, des Nanga Parbat, las von den Männern, die sie erklommen hatten, und lernte Namen und Höhenangaben auswendig – mit der Hartnäckigkeit eines Kindes, für das dieses Sich-Einprägen ein magischer Akt ist, weil es ihm vorgaukelt, so von den Dingen Besitz zu ergreifen. Damals träumte ich noch davon, Bergsteiger zu werden, las Messner und Bonatti, als wären sie Stevenson und Verne, während Tibet und Nepal sagenhafte Reiche, ja, Schatzinseln waren.
Noch dreißig Jahre später konnte ich den Dhaulagiri, den am westlichsten gelegenen Achttausender Nepals, anhand seiner Umrisse identifizieren. Das kleine Flugzeug ging tiefer, streifte die von der Sonne beschienenen Wolken und ließ ihn ostwärts liegen. Weitere dunkle Gipfel tauchten vor uns auf, eine Gebirgskette auf fünftausend Metern Höhe: Wie erhofft, blieb der Nebel an dieser Wand hängen. Dann entdeckte ich unter den Propellern nach und nach schmale Grate, Schluchten, die in morgendliches Dunkel abfielen, und Schotterrinnen, die Steinlawinen zur Regenzeit gegraben hatten. Ich warf einen Blick auf Remigio, der am Fenster klebte, und glaubte zu wissen, wonach er suchte: nach einer Landschaft, die er lesen konnte, nach einer Schrift, die ihm vertraut war.
Seit ich in den Bergen lebte, interessierten mich Täler mehr als Gipfel und Bergbewohner mehr als Bergsteiger. Mir gefiel die Vorstellung von einem einzigen großen Hochgebirgsvolk auf der Welt, aber das war nur so eine romantische Idee. In den Alpen waren wir mittlerweile Bewohner einer gigantischen europäischen Riesenmetropole beziehungsweise ihrer bewaldeten Peripherie. Wir lebten, arbeiteten, reisten und unterhielten Beziehungen wie Städter. Bergbewohner – gab es die überhaupt noch? Gab es noch irgendwo authentische Berge, unberührt vom Kolonialismus der Stadt, unversehrt in ihrem Berg-Sein? Mit diesen Fragen war ich vor wenigen Jahren nach Nepal geflogen und hatte die beliebtesten Gebiete bereist – nur um festzustellen, dass die Moderne mittlerweile auch den Himalaja beglückte: mit Straßen, Motoren, Telefonen, elektrischem Strom, Industriegütern und gepriesenen Wohlstandssegnungen im Tausch gegen eine uralte, genügsame Kultur, die genauso dem Untergang geweiht war wie die alpenländische. Ich musste weitersuchen, weiter in die Ferne ziehen.
Der Pilot, dessen Handgriffe ich genau im Auge behielt, drehte behutsam ab und folgte den Windungen eines sonnenbeschienenen Tals. Er steuerte eine kurze Schotterpiste an – nur wenige hundert Meter auf halber Höhe eines Hangs – und begann mit dem Landeanflug. Er setzte auf und bremste energisch zwischen den Häusern von Juphal, dem Ausgangspunkt unserer langen Tour nach Norden: niedrige Steinhütten, umgeben von Terrassenfeldern. Die Ernte war in dieser Region so gut wie eingeholt. An mir klebte der Schweiß eines schwülen Tropenvormittags, doch als ich die Flugzeugtreppe hinunterstieg, roch ich sofort die klare Bergluft. Ich hatte gerade noch Zeit, nach meinem Rucksack zu greifen, als das zweimotorige Flugzeug auch schon wieder abhob.
Sete war siebenundvierzig und ein Tamang aus Ostnepal – breite Wangenknochen, schmale Augen, dunkler Teint. Schon von klein auf war er es gewohnt, sich den Tragekorb umzuhängen. Nachdem er Koch und Hochgebirgsträger geworden war und als solcher den Everest, den Makalu, den Cho Oyu, den Dhaulagiri und den Shishapangma bestiegen hatte, war auch er mit zunehmendem Alter ins Tal zurückgekehrt. Jetzt arbeitete er sommers wie winters auf den Hütten des Monte Rosa, um im Herbst Expeditionen wie die unsere zu leiten. Er sprach Italienisch und lachte viel. Ich fragte mich, ob diese Fröhlichkeit angeboren oder antrainiert war, um direkten Fragen auszuweichen. In Juphal stellte er seit einigen Tagen die Truppe zusammen, die aus ihm, seinem Bruder, fünf für Zeltlager und Küche zuständigen jungen Männern bestand sowie aus weiteren fünf, die mit den Tieren und dem Transport betraut werden würden. Hinzu kamen fünfundzwanzig Maultiere, die alles tragen sollten, was wir auf unserer knapp einmonatigen Trekkingtour brauchen würden. Und dann noch wir zehn aus den Alpen, sodass sich – Tiere und Menschen zusammengerechnet – die stolze Zahl von siebenundvierzig ergab. Zelte, Ausrüstung, Lebensmittel, Kochbenzin, Maultierfutter und Privatgepäck wurden auf den Packsätteln verstaut. Das Einzige, was wir nicht mitnahmen, war Wasser. Allabendlich einen Bach und einen Zeltplatz zu finden, war Setes Aufgabe, der noch nie zuvor im Dolpo gewesen war. Da er unseren Karten misstraute, erkundigte er sich lieber bei vorbeikommenden Maultiertreibern und Bauern nach dem Weg. In Juphal war es warm, und ich wusste nicht recht, was ich im Rucksack bei mir tragen und was ich aufs Maultier packen lassen sollte. Daher fragte ich Sete, ab wann wir dickere Kleidung benötigen würden.
»Weiter oben.«
»Was genau meinst du mit oben?«
Er zeigte fahrig auf die ausgebreitete Karte, auf einen ypsilonförmigen Fleck, den großen Phoksundo-See, der zwischen zwei Tälern liegt.
»Und wie lange brauchen wir bis dorthin?«
»Vier Tage möglicherweise.«
»Möglicherweise?«
Ich schaute nach, auf welcher Höhe der See lag: auf dreitausendsechshundert Metern. Auf zweitausendfünfhundert Metern, wo wir uns gerade befanden, wuchs Mais. Während wir von Juphal aus zur Talsohle hinabstiegen, kamen wir an Reisfeldern, mit Gerste und Hirse bebauten Terrassen und üppigen Gemüsebeeten vorbei. Die Häuser hatten Flachdächer aus festgestampfter Erde. Darauf wurden Heu und Chilischoten getrocknet. Das Dorfleben schien sich überwiegend dort oben abzuspielen, vor allem das der Frauen: Die jungen droschen Gerste mit langen Stöcken, die alten siebten sie im Wind, der die Spelzen forttrug. Unten wusch sich ein Mädchen mit Kernseife die Haare in einem Steinbecken. Längliche gelbe Kürbisse, seltsame Erbsen mit dornigen Schoten, ja, sogar Tomatenrispen gediehen an diesem baumlosen Hang, wo nur die Himalaja-Zeder, ein afrikanisch aussehender Nadelbaum, zwischen den Gemüsebeeten Schatten spendete.
Während ich mich umsah, musste ich an die von Unkraut überwucherten Terrassen, die eingestürzten Trockenmauern und von Wald verschluckten Bewässerungskanäle denken, denen ich in den Alpen regelmäßig begegnete. Daran, dass unsere Berge bestimmt auch einmal so gepflegt gewesen waren, und ich fragte mich, wann man diese hier wohl sich selbst überlassen würde. War das da unten eine Straße? Ja, neben dem Fluss verlief eine Schotterstraße, und genau in dem Moment, in dem wir sie erreichten, überholte uns ein kleiner Lieferwagen. Noch vor wenigen Jahren habe hier nur ein Maultierpfad entlanggeführt, sagte man uns.
Bei dieser Nachricht tauschten Remigio und ich einen vielsagenden Blick. Er war in einem Dorf geboren, das bis zu den Siebzigerjahren nur zu Fuß erreichbar gewesen war. Dann war die Straße gebaut worden, und er hatte mit ansehen müssen, wie es sich im Lauf seines Lebens völlig entvölkerte. Einmal hatte er zu mir gesagt: »Wenn die Straße kommt, glaubt man jedes Mal, dass sie etwas bringen wird – nur um dann festzustellen, dass sie einem ausschließlich etwas nimmt.