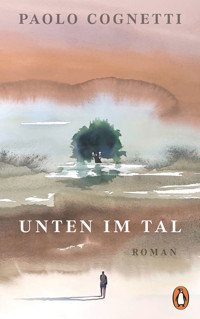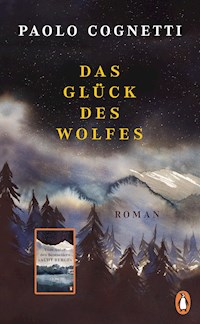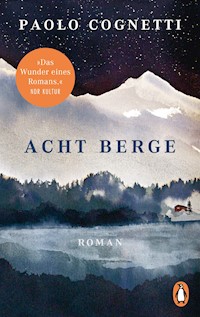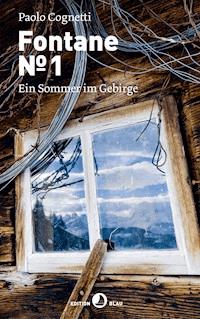
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rotpunktverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Schaffenskrise und das festgefahrene Leben in Mailand bringen Paolo auf die Idee, sich für eine Zeit von der Zivilisation zu verabschieden. Inspiriert von Henry David Thoreau, Chris McCandless und anderen Eremiten mietet er eine Hütte in den Bergen – Fontane Numero 1 –, nicht weit von dort, wo er als Kind die Sommer verbracht hat. Als Ende April das Abenteuer beginnt, erwarten ihn da oben Reste von Schnee, das Rauschen des Winds und das Schweigen der Steine. Das Dasein auf 2000 Meter Höhe bringt die einfachen Dinge zurück: Holz hacken, Feuer machen, die Gegend erkunden, einen Garten anlegen. Paolo spricht mit den Tieren, liest Bücher, hört seltsame Geräusche in der Nacht. Wochenlang sieht er keine Menschenseele, bis aus dem Nebel doch eine Gestalt auftaucht. Paolo Cognettis Hüttenbuch erzählt von der schönen, schrecklichen Einsamkeit, in der man sich selber näherkommt, von einer nicht gekannten Freundschaft und – wir lesen den Beweis – von der Wiederkehr der verlorenen Sprache.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 133
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Paolo Cognetti
Fontane Numero 1
Über dieses Buch
Eine Schaffenskrise und das festgefahrene Leben in Mailand bringen Paolo dazu, sich für eine Zeit von der Zivilisation zu verabschieden. Inspiriert von Henry David Thoreau, Chris McCandless und anderen Eremiten mietet er eine Hütte in den Bergen – Fontane № 1 –, nicht weit von dort, wo er als Kind die Sommer verbracht hat. Als Ende April das Abenteuer beginnt, erwarten ihn da oben Reste von Schnee, das Rauschen des Winds und das Schweigen der Steine.
Das Dasein auf zweitausend Meter Höhe bringt die einfachen Dinge zurück: Holz hacken, Feuer machen, die Gegend erkunden, einen Garten anlegen. Paolo spricht mit den Tieren, liest Bücher, hört seltsame Geräusche in der Nacht. Wochenlang sieht er keine Menschenseele, bis aus dem Nebel doch eine Gestalt auftaucht.
Paolo Cognettis Hüttenbuch erzählt von der schönen, schrecklichen Einsamkeit, in der man sich selber näherkommt, von einer nicht gekannten Freundschaft und – wir lesen den Beweis – von der Wiederkehr der verlorenen Sprache.
Paolo Cognetti
Fontane № 1
Ein Sommer im Gebirge
Aus dem Italienischen von Barbara Sauser
Die Übersetzung dieses Buchs wurde von der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia gefördert.
Der Verlag und die Übersetzerin bedanken sich hierfür.
Der Rotpunktverlag wird vom Schweizer Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2016–2020 unterstützt.
Die Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel Il ragazzo selvatico bei Terre di mezzo Editore, Mailand
© 2013 Cart’armata edizioni Srl / Terre di mezzo
Editore. This edition published in agreement with the Proprietor through MalaTesta Lit. Ag.
© 2017 Rotpunktverlag, Zürich (für die deutschsprachige Ausgabe)
www.rotpunktverlag.ch
www.editionblau.ch
Lektorat: Daniela Koch
Umschlagbild unter Verwendung eines Fotos von Marco Volken
Umschlaggestaltung: Ulrike Groeger
ISBN 978-3-85869-749-3
1. Auflage
Gabriele und Remigio gewidmet, meinen Lehrern im Gebirge.Und in Erinnerung an Chris McCandless, meinen Leitstern.
Ich war in dem hohen Tag, der
jenseits der Tannen lebt,
ich lief über Felder und Berge
aus Licht
Ich überquerte tote Seen – und die gefangenen
Wellen flüsterten mir einen geheimen
Gesang zu
Ich ging weißen Ufern entlang und rief
die schlafenden
Enziane beim Namen
Ich träumte im Schnee von einer riesigen
begrabenen
Blumenstadt
Ich war auf den Bergen
wie eine stachelige Blume
und betrachtete die Felsen,
hohe Klippen
für die Meere des Windes
und besang für mich einen lange vergangenen
Sommer, der mit seinen bitteren
Alpenrosen
in meinem Blut aufloderte
Antonia Pozzi, Schneewehen
Inhalt
Winter
Häuser
Topografie
Schnee
Gemüsegarten
Nacht
Nachbarn
Quo vadis, Hirte?
Männer
Steinböcke und Gämsen
Geisterhütte
Berghütte
Tränen
Rückkehr
Wörter
Alpabzug
Letzter Trinkabend
Winter
Vor ein paar Jahren erlebte ich einen schwierigen Winter. Die Gründe dafür sind jetzt nicht wichtig. Ich war dreißig und fühlte mich kraftlos, verloren und niedergeschlagen, wie wenn ein Unternehmen, an das man geglaubt hat, kläglich gescheitert ist: eine Arbeit, eine Beziehung, ein gemeinschaftliches Projekt, ein Buch, das mich Jahre der Mühe gekostet hatte. Mir eine Zukunft vorzustellen, kam mir in diesem Moment ungefähr so abwegig vor wie eine Reise anzutreten, wenn man Fieber hat, es draußen regnet und dazu der Tank leer ist. Ich hatte alles gegeben, wo blieb nun mein Lohn? Die Tage verbrachte ich in Buchläden, Eisenwarenhandlungen, in der Osteria bei mir gegenüber und im Bett, wo ich durch das Dachfenster den weißen Himmel von Mailand betrachtete. Vor allem aber schrieb ich nicht, und das ist für mich, als würde ich nicht schlafen oder essen: Eine solche Leere hatte ich noch nie erlebt.
Das Lesen von Romanen war mir in diesen Monaten zuwider, dafür faszinierten mich die Geschichten von Menschen, die aus Weltverdrossenheit in der Natur Einsamkeit gesucht hatten. Ich las Walden von Thoreau, Mein erster Sommer in der Sierra von John Muir, Geschichte eines Berges von Elisée Reclus. Diese Schriftsteller waren jung wie ich gewesen, als sie von der Zivilisation Abschied genommen hatten, um sich in die Wälder zurückzuziehen. Besonders beeindruckt war ich von Chris McCandless’ Reise, die Jon Krakauer in seinem Buch In die Wildnis erzählt. Vielleicht weil Chris kein Philosoph des 19. Jahrhunderts war, sondern ein junger Mann meiner Zeit, der mit zweiundzwanzig Stadt und Familie, dem Studium und den nach westlichen Maßstäben brillanten Zukunftsaussichten den Rücken gekehrt und sich auf einen einsamen Streifzug begeben hatte, der letztlich in Alaska mit dem Hungertod endete. Als seine Geschichte bekannt wurde, verurteilten viele seine Entscheidung als allzu idealistisch, sprachen von Realitätsflucht oder gar Selbstzerstörungstrieb. Ich fühlte, dass ich ihn verstand und eigentlich bewunderte. Chris hatte keine Zeit mehr gehabt, ein Buch zu schreiben, falls das je seine Absicht gewesen war, so oder so werden wir seine wahren Gedanken nie erfahren. Aber er liebte Thoreau und hatte sich sein Manifest auf die Fahnen geschrieben: »Ich zog in den Wald, weil ich den Wunsch hatte, mit Überlegung zu leben, dem eigentlichen, wirklichen Leben näherzutreten, zu sehen, ob ich nicht lernen konnte, was es zu lehren hatte, damit ich nicht, wenn es zum Sterben ginge, einsehen müsste, dass ich nicht gelebt hatte. Ich wollte nicht das leben, was nicht Leben war; das Leben ist so kostbar. Auch wollte ich keine Entsagung üben, außer es wurde unumgänglich notwendig. Ich wollte tief leben, alles Mark des Lebens aussaugen, so hart und spartanisch leben, dass alles, was nicht Leben war, in die Flucht geschlagen wurde. Ich wollte einen breiten Schwaden dicht am Boden mähen, das Leben in die Enge treiben und auf seine einfachste Formel reduzieren; und wenn es sich als gemein erwiese, dann wollte ich seiner ganzen unverfälschten Niedrigkeit auf den Grund kommen und sie der Welt verkünden.«
Ich war seit zehn Jahren nicht mehr in den Bergen gewesen. Davor hatte ich zwanzig Sommer dort verbracht. Für mich Stadtkind, aufgewachsen in einer Wohnung in einem Viertel, in dem es nicht möglich war, mal eben raus in den Hof oder auf die Straße zu gehen, waren die Berge der Inbegriff von Freiheit. Ich hatte gelernt, mich, anfänglich etwas unbeholfen und später mit großer Selbstverständlichkeit, im Gebirge zu bewegen, so wie andere Kinder das Schwimmen lernen, wenn ein Erwachsener sie ins Wasser wirft. Mit acht hatte ich angefangen, Gletschertouren zu machen, mit neun im Fels zu klettern, und mit sechzehn zog ich alleine los und fühlte mich auf den Gebirgspfaden deutlich wohler als auf den Straßen meiner Heimatstadt. Zehn Monate im Jahr steckte ich in adretten Kleidern und einem autoritären System von Regeln, die es zu befolgen galt. In den Bergen löste ich mich von all dem und ließ meiner Natur freien Lauf. Es war eine andere Freiheit als jene, zu reisen und Menschen kennenzulernen, oder nächtelang zu trinken, singen und mit Mädchen herumzuflirten, oder Gefährten zu finden, mit denen man zu großen Abenteuern aufbrechen will. All diese Freiheiten schätze ich, und mit zwanzig war es mir auch wichtig, sie gründlich auszukosten, aber mit dreißig hatte ich fast vergessen, wie es sich anfühlt, allein im Wald zu sein oder nackt in einen Fluss einzutauchen oder ganz oben über einen Grat zu laufen, über dem es nur noch den Himmel gibt. Diese Dinge hatte ich früher getan, und meine Erinnerungen daran gehören zu den glücklichsten. Ich empfand den jungen urbanen Mann, zu dem ich geworden war, als das genaue Gegenteil dieses wilden Burschen, und so entstand in mir der Wunsch, diesen wieder aufzuspüren. Es war weniger das Bedürfnis wegzugehen als zurückzukehren. Nicht eine unbekannte Seite von mir zu entdecken, sondern in mir etwas Ursprüngliches wiederzufinden, das mir, wie ich fühlte, abhandengekommen war.
Ich hatte ein wenig Geld gespart, genug, um ein paar Monate ohne Arbeit über die Runden zu kommen. Nun suchte ich nach einem möglichst hoch gelegenen Haus fernab besiedelter Gebiete. Weite Wildnis gibt es in den Alpen nicht, aber für das, was mir vorschwebte, brauchte es kein Alaska. Im Frühling fand ich das Passende, in einem Tal nicht weit von jenem, das ich aus meiner Kindheit kannte: eine Hütte aus Holz und Stein auf zweitausend Metern Höhe, wo die letzten Nadelwälder den Sommerweiden weichen. Den Ort selbst kannte ich nicht, aber die Landschaft war mir vertraut, weil ich als Teenager die andere Seite der Berge durchstreift hatte. Die Hütte war etwa zehn Kilometer von der nächsten Ortschaft und wenige Minuten von einem Dorf entfernt, das sich sommers und winters bevölkerte, aber am dreißigsten April, als ich ankam, war niemand da. Die Wiesen waren noch im Winterschlaf, in den Braun- und Ockertönen der Schneeschmelze. Gipfel und schattige Täler waren schneebedeckt. Ich ließ das Auto am Ende der asphaltierten Straße stehen. Mit geschultertem Rucksack stieg ich auf dem Saumpfad durch einen Wald und dann über eine verschneite Weide hoch, bis ich zu einer Gruppe von Häusern kam, die bis auf eines – das renovierte, das ich gemietet hatte – alle eingestürzt waren. Vor der Haustür blickte ich mich um: nichts als Wald, Viehweiden und verlassene Ruinen. Am Horizont die Berge, die das Aostatal im Süden Richtung Gran Paradiso abschließen. Ein Brunnen aus einem ausgehöhlten Baumstamm, die Überreste einer Trockenmauer, ein gurgelnder Wildbach. Das würde nun für einige Zeit meine Welt sein, für wie lange, hatte ich noch nicht festgelegt, weil ich nicht wusste, was sie mir bereithalten würde. An diesem Tag war der Himmel dumpfgrau, es war ein frostiger, lichtloser Morgen. Ich hatte nicht die Absicht, mich zu quälen: Falls mich hier oben Gutes erwartete, wollte ich bleiben, möglich war aber auch, dass mich eine noch tiefere Verzweiflung befallen würde, und dann wollte ich fliehen. Ich hatte Bücher und Notizhefte im Gepäck. Meine Hoffnung war, dass ich irgendwann wieder zu schreiben anfangen würde. Aber jetzt war mir kalt, ich musste einen dicken Pullover anziehen und ein Feuer anzünden, und so stieß ich die Tür auf und betrat mein neues Zuhause.
Häuser
Wenn man im Frühling eine Hütte zum ersten Mal wieder betritt, hat das etwas Rührendes. Ich riss die Türen der Zimmer auf, die monatelang geschlossen gewesen waren, mit dem Frost als einzigem Gast, die Dachluken vom Schnee verdunkelt. Mit dem Finger fuhr ich über den Tisch, den Stuhl, das Wandbord, überall Staub, im Kamin vergessene Asche. Ob die Häuser fühlen, wie die Zeit vergeht? Oder ist ein Winter für sie wie ein einziger Augenblick? Ich dachte an jenen Tag vor zehn Jahren zurück, als ich zum letzten Mal durch eine andere Tür hinausgegangen war, nachdem ich alles noch einmal lange angesehen hatte. Den Eindruck einer Rückkehr verdankte ich jetzt nicht der Sehkraft, sondern dem Geruchsinn, es war der Duft nach Holz und Harz, der mir das beruhigende Gefühl gab, wieder zu Hause zu sein. Ich fragte das Haus: War der Winter sehr hart? Und stellte mir vor, wie es in Januarnächten, wenn die Temperatur auf unter zwanzig Grad sinkt, gestöhnt und geknarrt haben mochte und wie es später die fahle Märzsonne genoss, die warmen Mauern, den von den Dachrinnen tropfenden Schnee. Falls es die Bestimmung eines Hauses ist, bewohnt zu werden, empfand es auf seine Art vielleicht Glück, dass nun wieder ein Mensch mit seinem Holz hin und her ging, im Kamin und im Ofen Feuer machte, sich in der Küche die Hände wusch. Hinter den Wänden zirkulierten wieder kaltes, felsiges Wasser und Feuer, wie Saft in einem Baum und Blut in einem Körper.
In der Erzählung Meine vier Häuser, die ich sehr mag, blickt Mario Rigoni Stern anhand der Häuser, die er bewohnte, auf die verschiedenen Phasen seines Lebens zurück. Nicht alle dieser Häuser waren real: Man bewohnt ein Haus auch, indem man es sich ausdenkt oder aus den Erinnerungen anderer ausleiht. Das erste war ein verloren gegangenes Haus, nämlich der historische Familiensitz der Sterns, nach vierhundert Jahren dem Ersten Weltkrieg zum Opfer gefallen. Der 1922 geborene Mario kannte das Haus dank der Erzählungen der Alten, hatte es aber nie mit eigenen Augen gesehen. Er bedauerte, nicht dort aufgewachsen zu sein: Es war das Bindeglied zwischen seiner Familie und dem heimatlichen Grund, stand für das Gefühl von Vaterland, das für die Bewohner der Berge nicht mit einer Nation identisch ist, sondern mit einer Sprache einhergeht, mit den Bezeichnungen für Dinge und Orte, dem Jahresablauf der Verrichtungen, der guten Art, etwas zu tun.
Das zweite Haus, das seiner Kindheit, war real und voller geheimer Winkel, wie es die Häuser sind, in denen wir Kind waren, mit Geschichten in der Küche und einem zum Rückzugsort und Land der Abenteuer erwählten Dachboden.
Das dritte war ein imaginäres Haus: 1945 in einem Konzentrationslager interniert, hatte Mario ein Blatt Papier und einen Bleistift gefunden und lange Hungertage damit verbracht, eine Hütte zu entwerfen. Er stellte sie sich auf einer Lichtung im Gebirge vor, wo er von Jagd, Büchern und Einsamkeit leben würde, um vom Krieg zu genesen – wie Hemingways Nick Adams in Großer doppelherziger Strom. Die Zeichnung bewahrte ihn lange Zeit davor, zu verzweifeln.
Das vierte schließlich war ein Haus mit Gemüsegarten und Holzschuppen – vor den Fenstern Wald, Bienenstöcke, von Rehen besuchte Wiesen –, das er wirklich baute und in dem er fünfzig Jahre lebte, »zusammen mit meiner Frau, meinen Büchern, meinen Gemälden, meinem Wein, meinen Erinnerungen«.
Vermutlich fühlt man einen großen Frieden in sich, wenn man in einem selbst erbauten Haus wohnt. Meine Hütte war vor etwa zweihundert Jahren von Hirten als Alpunterkunft für Vieh und Mensch errichtet worden. Es gab nur zwei Zimmer: Unten, wo einmal der Stall gewesen war, hatte ich jetzt mein Schlafzimmer mit Schrank, Kommode, Ofen. Oben waren die Küche, der Kamin, das Sofa, ein Tisch mit zwei Sitzbänken und einem Stuhl. Ich fuhr mit den Fingern über die Steinmauern, die seit ihrer Erbauung unverändert geblieben waren – wie viele Hände, wie viel Holzrauch, tierische Atemluft, Dampf von Polenta und Milch waren wohl schon darübergestrichen? Hier und da steckte zwischen zwei Steinen ein dicker Nagel oder ein angekohltes Holzstöckchen. Was hatte man da aufgehängt, wer hatte sie in die Wand geschoben? Das Haus war voller Gespenster, aber sie machten mir keine Angst: Mir war fast, als würde ich mit all diesen früheren Bewohnern zusammenleben, sie durch diese Räume und Dinge kennenlernen.
Das Haus, in dem ich die Sommer der Kindheit verbrachte, war 1855 als Hotel erbaut worden, aber zu meiner Zeit bereits baufällig. Ich hatte ein paar Ansichtskarten aus seinen goldenen Jahren gefunden. Es stand außerhalb des Dorfs, am Ende einer Allee aus Jahrhundertbuchen, die auf den Fotos noch frisch gepflanzte Sträucher waren. Die Piemonteser Bourgeoisie orientierte sich am angelsächsischen Mythos. Auf den Wiesen, über die ich rannte, hatten hundert Jahre früher Gentlemen Krocket gespielt, während die Damen mit ihren kleinen Sonnenschirmen lustwandelten. Ein Schild auf dem abblätternden Verputz der Fassade erinnerte an einen Aufenthalt der Königin Margarethe von Savoyen. Die Autowerkstatt war einst ein Ballsaal gewesen und ihr überwuchertes Dach eine Terrasse, auf der man den Nachmittagstee servierte. Das Hotel war bis in die Dreißigerjahre in Betrieb gewesen, aber im Krieg hatten es die Deutschen geplündert und danach verkauft, und fünfzig Jahre später sah es aus wie ein baufälliges Schloss mit glorreicher Vergangenheit. Es gehörte zwei alten Schwestern, die dort Unterkünfte eingerichtet hatten und mit der Sommervermietung etwas Geld verdienten, während es in den anderen Monaten geschlossen war. Da es weder instand gehalten noch geheizt wurde, kamen jeden Winter neue Schäden dazu. 1986 versetzte ein Aprilschnee dem Haus den Gnadenstoß: Eine Lawine riss einen Teil des Gebäudes mit sich, und ein ganzer Flügel wurde als einsturzgefährdet deklariert. Im folgenden Sommer bildeten sich in den noch stehenden Mauern große Risse, und mit den Jahren wucherten Brennnesseln auf den Trümmern, die nie jemand weggeräumt hatte. Aber lebhafter als die Ruine ist mir meine Verblüffung über den Schnee in Erinnerung geblieben, den ich Anfang Juli vorfand, kalt und hart, sodass wir noch wunderbar darauf rodeln konnten. Dieser Sommer blieb für immer als der Sommer der Lawine in Erinnerung.