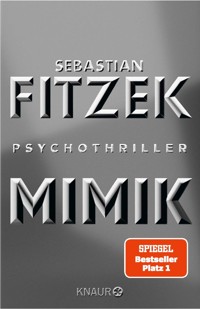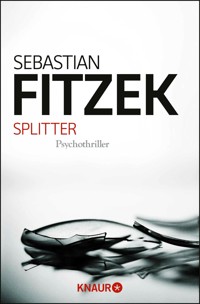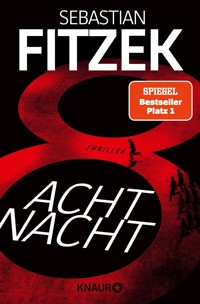
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein furioser Thriller von Sebastian Fitzek, basierend auf einer großartigen Wahn-Idee: Was wäre, wenn du einen Menschen deiner Wahl straflos töten darfst? Es ist der 8. 8., acht Uhr acht. Du hast 80 Millionen Feinde. Wirst du die AchtNacht überleben? Stell dir vor, es gibt eine Todeslotterie. Du kannst den Namen eines verhassten Menschen in einen Lostopf werfen. In der "AchtNacht", am 8. 8. jedes Jahres, wird aus allen Vorschlägen ein Name gezogen. Der Auserwählte ist eine AchtNacht lang geächtet, vogelfrei. Jeder in Deutschland darf ihn straffrei töten - und wird mit einem Kopfgeld von zehn Millionen Euro belohnt. Das ist kein Gedankenspiel. Sondern bitterer Ernst. Es ist ein massen-psychologisches Experiment, das aus dem Ruder lief. Und dein Name wurde gezogen! Ein rasanter Action-Thriller und Bestseller von Sebastian Fitzek, dem "Meister des Wahns" – exklusiv im Taschenbuch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 424
Veröffentlichungsjahr: 2017
Sammlungen
Ähnliche
Sebastian Fitzek
AchtNacht
Thriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Es ist der 8. 8., 8 Uhr 08.
Sie haben 80 Millionen Feinde.
Werden Sie die AchtNacht überleben?
Stellen Sie sich vor, es gibt eine Todeslotterie.
Sie können den Namen eines verhassten Menschen in einen Lostopf werfen.
In der »AchtNacht«, am 8. 8. jedes Jahres, wird aus allen Vorschlägen ein Name gezogen.
Der Auserwählte ist eine AchtNacht lang geächtet, vogelfrei.
Jeder in Deutschland darf ihn straffrei töten – und wird mit einem Kopfgeld von zehn Millionen Euro belohnt.
Das ist kein Gedankenspiel. Sondern bitterer Ernst.
Es ist ein massenpsychologisches Experiment, das aus dem Ruder lief.
Und Ihr Name wurde gezogen!
Inhaltsübersicht
Vorbemerkung
Motto
»Das ist eine wahre Geschichte!«*
Prolog
»You better run«
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
»Das hat er verdient!«
70. Kapitel
71. Kapitel
Anmerkung des Autors
Das Quiz für dein nächstes Fitzek-Abenteuer
Leseprobe »Der Nachbar«
Inspiriert von »The Purge«
… über jemanden die Acht verhängen:
Ausschluss einer Person vom Rechtsschutz, wodurch sie vogelfrei wird.
Duden
Wenn man eine große Lüge erzählt und sie oft genug wiederholt, dann werden die Leute sie am Ende glauben.
Joseph Goebbels
NS-Propagandaminister
Das ist eine wahre Geschichte!*
* Glauben Sie keinem, der Ihnen die Wahrheit verspricht, bevor er anfängt, seine Geschichte zu erzählen.
Prolog
Hier ist der Anruf für Sie.«
Dr. Martin Roth, der Psychiater mit dem unerwartet glatten, für einen Chefarzt etwas zu jungenhaft wirkenden Gesicht, wollte ihr den Hörer reichen, aber jetzt hatte sie Angst.
Natürlich freute sie sich darauf, einmal eine andere Stimme zu hören als die ihrer Therapeuten und Mithäftlinge, auch wenn Dr. Roth es nicht mochte, wenn sie die anderen Patienten so bezeichnete. Aber plötzlich überkam sie die alptraumhafte Vorstellung, dass sich mit dem ersten Wort ihres Gesprächspartners das Telefon in ihrer Hand in Flammen auflösen und ihren vernarbten Schädel verbrennen könnte. Sie befürchtete, es würde eine Stichflamme geben, die durch ihr Trommelfell hindurch bis zum Gehirn schlug.
Das war natürlich Unsinn. Ihrer Meinung nach allerdings kein so grober Unfug wie herkömmlicher Aberglaube – selbstverständlich konnte man beispielsweise Spiegel zerbrechen und trotzdem im Lotto gewinnen. Und lange nicht so abstrus wie die Schlaf-Fee, die sie in ihrer Kindheit jahrelang für real gehalten hatte. Eine fabelhafte Erfindung, die ihre Mutter früher immer aus der Schublade zog, wenn sie keine Lust hatte, ihr eine Gutenachtgeschichte vorzulesen.
»Wenn du jetzt sofort das Licht ausmachst, legt die Schlaf-Fee dir morgen früh etwas vor die Tür. Du hast einen Wunsch frei!«
Schokolade.
Manchmal hatte sie sich ein Prinzessinnenkleid oder ein Puppenhaus gewünscht. Aber meistens hatte sie Süßigkeiten gewollt, denn die kleinen Wünsche an die Schlaf-Fee – das fand sie schnell heraus – gingen manchmal in Erfüllung. Für die großen waren die Gewissensbisse ihrer Mutter selten stark genug gewesen.
Würde sich ihre Mutter heute neben ihr Krankenbett auf der geschlossenen Abteilung der Station 17 stellen, ihr einen Nasenkuss geben und die Schlaf-Fee-Frage stellen, dann würde sie sich wie eine Ertrinkende an die rettende Hand ihrer Mama klammern und mit angstgeweiteten Augen brüllen:
»Ich wünsche mir, es rückgängig zu machen!«
Bei Gott, ich wünsche es mir so sehr!
Und dann würde sie weinen, weil sie längst nicht mehr fünf Jahre alt und damit viel zu groß war, um an Wünsche und Wunder zu glauben. Obwohl es das war, was es jetzt brauchte.
Ein Wunder, das all das, was sie getan hatte und was am Ende zu so viel Blut, Schrecken und Elend führte, ungeschehen machte.
»Aber nur der Tod stellt den Zeiger auf null.«
Das hatte Oz ihr oft genug gesagt, und es war ja nun nicht so, dass man für diese Erkenntnis besonders viel Lebenserfahrung brauchte. Alles war dafür gemacht, kaputtzugehen: der Kühlschrank, die Liebe, der Verstand.
Wann sie ihren Verstand an die Angst verloren hatte, konnte sie heute nicht mehr sagen.
Oder doch. Vermutlich war es an dem Tag gewesen, an dem sie das letzte Mal Kontakt hatten.
Kurz vor Mitternacht. Als Oz, von dem sie nicht viel mehr als dieses alberne Pseudonym kannte, am Telefon sein wahres Gesicht gezeigt hatte, ohne dabei seine Identität zu enthüllen.
»Wieso stoppen wir es nicht wieder?«, hatte sie ihn gefragt. Den Tränen nahe, weil ihr klargeworden war, dass Oz nie vorgehabt hatte, das Experiment zu einem friedlichen Ende zu bringen. Er hatte sie benutzt. Schlimmer und brutaler als jemals ein Mensch zuvor.
»Wieso sollten wir?«, fragte er.
»Weil es so nie geplant war!«
»Das Leben kann man nicht planen, meine Kleine. Es ist ein Erkenntnisprozess. Es nimmt seinen Lauf, und wir schauen zu.«
»Wir sind aber keine Beobachter. Wir haben Es erschaffen.«
Oz lachte, und sie meinte zu sehen, wie er den gesichtslosen Kopf schüttelte.
»Wir hatten die Idee. Und wie schon Dürrenmatt in Die Physiker sagte: Eine Idee, die einmal gedacht wird, kann nie wieder zurückgenommen werden. Wenn wir jetzt aufhören, wird ein anderer unser Werk vollenden.«
»Dann trifft uns aber keine Schuld.«
»Oh doch. Wir sind schuldig, seit wir das Experiment gestartet haben. Wenn jetzt jemand stirbt – und das wird passieren –, dann nur, weil wir den Mördern die Idee dazu geliefert haben. Wir sind die Inspiration des Bösen.«
»Aber das wollte ich nie sein!«
Sie hatte so heftig gezittert, dass ihr die Welt um sie herum wie eine verwackelte Kameraaufnahme vorgekommen war. »Damit kann ich nicht leben.«
»Ich fürchte, das musst du.«
»Ich flehe dich an.«
»Was zu tun?«
»Hör damit auf.«
Er lachte. »Wir stehen kurz vor dem Durchbruch. Ich kann unser Experiment doch jetzt nicht stoppen. Das wäre so, als würden wir einen funktionierenden Impfstoff wegschütten, ohne ihn zu testen. Ein wissenschaftlicher Coitus interruptus.«
Impfstoff.
Das Wort hatte einen Gedanken ausgelöst: »Dann lass es uns wie Salk machen.«
»Wie wer?«
»Jonas Salk. Der Bezwinger der Kinderlähmung. Den von ihm entwickelten Impfstoff hat er zuerst an sich selbst getestet.«
Stille.
Mit dieser Idee hatte sie ihn offenbar überrumpelt. Oz schien tatsächlich nachzudenken. In sein Schweigen hinein wiederholte sie: »Mach es wie Salk. Nimm uns als Versuchskaninchen.«
Als er endlich antwortete, konnte sie im ersten Moment kaum glauben, dass er ihr wirklich zustimmte.
»Gar keine schlechte Idee. Ist notiert.«
Sie hatte genickt. Erleichtert und dennoch voller Angst. Die noch einmal größer wurde, als er nachschob: »Dein Name ist schon mal auf der Liste.«
Ihr Herz hatte einen Schlag ausgesetzt.
»Und du? Was ist mit dir?«
»Ich kann nicht mitmachen.«
»Wieso nicht?«
Du Feigling! Du feige Sau!
»Ich bin anders als du.«
»Was bitte schön unterscheidet uns denn?«, hatte sie gefragt.
Außer Ehrlichkeit, Wärme und Herz?
»Ich habe keine Lust zu sterben«, hatte er gesagt und aufgelegt.
Danach hatte er sich nie wieder bei ihr gemeldet.
Hatte ihre Anrufe ignoriert.
Und auch ihre Schreie.
Als der Kerl mit dem Pfefferspray vor ihr stand.
Als die Scheibe direkt neben ihrem Kopf zersplitterte.
Oder als sie um ihr Leben brüllte, während ihr der Mann mit der Mülltüte auf dem Kopf das Messer ins Auge rammen wollte.
Dabei war Oz die ganze Zeit bei ihr gewesen. Hatte sie beobachtet. Auf der Lauer gelegen. Ihr nachspioniert. Dessen war sie sich sicher.
So sicher, wie sie wusste, dass es keine Schlaf-Fee gab.
Und dass sie die Anstalt, in der sie jetzt lag, ihr Leben lang nicht mehr würde verlassen dürfen.
Selbst wenn Dr. Roth sie hin und wieder so ansah, als würde er die AchtNacht-Geschichte, die sie zu erzählen hatte, tatsächlich glauben.
Aber vielleicht war er auch nur ein guter Schauspieler und dachte sich seinen Teil.
Wie sollte sie es ihm verdenken?
Sie selbst konnte ja kaum unterscheiden, ob sie das hier tatsächlich erlebt hatte oder ob das alles nur ein perverser Alptraum gewesen war.
»Ihr Anruf«, wiederholte Dr. Roth flüsternd, der noch immer neben ihr stand und den sie während des Abtauchens in ihre Erinnerungen völlig vergessen hatte. Endlich nahm sie ihm den Hörer ab.
»Wer ist da?«, fragte sie, und der Mann am anderen Ende der Leitung nannte ihr einen falschen Namen. Doch seine Stimme klang echt, und sie seufzte erleichtert auf.
Gott sei Dank. Er ist es!
Dankbar lächelte sie ihrem Psychiater zu.
Es war richtig gewesen, auf Dr. Roth zu hören.
Er hatte recht gehabt, sie zu diesem Gespräch zu überreden.
Verdammt, sie hätte nie gedacht, dass es sich so gut anfühlen würde, mit einem Toten zu telefonieren.
You better run
Cause we got guns
(...)
We’re killing strangers
So we don’t kill the ones that we love
Marilyn Manson
»Killing Strangers«
Wenn eine Gruppe im Netz hetzt, dann sieht sie das Ernsthafte hinter ihrem Tun nicht. Einzelne machen mit, weil alle mitmachen.
Herbert Scheithauer, Professor der Psychologie, FU Berlin
»YouTube-Hetzjagd. Ein Ort für anonymen Hass« in Süddeutsche Zeitung, 14.12.2013
Nie haben die Massen nach Wahrheit gedürstet.Von den Tatsachen, die ihnen missfallen, wenden sie sich ab und ziehen es vor, den Irrtum zu vergöttern, wenn er sie zu verführen vermag.
Wer sie zu täuschen vermag, wird leicht ihr Herr,wer sie aufzuklären versucht, stets ihr Opfer.
Gustave Le Bon (1841–1931), französischer Arzt und Begründer der Massenpsychologie
1.
Bens Hände zitterten.
Das war nichts Ungewöhnliches, das taten sie oft. Immer dann, wenn er wusste, dass er wieder einmal die Kontrolle verloren hatte. Seine Finger waren wie ein Seismograph. Nervöse Antennen, die das Beben vorwegnahmen, das den Boden, auf dem er stand, ein weiteres Mal zum Einsturz bringen würde.
Dabei war er heute überpünktlich gekommen, um es diesmal nicht zu versauen. Aber so, wie es aussah, sollte ihm das nicht gelingen.
»Es tut mir leid«, sagte Lars, der Gitarrist seiner Band, und der melancholische Tonfall passte zu dem traurigen Basset-Blick des Musikers.
Ben lächelte unsicher und zeigte auf das Schlagzeug, das irgendjemand bereits aufgebaut hatte. Die Toms frisch geputzt und abgestaubt. Die Beckenständer funkelten im Schein der Hotelbar wie der polierte Auspuff eines nagelneuen Motorrads.
»Hey, ich weiß, das war Mist letztes Mal. Aber ich pack das heute Abend«, sagte er.
Der Gitarrist, der gleichzeitig der Bandleader war, drückte seine Zigarette im Aschenbecher aus und schüttelte bedauernd den Kopf. »Das geht nicht, Ben. Mike hat nein gesagt.«
»Ist er hier?«
Ben sah auf die Uhr. Nein. So früh ließ der Hotelmanager sich nicht blicken. Es war 17.20 Uhr. Noch über eine halbe Stunde, bis es losging, aber die Bar war schon geöffnet. Zwei ältere Männer mit grauen Anzügen und ausgelatschten Schuhen unterhielten sich lachend am Tresen. Ein Pärchen teilte sich einen Feierabend-Drink in einer der ledernen Ecknischen, die zwar bequem aussahen, aber stahlhart gepolstert waren.
Das war das Problem mit dem Travel-Star-Hotel am Messegelände unterm Funkturm. Auf den ersten Blick wirkte es wie ein gehobenes Mittelklassehotel. Beim näheren Hinsehen verstand man jedoch die Zwei-Sterne-Rezensionen, die zwar die Freundlichkeit des Personals lobten, aber die schimmeligen Fugen im Duschbad bemängelten.
Dass das Travel-Star nicht das Adlon war, ließ schon der Preis – neunundfünfzig Euro die Nacht – erahnen. Und die Tatsache, dass hier jeden Samstag die Spiders auftraten. Nicht gerade die berühmteste Band der Welt. Nicht einmal die beste Coverband Berlins.
Als Ben bei den »Spiders« als Schlagzeuger anheuerte, hatte er sich selbst gehasst. Noch vor vier Jahren durfte er seine eigenen Rocksongs im Quasimodo spielen. Heute musste er froh sein, wenn ihm sein angetrunkenes Vertreterpublikum keine Cocktailkirsche an den Kopf schnipste, während er »YMCA« von den Village People zum Besten gab. Aus ihm war eine Musikhure geworden. Er prostituierte sich als Fahrstuhlmusik-Schlagzeuger. Nie hätte Ben sich vorstellen können, um diesen elenden Job sogar zu betteln. Dabei hätte er es besser wissen müssen. So oft hatte er geglaubt, den Keller seines Lebens längst erreicht zu haben, und war dann doch noch ein Stockwerk tiefer gefallen.
»Hör mal, ich brauch den Job. Ich bin mit dem Unterhalt im Rückstand. Und du weißt ja, dass meine Tochter gerade …«
»Ja, ja, ich weiß. Und das mit Jule tut mir leid, ehrlich. Aber selbst, wenn ich es wollte. Es geht nicht. Du hast die Proben geschwänzt, nachdem …«
»Proben? Was gibt es denn bei Kool & the Gang zu proben?«
»… nachdem du bei deinem letzten Auftritt neben die Bassdrum gekotzt hast. Alter, wir mussten den Gig abbrechen. Du hast uns sechshundert Euro gekostet!«
»Das war ein Fehler, ein dummer Fehler. Du weißt, dass ich nicht mehr trinke. Es war einfach ein beschissener Tag gewesen, das weißt du doch. Es kommt nicht wieder vor.«
Lars nickte.
»Ganz genau. Das kommt nicht wieder vor. Sorry, Kumpel. Wir haben schon einen Ersatz für dich.«
Ersatz.
Als Ben vier Minuten später auf einer Bank in der Nähe des Hoteleingangs saß und einen Reisebus beim Rangieren auf dem nahe gelegenen Omnibusbahnhof beobachtete, dachte er, dass das eigentlich ein ganz guter Spruch für seinen Grabstein wäre:
Hier ruht Benjamin Rühmann.
Er wurde nur neununddreißig Jahre alt.
Aber machen Sie sich keine Sorgen.
Wir haben schon einen Ersatz für ihn gefunden.
In der Regel ging das schnell. Das war jetzt schon die vierte Combo, die ihn gefeuert hatte. Fast Forward nicht mitgerechnet. Die Band, die er gegründet hatte und aus der er ausgetreten war – kurz bevor sie ihren ersten großen Hit hatte. Den ersten von einer ganzen Reihe. Fast Forward war während ihrer USA-Tour gerade zu Gast in der Tonight-Show in New York.
Das letzte Interview, das Ben gegeben hatte, war für eine Rubrik eines Wirtschaftsmagazins gewesen: »Beinahe berühmt – Menschen, die um ein Haar zum Star geworden wären«. In dem Artikel war er mit Tony Chapman verglichen worden. Dem Typen, der 1962 im Londoner Marquee Club beim ersten offiziellen Auftritt einer Band namens Rolling Stones an den Drums gesessen hatte und kurz danach freiwillig ausgestiegen war.
»Aber von freiwillig kann bei mir keine Rede sein«, sagte Ben laut. Eine ältere Dame, die gerade an ihm vorbeilief, sah ihn erschrocken an. Sie zog einen braunen Koffertrolley an ihm vorbei, und für einen Moment überlegte Ben, ob er ihr auf dem Weg zu den Reisebussen behilflich sein sollte. Der Schweiß lief ihr die Stirn hinab. Kein Wunder bei den Temperaturen. Berlin hatte immer seltener tropische Augusttage, aber heute schien das Thermometer auch in der Nacht nicht unter achtundzwanzig Grad fallen zu wollen. Es sei denn, ein Gewitter sorgte später noch für Abkühlung. Der Himmel zog sich bereits zu.
Ben betrachtete eine nahezu rechteckige, an den Rändern gezackte Wolke, die ihn an einen alten Röhrenfernseher mit Antenne erinnerte, und hatte auf einmal den schalen Geschmack billigen Weins im Mund.
Der säurehaltige Nachhall einer Erinnerung an jene Nacht, in der er sich sinn-, aber nicht grundlos vor dem Fernseher betrunken hatte.
Ben stand von der Bank auf und suchte in seinen Hosentaschen nach dem Autoschlüssel, als er die Schreie hörte.
Angsterfüllt.
Gequält.
Unverkennbar die einer sehr jungen Frau.
2.
Die Schreie kamen vom Parkplatz auf der anderen Seite des Messedamms, direkt an der Stadtautobahn. Von mehreren Plakatwänden eingezäunt, war er schlecht einsehbar. Erst als Ben, seiner Neugierde folgend, die Hälfte der Straße überquert hatte, konnte er sie sehen:
Das Mädchen mit dem gepunkteten Petticoat. Und den Mann, vor dem sie davonlief.
Zumindest versuchte sie es, kam aber nicht weit, weil ihr Verfolger, ein massiv wirkender Pfeiler in Turnschuhen, ihre langen schwarzen Haare zu fassen bekam und sie grob nach hinten riss.
Das Opfer stieß erneut einen spitzen Schrei aus. Sie taumelte nach hinten und schlug auf dem Boden auf. Direkt neben einem Bauwagen, der mit anderen Baustellenfahrzeugen fast den gesamten Parkplatz blockierte. Diese wurden hier für die Großbaustelle am Kaiserdamm abgestellt, an dem ein neues Autohaus entstand. Mit der Folge, dass der sonst so belebte Parkplatz jetzt menschenleer war.
»Hey«, rief Ben, während er, ohne nachzudenken, die Straße überquerte. Sein Ruf wurde von einem Reisebus verschluckt, der hinter ihm hupte.
Der Angreifer zwang das Mädchen, vor ihm in die Knie zu gehen. Wieder packte er sie an den Haaren und riss ihr den Kopf in den Nacken. Er versetzte ihr eine Ohrfeige, die ihr die Brille aus dem Gesicht wischte.
»Hey!«, schrie Ben erneut und begann zu rennen. Der übergewichtige Angreifer sah nicht einmal auf, als Ben ihn erreicht hatte. Völlig unbekümmert spuckte er dem Mädchen ins Gesicht.
Gleichzeitig löste er mit der freien Hand einen Gegenstand aus einem Holster, das er an seinem Jeansgürtel trug.
Verdammt.
Im ersten Moment dachte Ben, es wäre ein Messer, und wartete auf das Blitzen einer Klinge.
Vor seinem geistigen Auge zog sie sich einmal quer über den Hals des Mädchens, und Blut verteilte sich erst über ihrer weißen Rüschenbluse, dann auf dem Asphalt. Aber der Angreifer schien es auf ihre Stirn abgesehen zu haben.
»Loslassen!«, brüllte Ben.
»Was …?«
Der Mann sah kurz auf, und erst da begriff Ben, dass er gar kein Mann war. Eher ein Teenager, wenn auch von massiger Statur, aber kaum älter als achtzehn.
Doch das spielte keine Rolle. Erst letzte Woche hatte ein Fünfzehnjähriger einen Touristen am Alex ins Koma geprügelt.
»Willst du mitmachen?«, fragte er Ben, der nun erkannte, dass der Täter kein Messer, sondern einen schwarzen Textmarker in der Hand hielt. Bizarrerweise schien er sich über die Störung zu freuen, denn er lachte und winkte Ben zu sich heran.
»Komm, die Schlampe braucht das!«
Er hatte kurz gestutzte braune Haare, durch die die Kopfhaut schimmerte, und trug ein Hard-Rock-Café-T-Shirt. Es hing auf Halbmast über einem kalkweißen, schuppigen Bauchstreifen, der sich wie ein toter Fisch über dem Jeansbund wölbte. Seine tiefe Stimme ließ ihn wieder ein, zwei Jahre älter wirken.
Vielleicht war er doch schon zwanzig.
Auf jeden Fall älter als das Mädchen mit dem Petticoat. Sie trug weiße Ballerinas, von denen sie einen auf ihrer Flucht verloren hatte. Ben war sich nicht sicher, meinte aber, bei ihrem Schrei eben eine Zahnspange gesehen zu haben.
»Na dann guck halt nur zu, Alter.«
Selbstbewusst wandte sich der Täter wieder von Ben ab und widmete sich erneut seinem knienden Opfer.
»Ich hoffe, Diana zieht nachher deinen Namen, du Nutte!«
Ben versuchte sich vergeblich einen Reim darauf zu machen.
Das Mädchen wimmerte mit geschlossenen Augen, während der Angreifer ihr etwas auf die Stirn kritzelte.
»Lass sie los!«, sagte Ben. Leise. Drohend.
Der Fischbauch lachte. Schweiß lief ihm in die verkniffenen Augen, als er sich noch einmal kurz zu Ben wandte, ohne die Haare des weinenden Mädchens loszulassen.
»Hey Alter, bleib locker. Alles okay, okay?«
Ben verzog keine Miene. Verschwendete keine Zeit mit coolen Sprüchen oder beruhigenden Worten. Er war ganz ruhig geworden. Schnellte nach vorne und brach dem Kerl die Nase.
Zumindest war das der Plan gewesen.
Die Tatsache, dass er schon seit zwei Jahren kein Fitnessstudio mehr von innen gesehen hatte, sorgte dafür, dass seine Faust nicht mal in die Nähe des Ziels kam.
Der Fischbauch ließ den Zopf des Mädchens los, trat einfach einen Schritt zurück und plazierte bei Ben einen Leberhaken.
Luft entwich aus seiner Lunge wie aus einer zerplatzten Luftmatratze.
»Geht das schon wieder los …«, hörte er jemanden hinter sich sagen, während er zu Boden sackte.
Eine Autotür schlug zu, und da wusste Ben, dass der Fischbauch Verstärkung bekam.
3.
»Wir müssen reden, Papa! Dringend!
Ich glaube, du bist in Gefahr!«
Der Schlag, der ihn so hart getroffen hatte, dass ihm schwarz vor Augen wurde, hatte etwas aktiviert: den Gedanken an Jules letzte Nachricht auf seinem Anrufbeantworter. Als wäre die Erinnerung daran ein Haftzettel, der, unter der Wucht der Erschütterung von seiner Gedächtniswand gelöst, langsam zu Boden schwebte.
Gleichzeitig befürchtete Ben, gänzlich das Bewusstsein zu verlieren. Noch ein weiterer Hieb oder Tritt, und er würde die Welt zwischen Autobahn und dem zentralen Omnibusbahnhof aus der stabilen Seitenlage betrachten müssen.
Im Moment tat er es dem Mädchen neben sich gleich und kniete. In gekrümmter Haltung hustete er den Parkplatz an. Die wenige Luft, die er nach und nach in seine brennenden Lungen zu saugen vermochte, schmeckte nach Dreck und heißem Gummi.
Er hörte eine weitere Autotür schlagen. Noch mehr Schritte.
Fischbauchs Verstärkung wuchs.
Bens Lage war so dermaßen schlecht, dass er beinahe lachen musste.
Ich und den Helden spielen?
Wie so vieles in seinem Leben war auch das eine schlechte Idee gewesen.
Das Mädchen würde ihm keine Hilfe sein, selbst wenn sie jetzt von ihr abließen. Sie war ebenso klein wie dünn und hatte schon Probleme, die Kraft zu finden, sich selbst in eine aufrechte Haltung zu befördern.
Aber bestimmt hatte sie ein Handy.
Vielleicht rief sie die Polizei?
Und wenn …
Ben durfte sich nicht auf fremde Hilfe verlassen. Er musste selbst den Angreifer ausschalten. Irgendwie. Wenn ihm das gelang, würden die anderen wegrennen.
Das taten sie immer.
Er hatte auf genug Festivals gespielt, auf denen alkoholisierte Jugendliche Streit mit den Ordnern gesucht hatten, und er hatte genug randalierende Mitläufer gesehen, die sich in alle Windrichtungen zerstreuten, sobald ihr Anführer außer Gefecht gesetzt war. Kräftemäßig war Ben dazu allerdings jetzt noch weniger in der Lage als zuvor.
Er spürte einen Schatten über sich und hob die Hand in einer instinktiven Abwehrreaktion.
»War ein Reflex«, hörte Ben den Fischbauch zu jemandem sagen.
Dann schlugen Autotüren, und mit dem Geräusch eines startenden Motors wehte ihm eine warme Abgaswolke ins Gesicht.
Sie wollen mich überfahren, dachte er und hob den Kopf. Riss die Augen auf. Versuchte, an den zuckenden Sternen in seinem Blickfeld vorbei das Nummernschild des SUV zu erkennen.
… als ob das irgendetwas bringt, wenn sie dich jetzt plattmachen …
Doch der Wagen fuhr in die andere Richtung. Rückwärts.
Fort von ihm.
Verwundert drehte sich Ben zu dem Mädchen um, das sich aufgerappelt hatte und den Dreck der Straße von ihrem Rock schlug. Sie weinte.
»Hey, Kleine«, sagte er so sanft wie möglich. Er stand auf und näherte sich ihr so zaghaft, wie man auf eine misstrauische Katze zuschleicht.
Aus der Nähe betrachtet, merkte Ben, dass auch ihr Alter schwer zu schätzen war.
Das Mädchen hatte den Körperbau einer Vierzehnjährigen, aber ihre Augen waren älter als seine eigenen. Sie sahen aus, als hätten sie genug Schlechtes für ein ganzes Leben gesehen.
Wie dunkle Einschusslöcher steckten sie in dem eigentlich hübschen Gesicht mit der kleinen Stupsnase sowie den vollen, etwas aufgesprungenen Lippen und einer hohen Stirn, die genug Platz bot für die schwarze Zahl, die der Fischbauch ihr ins Gesicht gemalt hatte.
Etwas verwackelt, die Schleife nicht ganz vollendet, aber deutlich erkennbar eine Acht.
»Wieso hat er dir das angetan?«, fragte Ben.
Er zog sein Handy aus der Hosentasche und überlegte, ob er die Polizei rufen sollte. Eigentlich hatte er keine große Lust dazu. Die 110 lag bei ihm nicht gerade auf Kurzwahl, seitdem sein früherer Vermieter ihn wegen der Rückstände angezeigt hatte. Mit ein Grund, weshalb er keinen festen Wohnsitz hatte und seiner Ex den Unterhalt bar übergab. Sein Dispo war dermaßen im roten Bereich, dass die Bank nach jedem Ausdruck seiner Kontoauszüge die Farbpatronen wechseln musste.
»Ach verdammt«, sprach das Mädchen ihre ersten Worte.
Sie zitterte am ganzen Körper, kein Wunder nach dem, was sie erlebt hatte. Ben wollte ihr die Hand reichen. Sie in den Arm nehmen und ihr sagen, dass alles gut werden würde.
Aber dazu kam er nicht, denn zuvor verwischte sie die Acht mit der Spucke des Fischbauchs in ihrem Gesicht und brüllte ihn an: »Scheiße, Mann! Du schuldest mir hundert Euro!«
4.
Public … was?«
»Disgrace. Public Disgrace«, schimpfte sie, nahm sich ihre Zahnspange aus dem Mund und warf sie auf den Boden zu der Brille, die ihr aus dem Gesicht geschlagen worden war.
Fassungslos beobachtete Ben die wundersame Verwandlung.
Aus dem Mädchen war eine junge Frau geworden. Aus dem Opfer eine wütende Furie.
Öffentliche Demütigung, übersetzte er in Gedanken und verstand immer noch nicht, was sie ihm klarzumachen versuchte.
»Du lässt dich freiwillig so behandeln?«
In der Öffentlichkeit?
Der Wind wehte die Geräusche eines beschleunigenden Motorrads von der Autobahnbrücke her.
»Das ist eine SM-Spielart«, erklärte sie ihm und betonte jedes einzelne Wort, als würde sie mit einem Gehörlosen sprechen. »Noch nie was davon gehört?«
»Nein, tut mir leid. Da hab ich wohl eine Bildungslücke.«
»Hab ich gemerkt.«
Ben wusste, dass es Menschen mit Vergewaltigungsphantasien gab, und er ahnte, dass die Porno-Industrie diesen Trend mit Fetisch-Streifen bediente, die wie zufällig gefilmt auf einem Parkplatz inszeniert wurden. Er hätte nur nie davon geträumt, einmal eine unfreiwillige Nebenrolle in solch einem Film zu spielen.
»Und die in dem Auto, die hatten die Kamera?«
»Ja. Und jetzt sind sie mit meiner Kohle abgehauen, weil du ihnen den Dreh versaut hast, du Arsch.«
Ben rieb sich die Stelle, wo der Fischbauch ihn getroffen hatte, und wurde nun selbst wütend.
»Okay, ich verstehe, dass ihr für solche Filme keine offizielle Drehgenehmigung beantragen könnt. Und ich bin auch ganz bestimmt nicht prüde. Es ist ein freies Land, jeder so, wie er will. Aber, verdammte Axt, was soll das mit der Acht? Ist das ein Erkennungszeichen in der Szene, oder was?«
Sie zuckte mit den Schultern. »War die Idee des bekloppten Regisseurs. Wollte den AchtNacht-Hype ausnutzen, für die Promo.«
Die Frau warf einen Blick auf die Uhr an ihrem Handgelenk und wurde auf einmal nervös.
»Muss nach Hause«, sagte sie und wandte sich ab. »Meine Tochter wartet.«
»Moment mal. AchtNacht?«
Irgendwo hatte Ben das Wort schon einmal gehört. Sein Klang brachte im hintersten Winkel seines Gehirns eine Saite zum Schwingen, hell, kaum wahrnehmbar.
»Was bedeutet AchtNacht?«, fragte er die Frau, die ihn ansah, als wäre sie nicht sicher, ob er sie veräppeln wollte oder schwachsinnig war.
»Alter … «, fragte sie kopfschüttelnd, »… auf welchem Planeten lebst du eigentlich?«
5.
Hey, Papa!«
Jule kam auf ihn zugerannt. Mit windzersausten Haaren, wie damals beim gemeinsamen Strandurlaub auf Juist. Sie lachte und stolperte beinahe über die eigenen langen Beine, dann sprang seine Tochter ihm regelrecht in die Arme. Ben konnte ihr Herz schlagen hören, als er Jule an sich drückte.
»Hey, Kleines«, sagte er.
»Du wolltest mich doch erst morgen besuchen.«
»Freust du dich nicht?«
»Doch. Natürlich. Aber du siehst müde aus. Hattest du einen schweren Tag?«
»Frag bloß nicht.«
Erst hat man mich gefeuert, dann verprügelt.
»Ich hab dich so vermisst«, sagte er mit geschlossenen Augen, und wie immer, wenn er bei Jule war, versuchte er die Außenwelt auszublenden. Das Stimmengewirr auf dem Gang, den Geruch nach Desinfektionsmitteln, das Pumpen des Beatmungsgeräts.
Vergeblich.
Von Besuch zu Besuch schaffte er es immer seltener, sich in seinen Tagträumen am Krankenbett zu verlieren. Meist genügte das Summen der Hydrauliktüren im Flur, um ihn herauszureißen. Heute zog ihn das Klingeln seines Handys in die Realität zurück – eine Realität, in der seine neunzehnjährige Tochter nie wieder auf eigenen Beinen würde laufen können.
Selbst dann nicht, wenn sie aus dem künstlichen Koma erwachte, in dem sie nun schon seit fast einer Woche lag.
»Hey, Jenny«, begrüßte Ben seine Ex-Frau. »Warte bitte einen Augenblick.«
Er legte das Handy zur Seite, gab Jule einen Kuss und hielt ihr ein kleines Taschentuch unter die Nase. Ben hatte es zuvor auf der Patiententoilette mit seinem herben Aftershave eingesprüht, das sie früher so an ihm gemocht hatte. Es hieß, nichts wirkte schneller und gezielter auf das Gehirn als ein bekannter Duft. Vielleicht half ihr das ja beim Aufwachen.
»Sei froh, dass du heute im Bett geblieben bist«, versuchte er zu scherzen. »Ich hab das Gefühl, die ganze Welt ist am Durchdrehen. Muss am Vollmond liegen.«
Dann griff er sich das Telefon vom Kopfkissen. »Was gibt’s?«
»Du bist bei ihr?«
Auf der »Ich bin aufgeregt«-Skala von eins bis zehn rangierte die Stimme seiner Ex-Frau bei einer Zwölf.
»Ja, wo bist du denn?«
Seitdem Jule vor sechs Tagen eingeliefert worden war, hatte ihre Mutter kaum das Krankenhaus verlassen.
»Unterwegs«, wich sie ihm aus, was Ben wunderte. Sie waren zwar getrennt, sich aber immer noch freundschaftlich verbunden. Vielleicht etwas mehr als das.
Ben strich eine schlaffe Strähne von Jules blonden Haaren aus ihrem reglosen Gesicht. Selbst nach einem angeblichen Selbstmordversuch war sie immer noch so schön wie ihre Mutter, daran änderten auch die vielen Schläuche in ihrem Körper nichts.
Wie immer, wenn er sie so sah, haderte Ben damit, dass es keine göttliche Gerechtigkeit gab. Sonst würden die Magensonden und Blasenkatheter in ihm und nicht in seiner Tochter stecken. Immerhin war er schuld daran, dass sie sich vor knapp einer Woche das Leben nehmen wollte.
Alles wäre anders gekommen, hätten sie vor vier Jahren ein Taxi genommen. Aber Ben liebte seinen frisch erstandenen Karmann Ghia; ein rotes VW-Cabrio aus den Sechzigern, und er fuhr es bei jeder Gelegenheit. Leider auch an diesem Tag.
Jule war bei den Aufnahmen in den Hansa-Studios dabei gewesen, und er hatte Jenny versprochen, es rechtzeitig zum Abendessen nach Hause zu schaffen. So kam es, dass Jule vorne saß, während John-John sich auf die hintere enge Sitzbank des Oldtimers quetschte.
John-John, der eigentlich Ulf Bockel hieß, war der neue Manager von Fast Forward und hatte versprochen, sie ganz groß rauszubringen. Er finanzierte das erste Studioalbum und war damit der wichtigste Mann ihrer Band.
Beim ersten Mal dachte Ben noch an ein Versehen, wie Jule vermutlich auch, deren Mund vor Überraschung offen stehengeblieben war.
Beim zweiten Mal verlor Ben die Fassung.
»Du perverses Schwein«, hatte er gebrüllt und sich auf der Leipziger Straße nach hinten umgedreht. Zu dem feist grinsenden Manager, der entschuldigend die Hände hob. Als könnte es irgendeine Entschuldigung dafür geben, die Brüste seiner fünfzehnjährigen Tochter zu kneten.
»Hey, ist doch nur Spaß«, hatte John-John gesagt, dann hatte Jule geschrien, aber es war schon zu spät.
Um der Mutter mit dem Kinderwagen an der Ampel auszuweichen, musste Ben nach links ziehen. Auf die Gegenspur.
Bis heute war nicht geklärt, ob Jule den Gurt nicht richtig hatte einrasten lassen oder ob John-John ihn während seiner Antatschversuche gelöst hatte. Jedenfalls wurde Jule aus dem Wagen geschleudert, als sie frontal gegen den Mercedes stießen.
»Es ist ein Wunder, dass sie noch lebt«, hatten die Ärzte später gesagt. Und ihm ein Merkheft über den Umgang mit schwerstbehinderten Kindern in die Hand gedrückt.
Jules Beine hatten unterhalb der Knie amputiert werden müssen.
Ben hatte sich das Schlüsselbein, John-John leider nur die Hüfte gebrochen. Noch vom Krankenbett aus putschte er Ben aus der Band. Er erklärte den anderen, Ben wäre ein verdammter Irrer, grundlos im Wagen ausgerastet und nicht tragbar für die Gruppe. Ben stellte daraufhin die Band vor die Wahl: Entweder ihr arbeitet mit diesem Verbrecher weiter, oder ihr haltet zu mir.
Und seine »wahren Freunde« zögerten nicht lange. Sie wählten den Mann mit dem Plattendeal und ließen ihn fallen. So einfach war das manchmal.
Jennifer war zu diesem Zeitpunkt noch zu sehr geschockt, um ihn zu verlassen. Selbst als am nächsten Tag das Jugendamt vor der Tür stand und von ihr wissen wollte, ob Ben sich jemals unsittlich ihrer Tochter genähert habe. Denn kurz vor der ersten Operation hatte Jule den Ärzten gesagt: »Er hat mich angefasst.«
Ein Missverständnis, das zum Glück nie an die Presse gelangt war. Später, als sie wieder die Augen öffnen konnte und ihre Unterschenkel nicht mehr fand, vermochte Jule sich an nichts mehr zu erinnern.
Die Tatsache, dass seine Tochter ihm nie die Schuld an ihrem Zustand gab, schickte Ben anfangs in einen fast schizophrenen Teufelskreis der Gefühle. Einerseits hasste er sich selbst für seine Unbeherrschtheit und hatte in seinen dunkelsten Stunden, kurz nach dem Unfall, sogar mit dem Gedanken gespielt, seinem missratenen Leben ein Ende zu setzen. Andererseits verbot ihm ausgerechnet Jules bedingungslose Liebe, sich etwas anzutun, was wiederum dazu führte, dass sein Selbsthass noch stärker wurde, weil er sich sicher war, diese Liebe nicht zu verdienen. Und nun hatte sie sich, vier Jahre nach dem Unfall, selbst etwas angetan.
»Hat sich was verändert?«
»Was?« Ben war in Gedanken so sehr abgedriftet, dass er Jenny beinahe vergessen hätte.
»Entschuldige, was hast du gesagt?«
»Ich wollte wissen, ob die Aufwachphase voranschreitet«, sagte Jennifer, und er liebte das leise Schnarren in ihrer Stimme.
Sie hatte nicht wieder geheiratet, seines Wissens hatte sie nicht einmal einen festen Freund, was er nicht verstehen konnte. Frauen wie Jenny blieben üblicherweise nicht lange allein. Groß, schlank, blond und dabei alles andere als billig. Make-up, künstliche Fingernägel und Push-up-BHs brauchte sie so sehr wie Bill Gates einen Schuldenberater. Und noch viel wichtiger: Sie hatte ein gutes Herz. Ein besseres als er auf jeden Fall, sonst hätte sie ihm nicht so lange zur Seite gestanden, selbst nach der Trennung, als er sein Leben immer schlechter auf die Reihe bekam.
»Laut den Ärzten ist alles im Normbereich. Sie war lange im künstlichen Koma, Jenny. Da dauert es etwas, bis sie sich aus der Narkose kämpft. Wie heißt es immer so schön? Die Medikamente müssen ausgeschlichen werden.«
»Aber so langsam?«
»Ja. Wir können von Glück sagen, dass Jule die OP so gut überstanden hat und nicht länger sediert werden musste. Die Ärzte sind weiterhin optimistisch, dass sie keine bleibenden Schäden davontragen wird.«
Keine weiteren.
»Hm.« Jennifer klang nicht überzeugt, aber auch abgelenkt. »Hattest du heute nicht einen Gig?«, fragte sie.
»Ich wollte lieber Zeit mit Jule verbringen.«
»Schwindel mich nicht an«, sagte Jenny weder unfreundlich noch oberlehrerinnenhaft.
Sie lebten jetzt zweieinhalb Jahre getrennt, und noch immer konnte er ihr nichts vormachen. Jenny reagierte auf winzige Schwankungen in seiner Stimme und wusste stets, wie er sich fühlte und ob er die Wahrheit sprach.
»Na schön, ich hab’s mal wieder versaut. Aber keine Sorge, ich zahl dir den Unterhalt. Noch diesen Monat, ich verspreche es.«
Das Licht der späten Abendsonne fiel schräg durch die Fenster. Die Klimaanlage, falls überhaupt vorhanden, funktionierte nicht richtig. Ben hatte das Gefühl, hier drinnen im Flachbau war es noch heißer als draußen.
Er trat ans Fenster, um es zu kippen, und sah auf die Mittelallee des Virchow-Klinikums im Wedding. Eine Einbahnstraßen-Ellipse mit einer baumgesäumten Flaniermeile in der Mitte. Der »Krücken-Kudamm«, wie ein Pfleger ihn einmal treffend bezeichnet hatte. Statt Gucci- und Chanel-Boutiquen reihten sich die verschiedenen Stationen der Uniklinik aneinander. Und anstelle von Kunden mit Einkaufstüten schoben sich Patienten mit rollbaren Infusionsständern über den Bürgersteig.
»Vergiss das Geld«, hörte er Jenny sagen. Das sagte sie immer, wenn er darauf zu sprechen kam, obwohl sie in ihrem Job als Rechtsanwaltsgehilfin gerade mal genug für Miete und Lebensmittel verdiente. Ben wusste, dass sie sich jeden Cent vom Munde absparte – und das nicht für Urlaub, Wellness oder auch nur den Friseur, sondern für eine völlig neue Prothesengeneration, die in den USA mit Hilfe von Weltraum- und Nanotechnikern entwickelt worden war. Die revolutionären, intelligenten und computergestützten Erfindungen wogen nicht einmal ein Drittel jener Gehhilfen, die die Kasse bezahlte, und kosteten ein Vermögen.
»Deswegen hab ich auch nicht angerufen.«
»Sondern?«
»Ich möchte, dass du herkommst.«
Die Aufregung in Jennys Stimme war zurück. Vielleicht war sie auch nie weg gewesen. Bislang hatte Ben sich nicht auf das Gespräch konzentriert. Das war jetzt anders.
»Wo bist du denn?«, fragte er zum zweiten Mal, und endlich bekam er eine Antwort.
»In Jules Wohnung.«
»Wieso das denn?«
»Ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht hast du recht, und es ist doch nicht alles so, wie es scheint.«
Ben presste das Handy, als hielte er einen Schwamm in der Hand. Seine Knöchel wurden weiß.
»Weißt du, was du da sagst?«, fragte er. Sein Herz fühlte sich unter der Brust an wie eine Faust.
»Ja.« Jenny machte eine Pause, mit der alles gesagt war.
Vielleicht hat Jule doch nicht versucht, sich das Leben zu nehmen.
6.
Jennifer öffnete ihm mit einem nervösen Flackern im Blick. Sie schien zu überlegen, ob sie ihn zur Begrüßung umarmen sollte, drückte dann aber nur seine Schulter und fragte: »Bist du geflogen?«
Von Wedding nach Dahlem brauchte man an guten Tagen eine halbe Stunde. Ben hatte es in zwanzig Minuten über die Avus geschafft.
Mit dem Gefühl, etwas Verbotenes zu tun, betrat er die Studentenwohnung in der Garystraße. In einem modernen vierstöckigen Flachbau hatte Jule das Erdgeschossappartement bezogen, in dem es noch ein wenig nach Farbe, Fugenkitt und frischem Holz roch, das hier vor nicht langer Zeit umfangreich verarbeitet worden war.
Es war Jules Reich. Hier hatte sie zu ihrer Selbständigkeit finden wollen. Raus aus der umsorgten Enge der Köpenicker Familienwohnung, die nach dem Unfall komplett umgebaut worden war: breitere Türzargen, Schalter in Sitzhöhe, ein ausklappbarer Sitz in der Dusche, zahlreiche Haltegriffe, Rampen im Treppenhaus und vieles mehr. Viel Zeit, Kreditgelder und Zuschüsse wurden für die Barrierefreiheit investiert, das meiste davon sinnlos. Denn wie sich herausstellte, konnte Jule sich von Anfang an gut auf Krücken, später mit Prothesen fortbewegen. Neuen Bekanntschaften fiel es manchmal gar nicht auf, dass sie künstliche Beine hatte.
Den Rollstuhl nutzte sie nur in Ausnahmefällen. Wenn sie erschöpft war, die Prothesen schmerzten oder sie sich zum Beispiel nach einem grippalen Infekt zu schwach fühlte, um sich aus eigener Kraft fortzubewegen.
Am Ende aber blieb das renovierte elterliche Heim eine Mahnung. Jede provisorisch überbrückte Bodenschwelle, jeder nachträglich angeschraubte Haltegriff erinnerte Jule täglich aufs Neue, dass diese Wohnung ursprünglich für einen anderen Teenager gedacht war. Ein Mädchen, das sich spätnachts zu ihren Freundinnen rausschleichen wollte, lachend vor dem Badezimmerspiegel tanzte oder wütend gegen die Tür trat, wenn die Eltern ihr den neuen WLAN-Code erst verraten wollten, nachdem die Hausaufgaben gemacht waren.
Als Jule ihnen nach dem Abi den Prospekt der Studi-City zeigte, konnten Ben und Jennifer trotz aller Sorge ihre Begeisterung verstehen.
Das Studentenwohnheim in Dahlem hatte für Menschen mit Behinderungen eigene Gebäude errichtet, mit barrierefreien Wohnungen, in denen vom verstellbaren Waschtisch bis zum tiefer gelegten Backofen an alles gedacht war.
Rolli-Reihenhäuser, wie Jule sie nannte. Als Betroffene durfte sie darüber wohl Witze reißen.
Ihre Bemerkung damals – »Ich muss endlich auf eigenen Beinen stehen« – hatte selbst ihn zum Lachen gebracht. Und auf seinen Einwand hin, das Appartement im Erdgeschoss wäre doch eher für Querschnittsgelähmte gedacht als für jemanden, der gelernt hatte, sein Leben ohne Rollstuhl zu meistern, hatte sie ihn erst todtraurig angesehen und dann gesagt: »Die Wohnung ist für Krüppel. Und ich bin ein Krüppel.«
Aber bevor Ben und Jenny protestieren konnten, hatte sie ihre harten Worte lachend mit einem Witz entschärft: »Außerdem liegt sie fußläufig zur juristischen Fakultät.«
Eine lange Zeit hatte Ben gedacht, der Humor würde Jule besser helfen als jeder Arzt und jeder Psychologe. Die Psychotherapie, die sie anfangs in Anspruch nahm, sollte die depressiven Schübe verhindern oder zumindest abmildern, die Menschen mit einem vergleichbaren Schicksal nach derartigen Verletzungen oftmals heimsuchten. Und es schien zu funktionieren.
Bis Jule vor sechs Tagen beschloss, sich vom Dach ihres Studentenwohnheims zu stürzen.
Oder doch nicht?
»Gibt es hier was zu trinken?«, fragte er mit Blick auf den Kühlschrank und fing sich einen bösen Blick ein.
»Ich meinte Wasser«, schob er nach. Nach der Trennung hatte er sich oftmals bis zur Besinnungslosigkeit volllaufen lassen und mehr als einmal betrunken auf ihren Anrufbeantworter gelallt. Doch seit über einem Jahr war er trocken, abgesehen von dem obligatorischen Besäufnis am Jahrestag des Unfalls. Und von dem Aussetzer nach Jules angeblichem Selbstmordversuch, der ihn heute seinen Job gekostet hatte.
Jenny hielt ein Glas unter die Spüle, aber es kam kein Wasser aus dem Hahn.
»Du musst erst das Licht über dem Herd anmachen«, erinnerte Ben sie an die Macke der Neubauwohnung. Der Elektriker hatte es irgendwie geschafft, die Wasserentkalkungsanlage mit dem Abzugslicht der Dunsthaube zu koppeln, und ohne Strom tröpfelte es nur aus der Leitung. Der Hausverwalter hatte zugesagt, das Problem bis spätestens nächsten Monat beheben zu wollen. Insgesamt schien bei der Elektrik gespart worden zu sein, die Klingelanlage hatte auch hin und wieder ihre Aussetzer.
Jenny reichte Ben das mittlerweile gefüllte Glas, und beide setzten sich an den Küchentisch. Von hier aus hatte man nach vorne einen schönen Blick durch die offene Küche ins Wohnzimmer und nach hinten durch die gläserne Hintertür in den Garten; vorausgesetzt, die Jalousien waren nicht zugezogen, so wie jetzt.
Hier war Jules Lieblingsplatz, hier hatte sie für die Uni gearbeitet oder gechattet. Wehmütig nahm Ben ihr Notebook und verstaute es in der Schublade des Küchentisches, wo Jule alte Rechnungen, Postkarten, Kugelschreiber, Radiergummis, Post-its, aber auch eine Ersatzdose Pfefferspray aufbewahrte. Nachdem sich eine Zeitlang Übergriffe von Neonazis auf Behinderte in U-Bahnhöfen gehäuft hatten, war sie eine Weile ohne das Spray nicht aus dem Haus gegangen.
Auch nicht typisch für jemanden, dem sein Leben gleichgültig ist.
Ben schloss die Schublade, trank einen großen Schluck und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Die gesamte Anlage lag in einem Park, unter alten, Schatten spendenden Ahornbäumen. Dennoch hatte sich selbst der gut gedämmte Neubau in den letzten Tagen aufgeheizt.
Auch an Jenny ging das schwüle Wetter nicht spurlos vorüber. Eine Schweißperle löste sich von ihrem Haaransatz, nahm eine winzige Narbeneinkerbung am Hals als Rollbahn, die von einem Kindheitsunfall auf dem Spielplatz stammte, und verlor sich zwischen ihren kleinen, wohlgeformten Brüsten. Obwohl ihre müden Augen von einem anstrengenden Tag zeugten, roch sie nach Honig und Sommerwiese. Aber vielleicht war das auch nur Bens Wunschdenken, so wie der Gedanke, mit der Schweißperle tauschen zu wollen.
»Erzähl mir noch mal, wie es war, als du sie gefunden hast«, hörte er sie sagen, und das angenehme Gefühl, das er eben noch beim Anblick seiner Ex-Frau gehabt hatte, war verschwunden.
7.
Nun, ich öffnete die Haustür und …«
»Nein!« Jennifer schüttelte den Kopf. »Fang bitte von vorne an. Sie hat das Kontrollgespräch verpasst, richtig?«
Ben nickte, obwohl er die Bezeichnung »Routineanruf« vorzog.
Jule und er hatten vereinbart, dass sie sich einmal pro Woche bei ihm meldete. Die Tage und Uhrzeiten waren jeweils verschieden. Für jene Schicksalsnacht hatten sie sich für acht Uhr abends verabredet. Zwar gab es mehrere Notfalltaster in der Wohnung, die direkt zur Feuerwehr geschaltet waren, aber Ben wollte an ihrer Stimme hören, wie es ihr wirklich ging.
Anfangs hatte Jule sich etwas dagegen gesträubt, wollte sie mit dem Auszug doch gerade ihre Selbständigkeit erlangen. Da passte eine »elektronische Fußfessel« nicht ins Konzept. Schließlich aber hatte sie um des lieben Friedens willen eingewilligt und zudem die Vorteile erkannt, die ein regelmäßiges Wochen-Update für Terminabsprachen mit sich brachte. So konnte sie ihren Vater als Gegenleistung für das wiederhergestellte Seelenheil darum bitten, am nächsten Tag dem Handwerker aufzumachen oder in der Wohnung auf eine Lieferung zu warten, während Jule selbst in der Uni war. Ein Deal, auf den Ben nur allzu gerne einging.
Man hätte meinen können, ihn hätte ihr Auszug nicht so schwer getroffen wie Jenny, denn immerhin wohnte er ja schon länger nicht mehr mit seiner Familie unter einem Dach.
Doch früher hatte Ben seine Tochter sicher in der Obhut ihrer Mutter gewusst, der zuverlässigsten Person im Universum. Nach dem Auszug wusste er sie nur noch in Gefahr.
In seinen Alpträumen hatte er seinen Liebling hilflos auf dem Boden liegen sehen. Auf Händen und Stümpfen kriechend. Krank oder verletzt. Ohnmächtig oder bei vollem Bewusstsein einem Angreifer ausgeliefert. Bedrängt von falschen Freunden und echten Feinden. Männer, die ihre Schutzbedürftigkeit ausnützten.
Ben hatte viele Horrorszenarien in seinem Kopf durchgespielt. Seltsamerweise niemals eines, in dem Jule einfach nicht mehr weiterleben wollte und ihrem Dasein selbst ein Ende setzte.
Hat sie sich deshalb die eigene Wohnung genommen?
In einem Mietshaus mit Fahrstuhl und Flachdach?
War das etwa von Anfang an Teil ihres Plans gewesen?
»Es war kurz nach acht, und sie hatte noch nicht angerufen«, wiederholte Ben das, was er seiner Frau schon mehrmals zuvor gesagt hatte. Doch heute schien Jenny ihm das erste Mal wirklich zuhören zu wollen. Die anderen Male hatte sie ihm immer deutlich zu verstehen gegeben, dass sie kein Interesse an seinen Verschwörungs-Hirngespinsten habe.
»Mach dir doch bitte nichts vor, Ben! Sie hat es selbst getan. Und sie wollte es!«
Jenny hatte zwar nicht direkt »Akzeptier deine Schuld!« gesagt, aber das war auch nicht nötig gewesen. Er hatte es auch so verstanden: Du bist schuld, dass unsere Tochter ihren Körper und damit ihr Leben hasst. Also bist du auch schuld daran, dass sie allem ein Ende setzen wollte.
Ben räusperte sich, trank noch einen Schluck Wasser und fuhr fort: »Normalerweise gebe ich ihr eine Viertelstunde. Manchmal sitzt sie noch in einem Seminar. Oder macht Überstunden in der Handy-Klinik.«
Jenny verzog unwillkürlich das Gesicht. Sie konnte es nicht leiden, dass sich Jule etwas mit der Reparatur von Telefonen dazuverdienen musste. Wenn es nach ihr ginge, sollte sie sich ganz und gar auf ihr Jurastudium konzentrieren können.
»Aber ich hatte ein komisches Gefühl, also fuhr ich schon mal in ihre Gegend. Und rief noch einmal an.«
»Doch sie ging nicht ran?«
»Genau. Ich versuchte es auch mit einem WhatsApp-Call, aber sie war nicht online.«
Und das war ungewöhnlich. Jule war ein Smartphone-Junkie. Vielleicht hatte sie manchmal keine Lust zu sprechen, aber sie war immer im Netz.
»Und dann kam die Nachricht?«
Ben schluckte.
papa bite hilf …
Für Ben ein Hilferuf.
Für die Ermittler auch, aber der einer Selbstmörderin, die auf ihren Versuch aufmerksam machen will.
»Ich bekam die SMS, als ich nur noch eine Ecke von hier entfernt war. Eine Minute später stand ich schon vor ihrer Tür.«
»Hattest du nicht gesagt, sie war verschlossen?«
»Du weißt doch, ich war in Panik, weil sie nicht mehr ans Handy ging. Nicht auf mein Klingeln und Klopfen reagierte. Ich hab einfach den Schlüssel umgedreht. Einmal, zweimal? Vielleicht war sie nur zugezogen, keine Ahnung.«
»Dann bist du rein?«
Er nickte.
»Wir müssen reden, Papa. Dringend!
Ich glaube, du bist in Gefahr.«
Am selben Morgen noch hatte Jule ihm diese Nachricht auf den Anrufbeantworter gesprochen. Er hatte sie viel zu spät abgehört und dann beschlossen, den verabredeten Abendanruf dafür zu nutzen, herauszufinden, weshalb sie sich Sorgen um ihn machte.
Auch etwas, was nicht zusammenpasste und seine Schuldgefühle verstärkte. Hatte all das, was hier passiert war, mit ihm zu tun?
Jenny griff seine Hand, und Ben schloss die Augen. Ihre rein freundschaftliche Geste hatte nicht das zu bedeuten, was er sich wünschte. Aber sie gab ihm Kraft, seine Erinnerungen zu schildern, ohne dass er in Tränen ausbrach.
»Es war so still«, flüsterte er.
Viel zu still.
In Gedanken war es wieder der zweite August, und er hörte nichts als das weiße Rauschen in seinem Ohr.
Jule brauchte Musik, um sich nicht alleine zu fühlen. Wann immer sie zu Hause war, ließ sie die Playlist auf ihrem Notebook durchrotieren. Die Beatsteaks, Goo Goo Dolls, 30 Seconds to Mars, Biffy Clyro. Vorwiegend Rocksongs. Sie hatten den gleichen Geschmack.
Doch an jenem Abend herrschte Totenruhe in der Wohnung. Obwohl sie zu Hause war, was Ben an dem Schlüsselbund erkannte, der ordentlich am Haken neben der Tür hing.
»Jule?«, rief er, und schon da war seine Stimme voller Angst. Er fühlte einen Druck auf den Ohren, als säße er in einem Flugzeug, das gerade in ein Luftloch gesackt war.
Mit angehaltenem Atem folgte er dem Licht.
Die Hintertür von der Küche zum Innenhof stand offen.
Wie eine Einladung zu einem Schlachtfest, dachte er noch, ohne zu wissen, wie er auf diesen morbiden Gedanken kam. Wahrscheinlich nahm sein Gehirn bereits die Bilder vorweg, die sich seinen Augen zeigen würden:
Der umgekippte Rollstuhl. Verbogen am Boden liegend. So wie Jule. Bäuchlings, die Arme absurd verdreht, den Kopf im Matsch, als lauschte sie mit einem Ohr das Erdreich ab. Blut, das ihr aus dem Mund lief.
Und dann waren da ihre Augen.
Das eine, das Ben sehen konnte, als er langsam auf sie zuging. Es schrie ihn an. So qualvoll und dennoch unerhört, wie der Mund auf dem Gemälde von Edvard Munch.
Ist sie gesprungen, als ich aus dem Wagen stieg?
Ben stöhnte auf, stolperte zu ihr, sackte neben ihr auf die Knie und wagte es nicht, sie anzufassen. Wollte nicht einmal ihre Bluse berühren, die von dem Blut getränkt war, das irgendwo aus ihrem Körper trat.
Wie sein Mobiltelefon in seine Finger gelangt war und er es geschafft hatte, die Feuerwehr zu rufen, hätte Ben im Nachhinein nicht zu sagen vermocht.
»Du hast sie nicht angerührt?«
Jennys Frage riss ihn wieder in die Gegenwart. Ben öffnete die Augen und trank einen weiteren Schluck aus dem Wasserglas. »Ich wusste nicht, was zu tun ist. Ich dachte, ich mache es vielleicht schlimmer, wenn ich sie bewege.«
Die Notärzte hatten später seine Umsicht gelobt, dabei war er einfach nur paralysiert gewesen.
»Okay, und jetzt erklär mir, weshalb du das rechtsmedizinische Gutachten anzweifelst?«
Er seufzte.
»Nun, wo soll ich anfangen? Die geöffnete Wodkaflasche auf dem Couchtisch? Ich bitte dich. Jule hat Alkohol gehasst. Nicht mal zu Silvester wollte sie anstoßen. Sie hätte sich niemals diese Flasche gekauft.«
»Es sei denn, sie wollte sich Mut antrinken.«
»Um sich dann in den Rollstuhl zu setzen, mit dem Fahrstuhl aufs Dach zu fahren und sich von dort aus vier Stockwerke tief nach unten zu stürzen?«
Zum Glück hatte es die Nächte davor geregnet, und der Erdboden war völlig durchweicht. Das hatte ihr vermutlich das Leben gerettet.
Sie hatte einen Schädelbasisbruch und innere Verletzungen. Das Gehirn war angeschwollen, weswegen man sie in eine dauerhafte Narkose versetzen musste. Aber die OP war gut verlaufen und die Prognose der Ärzte positiv, dass sie schon bald und hoffentlich ohne Spätfolgen aus dem künstlichen Koma erwachen würde.
»Wieso macht Jule es sich so schwer und rollt in den Tod? Sie hätte doch auch mit ihren Prothesen springen können.«
Jenny schüttelte den Kopf. »Du weißt, die Dinger waren ihr oft lästig. Und vielleicht wollte sie mit dem Rolli ein Zeichen setzen.«
Sie spielte weiter den Advocatus Diaboli.
»Das rechtsmedizinische Gutachten ist eindeutig.«
»Es ist falsch«, sagte Ben, ohne einen Beweis für seine These zu haben. Auch die hohe Opioid-Konzentration in Jules Blut lieferte den Forensikern keinen Hinweis auf eine böswillige Fremdeinwirkung, hatte ihr der Notarzt doch noch vor Ort ein Gegenmittel gespritzt.
»Sie ist nicht freiwillig gesprungen«, beharrte Ben trotz der gegenteiligen Beweislage.
Jenny rollte nicht mit den Augen wie einst, wenn er ihr widersprach, und er fuhr fort: »Wenn Jule sich angeblich Mut angetrunken hat, wie du sagst, wieso konnte man dann nichts in ihrem Blut nachweisen?«
»Du weißt nicht, wie viel Zeit vergangen ist«, sagte Jenny.
Zwischen Trinken und Fallen.
»Und wann die Blutprobe genommen wurde. Julchen wurde stundenlang operiert, da war vielleicht schon alles abgebaut.«
Ben biss sich auf die Unterlippe.
Nein, nein, nein.