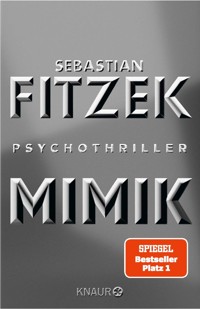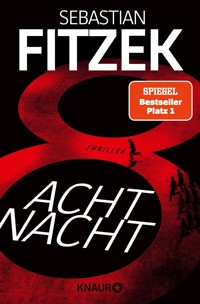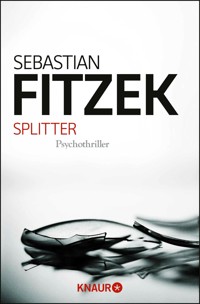9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein bahnbrechend-innovativer Psychothriller von Sebastian Fitzek, der das Böse zum Klingen bringt – und ein Wiedersehen mit Alina Gregoriev und Alexander Zorbach aus »Der Augensammler« und »Der Augenjäger«! Musik ist ihr Leben. 15 Songs entscheiden, wie lange es noch dauert. Vor einem Monat verschwand die 15-jährige Feline Jagow spurlos auf dem Weg zur Schule. Von ihrer Mutter beauftragt, stößt Privatermittler Alexander Zorbach auf einen Musikdienst im Internet, über den Feline immer ihre Lieblingssongs hörte. Das Erstaunliche: Vor wenigen Tagen wurde die Playlist verändert. Sendet Feline mit der Auswahl der Songs einen versteckten Hinweis, wohin sie verschleppt wurde und wie sie gerettet werden kann? Fieberhaft versucht Zorbach das Rätsel der Playlist zu entschlüsseln. Ahnungslos, dass ihn die Suche nach Feline und die Lösung des Rätsels der Playlist in einen grauenhaften Albtraum stürzen wird. Ein gnadenloser Wettlauf gegen die Zeit, bei dem die Überlebenschancen aller Beteiligten gegen Null gehen ... Das Besondere an »Playlist« ist, dass es Felines Musik wirklich gibt. »Playlist« ist eine einzigartige Verbindung aus Musik und Text des Bestsellerautors Sebastian Fitzek und nationalen und internationalen Top-Künstler*innen: Auf der Playlist zu "Playlist" finden sich 15 exklusive und noch unveröffentlichte Songs von Künstlern wie Rea Garvey, Silbermond, Beth Ditto, Kool Savas, Johannes Oerding, Lotte, Alle Farben, Tim Bendzko und vielen mehr. Die Audio-Playlist zum Thriller »Playlist« gibt es als CD, Vinyl, Download und Stream. "Man sagt mir ja eine gewisse Phantasie nach, aber dass dieses Projekt am Ende so fantastische Ausmaße annehmen würde, hätte ich mir selbst in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können. 15 Stars der nationalen und internationalen Musikszene haben den Schlüsselinhalt meines neuen Psychothrillers real und »Playlist« damit zu meinem bislang außergewöhnlichsten Buchprojekt werden lassen." - Sebastian Fitzek
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 440
Veröffentlichungsjahr: 2021
Sammlungen
Ähnliche
Sebastian Fitzek
Playlist
Psychothriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Vor einem Monat verschwand die 15-jährige Feline Jagow spurlos auf dem Weg zur Schule. Von ihrer Mutter beauftragt, stößt Privatermittler Alexander Zorbach auf einen Musikdienst im Internet, über den Feline immer ihre Lieblingssongs hörte. Das Erstaunliche: Vor wenigen Tagen wurde die Playlist verändert. Sendet Feline mit der Auswahl der Songs einen versteckten Hinweis, wohin sie verschleppt wurde und wie sie gerettet werden kann? Fieberhaft versucht Zorbach das Rätsel der Playlist zu entschlüsseln. Ahnungslos, dass ihn die Suche nach Feline und die Lösung des Rätsels der Playlist in einen grauenhaften Albtraum stürzen wird. Ein gnadenloser Wettlauf gegen die Zeit, bei dem die Überlebenschancen aller Beteiligten gegen Null gehen ...
Inhaltsübersicht
Hinweis 1
Hinweis 2
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
79. Kapitel
80. Kapitel
81. Kapitel
82. Kapitel
83. Kapitel
84. Kapitel
85. Kapitel
Zum Buch
Danksagung
Das Quiz für dein nächstes Fitzek-Abenteuer
Leseprobe »Der Nachbar«
»Playlist« nimmt Bezug auf die Romane »Der Augensammler« (erschienen 2010) und »Der Augenjäger« (erschienen 2011) und schließt zeitlich an »Der Augenjäger« an. Zum Lesen von »Playlist« sind aber keinerlei Vorkenntnisse notwendig, es ist ein völlig eigenständiges Werk. Falls Sie jedoch »Der Augensammler« und »Der Augenjäger« bereits in Ihrem Regal stehen und noch nicht gelesen haben, könnten Sie das zum Anlass nehmen, dies vorab zu tun.
Alle in diesem Buch erwähnten Songs auf Felines Playlist gibt es wirklich. Sie wurden extra für diesen Thriller komponiert. Inspiriert von der Geschichte haben die Künstlerinnen und Künstler mit ihrer Musik und ihren Texten wiederum die Handlung dieses Buches maßgeblich beeinflusst.
Für Ben (Keyboard), Jörg (Bass) und Jacques (Gitarre) – die vor so langer Zeit mit mir den Traum geträumt haben und leider irgendwann von der Realität eingeholt wurden. Wir sollten uns dringend wieder treffen. Bandprobe?
1
Exakt um 18 Uhr 42, drei Wochen, zwei Tage und neun Stunden nachdem seine Tochter spurlos auf ihrem Schulweg verschwunden war, klingelte es zweimal an der Haustür, und Thomas Jagow musste erfahren, dass das menschliche Grauen keine Belastungsgrenze kennt. Darauf, dass man sich selbst am Ende des Erträglichen angekommen glaubt, nimmt das Schicksal keine Rücksicht.
»Hallo?«, fragte er in die Leere des verwaisten Vorgartens.
Sie lebten seit drei Jahren in Nikolassee, in einer für sie viel zu teuren Gegend, allerdings in einem kleinen Bungalow, der für eine dreiköpfige Familie gerade passend war. Zwischen den hochherrschaftlichen Villen stand der graue Flachdachbau etwas schüchtern am Rand der Rehwiese und wäre von wohlhabenden Käufern sicher dem Erdboden gleichgemacht worden, um hier einen der Siedlung angemessenen Luxusneubau zu errichten. Anfangs, als Thomas noch Hoffnungen gehabt hatte, zum Schulleiter des Grunewalder Privatgymnasiums aufzusteigen, an dem er Erdkunde und Physik unterrichtete, hatten auch sie davon geträumt. Doch dann war der Posten anderweitig besetzt worden, und seitdem stagnierten seine Bezüge. Zusammen mit dem Krankenschwesterngehalt seiner Frau Emilia reichte das Geld gerade so, um die Kreditraten plus Nebenkosten zu tilgen, wenn am Monatsanfang noch genügend Geld für die normalen Bedürfnisse des Lebens vorhanden sein sollte. Wobei die mittlerweile fünfzehnjährige Feline in der Familienbilanz den größten Kostenfaktor darstellte. Allein ihre Ausgaben für Kleidung, Schuhe und Sportsachen hatten sich von Jahr zu Jahr verdoppelt. Bis sie von einem Tag auf den anderen auf null fielen.
Bis zu ihrerEntführung, dachte Thomas, der sich immer noch an den Gedanken klammerte, dass irgendwann ein Anruf mit der Lösegeldforderung käme. Dabei wusste er selbst, wie unwahrscheinlich das war. Bei den Jagows gab es nichts zu holen. Nichts Ererbtes, nichts Erspartes. Das sah man schon von außen.
»Am Garten erkennt man den wahren Reichtum der Leute«, pflegte seine Mutter zu sagen, und wenn sie damit recht hatte, dann waren die Jagows arme Schlucker, denn im Unterschied zu ihren Nachbarn konnten sie ihren Garten nicht regelmäßig von Landschaftsdesignern zu einem Naturkunstwerk formen lassen. Während bei den Heussners gegenüber die Hecken und Buchsbäume so aussahen, als wären sie von einem 3D-Drucker geschnitzt worden, verteilte sich bei ihnen das Herbstlaub auf Rasen und Gehweg bis vor die Haustür, die Thomas gerade geöffnet hatte.
Eine Ansammlung größerer Lindenblätter hatte es bis zum Fußabtreter vor dem Bungalow geschafft, weswegen Thomas beinahe den Ziegelstein übersehen hätte. Erst als er einen Schritt in den Nieselregen tat, der für das typische Berliner Oktober-Suizid-Wetter sorgte, trat er mit dem Fuß gegen das rote, buchgroße Hindernis.
Thomas wunderte sich über den Fremdkörper. Er beugte sich hinunter und bemerkte einen angeklebten Zettel. Der Tesafilm fand auf der porösen Struktur des Steines keinen sicheren Halt. Mit der nächsten Windböe wäre der Zettel vermutlich fortgerissen worden, und dann hätte er vielleicht nie den Hinweis gelesen. Handschriftlich verfasst, dem Schriftbild nach von einem jungen Mädchen:
Ich bin wieder da, Papa.
2
Thomas verharrte kniend vor dem Stein. Die Finger zitterten, eine Hitzewelle durchflutete seinen Körper, als wäre er nicht ins Freie, sondern vor einen Heizstrahler getreten.
Was hat das zu bedeuten?
Er sah sich um, ohne sich aufzurichten. Niemand in Sichtweite. Dabei konnte es sich doch nur um einen grausamen Klingelstreich handeln – von einem der Nachbarskinder, die erst von den klassischen Medien, dann über die sozialen Netzwerke mit gruseligen Details zu Felines Entführung unterhalten worden waren.
Thomas löste den Zettel mit zittrigen Händen, dabei wackelte der Ziegelstein. Er drehte ihn um und fand eine zweite Nachricht, noch mysteriöser als die erste.
Sie bestand aus einem Gegenstand, einem kleinen Schlüssel, der ihn an Emilias Kofferschlüssel erinnerte. Auch dieser war lediglich mit einem kleinen Tesastreifen befestigt. Er fiel Thomas beinahe in die Hände, als er den Stein hochhob.
Was geht hier vor?
Thomas, noch immer kniend, drehte sich zur Haustür, die der Wind hinter ihm weit aufgestoßen hatte, und überlegte, ob er Emilia zu sich rufen sollte. Seine Frau hatte gerade erst ihre Abendvalium genommen, der wie so oft eine Spätpille folgen würde, wahrscheinlich gegen Mitternacht; mit etwas Glück fand sie ab zwei Uhr morgens für einige Minuten etwas Schlaf, bevor die Sorgen um Feline sie wieder weckten und in einen weiteren Tag der schrecklichen Ungewissheit entließen.
Thomas beschloss, der Sache vorerst alleine auf den Grund zu gehen. Er war sich sicher, hinter dem Gartentor auf kichernde Grundschüler zu treffen, die weglaufen würden, sollte er sie zur Rede stellen wollen.
Der Gartenweg verlief etwas abschüssig. Hohe, immergrüne Hecken versperrten die Sicht zum Bürgersteig. Normalerweise war das verwitterte Holztor geschlossen, doch jetzt quietschte es vom Wind bewegt in den Angeln. Thomas’ Gelenke knackten, als er sich aufrichtete und die Pfeile entdeckte.
Drei Stück, etwa zehn Zentimeter lang, einer von ihnen mittlerweile schon fast vollständig vom Laub bedeckt. Sie waren mit roter Spielkreide auf die Kieselwaschbetonsteine gemalt und zeigten Richtung Gartenpforte.
Ein Wegweiser?
Die erste Erregung war verschwunden, jetzt fraßen sich Kälte und Nässe durch Thomas’ dünne Kleidung, als er den Pfeilen folgte. Es hätte ihm nichts ausgemacht, tagein, tagaus dieselbe Chino-Hose und dasselbe langärmlige Poloshirt zu tragen wie an dem Tag von Felines Verschwinden. Thomas kostete es unendlich viel Kraft, auf sein Äußeres zu achten, in einer Zeit, in der Äußerlichkeiten jeden Wert für ihn verloren hatten. Aber er durfte nicht zulassen, dass er ungepflegt aussah und ihm die dunklen, lockigen Haare ungebändigt vom Kopf standen. Nicht, wenn die Öffentlichkeit ihn unter dem Brennglas betrachtete, das die Medien ihren sensationslüsternen Nutzern vorhielt. Man würde es ihm negativ auslegen, wenn er sich gehen ließe. Allerdings auch, wenn er wie ein Werbemodel für dunkle Anzüge herumlief, weswegen er, wann immer er vor die Tür ging, ein möglichst schlichtes, aber gepflegtes Outfit auswählte. Blaues Hemd, schwarze Jeans.
Tag für Tag.
Seit Felines Entführung.
Wenn es denn eine war.
Hoffentlich.
Thomas öffnete die Gartentür und trat auf den menschenleeren Bürgersteig. Seine Füße steckten in Hausschuhen, in die er geschlüpft war, als es unerwartet geklingelt hatte. Seine Socken schienen die Feuchtigkeit, die durch die Filzsohlen drang, wie ein Schwamm aufzusaugen. Als wäre er jetzt schon erkältet, fühlte er sich fiebrig, was auch an der surrealen Situation liegen mochte, in die er im wahrsten Sinne des Wortes gerade hineinstolperte. Fast wäre er auf abgefallenen Kastanienhülsen ausgerutscht.
Die gepflasterte Straße war so breit, dass Autos bequem auf beiden Seiten hätten parken können, doch die wenigen Hausbesitzer hatten sich abgesprochen, nur auf einer Straßenhälfte zu stehen. Und zwar auf der, die ihrem Bungalow gegenüberlag. Selbst ohne diese inoffizielle Regelung wäre Thomas der Kastenwagen aufgefallen, der entgegen der nachbarschaftlichen Etikette etwa zwei Meter entfernt auf der »falschen« Seite parkte.
Er war grau oder weiß, wegen der starken Verschmutzung war das nicht zu sagen. Seine hintere Flügeltür hatte etwas mit dem Gartentor zum Bungalow gemein: Sie war nicht verschlossen, sondern angelehnt.
Es war nur ein schmaler Spalt, aber so deutlich zu erkennen wie die Tatsache, dass ein Nummernschild fehlte.
»Hallo?«, rief Thomas erneut und völlig sinnlos. Als würde sich ihm jemand, der sich – aus welchen Gründen auch immer – die Mühe dieser merkwürdigen Inszenierung gemacht hatte, einfach so zu erkennen geben und hinter einem Alleebaum hervorspringen.
Thomas lief zu dem Wagen und ging zunächst einmal um ihn herum. Dann spähte er ins Fahrerhäuschen. Niemand saß hinter dem Steuer. Kurz entschlossen öffnete er die Hintertür des Kastenwagens. Dabei hielt er den linken Ellenbogen abwehrend vor den Kopf, falls jemand ihn anspringen und sofort auf ihn einschlagen würde.
Doch es waren weder Fäuste noch Waffen, die ihn verletzten. Es war ein einziges Wort, das ihn traf und aus dem Gleichgewicht brachte, als hätte sich der Boden unter ihm aufgetan: »Papa?«
3
Er konnte es nicht glauben. Befürchtete zu halluzinieren. Doch es war in der Tat die Stimme seiner Tochter. Und auch die Gestalt, die in der rechten hinteren Ecke des Kastenwagens in der Dunkelheit kauerte, erinnerte ihn an Feline. Schlank, für ihr Alter mit ein Meter fünfundsechzig normal gewachsen, schulterlange Haare, die dem Mädchen ins Gesicht fielen.
»Feline?«
»Papa?«
Oh, Gott.
»Feline, bist du es?«
Eine Zeit lang redeten sie vor Aufregung aneinander vorbei. Und obwohl Thomas seine Tochter mittlerweile eindeutig identifiziert hatte, konnte er es nicht glauben. Er fühlte sich wie in einem Fiebertraum.
Bitte, lass mich nicht aufwachen. Bitte, lass mich Feline gleich in die Arme schließen, dachte er, während er in den Wagen stieg.
Es gab kein Licht, der Transporter war genau zwischen zwei Straßenlaternen geparkt, nur Reste der ohnehin schwachen Beleuchtung fanden ihren Weg ins Innere, das nach Staub, Werkzeugen und Angstschweiß roch.
Thomas schlug sich das Knie beim Einstieg an, doch der Schmerz war nichts im Vergleich zu dem Glücksgefühl, als er sein Mädchen in die Arme schloss.
Die Fünfzehnjährige, die unter der Glocke aus Angst und Verzweiflung noch immer so roch wie seine Tochter. Sich noch immer so anfühlte wie sein Kind, selbst durch das grobe Stoffhemd hindurch, in dem sie steckte. Ihre Konturen passten immer mehr zu der Stimme, die er so lange vermisst und von der er in seinem tiefsten Inneren geglaubt hatte, sie nie mehr wieder hören zu dürfen: Feline!
»Papa, bitte mach mich los.«
Er hielt sein geliebtes Kind fest in den Armen, atmete mit ihr im Gleichklang, war so gefangen von diesem Moment, dass er kurz brauchte, um zu verstehen, was sie ihm sagen wollte.
»Losmachen?«
Jetzt erst wurde ihm klar, weswegen sie seine Umarmung nur mit einer Hand erwiderte. Ihre Rechte war gefesselt. Der Arm zeigte ausgestreckt nach oben. Er hörte ein metallisches Scheppern, als sie ihn bewegte.
Handschellen.
Offenbar war sie an eine Metallverstrebung unter der Transporterdecke gekettet. Sie hing an einem kleinen, aber unnachgiebigen Rohr.
Handschellen?
Mit einem Mal war Thomas klar, wozu er den Schlüssel benutzen sollte, den er unter dem Stein gefunden hatte. Er hatte ihn in das kleine Uhrentäschchen gesteckt, das aus rein optischen Gründen die Vordertasche fast jeder Jeans zierte. Tatsächlich schien er zu passen, wie er feststellte, als er ihn nach einer gefühlten Ewigkeit mit tauben Fingern hervorgeklaubt und in das Schloss der Handschelle gesteckt hatte.
»Bitte, beeil dich, Papa! Ich hab solche Angst!«
»Alles wird gut, mein Schatz. Alles wird gut.«
In dem Moment, in dem er den Schlüssel herumdrehen wollte, setzte der melancholische Gesang ein. Sein Herz fühlte sich an, als wollte es sich mit einem Schlag durch die Brust drücken, und vor Schreck ließ Thomas den Schlüssel fallen.
»Oh, nein, tut mir leid«, stammelte er, und seine Worte wurden nun sowohl von Felines Schluchzen als auch von der Musik verschluckt, die Thomas erst als den Klingelton eines Handys identifizierte, als er das wild blinkende Telefon vom Boden des Transporters aufhob.
»Tut so weh, dass nach so langer Zeit nichts von uns bleibt«, hörte er die brüchige Stimme eines zutiefst traurig klingenden Mannes singen.
Auf dem Display des Smartphones las er einen Befehl:
GEH BESSER RAN, THOMAS!
Was geht hier vor?
Thomas überlegte, ob er den Anruf ignorieren konnte. Er wollte nach dem Schlüssel auf der Ladefläche suchen, Feline befreien und sie zurück zu dem Ort bringen, an dem sie einst glücklich gewesen waren.
Natürlich schrie alles in ihm danach, den Anruf und die herzzerreißende Musik einfach wegzudrücken, bis auf eine einzige, durchdringende innere Stimme, die ihn an das Offensichtliche erinnerte: Jemand, der sich solche Mühe gibt und Zettel, Steine, Schlüssel und Kreidezeichnungen platziert, lässt dich nicht einfach so entkommen!
GEH BESSER RAN, THOMAS!
Und deshalb folgte er dieser Anweisung. Und beging damit den größten Fehler seines Lebens, als er den Anruf entgegennahm, kurz nachdem der Sänger »Leb wohl« gesagt hatte.
»Hallo?«
Die Stimme am anderen Ende sagte nur wenige Sätze. Worte, die Thomas zunächst den Atem raubten. Dann den Verstand. Am Ende war seine Seele vergiftet.
»Papa?«, fragte Feline, die noch immer an das Rohr gefesselt war.
Er sah sie an. Dankbar, dass sie sich in dem Halbdunkel nicht direkt in die Augen blicken konnten.
»Es tut mir leid«, flüsterte Thomas und legte das Handy zurück auf den Fahrzeugboden.
»Was meinst du?«, fragte Feline. Ihre Stimme war löchrig. Sie klang wie von einem Kassettenrekorder abgespielt, dessen Tonband schon Jahrzehnte alt war. »Was tut dir leid?«
Sie wurde lauter und hörte sich dennoch entsetzlich kraftlos an. Als hätte sie schon viel zu viel ertragen und würde ihr Schicksal keine Sekunde länger aushalten.
Thomas zerriss es nicht nur das Herz. Es zerriss ihm den gesamten Verstand, und dennoch konnte er nicht anders.
»Es tut mir so leid, mein Schatz.«
Sie griff mit der freien Hand nach ihm, doch er wusste, sie durfte ihn jetzt nicht berühren, sonst wäre alles vorbei. Sonst würde er wanken und könnte nicht stark sein. Und übermenschliche Stärke war es, die er jetzt aufbringen musste.
»WAS TUT DIR LEID???«, brüllte sie ihn an mit der allerletzten Kraft eines Menschen, der sich dem Tod geweiht fühlt.
Und genau das ist sie, dachte Thomas. Er wandte sich von ihr ab, drehte sich um und stieg wieder aus dem Transporter.
»Papa, was tust du? Nein. Bitte nicht! Lass mich nicht allein.«
Thomas perlten die Tränen aus den Augen, dicker als die Tropfen, die jetzt auf das Dach des Transporters ploppten. »Ich liebe dich, mein Engel«, sagte er und schloss die Tür. Kaum war das geschehen, startete der Motor des Fahrzeugs, die Rücklichter flackerten kurz auf, und der Kastenwagen setzte sich in Bewegung. Nahm ihm das, was er liebte, und ließ ihn mit nichts als Schmerz zurück.
»LASS MICH NICHT ZURÜCK!!!«
Thomas wankte, buchstäblich. Auf seinem Rückweg vergaß er zu atmen, hielt sich hyperventilierend an einer Kastanie fest. Der Aufstieg zurück zum Bungalow kostete ihn mehr Kraft als ein Marathon.
Zum Glück war der Regen stärker geworden, weswegen er seiner Frau, die ihn mit banger Miene in der Diele empfing, wenigstens die Tränen nicht erklären musste.
»Was hast du da draußen gemacht?«, fragte Emilia und musterte ihn argwöhnisch. Starrte auf seine triefenden Haare, die nassen Hosen, die vom Regen dunkel durchweichten Hausschuhe. »Was war los?«
»Nichts«, sagte Thomas und wich beschämt ihrem Blick aus.
Er schloss die Tür und hatte das Gefühl, damit all sein Lebensglück für immer auszusperren.
»Nur ein Paketbote«, sagte er tonlos. »Hat sich in der Hausnummer geirrt.«
Besser ruf 9-1-1, 1-1-0,
weil dich sonst niemand sucht.
Oder sag bye-bye zu dei’m Life,
auf dass du in Frieden ruhst.
MAJAN – Junkie
4
Alexander ZorbachDrei Tage später
Die Schnittwunden in der Haut des dreizehnjährigen Mädchens waren mit geübter Hand ausgeführt. Das verkrustete Blut war frisch, nicht einmal zwei Tage alt. Ebenso der faustgroße Bluterguss und das Loch, das die ausgedrückte Zigarette auf dem Oberschenkel hinterlassen hatte.
»Ist Ihnen jetzt klar, mit was für einem perversen Schwein wir es zu tun haben?«, fragte Klaus Althof. Seine Unterlippe zitterte vor Hass, dennoch bemühte er sich zu flüstern, was gar nicht nötig war, denn seine Tochter Antonia war auf ihrem Zimmer außer Hörweite. »Der Irre hatte bestimmt Spaß daran. Schauen Sie sich das doch einmal an!«
Die Aufforderung des Vaters war unnötig. Ich konnte gar nicht anders, als auf die schrecklichen Fotos zu starren, die Antonias Verletzungen dokumentierten, und haderte mit meinem Schicksal.
Mittlerweile glaubte ich, alles Übel der Menschheit rührte daher, dass uns die Antwort fehlte. Die Antwort auf die Frage: »Wieso lebe ich?« Und damit meinte ich nicht die von Philosophen und Naturwissenschaftlern seit Anbeginn unseres Bewusstseins diskutierte Frage nach dem allgemeinen Sinn. Mir hätte eine individuelle, nur auf mich bezogene Antwort ja schon ausgereicht: »Wofür bin ich, Alexander Zorbach, neununddreißig Jahre alt, ein Meter fünfundachtzig groß, zweiundneunzig Kilo schwer, eigentlich hier auf dieser Welt?«
Diente mein Leben einem übergeordneten Zweck? Oder war meine Existenz eine bedeutungslose Laune des Universums? War es sinnvoll, dass ich als Polizist versucht habe, anderen Menschen das Leben zu retten, bis ich eine wahnsinnige Frau erschießen musste, die ein von ihr aus dem Krankenhaus entführtes Baby von einer Autobahnbrücke werfen wollte?
Würde es irgendwo irgendwann eine höhere Instanz geben, die mich dafür lobte, meine Lebenszeit im Anschluss an den Polizeidienst als Investigativjournalist genutzt und ein Kind aus den Fängen eines bis heute noch nicht gefassten Serienmörders gerettet zu haben? Oder würde ich von jenem höheren Wesen, das die Spielregeln unseres Daseins festlegt, am Ende meines Lebens ausgelacht werden, weil ich in dem Bemühen, fremde Menschen zu retten, meine eigene Familie zerstört und einen Unschuldigen versehentlich getötet habe? Denn zumindest das stand fest: Hätte ich mich mehr gekümmert, würde meine Frau noch leben und mein mittlerweile dreizehnjähriger Sohn Julian nicht jede Nacht von Albträumen aus dem Schlaf gerissen.
»Die Misshandlung Ihrer Tochter geschah an diesem Wochenende?«, fragte ich, noch immer die Polaroids in der Hand.
»Ganz genau«, bestätigte Christine Höpfner, die Nachbarin des aufgeregten Vaters, die ich sehr respektierte. In den letzten Jahren, in denen sie mich als Strafverteidigerin vor Gericht durch die Instanzen vertreten hatte, waren wir uns vielleicht nicht freundschaftlich nähergekommen, aber es hatte sich ein Vertrauensverhältnis eingestellt, das über das Professionelle hinausging. Wie das halt so ist, wenn man Stunden um Stunden mit einem Menschen verbringt, in dessen anwaltliche Hände man sein Schicksal legt.
»Könnten Sie mir einen Gefallen tun?«, hatte Christine mich kürzlich gefragt. »Es geht um einen guten Bekannten.« Ich hatte gar nicht anders gekonnt, als mich ihrer nachbarschaftlichen Probleme anzunehmen. So viel hatte sie schon für mich getan. Also hatte ich mich hier und heute auf das Treffen eingelassen.
Wir saßen uns an einem antiquiert wirkenden und bestimmt sündhaft teuren Landhaustisch im Esszimmer gegenüber, nachdem ich zuvor kurz mit Antonia alleine auf ihrem Zimmer hatte reden dürfen.
Während Christine Höpfner auch in ihrer Freizeit darauf achtete, dass man ihr den durch exzellente Anwaltsarbeit erarbeiteten Wohlstand nicht ansah, legte ihr Nachbar mit einer klobigen Markenuhr und einem Oberhemd mit auffälligem Markenlogo weniger Wert auf Zurückhaltung.
»Seit wann hat Ihre Ex-Frau diesen neuen Freund?«, fragte ich Althof.
»Seit etwa einem halben Jahr.«
»Sie teilen sich das Sorgerecht?«
»Ich bin die Hauptbezugsperson. Bei Astrid ist Antonia nur jedes zweite Wochenende.«
Ich nickte. »Und ist Ihre Tochter schon häufiger mit solchen Verletzungen zurückgekommen?«
Klaus sah mich ungnädig an. »Ich untersuche nicht jedes Mal ihren Körper nach Auffälligkeiten, Herr Zorbach. Ich habe es nur mitbekommen, weil mich Antonias beste Freundin darauf aufmerksam gemacht hat. Fenya hat hier übernachtet und die Verletzungen gesehen. Aber ja, Antonia hat sich nach den Besuchswochenenden immer seltsam benommen. Jedenfalls seit Norman. Und letztes Wochenende musste meine Ex zu einer Fortbildung, sie war also lange mit Mamas neuem Freund alleine.«
»Verstehe.«
Ich legte die Polaroids weg. Mit der Bildseite nach unten. Ich hatte genug gesehen. »Wer hat die Aufnahmen gemacht?«
»Sarah, meine Verlobte. Sie hat eine enge Beziehung zu Antonia. Im Grunde hat sie sich auch mit Astrid gut verstanden. Sie haben sich nach der Trennung vor zwei Jahren nicht gerade angefreundet, aber hin und wieder sogar getroffen. Für eine Patchworkfamilie lief es ganz gut. Bis dieser Motorrad-Hooligan auftauchte.«
»Norman?«, wiederholte ich den Namen, den er mir eben genannt hatte.
»Er arbeitet in einem Geschäft für Motorradzubehör und fährt so eine Rocker-Maschine.« Althof ließ keinen Zweifel daran, dass er einen derart proletarischen Umgang für seine Ex-Frau für absolut unangebracht hielt.
»Wir wollen, dass Sie Norman beschatten. Wer so etwas macht, der hat noch mehr Dreck am Stecken.«
Ich wechselte einen Blick mit Christine, die mir nonverbal signalisierte, dass ich ihrem Nachbarn erst einmal einfach nur zuhören sollte.
»Ich will keine Bewährungsstrafe wegen Körperverletzung für ihn«, erklärte Klaus zornig. »Ich will, dass Sie etwas herausfinden, wofür er in den Bau fährt.«
»Verstehe«, wiederholte ich erneut. Ich sah durch die großen Fenster nach draußen. Dank dem gegenüberliegenden Park war die Aussicht ungestört. Ausnahmsweise schien die Sonne und wurde nur sporadisch von Wolken verdeckt. Früher hätte mich ein Blick in einen solch babyblauen Himmel meine Sorgen für einen Moment vergessen lassen. Heute schien es, als hielte mein Körper es nicht mehr aus, wenn meine dunkle Seele nicht im Einklang mit der trüben Natur war.
Antonias Vater drehte die Polaroids wieder um und breitete sie wie Memory-Karten vor mir aus. »Haben Sie so etwas Perverses schon einmal gesehen?«
Ich sah Christine an. Meine Verteidigerin wusste natürlich, was mir auf der Zunge lag. Folgender Monolog schoss mir als Antwort durch den Kopf:
»Ob ich so etwas Schlimmes schon einmal gesehen habe? Nun, lassen Sie mich überlegen, Herr Althof. Es gab da mal einen Fall, vor über zwei Jahren. Ich arbeitete damals noch als Polizeireporter bei einer großen Zeitung. Da kam eines Tages eine Physiotherapeutin zu mir, die behauptete, sie habe gerade den meistgesuchten Serienmörder Deutschlands behandelt. Vielleicht haben Sie vom sogenannten Augensammler gehört, der Kinder entführte und den Eltern fünfundvierzig Stunden und sieben Minuten Zeit ließ, um ihre Kinder zu finden, bevor er sie tötete und ihnen das rechte Auge entfernte. Die Zeugin hieß Alina Gregoriev, und ihr wollte anfangs niemand glauben, da sie blind ist. Doch tatsächlich führten uns ihre Hinweise auf die Spur des Täters, der den elfjährigen Tobias Traunstein in seiner Gewalt hatte. Wir befreiten den Jungen, bevor der Augensammler ihn in einem Köpenicker Fahrstuhlschacht qualvoll ersticken konnte. Leider tötete der Psychopath in der Zwischenzeit meine Ex-Frau, entführte meinen Sohn Julian und stellte nun mir das Ultimatum, meinen Sohn rechtzeitig wiederzufinden, bevor er ihn ermorden wollte.«
Natürlich sagte ich das alles nicht. Auch weil Christine Höpfner die Geschichte nur allzu gut kannte. Hatte sie mich doch rechtlich in allen Prozessen vertreten müssen, in die ich wegen meiner Jagd auf den Augensammler hineingeraten war.
Also erwiderte ich nur kurz: »Um Ihre Frage zu beantworten, Herr Althof: Auf meiner Jagd nach einem Serienkiller habe ich erstickte Kinder gesehen, denen ein Auge herausgerissen wurde. Ich habe Menschen gesehen, die in Plastikfolie gewickelt in einem dunklen Kellerverlies mit Beatmungsgeräten am Leben gehalten wurden, damit sie nicht an den offenen, eiternden Wunden starben, an denen sie bei lebendigem Leib verwesten. Ich habe meine ermordete Ex-Frau in den Armen gehalten und einen Unschuldigen zum Sterben aus einem Operationssaal entführt, weil ich wollte, dass er mich zu meinem Sohn bringt. Die Antwort ist also: Ja, leider habe ich so etwas Schlimmes schon mehrfach sehen müssen. So oft, dass ich daran zerbrochen bin.«
Ich blickte in Althofs schockiert aufgerissene Augen. Ihm war anzusehen, dass er gerade im Geiste abwog, ob er mit mir einen traumatisierten Verrückten oder einen erfahrenen Experten vor sich hatte. Hätte er seine Nachbarin gefragt, hätte die ihm wohl beides bestätigt.
»Dann … äh … werden Sie uns also helfen?«, fragte er nach dem Ablauf einer Minute, in der wir uns alle schweigend angestarrt hatten.
Ich überlegte, wie ich Althof so schonend wie möglich die Wahrheit beibringen konnte, ohne dass er unter ihrer Last zusammenbrach.
Ich kam zu dem Schluss, dass es keinen einfachen Weg gab, also fragte ich freiheraus: »Ist Ihre Tochter Linkshänderin?«
»Ja«, bestätigte der Vater verwirrt.
»Dann werde ich diesen Fall nicht annehmen.«
5
Dabei hätte ich das Geld gut gebrauchen können. Und es wäre schnell verdient gewesen. Mit dem Honorar wäre es mir gelungen, mein Hausboot wieder flott zu machen. Es lag in einer vom Wasser aus nicht einsehbaren Bucht, nur über einen schmalen Pfad durch den Grunewald erreichbar, und war in den letzten Jahren mein ständiger Wohnsitz gewesen. Vor drei Monaten aber hatte ein Förster den illegalen Liegeplatz entdeckt und angezeigt und so dafür gesorgt, dass ich den mir einst liebsten Platz auf Erden verkaufen musste.
»Haben Sie den Verstand verloren?«, fragte Althof erschüttert. »Was zum Teufel spielt es denn für eine Rolle, mit welcher Hand meine Tochter Tennis spielt oder den Stift hält?«
»Nun …«, ich drehte die Polaroids so, dass sie von dem Vater und meiner Anwältin richtig herum gesehen werden konnten, »… alle Verletzungen finden sich auf der rechten Körperhälfte.«
»Und?«
»Die Schnittwunden«, ich zeigte auf das entsprechende Bild, »sind nicht tief, dafür sehr gleichmäßig. Außerdem finden sich keine an der Körperinnenseite.«
»Sondern?«, fragte Christine Höpfner eine Spur zu ruhig. Sie wusste als Strafrechtsexpertin natürlich, worum es mir ging.
»Dort, wo es im Vergleich weniger wehtut.«
»Worauf wollen Sie hinaus?«, fragte mich der Vater.
»Dass Norman«, ich sah Althof in die Augen, »mit den Wunden Ihrer Tochter sehr wahrscheinlich nichts zu tun hat.«
»Wie, zur Hölle, kommen Sie darauf?«
Ich legte den Kopf schief, ließ die Nackenwirbel knacken, aber es brachte mir keine Entspannung. »Nun, mein Seminar in der Rechtsmedizin ist zwar schon etwas her, aber lange, parallele Schnitte an leicht zugänglichen Stellen … Zudem habe ich mir die Handgelenke Ihrer Tochter angesehen, es gab weder Festhalte- noch Abwehrspuren. Für mich sieht das nach einem Paradebeispiel für selbst beigebrachte Verletzungen aus.«
Althof fuhr förmlich aus der Haut. »Wollen Sie andeuten, dass Antonia sich selbst …«
»Nicht nur andeuten.«
»Aber …« Er schnappte wie ein Fisch auf dem Trockenen nach Luft. »Wieso sollte sie so etwas tun?«
Ich zuckte mit den Achseln. Sich selbst verletzende Jugendliche litten unter schwersten seelischen Belastungen. Es konnte der Versuch sein, eine innere Spannung abzubauen oder sich zu bestrafen. War Antonia ein Mobbingopfer in der Schule, hatte die Trennung der Eltern ein Trauma ausgelöst? Weder kannte ich sie gut genug für eine Diagnose, noch reichte meine Expertise aus, um die Abgründe ihrer Teenagerseele auszuloten. Daher antwortete ich dem Vater: »Ich weiß nicht, was sie dazu treibt, aber genau das gilt es jetzt herauszufinden. Doch dafür braucht Antonia weder einen Anwalt noch einen Privatdetektiv. Sie braucht eine Therapie.«
Er sprang von seinem Stuhl auf. »Sie kleiner, mieser Privatschnüffler, was nehmen Sie sich da heraus? Kommen einfach hier in unser Heim und verbreiten solche Ungeheuerlichkeiten über meine …«
Er sprach nicht weiter, nicht weil Christine ihn sanft an der Hand berührte, sondern weil er, wie wir alle, die Stimme hörte.
»Papa, bitte.«
Wir drehten uns gleichzeitig zur Tür, in der Antonia stand; urplötzlich aufgetaucht wie die Projektion eines Beamers, den man unvermittelt angeschaltet hatte. Ich hatte keine Ahnung, wie lange sie uns schon zugehört hatte, aber offenbar lange genug. Sie weinte, dennoch konnten wir ihre Worte sehr deutlich verstehen.
»Er hat recht.«
Wir zuckten synchron am Esstisch zusammen, als sie die Tür hinter sich zuschlug. Dann rannte sie den Flur hinunter, vermutlich zurück in ihr Zimmer.
6
Wieso wollten Sie, dass ich komme? Sie haben es doch sicher selbst gewusst?«
Christine Höpfner hatte mich zur Verabschiedung bis nach unten zum Eingang des Mehrfamilienhauses begleitet. Wir standen in der Zufahrt, die erst kürzlich mit einem Laubbläser bearbeitet worden war, wie es sich für einen frisch renovierten Prachtaltbau in dieser Gegend gehörte.
»Dass Sie den Fall nicht annehmen, wusste ich, klar. Schon aus Zeitgründen. Aber das mit der Selbstverletzung?« Sie machte eine abwägende Handbewegung. Es sah aus, als wollte sie ein schwankendes Flugzeug imitieren. »Ich habe es geahnt, ja. Aber ich hab Sie nicht wegen meines Nachbarn hierhergebeten.«
»Sondern?«
»Wegen Antonia. Ich habe ja nun schon sehr viel Zeit mit Ihnen verbringen dürfen, Herr Zorbach. Ich habe Sie beobachtet, Sie regelrecht studiert. Und ich weiß, welche Wirkung Sie auf Zeugen, Richter und den Staatsanwalt haben. Ich habe verstanden, weshalb Sie so ein herausragender Polizist und Journalist waren.«
»Das sahen meine Arbeitgeber anders«, sagte ich. Es hatte humorvoll klingen sollen, kam aber unangenehmerweise etwas wehleidig herüber.
Die Anwältin ließ meine Hand los, doch ihr fester Blick hielt mich weiterhin umklammert. »Sie sind ehrlich. Authentisch. Sie reden nie um den heißen Brei herum und erzeugen dadurch eine Aura, dass man sich Ihnen anvertrauen will. Ich hatte Hoffnung, bei Antonia wäre es ähnlich.«
Nun, ihr Plan war wohl aufgegangen. Ich hatte vor der Unterredung mit ihrem Vater kurz mit Antonia gesprochen, allerdings bewusst nur Small Talk. Kein Wort über Misshandlungen, Verletzungen oder ihren Vater oder Norman. Stattdessen hatte ich mich von ihr beraten lassen, ob ich meinem Sohn eine Anfrage auf Instagram schicken sollte oder ob das peinlich war.
Christines Blick wurde weicher. In ihm fand sich etwas, was ich in den letzten Wochen immer mal wieder gesehen hatte und was nicht zu ihrem so professionell distanzierten Auftreten in der Öffentlichkeit passte: Melancholie.
»In drei Tagen«, sagte sie leise. Ein Kastanienblatt segelte an uns vorbei. Es sank so langsam zu Boden wie eine Seifenblase.
»In drei Tagen«, bestätigte ich Christine Höpfner.
Mein Handy klingelte, und ich nutzte die Gelegenheit, um mich zu verabschieden und zurück zu meinem Hausboot zu fahren – solange es noch mir gehörte.
Drei Tage.
Dann würde ich meine zweieinhalbjährige Haftstrafe antreten. Wegen Frank Lahmann. Einem jungen Mann, den ich als Mentor betreut hatte, als er für mich als Volontär bei der Zeitung arbeitete. Und den ich dann zu Tode folterte.
»Hallo?«
Ich angelte den Schlüssel für meinen alten Volvo aus der Innentasche meines Parkas und nahm gleichzeitig den Anruf des unbekannten Teilnehmers an.
Oder, genauer gesagt, der unbekannten Teilnehmerin.
»Herr Zorbach?«
»Ja?«
»Der Journalist?«
»Das war ich mal. Weswegen rufen Sie mich an?«
»Mein Name ist Emilia Jagow.«
Ich schätzte die Frau auf nicht älter als Anfang vierzig. Wobei es angesichts des Schmerzes in ihrer Stimme schwer zu sagen war. Es schien, als hätte er tiefe Furchen in ihre Stimmbänder gezogen, was mich in meiner Vermutung bestärkte, mit wem ich es zu tun haben könnte.
»Die Emilia Jagow?«, fragte ich und stieg in meinen Volvo.
Der Fall der fünfzehnjährigen Feline, die vor wenigen Wochen eines Morgens wie gewohnt zu Hause aufgebrochen, doch nie in der Schule angekommen und seitdem spurlos verschwunden war, hatte natürlich auch meine Aufmerksamkeit erregt. Felines Schicksal – dem man dank der medialen Aufgeregtheit nicht entgehen konnte – hatte mich an jene meiner früheren Fälle erinnert, mit denen ich nie im Leben wieder etwas zu tun haben wollte.
Weswegen sich mein Nacken schmerzhaft verspannte, als Emilia Jagow mir ihre Identität bestätigte und sagte: »Ich bin völlig verzweifelt, Herr Zorbach. Ich brauche dringend Ihre Hilfe.«
7
Feline
Da bist du ja wieder«, sagte die Frau, die sich Tabea nannte und von der Feline sich gewünscht hätte, sie würde nur in ihren Albträumen existieren.
Doch sie war immer noch da. Die ebenso blasse wie zierliche Schwarzhaarige mit der Ponyfrisur, die sie wie einen Helm trug, wodurch Tabea Ähnlichkeit mit einer Playmobilfigur hatte. Schon zum zweiten Mal erwachte Feline hier in diesem Gefängnis aus einer Betäubung neben ihrer seltsamen Leidensgenossin, die so verrückt war wie ein Leguan auf Crack, um einen von Olafs Lieblingssprüchen zu zitieren. Ihr bester Freund, der ihr jetzt nicht mehr helfen konnte, selbst wenn er es wollte.
An das erste Mal – das Erwachen am Tag ihrer Entführung – hatte Feline nur noch bruchstückhafte Erinnerungen. Die Gestalt hatte ihr beim S-Bahnhof Nikolassee aufgelauert, in dem kleinen Waldpfad, den sie als Abkürzung nahm, wenn sie mit dem Fahrrad fuhr. Der bärtige Mann mit der tief ins Gesicht gezogenen Mütze hatte ihr zugerufen, sie hätte ihren Schal aus ihrem Fahrradkorb verloren, und Feline hatte angehalten, um nachzusehen. Und ihr Schicksal damit besiegelt. Sie hatte ein Geräusch gehört, das Knacken eines Astes unter einem schweren Stiefel. Bevor sie sich umdrehen konnte, hatte sie die Hand vor dem Mund gespürt, dann den beißenden Geruch, der ihr in die Nase stach, dann wurde es schwarz.
Als sie wieder zu sich kam, steckte sie wie Tabea in einem kratzigen Nachthemd, das man auf dem Rücken zusammenbinden konnte. Wie Feline lernen sollte, gab es hier unten keine Wechselwäsche. Ihr Entführer (oder waren es mehrere?) hatte wenigstens an Hygieneartikel gedacht, wie Zahnbürste, Pasta, Shampoo, Duschgel und Tampons. Und zum Glück an einen Vorhang, hinter dem das Chemieklo stand.
Ihr war übel geworden, als ihr die ausweglose Lage langsam bewusst geworden war. In ein Gefängnis verschleppt, das sie sich mit einer seltsamen, wenn nicht sogar komplett gestörten Fremden teilen musste, von einem Unbekannten, der sie ausgezogen hatte, während sie bewusstlos war.
Und das jetzt schon zum zweiten Mal.
Wieder saß ihre merkwürdige Mitgeisel neben ihr. Und wieder fühlte sich Tabeas Hand auf ihrer Stirn an wie ein toter Fisch. Feline bat sie, damit aufzuhören, ihr den Kopf zu streicheln, und Tabea, die bestimmt zwanzig Jahre älter war, kletterte schmollend wie ein Kleinkind vom Hochbett.
Feline richtete sich auf, sah sich um, und das, was sie wiedererkannte, verstärkte die in ihr gärende Übelkeit.
Papa, du hast mich zurück in die Hölle geschickt. Und es hat sich nichts verändert.
Was diesen Ort unerträglich machte, war nicht das Fehlen der Fenster, sondern dass alles andere vorhanden war: ein grauer Teppich, ein Multifunktions-Couchtisch darauf, der sich höher stellen ließ, falls man ihn als Esstisch benutzen wollte. Das Hochbett stand, so dicht es nur ging, an der ovalförmigen Wand. Auf seiner oberen Ebene bot es Platz für zwei Personen. Auf der unteren Ebene waren Bücherregale und Schränke eingebaut sowie ein weiteres Klappbett für »Gäste«, wie die Verrückte, mit der sie hier eingesperrt war, ihr allen Ernstes erklärt hatte.
Ich bin aus einem schlimmen Traum in einem Albtraum erwacht, hatte Feline damals gedacht, nur um festzustellen, dass die knochige Person mit dem fleckigen Nachthemd und den bis aufs Blut abgekauten Fingernägeln keine Einbildung war. Tabea war so real wie die Mikrowelle in der Küchenzeile und die gerundeten Betonwände des »Tanks«.
Tank.
So nannte Feline das Gefängnis, denn anders als Zellen, Verliese oder Verschläge, die sie aus Horrorfilmen kannte, hatte ihr Gefängnis keine Tür, sondern einen Deckel. Eine mittig in die Decke eingelassene Luke, ähnlich wie Feline sich einen Einstieg bei einem U-Boot vorstellte. Er schwebte etwa drei Meter über ihrem Kopf, auch vom Bett aus ohne Treppe unerreichbar. Und selbst wenn sie es geschafft hätte, den gewölbten Stahlverschluss mit den Fingerspitzen zu berühren, wäre es völlig sinnlos gewesen, denn der Öffnungsmechanismus konnte nur von außen betätigt werden.
Das war bislang erst einmal geschehen.
Ohne Vorwarnung hatte sich plötzlich die schwere Luke geöffnet, und eine Strickleiter war vom Deckel des Tanks nach unten gefallen. Mit einem Zettel an der untersten Sprosse, auf dem eine Nachricht stand: »Wir machen einen Ausflug, Feline. Zieh dir einen Sack über den Kopf, du findest ihn im Schrank. Dann steig hoch zu mir.«
Und das hatte sie getan. War blind die Leiter hochgeklettert, bis starke Arme sie gepackt und aus dem Tank gezogen hatten. Dann hatte ihr der Wahnsinnige, der ihr nicht sagen wollte, was er mit ihr vorhatte, eine Spritze gegeben. Ihre zweite Betäubung innerhalb weniger Tage. Als sie aus ihr erwachte, hatte sie angekettet in einem Lieferwagen gesessen und sich eine halbe Ewigkeit in schrecklichen Farben sämtliche Horrorszenarien ausgemalt, was mit ihr wohl gleich passieren würde. Feline hatte mit allem gerechnet. Mit Folter, Schmerzen, sogar dem Tod. Nicht aber, dass auf einmal die Tür aufgehen und sie ihren Vater sehen würde.
Der sie in die Verdammnis zurückschickte.
Feline schossen die Tränen in die Augen, als sie daran dachte, dass sie der Freiheit so nahe gewesen war.
Warum, Papa, warum nur?
Sie hatte eine weitere Spritze bekommen. Und jetzt war sie zurück in diesem Tank, in dem sie nun schon Tage oder Wochen in einem Zustand absoluter Hoffnungslosigkeit verharrte und versuchte, nicht den Verstand zu verlieren.
Es gab keine Uhren und eben keine Fenster, durch die man den Wechsel von Tag und Nacht hätte bestimmen können. Nur eine zwischen Bett und Küchenzeile baumelnde Lichterkette. Das einzige Leuchtmittel hier im Verlies, das (so wie jetzt) immer wieder für Stunden abgestellt wurde, vermutlich, um in diesem fensterlosen Versteck den Nacht-Tag-Unterschied zu simulieren. Dann musste Feline mit dieser komplett Verrückten im Dunkeln sitzen, die in unregelmäßigen Abständen anfing, sich am Hals und den Unterarmen zu kratzen. Bei dem Anblick begann jedes Mal auch Felines Haut zu jucken.
Verliere ich hier unten bald auch den Verstand und beginne mich wie Tabea selbst zu verletzen?
Feline schloss die Augen und fiel in einen kurzen, unruhigen Schlaf, der nicht ausreichte, dass ihr Körper nach den wiederholten Betäubungen wieder vollends zu Kräften kam. Sie erwachte von den Vibrationen, die in regelmäßigen Abständen den Tank in Schwingungen versetzten. Und die anscheinend noch etwas anderes auslösten, was Feline eines Tages nur durch Zufall entdeckt hatte. Etwas, was für sie den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten konnte, wenn sie es nur richtig nutzte.
Feline richtete sich auf und horchte in die Dunkelheit hinein.
Schläft Tabea?
Sie achtete auf die gleichmäßigen Atemgeräusche, die hin und wieder von einem Schnarchen ihrer »Mitbewohnerin« unterbrochen wurden. Leise tastete Feline nach dem Geheimnis, das sie am Kopfende unter ihrer Matratze des Hochbetts versteckt hatte.
Ihr Entführer hatte die Uhr zwischen den Büchern, Stiften und Papier in der Innentasche ihres Schulrucksacks übersehen, den sie im Schrank neben ihrer Kleidung vorgefunden hatte. Vielleicht aber hatte er sie ihr auch bewusst überlassen?
Wieso einer Geisel etwas wegnehmen, wenn man ihr ohnehin sehr bald das gesamte Leben rauben will?
Feline schlug sich die Decke über den Kopf, damit Tabea es nicht auffiel, wenn sie gleich die Taste drückte, die das Display der Uhr zum Leuchten brachte. Sie traute ihrer Mitgeisel nicht, die offensichtlich am Stockholm-Syndrom litt, wenn sie von ihrem Entführer als »mein Freund« schwärmte. Tabea schien im Tank von Tag zu Tag noch seltsamer zu werden. Kratzte sich intensiver, hielt Lobesreden auf ihren Kerkermeister, den sie heiraten wolle und für den sie sogar bereit wäre zu sterben.
Vielleicht war Tabea auch einfach nur eine begnadete Schauspielerin? Womöglich war sie von ihrem Entführer als Bewacherin eingesetzt worden?
Wenn ja, darf sie unter keinen Umständen mitbekommen, dass ich im Besitze eines …
»Was zum Teufel …?«
Feline schrie auf.
Das Playmobil-Gesicht schwebte so plötzlich über ihr, wie ihr die Decke vom Kopf gerissen worden war.
Wütend riss Tabea ihr die Uhr aus den Händen: »Was verheimlichst du Miststück hier vor mir?«
8
Zorbach
Ich hatte Mühe, den Ofen in Gang zu bringen. Das Birkenholz war zu feucht, und als ich es endlich geschafft hatte, stand das Mittschiff unter Qualm. Ich öffnete ein Bullauge und entschuldigte mich bei meiner Besucherin, die den ersten Intelligenztest schon mal bestanden hatte, indem sie gestern gut zugehört und heute Nachmittag den Weg auf mein Hausboot gefunden hatte. Früher hatte ich hier nie Besucher empfangen. Das Hausboot war mein Refugium gewesen, mein geheimer Rückzugsort. So unbequem zu erreichen, dass ich früher gehofft hatte, auf dem unbefestigten Weg zum Ufer durch Unterholz und Gestrüpp hindurch all die Dämonen abschütteln zu können, die mich im Alltag verfolgten. Heute hatte ich diese Hoffnung längst aufgegeben.
Früher war es noch schwieriger gewesen, den Zugang zu meiner »Oase« zu entdecken. Ich hatte immer darauf geachtet, dass mich keiner sah, wenn ich vom Nikolskoer Weg kurz vor Potsdam in den Wald bog. Anfangs war ich sogar so paranoid gewesen, meine Nummernschilder abzuschrauben, bevor ich meinen zerbeulten Volvo durch die Brombeerbüsche quetschte, bis er so weit von der Straße entfernt stand, dass man ihn auch bei klarem Wetter nicht mehr sehen konnte. Doch dann hatte Alina Gregoriev mein Versteck entdeckt. War zu mir gekommen und hatte mir von ihren Erlebnissen mit einem Patienten erzählt, den sie behandelt hatte. In ihm hatte sie den meistgesuchten Verbrecher Deutschlands zu erkennen geglaubt. Seither war mein Hausboot nie wieder der Wohlfühlort gewesen wie einst.
»Sie lagern Ihre Sachen ein?«, fragte mich Emilia. Wir saßen uns auf zwei der gepackten Umzugskartons gegenüber, die ich auf dem Boot verteilt hatte. Von ihrem Platz aus hatte sie durch ein Sprossenfenster die direkte Sicht zu den Trauerweiden, die einen natürlichen, vom Wasser aus nicht einsehbaren Carport über der Bucht bildeten.
»Ich denke, ich schmeiße alles weg.« Ich nahm einen Schluck aus meiner Blechtasse. Pulverkaffee mit Kaffeeweißer. Ich konnte verstehen, dass Felines Mutter das abgelehnt hatte, aber meine Kombüse war nicht auf anspruchsvolle Gäste ausgelegt, und mir schmeckte die Plörre. »Eine Garage kann ich mir nicht leisten. Ich gehe ins Gefängnis.«
»Ich weiß«, kommentierte Emilia, was mich nicht wunderte. Auch wenn meine Verurteilung in der Presse keine großen Wellen mehr geschlagen hatte, so war sie doch nicht gänzlich totgeschwiegen worden. Zwei Jahre hatten wir prozessiert, und Christine Höpfner hatte alle Register gezogen. Sie hatte gegenüber der Staatsanwaltschaft glaubhaft argumentiert, dass ich mich in einem entschuldbaren Notstand befunden habe, als ich die mir zur Last gelegten Taten beging. Selbst ich hatte für einen Moment an meine Unschuld geglaubt und deshalb sogar der Berufung zugestimmt, mit der wir gegen das erstinstanzliche Urteil vorgegangen waren. Rückblickend ein Fehler, der mir aber zumindest einen weiteren Aufschub verlieh, den ich dafür nutzte, mehr Zeit mit meinem Sohn Julian zu verbringen.
Letztendlich gab es an meiner Schuld nichts zu rütteln. Ich hatte gedacht, auf dem OP-Tisch des Martin-Luther-Krankenhauses läge mit dem lebensgefährlich verletzten Frank Lahmann der von mir gesuchte Augensammler. Und ich hatte alle Gründe, es zu glauben, denn mein Volontär hatte es mir selbst am Telefon gestanden. Was ich nicht wusste, war, dass er zu diesem Geständnis von dem wahren Täter gezwungen worden war, der ihm eine Pistole an die Schläfe presste, während er mit mir sprach. Mike »Scholle« Scholokowsky.
Und weil ich weiter glaubte, Frank habe meinen Sohn entführt, wollte ich das Risiko nicht eingehen, dass er während der Operation starb, bevor er mir Julians Aufenthaltsort verraten hatte. Also drang ich in den Operationssaal ein und zwang den Narkosearzt, Frank aus seiner Betäubung zu holen. Was meinen Volontär das Leben kostete – und mich die Freiheit. Zwar wurde ich nicht, wie von der Staatsanwaltschaft gefordert, wegen Mordes verurteilt, sondern in Anerkennung meines seelischen Ausnahmezustands »nur« wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Aber weniger als vier Jahre, von denen ich zweieinhalb auf jeden Fall würde absitzen müssen, hatte Christine Höpfner nicht raushandeln können, wofür ich ihr nicht böse war, im Gegenteil. Allein dafür, dass ich die Zeit bis zur Verurteilung nicht in U-Haft hatte sitzen müssen, war ich ihr unendlich dankbar. In meinen Augen war das Urteil gerecht. Auch wenn Frank vielleicht ohnehin bei der Operation gestorben wäre – das konnte man nicht ausschließen –, hatte ich ihn zweifelsohne absichtlich einer Überlebenschance beraubt.
»Wann gehen Sie denn rein?«, fragte Emilia.
»Übermorgen.«
»Oh«, sagte sie und klang überrumpelt. »So bald schon?« Offensichtlich hatte sie dieses Detail in der Presse überlesen. »Ich hatte gehofft, Ihnen bliebe noch etwas mehr Zeit. So, fürchte ich, können Sie mir gar nicht helfen.« Sie machte Anstalten aufzustehen.
»Vielleicht erzählen Sie mir erst einmal, was Sie überhaupt zu mir führt«, bat ich sie. »Am Telefon wollten Sie ja nicht darüber sprechen.«
Emilia nickte schwach und setzte sich wieder. Ihr Blick wanderte zum flackernden Holzofen der Kombüse hinüber. Gemeinsam mit der Öllampe, die ich an einen Haken unter die niedrige Decke gehängt hatte, erzeugte er eine beinahe romantische Atmosphäre in der Kabine, die überhaupt nicht zu dem Anliegen ihres Besuchs passte. Ich vermutete, dass Emilia die spärliche Beleuchtung gelegen kam. Das gelbrötliche Licht wirkte wie ein Weichzeichner, der ihre Kummerfurchen etwas glättete. Sie wirkte müde wie jemand, der spürt, dass eine Erkältung im Anmarsch ist, der sich jedoch nicht in sein ersehntes Bett legen kann, weil eine unaufschiebbare, belastende Aufgabe auf ihn wartet. Allerdings konnte ich nicht sagen, ob ihre blauen Augen wirklich fiebrig glänzten, sie weinte oder ob es die Folgen des Nieselregens waren, der draußen wieder eingesetzt hatte. Auch ihr dunkles Haar war nass. Ihr schulterlanger Pferdeschwanz glänzte wie ein in Öl getauchtes Seil.
»Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll«, murmelte sie und wandte den Blick zu ihren Schuhen. Sie trug vom Lehm des Waldwegs verkrustete Halbstiefel, die viel zu klein wirkten für ihre langen Beine. Ich war mir sicher, dass sie vor der Entführung ihrer Tochter von der überwiegenden Mehrheit der Männer mit Attributen wie »schön«, »attraktiv«, vielleicht sogar »atemberaubend« betitelt worden war. Doch die Trauer hatte ihr jegliche Ausstrahlung genommen. Die Haut war fleckig geworden, und die einst sicher markanten Gesichtszüge rund um die hohe Stirn und die gewölbten Wangenknochen machten nun einen ebenso schlaffen Eindruck wie der Händedruck, mit dem sie mich begrüßt hatte.
»Es geht vermutlich um Feline«, gab ich ihr einen verbalen Anstupser.
Emilia nickte.
»Haben Sie Probleme mit den Ermittlungen der Polizei?«
»Ich habe Probleme mit meinem Mann.«
Ich hielt inne und ließ meinen Kaffeebecher vor meinem Gesicht in der Luft schweben, ohne einen weiteren Schluck zu nehmen. »Inwiefern?«
Sie sah zu mir auf. Auf diesen Moment, das spürte ich intuitiv, hatte sie gewartet. Sie hatte mit sich gerungen, ob sie sich mir anvertrauen sollte, und jetzt war der Punkt erreicht, an dem es kein Zurück mehr gab.
»Es war vor knapp einer Woche. Ich habe mich in unserem Schlafzimmer ausgeruht, wir wohnen in Nikolassee.«
Ich kannte das aus zahlreichen Vernehmungen, die ich als Polizist geleitet hatte, sowie aus Interviews, die ich später als Journalist führen durfte. Menschen, die Angst vor dem hatten, was sie im Begriff waren, einem Fremden anzuvertrauen, neigten zum Plappern. Sie füllten ihre Sätze mit nebensächlichen Informationen, um den Zeitpunkt der Enthüllung jener Ungeheuerlichkeit, die sie so schwer belastete, noch ein wenig hinauszuzögern.
»Auf jeden Fall hörte ich, wie es an der Tür klingelte, was mich ärgerte, da ich gerade etwas Schlaf gefunden hatte und nun die nächsten Stunden trotz Valium nicht mehr zur Ruhe kommen würde. Wir erwarteten keinen Besuch, wen auch? Unsere Nachbarn meiden uns ja eh, so wie die meisten Freunde sich von uns zurückgezogen haben, als wäre der Verlust eines Kindes eine ansteckende Krankheit. Ich kann es ihnen auch nicht verdenken. Die wenigen, die die erdrückende Stille in unserem Bungalow ertragen, kommen jedenfalls nicht mehr unangemeldet.«
»Es hat also geklingelt«, führte ich sie auf den Eingangspfad ihres Monologs zurück.
»Mein Mann, Thomas, er öffnete die Haustür und ging nach draußen, was mich sehr gewundert hat.«
»Wieso?«
»Es hat genauso durchdringend geregnet wie heute. Und Thomas trug nur Hausschuhe und eine dünne Hose. Trotzdem blieb er sehr lange in diesem Schmuddelwetter da draußen.«
»Wer hatte denn nun geklingelt?«
»Das ist es ja, weswegen ich hier bin. Mein Mann behauptet, es wäre ein Lieferdienst gewesen. Ein Paketbote, der sich an der Haustür geirrt hat.«
»Und das bezweifeln Sie?«
»Ich habe Thomas vom Schlafzimmerfenster aus beobachtet. Erst lange nachdem es geklingelt hatte – das war sicher eine Minute –, ist er zur Gartenpforte gegangen und auf den Bürgersteig getreten.«
»Wozu?«
»Das habe ich mich auch gefragt. Ich konnte es aus meiner Perspektive nicht richtig erkennen, aber ich habe einen Kastenwagen gegenüber unserer Haustür stehen sehen.«
»Passt also zu der Geschichte mit dem Paketboten«, warf ich ein.
Sie protestierte. »Dass er im Regen in Filzpantoffeln nach draußen marschierte? Nein. Außerdem: Das war kein DHL-, UPS-, Hermes- oder sonstiger Laster, sondern ein schmutziger Kleintransporter ohne jegliches Firmenlogo.«
»Mittlerweile nutzen viele Zusteller ihre Privatfahrzeuge«, gab ich zu bedenken. Die armen Schweine arbeiteten als »selbstständige Unternehmer«. Erst kürzlich hatte ich eine Reportage gesehen, die diese Praktik als eine perfide Form der Ausbeutung und Umgehung von Arbeitgeberpflichten einstufte.
Emilia nickte. »Ich weiß, aber trotzdem, da stimmt was nicht.«
»Was konkret löst dieses Gefühl bei Ihnen aus?«
Sie schien zu überlegen, was sie antworten sollte. Zögerte vermutlich, weil jetzt der entscheidende Punkt ihrer Schilderung kam.
»Nachdem ich gesehen habe, wie Thomas auf den Lieferwagen zustapfte, bin ich zur Tür gegangen. Hier hatte ich eine schlechtere Perspektive, und der Regen wurde heftiger. Wie ein Schleier. Durch ihn hindurch habe ich gesehen, wie mein Mann aus dem Fahrzeug gestiegen ist.«
Ich kniff die Augen zusammen, als wäre mir gerade etwas hineingeflogen. »Er ist aus dem Wagen gestiegen?«
»Ich denke, ja.«
»Haben Sie ihn nicht direkt danach gefragt?«
»Doch. Er sagt, ich hätte mich geirrt.«
»Haben Sie denn gesehen, wie er eingestiegen ist?«
»Nein. Und wenn ich ehrlich bin, kann es schon sein, dass mir meine Sinne einen Streich gespielt haben. Immerhin hatte ich kurz zuvor eine Valium genommen.«
»Haben Sie darüber mit der Polizei geredet?«, wollte ich wissen.
Sie rang sich ein verzweifeltes Lachen ab. »Um das Leben meines Mannes vollends zu zerstören? Sie waren Polizist und Polizeireporter. Sie wissen doch, auf wen der Anfangsverdacht bei solchen Taten regelmäßig fällt.«
Ich nickte. In über achtzig Prozent der Mordfälle, und als solcher war der Fall Feline Jagow wohl leider einzustufen, fand sich der Täter im nahen Angehörigenkreis.
»In den sozialen Netzwerken wird längst über uns gehetzt. Die Menschen finden es schon verdächtig, dass Feline auf die Schule geht, wo Thomas unterrichtet.«
Emilias Stimme klang plötzlich etwas rauer. »Er stand schon einmal tagelang in den sozialen Medien auf der Abschussliste, nachdem die Information über das verschwundene Handy durchgesickert ist.«
»Was für ein verschwundenes Handy?«
»Mein Mann hatte seins kurz vor Felines Entführung verloren. Das war vorübergehend Gegenstand der Ermittlungen, aber eine Sackgasse, leider ist es irgendwie durchgesickert. Die niederträchtigen Mutmaßungen halten sich seitdem. Was denken Sie, wird erst passieren, wenn ich als seine Ehefrau jetzt auch nur den geringsten Zweifel an meinem Mann in der Öffentlichkeit andeute?«
Freiwild. Sein Leben wäre vorbei. Selbst wenn er sich im Nachhinein als unschuldig erweisen würde. Ich brauchte das nicht offen auszusprechen. Emilia hatte mir eine rhetorische Frage gestellt.
»Schön, aber Sie wären nicht hier, wenn Sie sich im Grunde nicht sicher wären, dass Ihr Mann gelogen hat, hab ich recht?«
Sie nickte.
»Okay, gesetzt den Fall, Sie haben gesehen, wie er aus dem Van stieg. Haben Sie dafür eine Erklärung?«
Sie zuckte mit den Schultern. »Keine gute.«
Ich nickte. So arbeitete leider unser Verstand. Es mochte einen ganz einfachen Grund für das Verhalten von Emilias Mann geben. Vielleicht hatte er wirklich dem Boten geholfen, ein schweres Paket umzuräumen, und in der Eile vergessen, sich Schuhe anzuziehen? Und dann war es ihm im Nachhinein peinlich, und er stritt es lieber ab, als sich Vorwürfe anzuhören, ob er sich den Tod holen wollte. Solange ein Gehirn nicht die ganze Wahrheit kannte, füllte es die Lücken mit einer erdachten Geschichte aus, und die war im Zweifel negativ. So entstanden Verschwörungstheorien. Wenn wir nicht wussten, woher das Vermögen eines Menschen kam, unterstellten wir ihm krumme Geschäfte. Wenn wir die Ausbreitung einer neuen Krankheit nicht verstanden, vermuteten wir ein Bevölkerungskontrollprogramm dahinter. Und wenn wir den Menschen, der uns am nächsten stand, im strömenden Regen aus einem Lieferwagen klettern sahen, rechneten wir mit Betrug, Verrat oder Schlimmerem.
»Im Grunde habe ich nicht mehr als ein Bauchgefühl«, sagte Emilia leise. »Ich glaube, er hat mich angelogen, und ich weiß nicht, wieso.«
»Hat er sich auch danach komisch verhalten?«