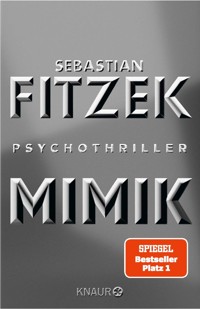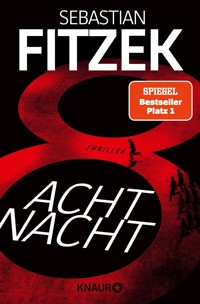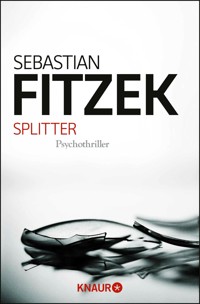9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Was, wenn der Tod deine einzige Chance ist, zu überleben? Sebastian Fitzeks neuer Psychothriller für die dunkle Jahreszeit ... Vor elf Jahren wurde Alma als Baby unter mysteriösen Umständen zur Adoption freigegeben. In ihrer streng unter Verschluss gehaltenen Adoptionsakte steht der Vermerk: »Identität der Eltern darf unter keinen Umständen ans Licht kommen! Mutter droht Todesgefahr!!!« Doch nun ist Alma lebensgefährlich erkrankt und braucht dringend einen Knochenmarkspender. Um das Leben ihrer Adoptivtochter zu retten, startet Olivia Rauch eine verzweifelte Suche nach den biologischen Eltern. Dabei stößt die auf Gewaltverbrechen spezialisierte Psychologin auf die Legende vom »Kalendermädchen«: einer jungen Frau, die sich einst zur Weihnachtszeit in ein abgeschiedenes Häuschen im Frankenwald zurückgezogen hatte. Und die dort von einem Psychopathen heimgesucht wurde, der sie zwang, einen Adventskalender des Grauens zu öffnen … Düster und absolut nervenaufreibend sorgt Sebastian Fitzek mit seinem vielschichtigen Psychothriller »Das Kalendermädchen« auf drei Zeitebenen für gruselige Spannung. Nervenkitzel pur vom #1-Bestseller-Autor!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 448
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Sebastian Fitzek
Das Kalendermädchen
Thriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Um über die Weihnachtszeit ungestört für ihr Examen zu lernen, zieht die Berliner Studentin Valentina Rogall in ein Ferienhäuschen im Frankenwald. Hier schmückt sie ihr Küchenfenster – ohne zu ahnen, was sie damit bei ihren Nachbarn auslöst. Denn im Örtchen Rabenhammer wird die Tradition des »lebendigen Adventskalenders« gepflegt. Jeder, der sich eine brennende Kerze ins Fenster stellt, signalisiert, dass seine Haustür für alle Dorfbewohner zum gemeinsamen Feiern offensteht. Anfangs überrumpelt, genießt Valentina die Gegenwart der unerwartet auftauchenden Gäste. Es ist schon dunkel, als sich die letzten verabschieden. Und der Psychopath, der sich in Valentinas Haus am Waldrand eingeschlichen hat, endlich aus seinem Versteck kriechen kann …
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
79. Kapitel
Zum Roman und Danksagung
Das Quiz für dein nächstes Fitzek-Abenteuer
Leseprobe »Der Nachbar«
Für Sabrina
Selbst wer an nichts glaubt,glaubt damit an etwas.
1. Kapitel
Notrufprotokoll
20. Dezember, 23:34 Uhr, Leitstelle Hof, Bayern.
P: Notruf der Polizei, mit wem spreche ich?
A: Ja, hallo. Ich würde gern eine Pizza bestellen.
P: Gute Frau, Sie haben den Notruf der Polizei gewählt.
A: Genau. Mit Salami und Käse.
(Pause.)
P: Verstehe … Sind Sie aktuell in Gefahr und werden bedroht?
A: Ja.
P: Sie sind nicht allein im Raum?
A: Ganz genau.
P: Sind es mehrere Täter?
A: Nein. Nur eine Pizza.
P: Gut. Sie machen das sehr gut. Ist die Person bei Ihnen bewaffnet?
(Längere Pause.)
A: Ja. Die XXL-Größe bitte.
P: Sind Sie verletzt?
A: Mit Peperoni.
P: Schwer?
A (gequält lachend): Wenn ich nicht bald was zu essen bekomme, sterbe ich.
P: Okay. Sie sind eine starke Frau. Sie machen das perfekt. Hilfe ist gleich bei Ihnen. Sie müssen mir jetzt bitte die genaue Adresse durchgeben.
A: Hm. Na klar. (Pause. Schweres Atmen.) Bitte liefern Sie es nach Rabenhammer in den, äh … in den Tannensteig 18.
P: Ist das eine Wohnung?
A: Äh, das ist ein Ferienhaus. Haus Waldpfad.
P: Gut, wie heißen Sie?
A: Valentina. Valentina Rogall. Aber es steht natürlich kein Name an der Klingel. Was …?
(Rascheln, Hörer wird offenbar mit der Hand zugehalten.)
A (zu einem Dritten im Raum): Ja. Sag ich.
(Wieder direkt in die Leitung. Verunsichert. Zittrige Stimme.) Hören Sie? Sie sollen das Essen bitte vor die Tür stellen. Bargeld liegt dann unter der Fußmatte.
P: Wo genau im Haus halten Sie sich auf? Im Erdgeschoss?
A: Nein.
P: Im ersten Stock also?
A: Ganz genau. (Pause, Rascheln.) Wie lange wird das dauern?
P: Hilfe ist in wenigen Minuten bei Ihnen. Sagen Sie jetzt bitte: »Kein Problem, ich warte in der Leitung, bis Sie Ihren Lieferanten erreicht haben.«
A: Kein Problem, ich warte in der Leitung, bis Sie Ihren Lieferanten erreicht haben. Moment, warten Sie. Ich soll noch sagen …
(Längere Pause. Rascheln. Unverständliches Gemurmel im Hintergrund. Ein unterdrücktes Wimmern.)
A: Nein, nein, das mach ich nicht.
P: Hallo? Hallo? Sind Sie noch dran?
(Lauter, gequälter Frauenschrei.)
Verbindung reißt ab.
Ende der Aufzeichnung: 23:37 Uhr.
2. Kapitel
Rabenhammer, Tannensteig 1823:51 UhrStrachnitz
Mit dem halb heruntergelassenen Raffrollo sah das kleine Schieferdachhäuschen aus, als würde es Polizeimeister Strachnitz vom Waldrand aus zuzwinkern.
Es war eine sternklare, eiskalte Nacht. Keine Wolke störte das Licht des Vollmonds, das den Polizisten als Scheinwerfer diente und trotz der späten Stunde eine abenddämmerungsgleiche Stimmung erzeugte.
Die letzten Tage über hatte es geschneit, gestern früh hatte es kurz aufgehört, dann am Abend wieder begonnen, und ein lautloses Vorankommen war kaum möglich. Seine Stiefel und die der Polizistin hinter ihm knirschten bei jedem Schritt den Weg hinauf zum letzten Haus in der Sackgasse. Immerhin hatte jemand Splitt gestreut, sodass ihr Aufstieg nicht zur Schlitterpartie wurde. Trotzdem lief er Gefahr, zu stürzen. Strachnitz hatte mal wieder falsch getrunken. Zu viel Alkohol, zu wenig Wasser. Die vergangenen Stunden steckten ihm noch in den Knochen, und der Aufstieg zum Haus Waldpfad, wie die kleine Hütte in Internet-Ferienportalen bezeichnet wurde, schien eher länger statt kürzer zu werden.
»Sieht friedlich aus«, sagte er zu seiner jungen Kollegin, die einige Minuten nach ihm eingetroffen war. Als die Einsatzmeldung der Zentrale einging, war er in der Nähe gewesen, doch der Inhalt des Notrufs hatte keinen Zweifel daran gelassen, dass das hier kein Routineeinsatz für einen einzelnen Beamten war; also hatte er auf Samira warten müssen.
Sie sog die klare Luft ein und sah sich um. »Auf jeden Fall ist da noch jemand wach«, befand sie. Im Obergeschoss brannte Licht, wohingegen die restlichen Häuser der Siedlung in Dunkelheit lagen. In einigen Gärten standen illuminierte Tannenbäume, in Haus Waldpfad fehlte jegliche Außenbeleuchtung. Dafür flackerte eine zu einem Drittel herabgebrannte Stumpenkerze in einem weihnachtlich geschmückten Fenster.
»Sieh mal!« Samira deutete auf den Boden.
Zahlreiche vom Abendschnee nur lose bedeckte Fußstapfen zeugten davon, dass der Pfad vor Kurzem öfter benutzt worden war. Irgendwann einmal ganz sicher auch von Valentina Rogall – der jungen Frau, die den ungewöhnlichen Pizza-Notruf abgesetzt hatte.
»Seltsam«, stimmte er ihr zu.
Die Wettervorhersage der letzten Tage hatte dafür gesorgt, dass kaum noch jemand in dieser Gegend wandern ging. Der Sommer war heiß und trocken gewesen. Jetzt lastete Neuschnee auf den morschen Baumkronen. Ein Sturm konnte lebensbedrohliche Folgen haben. Erst letztes Jahr war ein leichtsinniger Spaziergänger um diese Jahreszeit von einem herabfallenden Ast erschlagen worden.
Im Einklang mit der Natur leben. Was für ein Schwachsinn!, dachte Strachnitz und tastete intuitiv nach der Waffe an seiner Weste.
Der Polizist liebte den Frankenwald, die verschneiten Berglandschaften, die klare Luft und den warmen Sonnenschein auf den Gipfeln seiner fränkischen Heimat. Aber er war nicht so dumm, zu denken, Mutter Erde wäre seine Freundin.
»Die Natur will uns töten. Erdbeben, Vulkanausbrüche, Sturmfluten, Bakterien, wilde Tiere, Viren, Zecken, Krankheiten, brutale Hitze, eisige Kälte … der Mensch hat all das über Jahrtausende überlebt. Nicht, indem er die Natur in Ruhe gewähren ließ. Sondern, indem er sich vor ihr schützte, wie sich ein Volk vor kriegerischen Angreifern schützt: mit Höhlen, Häusern, Kleidung, Medikamenten, Heizungen, Gewehren, Angelruten und Rattengift.«
Das hatte ihn schon sein Vater gelehrt.
»Dann bekämpfen wir die Natur?«, hatte er ihn als Kind gefragt und sich eine Ohrfeige eingehandelt.
»Du hörst nicht zu. Ich habe gesagt: Wir verteidigen uns. Nicht wir kämpfen. Die Natur bekämpft uns. Und das zu Recht. Wir sind ihr Feind. Wir haben keine Funktion in der Nahrungskette. Unser Dasein ergibt keinen Sinn. Aus diesem Grund muss uns die Natur niemals ein Friedensangebot machen. Deshalb sind all die Versuche, weniger Strom zu verbrauchen, weniger Fleisch zu essen und weniger Müll zu produzieren, schwachsinnig. Das ist so, als würdest du einen Tumor bitten, weniger zu streuen. Wir sind nun einmal das Krebsgeschwür der Natur. Aus ihrer Sicht müssen wir vollständig entfernt werden.«
Je älter er wurde, umso besser verstand Strachnitz die Verbitterung seines alten, mittlerweile schwer kranken Herrn, der der Öffentlichkeit jedoch sein ganzes Leben lang ein anderes Gesicht gezeigt hatte. Das des seriösen Kriminalkommissars, stets im Dienste seiner schutzbedürftigen Bürger.
Dieser Heuchler.
Wieso hatte er nur auf Papa gehört, es ihm gleichgetan und war zur Polizei gegangen? »Willst du dein Leben weiter als Wachmann vergeuden oder endlich wie ein echter Mann in einem echten Männerberuf arbeiten?«
Strachnitz bereute es fast jeden Tag. Heute womöglich mehr denn je. Trotzdem konnte er nicht auf die innere Stimme hören, die ihm vom eisigen Wind getragen ins Ohr flüsterte, dass er umkehren und das Haus nicht betreten solle. Schon gar nicht mit einem Kater, der ihm mit jedem Atemzug seine Krallen in die Synapsen schlug.
Zum Glück hatte er sich so weit unter Kontrolle, dass seine jüngere Kollegin seinen desolaten Zustand nicht bemerkte. Das hoffte er zumindest.
Der Weg führte sie erst an einer Scheune, dann an einer zum Haus gehörenden Garage vorbei, auf deren Flachdach eine kleine Terrasse mit Aussicht in den Wald angelegt war.
Ein Bewegungsmelder aktivierte eine Lampe über dem rückseitigen Eingang.
Die in die Haustür eingelassene Glasscheibe war von innen mit schwarzem Markierstift beschmiert worden.
»Eigenartig«, kommentierte Samira.
Strachnitz nickte. »Sieht aus wie ein Zeichen.«
Eine geschwungene Linie, die die Zahl 2 oder den Buchstaben S darstellen mochte, je nachdem, ob man von innen oder außen darauf schaute.
Die Haustür stand einen Spalt offen. Strachnitz stieß sie behutsam auf. Sie schwang leicht knarzend in einen ebenso dunklen wie engen Flur hinein. Eine schmale Treppe führte rechter Hand in den ersten Stock. Zur Linken war ein Sicherungskasten in eine Holzpaneelwand eingelassen. Auch dessen Tür war mit Edding markiert. Diesmal mit der Zahl 5.
»Hallo, wir bringen die Pizza!«, rief Strachnitz so laut, dass man es im gesamten Haus hören musste. Keine Antwort. Er vernahm nichts außer dem Rauschen des Windes von draußen.
Im Inneren des verlassen wirkenden Gebäudes roch es nach kaltem Kamin und feuchtem Hund.
Leider nicht nach Schnaps.
»Ist hier jemand?«
Unten am Parkplatz hatte er Samira erklärt, dass sie sich nicht als Polizisten zu erkennen geben sollten, weswegen sie ihre Uniformjacken gegen neutrale Regenüberzüge ausgetauscht hatten.
»Der Täter, der die Anruferin bedroht, rechnet mit einem Pizzaboten, und in dieser trügerischen Sicherheit wollen wir ihn belassen.«
»Das Geld lag nicht unter der Matte«, rief Strachnitz jetzt und ging mit der Pistole im Anschlag leise den Flur hinunter, bis er zu seiner Linken auf eine dünne Holztür traf. Die Decken des Hauses waren für einen Mann seiner Statur zu niedrig, sodass er leicht vornübergebeugt gehen musste.
Er öffnete die Tür und betrat ein auf den ersten Blick gemütlich wirkendes Wohnzimmer: ein kleines, bequem aussehendes Ledersofa und ein Ohrensessel, dazwischen ein von roten Blumenornamenten dominierter Perserteppich, auf dem ein rollbarer Couchtisch vor einem rustikalen Kaminofen stand. Das Wohnzimmer war ein Durchgangszimmer zur Küche, deren weihnachtlich geschmücktes Fenster der Polizist von außen gesehen hatte. Das Raffrollo halb heruntergelassen, davor stand die schwarze Kerze.
»Leer!«, sagte Samira.
Auch er hatte auf den ersten Blick gesehen, dass sich niemand in der altbackenen Landhausküche aufhielt. Die Stühle waren verrückt. Hier roch es nach kaltem Kaffee und Absinth. Benutztes Geschirr stand auf dem Küchentisch.
»Sieh mal!« Strachnitz deutete auf die Scheibe des Kaminofens. Der Anblick der in den Ruß gezeichneten 19 erinnerte ihn an die verdreckte Motorhaube seines Privatwagens, auf die Kinder letzte Woche einen Lachsmiley geschmiert hatten.
Strachnitz kniete sich hin und öffnete den Ofen. Samira hinter ihm stöhnte laut auf.
»O Gott!«
Er fluchte ebenfalls. Derber. Panischer.
Das darf doch nicht wahr sein!
Er musste daran denken, wie ihm sein Vater von seinem schlimmsten Fall als Streifenpolizist erzählt hatte: Ein sich von Dämonen besessen glaubender Junkie hatte versucht, sich mit einer Gartenschere seine »vom Teufel verfluchte« linke Hand abzutrennen.
Scheiße!
Hier in dem Ofen lag keine Hand. Nur ein Zeigefinger. Mit halb abgerissenem Nagel. In Blut getränkt, unfachmännisch abgetrennt. Drapiert wie die Vorspeise eines geisteskranken Kannibalen auf einem Stapel Zündelholz im Holzkohleofen.
»Herr im Himmel«, keuchte Samira und wandte sich ab.
»Ich brauche hier die Spurensicherung!«, funkte Strachnitz die Zentrale an. »Und Verstärkung. Schickt am besten einen Rettungswagen mit.«
Er starrte in den kalten Ofen hinein, verfluchte sich und sein Leben, brauchte viel zu lange, um sich wieder aufzurichten, und bemerkte deshalb zu spät, dass seine Kollegin nicht mehr in seiner Nähe war.
3. Kapitel
Samira
Strachnitz hatte ihr verboten, alleine nach oben zu gehen, doch sie sah keinerlei Anlass, ihm Folge zu leisten. Zwar war er dienstälter und rein technisch ihr Vorgesetzter, seinem Atem und seinem schwankenden Gang nach war er jedoch kaum in der Lage, diesen Einsatz hier vernünftig durchzuführen, geschweige denn, ihr Anweisungen zu erteilen. Sollte er doch unten auf die Verstärkung warten. Sie würde sich später nicht den Vorwurf machen lassen wollen, eine hilflose Frau im Stich gelassen zu haben.
Samira zog ihre Dienstwaffe.
Die ausgetretenen Stufen knarzten bei jedem Schritt wütend nach. Niemand, der sich im ersten Stock direkt unter dem Dach aufhielt, konnte das überhören. Sie gab sich keine Mühe mehr, sich als Pizzabotin zu tarnen, und lernte rasch, dass das von Anfang an nicht nötig gewesen wäre. Auch die oben gelegenen Zimmer waren leer, sowohl das Schlaf- als auch das kleine Arbeitszimmer, durch dessen Fenstertüren man auf die Aufdachterrasse über der Garage steigen konnte.
Keine Valentina Rogall. Kein Mann, der sie bedrohte.
Allerdings gab es auch hier eindeutige Anzeichen, dass das Haus noch vor wenigen Stunden Menschen beherbergt haben musste: Im Schlafzimmer lagen Bettwäsche und Kopfkissen achtlos neben dem Doppelbett. Das schien frisch bezogen, jedoch waren die Laken verschmiert. Wie unten die Tür und der Sicherungskasten waren auch sie mit Zahlen beschriftet:
Rechts mit einer 9. Auf die linke Seite hatte jemand mit rotem Textmarker eine 17 geschrieben.
Was geht hier vor?
Samira fand einen kleinen, mintfarbenen Briefumschlag neben dem Bett, er war kaum größer als eine Kreditkarte. Sie hob ihn auf und zog eine Karte hervor. Auf ihr befand sich ein mit feinem schwarzen Filzstift verfasster Text. Ein Gedicht, das in Samiras Magen eine Reaktion auslöste, als hätte sie gerade ein fauliges Ei herunterwürgen müssen:
Lasst es tot und drunter sein.
Das Kalendermädchen kann sich nicht mehr freun.
Versteckt im Kasten, trallalalala!
Heut ist Todesabend da!
Heut ist Todesabend da!
Sie fragte sich, was mit einem »Kasten« gemeint sein könnte. Vor ihrem geistigen Auge sah sie eine fingeramputierte Leiche in einer Kiste liegen; einem Sarg, einer Truhe oder, falls der Verfasser tatsächlich wörtlich genommen werden wollte, in einem kastenartigen Gebilde, einem Sandkasten etwa.
Oder …
Sie lief um das Bett herum. Bückte sich. Tastete mit den Fingern auf dem Teppich herum, der so dunkel war, dass man sie auf den ersten Blick nicht sah – die dunkle Flüssigkeit, die aus dem Bett auf den Boden sickerte.
Aus dem Bett.
Genauer gesagt: aus dem Bettkasten.
Lasst es tot und drunter sein.
Unter dem Bett. In einem Kasten.
»Was ist denn hier los?«, hörte sie Strachnitz von der Tür her fragen.
Das Deckenlicht schien mit einem Mal an Kraft verloren zu haben.
Die Waffe im Anschlag, öffnete Samira den Bettkasten auf der Seite, auf der sie den Umschlag gefunden hatte,indem sie die Matratze anhob. Die Feder des Öffnungsmechanismus gab nur widerwillig nach, als würde er in eine falsche, ungesunde Position gezwungen.
Strachnitz, der hinter sie getreten war, richtete ebenfalls seine Stabtaschenlampe aus.
»O Gott!«
Samira keuchte entsetzt.
Das Wesen im Bettkasten war weder als Frau noch als Mann zu erkennen, und sie zweifelte für einen Moment, ob es überhaupt ein Mensch war, denn noch nie zuvor hatte sie irgendwen so entsetzlich und unverständlich schreien hören.
»Rettungswagen!«, hörte sie Strachnitz hinter sich ins Funkgerät brüllen. »Sofort!«
In einer idealen Welt hätte sie jetzt Alarmsirenen gehört, die durchdrehenden Reifen von Polizei und Ambulanz. Das Flackerlicht der Einsatzfahrzeuge hätte das Schlafzimmer in ein zuckendes Blau getaucht.
Doch Samira hörte nichts dergleichen. Und sie sah keine Signallichter. Nur das blutbesudelte, schwer atmende Etwas in dem Bettkasten.
Das Kalendermädchen?
»Rettungswagen, wo bleibt die verdammte Feuerwehr?«, brüllte Strachnitz in sein Funkgerät. Dann brach die Hölle los. Noch während ihr Kollege mit dem Notruf abgelenkt war, sprang das blutüberströmte Wesen unvermittelt mit einem einzigen Satz aus dem Bettkasten.
Samira versuchte es. Aber es gelang ihr nicht, auch nur einen einzigen Schuss abzugeben, bevor es Strachnitz an die ungeschützte, bloß liegende Kehle ging.
4. Kapitel
Sieben Stunden später Strachnitz
Kein Kater. Keine Übelkeit. Das war das Erste, was er beim Aufwachen registrierte. Seit Monaten war er nicht mehr ohne dröhnenden Schädel aufgewacht, so wie jetzt. Doch das war für ihn kein Anlass zur Freude. Denn dafür hatte er das Gefühl, als wäre sein Hals eine offene Wunde, die ein Sadist mit brühend heißen, in Salzlauge getränkten Tüchern umwickelt hatte.
»Kannst du mich hören?«
Strachnitz nickte, was ein Fehler war, denn nun scheuerten die Tücher tief in die Halswunde. Am liebsten hätte er nach dem Kabel mit dem roten Notruf-Knopf gegriffen, das an seinem Krankenhausbett baumelte, aber er scheute jede weitere Bewegung.
»Du bist wach, gut. Das ist sehr gut …«
Der Mann an seinem Bett war kein Mediziner, auch wenn seine teebeutelgroßen Tränensäcke zu einem Stationsarzt nach einer Achtundvierzig-Stunden-Schicht gepasst hätten. Es dauerte eine Weile, bis Strachnitz in dem graumelierten Mittfünfziger seinen Vater erkannte. Den hochdekorierten Ermittler.
Na toll.
»Wo bin ich?«, fragte er ihn. Seine Stimme klang, als hätte er mit Chlorreiniger gegurgelt.
»Im Sankt Martin. Zum Glück, die Chirurgen hier sind top.«
Ein Monitor piepte außerhalb seines Sichtfelds, vermutlich einer, mit dem die Vitalfunktionen überwacht wurden. Das zumindest würde die vielen Schläuche und die Manschette an seinem linken Arm erklären.
»Was ist passiert?«, krächzte er und wollte schlucken, schaffte es aber nicht.
»Du weißt es nicht?« Die Stimme seines alten Herrn klang seltsam euphorisch.
Strachnitz dachte nach, während er aus den Augenwinkeln zum Fenster rechts von ihm blickte. Draußen war es hell. Seine letzten Erinnerungen lagen im Dunkeln. Er erinnerte sich an den Geschmack des Alkohols, den er heute früh (war es überhaupt noch heute?) getrunken hatte. Und an den Notruf. Die Leitstelle hatte etwas von einer Frau gesagt, die bei der 110 Pizza bestellt habe und vermutlich nicht frei sprechen könne, weil sie bedroht wurde.
»Ich bin um die Ecke!« Mit diesen Worten hatte er die Meldung angenommen und dann auf seine Kollegin gewartet.
Von da ab wurde sein Gedächtnisbild immer löchriger. In seiner Erinnerung öffnete er eine Haustür, sah einen Sicherungskasten, der mit einer Zahl beschriftet war. Dann ein Bett, schließlich ein blutüberströmtes Wesen, und dann …? Nichts mehr.
Strachnitz räusperte sich, was sich anfühlte, als zöge er eine Nagelfeile über seine Stimmbänder. »Habt ihr den Täter?«, fragte er und ertastete einen Verband, als er sich an den Hals griff.
»Hör mir jetzt gut zu!«, sagte sein Vater, dessen Stimme sich um eine halbe Oktave gesenkt hatte, wodurch sie mit einem Mal viel bedrohlicher klang. »Es ist sehr wichtig, dass du begreifst, was im Haus Waldpfad vor sich gegangen ist, okay?«
Strachnitz nickte und bereute es sofort. In seinem Kopf schwappte ein Säurebad umher.
»Das war ein Hund!«
»Ein Hund? Wo denn … ich meine, wie …?«
»Ein Streuner. Du bist einem Notruf in ein leer stehendes Haus gefolgt. Dort hat dich der Köter angegriffen. Das Tier muss versehentlich eingeschlossen worden sein und seit Tagen kein Fressen mehr gesehen haben. Du warst seine Beute.«
Die sonore Ermittlerstimme seines Vaters schraubte sich wieder in einen kumpelhaft klingenden Bereich: »Anscheinend bist du nicht sehr genießbar, Kleiner. Das Vieh muss von dir abgelassen haben und ist über alle Berge.«
Strachnitz fühlte, wie ihn eine bleierne Schläfrigkeit überfiel, als hätte er ein Schlafmittel genommen, das plötzlich seine Wirkung entfaltete. Vermutlich war er tatsächlich mit sedierenden Schmerzmitteln vollgepumpt.
»Was ist mit der Frau?«, wollte er wissen.
Und mit meiner Kollegin. Wie hieß sie noch mal …?
»Welche Frau?«
»Das Opfer. Im Bettkasten. Sie war voller Blut. Ihr müsst doch ihren Finger gefunden haben!«
»Ihren was …?«
Strachnitz’ Lider begannen zu flattern.
»Im Ofen. Da war eine Zahl. Und ein Gedicht …«
Versteckt im Kasten, trallalalala!
Heut ist Todesabend da!
Verdammt, wie war es nur weitergegangen?
Das Krankenzimmer flimmerte vor seinen Augen, als wäre alles um ihn herum eine Projektion, die gerade einer stark schwankenden Stromversorgung ausgesetzt war. Er hörte seinen Vater sagen, jetzt wieder mit tiefer Stimme: »Ganz ruhig, mein Junge. Wie ich schon sagte, es ist wichtig, dass du das verstehst, wer auch immer danach fragen wird: Es gab niemanden in dem Haus. Kein Opfer, kein Blut, keine Finger oder Zahlen. Und Gedichte hast du auch keine gesehen.«
Das ist unmöglich.
»Mach dir keinen Kopf, Kleiner. Die Ärzte sagen, dass Verwirrung und falsche Erinnerungen nach so einer traumatischen Verletzung ganz normal sind. Zumal wenn man hin und wieder einen über den Durst trinkt.«
Strachnitz spürte eine Hand auf der Schulter, und am liebsten hätte er sie gepackt und seinen Vater mit aller Gewalt zu sich heruntergezogen, bis dessen Mund an seinem Ohr war, damit dieses Tränensack-Gesicht es auch ja mitbekam, wenn er in es hineinbrüllte:
»Ich bin vielleicht ein Suffkopp. Aber ich bin nicht verrückt. Und ich habe das auch nicht im Betäubungsmittelschlaf geträumt. Also hör auf, mich zu verscheißern.«
Doch er bekam kein Wort mehr heraus. Seine Augen waren bereits geschlossen. Er driftete in ein dunkles Nichts, in die Abwesenheit jeglichen Lichts. Auf einmal durchzuckte ihn ein Gedanke, der lediglich aus einem Wort bestand. Es stammte aus dem Gedicht im Haus Waldpfad, an dessen kompletten Wortlaut er sich nicht mehr erinnern konnte, aber bei diesem einen Wort, da war er sich sicher:
Kalendermädchen
Ohne dass er es sich im Moment erklären konnte, elektrisierte es ihn, jagte ihm einen unangenehmen Schauer durch den gesamten waidwunden Körper und brachte ihn zu einer letzten Erkenntnis: Valentina Rogall.
Auf einmal ergab alles einen grausamen Sinn, wenn auch nur für den Bruchteil einer Sekunde, bevor alles um ihn herum an Substanz verlor und sich in Luft auflöste, bis es nur noch das dunkelste Schwarz gab, dem sein Verstand jemals ausgesetzt gewesen war.
5. Kapitel
Elf Jahre später. Heute. Olivia
Das viele Blut machte bestimmt keinen guten Eindruck. Es klebte Olivia Rauch am Kinn, am Hals und natürlich an ihrer weißen Bluse. An allem, was mit dem Kopf in Verbindung gekommen war, einschließlich der Hände, mit denen sie die Sauerei abzuwischen versucht hatte. Vergeblich.
Sie hatte nicht die Zeit gehabt, den Flecken mit einem aufgelösten Aspirin Plus C zu Leibe zu rücken (den Tipp hatte ihr einst eine Tatortreinigerin gegeben, und er funktionierte wirklich gut). Noch hatte sie es geschafft, sich umzuziehen, bevor sie die fluchtartige Autofahrt nach Berlin Mitte angetreten war. Momentan fühlte sie sich so, als würde sie niemals mehr wieder für etwas Alltägliches Zeit haben. Nicht, während ihre Tochter auf der Überholspur Richtung Tod ihr viel zu junges Leben hinter sich ließ.
»Es muss doch einen Weg geben?«, hörte sie sich mit seltsam tauber Stimme fragen. Die Wörter, die ihr aus dem Mund rollten, fühlten sich an wie Fremdkörper. Rau, pelzig und unangenehm hart. Wie der Holzstuhl, auf dem sie nach vorne gebeugt saß, angespannt wie eine Läuferin vor dem Startschuss.
»Ich wüsste nicht, wie«, entgegnete der Beamte. Mit seinem muskulösen Körper wirkte er hinter dem Behördenschreibtisch wie ein Türsteher im Smoking. Gleichzeitig lächerlich und doch Respekt einflößend.
Der Bleistift, mit dem er auf irgendeine Akte vor ihm auf dem Tisch trommelte, verschwand zahnstochergleich in seinen riesigen Pranken.
Seitdem Olivias Kontaktperson in Pension gegangen war, war Walther Wallenfels ihr Hauptansprechpartner in der Adoptionsvermittlungsstelle, die sich hier im Gebäude der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie befand. Bislang hatte sie nur sporadisch mit dem Amtsleiter zu tun gehabt. Sie wusste nichts Persönliches über ihn, außer dass ihn seine Kollegen »Walli« nannten. Wobei sie nicht sicher war, ob sich dieser Spitzname von seinem Vor- oder Nachnamen ableitete.
»Laut Rechtslage haben Adoptionskinder einen Anspruch darauf, zu erfahren, wer ihre leiblichen Eltern sind.«
»Mit dem sechzehnten Geburtstag«, bestätigte Wallenfels, um ihr im nächsten Atemzug bereits zu widersprechen: »Alma ist erst elf. Zudem«, er deutete mit dem Bleistift genau auf den Blutfleck ihrer Bluse, »haben wir es hier nicht nur mit einer geschlossenen Adoption zu tun, bei der die Altersgrenze des Kindes strikt zu beachten ist. Sondern zusätzlich mit einer geheimen!«
»Das ist mir bekannt«, rutschte es Olivia heraus. Und sie schaffte es auch nicht, sich auf die Zunge zu beißen, bevor ihr ein »Ich war bei dem Verfahren dabei!« über die Lippen ging.
Verdammt. Psychologiestudium mit Bestnoten. Juniorprofessorin an der FU. Aber bei meiner eigenen Vorlesung zum Thema Impulskontrolle habe ich wohl selbst nicht zugehört.
»Nun …«, Wallenfels schenkte ihr einen arroganten »Was hat diese Unterhaltung hier dann für einen Sinn?«-Blick, »… wenn Sie dabei waren, wissen Sie gewiss auch, dass ich Ihnen keine personenbezogenen Daten zu Almas biologischen Eltern geben darf. Das war die zentrale Bedingung für die Adoption, und Sie haben damals zugestimmt, Frau Rauch.«
Olivia wollte nervös an ihrem Ehering drehen und stellte wieder einmal fest, dass sie ihn nicht mehr trug. Seit vier Monaten schon nicht mehr. Aber alte Angewohnheiten ließen sich nicht so schnell ablegen wie ein Stück Metall.
»Es muss doch eine Ausnahme geben!«
Wallenfels schüttelte den Kopf. »Nein. Wenn ich Ihnen jetzt einen Namen verrate, gefährde ich das Leben der Mutter.«
Sie legte die Stirn in Falten. »Wie bitte soll das ihr Leben gefährden?«
»Genau auf diese Frage darf ich Ihnen keine Antwort geben. Sonst wüssten Sie …«
»… wer Alma zur Welt gebracht hat!«, ergänzte sie augenrollend.
Okay, okay. So komme ich nicht weiter.
Olivia atmete tief durch, dann streckte sie dem Beamten die Hände entgegen, als Nächstes zeigte sie auf ihre Bluse.
»Sehen Sie das Blut an mir? Meine Tochter ist krank! Sie leidet an ALL, also an akuter lymphatischer Leukämie. Das ist normalerweise kein Todesurteil. Die Chancen stehen dank der modernen Medizin recht gut. Etwa neunzig Prozent aller von ALL betroffenen Kinder und Jugendlichen überleben die nächsten zehn bis fünfzehn Jahre. Leider reicht in Almas Fall eine Chemotherapie nicht aus. Im Gegenteil. Statt ihr zu helfen, sorgt sie nur dafür, dass sie immer wieder Nasenbluten hat. Ich komme direkt von daheim, wo ich sie betreue, weil man im Krankenhaus nichts mehr für Alma tun kann. Es sei denn, wir finden sehr, sehr schnell einen passenden Stammzellenspender.«
Wallenfels sah sie stoisch an und wartete eine Weile, bis er sie fragte: »Haben Sie sich schon typisieren lassen?«
Ernsthaft?
Diese Frage machte Olivia so wütend, dass sie am liebsten aufgestanden wäre und ihren Stuhl durch den Raum geschmissen hätte. »Natürlich, was denken Sie denn?«
Das war das Erste, was sie getan hatte. Alle, die ihr nahestanden, hatten einen Mundabstrich machen und sich bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei, kurz DKMS, registrieren lassen. Um Almas Leben zu retten, hätte sie sich sämtliche Zähne ziehen lassen, wenn das für die Typisierung notwendig gewesen wäre, und das ohne Betäubung. Es gab nichts, was sie nicht für sie tun würde. Von dem Moment an, als ihr das Baby zum ersten Mal in die Arme gelegt worden war, hatte sie nicht gewusst, wie man einen Menschen noch mehr lieben konnte. Dieses perfekt zerbrechliche Wesen mit dem grummelig eingeknautschten Gesicht, den aufgeplusterten Backen und diesen Speckfüßchen, die wie Miniaturbrötchen aussahen. »Ich werde für dich leben. Und wenn es nötig ist, auch sterben«, war das Erste, was sie Alma ins Ohr geflüstert hatte. Und jeder, der Olivia etwas besser kannte, wusste, dass dies keine hohle Phrase war. Sie hatte ihre Selbstlosigkeit bereits im Alter von sechs Jahren bewiesen. Ihr kleiner Bruder Henry hatte gerade erst seinen vierten Geburtstag gefeiert und war wenige Tage später im Wintergarten ihres Köpenicker Elternhauses durch eine Glastür gelaufen. Er hatte sich die Brust aufgeschnitten und sehr viel Blut verloren. Die Ärzte im Krankenhaus hatten nicht genügend Konserven seiner seltenen Blutgruppe AB vorrätig, aber Olivia kam als Spenderin infrage. Also fragte einer der Ärzte nach Rücksprache mit ihren Eltern, ob sie ihren Bruder Henry retten wolle. Olivia überlegte nicht lange, verabschiedete sich von den Eltern und folgte dem Mediziner zur Blutspende. Danach fragte sie ihn: »Okay, und wie lange dauert es jetzt noch, bis ich tot bin?«
Als dem Arzt die Bedeutung dieses Satzes bewusst wurde, stiegen ihm die Tränen in die Augen. Olivia war tatsächlich davon ausgegangen, dass man sie mit der Bitte um eine Blutspende aufgefordert hätte, ihr Leben für das ihres kleinen Bruders zu opfern. Und das kleine Mädchen hatte nicht eine Sekunde gezögert.
So wie Olivia auch jetzt keinen Wimpernschlag lang zögern würde, alles für Alma zu opfern. Meinetwegen mein gesamtes Rückenmark. Nur leider wäre das sinnlos. Diesmal war sie, anders als damals bei Henry, nicht ausreichend kompatibel. Niemand in den weltweiten Spenderdateien war das. Bislang.
»Bitte, Herr Wallenfels«, versuchte sie daher zu dem Beamten durchzudringen. »Es geht um Leben und Tod. Ich muss Almas biologische Eltern finden.«
»Weil Sie glauben, die kommen als Stammzellenspender infrage?«
»Ja!« Olivia nickte mit ernster Miene.
»Sie glauben daran?«, wiederholte Wallenfels noch einmal und lächelte auf eine Art, die Olivia nicht zu deuten wusste.
So wie Wallenfels das Verb betont hatte, stieg jedoch in ihr die Ahnung auf, worauf er anspielte. Als er den linken Ärmel seines Oberhemds hochschob und ein Kreuz-Tattoo am Handgelenk freilegte, wusste sie es.
»Ich habe den Podcast gehört, Frau Rauch.«
Verdammt.
Sie schloss mit einem stillen Seufzer die Augen und hielt sie zwei tiefe Atemzüge lang geschlossen.
Selbst er hat es mitbekommen.
Dieser bescheuerte Podcast. Sechsunddreißig Jahre ihres Lebens war es ihr gelungen, sich aus dem Rampenlicht herauszuhalten. Noch nie war sie einer Intervieweinladung gefolgt, und von denen hatte sie seit ihrer Spezialisierung mehr als genug erhalten. Ihr Forschungsschwerpunkt war die Opferpsychologie. Schon mit ihrer Doktorarbeit hatte sie die Frage untersucht, weshalb die grausamsten Täter in ihrer Kindheit häufig selbst Opfer von Straftaten gewesen waren. Oft hatten sie sogar den gleichen Missbrauch erleiden müssen, den sie jetzt anderen antaten.
Doch Olivia scheute das mediale Rampenlicht und hatte noch nie verstanden, was Menschen daran reizte, den eigenen Namen in der Presse zu lesen, geschweige denn, das eigene Gesicht im Fernsehen zu sehen. Sie liebte ihr beschaulich zurückgezogenes Leben, ihre Privatsphäre und das diskrete Arbeiten als Juniorprofessorin an der Uni. Kaum etwas widerte sie mehr an als geltungssüchtige Kollegen, die aus den abscheulichsten Verbrechen Aufmerksamkeitskapital schlugen und damit auf Kosten der Opfer zu Berühmtheiten wurden.
Doch dann war ihre Mentorin krank geworden. Und sie hatte sie dummerweise als Expertin in dem populärwissenschaftlichen Psychologie-Podcast »Religiös motivierte Straftaten – wenn Glaube zum Wahn wird« vertreten.
»Haben Sie die ganze Sendung gehört oder nur die Instagram-Zusammenschnitte?«
Das Verrückte an der ganzen Angelegenheit war, dass dieser Podcast bereits vor zwei Jahren aufgezeichnet und ausgestrahlt worden war und damals keinerlei Beachtung gefunden hatte – bis ein für seine religiösen Texte bekannter Popmusiker mit seinem YouTube-Kanal seine Fans auf Olivia aufmerksam machte. Kurz darauf ging die Folge viral, und ihre Worte fanden sich plötzlich in den Massenmedien wieder.
FU-Professorin behauptet: Gläubige sind geisteskrank!
So hatte die verkürzte Schlagzeile einer stets mit verkürzten Schlagzeilen arbeitenden Zeitung gelautet. Mit der Folge, dass sie innerhalb von Stunden von einer unbekannten Wissenschaftlerin sowohl zu einem Hassobjekt gottesfürchtiger Menschen jedweder Glaubensrichtung geworden war wie auch zur Galionsfigur militanter Kirchenkritiker. Es dauerte einen Tag, bis ihr E-Mail-Postfach unter der Flut fanatischer Reaktionen in die Knie ging. Eine Woche, bis die ersten Farbbeutel die Fassade ihres Zehlendorfer Unibüros trafen. Einen Monat, bis der Shitstorm endlich etwas an Dynamik verlor und sie in ihren Vorlesungen nicht mehr ständig von Störern unterbrochen wurde.
»Das war aus dem Zusammenhang gerissen«, rechtfertigte sich Olivia zum hunderttausendsten Mal in der letzten Zeit.
»Ach ja?« Wallenfels zog eine Augenbraue nach oben.
»Gottgläubige Menschen erfüllen in psychopathologischer Hinsicht alle Kriterien von Geistesgestörten. Das haben Sie gesagt, oder etwa nicht?«
Nein. Ihr vollständiges Zitat lautete: Es gibt Menschen, die sagen: ›Gottgläubige Menschen erfüllen in psychopathologischer Hinsicht alle Kriterien von Geistesgestörten.‹ Zu denen zähle ich nicht!
Sie überlegte, ob sie mit Wallenfels diskutieren wollte, ahnte aber, dass sie auf verlorenem Posten kämpfte. Er hatte sein Urteil gefällt. Über sie. Und über ihre Anfrage auf Akteneinsicht.
Trotzdem versuchte sie es noch einmal mit einer flehentlichen Bitte. »Alma stirbt, wenn ich ihre biologischen Eltern nicht finde! Ich brauche nur die Namen.«
»Es tut mir leid«, sagte der Beamte, ohne es so zu meinen. »Meiner Kenntnis nach ist es ohnehin eher unwahrscheinlich, dass leibliche Eltern passende Stammzellenspender sind.«
Stimmt. Aber es ist der letzte Strohhalm, an den ich mich klammere.
Bei der Stammzelltransplantation kam es auf die sogenannte HLA-Kompatibilität an. Das Gewebematerial der weißen Spender-Blutkörperchen sollte am besten identisch mit dem des Empfängers sein, damit diese vom Körper nicht wieder abgestoßen wurden. Das allerdings war nur bei eineiigen Zwillingen der Fall. Bei Geschwistern, die ja jeweils zur Hälfte ihr genetisches Material von den Eltern bekamen, bestand immerhin noch eine 25-Prozent-Chance auf Übereinstimmung. Bei Eltern lag diese deutlich niedriger.
»Aber es gibt eine Chance«, sagte Olivia. »Aus gutem Grund wird bei einer Stammzelltherapie immer erst in der Familie des Patienten gesucht. Das will ich auch, doch ich kenne Almas Familie nicht.«
»Tja, das verstehe ich, dennoch kann ich nichts für Sie tun, Frau Rauch.«
Wallenfels schaffte es, einen kurzen Seufzer sarkastisch klingen zu lassen.
»Bringen Sie mir einen Beschluss des Familiengerichts, in dem angeordnet ist, dass ich die Identität von Almas biologischen Eltern preisgeben darf. Sonst sind mir die Hände gebunden.«
Scheißkerl, dachte Olivia zitternd und hoffte, sie würde erst in ihrem Auto in Tränen ausbrechen. Die Kälte, die sie vor dem Gebäude der Senatsverwaltung in der Bernhard-Weiß-Straße empfing, entsprach der frostigen Verabschiedung von Wallenfels, dessen Büro sie Türe schlagend verlassen hatte. Jetzt schon, nur wenige Sekunden später, ärgerte sie sich, dass ihr wieder einmal das Temperament durchgegangen war.
»Irgendwann einmal werden auch Sie dem Tode näher sein als dem Leben, und dann gnade Ihnen jener Gott, den Sie so inbrünstig anbeten, Herr Wallenfels!«
Verdammter Mist!
Sie hatte nichts erreicht, außer ihn gegen sich aufzubringen.
Gut gemacht, Olivia.
Sie zog die Schultern zusammen und stellte den Kragen ihres Wollmantels auf. Dummerweise hatte sie ihren Schal im Auto liegen lassen, und das stand einen guten Kilometer entfernt, irgendwo im Halteverbot. Den Minivan hatte ihr eine listige Verkäuferin mit dem Argument aufgeschwatzt, er wäre dank seinem großen Kofferraum die perfekte Einkaufs- und Familienkutsche. Im Verhältnis zu den meisten anderen Vans auf Berlins Straßen war das rotebetefarbene Mobil tatsächlich »mini«. In Mitte war es dennoch in etwa so praktisch wie ein Panzer. Nur Idioten fuhren damit in die parkplatzfeindliche Innenstadt, und Olivia hatte sich heute schon mehrfach idiotisch verhalten.
Es war kurz vor achtzehn Uhr, die Straßenlaternen brannten längst. Im Kopf rechnete sie die Fahrzeit bis nach Spandau aus, bis ihr einfiel, dass sie ja gar nicht mehr in diese Richtung zu fahren hatte. Kurz nachdem das geheime Liebesdoppelleben ihres Mannes Julian aufgeflogen war, war sie bereits ausgezogen, und das war nun schon über ein Vierteljahr her. Dennoch ertappte sie sich immer wieder dabei, dass sie nach einem langen Arbeitstag unwillkürlich die Route wählte, die ein gutes Jahrzehnt ihr Heimweg gewesen war.
Zu einem Zuhause, das es nicht mehr gibt.
Olivia hatte sich erst wenige Schritte vom Eingang entfernt, als sie hinter sich eine aufgeregte Frauenstimme ihren Namen rufen hörte. »Frau Rauch? Bitte warten Sie.«
Sie drehte sich zu der Person um, die schwer atmend auf sie zuging, als hätte sie gerade einen Spurt hinter sich.
»Ja?«, fragte Olivia die Frau, deren Alter schwer zu schätzen war. Ihre kehlige Stimme klang, als hätte sie die Pensionsgrenze längst überschritten. Der graue Hoodie mit den bekannten Boygroup-Konterfeis passte eher zu einem Teenager. Wegen des eisigen Nieselregens hatte sie die Kapuze über ihre ergrauten Locken geschlagen, was für Olivia den eigenartigen Eindruck erzeugte, als würde ein Mönch zu ihr sprechen: »Ich arbeite im Büro neben Herrn Wallenfels. Unsere Türen stehen immer offen. Daher hab ich Ihre Unterhaltung mitbekommen. Zwangsläufig.«
»Ach ja?«
Olivia war in Wallenfels’ Büro so angespannt und nervös gewesen, dass sie auf ihre Umgebung nicht geachtet hatte.
»Ich kenne Ihren Fall.«
»Dann können Sie mir …?«, fragte Olivia mit neu erwachter Hoffnung.
»Nein. Ich habe keinen Zugang zu der Akte. Nicht mehr.«
»Das verstehe ich nicht.«
Die namenlose Beamtin, die offenbar nicht vorhatte, sich ihr vorzustellen, schüttelte energisch den Kopf. »Die haben mir auf die alten Tage diese elende Digitalisierung aufgehalst. Ausgerechnet mir. Ich komm mit meinem Handy kaum klar und hab jetzt den Auftrag, alle Adoptionsfälle der letzten zwanzig Jahre einzuscannen.«
»Und?«
Die faltenumrandeten, dunklen Augen der Beamtin weiteten sich, als sie sagte: »Und Ihrer ist mir unter all den vielen besonders im Gedächtnis geblieben.«
Olivia fröstelte und wünschte sich ebenfalls eine Kopfbedeckung, auch wenn sie sich sicher war, dass die Kälte, die sie durchströmte, weniger vom Wetter als von den Worten der seltsamen Gesprächspartnerin rührte.
»Wieso das?«
Die Frau zögerte. Dann senkte sie die Stimme. Man musste keine Expertin der menschlichen Psyche sein, um anhand ihrer Körpersprache die Stresssymptome zu erkennen, die mit einer spontanen Angstreaktion einhergingen, als sie sagte:
»Haben Sie schon mal etwas vom Kalendermädchen gehört?«
Das Kalendermädchen.
Olivias Mund wurde trocken. »Wer soll das sein?«
»Sie …«
Ein Windhauch versuchte der Namenlosen die Kapuze von den Haaren zu wehen. Sie sah sich wieder um, diesmal schaute sie auch nach oben, zu Wallenfels’ Büro, und zuckte zusammen. Auch Olivia hatte den Schatten hinter der Gardine gesehen.
»Ich hab schon zu viel gesagt«, flüsterte die Kapuzen-Frau und wandte sich ab.
»Warten Sie«, rief Olivia ihr hinterher. »Wieso haben Sie mir überhaupt diesen Hinweis gegeben, wenn Sie so viel Angst haben?«
Wovor auch immer.
Wallenfels’ Büronachbarin blieb noch einmal stehen und drehte sich kurz zu ihr um. Dann gab sie die Erklärung, die Olivia bereits geahnt hatte. Die einzige, die keine Nachfrage nötig machte.
»Ich bin auch eine Mutter«, sagte sie.
Sekunden später war sie wieder im Gebäude verschwunden.
6. Kapitel
Wallenfels
Wallenfels stand am Fenster und sah, wie Olivia Rauch die Straße mit gebeugtem Kopf, dem stärker gewordenen Regen möglichst wenig Angriffsfläche bietend, bis zur Kreuzung ging, wo sie aus seinem Blickfeld verschwand.
Er setzte sich zurück an den Schreibtisch und griff sich einen Bleistift, mit dem er auf die Arbeitsplatte trommelte. Eine geraume Zeit lang starrte er auf das Poster an seiner Bürotür. Es zeigte ein kleines Mädchen, deren Schwarz-Weiß-Silhouette auf eine Häuserwand gesprüht war und aus deren ausgestreckter Hand ein roter Luftballon glitt. Vielleicht wollte sie ihn auch absichtlich aufsteigen lassen. Wallenfels hatte sich noch nicht entschieden, was das Werk des Street-Art-Künstlers Banksy ihm sagen wollte.
Von einer ungewohnten inneren Unruhe erfasst, löste er sich von dem Poster, angelte einen Schlüssel aus der obersten Schreibtischschublade und ging zu dem einzigen auf Dauer verschlossenen Aktenschrank. Zuvor schloss er die Durchgangstür zum Büro seiner Kollegin.
Es dauerte eine Weile, bis er in den Hängeordnern unter RO–RU gefunden hatte, wonach er suchte. Wallenfels löste den Schriftsatz aus dem Hefter, blätterte zur letzten Seite und prägte sich die in der rechten oberen Ecke handschriftlich notierte Telefonnummer ein.
Dann ging er auf die Mitarbeitertoilette, wo sich bereits die Tür des Waschvorraums zum Flur abschließen ließ. Nachdem Wallenfels sich vergewissert hatte, dass außer ihm niemand die Örtlichkeit benutzte, drehte er den Wasserhahn auf und wählte die auswendig gelernte Nummer.
Das vom stetigen Wasserrauschen verschluckte Gespräch dauerte nicht lange, nachdem der Mann am anderen Ende abgenommen hatte. Im Grunde bestand es nach dem müden »Hallo?« des Angerufenen nur aus einem einzigen Satz.
»Sie beginnt, Staub aufzuwirbeln«, sagte Wallenfels und legte auf. Auf dem Rückweg zum Schreibtisch hatte er das ungute Gefühl, dass heute der Tag gekommen war, an dem der lange Arm der Wahrheit in die Vergangenheit zurückreichen und ein begraben geglaubtes, schreckliches Geheimnis zutage fördern würde.
Einundzwanzig Jahre nachdem der Schrecken seinen grauenhaften Anfang genommen hatte. Damals, auf Schloss Lobbeshorn …
7. Kapitel
Einundzwanzig Jahre zuvor Internat Schloss Lobbeshorn Valentina
Valentina starrte erst auf den Schwangerschaftstest, dann auf die leere Medikamentenschachtel, schließlich auf die Bibel und wollte sterben. In dieser Sekunde, hier im Direktorenzimmer des Internats, ahnte das sechzehnjährige Mädchen nicht, wie nah sie dem Tod bereits war.
»Ihr wisst, was ihr verbrochen habt?«, fragte Frau Dr. Stella Großmuth, die Schulleiterin von Lobbeshorn. Ihre Dauerwellenfrisur sah altmodischer aus als der antike Schreibtisch, hinter dem sie thronte. Valentina fand, sie wirkte sogar älter als das Schlossgebäude, in dem das private Internat untergebracht war.
»Wir lieben uns, das ist ja wohl kein Verbrechen!«, wagte Ole zu antworten. Er stand gemeinsam mit Valentina vor dem Schreibtisch der Direktorin und griff nach ihrer Hand; ein mutiges Zeichen in einer feindseligen Umgebung. Wieder einmal bewunderte Valentina die Courage ihres Freundes. In Situationen, wo sie sich am liebsten unsichtbar gemacht hätte, zeigte er ein Selbstbewusstsein, das man dem schlaksigen Teenager mit den verstrubbelten Haaren auf den ersten Blick niemals zugetraut hätte. Sie selbst hatte allerdings schon beim ersten Zusammentreffen bemerkt, dass er sich wohltuend von den anderen Schülern unterschied. Er war nicht nur klüger und humorvoller, sondern auch sensibler.
»Nimm deine sündigen Finger von ihr!«, befahl ihm die Direktorin. Er gehorchte, wenn auch widerwillig, vermutlich aus Angst, Stella könnte Valentina bestrafen, falls er sich ihr widersetzte.
Die Schulleiterin kniff die ohnehin schon schmalen blassgrauen Augen zusammen und drehte an ihrem wuchtigen Siegelring mit dem Schulwappen. »Der Apfel fällt bei dir wirklich nicht weit vom Stamm!«, sagte sie zu Ole und spielte damit auf die Verfehlungen seiner Eltern an. Beide hatten sich der Steuerhinterziehung, Insolvenzverschleppung und Untreue in Millionenhöhe schuldig gemacht und saßen eine langjährige Gefängnisstrafe ab.
»Dass du noch nicht einmal jetzt von ihr ablassen kannst, nach all dem, was du schon angerichtet hast!«, fauchte sie den Schüler an.
Valentina strich sich unbewusst über den Bauch. Ihr war übel, aber unter ihren schwarzen Leggings deutete sich nicht die kleinste Wölbung an. Dazu war es noch viel zu früh. Ole und sie waren zwar bereits seit anderthalb Jahren ein Paar, doch ihre erste gemeinsame und verhängnisvolle Nacht in der Turnhalle lag gerade mal drei Wochen zurück.
»Allerdings verstehe ich, wie schwer es einem Heranwachsenden fallen kann, sich ihr zu widersetzen!« Stella sprach über Valentina, als wäre sie nicht mehr im Raum. »Im Sommer mit den viel zu kurzen Röcken und den bauchnabelfreien Tops, oder wie heute mit diesem schamlos eng anliegenden Rollkragenpulli. Dann diese offenen Haare.«
Valentina wischte sich unwillkürlich eine ihrer braunen Strähnen aus der Stirn, derweil breitete Stella gönnerhaft die Hände aus und plusterte die Backen auf, womit sie nicht mehr ganz so hohlwangig aussah. »Meinetwegen dürftet ihr euch lieben, so viel ihr wollt. Das ist mir gleichgültig. Nicht egal ist mir hingegen, wenn ihr gegen das fünfte Gebot verstoßt!«
»Wir haben doch niemanden getötet!«, widersprach Ole genauso perplex, wie Valentina es war.
»Aber ihr habt es versucht!«, knurrte Stella. Ihre Stimme war leise wie das Flüstern eines Bächleins, und gerade das machte sie für Valentina unerträglich. Sie wäre lieber angeschrien worden. Dann hätte es eine Chance gegeben, dass mit dem Gebrüll der Internatsleiterin auch ihre Wut verraucht wäre. So aber glich Stella einem Vulkan, der die ersten Ausbruchsanzeichen zeigte.
»Wir reden doch nicht etwa hierüber?«, fragte Ole und zeigte auf die Medikamentenschachtel auf Stellas Schreibtisch. Henriette, ihre intrigante Zimmerkameradin, musste sie im Badezimmermülleimer gefunden und sie an die Direktorin weitergeleitet haben. Anders konnte Valentina es sich nicht erklären, wie das alles ans Licht gekommen war.
Stella erhob sich von ihrem Schreibtischstuhl. Damit nahm sie Valentina die Sicht auf die hügelige Winterlandschaft hinter ihrem Fenster. Der Blick auf die vereisten Nadelbäume im Schlosspark hatte sie bislang von der grauenhaften Schulleiterin mit ihren noch grauenhafteren Reden ablenken können. Jetzt konnte sie nicht anders, als dem Schrecken direkt ins Gesicht zu blicken.
»Ich weiß, ihr versteht das nicht«, sagte Stella, noch immer leise und offenbar auf jedes Wort bedacht. »Ihr habt keinen Glauben und damit keinen Respekt vor dem Leben. Aber ich habe Werte und Prinzipien, und die versuche ich an euch hier in dieser Anstalt weiterzugeben. Auch wenn ihr mich deswegen belächelt. Etwa, wenn ich darüber spreche, weshalb bereits ein Kondom eine Abtreibung und Abtreibung eine unverzeihliche Sünde ist.« Sie nahm die Medikamentenschachtel in die Hand. »Ihr wolltet eine Leibesfrucht verhindern, ergo abtöten.«
Ja. Und leider haben wir damit zu lange gewartet, dachte Valentina; zu ängstlich, es auszusprechen.
Sie hatten nicht geplant, miteinander zu schlafen. Es hatte sich im Eifer ihrer Leidenschaft ergeben, und keiner von ihnen hatte an Verhütung gedacht. Es war Wochenende. Die nächstgelegene Apotheke öffnete erst wieder am Montag. Da war es offenbar schon zu spät gewesen für die Pille danach, wie der Schwangerschaftstest anzeigte, zu dem sie die Direktorin vor nicht einmal zehn Minuten auf ihrer Bürotoilette gezwungen hatte.
»Werden Sie unsere Eltern informieren?«, fragte Valentina. Es waren ihre ersten laut ausgesprochenen Worte.
Stella lächelte geringschätzig. »Du meinst deinen Vater, der sich so sehr für seine lüsterne Tochter interessiert, dass er sie noch nicht einmal über Weihnachten zu sich nach Hause holt?«
Sie deutete auf Ole. »Deine Eltern verbüßen ja noch immer ihre gerechte Strafe im Gefängnis. Ihr bleibt über die Feiertage somit beide zusammen im Hort!«
Valentina spürte, wie ihr die Schamesröte ins Gesicht schoss. Es war erst das zweite Weihnachten nach Mutters Tod. Vater hatte ihr versprochen, dass sie es mit ihm und seiner neuen Freundin verbringen dürfe. Heute war der zehnte Dezember. Die Privatschule hatte dieses Jahr wegen dringend notwendiger Renovierungen ausnahmsweise früher als sonst geschlossen, und die meisten ihrer Mitschüler waren bereits abgeholt worden.
Nun ja, wenigstens muss ich Papa dann nicht die Schande beichten, dachte sie bitter.
»Euren Erzeugern seid ihr gleichgültig«, fuhr Stella fort. »Nicht aber unserem Schöpfer. Vor dem gibt es keine Geheimnisse.«
»War’s das?«, wollte Ole wissen und machte Anstalten zu gehen.
Stella fuchtelte mit dem Zeigefinger in seine Richtung, ihre Stimme blieb weiterhin ruhig. »Hiergeblieben! Dir werden deine Frechheiten schon vergehen, sobald du merkst, was ich für euch als Buße im Sinn habe.«
»Buße?«, entfuhr es Valentina.
Die Direktorin nahm wieder Platz und griff zu einer Lesebrille, bevor sie einen Blick in die Bibel warf. »Ihr kennt doch sicher das erste Buch Mose, Kapitel 3, Vers 16?«
Ihre knochigen Finger schienen nach dem entsprechenden Absatz zu suchen, den sie unter Garantie auswendig konnte.
»Du sollst mit Schmerzen Kinder gebären!«, las sie vor.
Stella sah auf und blickte Valentina direkt in die Augen.
»Na, das wird bei dir mit deinen schmalen Hüften ganz sicher der Fall sein. Aber darauf will ich nicht hinaus. Mir geht es gleich um die erste Zeile des Bibelzitats. Darin heißt es nämlich: Und zum Weibe sprach er: Ich will dir viel Schmerzen schaffen, wenn du schwanger wirst.«
Stella lächelte. In ihren blassgrauen Augen blitzte etwas auf, das Valentina schon einmal in Henriettes Blick gesehen hatte; vor drei Monaten, als sie diese in letzter Sekunde davon abhalten konnte, mit Absicht auf eine verletzte Maus im Hof zu treten.
»Was haben Sie mit Valentina vor?«, fragte Ole.
Welche Schmerzen willst du mir bereiten?
Stella lachte freudlos. »Nicht mit ihr. Mit euch. Ihr beide habt euch versündigt. Ihr beide müsst Abbitte leisten.«
Von draußen schallte das Gelächter einiger Schulkameraden herauf. Für Valentina hörte es sich an, als würden sie hier oben von einem unsichtbaren Publikum verhöhnt.
»Nun, ihr habt das Glück, in diesem Jahr die Einzigen zu sein, die im Ferienmonat und über die Feiertage auf Schloss Lobbeshorn betreut werden müssen. Ihr allein werdet in den Genuss eines ganz besonderen Adventskalenders kommen, den ich für euch vorbereitet habe!«
Stella schlug die Bibel zu und lehnte sich in ihrem Arbeitssessel zurück. »Ich werde für euch vierundzwanzig Türen im Schloss schmücken. Vierundzwanzig Türen, durch die ihr gehen müsst und hinter denen euch vierundzwanzig Aufgaben erwarten. Manchmal mehrere an einem Tag.«
»Was sind das für Aufgaben?«, wollte Ole wissen.
Das Lächeln um Stellas dünne Lippen verhieß ebenso wenig Gutes wie ihre knappe Antwort: »Die wird Andrea euch zeigen.«
Andrea?
Valentina kannte weder eine Lehrerin noch eine Schülerin mit diesem Namen.
»Meine rechte Hand!«, erklärte Stella weiter.
»Was, wenn wir nicht mitmachen?«, fragte Ole mit aufmüpfig vorgestrecktem Kinn.
Wieder schenkte ihnen die Direktorin ein Lächeln, das sich für Valentina wie eine Ohrfeige anfühlte. »Oh, ihr macht schon längst mit!«
Stella zeigte zum Eingang des Direktorenzimmers. Ole und Valentina drehten sich um, als hätten sie vergessen, wie sie hier hereingekommen waren.
»Ihr seid bereits durch Tür Nummer eins meines Bußkalenders hindurchgegangen«, sagte die Internatsleiterin und klatschte freudig in die Hände. »Und da kommt auch schon die erste Aufgabe für euch!«
Mit diesen Worten öffnete sich die Tür, und Valentina hatte das Gefühl, als sähe sie dem Tod persönlich dabei zu, wie er das Zimmer betrat. Mit einem kleinen, mintfarbenen Umschlag in der Hand, den er vor Ole und Valentina auf dem Boden ablegte, nachdem er die Tür hinter sich abgeschlossen hatte.
8. Kapitel
21 Jahre später Heute Olivia
Die letzten Meter bis zum Eingangstor zu ihrem derzeitigen Wohnhaus waren für Olivia ein Spießrutenlauf. Es war Mitte Dezember, und jedes zweite Geschäft rund um den Olivaer Platz hatte wenigstens einen blinkenden Weihnachtsbaum vor der Tür stehen.
»Ausweichen ist keine Lösung«, hörte sie die Stimme ihres Therapeuten im Kopf, den sie einmal im Monat aufsuchte. »Sie müssen sich Ihren Ängsten stellen!«
Gut gebrüllt, Herr Kollege. Sie haben gut reden. Sie müssen ja nicht alle zwanzig Sekunden eine haarige Spinne auf der Zunge balancieren.
Denn genauso fühlte es sich für sie an, wenn sie ein festlich geschmücktes Schaufenster, eine Lichterkette an einer Häuserwand oder einen mit Christbaumkugeln und Lametta behängten Weihnachtsbaum sah – so wie jetzt im Eingang des Mehrfamilienhauses, in dem sie das möblierte Appartement für sich und Alma gemietet hatte.
Olivia spürte eine so intensive Angst, dass ihr körperlich schlecht wurde. Und auch wenn die Panik, die sie oftmals dazu brachte, sich übergeben zu müssen, sehr viel schneller überwunden war als eine Lebensmittelvergiftung, waren die Symptome in den ersten Sekunden vergleichbar: Ganzkörperkrampf, Schweißausbruch, allumfassender Ekel.
Leider gab es in ihrem Umfeld seit der Trennung von Julian kaum noch jemanden, der sie verstand und mit dem sie über ihr Leiden reden konnte. Psychische Erkrankungen wurden von weiten Teilen der Gesellschaft ohnehin schon nicht ernst genommen. Bei ihr kam erschwerend hinzu, dass sie unter einer Angststörung litt, die selbst für ihre eigenen Ohren einen lächerlich niedlichen Namen trug: die Santaclausophobie.
»Moment mal, du hast Angst vorm Weihnachtsmann?« Auch ihre beste Freundin Evi, die aktuell auf Mallorca lebte, hatte sich ein Grinsen nicht verkneifen können, als Olivia sich ein Herz gefasst und ihr die Diagnose ihres Therapeuten verraten hatte.
»Leider nicht nur vor dem«, hatte sie geantwortet. Bärtigen Männern in rot-weißen Nikolauskostümen konnte sie in der Adventszeit vielleicht noch aus dem Weg gehen. Ihre Phobie bezog sich allerdings auf alles, was mit Weihnachten zu tun hatte: Lebkuchengebäck, Adventskalender, Christbäume – besonders schlimm war es, wenn sie ein bestimmtes Weihnachtslied hörte: Jingle Bells. Letztes Jahr hatte sie den Fehler gemacht und auf dem Heimweg das Autoradio laufen lassen, als der Sender es plötzlich spielte. Olivia hatte beinahe einen Auffahrunfall verursacht, als sie, ohne zu blinken, hyperventilierend und den Tränen nahe rechts rangefahren war. Erst nach Minuten war ihr klar geworden, wo sie zum Stehen gekommen war: in einer Nothaltebucht mitten im Britzer Tunnel der Berliner Stadtautobahn.
Fast so wie vor vierundzwanzig Jahren. Als ich Henry verlor.
Zwei Tage vor Weihnachten war ihr kleiner Bruder von einem stark alkoholisierten Autofahrer getötet worden. Mit mehr als 2,3 Promille im Blut, wie man später feststellte. Der Raser hatte sie auf der Stadtautobahn geschnitten.
Vielleicht lief im Radio Jingle Bells, als ihr Vater die Kontrolle über den VW verlor. Vielleicht spielte es erst, als die Feuerwehr sie aus dem Wrack schnitt. Vielleicht war es während der Rettungsarbeiten in ihr Unterbewusstsein gekrochen, wie ihr Therapeut vermutete, weil dieses Lied Olivia seitdem so sehr triggerte. Nichts davon wusste sie mit Sicherheit. Sie konnte sich nur daran erinnern, wie sie mit schweren inneren Verletzungen im Krankenhaus aufgewacht war, deretwegen sie später keine eigenen Kinder mehr bekommen sollte. Eine Woche hatte sie um Henry gebangt, der durch die Wucht des Aufpralls durch die Windschutzscheibe in den Gegenverkehr geschleudert worden war. Bis feststand, dass ihn dieses Mal keine Bluttransfusion der Schwester mehr würde retten können.
Während um sie herum die christlichen Feiertage gefeiert wurden, hatte ihr Vater am Bett des Bruders gesessen und fast unaufhörlich gebetet. Umsonst.
Henry war gestorben – wie auch Olivias Mutter wenige Monate später vor Kummer. Seitdem glaubte Olivia nicht mehr an ein höheres Wesen, das ihre Geschicke lenkte. Denn wenn diese Schicksalsschläge vorherbestimmt gewesen wären, müsste sie auch an das Böse glauben. An einen sadistischen Gott, der sich den Tod ausgedacht hatte, auch weil er sich am Leid seiner menschlichen Marionetten erfreute.
Nein, Olivia glaubte nicht länger an eine biblische Kraft, wohl aber an den Menschen. Der – trotz allem – in erster Linie gut war. Das hatte sie paradoxerweise nicht zuletzt auch ihre Arbeit mit extremen Straftätern gelehrt. Niemand kam mit dem Vorsatz zur Welt, das eigene Kind an ältere Männer zu verkaufen, das Gesicht seiner Frau mit Säure zu verätzen oder durch eine Trunkenheitsfahrt eine Familie zu zerstören.
Die Mehrheit war gut, die friedliebenden, gewaltlosen Helfer stets in der Überzahl.
Das Gute ist die Regel.
Und das, obwohl es so viele Verbrechensopfer gab. Allein in Deutschland wurden jedes Jahr etwa zwanzigtausend Kinder Opfer sexueller Gewalt. Hundertachtzigmal am Tag registrierten die Jugendämter Fälle von Kindeswohlgefährdung. Das waren fünfundsechzigtausend verletzte Körper und Seelen, die meisten unter zehn Jahre alt. Offiziell.
Die Dunkelziffer dürfte sehr viel höher liegen. Und dennoch schaffte es die Mehrzahl dieser Opfer im weiteren Verlauf ihres Lebens, die Spirale der Gewalt zu durchbrechen und nicht selbst zum Täter zu werden.
»Man kann ein gutes Leben trotz der Gewalt führen – oder ein schlechtes wegen ihr. Der freie Wille wird selbst durch das schlimmste erlittene Verbrechen nicht notwendigerweise zerstört!«
Das war ein Zwischenfazit ihrer Doktorarbeit gewesen.
Das Böse ist die Ausnahme.