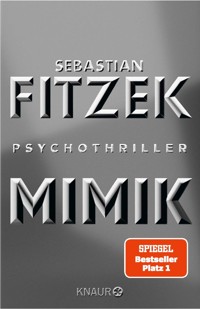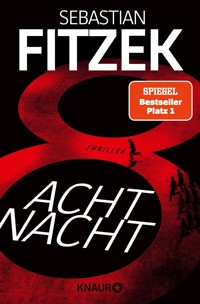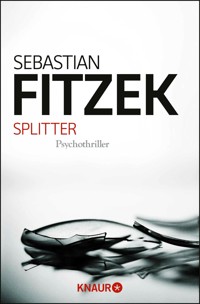9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Nummer-1-SPIEGEL-Bestseller von Sebastian Fitzek: Ein vermisstes Kind – ein verzweifelter Vater – ein Höllentrip von einem Psycho-Thriller! Zwei entsetzliche Kindermorde hat er bereits gestanden und die Berliner Polizei zu den grausam entstellten Leichen geführt. Doch jetzt schweigt Guido T., der im Hochsicherheitstrakt der Psychiatrie einsitzt, auf Anraten seiner Anwältin. Die Polizei ist sicher: Er ist auch der Entführer des sechsjährigen Max, der seit einem Jahr spurlos verschwunden ist. Die Ermittler haben jedoch keine belastbaren Beweise, nur Indizien. Und ohne die Aussage des Häftlings werden Max' Eltern keine Gewissheit haben und niemals Abschied von ihrem Sohn nehmen können. Monate nach dem Verschwinden von Max macht ein Ermittler der Mord-Kommission dem verzweifelten Vater ein unglaubliches Angebot: Er schleust ihn in das psychiatrische Gefängnis-Krankenhaus ein, in dessen Hochsicherheitstrakt Guido T. eingesperrt ist. Als falscher Patient, ausgestattet mit einer fingierten Krankenakte. Damit er dem Kindermörder so nahe wie nur irgend möglich ist und ihn zu einem Geständnis zwingen kann. Denn nichts ist schlimmer als die Ungewissheit. Dachte er. Bis er als Insasse die grausame Wahrheit erfährt ... Bestseller-Autor Sebastian Fitzek schickt Sie mit diesem Psycho-Thriller auf einen genial-verstörenden Trip in die Psychiatrie. "Sebastian Fitzek hat diesmal einen besonderen raffinierten Dreh gefunden, seine Leser mit wachsender Spannung komplett in die Irre zu führen." Sächsische Zeitung
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 419
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Sebastian Fitzek
DER INSASSE
Psychothriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Vor einem Jahr verschwand der kleine Max Berkhoff.
Nur der Täter weiß, was mit ihm geschah.
Doch der sitzt im Hochsicherheitstrakt der Psychiatrie und schweigt.
Max’ Vater bleibt nur ein Weg, um endlich Gewissheit zu haben: Er muss selbst zum Insassen werden.
DER INSASSE
Um die Wahrheit zu finden, muss er seinen Verstand verlieren.
Inhaltsübersicht
Motto
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
Die Danksagung
Hinweis
Das Quiz für dein nächstes Fitzek-Abenteuer
Leseprobe »Der Nachbar«
Ich war einst glücklich, wenn auch nur im Traum.
Doch ich war glücklich.
Edgar Allan Poe,Träume
1.
Wieso ist es hier so kühl?
Dafür, dass Myriam gerade die Hölle betrat, war es viel zu kalt hier unten, in dem fensterlosen Kellerverschlag mit den feuchten Ziegelwänden, an denen der schwarze Schimmel wie Krebs in den Bronchien einer Raucherlunge haftete.
»Vorsicht«, mahnte der Polizist und deutete auf ihren Kopf, den sie einziehen musste, wenn sie beim Übergang in den Heizungskeller nicht an ein Abwasserrohr stoßen wollte. Dabei war Myriam nur eins fünfundsechzig groß. Ganz anders als Tramnitz, der für den entsetzlichen Anlass viel zu attraktiv aussah. Breite Schultern, hohe Stirn, schlank, aber muskulös. Wie geschaffen für das Titelblatt des Berliner Polizeikalenders, wenn es denn einen gab. Hier unten aber verfingen sich Staub und Spinnweben in seiner blonden »Ich hab mal wieder keinen Schlaf bekommen«-Frisur, so dicht klemmte der Kopf unter der Kellerdecke. Das Häuschen am Rand des Grunewalds stammte aus den Zwanzigerjahren des letzten Jahrhunderts. Damals waren die Menschen hier offenbar kleiner gewesen.
Und ganz sicher nicht so böse wie der letzte Bewohner dieses Hauses. Oder etwa doch?
Myriam schluckte und versuchte sich zu erinnern, wie der freundliche Beamte mit Vornamen hieß, der sie zu Hause abgeholt und hier rausgefahren hatte.
Nicht, dass es irgendwie wichtig wäre. Sie versuchte nur, sich abzulenken. Aber es gelang ihr nicht, harmlose Gedanken zu entwickeln. Nicht hier in einem Keller, der nach Blut, Urin und Angst roch.
Und Tod.
Tramnitz löste das rot-weiße Tatortband, das die Spurensicherung als X in den offenen Türrahmen geklebt hatte. POLIZEIABSPERRUNG stand darauf, wieder und wieder wiederholte sich das Wort in schwarzen Lettern auf dem Flatterband.
Doch Myriam las: »NICHT WEITERGEHEN! NICHT HINSEHEN!«
»Hören Sie.« Der Kommissar rieb sich nervös seinen Dreitagebart. Im Licht der staubigen Kellerlampe sah er aus, als leide er unter Gelbsucht. »Wir dürften hier eigentlich nicht sein.«
Myriam wollte gleichzeitig nicken und den Kopf schütteln (Nein, dürften wir nicht. Aber: Ja, ich muss das machen), was im Ergebnis dazu führte, dass ihr Oberkörper merkwürdig zuckte.
»Doch, ich will es sehen«, sagte sie.
Sie sagte es, als ginge es um einen Gegenstand. Den Schrecken beim Namen, bei ihrem Namen zu nennen, brachte sie nicht über sich.
»Ich überschreite hier meine Befugnisse. Der Tatort ist noch nicht freigegeben, und die Bilder …«
»Schlimmer als die in meinem Kopf können sie nicht sein«, sagte Myriam kaum hörbar. »Bitte, ich muss es mit eigenen Augen sehen.«
»Okay, aber Vorsicht!«, mahnte der Polizist ein zweites Mal, nun deutete er auf die Stufen vor ihnen. Die kleine Holztreppe knarzte trocken unter ihren Turnschuhen. Tramnitz zog eine milchige Plastikplane wie einen Duschvorhang zur Seite. Dahinter lag eine Art Vorkeller, der von seinem Besitzer vermutlich als Umkleide oder Garderobe genutzt worden war, bevor es einige Schritte weiter durch eine angelehnte Brandschutztür in die Hölle ging.
Eine Briefträgeruniform hing ordentlich auf einem Bügel an einer Kupferleitung. Daneben stand eine Sackkarre mit Paketen.
»Also doch«, entfuhr es Myriam.
Tramnitz nickte. Er blinzelte, als sei ihm etwas vom Staub, der hier unten die stickige Atemluft durchsetzte, in die Augen geraten. »Ihr Verdacht hat sich bestätigt.«
Großer Gott.
Myriam griff sich an die Kehle, unfähig zu schlucken, ihr Mund war wie ausgedörrt.
Als die Polizei nach Wochen noch immer keine Spur von Laura gefunden hatte, machte sich Myriam auf eigene Faust auf die Suche nach ihrer Tochter. Befragte noch einmal alle Nachbarn, alle Mitarbeiter in den Ladengeschäften rund um den Spielplatz des Schweizer Viertels, auf dem ihre Tochter das letzte Mal gesehen worden war.
Es war eine ältere, leicht altersdemente Mieterin, deren Aussage man offenbar nicht ernst genommen oder nicht weiterverfolgt hatte, sicher auch, weil sie beim Reden sehr schnell den Faden verlor und plötzlich anfing, in Erinnerungen zu schwelgen. Jedenfalls meinte die Dame, am Tag der Entführung einen Postboten beobachtet zu haben. Er habe ihr leidgetan, weil ihm niemand geholfen habe mit seinen vielen Paketen, die er alle wieder hatte zurücknehmen müssen; den ganzen langen Weg von dem Wohnblock in der Altdorfer zurück zu seinem DHL-Laster, weil die Empfänger nicht zu Hause waren. Dann schweifte sie ab – er habe sie an ihren Neffen erinnert –, was ihrer Glaubwürdigkeit nicht zuträglich gewesen war.
Und doch hat sie den wichtigsten aller Hinweise gegeben!
»Er hat sich tatsächlich als Zusteller getarnt«, bestätigte Tramnitz und stieß sanft mit dem Fuß gegen einen etwa anderthalb Meter hohen Paketstapel, der auf einer Sackkarre an der Wand ruhte. Erst zu ihrem Erstaunen, dann zu ihrem Entsetzen kippte der Stapel um, obwohl der Polizist ihn kaum berührt hatte.
»Pappmaché«, erklärte Tramnitz. »Hohl.«
Es war eine ausgehöhlte Attrappe.
Einen Meter fünfzig hoch.
Genug Platz für eine Siebenjährige.
»Laura«, stöhnte Myriam. »Mein Baby. Was hat er mit ihr gemacht?«
»Er hat sie betäubt, um sie, in dieser Attrappe versteckt, unbehelligt zu seinem Transporter zu schleppen. Kommen Sie.«
Tramnitz’ starke Hände zogen die Brandschutztür auf, an der außen ein alter Aufkleber von Sound & Drumland klebte. War es möglich, dass das Monster Musik liebte?
So wie Laura?
Myriam musste an das Kinderklavier denken, das sie erst im letzten Sommer gekauft hatten und das in den vergangenen Wochen so unerträglich still im Wohnzimmer gestanden hatte.
Hier unten hingegen war es unerträglich laut. Hier, in dem quadratischen Keller, den sie gerade betrat, glaubte Myriam, die Schreie ihrer Tochter zu hören. Ein Echo der Erinnerung, das von den leichengrauen Wänden und dem gefliesten Boden mit dem Abfluss in der Mitte widerhallte. Über ihnen baumelte eine nackte, mit weißer Farbe besprenkelte Glühbirne, die mehr Schatten als Licht zu spenden schien.
»Was ist das?«, krächzte Myriam und deutete auf die Kiste, die an der Wand vor ihnen stand.
Tramnitz kratzte sich den ausrasierten Haaransatz im Nacken und musterte den kantigen Holzverschlag. Die Kiste ruhte auf einem Metalltisch, der an den Seziertisch eines Rechtsmediziners erinnerte. Sie war aus braunem Pressholz gezimmert, etwa anderthalb Meter lang und dreißig Zentimeter breit. In der ihnen zugewandten Längswand waren im handbreiten Abstand zwei kreisrunde Löcher ausgestanzt, etwas größer als die Spielfläche eines Tischtennisschlägers. Sie waren mit einer blickdichten Folie bespannt, ebenso wie die Oberseite der Kiste, weswegen Myriam nicht sehen konnte, was sich in ihrem Inneren befand.
»Das ist ein Brutkasten«, sagte Tramnitz, und die Hölle des Kellers wurde noch kälter. Myriam wurde schlecht, als sie verstand, dass die Löcher Eingriffe darstellten, durch die man das berühren konnte, was sich hinter den Wänden des »Brutkastens« verbarg.
»Was hat er ihr angetan? Was hat er meinem Baby nur angetan?«, fragte sie Tramnitz, ohne ihn anzusehen.
»Der Täter hat viele Jahre auf einer Frühgeborenenstation gearbeitet, bis er wegen unsittlichen Verhaltens gefeuert wurde. Das hat er nie verwunden. Hier unten schuf er sich seine eigene Babystation.«
»Um was zu tun?«
Myriam trat einen Schritt näher, streckte die Hand aus, aber sie zitterte zu sehr. Sie schaffte es nicht. Als befände sich ein Magnetfeld um den »Brutkasten«, das ihre Finger umso stärker abstieß, je näher sie ihm kam, um die Folie abzureißen.
Tramnitz trat von hinten an sie heran. Berührte sanft ihre Schultern, räusperte sich. »Wollen Sie das wirklich?«
Sie nickte, anstatt schreiend wegzurennen.
Der Beamte riss die Plastikfolie von dem »Brutkasten«, und Myriam schaffte es nicht schnell genug, die Augen zu schließen. Sie hatte es gesehen, und das Bild des Grauens hatte ihr Gedächtnis markiert wie ein Brandeisen die Haut eines Tieres.
»Laura«, stieß sie keuchend hervor, denn es gab keinen Zweifel. Der Körper war zwar über und über mit geruchsbindendem Katzenstreu bedeckt, und unter den weit geöffneten Augen kringelten sich bereits die Maden, aber Myriam hatte sie erkannt: an ihrem Grübchen am Kinn, am Leberfleck neben der rechten Augenbraue, an der Lillifee-Spange, die ihren widerspenstigen Pony zähmte.
»Er hat sich um sie gekümmert.«
»Was?«
Myriams Geist war meilenweit von allem wirklichen Leben entfernt, verloren in einem Meer aus Schmerz und Seelenqualen. Die Worte des Polizisten schwappten wie aus einer anderen Dimension in ihr Bewusstsein und ergaben keinen Sinn.
»Er gab ihr Nahrung, Medikamente, Wärme. Und Liebe.«
»Liebe?«
Myriam fragte sich, ob sie den Verstand verloren hatte.
Sie drehte sich zu Tramnitz, sah zu ihm auf. Im Schleier ihrer Tränen verschwamm das attraktive, symmetrische Gesicht des Polizisten wie hinter einer Regenwand.
Zu ihrem Entsetzen begann er zu glucksen. »Oh, das ist ja noch viel besser, als ich gehofft habe. Dieser Ausdruck in Ihrem Gesicht!«
Das war der Moment, in dem Myriam sich sicher war, dass es keinen Gott mehr gab. Nur noch sie, Lauras Leiche und den Teufel direkt vor ihr.
»Sie sind gar kein Polizist«, wollte Myriam noch schreien, »Sie waren das! Sie haben mein Baby entführt, gequält und ermordet!«
Doch all diese Worte fanden den Weg nicht mehr aus ihrem Mund, da Myriam eine Axt direkt zwischen die Augen gefahren war.
Das Letzte, was sie in diesem Leben hörte, war ein schmerzhaft splitterndes Geräusch, als würde ein ganzer Wald knochentrockener Zweige direkt in ihren Ohren zerbrechen, nur noch überlagert von dem ekelerregenden Lachen, das Guido Tramnitz entfuhr, während er zuschlug. Wieder und wieder.
Und wieder.
Bis alles um ihn und sie herum ein einziger roter Nebel war, dann ein letzter, heftiger Schmerz. Dann nichts mehr.
Nicht einmal mehr schwarz.
2.
Das Baby erstickte, aber das war dem Glatzkopf egal.
Er hob die Faust und ließ sie wie Thors Hammer auf Tills Motorhaube krachen. »Fahr die Scheißkarre hier weg, das ist eine Einbahnstraße!«
»Drücken Sie weiter. Dreimal, wie besprochen, Sie schaffen das«, sagte Till, der gerade aus seinem Rettungswagen ausgestiegen war.
Er sprach nicht zu dem Hünen vor ihm auf der Straße, der den Trainingsanzug für seine Muskeln drei Nummern zu klein gewählt hatte, sondern zu der Mutter am Telefon, die vor Panik zu hyperventilieren drohte.
Ihr Notruf war vor fünf Minuten eingegangen. Seitdem versuchte Till sie fernzusteuern: »Dann wieder Mund-zu-Mund-Beatmung. Wir sind gleich da.«
Vorausgesetzt, Mr Boxerstiefel lässt uns endlich durch.
Noch etwa vierhundert Meter Luftlinie trennten sie von der Frau, und sie hatten die Abkürzung über den Eichkatzweg genommen, um einen Unfall auf der Eichkampstraße zu umfahren. Aber weil der Idiot mit seinem SUV den Weg nicht freimachen wollte, kamen sie in der engen Einbahnstraße mit ihrem Rettungsfahrzeug nicht mehr durch. Die Gasse hatte nicht einmal einen Bürgersteig. Und ganz offensichtlich wollte der Prolet das Rettungsfahrzeug per Faustrecht in den Rückwärtsgang zwingen.
»Ich sag’s nur noch ein Mal, dann klatscht es, aber keinen Applaus.« Das Kraftpaket sah kurz nach hinten zu seinem Wagen. Darin saß ein rothaariges Gerippe, das sich gerade die Schlauchbootlippen schminkte. »Du stehst mir im Weg, und ich hab’s eilig.«
Till atmete tief durch und ließ kurz sein Handy sinken. »Hör mal, wonach sieht das hier für dich aus?«, fragte er.
Er zeigte auf den Rettungswagen, auf den der Idiot gerade eingedroschen hatte und dessen Signallampen auf dem Dach stumm vor sich hin rotierten.
»Ich muss zum Dauerwaldweg, ich werde jetzt sicher nicht rückwärts durch das Nadelöhr fahren, nur damit du rechtzeitig ins Fitnessstudio kommst.«
Dass Passanten sich beschwerten, wenn Einsatzfahrzeuge in zweiter Reihe standen, war keine Seltenheit, aber das hier hatte selbst für Berliner Verhältnisse eine neue Qualität. Obwohl. Erst gestern hatte in Lankwitz ein Zettel an ihrer Windschutzscheibe geklebt: »Nur weil Sie Menschen retten, haben Sie nicht das Recht, unsere Luft mit Ihren Abgasen zu verpesten. Machen Sie das nächste Mal den Motor aus, während Sie einen Kranken aus dem Haus schleppen!«
Die Idee, dass sie damit auch die lebenserhaltenden Geräte für den Schlaganfallpatienten abgeschaltet hätten, war dem besorgten Wutbürger anscheinend nicht gekommen. Oder es war ihm gleichgültig gewesen. So wie den Muskelberg das erstickende Baby nicht kümmerte.
»Hallo? Sind Sie noch da?«, hörte Till die Mutter ängstlich rufen, während der Glatzkopf näher kam.
Er presste sich das Handy fester ans Ohr. »Ja, ja ich bin noch da. Machen Sie weiter mit der Mund-zu-Mund-Beatmung!«
»Sie läuft blau an. Himmel. Ich glaube, sie, sie …«
»Lass gut sein!«, rief Tills Partner hinter ihm. Aram war bereits mit dem Einsatzkoffer ausgestiegen. »Setz du zurück, ich renn alleine vor.«
»Ja, hör auf den Kanaken«, lachte der Glatzkopf. »Husch, husch. Setz zurück!«
Und da war es wieder. Dieses Kribbeln in den Fingern. Das Warnsignal, das Tills Gehirn aussandte, wenn er im Begriff war, einen Fehler zu machen. Till wusste nicht, ob es die Beleidigung seines kurdischen Partners durch den Proleten war oder ob er gar keinen weiteren Anlass gebraucht hätte. Immerhin stand das Leben eines sechs Monate alten Säuglings auf dem Spiel. Zuletzt hatte er dieses nadelstichartige Zwicken in den Fingerspitzen bei dem Brandeinsatz vor drei Wochen gespürt. Der Einsatz, der ihm das Disziplinarverfahren eingebracht hatte.
Till war Feuerwehrmann, Mitglied des Angriffstrupps. Oberbrandmeister mit Notfallsanitäterausbildung. Eigentlich sollte er gar nicht hier im Westend den Sani spielen, sondern irgendwo an vorderster Front mit Atemschutzgerät und Spitzhacke in ein brennendes Gebäude rennen.
Eigentlich.
»Zu impulsives Verhalten. Latent kameradengefährdend«, stand in dem psychologischen Gutachten, das ihm die Versetzung eingebrockt hatte. Eine Degradierung. Rettungssanitäter in Berlin-Südwest.
Und das alles wegen einer verdammten Katze. Aber was hätte er tun sollen? Die alte Oma hatte bitterlich geweint, hatte ihm gestanden, die Fellnase sei das Einzige, was sie noch hatte, also war er wieder in die Flammen ihrer Etagenwohnung gestiegen. Am Ende hatte ihm ein Kumpel zu Hilfe kommen müssen.
Kurz bevor er ins Feuer gerannt war, hatte er dieses Kribbeln in den Fingern gespürt. Das Warnsignal, bloß nicht wieder Mist zu bauen. Diesmal, so sagte er sich jetzt, werde ich darauf hören.
Abgesehen davon, dass er für diesen Blödsinn keine Zeit hatte, kämpfte Mr Boxerstiefel eindeutig in einer anderen Gewichtsklasse. Nicht, dass Till klein und schmächtig gewesen wäre, aber er hatte einen geschulten Blick für Straßenkämpfer und Kampfsportler. Und in diesen Disziplinen war sein Gegenüber ihm haushoch überlegen.
»Okay, der Klügere gibt nach«, seufzte Till unter dem höhnischen Gelächter des Proleten.
Er stieg wieder in den Rettungswagen und startete den Motor mit kribbelnden Händen. Legte den Gang ein, versuchte, seine Wut runterzuschlucken.
Er wartete noch, bis der Idiot wieder in seinem SUV saß.
Dann fuhr er los.
Eine halbe Sekunde später hatte er die Motorhaube erwischt. Der Aufprall war nicht heftig genug, um die Airbags auszulösen, aber da der Hüne noch nicht wieder angeschnallt war, knallte er mit dem Kopf aufs Lenkrad.
Die Rothaarige schrie so laut, dass Till sie selbst durch zwei Windschutzscheiben hindurch noch hören konnte und trotz des Knirschens von Reifen, Asphalt und des Splitterns von Glas, Plastik und Chrom, während sie mitsamt dem Wagen rückwärtsgeschoben wurde.
Wenig später öffnete sich auf der linken Seite eine Einfahrt, und Till schlug das Lenkrad ein, während er weiter Vollgas gab, um mit durchdrehenden Reifen den ramponierten SUV zur Seite zu drücken. Wobei zwei weitere parkende Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen wurden. Aber der Weg war endlich frei, und Till musste auf die Bremse treten, um nicht wie ein Pfeil Richtung Alte Allee zu schießen.
Er hielt an, öffnete seine Fahrertür und drehte sich kurz nach hinten zu Aram, der wie unter Schockstarre auf der Straße stand, neben dem völlig zerbeulten SUV in der Einfahrt, aus dem der Hüne gerade herausklettern wollte. Seine Nase war gebrochen, Blut strömte ihm übers Gesicht, und er wirkte völlig benommen.
»Erst das Baby«, rief Till seinem Partner zu. »Die Nase kann warten.«
3.
Ich will dir was zeigen«, hörte er ihn stammeln. Halb flüsternd, halb weinend.
Till schrak zusammen, weil Max sich mal wieder wie ein Elitesoldat angeschlichen hatte. Dabei hatte er wie immer die Tür zu seinem Arbeitszimmer unter dem Dach offen gelassen. Till hasste verschlossene Räume so sehr, wie er seinen sechsjährigen Sohn liebte, der über die Gabe verfügte, lautlos die Treppe hinaufzuschweben.
»Was ist denn los, Kleiner?«
Till klappte den Laptop zu, auf dem er seine Stellungnahme vorformuliert hatte, auch wenn das die Mühe eigentlich nicht wert war. Die Sachlage war klar, was gab es da der Untersuchungskommission schon groß zu erklären?
Ja, er war wieder ausgerastet. Ja, er hatte sich erneut impulsiv und unkontrolliert verhalten, diesmal sogar vor Zeugen, die bestätigen würden, wie er durchgedreht war und einem Bürger die Nase gebrochen hatte, von den Blechschäden an insgesamt vier Fahrzeugen ganz abgesehen, die in die Hunderttausende gingen. Dass er wenige Minuten später ein Baby gerettet hatte, war nebensächlich. Man benutzte seinen Rettungswagen nicht als Panzer, um rechtzeitig zum Einsatz zu kommen. Till würde gefeuert werden, spätestens dann, wenn die Presse den Fall ausschlachtete und ihn als Amok-Sanitäter darstellte.
»Ich hab den Millennium Falcon fertig.«
Sein Sohn trug das graue Lego-Raumschiff wie eine Heiligen-Reliquie ins Arbeitszimmer.
»Das sieht toll aus«, lobte Till, wobei er sich fragte, ob es pädagogisch sinnvoll war, Max im Alter von sechs Jahren ausgerechnet einen mit Laserkanonen ausgerüsteten Star-Wars-Raumfrachter bauen zu lassen. »Wahnsinn, auf dem Karton stand doch, das wär erst für Kinder ab neun«, fügte er hinzu, wobei er wusste, dass diese Altersangaben oft reine Fantasiezahlen waren. »Im Zweifel«, so hatte ihm ein Spielzeugentwickler einmal im Vertrauen gesagt, dessen Lagerbrand sie hatten löschen müssen, »behaupten wir, es sei für ältere Kinder, dann denken die Eltern, sie hätten ein kleines Genie zu Hause sitzen.«
»Ich sehe Han Solo, und hier, ist das Chewbacca? Du hast sogar Luke Skywalker im Cockpit. Wow. Alles perfekt. Also, wieso weinst du dann?«
Max zog die Nase hoch und druckste herum. »Mama«, sagte er schließlich.
»Was ist mit ihr?«
»Sie hat gesagt, ich darf nicht.«
»Was darfst du nicht?«
»Es ihr zeigen.«
Till lächelte und wuschelte ihm durch die dichten braunen Haare, die er von seiner Mutter Ricarda geerbt hatte. Genauso wie die vollen Lippen und die langen Wimpern.
Dennoch sagten die meisten, sein Sohn komme nach ihm, was nur an den großen dunklen Augen liegen konnte, die immer traurig aussahen, selbst wenn er mal lächelte.
»Mit ›ihr‹ meinst du Anna?« Till warf einen Blick durch das Galeriefenster. Auf den Dächern der Nachbarhäuser stapelten sich die Schneemassen, die in der letzten Nacht über Buckow heruntergekommen waren. Das Nachbarskind war Max’ erste Liebe und tatsächlich, das musste Till zugeben, wunderschön. Sie war auch klug, nett und höflich; eigentlich die perfekte Schwiegertochter, wäre da nicht der winzige Altersunterschied. Anna war siebzehn und bereitete sich aufs Abi vor, während Max noch in die erste Klasse ging und Feuerwehrmann werden wollte. Wie sein Vater.
Gleichwohl machte Anna den Spaß mit. Wenn Max sie anschmachtete, erlaubte sie ihm hin und wieder, sie zu drücken, und antwortete sogar auf seine unbeholfenen Liebesbriefe. Wann immer sie Till sah, warf sie ihm ein »Hallo, Schwiegerpapa« zu, und um Max nicht sein kleines Herz zu brechen, verschwieg sie ihm, dass der junge Mann, der sie hin und wieder mit dem Motorrad abholte, ihr fester Freund war.
»Ist Anna denn da?«, fragte Till.
Max nickte.
»Und Mama hat gesagt, du sollst nicht rüber?«
»Dabei will ich es ihr nur kurz zeigen.«
»Hm, verstehe. Das wird sie sicher freuen.«
Till überlegte, wie er aus der Nummer herauskam, ohne selbst Ärger zu bekommen. Sein Bedarf an Streit und Tränen war für den heutigen Tag gedeckt. Nach allem, was passiert war, sehnte er sich nach Harmonie. Am Ende entschied er sich mal wieder für den Mittelweg, der in Wahrheit ein fauler Kompromiss war.
»Okay, Kleiner. Hier ist der Deal. Du machst das Katzenklo sauber, und dafür darfst du noch kurz rüber und Anna den Millennium Falcon zeigen, wie klingt das?«
Max nickte, und Till wischte ihm die letzte Träne von der Wange, dann gab er ihm einen sanften Klaps auf den Po. »Und sag Mama, ich komme gleich runter und rede mit ihr.«
Wie er Ricarda kannte, würde sie mindestens eine Stunde lang nicht mehr mit ihm sprechen, weil er mal wieder ihre Erziehungsmaßnahmen durchkreuzt hatte.
So viel zum Wunsch nach Harmonie.
Sicher hatte sie gute Gründe, weshalb sie nicht wollte, dass Max kurz vor Einbruch der Dunkelheit noch mal rausging, auch wenn er zu Annas Haus nur eine Ecke weiter die Straße hoch musste.
»Er spielt uns schon jetzt gegeneinander aus«, warf sie ihm regelmäßig vor – und hatte recht. Till konnte seinem Sohn einfach nichts abschlagen, schon gar nicht, wenn er weinend vor ihm stand und ihn wie ein ausgesetzter Hundewelpe ansah. Manchmal glaubte er, Ricarda hatte sich mit Emilia vor allem deswegen noch ein zweites Baby gewünscht, damit Max kein Einzelkind blieb, das er noch mehr verhätscheln konnte.
»Ach, und Max?«
Sein Sohn drehte sich auf der obersten Stufe der Galerietreppe noch einmal zu ihm herum. Mit Sorge im Blick, sein Vater könnte den Deal wieder rückgängig machen.
»Ja, Papa?«
»Wie lautet das Codewort?«
4.
Eiswürfel, dachte Max und hielt den Bausatz fest umklammert.
Er trat aus der Haustür in eine Kälte, die perfekt zu dem Wort passte, das er und Papa bereits im letzten Sommer vereinbart hatten. Auf die Idee hatte sie ein Polizist gebracht, der in die Kita gekommen war und vor den bösen Menschen gewarnt hatte, die kleinen Kindern wehtun wollten. Der Polizist hatte empfohlen, dass Eltern und Kinder ein Codewort vereinbaren sollten, das nur die Familie kannte.
Papa hatte die Idee gefallen.
Immer und immer wieder hatten sie es geübt; auf ihren Wanderungen durch den Wald, beim Autofahren oder während sie auf den Bus warteten. Hatten den Fall durchgespielt, mit dem der Polizist Max Angst eingejagt hatte.
»Was machst du, wenn ein fremder Mensch zu dir sagt, du sollst mit ihm mitkommen, weil er dir Süßigkeiten geben oder ein niedliches Haustier zeigen will?«
»Ich sage Nein!«
»Und wenn er sagt, wir Eltern hätten das erlaubt?«
»Dann frage ich ihn nach dem Codewort.«
»Und wie heißt unser Codewort?«
»Eiswürfel.«
»Okay. Und was, wenn der Mensch das Wort nicht kennt?«
»Dann weiß ich, dass er nicht von euch geschickt wurde.«
»Und was tust du dann?«
»Dann rufe ich laut ›Hilfe‹ und renne weg.«
»Eiswürfel«, murmelte Max und trat vorsichtig die drei Stufen der Haustürtreppe hinunter in den Vorgarten.
Papa hatte den kurzen Weg zum Zaun heute früh gestreut, aber es hatte schon wieder geschneit, und Max durfte auf keinen Fall ausrutschen. Nicht, dass sich etwas verschob oder das Raumschiff gar kaputtging.
Er freute sich schon auf Annas Gesicht, wenn sie es sah. Dann würde sie ihn knuddeln. Das tat sie immer, wenn sie sich sahen. Und dabei roch sie so gut. Nach Pfirsich vielleicht, so sicher war er sich nicht, womit sie sich die Haare wusch. Es roch auf jeden Fall anders als das grüne Dino-Duschgel, mit dem Mama ihn immer einschäumte.
Hoch konzentriert, den Blick abwechselnd auf die Zaunpforte gerichtet, die er langsam mit dem Fuß öffnete, und dann wieder auf das Raumschiff, ging er langsam voran und hätte den Bausatz doch um ein Haar fallen gelassen. So sehr erschreckte ihn die Stimme.
»Hey, Kleiner!«
Er sah nach rechts zu dem Mann, der unter einer alten Laterne stand, die in dieser Sekunde wie auf Kommando anging, wie alle anderen in der kleinen Kopfsteinpflasterstraße.
»Ja?«
»Weißt du, wo Hausnummer 65 ist?«
Max wollte auf seinem Weg zu Anna nicht aufgehalten werden, außerdem wurde es von Sekunde zu Sekunde kälter.
»Wie ist das Codewort?«, rutschte es ihm heraus.
»Hä?«
Der Mann sah ihn an, als hätte er mit ihm in der Geheimsprache geredet, die er sich zusammen mit seinem besten Freund Anton ausgedacht hatte.
»Egal«, sagte Max nach einer Weile und beschloss, dem Mann zu helfen. »Hausnummer 65?«
Der Mann näherte sich, aber Max hatte keine Angst.
Immerhin hatte der Mann ihn nicht aufgefordert mitzugehen. Und die Codewort-Regel galt ja wohl kaum für einen Postboten in Uniform, der versuchte, eine mit Paketen voll beladene Sackkarre durch den Schnee zu ziehen.
5.
Nichts. Kein Laut. Keine Schritte. Nicht einmal das Klopfen.
Till Berkhoff hatte nicht gehört, wie sein Schwager zur Tür hereingekommen war. Dabei war Oliver Skania nicht gerade eine Elfe, die federleicht über den Boden zu schweben pflegte. Normalerweise sorgte der massive Kriminalkommissar allein dadurch für Aufmerksamkeit, dass er mit seinen hundertzwanzig Kilo Lebendgewicht irgendwo durch die Tür schritt. Sei es an einem Tatort, beim Betreten eines Vernehmungszimmers oder, wie jetzt, bei privaten Anlässen.
Doch im Augenblick brüllte ein anderer grau melierter Mann so laut durchs Wohnzimmer, dass im Garten ein Hubschrauber hätte landen können, ohne dass er von Till bemerkt worden wäre.
»Der Serienmörder Guido Tramnitz wird in diesen Minuten, zehn Monate nach seiner Verhaftung, aus bislang noch unbekannten Gründen auf die Intensivstation der Forensischen Psychiatrie verlegt.«
Till hatte den Fernseher beinahe auf volle Lautstärke eingestellt, damit er kein einziges der Worte verpasste, mit denen der Nachrichtensprecher die grauenhaften Bilder kommentierte. Seine Stimme hatte den unehrlichen, selbstverliebten Dramaklang, den Till an Moderatoren so hasste.
»Tramnitz war im Januar des Mordes an der siebenjährigen Laura sowie an ihrer Mutter Myriam S. überführt worden und hatte die Beamten zum Fundort einer weiteren Leiche geführt, des sechsjährigen Andreas K.«
Tatortbilder eines schmutzigen Kellers und einer grob gezimmerten, kindersargähnlichen Holzkiste wechselten mit den Aufnahmen zweier Schülerfotos der ermordeten Kinder.
Dann wurde wieder das Foto eingeblendet, das Tramnitz zu einem Popstar des Schreckens gemacht hatte. Geschossen von einem Paparazzo unmittelbar nach der Verhaftung, als Tramnitz schon im Polizeiwagen saß und direkt in die Kamera lächelte.
Offen, sympathisch, wie ein Fotomodell mit den blauen Augen eines Neugeborenen.
»Vor Gericht wurde die sogenannte Brutkasten-Bestie wegen schwerster schizophrener Störungen als schuldunfähig eingestuft. Tramnitz war davon überzeugt, dass ihm böse Mächte einen Gegenstand ins Gehirn gepflanzt hätten, um seine Gedanken zu steuern.
Nach nur drei Verhandlungstagen wurde er unter strengsten Auflagen in die Steinklinik, ein psychiatrisches Hochsicherheitskrankenhaus in Berlin-Tegel, eingewiesen. Aktuell scheint er in akuter Lebensgefahr zu schweben. Bislang kennen wir nur unbestätigte Gerüchte, die besagen, dass Tramnitz heute noch operiert werden soll.«
»Hoffentlich haben Mithäftlinge dem Schwein die Scheiße aus dem Leib geprügelt«, murmelte Skania.
Der Fernseher zeigte ein Bild der Klinik und den offenbar behandelnden Arzt, der auf Fragen nach dem Zustand seines Patienten nur den Kopf schüttelte und an den Reportern vorbeieilte. In der Bildunterschrift des Fernsehsenders stand:
Dr. med. H. Frieder, Chirurg
Dazu führte der Nachrichtensprecher aus:
»Die Steinklinik ist für Notfälle mit einer Intensiv- und Traumastation ausgestattet, da es unter den psychisch kranken Straftätern immer wieder zu Selbstverletzungen kommt. In manchen Fällen sind die Psychosen auch organischer Natur und Eingriffe am Gehirn notwendig. Ob das bei Guido Tramnitz der Fall ist, darüber wollte uns Dr. Hartmut Frieder keine Auskunft geben.«
Till sagte der Name etwas, er meinte sich daran zu erinnern, dass er dem Arzt einmal im Virchow bei der Einlieferung eines Brandopfers begegnet war. Und er hatte später Gerüchte der Schwestern gehört. Angeblich hatte Frieder in alkoholisiertem Zustand einen Patienten verloren, aber es war nie zu einem Prozess gekommen. Die Angehörigen hatten sich wohl mit dem Krankenhaus per Zahlung einer hohen Geldsumme verglichen. Seitdem praktizierte Frieder als niedergelassener Arzt und wurde offenbar bei Notfällen in der Steinklinik als Chirurg hinzugezogen.
»Du solltest dir das nicht ansehen«, sagte Skania, während er sich das Jackett auszog.
Till warf einen Blick auf das Schulterholster mit der Dienstwaffe, das sich über die voluminöse Brust seines Schwagers spannte, dann sah er wieder zum Fernseher, stellte ihn aber mit der Fernbedienung etwas leiser.
»Der Fall Guido Tramnitz sorgte nicht nur wegen seiner unbeschreiblichen Brutalität für Schlagzeilen, sondern auch, weil Kriminalisten und Forensiker davon ausgehen, dass der psychopathische Serienmörder noch für mindestens einen weiteren Kindermord verantwortlich ist. Doch da Tramnitz auf Anraten seiner Anwältin schweigt, werden seine weiteren Taten wohl niemals aufgeklärt werden.«
Till zuckte zusammen, als er in der nächsten TV-Aufnahme einen Mann sah, der ihm seltsam vertraut und zugleich völlig fremd war: sich selbst.
Der Reporter hatte ihm vor seiner Wohnung aufgelauert. Till konnte sich kaum noch daran erinnern, in welcher Ausnahmesituation er von der Pressehyäne gestellt worden war, die ihn mit taktlosen Fragen gequält hatte: »Herr Berkhoff, glauben Sie, dass Guido Tramnitz auch Ihren Max auf dem Gewissen hat? Wird er den Mord an Ihrem Sohn gestehen? Was würden Sie mit dem Beschuldigten machen, wenn Sie die Gelegenheit dazu hätten?«
Die letzte Frage war eine unverhohlene Anspielung auf die Berichterstattung über seine »impulsive, unbeherrschte Natur«, die ihn den Job gekostet hatte.
Als Max verschwand, war Till zunächst der Hauptverdächtige gewesen. Nicht für die Polizei, wohl aber für die Medien, die schnell von seiner Personalakte und den Disziplinarverfahren Wind bekommen hatten, in denen Till ein latent gewalttätiges, risikofreudiges Verhalten bescheinigt wurde. Als dann noch der SUV-Glatzkopf jedem Käseblatt gegen entsprechendes Honorar in Interviews erzählte, wie Till ihn mit seinem Rettungsfahrzeug habe töten wollen, fragten die ersten Reporter in Max’ ehemaligem Kindergarten nach, ob der Kleine schon mal mit ungewöhnlichen Verletzungen in die Kita gekommen sei. Ob der Vater seinem Sohn vielleicht schon früher einmal Gewalt angetan habe?
Wütend schaltete Till den Fernseher ab, die Bilder in seinem Kopf wollten damit jedoch nicht verschwinden.
Die Straße. Das verschneite Kopfsteinpflaster. Die Legosteine.
Wie passend, dachte Till in Erinnerung an das kaputte Raumschiff – das Einzige, was in seinem eigenen, seither zerbrochenen Leben von Max geblieben war. Als er nicht nach Hause kam und sie erfuhren, dass er nie bei Anna angekommen war, hatten sie nur noch Einzelteile gefunden. Die Spurensicherung hatte jeden einzelnen Legostein aufgesammelt und das Ganze im Labor wieder zusammengesetzt. Um zu überprüfen, ob der Täter sich neben Max auch noch eine Trophäe gegriffen hatte. Und tatsächlich fehlte eine Figur.
Luke Skywalker.
Vom Erdboden verschluckt, so wie sein Sohn.
Mittlerweile war auch Ricarda aus seinem Leben verschwunden, die ihm zu Recht die Mitschuld an der Tragödie gab, auch wenn sie den Satz nie aussprach, mit dem er sich seit zwölf Monaten ununterbrochen quälte: »Hättest du ihm nicht erlaubt, zu Anna zu gehen, wäre das alles nicht passiert.«
Till stand auf und schüttelte sich wie ein nasser Hund, doch die Erinnerungen wurde er nicht los. Auch nicht seinen ungebetenen Gast, der sich offenbar nicht daran störte, dass Till ihn seit seiner Ankunft ignorierte.
»Was willst du hier?«, fragte er schließlich unhöflich, aber auch das schien Skania nichts auszumachen. Wahrscheinlich war sein Schwager aus langjähriger Erfahrung gewohnt, dass Hinterbliebene ihre Verzweiflung an den Ermittlern ausließen. Oder er hielt es für seine familiäre Pflicht, ihm zur Seite zu stehen, auch wenn es nur noch eine Frage der Zeit war, bis seine Schwester sich von Till scheiden ließ. Ausgezogen war Ricarda ja bereits, und Max’ Schwester hatte sie natürlich mitgenommen.
»Pass auf, es gibt eine Entwicklung, aber …«
Skania zog eine Hautfalte seines Doppelkinns nach unten, eine Marotte, wann immer er darüber nachsann, was er als Nächstes sagen sollte.
»Was?«
»Sie haben die Suche nach Max endgültig eingestellt.«
6.
Till fuhr sich durch die fettigen, ungewaschenen Haare. Es war längst ein Uhr mittags durch, und er steckte immer noch in seinem Pyjama.
»Wie bitte? Mein Sohn wird doch erst seit einem Jahr vermisst!«
Sein Schwager nickte. »Das stimmt. Aber sie sind sich sicher, dass Tramnitz der Täter ist. Der Modus Operandi, das Einzugsgebiet, alle Umstände seiner Taten passen eins zu eins auf deinen Sohn. Du weißt, was bei uns los ist. Glaubst du, mir schmeckt das? Aber es ergibt keinen Sinn, nach einem Täter zu suchen, der ohnehin schon lebenslang in Haft sitzt. Wir wissen, dass er es war.«
Till hatte das Gefühl, als wäre um ihn herum sämtliche Luft aus dem Wohnzimmer gewichen.
Die Endgültigkeit der Nachricht drohte ihn zu ersticken.
»Aber ihr wisst nicht, wo Max ist. Ihr müsst weitersuchen!«, widersprach Till seinem Schwager mit kehliger Stimme.
Skania nickte. »Glaub mir, hätte ich die Leitung, würde es anders laufen. Ich würde jeden Stein in dieser Stadt so lange umdrehen lassen, bis wir ihn gefunden haben. Und es wäre mir egal, dass wir dafür weder das Geld noch das Personal haben. Aber genau das ist der Grund, weshalb ich offiziell nicht mit der Sache betraut bin.«
»Klar.«
Skania war als Bruder seiner Frau befangen. Wie sollte er da objektiv ermitteln? Aber dass er nicht Teil des Ermittlungsteams war, hieß noch lange nicht, dass seine Kollegen ihn vom Informationsfluss abschnitten.
»Sie dürfen die Suche nach Max nicht einstellen. Ich muss wissen, was mit meinem Jungen geschehen ist!«
»Du weißt, was mit ihm geschehen ist«, entgegnete Skania.
Ja. Wusste er.
Till rieb sich seinen Zehntagebart, der ihm vielleicht auch schon zwei Wochen stand. Seit Max verschwunden war, glich ein Tag dem anderen.
Aufstehen. An Max denken. Anziehen. An Max denken. Verzweifeln. An Max denken. Ausziehen. An Max denken. Hinlegen. An Max denken. Verzweifeln. Nicht einschlafen können. An Max denken. Aufstehen.
Und seit Ricarda ihn verlassen hatte, musste er sich noch nicht einmal mehr an- oder ausziehen.
»Du kennst das Schicksal der anderen Kinder«, versuchte Skania, sanft zu ihm durchzudringen.
Ja. Kannte er. Ein Mädchen, ein Junge. Sieben und sechs Jahre alt. Tramnitz hatte beide beim Spielen aus ihren Vorgärten verschleppt. Hatte sich als Paketzusteller getarnt, sie betäubt und in den Keller seines Hauses gebracht, wo er sie in einem selbst gebauten Brutkasten quälte, missbrauchte und tötete. Kein Kind hatte länger als achtundvierzig Stunden in seiner Gewalt überlebt. Max war nun schon seit gut einem Jahr verschwunden. Kurz nachdem die Nachbarn einen DHL-Laster und einen Postboten mit einer voll beladenen Sackkarre in der Straße gesehen hatten.
Wenig später wurde das Schwein verhaftet. Man hatte die Leiche von Myriam Schmidt gefunden, der Mutter der entführten Laura. Sie war Tramnitz mit eigenen Recherchen zu nahegekommen; zu einem Zeitpunkt, da der Killer die alleinerziehende Mutter nach der Tat noch im Blick behalten hatte, wahrscheinlich, um sich an ihrem Leid zu ergötzen. Bei Tramnitz’ Festnahme fand man in seiner Wohnung zahlreiche Fotos und Videoaufnahmen von Myriam, wie sie Flugblätter mit dem Gesicht ihrer Tochter an Bäume pinnte oder die Straßen abwanderte, in denen ihr Kind zuletzt gesehen worden war. Mit ihrer Theorie, der Täter habe sich als Lieferant oder Paketbote getarnt, hatte sie ins Schwarze getroffen, weswegen Tramnitz sie aus dem Weg räumen wollte, bevor sie damit zur Polizei ging. Nur durch Zufall wurde er dabei beobachtet, wie er ihre Leiche in einem Bootshaus beim Teltowkanal verschwinden lassen wollte, womit Myriam am Ende doch noch den Mörder ihrer Tochter und mindestens eines weiteren Kindes überführt hatte. Unter Druck hatte Tramnitz die Polizei zu den Leichen von Laura und einem sechsjährigen Jungen aus Pankow geführt. Nur über Max’ Schicksal schwieg er sich aus.
»Komm mit, ich muss dir was zeigen.«
Till schlurfte an Skania vorbei ins Badezimmer, öffnete den Waschbeckenunterschrank und nahm eine Dose Raumspray heraus.
»Febreze?«, fragte Skania verwirrt.
»Anti-Monster-Spray«, antwortete Till, was Skania nicht viel weiterhalf.
»Es ist jetzt anderthalb Jahre her. Ich habe damals einen Fehler gemacht und Max eine gruselige Gutenachtgeschichte erzählt. Er hatte sie sich gewünscht, weil er im Kino Vaiana gesehen hatte und sich so vor Te Ka, dem Lavadämon, fürchtete. Da wollte er auch von mir etwas Schauriges hören. Ich weiß, ich weiß, ich hätte ihm nichts von dem Monster mit den grünen Augen im Schrank erzählen dürfen. Von da an kam er jede Nacht zu uns ins Bett, bis ich ihm erklärte, dass ich im Geisterladen Anti-Monster-Spray gekauft hätte.«
Till schüttelte die Sprühdose mit dem Raumduft »Gute-Nacht-Lavendel«. »Ich habe ihm erklärt, wenn man das in die Schränke und aufs Bett sprüht, schläft er sicher. Dann könne ihm nichts passieren. Und er hat es geglaubt.«
Ihm schossen die Tränen in die Augen. »Jeden Abend habe ich es in seinem Zimmer versprüht, und er ist nicht mehr in der Nacht aufgewacht und hat sich nicht mehr zu uns ins Bett geschlichen. Er hat seitdem durchgeschlafen. Max hatte keine Angst mehr.«
»Till!«
»Meinst du, er hat seinen Entführer auch nach dem Monster-Spray gefragt?« Seine Stimme brach. »Weißt du, ich liege immer da, mit offenen Augen, und starre an die Decke und höre Max nach dem Monster-Spray rufen, weil er so große Angst hat. Aber da ist niemand, der es ihm bringt. Da ist kein Spray. Nur das Monster selbst …«
»Max ist tot!« Skania wurde laut.
»Ich weiß!«
Till schleuderte die Flasche gegen den Spiegel, der wie durch ein Wunder nicht einmal einen Sprung bekam.
»Ich weiß, dass er tot ist«, sagte er, und seine Stimme wurde mit jedem Wort lauter, bis er seinen Schwager anbrüllte: »Aber ich muss ihn sehen, seine Leiche. Ich muss Max begraben, verstehst du das nicht? ICH BRAUCHE GEWISSHEIT!«
Er eilte aus dem Bad, und Skania lief ihm hinterher.
»Ja, natürlich verstehe ich das. Ich will das genauso sehr wie du – oder wie Ricarda.«
»Deine Schwester hat mich verlassen. Mit Emilia.«
Skania musterte Till mitleidig von oben bis unten. »Ich weiß. Sie hat es mir gesagt. Aber mal ehrlich, darüber wunderst du dich? Schau dich doch an. Du lässt dich gehen. Du verwahrlost. Du stellst dich nicht der Wahrheit.«
»Was ist denn die Wahrheit?«
Sein Schwager hob beide Arme. Till sah bierdeckelgroße Schweißflecken unter Skanias Achseln.
»Wenn das Schwein uns nicht sagt, wo wir Max finden können …« Skania räusperte sich. »Ich meine, du weißt, wie das bei den anderen Kindern gewesen ist. Du hast die Berichte von den Polizeireportern gelesen. Wenn er uns nicht zu den Leichen geführt hätte, hätten wir die armen Seelen nie gefunden, so gut hatte Tramnitz sie vergraben. Tief unter der alten Deponie, nicht einmal die Leichenhunde haben da angeschlagen. Doch seit er in Haft ist …«
Redet er nicht mehr. Sagt keinen Ton. Schweigt.
Till schloss die Augen.
Auf Anraten seiner Anwältin schwieg Tramnitz seit seinem ersten Geständnis. Und ließ Till damit in der schlimmsten aller Lagen zurück: der Ungewissheit. Aber da man in Deutschland in einem Rechtsstaat lebte, war bereits die Androhung von Folter strafbar. Selbst einem Monster gegenüber. Es gab nichts, was man tun konnte, um diese Bestie zum Reden zu bringen.
Nichts, außer …
Till kam ein Gedanke. Er war absurd, beinahe lächerlich, völlig unaussprechlich. Und dennoch war er seit langer Zeit der erste Gedanke, der ihn beflügelte.
»Was würden Sie mit dem Beschuldigten machen, wenn Sie die Gelegenheit dazu hätten?«
»Wie sicher sind wir uns, dass Tramnitz meinen Sohn auf dem Gewissen hat?«, fragte er Skania.
»Bislang lag unsere Vermutung bei neunundneunzig Prozent. Seit einer Stunde aber haben wir die hundertprozentige Gewissheit.«
»Wieso das?«
»Sie haben etwas gefunden«, sagte sein Schwager. »Deswegen bin ich eigentlich hier.«
Till wurde schlecht. Die Welt um ihn herum begann sich zu drehen, und er stützte sich an dem Stuhl ab, den er vor den Fernseher gestellt hatte.
»Was?«, fragte er, und allein dieses eine Wort kostete ihn eine unglaubliche Kraft.
Was haben sie gefunden?
Skania öffnete seine Pranke, und erst konnte Till nichts darin erkennen. Das staubige Licht, das durch die Jalousien ins Zimmer fiel, stand so ungünstig, dass es ihn blendete. Zumal der Gegenstand in Skanias Hand weiß und klein war … und aus Plastik!
»Luke Skywalker«, flüsterte Till und wich zurück, als wäre die Legofigur in Skanias Hand ansteckend. »Wo wurde er gefunden?«
»Auf Tramnitz’ Nachttisch. Als er in den OP gebracht wurde. Das Schwein hat seine Trophäe in der Klapse ganz offen zur Schau gestellt. Und da ist noch etwas.«
»Noch ein Beweis?«
»Möglich.«
Skania zog die Hautfalte noch länger.
»Es gibt Gerüchte. Knastfunk sozusagen.«
»Was?«
»Angeblich prahlt Tramnitz damit, in der Klinik ein Tagebuch über seine Taten zu führen.«
7.
Frieder?«
Irritiert angesichts der unbekannten Rufnummer auf seinem Privathandy setzte sich der Chirurg zurück an seinen Schreibtisch. Gerade hatte er das ihm zur Verfügung gestellte Büro verlassen wollen, um ins Gartengeschoss der Steinklinik aufzubrechen, wo sich der Operationssaal befand.
»Es tut mir leid, Sie zu stören«, vernahm Frieder eine sonore, tiefe Stimme.
Allerdings sprach der Mann etwas kraftlos und erschöpft, sodass seine Worte in dem monotonen Rauschen des draußen tobenden Regensturms unterzugehen drohten. Hier im ersten Stock der Klinik klang es wie das Jaulen eines ängstlichen Hundes, wenn sich der Wind seinen Weg durch die Lüftungs- und Fahrstuhlschächte suchte.
»Mit wem spreche ich?«, fragte Frieder ungeduldig.
»Mein Name ist Till Berkhoff. Ich bin der Vater von Max.«
Ach du lieber Himmel.
Frieder schluckte und nickte unbewusst.
Jetzt war ihm klar, wen er am Apparat hatte. Und da er sich ungefähr vorstellen konnte, was der arme Mann von ihm wollte, begann sein Herz schneller zu schlagen. Sein Puls zog an, und ihm wurde heiß.
»Wie sind Sie an meine Nummer gekommen?«
»Als ehemaliger Brandmeister habe ich noch immer gute Kontakte bei den Behörden.«
Frieder griff sich an den Hals und lockerte den obersten Knopf seines roséfarbenen Poloshirts. Rosé war seine Lieblingsfarbe, weil er der Meinung war, sie würde gut zu seinem solariumgebräunten Teint passen.
»Hören Sie«, sagte er. »Ich darf mit Ihnen nicht über meinen Patienten reden.«
»Ich will nicht reden. Ich will, dass Sie etwas für mich erledigen.«
Kalte Wut durchsetzte die Stimme des Anrufers. Frieder war sofort klar, was Berkhoff mit »etwas erledigen« umschrieb.
Er hätte auch sagen können, er solle »das Problem aus der Welt schaffen«, »der Gerechtigkeit auf die Sprünge helfen« oder »dem Steuerzahler viel Geld ersparen«.
»Zeichnen Sie das Gespräch auf?«, wollte Frieder wissen und löschte die Schreibtischlampe. Er musste sich nun wirklich auf den Weg in den OP machen, um sich vorzubereiten.
»Mein Sohn ist keine Story«, fauchte Berkhoff, und nun richtete sich sein Zorn direkt gegen Frieder.
»Tut mir leid, das wollte ich damit nicht andeuten. Es ist nur so, ich …« Er zögerte. »Ich kann es noch nicht einmal in Erwägung ziehen, was Sie von mir wünschen.«
Obwohl ich es nachvollziehen kann. Auch ich würde mir einen qualvollen Tod für den Mann wünschen, der meinen Sohn entführt und getötet hat.
»Doch, das können Sie.«
»Nein.« Frieders Hände begannen zu zittern. »Ich kann und will keinen Menschen töten«, sagte er laut. Er hatte ganz bewusst ein eindeutiges und ehrliches Statement abgegeben für den Fall, dass Berkhoff doch einen Mitschnitt anfertigte. Zu seinem Erstaunen widersprach ihm der Vater: »Das sollen Sie auch nicht.«
»Was denn sonst?«
Er hörte ein Schniefen, Berkhoff putzte sich die Nase, entschuldigte sich kurz und sagte dann: »Ich bitte Sie um das komplette Gegenteil.«
»Das verstehe ich nicht.«
»Ich bitte Sie, nein, ich flehe Sie an: Tun Sie alles in Ihrer Macht Stehende, damit Guido Tramnitz durchkommt. Er muss die Operation überleben, verstehen Sie? Er ist der Einzige, der weiß, was mit meinem Sohn passiert ist. Er darf sein Geheimnis nicht mit ins Grab nehmen.«
»Okay, okay«, sagte Frieder bewegt. »Ich tue, was ich kann.«
Die emotionale, unerwartete, aber letztlich völlig nachvollziehbare Bitte des Vaters hatte ihn zutiefst berührt. Als er auflegte, zitterten seine Finger so sehr, dass er keine andere Wahl hatte.
Er konnte sie auf keine andere Weise beruhigen, als noch einmal die Schublade seines Schreibtisches zu öffnen und sich einen Schluck zu genehmigen. Nicht viel.
Nur zwei Zentiliter.
8.
Ein V-Patient?«
»Ja.«
»Was soll das sein?«
»V wie verdeckt. Ich will, dass du mich in die Steinklinik einschleust.«
»Zu Tramnitz?«
»Als Insasse in der Psychiatrie, ganz genau.«
Till, dem der Verhörcharakter ihrer Unterhaltung gehörig auf den Nerv ging, wandte sich von Skania ab und sah aus dem Fenster.
Eine Plastiktüte wurde von dem regnerischen Herbststurm über den Gehweg in eine Trauerweide getrieben, wo sie wie der letzte Rest eines zerfetzten Segels hängen blieb. Kein einziger Vogel, kein Eichhörnchen, kein Lebewesen war im Garten zu sehen. Kein Wunder bei dieser Sintflut. Und dennoch wäre Till sehr viel lieber draußen den Naturgewalten ausgesetzt gewesen, als hier drinnen zur Untätigkeit verdammt im Warmen zu warten.
In seinem Rücken räusperte sich sein Schwager, und selbst das nervte Till bereits. Seit er aus dem Bad zurückgekommen war, hörte Skania nicht auf, ihn zu bevormunden. Jetzt schon wieder.
»Okay, mal davon abgesehen, dass ein V-Mann im Polizeijargon kein verdeckter Ermittler, sondern eine Verbindungsperson ist …«
»… die, ohne einer Strafverfolgungsbehörde anzugehören, bereit ist, diese bei der Aufklärung von Straftaten zu unterstützen«, ergänzte Till augenrollend. »Erspar mir deine Wikipedia-Vorträge.«
»Dann erspar du mir deine schwachsinnigen Vorschläge«, polterte Skania. »Selbst wenn ich es wollte, und ich will es nicht, wie sollte ich dich da reinbekommen? Idiotical Island ist nicht gerade ein Freizeitpark, wo man einfach reinspazieren und sich mal so in Ruhe umschauen kann.«
Womit er ganz sicher recht hatte.
Die Steinklinik für Forensische Psychiatrie war eine Anstalt der höchsten Sicherheitsstufe in Reinickendorf. Da sie als einziger Gebäudekomplex auf einer Halbinsel im Tegeler See lag, hatte ihr der Berliner Volksmund in Anspielung auf das Brandenburger Spaßbad »Tropical Island« diesen Spitznamen verpasst. Ursprünglich hatte ein Großinvestor hier ein Grandhotel eröffnen wollen. Nachdem der Innenstadt-Airport jedoch als Folge der typischen Berliner Chaos-Politik nicht rechtzeitig geschlossen worden war, wollte kein Gast sechshundertfünfzig Euro die Nacht dafür bezahlen, dass er von Triebwerkslärm in den Schlaf gelullt wurde. Da nützte es auch nichts, dass ein Stararchitekt die Gestalt des Gebäudes dem Weißen Haus in Washington nachempfunden hatte, mit einem prunkvollen Säulenentree und dreistöckigen Flügeln zur West- und Ostseite hin.
Ein privater Klinikbetreiber kaufte schließlich das Areal samt Rohbau, und heute wurden hier keine betuchten Gäste, Prominente oder Politiker beherbergt, sondern einige der gefährlichsten Psychopathen Deutschlands, wobei böse Zungen behaupteten, der Geisteszustand der aktuellen Gäste würde sich von dem der ursprünglich geplanten gar nicht so sehr unterscheiden: schizophrene Vergewaltiger, sadistische Mörder, triebgestörte Wahnsinnige. Darunter beispielsweise der Blutmaler, ein zweiunddreißigjähriger Mann mit dem Aussehen eines Volkshochschullehrers, dessen Vorliebe es war, Seenlandschaften mit den Körperflüssigkeiten seiner Opfer zu zeichnen, die ihm dabei zusehen mussten, während sie ausbluteten.
Guido Tramnitz war hier also in bester Gesellschaft mit weiteren Tätern, die wegen ihrer Geisteskrankheit vom Gericht für schuldunfähig erklärt worden waren und daher in dieser psychiatrischen Anstalt für immer weggesperrt blieben.
Till holte tief Luft und sprach beim Ausatmen. »Ich hab auch keine Ahnung, wie du das regelst, aber ich muss da rein. Zu Tramnitz.«
»Wieso? Damit du dem Mörder deines Sohnes die Rübe einschlagen kannst?«
Till schüttelte den Kopf. »Ich brauche Gewissheit, Oliver. Ich kann so nicht weiterleben. Ich brauche etwas, woran ich mich festhalten kann. Um Abschied zu nehmen. Verstehst du das?«
Er sah die Antwort in den Augen seines Schwagers. Natürlich verstand er ihn. Skania war Polizist. Er wusste, was die Nachricht vom Tod eines Kindes bei den Eltern auslöste. Es beendete ihr Leben. Ihre Seele, ihr Glück, all das, was sie als Lebewesen ausmachte, verabschiedete sich für immer. Aber damit waren sie denjenigen Eltern gegenüber noch im Vorteil, die niemals die hundertprozentige Gewissheit erhalten hatten, was mit ihrem Kind geschehen war. Denn deren Todeskampf fand niemals einen Schlusspunkt.
»Ich fühle mich wie ein Pferd mit gebrochenen Beinen im Straßengraben.«
»Dann wäre ein Zusammentreffen mit Tramnitz so etwas wie ein Gnadenschuss für dich?«
»Ganz genau. Er spricht weder mit der Polizei noch mit der Staatsanwaltschaft oder dem Richter. Also muss ich in seine unmittelbare Nähe. Ich will wissen, wo er die Leiche von Max versteckt hat.«
»Hm, gute Idee. Das wird Tramnitz dir ganz bestimmt freiwillig und völlig zwanglos gestehen.«
Wieder schüttelte Till den Kopf. »Womöglich muss ich nicht einmal mit ihm reden, wenn ich sein Tagebuch finde.«
Skania lachte auf. »Wie naiv bist du eigentlich? Das ist ein Gerücht. Und selbst wenn es existiert, was ich bezweifle, wird Tramnitz das ja wohl kaum offen rumliegen lassen.«
Till verstand die Logik in Skanias Worten, wollte die Wahrheit aber nicht akzeptieren, da er sich sonst hätte eingestehen müssen, dass er außer dem Mut des Verzweifelten keinen Plan vorzuweisen hatte.
»Im Hochsicherheitstrakt dürfte es nicht allzu viele Verstecke geben«, behauptete er deshalb beinahe trotzig.
»Genau. Du sagst es: Hochsicherheit! Ich habe nicht die geringste Vorstellung davon, wie du dich in der Klapse bewegen, geschweige denn zu Tramnitz vorarbeiten willst. Selbst wenn ich das Unmögliche möglich mache, stecken sie dich allenfalls in den herkömmlichen, geschlossenen Psychiatriebereich. Für Tramnitz aber herrscht Sicherheitsklassifikation der Stufe IV.« Skania hob die Hand und zählte an den Fingern ab: »Das bedeutet: Bodyscanner in der Zugangsschleuse zu seiner Station, Fingerabdruck- und Irisüberprüfung an den sicherheitsrelevanten Übergängen und ein Doppelzaun im drohnenüberwachten Außenbereich, der an die Berliner Mauer erinnert.«
»Darüber mache ich mir Gedanken, sobald ich drin bin. Ich finde schon einen Weg.«
»Schwachsinn! Erwarte nicht, dass ich dich bei diesem Himmelfahrtskommando unterstützen werde.«
»Ach nein?«, fragte Till, packte ein Büschel seiner Haare direkt an der Stirnwurzel. Und riss es sich aus.
Es knackte in seinen Ohren, als hätte er mehrere Kammern einer Luftpolsterfolie gleichzeitig zum Zerplatzen gebracht.
Das Blut schoss ihm schneller übers Gesicht, als Skania brüllen konnte.
»Himmel, was machst du denn da?«
»Ich bereite mich vor.«
Till versuchte die ausgerissenen Haare fallen zu lassen, was ihm wegen seiner schweißnassen Hände kaum gelang. Dann griff er nach weiteren Strähnen, diesmal in der Kopfmitte.
»Hör auf, mein Gott. Nein!«
Er riss ein zweites Mal. Noch heftiger. Der Schmerz war eher zu ertragen als das viele Blut, das nun schon auf den Boden tropfte.
»Hast du den Verstand verloren, du Idiot?«
Till zwang sich zu lächeln. »Schau mal an, wie schnell ich dich überzeugt habe. Also, was ist?«
»Was meinst du?«