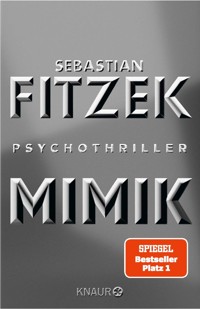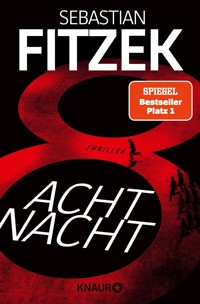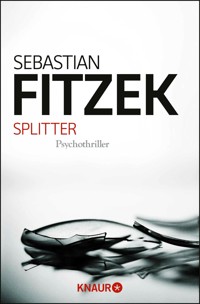
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Tödliche Unfälle, Gedächtnisverlust, Experimente – Spannung pur in diesem Psychothriller der Extraklasse von Sebastian Fitzek Was wäre, wenn wir die schlimmsten Erlebnisse unseres Lebens für immer aus unserem Gedächtnis löschen könnten? Und was, wenn etwas dabei schief geht? Viel stärker als der Splitter, der sich in seinen Kopf gebohrt hat, schmerzt Marc Lucas die seelische Wunde seines selbst verschuldeten Autounfalls - denn seine Frau hat nicht überlebt. Als Marc von einem psychiatrischen Experiment hört, das ihn von dieser quälenden Erinnerung befreien könnte, schöpft er Hoffnung. Doch nach den ersten Tests beginnt das Grauen: Marcs Wohnungsschlüssel passt nicht mehr. Ein fremder Name steht am Klingelschild. Dann öffnet sich die Tür – und Marc schaut einem Alptraum ins Gesicht … Dieser Psychothriller von Sebastian Fitzek garantiert Spannung bis zur letzten Zeile
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 437
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Sebastian Fitzek
Splitter
Psychothriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Was wäre, wenn wir die schlimmsten Erlebnisse unseres Lebens für immer aus unserem Gedächtnis löschen könnten? Und was, wenn etwas dabei schief geht?
Viel stärker als der Splitter, der sich in seinen Kopf gebohrt hat, schmerzt Marc Lucas die seelische Wunde seines selbst verschuldeten Autounfalls - denn seine Frau hat nicht überlebt. Als Marc von einem psychiatrischen Experiment hört, das ihn von dieser quälenden Erinnerung befreien könnte, schöpft er Hoffnung. Doch nach den ersten Tests beginnt das Grauen: Marcs Wohnungsschlüssel passt nicht mehr. Ein fremder Name steht am Klingelschild. Dann öffnet sich die Tür - und Marc schaut einem Alptraum ins Gesicht …Was wäre, wenn wir die schlimmsten Erlebnisse unseres Lebens für immer aus unserem Gedächtnis löschen könnten? Und was, wenn etwas dabei schief geht?
Inhaltsübersicht
Widmung
»Was denkst du?«
Motto
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
Viele Jahre später
Zu der Idee hinter Splitter
Bevor ich es vergesse …
Das Quiz für dein nächstes Fitzek-Abenteuer
Leseprobe »Der Nachbar«
Für Clemens
»Was denkst du?«
»Na ja, ich finde sie etwas, sagen wir … gewöhnungsbedürftig?«
»Grottenhässlich trifft es wohl eher.«
»Hast du sie geschenkt bekommen?«
»Nein, gekauft.«
»Moment mal. Du hast Geld dafür bezahlt?«
»Ja.«
»Für eine babyblaue, batteriebetriebene Delphinnachttischlampe, die du selbst hässlich findest?«
»Grottenhässlich.«
»Okay, dann klär mich auf. Wenn das Frauenlogik ist, dann kapier ich sie nämlich nicht.«
»Komm her.«
»Ich lieg doch schon fast auf dir drauf.«
»Trotzdem, noch näher.«
»Sag mir nicht, du willst die Lampe in unser Liebesspiel integrieren.«
»Spinner.«
»Hey, was ist los? Wieso schaust du mich auf einmal so an?«
»Versprichst du mir …«
»Was?«
»Versprichst du mir, immer ein Licht anzulassen?«
»Ich … ich verstehe nicht ganz. Hast du plötzlich Angst vor der Dunkelheit?«
»Nein, aber …«
»Aber?«
»Na ja. Ich hab darüber nachgedacht, wie unerträglich es wäre, wenn dir etwas zustößt. Halt, warte, bleib da. Ich will dich ganz fest halten.«
»Was ist denn … weinst du etwa?«
»Hör zu, ich weiß, es hört sich jetzt etwas verrückt an, aber ich will, dass wir eine Abmachung treffen.«
»Okay?«
»Sollte einer von uns beiden sterben – halt, lass mich bitte ausreden. Dann soll der, der gegangen ist, dem anderen ein Zeichen geben.«
»Er soll die Lampe anmachen?«
»Damit wir wissen, dass wir trotzdem nicht alleine sind. Dass wir an uns denken, auch wenn wir uns nicht sehen können.«
»Schatz, ich weiß nicht, ob …«
»Schhhhhh. Versprichst du mir das?«
»Okay.«
»Danke.«
»Ist sie deshalb so hässlich?«
»Grottenhässlich.«
»Stimmt, so gesehen eine gute Wahl. Das Monstrum werden wir niemals aus Versehen anschalten.«
»Also versprichst du es mir?«
»Na klar, Süße.«
»Danke.«
»Aber was soll uns denn schon zustoßen?«
It’s either real or it’s a dream
There’s nothing that is in between
»Twilight«, Electric Light Orchestra
Der Zweck heiligt die Mittel
Lebensweisheit
1.
Heute
Marc Lucas zögerte. Ließ den einzigen noch unversehrten Finger seiner gebrochenen Hand lange auf dem Messingknopf der alten Klingel ruhen, bevor er sich einen Ruck gab und drückte.
Er wusste nicht, wie spät es war. Die Schrecken der letzten Stunden hatten ihm auch das Zeitgefühl geraubt. Doch hier draußen, mitten im Wald, schien Zeit ohnehin keine Bedeutung zu haben.
Der eisige Novemberwind und der Schneeregen der letzten Stunden hatten etwas nachgelassen, sogar der Mond schimmerte kurz durch die aufgerissene Wolkendecke. Er war die einzige Lichtquelle in einer Nacht, die ebenso kalt wie dunkel schien. Nichts deutete darauf hin, dass das efeuberankte, doppelstöckige Holzhaus bewohnt war. Selbst der viel zu groß dimensionierte Schornstein auf der Spitze des Giebeldachs schien nicht in Betrieb. Marc roch auch nicht den typischen Duft verbrannten Kaminholzes, der ihn heute Vormittag im Haus des Arztes geweckt hatte – um kurz nach elf, als sie ihn zum ersten Mal hierher in den Wald zum Professor gebracht hatten. Schon da hatte er sich krank gefühlt. Sterbenskrank. Und doch hatte sich sein Zustand seither dramatisch verschlechtert.
Vor wenigen Stunden noch waren seine äußerlichen Verfallserscheinungen kaum sichtbar gewesen. Jetzt tropfte Blut aus Mund und Nase auf seine verdreckten Sportschuhe, die zersplitterten Rippen rieben beim Atmen aneinander, und sein rechter Arm hing wie ein schlecht verschraubtes Ersatzteil am Körper herab.
Marc Lucas drückte erneut den Messingknopf, wieder ohne ein Klingeln, Summen oder Schellen zu hören. Er trat einen Schritt zurück und sah zum Balkon hoch, hinter dem das Schlafzimmer lag, von dem man tagsüber einen atemberaubenden Blick auf den kleinen Waldsee hinter dem Haus hatte, dessen Oberfläche in windstillen Momenten an Fensterglas erinnerte – eine glatte, dunkle Scheibe, die in tausend Teilchen zersplittern würde, sobald man einen Stein hineinwarf.
Das Schlafzimmer blieb dunkel. Selbst der Hund, dessen Namen er vergessen hatte, schlug nicht an, auch alle anderen Geräusche blieben aus, die normalerweise aus einem Haus dringen, dessen Bewohner mitten in der Nacht aus dem Schlaf gerissen werden. Keine nackten Füße, die die Treppe heruntertrampeln; keine Hausschuhe, die über den Dielenboden schlurfen, während ihr Besitzer sich nervös räuspert und versucht, seine zerzausten Haare mit beiden Händen und etwas Spucke zu glätten.
Und dennoch wunderte Marc sich nicht eine Sekunde, als plötzlich wie von Geisterhand die Tür geöffnet wurde. Viel zu viel Unerklärliches war ihm in den letzten Tagen widerfahren, als dass er auch nur einen Gedanken daran verschwendet hätte, weshalb der Psychiater vollständig bekleidet vor ihm stand, im Anzug und mit korrekt gebundener Krawatte, als halte er seine Sprechstunden grundsätzlich mitten in der Nacht ab. Vielleicht hatte er ja im hinteren Teil seines verwinkelten Häuschens gearbeitet, alte Patientenakten gelesen oder einen der dicken Wälzer über Neuropsychologie, Schizophrenie, Gehirnwäsche oder multiple Persönlichkeiten studiert, die überall umherlagen, obwohl er schon seit Jahren nur noch als Gutachter praktizierte.
Marc fragte sich auch nicht, weshalb das Licht aus dem Kaminzimmer erst jetzt zu ihm nach draußen drang. Ein Spiegel über der Kommode reflektierte die Strahlen, so dass es für einen Moment so wirkte, als trage der Professor einen Heiligenschein. Dann trat der alte Mann einen Schritt zurück, und der Effekt war verschwunden.
Marc seufzte, lehnte sich erschöpft mit der gesunden Schulter an den Türrahmen und hob die zertrümmerte Hand.
»Bitte …«, flehte er. »Sie müssen es mir sagen.«
Seine Zunge schlug beim Reden an lose Schneidezähne. Er hustete, und ein dünner Blutstropfen löste sich aus der Nase.
»Ich weiß nicht, was mit mir geschieht.«
Der Arzt nickte bedächtig, als fiele es ihm schwer, den Kopf zu bewegen. Jeder andere wäre bei seinem Anblick schockiert zusammengezuckt, hätte vor Angst die Tür zugeschlagen oder zumindest sofort medizinische Hilfe gerufen. Doch Professor Niclas Haberland tat nichts dergleichen. Er trat lediglich zur Seite und sagte mit leiser, melancholischer Stimme: »Es tut mir leid, aber Sie kommen zu spät. Ich kann Ihnen nicht mehr helfen.«
Marc nickte. Mit dieser Antwort hatte er gerechnet. Und er hatte sich darauf vorbereitet.
»Ich fürchte, Sie haben keine andere Wahl!«, sagte er und zog die Pistole aus seiner zerrissenen Lederjacke.
2.
Der Professor ging voran, den Flur entlang zum Wohnzimmer. Marc blieb dicht hinter ihm, die Waffe unablässig auf Haberlands Oberkörper gerichtet. Dabei war er froh, dass der alte Mann sich nicht umdrehte und daher seinen drohenden Schwächeanfall nicht wahrnahm. Kaum hatte Marc das Haus betreten, war ihm schwindelig geworden. Der Kopfschmerz, die Übelkeit, die Schweißausbrüche … all die Symptome, die die psychischen Qualen der letzten Stunden noch verstärkt hatten, waren mit einem Mal zurückgekommen. Jetzt wollte er sich am liebsten an Haberlands Schultern festhalten und sich von ihm ziehen lassen. Er war müde, so unerträglich müde, und der Flur schien unendlich viel länger als bei seinem ersten Besuch.
»Hören Sie, es tut mir leid«, wiederholte Haberland, als sie das Wohnzimmer betraten, dessen hervorstechendes Merkmal ein offener Kamin war, in dem ein schwächelndes Feuer langsam ausbrannte. Seine Stimme klang ruhig, fast mitleidig. »Ich wünschte wirklich, Sie wären früher gekommen. Jetzt wird die Zeit knapp.«
Haberlands Augen waren völlig ausdruckslos. Wenn er Angst hatte, konnte er sie ebenso gut verbergen wie der greise Hund, der in einem kleinen Rattankörbchen vor dem Fenster schlief. Das sandfarbene Fellknäuel hatte noch nicht einmal den Kopf gehoben, als sie eingetreten waren.
Marc ging in die Mitte des Raumes und sah sich unschlüssig um. »Die Zeit wird knapp? Wie meinen Sie das?«
»Sehen Sie sich doch an. Sie sind in einem schlimmeren Zustand als meine Wohnung.«
Marc erwiderte Haberlands Lächeln, und selbst das tat ihm weh. Die Inneneinrichtung des Hauses war in der Tat ebenso ungewöhnlich wie die Lage mitten im Wald. Kein Möbelstück passte zum anderen. Ein überfülltes Ikearegal stand neben einer eleganten Biedermeierkommode. Fast der gesamte Boden war mit Teppichen ausgelegt, von denen einer unschwer als Badezimmerläufer zu erkennen war, der auch farblich nicht mit dem handgeknüpften, chinesischen Seidenteppich harmonierte. Man musste unweigerlich an eine Rumpelkammer denken, und dennoch schien nichts an diesem Arrangement zufällig. Jeder einzelne Gegenstand, vom Grammophon auf dem Teewagen bis zur Ledercouch, vom Ohrensessel bis zu den Leinenvorhängen, wirkte wie ein Souvenir aus vergangenen Zeiten. So als hätte der Professor Angst, die Erinnerung an eine entscheidende Phase seines Lebens zu verlieren, würde er ein Möbelstück weggeben. Die medizinischen Fachbücher und Zeitschriften, die sich nicht nur in den Regalen und auf dem Schreibtisch, sondern auch auf den Fensterbrettern, dem Fußboden und sogar im Holzkorb neben dem Kamin fanden, wirkten wie ein Bindeglied zwischen all dem Krempel.
»Setzen Sie sich doch«, bat Haberland, als wäre Marc immer noch ein willkommener Gast. So wie heute Vormittag, als sie ihn bewusstlos auf die bequeme Polstercouch gelegt hatten, in deren Kissen man zu ertrinken drohte. Doch jetzt hätte er sich am liebsten direkt vor das Feuer gesetzt. Ihm war kalt; so kalt wie noch nie zuvor in seinem Leben.
»Soll ich noch etwas nachlegen?«, fragte Haberland, als habe er seine Gedanken gelesen.
Ohne eine Antwort abzuwarten, ging er zum Holzkorb, zog ein Scheit hervor und warf es in den Kamin. Die Flammen schlugen hoch, und Marc spürte ein nahezu unerträgliches Verlangen, die Hände mitten ins Feuer zu strecken, um endlich die Kälte aus seinem Körper zu vertreiben.
»Was ist mit Ihnen passiert?«
»Wie bitte?« Er benötigte eine Weile, um seinen Blick von dem Kamin abzuwenden und sich wieder auf Haberland zu konzentrieren. Der Professor musterte ihn von oben bis unten.
»Ihre Verletzungen? Wie ist das geschehen?«
»Das war ich selbst.«
Zu Marcs Erstaunen nickte der alte Psychiater nur. »Das habe ich mir bereits gedacht.«
»Weshalb?«
»Weil Sie sich fragen, ob Sie überhaupt existieren.«
Die Wahrheit schien Marc regelrecht auf das Sofa zu drücken. Haberland hatte recht. Genau das war sein Problem. Heute Vormittag noch hatte der Professor sich in Andeutungen verloren, doch jetzt wollte Marc es ganz genau wissen. Deshalb saß er schon wieder auf dieser weichen Couch.
»Sie wollen wissen, ob Sie real sind. Auch aus diesem Grund haben Sie sich selbst Verletzungen zugefügt. Sie wollten sicherstellen, dass Sie noch etwas spüren.«
»Woher wissen Sie das?«
Haberland winkte ab. »Erfahrung. Ich war selbst einmal in einer vergleichbaren Lage wie Sie.«
Der Professor sah auf seine Uhr am Handgelenk. Marc war sich nicht sicher, aber er glaubte, mehrere Narben rund um das Armband entdeckt zu haben, die weniger von einem Messer als von einer Brandwunde herzurühren schienen.
»Ich praktiziere offiziell nicht mehr, aber mein analytisches Gespür hat mich deshalb noch lange nicht verlassen. Darf ich fragen, was Sie im Augenblick empfinden?«
»Kälte.«
»Keine Schmerzen?«
»Die sind auszuhalten. Ich glaube, der Schock sitzt noch zu tief.«
»Aber denken Sie nicht, es wäre besser, wenn Sie nicht hier, sondern in einer Notaufnahme wären? Ich habe noch nicht einmal Aspirin im Haus.«
Marc schüttelte den Kopf. »Ich will keine Tabletten. Ich will nur Gewissheit.«
Er legte die Pistole auf den Couchtisch, die Mündung auf Haberland gerichtet, der immer noch vor ihm stand.
»Beweisen Sie mir, dass es mich wirklich gibt.«
Der Professor griff sich an den Hinterkopf und kratzte sich an der etwa bierdeckelgroßen, lichten Stelle in seinem grauen Haupthaar. »Wissen Sie, was man gemeinhin über den Unterschied zwischen Mensch und Tier sagt?« Er deutete auf seinen Hund in dem Körbchen, der im Schlaf unruhig stöhnte. »Es sei das Bewusstsein. Während wir darüber reflektieren, warum es uns gibt, wann wir sterben werden und was nach dem Tode geschieht, verschwendet ein Tier nicht einen Gedanken daran, ob es überhaupt auf der Welt ist.«
Während er geredet hatte, war Haberland zu seinem Hund gegangen. Er kniete sich hin und nahm liebevoll den wuscheligen Kopf in beide Hände.
»Tarzan hier kann sich noch nicht einmal im Spiegel erkennen.«
Marc rieb sich etwas Blut von einer Augenbraue, dann glitt sein Blick zum Fenster. Für einen kurzen Moment hatte er geglaubt, dort draußen ein Licht in der Dunkelheit gesehen zu haben, doch dann war ihm klargeworden, dass das Glas nur das Flackern des Kamins widerspiegelte. Der Regen musste zurückgekommen sein, denn die Scheibe war außen mit winzigen Tropfen überzogen. Nach einer Weile entdeckte er sein eigenes Spiegelbild weit draußen in der Dunkelheit über dem See.
»Nun, ich sehe mich noch, aber wie kann ich wissen, dass der Spiegel nicht lügt?«
»Was hat Sie denn zu der Annahme verleitet, Sie würden an Wahnvorstellungen leiden?«, stellte Haberland die Gegenfrage.
Marc konzentrierte sich wieder auf die Tröpfchen an der Scheibe. Sein Spiegelbild schien zu zerlaufen.
Nun, wie wäre es zum Beispiel mit Hochhäusern, die sich in Luft auflösen, kurz nachdem ich sie verlassen habe? Mit Menschen, die in meinem Keller gefangen gehalten werden und mir Bücher übergeben, in denen ich nachlesen kann, was mir in wenigen Sekunden zustoßen wird? Ach ja, und dann wären da noch die Toten, die plötzlich wiederauferstehen.
»Weil es für all das, was mir heute widerfahren ist, keine logische Erklärung gibt«, sagte er leise.
»O doch, die gibt es.«
Marc schnellte herum. »Welche? Bitte sagen Sie es mir.«
»Ich fürchte, dafür fehlt uns die Zeit.« Haberland sah schon wieder auf seine Uhr. »Uns bleibt nicht mehr viel, bevor Sie endgültig von hier verschwinden müssen.«
»Wovon sprechen Sie?«, fragte Marc, griff sich seine Waffe vom Couchtisch und stand auf. »Gehören Sie etwa auch zu denen? Stecken Sie da mit drin?« Er richtete die Pistole auf den Kopf des Psychiaters.
Haberland streckte ihm abwehrend beide Hände entgegen. »Es ist nicht so, wie Sie denken.«
»Ach ja, und woher wissen Sie das?«
Der Professor schüttelte mitleidig den Kopf.
»Raus mit der Sprache!« Marc schrie so laut, dass die Adern am Hals hervortraten. »Was wissen Sie über mich?«
Die Antwort nahm ihm die Luft zum Atmen.
»Alles.«
Das Feuer loderte auf. Marc musste wegsehen, auf einmal ertrugen seine Augen die Helligkeit nicht mehr.
»Ich weiß alles, Marc. Und Sie wissen es auch. Sie wollen es nur nicht wahrhaben.«
»Dann, dann …« Marcs Augen begannen zu tränen. »… dann sagen Sie es mir bitte. Was geschieht hier mit mir?«
»Nein, nein, nein.« Haberland faltete die Hände beschwörend wie zum Gebet. »So funktioniert das nicht. Glauben Sie mir. Jede Erkenntnis ist wertlos, wenn sie nicht von innen kommt.«
»Das ist doch scheiße!«, brüllte Marc und schloss kurz die Augen, um sich besser auf den Schmerz in der Schulter konzentrieren zu können. Bevor er weiterredete, schluckte er das Blut herunter, das sich in seinem Mund angesammelt hatte. »Sagen Sie mir sofort, was hier gespielt wird, oder, ich schwöre bei Gott, ich bringe Sie um.«
Jetzt zielte er nicht mehr auf den Kopf, sondern genau auf die Leber des Professors. Auch wenn er nicht richtig traf, würde die Kugel lebenswichtige Organe zerstören, und hier draußen käme jede Hilfe zu spät.
Haberland verzog keine Miene.
»Also schön«, sagte er nach einer Weile, in der sie sich wortlos angestarrt hatten. »Sie wollen die Wahrheit wissen?«
»Ja.«
Der Professor setzte sich langsam in den Ohrensessel und neigte den Kopf zum Kamin, in dem das Feuer immer stärker loderte. Seine Stimme wurde zu einem kaum wahrnehmbaren Flüstern. »Haben Sie jemals eine Geschichte gehört und sich danach gewünscht, Sie hätten das Ende niemals erfahren?«
Er drehte sich zu Marc und sah ihn mitleidig an.
»Sagen Sie nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt.«
3.
Elf Tage zuvor
Es gibt Menschen, die leiden unter Vorahnungen. Sie stehen am Straßenrand, sehen einen Wagen vorbeifahren und halten inne. Das Auto ist unauffällig, weder frisch gewaschen noch außergewöhnlich verdreckt. Auch der Fahrer unterscheidet sich nicht von all den anderen namenlosen Gesichtern, die täglich an einem vorüberziehen. Er ist weder zu alt noch zu jung, weder hält er das Lenkrad zu verkrampft, noch telefoniert er freihändig und isst noch dabei. Und er überschreitet die Geschwindigkeit nur in dem Maß, das nötig ist, um sich dem Rest des Verkehrs anzupassen. Es gibt keine Vorzeichen für die drohende Katastrophe. Und dennoch drehen sich einige Menschen um – aus einem Grund, den sie später der Polizei nicht nennen können – und starren dem Auto hinterher. Lange bevor sie die Kindergärtnerin sehen, die ihre zerbrechlichen Zöglinge ermahnt, sich beim Überqueren der Ampel an den Händen zu halten.
Marc Lucas zählte ebenfalls zu den »Schicksalsfühligen«, wie seine Frau Sandra ihn immer genannt hatte, auch wenn die Gabe bei ihm nicht so ausgeprägt war wie bei seinem Bruder. Sonst hätte er vor sechs Wochen die Tragödie vielleicht verhindern können. Ein Alptraum, der sich in dieser Sekunde zu wiederholen schien.
»Halt, warte noch einen Augenblick!«, rief er zu dem Mädchen nach oben.
Die Dreizehnjährige fror erbärmlich. Sie stand an der äußersten Kante des Fünfmeterbretts, beide Arme um die Rippen geschlungen, die sich durch den dünnen Stoff des Badeanzugs abzeichneten. Marc war sich nicht sicher, ob es die Kälte war, die sie frösteln ließ, oder die Angst vor dem Sprung. Von seinem Standpunkt aus hier unten in dem entleerten Schwimmbecken war das nicht zu unterscheiden.
»Fick dich, Luke!«, schrie Julia in ihr Handy.
Marc fragte sich, wie sie das dürre Mädchen da oben überhaupt bemerkt hatten. Immerhin war das Stadtbad Neukölln schon seit Monaten gesperrt. Julia musste die Aufmerksamkeit eines Passanten auf sich gezogen haben, der schließlich die Feuerwehr alarmiert hatte.
»Fick dich und verpiss dich endlich!«
Sie beugte sich nach vorne und sah in die Tiefe, als suche sie einen geeigneten Platz für ihren Aufprall auf den dreckigen Kacheln. Irgendwo zwischen der großen Pfütze und dem Laubhaufen.
Marc schüttelte den Kopf und drückte sein Handy an das andere Ohr. »Nee, ich bleib hier. Die Gelegenheit lass ich mir doch nicht entgehen, Schätzchen.«
Er hörte ein Raunen hinter sich und sah kurz zu dem Einsatzleiter der Feuerwehr hinüber, der sich mit vier weiteren Helfern und einer Sprungmatte am Beckenrand postiert hatte. Der Mann sah so aus, als bereue er schon jetzt, ihn zu Hilfe gerufen zu haben.
Sie hatten seine Telefonnummer in der Tasche von Julias Jeans gefunden, die sie gemeinsam mit ihren anderen Anziehsachen sorgsam gefaltet neben die Leiter des Sprungturms gelegt hatte. Es war kein Zufall, dass sie heute ausgerechnet den Badeanzug trug, in dem sie von zu Hause ausgerissen war. An jenem Sommertag, als ihr drogensüchtiger Stiefvater ihr wieder einmal am See aufgelauert hatte.
Marc legte wieder den Kopf in den Nacken. Im Gegensatz zu Julia hatte er keine Haare mehr, die der Wind zerzausen konnte. Seine Geheimratsecken waren schon kurz nach dem Abitur so ausgeprägt gewesen, dass der Frisör ihm zu einer Radikalrasur geraten hatte. Das war nun dreizehn Jahre her. Heute, wo eine Hundert-Kaffeetassen-Woche seinen Alltag bestimmte, konnte es schon passieren, dass er von einer Fremden in der U-Bahn angelächelt wurde – aber nur, wenn sie auf die Lüge der Männermagazine hereingefallen war, die Tränensäcke, Sorgenfalten, eine schlechte Rasur und andere Verfallserscheinungen zu Charaktermerkmalen erklärten.
»Was laberst du wieder für Dreck?«, hörte er sie fragen. Ihr Atem dampfte wütend. »Was für eine Gelegenheit?«
Der Berliner November war für seine plötzlichen Kälteeinbrüche bekannt, und Marc fragte sich, woran Julia eher sterben würde, an dem Aufprall oder an einer Lungenentzündung. Auch er war völlig unpassend gekleidet. Nicht nur, was das Wetter betraf. Keiner seiner Bekannten lief heute noch in löchrigen Jeans und zerschlissenen Turnschuhen durch die Gegend. Aber keiner von denen hatte ja auch einen Job wie seinen.
»Wenn du jetzt springst, versuche ich dich aufzufangen«, rief er.
»Dann gehen wir halt beide drauf.«
»Möglich. Aber noch wahrscheinlicher ist, dass mein Körper deinen Sprung abfedert.«
Es war ein gutes Zeichen, dass Julia ihm vor zehn Minuten erlaubt hatte, in den dreckigen Pool hinabzusteigen. Den Feuerwehrmännern hatte sie mit einem sofortigen Kopfsprung gedroht, wenn sie auch nur eine Matte ins leere Becken werfen würden.
»Du bist noch im Wachstum, deine Gelenke sind sehr biegsam.«
Er war sich nicht sicher, ob das bei ihrem Drogenkonsum wirklich stimmte, aber für den Augenblick klang es glaubhaft.
»Was soll denn diese Scheiße schon wieder heißen?«, brüllte sie zurück.
Nun konnte er sie auch ohne Telefon verstehen.
»Wenn du unglücklich fällst, kannst du die nächsten vierzig Jahre nur noch deine Zunge bewegen. So lange, bis einer der Schläuche, durch den deine Körperflüssigkeiten abtransportiert werden, verstopft ist und du an einer Infektion, einer Thrombose oder einem Schlaganfall verreckst. Willst du das?«
»Und du? Willst du denn sterben, wenn ich auf dich draufknalle?«
Julias kehlige Stimme klang nicht wie die einer Dreizehnjährigen. So als hätte sich der Dreck der Straße auf ihre Stimmbänder gelegt, und ihre Stimme verriete jetzt das wahre Alter ihrer Seele.
»Ich weiß nicht«, antwortete Marc wahrheitsgemäß. Gleich danach hielt er die Luft an, als Julia von einem Windstoß erfasst wurde und nach vorne schwankte. Doch sie hielt mit den Armen das Gleichgewicht.
Noch.
Diesmal drehte sich Marc nicht zu der aufstöhnenden Menge in seinem Rücken um. Der Lautstärke nach hatten sich zu den Männern der Polizei und der Feuerwehr zahlreiche Schaulustige gesellt.
»Auf jeden Fall hätte ich ebenso viel Grund zum Springen wie du«, sagte er.
»Du laberst doch jetzt nur irgendeine Scheiße, um mich abzuhalten.«
»Ach ja? Wie lange kommst du jetzt schon zum ›Strand‹, Julia?«
Marc mochte den Namen, den die Straßenkinder seinem Büro an der Hasenheide gegeben hatten. Strand. Das klang optimistisch und passte doch zu dem menschlichen Treibgut, das die Welle des Schicksals Tag für Tag in sein Büro spülte. Offiziell hieß die Zentrale natürlich anders. Aber selbst in den Akten des Senats war schon lange nicht mehr von der »Jugendsprechstelle Neukölln« die Rede.
»Wie lange kennen wir uns?«, fragte er noch einmal.
»Keine Ahnung.«
»Es sind jetzt anderthalb Jahre, Julia. Hab ich dir in dieser Zeit jemals irgendeine Scheiße erzählt?«
»Weiß nicht.«
»Habe ich dich ein einziges Mal angelogen? Oder versucht, deine Eltern oder Lehrer zu informieren?«
Sie schüttelte den Kopf, zumindest glaubte er das von hier unten zu erkennen. Ihre pechschwarzen Haare fielen ihr über die Schultern.
»Hab ich irgendjemandem erzählt, wo du anschaffst oder wo du pennst?«
»Nein.«
Marc wusste, wenn Julia jetzt sprang, würde er sich genau deswegen rechtfertigen müssen. Doch sollte es ihm gelingen, diesen cracksüchtigen Teenager vom Selbstmord abzuhalten, dann war das einzig und allein dem Umstand zu verdanken, dass er in all den Monaten zuvor ihr Vertrauen gewonnen hatte. Er machte den Menschen keinen Vorwurf, die das nicht verstanden – seinen Freunden beispielsweise, die bis heute nicht begreifen konnten, warum er sein Jurastudium an Asoziale verschwendete, wie sie es nannten, anstatt es in einer Großkanzlei zu Geld zu machen.
»Du warst nicht da. Sechs Wochen lang«, sagte Julia trotzig.
»Hör zu, ich stecke nicht in deiner Haut. Ich lebe nicht in deiner Welt. Aber ich habe auch meine Probleme. Und die sind im Augenblick so groß, dass viele andere sich schon längst das Leben genommen hätten.«
Oben ruderte Julia wieder mit den Armen. Von hier unten sah es so aus, als wären ihre Ellbogen verdreckt. Aber Marc wusste, dass der dunkle Schorf von den Narben herrührte, die sie sich selbst zufügte. Es war nicht das erste Mal, dass eine Ritzerin Ernst machte. Kinder, die sich selbst mit einer Rasierklinge schnitten, um wenigstens irgendein Gefühl zu empfinden, zählten zu den häufigsten Besuchern am »Strand«.
»Was ist passiert?«, fragte sie leise.
Er tastete vorsichtig nach dem Pflasterverband im Nacken, den er spätestens übermorgen wieder wechseln lassen musste. »Das ist egal. Meine Scheiße macht deine nicht besser.«
»Amen.«
Marc lächelte und sah kurz auf sein Handy, das einen ankommenden Anruf anzeigte. Er drehte sich zur Seite und bemerkte eine Frau in einem schwarzen Trenchcoat, die ihn vom Beckenrand aus mit großen, weit aufgerissenen Augen anstarrte. Offensichtlich war die Polizeipsychologin gerade eingetroffen und mit seiner Herangehensweise nicht ganz einverstanden. Hinter ihr stand ein älterer Mann in einem teuren Nadelstreifenanzug, der ihm freundlich zuwinkte.
Er beschloss, beide zu ignorieren.
»Weißt du noch, was ich dir gesagt habe, als du deinen ersten Entzug abbrechen wolltest, weil die Schmerzen zu stark wurden? Manchmal fühlt es sich falsch an …«
»… das Richtige zu tun. Ja, ja, dieser blöde Spruch kommt mir mittlerweile zum Arsch raus. Aber weißt du, was? Du irrst dich. Das Leben fühlt sich nicht nur falsch an. Es ist falsch. Und dein dummes Gelaber wird mich jetzt nicht davon abhalten …«
Julia trat zwei Schritte zurück. Es sah so aus, als wolle sie Anlauf nehmen.
Die Menge hinter ihm stöhnte auf. Marc ignorierte ein weiteres Anklopfen in der Leitung.
»Okay, okay, dann warte wenigstens noch einen Augenblick, ja? Ich hab dir was mitgebracht …«
Er fingerte einen winzigen iPod aus seiner Jackentasche, stellte ihn auf volle Lautstärke und hielt den Kopfhörer dicht an das Handymikrophon.
»Ich hoffe, du kannst was hören«, rief er nach oben.
»Was soll das denn jetzt werden?«, fragte Julia. Ihre Stimme klang belegt, als wüsste sie, was jetzt kam.
»Du weißt doch, der Film ist erst zu Ende, wenn die Musik läuft.«
Diesmal hatte er einen ihrer Sprüche zitiert. Die wenigen Male, die sie freiwillig zu ihm in die Sprechstunde gekommen war, hatte sie darauf bestanden, einen ganz bestimmten Song zu hören, bevor sie ging. Es war so etwas wie ein Ritual zwischen ihnen geworden.
»Kid Rock«, sagte er. Der Anfang war viel zu leise und bei dem Wind und den Nebengeräuschen über das Handy ohnehin nicht zu verstehen. Also tat Marc etwas, was er zuletzt als Teenager getan hatte. Er sang.
»Roll on, roll on, rollercoaster.«
Er sah nach oben und meinte zu sehen, wie Julia die Augen schloss. Dann trat sie einen kleinen Schritt vorwärts.
»We’re one day older and one step closer.«
Die hysterischen Schreckensrufe hinter ihm wurden lauter. Julia trennten nur noch wenige Zentimeter vom Rand des Sprungbretts. Marc sang weiter.
»Roll on, roll on, there’s mountains to climb.«
Die Zehenspitzen von Julias rechtem Fuß lugten bereits über die Kante. Sie hielt weiterhin die Augen geschlossen und das Handy am Ohr.
»Roll on, we’re …«
Marc hörte exakt in der Sekunde auf zu singen, als sie ihr linkes Bein nachziehen wollte. Mitten im Refrain. Ein Zittern ging durch Julias Körper. Sie erstarrte in der Laufbewegung und öffnete erstaunt die Augen.
»… we’re on borrowed time«, flüsterte sie nach einer langen Pause. Um das Becken herum war es totenstill geworden.
Er steckte sein Handy in die Hosentasche, suchte Augenkontakt mit ihr und rief: »Glaubst du, es ist besser? Dort, wo du jetzt hingehst?«
Der Wind zog an den Beinen seiner Jeans und wirbelte das Laub um seine Füße.
»Alles ist besser«, schrie Julia zurück. »Alles.«
Sie weinte.
»Echt? Also ich hab mich gerade gefragt, ob die dort auch deinen Song spielen.«
»Du bist so ein Arsch.« Julias Brüllen war in ein Krächzen übergegangen.
»Wär doch möglich? Ich meine, was, wenn du das nie wieder hören wirst?«
Mit diesen Worten drehte Marc sich um und marschierte zum fassungslosen Entsetzen der Beamten in Richtung Beckenausgang.
»Sind Sie wahnsinnig?«, hörte er jemanden rufen. Ein weiterer wütender Kommentar ging in einem kollektiven Aufschrei der Menge unter.
Marc zog sich gerade an der Aluminiumleiter hoch, als er hinter sich den Aufprall auf den Kacheln hörte.
Erst als er aus dem Becken herausgeklettert war, drehte er sich um.
Julias Handy lag zerborsten an der Stelle, wo er bis eben noch gestanden hatte.
»Du bist ein Arsch«, schrie sie zu ihm herunter. »Jetzt hab ich nicht nur Angst vorm Leben, jetzt fürchte ich mich auch noch vor dem Tod!«
Marc nickte Julia zu, die ihm den Mittelfinger zeigte. Ein tiefes Schluchzen durchschüttelte ihren schmalen Körper, während sie sich auf das Sprungbrett setzte. Zwei Rettungssanitäter waren bereits auf dem Weg zu ihr nach oben.
»Und du singst scheiße!«, brüllte sie ihm heulend hinterher.
Marc musste lächeln und wischte sich eine Träne aus dem Gesicht.
»Der Zweck heiligt die Mittel«, rief er zurück.
Er bahnte sich seinen Weg durch das Blitzlichtgewitter der Pressehyänen und versuchte der Frau in dem Trenchcoat auszuweichen, die sich ihm in den Weg stellte. Er erwartete eine Tirade an Vorwürfen und war über den geschäftsmäßigen Blick erstaunt, den sie ihm schenkte.
»Mein Name ist Leana Schmidt«, sagte sie sachlich wie bei einem Vorstellungsgespräch und reichte ihm die Hand. Das schulterlange, braune Haar trug sie so streng zurückgebunden, dass es so aussah, als ziehe jemand von hinten an ihrem Zopf.
Marc zögerte kurz und griff sich wieder an seinen Verband im Nacken. »Wollen Sie sich nicht erst einmal um Julia kümmern?«
Er sah zum Sprungbrett hoch.
»Deswegen bin ich nicht hier.«
Ihre Blicke trafen sich.
»Worum geht es dann?«
»Um Ihren Bruder. Benjamin ist vorgestern aus der psychiatrischen Klinik entlassen worden.«
4.
Der schwarz glänzende Maybach, der am Ende der schmalen Sackgasse parkte, wirkte in dieser Gegend nicht nur wegen seiner ungewöhnlichen Ausmaße wie ein Fremdkörper. Normalerweise rollten solche Schlachtschiffe nur durch das Regierungsviertel und nicht durch den Bezirk mit der höchsten Kriminalitätsrate der Hauptstadt.
Marc hatte die unbekannte Frau, die mit ihm über seinen Bruder sprechen wollte, einfach stehenlassen und bemühte sich, so schnell wie möglich von hier wegzukommen. Einerseits, weil er auch ohne Neuigkeiten von Benny bereits genug Sorgen am Hals hatte, andererseits musste er Abstand zwischen sich und diesen trostlosen Ort bringen. Zudem wurde es hier draußen von Minute zu Minute kälter.
Er schlug den Kragen seiner Lederjacke hoch und rieb sich die Ohren. Sie waren der wetterempfindlichste Teil seines Körpers und reagierten auf Frost stets mit einem ziehenden Schmerz, der sich schnell bis zu den Schläfen ausbreiten würde, wenn er nicht bald ins Warme kam.
Marc überlegte gerade, ob er die Straßenseite wechseln sollte, um zur U-Bahn zu gehen, als er das Knirschen der Breitreifen hinter sich hörte. Der Fahrer betätigte zweimal kurz die Lichthupe, die Halogenlichter wurden von dem nassen Kopfsteinpflaster reflektiert. Marc blieb auf seiner Seite des Bürgersteigs und lief schneller. Wenn er eines durch seine Arbeit auf der Straße gelernt hatte, dann, dass man es in Berlin so lange wie möglich vermeiden sollte, auf Fremde zu reagieren.
Der Wagen schloss zu ihm auf und verlangsamte dann auf Schritttempo, um fast lautlos neben ihm herzugleiten.
Dass der Maybach auf der Gegenspur fuhr, schien den Fahrer nicht zu kümmern. Das Fahrzeug war ohnehin so breit, dass ein entgegenkommendes Auto hier nicht an ihm vorbeikonnte.
Marc hörte das typische Surren einer elektrischen Fensterscheibe. Dann flüsterte eine heisere Frauenstimme seinen Namen. »Dr.Lucas?«
Sie klang freundlich und ein wenig kraftlos, also riskierte er einen Blick aus den Augenwinkeln und war erstaunt, dass es sich bei der Sprecherin um einen älteren Mann handelte. Er schien weit über sechzig zu sein, vielleicht sogar über siebzig. Während die meisten Stimmen im Alter tiefer wurden, war bei ihm offensichtlich das Gegenteil eingetreten.
Marc beschleunigte seinen Schritt, als er den Mann am Nadelstreifenanzug wiedererkannte. Er hatte ihm vorhin vom Beckenrand aus zugewinkt.
Verdammt, werde ich heute denn nur von Spinnern verfolgt?
»Dr.Marc Lucas, zweiunddreißig Jahre alt, wohnhaft in der Steinmetzstraße 67 A in Schöneberg?«
Der Alte saß auf einem hellen Ledersitz mit dem Rücken zur Fahrtrichtung. Offenbar war der Innenraum der Limousine so groß, dass man sich im Fond gegenübersitzen konnte.
»Wer will das wissen?«, fragte Marc, ohne aufzusehen. Sein Gefühl sagte ihm, dass der Unbekannte mit den weißen Haaren und den wild wuchernden, daumendicken Augenbrauen keine Bedrohung darstellte. Aber das hieß noch lange nicht, dass er nicht der Bote schlechter Nachrichten sein konnte. Und von denen hatte er in den letzten Wochen weiß Gott mehr als genug erhalten.
Der Alte räusperte sich, dann sagte er kaum hörbar: »Der Marc Lucas, der seine schwangere Frau getötet hat?«
Marc erstarrte. Von einer Sekunde auf die andere war es ihm nicht mehr möglich, weiterzugehen. Die feuchte Herbstluft war zu einer undurchlässigen Glaswand geworden.
Er drehte sich zu dem Wagen, dessen Hintertür langsam aufschwang. Ein sanfter elektronischer Warnton summte rhythmisch auf, wie wenn sich jemand nicht angeschnallt hatte.
»Was wollen Sie von mir?«, fragte Marc, als er seine Stimme wiedergefunden hatte. Er klang jetzt fast so heiser wie der Unbekannte im Wagen.
»Sandra und das Baby sind jetzt wie lange tot? Sechs Wochen?«
Marc stiegen die Tränen in die Augen. »Warum tun Sie mir das an?«
»Kommen Sie, steigen Sie ein.«
Der Alte lächelte gutmütig und klopfte auf den Sitz neben sich.
»Ich bringe Sie zu einem Ort, an dem Sie das alles ungeschehen machen können.«
5.
Durch die getönten Scheiben des Maybachs wirkten die lautlos an ihnen vorbeifliegenden Häuserwände wie die unwirklichen Aufbauten einer Filmkulisse. Im schallgeschützten Inneren dieser Luxuslimousine war es schwer vorstellbar, dass hinter den schmutzigen Fassaden da draußen echte Menschen lebten. Oder dass die Passanten am Straßenrand keine Statisten waren. Weder der Rentner, der die Abfalleimer nach Pfandflaschen durchwühlte, noch die Gruppe Schulschwänzer, die gerade den Einkaufswagen einer Obdachlosen umkippen wollten. Natürlich gab es auch unauffällige Subjekte, die sich ihren Weg durch den einsetzenden Regen kämpften. Aber selbst die schienen in einer verlorenen Parallelwelt zu leben, aus der Marc entkommen war, seitdem er hier im Wagen des Unbekannten Platz genommen hatte.
»Wer sind Sie?«, fragte er und beugte sich nach vorn. Sofort passten sich die hydraulischen Luftkissen des ergonomisch geformten Ledersitzes seiner neuen Körperhaltung an. Statt einer Antwort reichte ihm der alte Mann eine Visitenkarte. Sie war ungewöhnlich dick, etwa so wie ein doppelt gefalteter Geldschein. Marc hätte darauf gewettet, dass sie nach einem Edelholz duftete, wenn er an ihr riechen würde.
»Können Sie sich nicht an mich erinnern?«, fragte der Unbekannte und lächelte wieder gutmütig.
»Professor Patrick Bleibtreu?«, las Marc und zeichnete nachdenklich die schwarze Reliefprägung auf dem Leinenpapier mit der Fingerspitze nach. »Kennen wir uns?«
»Sie haben meinem Institut eine E-Mail geschickt, etwa vor zwei Wochen.«
»Moment mal …« Marc drehte die Visitenkarte um und erkannte das Logo der Klinik. Ein talentierter Graphiker hatte die Initialen des Professors zu einer dreidimensionalen, seitwärtsliegenden Acht verwoben, dem Zeichen für Unendlichkeit.
»Diese Anzeige … die im Spiegel, die war von Ihnen?«
Bleibtreu nickte kurz, öffnete die Armlehne neben sich und nahm eine Zeitschrift heraus. »Wir inserieren im Focus, Stern und Spiegel. Ich denke, Sie haben sich hierauf gemeldet.«
Marc nickte, als der Mann ihm die aufgeschlagene Zeitschrift reichte. Es war reiner Zufall gewesen, dass ihm die Annonce beim Durchblättern überhaupt aufgefallen war. Normalerweise las er keine Nachrichtenmagazine und schon gar keine Werbung. Doch seitdem er zweimal die Woche zum Verbandswechsel musste, hatte er viel Zeit mit den meist veralteten Illustrierten verbringen dürfen, die im Wartebereich der Klinik seines Schwiegervaters auslagen.
»Lernen zu vergessen«, wiederholte er die Überschrift, die ihn schon damals magnetisch angezogen hatte.
Sie haben ein schweres Trauma erlitten und wollen es aus Ihrer Erinnerung löschen? Dann wenden Sie sich an uns und schicken Sie uns eine E-Mail. Die Psychiatrische Privatklinik Bleibtreu sucht Teilnehmer für einen Feldversuch unter medizinischer Aufsicht.
»Weshalb haben Sie nicht auf unsere Rückrufe reagiert?«, wollte der Professor wissen.
Marc rieb sich kurz die Ohren, die langsam mit dem vertrauten brennenden Schmerz auftauten. Daher also rührten die zahlreichen Anrufe, die er in den letzten Tagen nicht beantwortet hatte.
»Ich gehe nie an unterdrückte Rufnummern«, sagte er. »Und, ehrlich gesagt, steige ich auch nie zu Fremden ins Auto.«
»Wieso haben Sie eben eine Ausnahme gemacht?«
»Ist trockener.«
Marc lehnte sich wieder zurück und deutete auf das nasse Seitenfenster. Der Fahrtwind zog die dicken Regentropfen quer über die wasserabweisende Oberfläche der Scheibe.
»Kümmert sich bei Ihnen der Chef immer persönlich um neue Patienten?«, fragte er.
»Nur wenn es sich um so aussichtsreiche Kandidaten handelt wie Sie.«
»Aussichtsreich wofür?«
»Für das Gelingen unseres Experiments.«
Der Professor nahm die Zeitschrift wieder an sich und legte sie zurück in die Mittelkonsole.
»Ich will ganz offen zu Ihnen sein, Marc. Ich darf Sie doch so nennen, oder?« Sein Blick fiel auf Marcs Turnschuhe und wanderte dann hoch zum Knie, das durch die Fäden der ausgefransten Jeans schimmerte.
»Sie wirken nicht wie jemand, der allzu steif auf Etikette bedacht ist.«
Marc zuckte mit den Achseln. »Worum geht es bei dem Experiment?«
»Die Bleibtreu-Klinik ist weltweit führend auf dem Gebiet der privaten Gedächtnisforschung.«
Der Professor überkreuzte seine Beine. Dabei rutschte seine Nadelstreifenhose etwas über die Socke und gab den Blick auf den Ansatz eines behaarten Schienbeins frei.
»In den letzten Jahrzehnten wurden Hunderte Millionen an Forschungsgeldern investiert, um herauszufinden, wie das menschliche Gehirn funktioniert. Vereinfacht ausgedrückt geht es dabei hauptsächlich um Fragestellungen, die sich mit dem Thema ›Lernen‹ beschäftigen. Legionen von Forschern waren und sind von dem Gedanken besessen, die Kapazität des Gehirns besser nutzen zu können.«
Bleibtreu tippte sich gegen die Schläfe.
»Nach wie vor gibt es keinen besseren Hochleistungsrechner als den in unserem Kopf. Theoretisch wäre jeder Mensch dazu in der Lage, nach dem einmaligen Lesen des Telefonbuchs alle Nummern auswendig aufzusagen. Die Fähigkeit, Synapsen zu bilden und damit die Speicherkapazität unseres Gehirns ins nahezu Unendliche zu steigern, ist keine Utopie. Dennoch gehen all diese Forschungsansätze meiner Überzeugung nach in die falsche Richtung.«
»Ich schätze, Sie verraten mir gleich, wieso.«
Der Wagen wurde von dem unsichtbaren Fahrer hinter der blickdichten Glasscheibe in einen Kreisverkehr gelenkt.
»Weil unser Problem nicht ist, dass wir zu wenig lernen. Im Gegenteil. Unser Problem ist das Vergessen.«
Marcs Hand wanderte zu dem Pflasterverband im Nacken. Als er sich dieser unbewussten Bewegung gewahr wurde, zog er den Arm sofort wieder zurück.
»Nach jüngsten Statistiken wird jedes vierte Kind missbraucht, jede dritte Frau einmal in ihrem Leben sexuell genötigt oder vergewaltigt«, referierte Bleibtreu. »Überhaupt gibt es kaum einen Menschen auf unserem Planeten, der nicht mindestens ein Mal zum Opfer einer Straftat wurde, wovon die Hälfte danach psychologisch betreut werden müsste, zumindest kurzfristig. Doch nicht nur Verbrechen, sondern auch zahlreiche Alltagserlebnisse sorgen oft für Narben in unserem Seelengewebe. Liebeskummer zum Beispiel hat psychologisch betrachtet eine fast noch größere negative Intensität als das Gefühl, einen nahen Angehörigen verloren zu haben.«
»Das klingt so, als hätten Sie diesen Vortrag schon zigmal gehalten«, warf Marc ein.
Bleibtreu zog sich einen dunkelblauen Siegelring vom Finger und steckte ihn an die andere Hand. Er lächelte.
»In der Psychoanalyse ging man bislang den Weg der Aufarbeitung verdrängter Erinnerungen. Wir marschieren mit unserer Forschung in die entgegengesetzte Richtung.«
»Sie helfen den Menschen, zu vergessen.«
»Exakt. Wir löschen die negativen Erinnerungen aus dem Bewusstsein unserer Patienten. Endgültig.«
Das klingt beängstigend, dachte Marc. Er hatte vermutet, dass das Experiment auf so etwas hinauslaufen würde, und sich schon kurz nach dem Versenden der E-Mail über seine weinselige Aktion geärgert. In nüchternem Zustand hätte er sich niemals auf diese dubiose Anzeige der Bleibtreu-Klinik gemeldet. Doch an jenem Abend hatte er einen folgenschweren Fehler gemacht und einem Taxifahrer versehentlich seine alte Adresse genannt. Und so hatte er sich plötzlich vor dem kleinen Häuschen wiedergefunden, das immer noch so aussah, als könne jeden Moment die Tür auffliegen und Sandra ihm barfuß und lachend entgegenlaufen.
Erst das »Zu verkaufen«-Schild im Rasen hatte ihm schmerzhaft seinen Verlust vor Augen geführt. Er hatte sich sofort abgewandt, war die bürgersteiglose Straße zurückgerannt, in der die Nachbarskinder im Sommer auf dem Asphalt spielten und die Haustiere auf den Mülltonnen schliefen, weil hier kein Lebewesen mit der Ankunft des Bösen rechnete. Er war immer schneller gerannt, so schnell er konnte, zurück in sein neues, wertloses Leben, in seine Schöneberger Single-Wohnung, in die er nach seiner Entlassung gezogen war. Doch er war nicht schnell genug gewesen, um all den Erinnerungen davonzulaufen, die hinter ihm herjagten. Die Erinnerung an ihren ersten Kuss im Alter von siebzehn Jahren; an Sandras Lachen, wenn sie ihm schon wieder die Pointe eines Filmes verraten hatte, bevor er selbst darauf gekommen war; an ihren ungläubigen Blick, wenn er ihr sagte, wie schön sie war; ihre gemeinsamen Tränen, die auf den positiven Schwangerschaftstest fielen; und schließlich die Erinnerung an diese Anzeige, die er eben erst gelesen hatte.
Lernen zu vergessen.
Marc atmete tief aus und versuchte sich auf die Gegenwart zu konzentrieren.
»Die Vorteile einer absichtlich herbeigeführten Amnesie sind immens. Ein Mann, dem ein Kind vor das Auto gesprungen ist, wird nie wieder mit den schrecklichen Bildern der fehlgeschlagenen Reanimation verfolgt werden. Eine Mutter wartet nicht bis ans Ende ihres Lebens darauf, dass ihr Elfjähriger vom See zurückkommt.«
Der Wagen bremste sanft ab, dennoch klirrten mehrere Kristallgläser leise in der holzverkleideten Bordbar.
»Ich will nicht verhehlen, dass auch die Geheimdienste an unseren Ergebnissen interessiert sind. Agenten müssten ab sofort nicht mehr getötet werden, wenn die Gefahr droht, dass sie mit ihrem Wissen zum Feind überlaufen. Wir löschen einfach die brisanten Daten aus ihrem Kopf.«
»Schwimmen Sie deshalb so im Geld, weil Sie vom Militär gefördert werden?«
»Es ist ein Milliardengeschäft, und es wird wie kein zweites die nächsten Jahre bestimmen, zugegeben. Aber so ist es doch immer in der medizinischen Industrie. Sie macht einige wenige reich, aber sehr viele gesund und vielleicht sogar glücklich.«
Bleibtreu fixierte Marc jetzt mit einer durchdringenden Intensität, als wolle er ihn verhören.
»Wir stehen noch ganz am Anfang, Marc. Wir leisten hier Pionierarbeit, und dafür sind wir auf der Suche nach Menschen wie Ihnen. Probanden, die derart schwere Traumata durchstehen mussten wie Sie.«
Marc schluckte und fühlte sich so wie vor sechs Wochen, als sein Schwiegervater ihm persönlich die grauenhafte Nachricht am Krankenbett mitgeteilt hatte.
»Sie hat es nicht geschafft, Luke.«
»Überlegen Sie doch einmal selbst«, bat Bleibtreu. »Wäre es nicht schön, wenn Sie morgen früh aufwachen könnten, und der erste Gedanke würde nicht Ihrer toten Frau gelten? Nicht dem Baby, das nie zur Welt kam? Sie hätten keine Schuldgefühle mehr, denn Sie wüssten gar nicht, dass Sie das Auto gegen den Baum gelenkt haben. Sie würden wieder zur Arbeit gehen, sich mit Freunden treffen und über eine Komödie im Kino lachen können, weil der Splitter in Ihrem Nacken Sie nicht ständig daran erinnern würde, dass Sie lediglich einen Kratzer abbekamen, während Sandra durch die Windschutzscheibe schleuderte und noch an der Unfallstelle verblutete.«
Marc löste demonstrativ seinen Gurt und suchte in der Seitentür nach dem Griff. »Lassen Sie mich bitte aussteigen.«
»Marc.«
»Sofort!«
Bleibtreu legte ihm sacht die Hand auf das Knie. »Ich wollte Sie nicht provozieren. Ich habe nur die Worte Ihrer E-Mail wiederholt, die Sie uns selbst geschrieben haben.«
»Damals war ich am Ende.«
»Das sind Sie immer noch. Ich habe Sie eben am Schwimmbecken erlebt. Sie sagten, Sie denken an Selbstmord!«
Er nahm die Hand wieder weg, doch Marc spürte ihr Gewicht weiterhin auf seinem Oberschenkel ruhen.
»Ich habe Ihnen etwas Besseres anzubieten.«
Das Kristall klirrte wieder, als prosteten sich zwei Geister höhnisch zu. Marc bemerkte erst jetzt, dass sein Rücken schweißnass war, obwohl der Innenraum angenehm temperiert war. Wieder griff er sich nervös an den Verband im Nacken. Diesmal ließ er die Hand auf dem Pflaster über der juckenden Wunde liegen.
»Nur mal rein hypothetisch gesprochen«, fragte er mit belegter Stimme, »Ihr Experiment? Wie soll das eigentlich funktionieren?«
6.
In Eddy Valkas Laden stank es nach Katzenpisse und Rosenblüten. Keine ungewöhnliche Mischung, wenn man Eddy etwas näher kannte. Ungewöhnlich war nur, dass er ihn schon so früh sehen wollte. Schließlich war er gerade mal zwei Tage draußen, und eigentlich lief das Ultimatum erst in der nächsten Woche aus.
»Was ist, willst du mir einen Antrag machen?«, lachte Benny und rieb sich die linke Schulter, die ihm die beiden Schwachköpfe beinahe ausgekugelt hätten, als sie ihn in den Kofferraum hatten werfen wollen.
Dabei wäre er freiwillig eingestiegen. Niemand widersetzte sich, wenn Valka einen sprechen wollte. Zumindest nicht lange.
Eddy sah nur kurz auf, dann widmete er sich wieder den langstieligen Rosen, die vor ihm auf der Arbeitsplatte lagen. Eine nach der anderen nahm er hoch, begutachtete ihren Wuchs, kürzte sie mit einer Handschere und steckte sie zu den anderen in einen silbergrauen Blecheimer.
»Erst musst du aber bei meinen Eltern um meine Hand anhalten.«
»Deine Eltern sind tot«, sagte Valka tonlos und schnitt einer Rose den Kopf ab.
Offenbar war er mit der Farbe ihrer Blüte nicht einverstanden gewesen.
»Wusstest du, dass man Schnittblumen kurz in kochend heißes Wasser tauchen soll, wenn sie die Köpfe hängen lassen?« Eddy ließ die kleine Gartenschere in seiner Hand aufschnappen und verscheuchte damit eine Kartäuserkatze, die zu ihm auf den Tisch springen wollte.
»Mit dem Kopf oder mit dem Stiel?«, witzelte Benny.
Er sah der Katze hinterher, die sich zu ihren Geschwistern unter die Heizung trollte. Niemand wusste, weshalb Valka diese Viecher überhaupt in seiner Umgebung duldete. Eddy mochte keine Tiere. Wenn man es genau betrachtete, mochte er grundsätzlich keine Lebewesen. Den Blumenladen hatte er nur aufgemacht, weil er dem Finanzamt schlecht seine wahren Geldquellen angeben konnte und es außerdem nicht einsah, dass die bei ihm versklavten Rosenverkäufer, die nachts durch die Bars und Kneipen der Stadt zogen, ihre Bettelware anderswo bezogen. Wenn er ein Geschäft kontrollierte, dann zu hundert Prozent.
Benny suchte nach einer Möglichkeit, sich zumindest irgendwo anzulehnen, aber für Wartende war das schwüle Ladengeschäft nicht ausgelegt. Überhaupt schien es nicht an Kunden interessiert, dazu lag es viel zu weit abseits von den Köpenicker Hauptgeschäftsstraßen, noch dazu direkt neben einem Boxgym, dessen schlagkräftige Besucher nicht gerade zu der bevorzugten Laufkundschaft eines Floristen zählen.
»Schöner Name übrigens«, sagte Benny mit Blick auf das schlierige Schaufenster. ROSENKRIEG stand dort spiegelverkehrt mit aufgeklebten Buchstaben, die einen Halbkreis andeuteten.
»Passt gut.«
Eddy nickte anerkennend. »Du bist der Erste, dem das auffällt.«
Valka war ein tschechischer Nachname und bedeutete übersetzt »Krieg«, etwas, worauf der Chef der organisierten Ostberliner Türsteherszene außerordentlich stolz war.
Nachdem er sich die Hände an einer grünen Gummischürze abgewischt hatte, sah Eddy ihm zum ersten Mal in die Augen.
»Du siehst besser aus als früher. Nicht mehr so lasch. Treibst du Sport?«
Benny nickte.
»Verdammt, der Psychoknast scheint dir gutgetan zu haben. Wie kommt es, dass du schon so früh wieder draußen bist?«
»Alle paar Monate gibt es eine Überprüfung. Das ist Vorschrift.«
»Aha.«
Valka zog eine besonders langstielige Rose aus dem Eimer, roch an ihr und nickte anerkennend.
»Und die Psychofritzen denken jetzt also, du bist doch nicht mehr gemeingefährlich?«
»Nachdem mein lieber Bruder seine Aussage endlich korrigiert hat …«, Benny griff nach dem Blatt einer Yucca-Palme, »… ja, danach haben sie mich gehen lassen.«
»Die hätten auch mich fragen können«, sagte Valka, und Benny musste grinsen.
»Ehrlich gesagt bin ich mir nicht so sicher, ob du in den Augen der Justiz einen vertrauenswürdigen Leumund hast.«
Eddy verzog beleidigt den Mund. »Es gibt keinen Besseren, um zu bezeugen, dass du keiner Fliege was zuleide tun kannst. Wie lange kennen wir uns jetzt schon?«
»Über siebzehn Jahre«, antwortete Benny und fragte sich, wann Valka endlich zur Sache kommen würde. Bei diesem Treffen ging es wohl kaum um einen Plausch über alte Zeiten.
»Scheiße, damals war meine jetzige Freundin noch nicht mal geboren.«
Valkas Lächeln erstarb so plötzlich, wie es aufgeblitzt war. »Anfangs wollten wir dich nicht dabeihaben, Benny. Du warst uns einfach zu weich.«
Eine weitere Rose wurde geköpft.
»Und genau das würde ich den Psychofritzen erklären, die dich weggesperrt haben. Ich würde denen stecken, dass mein ehemaliger Mitarbeiter ein HSPler ist.«
Benny lächelte. Es war äußerst selten, dass jemand den Fachbegriff für seine Störung kannte. Aber Valka war einer jener Menschen, bei denen man nicht vom Äußeren aufs Innere schließen durfte. Mit dem gedrungenen Gesicht, der platten hohen Stirn und den schiefen Zähnen wirkte er wie der Prototyp eines Schlägers. Tatsächlich hatte er Abitur gemacht und sogar vier Semester Psychologie studiert, bevor er herausfand, dass er nicht die Lösung, sondern lieber die Ursache für die Alpträume seiner Mitmenschen werden wollte.
»Woher weißt du das?«, fragte Benny.
»Nun, ich habe mich oft gefragt, was mit dir nicht stimmt. Weshalb du so anders bist als dein Bruder, der keiner Auseinandersetzung aus dem Weg gegangen ist.«
Eddy rüttelte an einer verklemmten Schublade unter der Arbeitsplatte und zog sie mit einiger Mühe auf.
»Ich meine, ich habe dich nie mit einer Braut gesehen. Also dachte ich, du bist schwul oder so. Doch dann habe ich das hier gefunden.«
Er nahm einen Zeitungsartikel heraus. »HSP«, las er laut. »Highly Sensitive Person. Umgangssprachlich auch als Mensch mit krankhafter hypersensibler Störung bezeichnet. Solche Menschen nehmen ihre Umwelt wesentlich stärker als normale Vergleichspersonen wahr. Sie spüren, fühlen, sehen, schmecken und riechen alles viel intensiver.«
Benny winkte ab. »Das ist alles Humbug.«
»Ach ja? Hier steht, früher waren HSPler Berater und Weise an den königlichen Höfen. Oder sie wurden wegen ihrer Fähigkeit, sich in die Gedanken und Gefühlslagen anderer hineinzuversetzen, zu Diplomaten, Künstlern, Finanzweisen …« Eddy sah kurz über die obere Kante des Artikels hinweg. »Das würde erklären, warum du mich immer belabert hast, ich solle Gnade vor Recht ergehen lassen, Mitleid mit meinen Feinden haben und so einen Scheiß.« Er zog geräuschvoll die Nase hoch. »Und es erklärt, weshalb ich dich damals zu meinem Buchhalter gemacht habe.«
Benny verzog keine Miene, auch wenn Valka sich jetzt endlich dem eigentlichen Grund ihres Treffens näherte. Geld.
»Allerdings steht hier auch …«, Eddy sah wieder auf seinen Artikel und schnalzte mit der Zunge, »… dass HSPler leider oft depressiv werden. Wahnsinnige, die vermehrt den Freitod wählen.«
»Ich lebe noch.«
»Ja. Aber das ist nicht dein Verdienst, sondern das deines Bruders.«
»Müssen wir ausgerechnet über Marc reden?«
Eddy lachte auf. »Gut, dass du mich daran erinnerst, was ich dir eigentlich zeigen wollte. Komm mit.«
Valka warf seine Schürze auf die Arbeitsplatte, griff sich die Gartenschere und gab ihm ein unmissverständliches Zeichen, ihm ins Hinterzimmer zu folgen.
Der angrenzende fensterlose Raum wurde als Lager genutzt. Allerdings nicht für Blumen, Dünger oder Vasen, sondern für Abfälle, wie Benny schockiert feststellen musste. Menschliche Abfälle, und sie lebten noch.
»Es wird Zeit, dass wir endlich deine HSP-Krankheit therapieren«, sagte Valka und zeigte auf einen Mann, der nackt an einem Andreaskreuz hing. In seinem Mund steckte ein orangefarbener Beißball, der in der Mitte eine strohhalmgroße Öffnung besaß, durch die der Nackte atmen musste. Er stand kurz davor, zu hyperventilieren, da er durch die bereits gebrochene Nase keine Luft mehr bekam.
»Ich will, dass du jetzt ganz genau aufpasst«, sagte Eddy und schaltete eine Bauarbeiterleuchte an, die lose von der Decke hing. Dabei presste er die Gartenschere in seiner Hand rhythmisch auf und zu. Die Augen des Geknebelten weiteten sich, als er das Ratschen hörte. Noch konnte er die Klingen nicht sehen, da sein Kopf in einer schraubzwingenartigen Vorrichtung steckte, die ihm jede Seitwärtsbewegung unmöglich machte. Die Befestigungsschrauben steckten jeweils in seinen Ohren. Aus dem linken rann bereits Blut.
Benny wollte sich abwenden.
»Nein, nein, nein.« Eddy schnalzte mehrfach mit der Zunge, als wolle er ein Pferd beruhigen. »Schön hinsehen.«
Er trat dicht an den Nackten heran und hielt ihm jetzt die Schere direkt vors Gesicht. Die Klingen funkelten in den Pupillen seines immer heftiger atmenden Opfers.
»Der Artikel hat mir wirklich die Augen geöffnet, Benny. Darin stand nämlich, dass HSPler ein besonders stark ausgeprägtes Schmerzempfinden haben, stimmt das?«
Benny brachte vor Entsetzen kein Wort heraus.
»Manche sprechen nicht einmal auf Betäubungsmittel an. Stell dir vor, was das für Qualen beim Zahnarzt sind.«