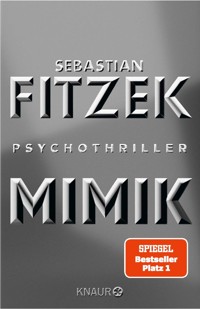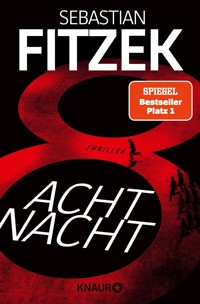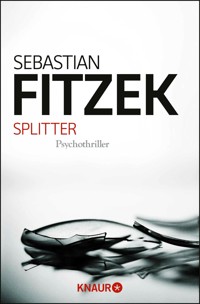12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Stell dir vor ... … du musst eine halbe Ewigkeit auf einem Elternabend verbringen. Dabei hast du gar kein Kind! Ein lebenskluger und hinreißend komischer Roman im Stil von Sebastian Fitzeks Nr.1-Bestseller »Der erste letzte Tag« Sascha Nebel hat sich zur falschen Zeit am falschen Ort das falsche Auto für einen Diebstahl ausgesucht. Kaum, dass er hinter dem Steuer eines Geländewagens Platz genommen hat, zieht eine Horde demonstrierender Klimaaktivisten durch die Straße. Allen voran eine junge Frau, die den SUV mit einer Baseballkeule demoliert. Als die Polizei auf der Bildfläche erscheint, ergreifen Sascha und die Unbekannte die Flucht und platzen in den Elternabend einer 5. Klasse. Um die Nacht nicht in Polizeigewahrsam zu verbringen, bleibt ihnen keine andere Wahl: Sie müssen in die Rolle von Christin und Lutz Schmolke schlüpfen, den Eltern des 11jährigen Hector, die bislang jede Schulveranstaltung versäumten. Zwei wildfremde Menschen, zwischen denen kaum größeres Streitpotential herrschen könnte, geben sich als Vater und Mutter eines ihnen völlig unbekannten Kindes aus. Dabei ist die Tatsache, dass Hector der größte Rüpel der Schule ist, sehr schnell ihr kleinstes Problem …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Sammlungen
Ähnliche
Sebastian Fitzek
Elternabend
Kein Thriller(Auch wenn der Titel nach Horror klingt!)
Knaur eBooks
Mit Illustrationen von Jörn Stollmann
Über dieses Buch
Sascha Nebel hat sich zur falschen Zeit am falschen Ort das falsche Auto für einen Diebstahl ausgesucht: Kaum hat er den SUV seiner Wahl gestartet, zieht eine Horde demonstrierender Klimaaktivisten vorbei, allen voran eine junge Frau, die die Luxuskarosse mit einer Baseballkeule demoliert.
Als die Polizei erscheint, ergreifen Sascha und die Unbekannte die Flucht – und platzen in den Elternabend einer 5. Klasse. Um die Nacht nicht auf dem Revier zu verbringen, bleibt ihnen nur, in die Rolle von Christin und Lutz Schmolke zu schlüpfen, den Eltern des elfjährigen Hector, die bislang jede Schulveranstaltung versäumten.
Zwei wildfremde Menschen, zwischen denen kaum größeres Streitpotenzial herrschen könnte, geben sich als Vater und Mutter eines ihnen völlig unbekannten Kindes aus. Dabei ist die Tatsache, dass Hector der größte Rüpel der Schule ist, sehr schnell ihr kleinstes Problem …
Inhaltsübersicht
Widmung
Wichtiger Hinweis zum Inhalt:
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Danksagung
Für meine Kinder
Wichtiger Hinweis zum Inhalt:
Dieses Buch ist eine komplett ausgedachte, im Kern humorvolle Geschichte. Es werden dennoch ernste Themen behandelt wie Suizid, Mobbing oder Depressionen bei Schulkindern, die Leserinnen und Leser als verstörend empfinden könnten, weil sie sie in einer Komödie womöglich nicht erwarten. Und doch, genau da gehören sie rein. Denn wie sagte schon Mark Twain: Die verborgene Quelle des Humors ist nicht Freude, sondern Kummer.
Kapitel 1
Lassen Sie mich diese Geschichte an der Stelle beginnen, an der sie hätte enden sollen. Um 16.44 Uhr an einem extrem heißen Sommertag in einer kleinen Einbahnstraße in der Heerstraßensiedlung im Südwesten Berlins.
Ich saß hinter dem Lenkrad eines Hundertzwanzigtausend-Euro-Geländewagens – von der albernen Sorte, die in echtem »Gelände« etwa so offroad-tauglich ist wie ein Liegefahrrad im Dschungel –, der von einem völlig bescheuerten Kleinkriminellen aufgebrochen worden war. Ich war dabei, einen Brief zu schreiben. Auf meinem Schoß lag eine in Papier eingewickelte, langstielige blaue Hortensie, und um meinen Hals schlackerte ein lederner Hosengürtel. Die Frau, die sich mir und damit dem parkenden Stadtpanzer näherte, steckte in brombeerfarbenen Yogashorts, die so eng anlagen, dass sie sie wohl vor einen Tannenbaumtrichter gespannt hatte und hindurchgesprungen war, um in sie reinzukommen. An den eher zierlichen Füßen klebten Joggingschuhe in Neonquietschpink. Ein tailliertes, aus Schweiß absorbierendem Slimfit-Stoff gedrechseltes Oberteil mit dem Aufdruck »Save our Planet« komplettierte ihr Sportoutfit.
Sportlich war auch, was die Frau in der Hand hielt. Eine Baseballkeule, die sie, kaum dass sie in Schlagweite war, mit voller Wucht gegen den rechten Xenon-Scheinwerfer des Autos drosch.
Wenn Sie jetzt denken: Hm, das ist aber eine seltsame Situation, dann sage ich: »Herzlich willkommen im Leben von Sascha Nebel. Dem Inhaber eines Premium-Abos auf seltsame Lebenssituationen.« Keine Ahnung, warum ausgerechnet ich mich immer wieder in filmreifen Szenen wiederfinde. Wobei Sie hier weniger an »Pretty Woman« oder »Bodyguard« denken sollten als vielmehr an eine Mischung aus »Dumm und Dümmer« und »SAW«, nur nicht so romantisch.
Ich hielt mich schon länger für so etwas wie einen Irrenmagneten, so oft, wie verhaltensauffällige Menschen ohne Einladung in mein Leben schredderten. Beispielsweise gerade vor einer Stunde der Beknackte im Supermarkt, der mit dem gebrüllten Ausruf »Rechts vor liiiinks!« aus dem Nudelgang schoss und mich mit seinem Einkaufswagen beinahe in die Gefriertruhe rammte.
»Hast du sie noch alle?«, hatte ich ihn angeschrien. Und in etwa das fragte ich jetzt die etwa Gleichaltrige, also Mitte-dreißig-Jährige, mit der Keule. Sicher konnte ich mir ihres genauen Alters nicht sein. Tatsächlich lässt sich das nur schwer schätzen, wenn die Frau einen Gesichtsausdruck hat wie eine Mutter, die versucht, ein Auto hochzuhieven, um ihr darunter eingeklemmtes Kind zu befreien. Nur dass die Unbekannte den Wagen, in dem ich mich ans Lenkrad klammerte, offenbar nicht hochstemmen, sondern schrottreif prügeln wollte. Nach dem Scheinwerfer war jetzt die Windschutzscheibe dran, der sie mit einem gezielten Hieb eine Spinnennetzoptik verpasste.
Pachwumm. Ein weiterer Treffer.
»Was bitte stimmt denn mit dir nicht?«, schrie ich die offenbar irre Gewordene an, die jetzt ein Loch in mein Seitenfenster prügelte. Ich sah, dass sie einen Rucksack aus grauer Lkw-Plane auf dem Rücken trug. Sie hingegen schien mich in ihrem Zerstörungswahn überhaupt nicht zu bemerken. Ihr brauner Zopf schlug wie das Pendel einer Standuhr im Takt zu den Treffern, die sie jetzt auf der Dachkante landete.
Ich beschloss, sie Wilma zu nennen. Wegen der Keule = Steinzeitmensch = Frau von Fred Feuerstein. Kreativ, ich weiß.
Ich fragte mich, ob ich sie kannte, womit sie dann wohl eine Ex-Partnerin hätte sein müssen, denn meiner Lebenserfahrung nach neigen Menschen zu solch hysterischem Extremverhalten in der Öffentlichkeit meist nur im Zustand hochgradiger Eifersucht. Dass ich mit Wilma einst einmal liiert gewesen sein sollte, konnte ich jedoch mit gewisser Sicherheit ausschließen. Allein schon deshalb, weil nur eine einzige meiner (wenigen) Verflossenen so attraktiv gewesen war wie sie.
Wobei, das klingt in dem Zusammenhang jetzt etwas missverständlich. Nicht dass Sie auf die Idee kommen, ich hätte Gewalt auf irgendeine Weise anziehend gefunden. Obwohl weniger wohlmeinende Mitmenschen mein Äußeres schon mal mit einem Boxer verglichen haben (sowohl mit dem Sportler als auch dem Hund!). Dabei täuschte mein Anblick. Meine Nase zum Beispiel war nicht bei einem Faustkampf, sondern in jungen Jahren bei einer Schultheateraufführung gebrochen worden. Ich hatte in einem Bettlaken über die Bühne der Aula hüpfen müssen und war in den Orchestergraben geknallt (sehr zur Freude meiner hämisch lachenden Mitschülerinnen und Mitschüler). Meine auf acht Millimeter rasierten Haare verdankte ich den Geheimratsecken, die im Skinhead-Look weniger verboten aussahen. Und die Narbe unter dem rechten Auge war kein Gang-Erkennungszeichen, sondern der schlagende Beweis dafür, dass man als Teenager keine Abkürzung über die Abschlagsanlage eines Golfplatzes nehmen sollte. Kurz: Ich sah aus wie ein Bad Guy, und Mädchen aus gutem Hause wollten, wenn überhaupt, allenfalls eine kurze Affäre mit mir. Dafür allerdings war ich definitiv nicht der Typ und scheiterte stets krachend daran, die Mädchen aus gutem Hause von meinen inneren Werten zu überzeugen.
Moment mal, fragen Sie sich vermutlich, was hat die Irre mit der Keule mit einem Mädchen aus gutem Hause gemein? Nun, wenn mich nicht alles täuschte, waren ihre Hände perfekt manikürt. (Sagt man das überhaupt so? Ich kenn mich mit den Fachtermini nicht so aus und habe jahrelang geglaubt, Waxing wäre etwas Unanständiges.) Ihre zornig zusammengekniffenen Augenbrauen waren frisch gezupft und die gebleckten Zähne strahlend weiß gesandstrahlt. Für mich waren das sichtbare Insignien eines »guten Zuhauses« – oder zumindest eines besseren Zuhauses, als es mir vergönnt gewesen war, wo Kosmetik- und Wellnesswochenenden nicht sehr hoch auf der Prioritätenliste gestanden hatten. Alles, was über Duschen hinausging, war nach Ansicht meines trinkfreudigen Vaters was für Weicheier. Auch meine Mutter hätte eher mit Haarentferner gegurgelt, als ihr hart erarbeitetes Supermarkt-Verkäuferinnen-Geld in ein Nagelstudio zu tragen. Bei den gemeinsamen Bowlingabenden mit Papa war es besser in Alk, Kippen und Pommes rot-weiß investiert, logisch. Ich glaube, Sie ahnen, weshalb mir eine Karriere als Gegenwartsphilosoph nicht in die Wiege gelegt war.
Kaweng.
Wilma hatte die Seiten gewechselt. Der rechte Außenspiegel platzte ab.
Ich überlegte, ob ich aussteigen sollte. In dieser Situation ein im Grunde unsinniger Gedanke, es sei denn, man war leicht lebensmüde. Andererseits bröckelte der Schutzwall zwischen mir und Wilma buchstäblich. Und das war nicht mal mein größtes Problem.
Ob Sie es glauben oder nicht, im Rückspiegel sah ich noch Bedrohlicheres auf mich zukommen.
Kapitel 2
Ich hatte von der Gefahr in den Nachrichten gehört, sie aber aus naheliegenden Gründen, die Sie gleich erfahren werden, vollständig verdrängt. Eine Meute Heranwachsender, die meisten kaum größer als die Banner und Schilder, die sie trugen. Noch waren sie so weit entfernt, dass ich keinen der Sprüche lesen konnte, aber ich ging fest davon aus, dass sie sich nicht gravierend von dem unterschieden, was sie als Sprechchor in meine Richtung brüllten. In der Hauptsache setzte es sich aus den Wörtern Klima und Killer zusammen.
Oh, verdammt.
Fridays for Future. Die letzte Generation.
Würde ich über Superkräfte verfügen, hätte ich im Rückspiegel dank meiner Teleskopaugen Reste von Sekundenkleber an den Händen der Kinder und Jugendlichen erkannt. Mehr als die Hälfte des Demonstrationszuges hatte heute Vormittag vermutlich noch auf dem Asphalt der Stadtautobahn geklebt.
Ich habe ja durchaus Verständnis dafür, dass sich jüngere Menschen nicht entspannt zurücklehnen, wenn die erwachsene »Nach mir die Sintflut«-Generation so tut, als wäre Erdöl eine Hexe, die man am besten so schnell wie möglich verbrennt. Und ja, man muss kein Mathegenie sein, um sich auszurechnen, dass es energetisch kompletter Schwachsinn ist, sich tausend Kilo Stahl um den Körper zu wickeln, um die eigenen achtzig Kilo Lebendgewicht für einen labbrigen Hamburger durchs Drive-in zu schieben, dessen Herstellung etwa sechstausend Liter Wasser verbraucht hat (der Hamburger wohlgemerkt, nicht das Drive-in). Allerdings war ich mir nicht sicher, ob man die Unbelehrbaren am Ende damit überzeugte, dass man sich ihnen als lebende Verkehrsberuhigungspoller zur Verfügung stellte. Oder damit – jetzt begriff ich das mir bis eben unerklärliche Verhalten Wilmas –, dass man einem Luxus-SUV den versicherungstechnischen Gegenwert eines Trabis verlieh. Auch der »Save our Planet«-Weltrettungsslogan auf ihrem Oberteil ergab jetzt einen tieferen Sinn. Zweifelsohne sympathisierte sie mit den Aktivisten, die sich zügig näherten.
Großer Gott, was jetzt?
Halten Sie mich bitte nicht für einen Feigling. Aber es war definitiv ein ungünstiger Zeitpunkt, um in dem symbolgewordenen Hassobjekt aller Klimaaktivisten zu sitzen, wenn bereits die Vorhut in Gestalt einer wutenthemmten Mittdreißigerin deutlich gemacht hatte, dass sie Gewalt für ein taugliches Mittel zur Weltrettung hielt.
Wilma schien mich endlich bemerkt zu haben. Sie legte eine Pause ein und starrte mich durch die zerbröselte Beifahrerscheibe an, als wäre ich ein Geist, der sich vor ihren Augen aus dem Nichts materialisiert hatte.
»Was machen Sie hier?«, fragte sie mich allen Ernstes. Eine angenehm markante, leicht heisere Stimme, wenngleich die einer offenbar Verwirrten. Ich meine, ich saß nur hinter dem Steuer von etwas, was einst ein Auto gewesen war. Sie hingegen glotzte mich durch ein Loch an, das sie hineingeprügelt hatte.
Ich überlegte, ob ich dem Wahnsinn durch das Dachschiebefenster würde entfliehen können, da wurde die Lage gänzlich aussichtslos.
Die Polizei rückte an.
Ich war so auf die Meute im Rückspiegel und Keulen-Wilma fixiert gewesen, dass ich nicht nach vorne geschaut und daher den Moment verpasst hatte, in dem das gute Dutzend Beamter in die Einbahnstraße gebogen sein musste. Jetzt liefen sie den Demonstranten entgegen, wodurch ich zwischen den Polizisten und den Aktivisten eingekesselt zu werden drohte.
Und in der Tat, das war der Super-GAU. Wieso? Nun, ich sagte doch eingangs, dass der Geländewagen, in dem ich saß, von einem völlig bescheuerten Kleinkriminellen aufgebrochen worden war, mit einer Hortensie auf dem Schoß und einem Ledergürtel um den Hals. Tja, was ich in diesem Zusammenhang zu erwähnen vergaß: Dieser bescheuerte Ganove … der war ich.
Kapitel 3
Scheiße!«
Das fünfte Wort, das ich von Wilma hörte. Das erste, das in diesem Kontext einen Sinn ergab. Und zwar für uns beide. In flagranti von der Polizei bei einer Straftat erwischt zu werden war alles andere als ein erstrebenswertes Feierabenderlebnis. In der Aufregung war ich mir nicht sicher, wer von uns beiden die längere Zeit in U-Haft verbringen würde. Der verhinderte Autodieb (das wäre dann ich) oder die Abwrackhelferin (also sie). Mir schoss durch den Kopf, ob Wilma womöglich in einem Anflug spontaner Spritschleuder-Scham vor lauter Klimareue ihren eigenen SUV zerhackt hatte. Das wäre zumindest eine Erklärung auf ihre Frage: »Was machen Sie hier?«
Und für ihren bass erstaunten Blick.
Zu dieser Theorie passte allerdings nicht, wie sie jetzt die Keule von sich warf, und zwar in Richtung des Waldes, der die rechte Straßenseite säumte (die linke war von den in dieser Gegend obligatorischen Reihenhäusern belegt). Dann rannte sie dem Baseballschläger hinterher, offenbar mit dem Ziel, sich mitsamt ihrem Rucksack als Marschgepäck zwischen den Bäumen zu verdrücken.
Also gut.
Immerhin hatte sie damit auch mir den Fluchtweg freigeräumt. Leider blieb mir kaum etwas anderes übrig, als ihr zu folgen. Denn was war meine Alternative? Losfahren?
Ging nicht. Selbst wenn die Karre noch ansprang, wurde mir ja vorne und hinten der Weg versperrt.
Also aussteigen, um mitten hinein in den Demonstrationszug zu rennen? Mit weit aufgerissenen Armen, lächelnd: »Hey, ihr Lieben, wartet mal kurz, bevor ihr mir euer Protestschild über die Platte schädelt, es ist nicht so, wie es aussieht. Ich bin auf eurer Seite. Das CO2-Monster, aus dem ich gerade geklettert bin, gehört mir gar nicht …«
Oder sitzen bleiben, bis die Polizei mich aus dem SUV zog, um nach kurzer Halterabfrage bei mir die Handschellen klicken zu lassen?
Nein, da blieb nur eins.
Ich atmete tief durch und riss die glücklicherweise nur leicht verbogene Fahrertür auf. Ich schätzte den Abstand zwischen mir und den Beamten auf maximal dreißig Meter.
Der Geruch nach heißem Asphalt wurde von waldbrandtrockenem Kiefernduft abgelöst, als ich erst über eine Straße, dann über einen Fahrradweg in den Wald spurtete. Wobei Wald eine etwas hochtrabende Bezeichnung war. Wenn mich nicht alles täuschte, bildete die Ansammlung von Bäumen, durch die ich rannte, nur ein schmales Mischwaldstreifchen, das eingeklemmt zwischen der Einbahnstraße und der Teufelsseechaussee lag, die – dreimal dürfen Sie raten … richtig! – zum Teufelssee führte.
»Polizei, stehen bleiben!«
Kaum dass mir die ersten Zweige ins Gesicht klatschten, hörte ich eine megafonverzerrte Stimme und drehte mich um. Mindestens zwei Beamte hatten die Verfolgung aufgenommen. Eine jüngere Bohnenstange und ein fülliger Glatzkopf. Mochte der Demonstrationszug, der vermutlich nur eine Abkürzung zum Messedamm hatte nehmen wollen, nicht angemeldet gewesen sein – in den Augen der hinter mir herjapsenden Polizisten war das offenbar das zu vernachlässigende Delikt. Keulen-Wilma sowie ihr Komplize (für den sie mich halten mussten) waren ein weitaus attraktiveres Ziel, wenn es darum ging, Recht und Ordnung wiederherzustellen.
Sie wussten noch nicht einmal, welche Beute ihnen mit mir ins Netz gehen würde. Dabei, darauf lege ich Wert, hatte ich nicht immer eine Strafakte gehabt. Eigentlich habe ich mich den Großteil meines Erwachsenenlebens bemüht, anständig durchs Leben zu kommen. Ich war früher so ehrlich, dass es wehtat. Einmal gab es bei mir einen Rohrbruch, und meine mir sehr zugetane Versicherungsmaklerin fragte mich augenzwinkernd: »Ich nehme an, für den Teppich, der bei dem Wasserschaden zerstört wurde, haben Sie nur deshalb keine Quittung, weil er ein extrem teures Erbstück war?« Und ich antwortete: »Nein, der war total billig. Den wollte ich eh wegschmeißen.«
Doch die Zeiten, als ich mich bemüht hatte, ein rechtschaffener Bürger zu sein, waren vorbei. Seitdem das Schicksal mich von der Überholspur des Lebens auf die Gegenfahrbahn geworfen hat, und das, ohne dass ich etwas Illegales getan hätte. Es war ein lächerliches Gewürz, das mich in eine so tiefe Depression stürzte, dass es mich unter anderem meinen Job als Werbetexter kostete, meine Ehe, mein Vermögen und am Ende auch noch den letzten Funken Selbstachtung. Wenn Sie diese Kurzzusammenfassung meines sozialen Abstiegs mangels weiterführender Informationen jetzt etwas ratlos zurücklässt, dann lassen Sie sich darüber keine grauen Haare wachsen. Es reicht völlig, wenn Sie verstehen, dass ich eines Tages mittellos und hoch verschuldet mit dem Räumungsbeschluss im Briefkasten in meiner Mietwohnung aufwachte und feststellen musste, dass ich im Leben nichts Anständiges gelernt hatte. Als Werbefuzzi konnte ich quatschen, texten und den Menschen Dinge andrehen, die sie nicht brauchten. Im Grunde also hatte ich die perfekte Ausbildung zum Kleinbetrüger absolviert. Und als solcher versuchte ich mich fortan durchs Leben zu schlagen, nach dem Motto: Wenn das Leben dir Zitronen gibt, dann mach keine Limonade draus, sondern finde jemanden, dem du einreden kannst, sie wären die letzten von einer Handvoll Exemplare, die auf den geweihten Hügeln Nepals unter der Aufsicht von heiligen Kühen gepflückt wurden und deren Fruchtfleisch einen wahlweise über Nacht erschlanken oder zehn Jahre länger leben ließ – vorausgesetzt, man zahlte das Hundertfache des eigentlichen Ladenpreises für die Schrumpeldinger.
Allerdings möchte ich die Verschnaufpause, in der ich an eine Eiche angelehnt den Stamm ankeuchte, noch kurz dazu nutzen, um eins klarzustellen: Ich habe nie jemanden geschädigt, der es nicht verdient hätte. Ich meine, mal ehrlich: Was ist denn dagegen zu sagen, dem Vorstandsvorsitzenden eines börsennotierten Pharmaunternehmens ein Bild zu verkaufen, der kurz vor Weihnachten seine schwangere Frau für eine jüngere verlassen hat? Einen Miró im Übrigen, den mein Kumpel Stolli bei der Beaufsichtigung seines Sohnes auf dem Kinderspielplatz gezeichnet hat.
Sehen Sie!
Ich stolperte über eine Wurzel, rappelte mich auf und blieb mit meinem Sakko an etwas Dornigem hängen. Einmal um die Achse drehend, entledigte ich mich des ohnehin viel zu warmen Kleidungsstücks, dessen linker Ärmel sich hoffnungslos verfangen hatte, und dabei passierte es. Ich verlor die Orientierung. Schon nach wenigen Schritten stellte ich fest, dass ich in die falsche Richtung gelaufen war. Zumindest nicht in die, die ich mit dem Teufelsberg anvisiert hatte, in der Hoffnung, auf ein paar Ausflügler zu treffen, unter die ich mich hätte mischen können. Stattdessen war ich offenbar in einem Neunzig-Grad-Winkel abgebogen und lief nun parallel zur Einbahnstraße die Strecke zurück, die die Polizei genommen hatte. Auf einem sandigen Parkplatz fand ich mich wieder. Ungeschützt und von allen Seiten einsehbar. Vor allen Dingen von etwa einem guten Dutzend Gesichtern, die mich unverhohlen neugierig durch die Fensterscheiben eines Reisebusses anstarrten.
»Holiday-Charter« stand mit gelber Schrift auf schwarzem Lack auf dem Bauch des Busses. So wie es aussah, hatte die Reisegruppe sich gerade in Bewegung setzen wollen, aber irgendetwas hatte die Person hinter dem Steuer veranlasst, wieder auf die Bremse zu treten und zischend die Tür zu öffnen. Im Einstieg erschien ein Lockenkopf im Union-T-Shirt.
»Dann mal hastich«, rief die Busfahrerin mir zu.
Ich sah mich um. Noch sah ich meine Verfolger nicht, hörte aber das Knacken und Kracksen ihrer Stiefel. Es war also nicht anzunehmen, dass die Urberliner Fußballfanin eine verkappte Fluchthelferin war. Wieso forderte sie mich dann auf, zu ihr zu kommen?
»Husch, husch, oder haste nen WBS?«
»Einen was?«, fragte ich und kam näher.
»Einen Wohnberechtigungsschein. Den brauchen wa nämlich, wenn ick hier Wurzeln schlage.«
Sie drehte sich um, um sich wieder hinter das Lenkrad zu setzen, das, wie in derartigen Gefährten üblich, fast waagerecht angebracht war und den Radius eines Hulk-tauglichen Hula-Hoop-Reifens hatte.
Falls sie einen Restzweifel daran gelassen hatte, dass ich ihr in den Bus folgen sollte, zerstreute sie ihn mit einem wilden Hupkonzert.
Na wunderbar. Geht doch nichts über unauffälliges Verhalten auf der Flucht.
Wieder erwog ich meine Optionen, wieder stellte ich fest, dass ich keine andere Wahl hatte, wenn ich nicht in höchstens zwanzig Sekunden einer Einheit misstrauischer Polizisten gegenüberstehen wollte, die sich fragten, wer um Himmels willen mit einem Nebelhorn Morsezeichen in den Berliner Vorabendäther pumpte.
Also stieg ich ein.
Dass damit ein Albtraum begann, wäre im Nachhinein betrachtet die Untertreibung des Jahres. In etwa so, als würde man sagen, die Corona-Pandemie hätte weltweit für ein paar Scherereien gesorgt.
Kapitel 4
Die Anzahl der Augenpaare, die mich beim Einstieg musterten, hatte sich verdoppelt. Nun starrte mich auch die andere Fensterseite der Reisegruppe des annähernd voll besetzten Busses an. Niemand sagte etwas.
Mit einer Ausnahme.
»Herr Schmolke, nehme ich an?«, hörte ich eine Endfünfzigerin mit Singsangstimme und mitleidigem Gesichtsausdruck fragen. Sie trug einen im Nacken ausrasierten Kurzhaarschnitt. Am Hals baumelte eine beeindruckend große Lesebrille an einer Bernsteinperlenkette über einer Rüschenbluse.
Wäre die Frau ein Modeartikel gewesen, dann ein Gesundheitsschuh, wie er im Teleshopping mit den Bemerkungen »flott und bequem« angepriesen wurde, und zwar erhältlich in den Farben Beige und Taupe.
Sie war aus der ersten Reihe hinter der Busfahrerin aufgestanden. Neben ihr saß ein hochgewachsener Mann mit Herrendutt und Viertagebart, der ihn nicht viel älter als einen Studienanfänger der Geisteswissenschaften aussehen ließ.
»Herr Schmolke?«, wiederholte sie, jetzt mit der gewaltigen Brille auf der Nase. Ich gab mein Zögern auf und nickte der Dame zu, in der ich die Reiseleiterin auszumachen glaubte. Immerhin hatte sie ein Klemmbrett aus der Netztasche vor ihrem Sitz gezogen und schien eine Namensliste abzuhaken.
»Und das ist …?«, fragte sie lächelnd.
Nervös folgte ich ihrem Blick, den Kopf schon leicht eingezogen, um den krachenden Aufschlag der flachen Hand auf der Schulter etwas abzufedern, und sah – nein, nicht den Ordnungshütern ins Gesicht. Sondern Wilma.
Wie zum Teufel …
Ihre Hektikflecken standen meinen unter Garantie in nichts nach.
Mehrere Gedanken schossen mir durch den Kopf, einer beunruhigender als der andere:
Hat sie sich absichtlich zurückfallen lassen?
Verfolgt sie mich?
Und wenn ja, war vielleicht sogar doch ich das Angriffsobjekt und nicht der SUV? War ihre Zerstörungswut nur eine Demonstration dessen gewesen, was sie eigentlich mir antun wollte?
Aber warum? Was habe ich ihr getan?
»Sie ist …«, setzte ich an, kurz versucht, die Wahrheit zu sagen, … eine aggressive Psycho, die entweder vor der Polizei davon- oder mir hinterherrennt.
»Ich bin Frau Schmolke«, nutzte sie mein Zögern, mit der Betonung auf »Frau«. Dabei griff sie nach meiner Hand und schenkte mir eine gequälte Grimasse, die wohl ein verliebtes Ehefrau-Lächeln imitieren sollte. Mir wuchs ein Kloß im Hals. In etwa so musste sich die entführte Senatorentochter in »Das Schweigen der Lämmer« gefühlt haben, als Buffalo Bill einen Korb zu ihr in den Brunnen hinabließ und dabei »Es reibt sich die Haut mit der Lotion ein« säuselte.
»Na, dann sind wir ja endlich vollzählig«, sagte der Männerdutt leicht genervt.
Wenn er derselben Meinung war wie ich, nämlich dass Wilma und ich optisch ein schräges Paar abgaben, ließ er es sich nicht anmerken. Während sie sich mit ihrem Sportoutfit einmal durch den Musterfarbfächer eines Malereibetriebs gearbeitet hatte, waren meine Klamotten so farbenfroh wie die eines Schornsteinfegers. Schwarze Hose, schwarzes Hemd und – Überraschung – schwarze Schuhe. Damit fiel meine Kleidung weit mehr aus dem Rahmen als eine brombeerfarbene Yogahose. Zumindest in Berlin, wo man sich einen Smoking nur dann kauft, wenn man auf einen Fetischball gehen will. Aber heute war ein besonderer Tag für mich. Der sechzehnte Geburtstag meiner Tochter Lara. Für sie hatte ich mich fein gemacht. Und um zu ihr zu gelangen, hätte ich den SUV dringend gebraucht.
»Die Schmolkes – das hätte ich ja nicht für möglich gehalten«, hörte ich jemanden raunen. Bevor ich ausmachen konnte, wer das gesagt hatte, sah ich durch die geschlossene Türscheibe, wie sich einer der beiden Polizisten (der jüngere, schlaksige) seinen Weg zwischen zwei Tannen zum Parkplatz bahnte.
Sein Anblick ließ mich spontan zu Boden sinken, wo ich so tat, als müsste ich mir die Schuhe binden.
Wilma stolperte mit tief gesenktem Kopf über mich hinweg in den anfahrenden Bus hinein.
Zeitgleich schepperte die Stimme der Lockenkopf-Busfahrerin durch die Bordlautsprecher: »So, Jungs und Mädels, dann jeht’s jetzt endlich los, nachdem sich nun auch die Schmolkes die Ehre gegeben haben. Aber macht euch keinen Kopp wegen der Verspätung. Der frühe Vogel fängt den Wurm, aber erst die zweite Maus kriegt den Käse. Bis Danzig, auf Wiederhörnchen, eure Hilde.«
Diese Durchsage im Ohr, die sich fast so bekloppt anhörte, wie meine gebückte Körperhaltung aussehen mochte, kroch ich tiefer in den Bus hinein, um mich auf den ersten freien Platz zu verdrücken, der sich mir bot.
Der neben Wilma.
Kapitel 5
Erst nach geraumer Zeit wagte ich, aus dem Fenster zu schauen. Weder sah ich einen Polizisten mit dem Bus um die Wette rennen noch uns verfolgende Blaulichter.
»Also gut«, hörte ich Wilma sagen. Sie hatte die Füße auf ihren Rucksack am Boden gestellt und sich mir zugewandt. Definiert es mich als oberflächlich, dass mir in diesem Moment auffiel, wie gut sie duftete? Nach all den Anstrengungen hätte ich erwartet, dass sie in etwa so roch, wie ich mich fühlte. Durchgeschwitzt. Aber sie duftete wie frisch geduscht nach Minze und Zitronengras.
»Wer zum Teufel sind Sie?«, fragte sie mich leise, aber nachdrücklich.
»Wer zum Henker sind Sie?«,parierte ich mit einer, wie ich fand, durchaus berechtigten, wenn auch nicht sonderlich originellen Gegenfrage.
»Ich glaube nicht, dass Sie das etwas angeht.«
»Aber Sie?«
»Ja, das tut es, denn …«
Sie kam nicht dazu, mir zu erläutern, weshalb sie ihrer Meinung nach in der Hierarchie der Auskunftsberechtigten weit über mir rangierte (wobei, wenn man den Begriff »Hackordnung« wörtlich nahm, hatte sie das bereits mit dem Baseballschläger am SUV klar zum Ausdruck gebracht), denn ihr fiel ein fleischiger Finger von einer Sitzreihe weiter hinten auf die Schulter.
Um Sie zu beruhigen, der Finger hing an einer Hand, diese an einem Arm, und der gehörte zu einem offenherzig lächelnden Mann mit Mönchsglatze.
»Christin? Lutz?« Der Wilma penetrant antippende Mitreisende war entweder ein Sitzriese oder von nicht besonders großem Körperwuchs. Ich tippte auf Letzteres und vermutete, dass er von seinem Platz aufgestanden war, um uns über die Lehne hinweg anzugrinsen. Das Doppelkinn hing nur Millimeter über der Kopfstütze. Der Mann erinnerte mich an meinen Bankberater Rüdiger. Auch Rüdi lugte nur mit größter Mühe und auf Zehenspitzen mit seinem gutmütigen Rundschädel über das Pult, das er an den Wochenenden als DJ Dispo in den Brandenburger Dorfdiscos aufbaute.
»Das ist ja echt eine Überraschung. Ihr traut euch was! Sehr schön!«
Aha, jetzt hatten wir neben einem Nach- auch neue Vornamen. Christin und Lutz Schmolke.
Es gab sicher schlimmere Kombinationen, dennoch wäre ich gerne Sascha Nebel geblieben.
»Ulf!«, zischte die Frau auf seinem Nachbarsitz, und der über unser Erscheinen offenbar äußerst belustigte Passagier verschwand aus unserem Blickfeld.
»Zieh doch nicht immer so an meiner Hose, Martha!«, maulte er eine Person an, die nur seine Frau oder seine Mutter sein konnte. So ungeniert, wie sie den bestimmt Vierzigjährigen in der Öffentlichkeit maßregelte, war eine eheliche Verbindung wahrscheinlicher.
»Dann hör auf, dich wie ein Idiot zu benehmen.«
»Idiot? Ich hab grad zwanzig Euro gewonnen. Elias und Jamal haben dagegen gewettet, aber ich hab gesagt, die beiden kommen. Na, wer ist jetzt der Idiot?«
»Du, wenn du dich darüber freust.«
»Natürlich freue ich mich. Hast du gesehen? Arne Brehmer ist auch da. Letzte Reihe. Ich kann es gar nicht erwarten, dass die aufeinandertreffen.«
Um was genau zu erleben?
Verdammt, wo war ich hier nur reingeraten? Was zum Geier war das für eine krude Reisegruppe, in der sich die Mitreisenden anscheinend mit Namen kannten, nicht aber von Angesicht zu Angesicht? Sonst wäre es ja Martha und Ulf aufgefallen, dass wir nicht Lutz und Christin Schmolke sein konnten. Mochten ihnen die Gesichter nichts sagen, so wussten sie offenbar doch brisante Details aus dem Leben jenes Paares, in dessen Identität wir zwangsweise geschlüpft waren. Zum Beispiel, dass die Schmolkes offenbar irgendeine Art Zwist mit einem Mann namens Arne hatten.
Ich drehte mich mit der Grazie eines Walrosses unauffällig nach hinten um und entdeckte auf der allerletzten, durchlaufenden Sitzbank im Heck des Busses mittig einen hageren, bestimmt zwei Meter großen Mann in kurzen Khakihosen und Flipflops, der mich wie ein Scharfschütze fixierte.
Mir kam ein Gedanke.
War das hier vielleicht ein Betriebsausflug? Hatte Lutz seinem Kollegen die Beförderung weggeschnappt?
Hm.
Das war eine gedankliche Sackgasse. Wären das hier im Bus alles Kolleginnen und Kollegen, hätten die ja wissen müssen, wie die Schmolkes aussahen. Es sei denn, die wären die letzten Jahre nur im Homeoffice gewesen und hätten sich bei den Zoom-Meetings konsequent geweigert, die Kamera anzuschalten.
Alles irgendwie unwahrscheinlich.
Kurz hatte ich die bange Befürchtung, in eine anonyme Dating-Gruppe geraten zu sein. Eine Horde Tinder-Süchtiger, die sich zum ersten Mal im Real Life sah und nun gepflegt zum nächsten Swingerclub düste. Hatten Elias und Jamal dagegen gewettet, dass wir es wagen würden, uns von Arne Brehmer am Andreaskreuz auspeitschen zu lassen?
»Ihr traut euch was.«
Zum Glück blieb mir keine Zeit, mir diese schreckliche Theorie weiter auszumalen, denn Wilma-Christin zerrte energisch an meinem Hemdsärmel.
»Hey!«
»Was hey?«
»Antworten Sie mir endlich.«
»Was denn?«
»Wer sind Sie?«
Ich deutete mit dem Daumen nach hinten. »Haben Sie doch eben gehört. Lutz Schmolke.«
Sie rollte mit den Augen. »Okay, dann spiele ich das Spiel mal mit, Lutz. Wieso nicht? Zwei Fremde auf der Flucht vor der Polizei, die so tun, als wären sie ein Ehepaar. Im Grunde ganz lustig.« Sie seufzte. »Endlich mal was Aufregendes in meinem Leben.«
Endlich?
Ich versuchte, aus ihrer Miene Zeichen von Demenz oder Gedächtnisverlust herauszulesen. Hatte sie das »Hau den Lukas«-Intermezzo in der Einbahnstraße etwa schon vergessen? Oder zählte eine gepflegte Vorabendrandale zu ihrer herkömmlichen, ergo langweiligen Alltagsroutine? Wenn es nicht ausreichte, dass sie wie Thor den Hammer schwang, wollte ich lieber nicht wissen, was sie sonst so brauchte, um endlich mal wieder einen Adrenalinkick zu verspüren.
»Hören Sie, ich weiß nicht, was Sie für den heutigen Abend so geplant haben, aber ich für meinen Teil hab auf diese Irrfahrt ins Was-weiß-ich-wohin mit Ihnen so gar keinen Bock.«
»Dann hätten Sie nicht in diesen Bus steigen sollen, Lutz.«
»Ich hatte keine Alternative, Christin.«
»Wieso?«
»Weil ich …«
Ich zögerte, da ich keine Lust hatte, einer wildfremden, gewaltbereiten Aktivistin anzuvertrauen, dass ich gerade einen Wagen hatte klauen wollen, andererseits eine plausible Erklärung dafür brauchte, weshalb ich ihr hinterhergelaufen war, anstatt einfach auszusteigen und der Polizei wild gestikulierend zuzurufen: »Hinterher! Da läuft Greta Thor-Berg!«
Ich erinnerte mich an eine der wenigen Weisheiten meines Vaters, dass die beste Lüge im Kern immer auf der Wahrheit fußt, und sagte: »Ich hab Ärger mit der Polizei.«
»Und?«
»Und hätten Sie sich nicht ausgerechnet meinen Wagen ausgesucht, um an ihm ein subtiles Zeichen für mehr Klimaschutz zu setzen, dann wäre ich schon längst im wohlverdienten Feierabend und müsste hier nicht mit Ihnen ins Unbekannte zuckeln.«
»Verstehe«, sagte sie belustigt und zupfte an ihrem »Save our Planet«-Shirt. Ihr Lächeln, ich kann es nicht anders sagen, war äußerst charmant und entblößte etwas, was meine Omi Lenor als »Kuchenzahn« bezeichnet hätte. Ein leicht schräg stehender Eckzahn, der aufblitzte, als sie keck mit der Zunge dranstieß. (Keck, Sie ahnen es, auch ein Wort Lenors.)
»Ach, das freut Sie, ja?«
Sie nickte. Ganz eindeutig hatte sie einen schrägen Sinn für Humor, aber was hatte ich auch anderes erwartet.
»Es freut mich schon mal deshalb, weil Sie mich nicht anzeigen können, Lutz.«
Kapitel 6
Stimmt. Hatte ich gar nicht dran gedacht. Wäre es tatsächlich mein Auto gewesen, hätte ich ihr längst an die Gurgel gehen müssen. In Kreuzberg wurden Menschen schon erschossen, wenn sie sich nur ans falsche Auto lehnten. Jeder zünftige Geländeprotzwagenbesitzer hätte Wilma-Christin mit einem Schraubenzieher die Augen ausgestochen. Und dann die Polizei gerufen.
Ich hatte nichts dergleichen getan. Ließ mich sogar von ihr verhören, wie ein … nun ja, ein Autodieb.
»Sie wollen nichts mit der Polizei zu tun haben. Ich auch nicht. Wir sitzen wohl im selben Boot.«
»Bus«, korrigierte ich sie. »Und aus dem steige ich bei der nächstbesten Gelegenheit aus.«
»Tja, aber wer weiß, wann die kommt.«
Der Gedanke, der sie verträumt aus dem Fenster sehen ließ, erschreckte mich. Ich sah mich um. Verdammt. Der Bus hatte eine Toilette. Und soweit ich es erkennen konnte, fuhr hier kein einziger Rentner mit. Es war also nicht zu erwarten, dass es zu einem Granufink-Patienten-Auflauf vor dem Bord-WC kommen würde, der Locken-Hilde am Steuer zur baldigen Einkehr an der nächsten Raststätte zwang. Was fasste so ein Reisebustank? Reichte das aus, um damit bis nach München durchzubrettern? Oder hatte sie mit »Bis Danzig« eben gar kein blödes Wortspiel gemacht, sondern tatsächlich das Ziel verraten?
Ich sah wieder aus dem Fenster.
Im Moment fuhren wir die AVUS Richtung Wannsee, es ging also eher gen Westen. Ich beschloss, spätestens bei Potsdam nach vorne zu gehen und notfalls einen Anfall spontaner Reiseübelkeit zu simulieren, sollte Hilde nicht freiwillig auf mein Bitten anhalten wollen.
»Hey, das musst du dir anhören!«, riss mich der Gangnachbar links von mir aus den Gedanken. Er sprach in einem arroganten Singsang, so hoch und vor allem so laut, dass ich zunächst dachte, ich wäre gemeint, dabei unterhielt er sich mit seinem Sitznachbarn. Modeopfer wäre vermutlich eine freundliche Bezeichnung für seine Erscheinung. Er trug ein Netzhemd-T-Shirt zu einer eng anliegenden, absichtlich zerrissenen Designerjogginghose, die kurz über den Knöcheln endete. Ein Umstand, der seine mit Goldnieten besetzten Loafer aufs Geschmackloseste zur Geltung brachte. Sein blondes Haar war mit einer halben Tonne Gel zu einer Sascha-Hehn-Gedächtniswelle toupiert. Und damit jedermann auch sah, wie hip und jung geblieben er doch war, stapelten sich an seinem Handgelenk neben der obligatorischen Rolex mehr Festivalarmbänder als Jahresringe an einer Dreißig-Meter-Eiche.