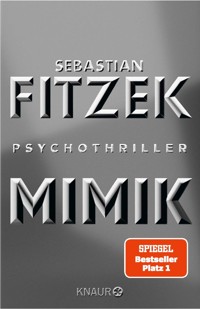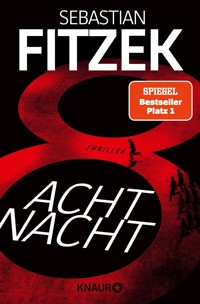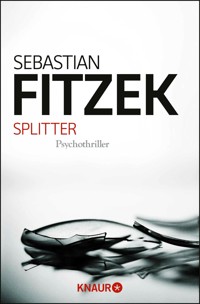9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Sebastian Fitzek ist zurück! Der #1-Bestseller-Autor Sebastian Fitzek schickt uns in seinem neuen Psychothriller auf einen alptraumhaften Trip in die winterlichen Alpen. In Vorfreude auf ein verlängertes Wochenende in den Alpen folgt Marla Lindberg der Einladung zu einem Klassentreffen. Doch schon kurz nach der Ankunft wird ihr klar: Es gibt nur eins, was tödlicher ist, als das abgeschiedene Berghotel nachts im eisigen Schneetreiben wieder zu verlassen. Es nicht zu tun … Die Einladung: Wehe dem, der sie erhält... Marla Lindbergs Erinnerungen sind glasklar: An die seltsame Nachricht, die sie in eine stillgelegte Geburtsklinik lockte. An die Gestalt, die versuchte, sie zu töten. Das seltsam pfeifende Husten des Psychopathen beim Kampf auf Leben und Tod. Nach Jahren der Psychotherapie hat die hochintelligente junge Frau gelernt: Das alles sind falsche Erinnerungen. Marla leidet unter Gesichtsblindheit. Ihr Gehirn spielt ihr in Extremsituationen Streiche, wenn es vergeblich versucht, Menschen an ihrem Gesicht zu erkennen. Als Marla die Einladung zum Klassentreffen in den Alpen bekommt, hofft sie darauf, mit ihren ehemaligen Mitschülern in schönen und echten Erinnerungen schwelgen zu können. Bei ihrer Ankunft in dem verschneiten Berghotel sind alle Zimmer bereits bezogen. Benutztes Geschirr steht auf dem Esstisch, der Kamin flackert, doch es ist niemand da. Marla beginnt die anderen zu suchen. Und dann hört sie es wieder. Wie jemand pfeifend hustet, draußen, in der eisigen Dunkelheit … Spannung Pur – Thriller trifft auf Horror Mit einem Setting voller subtiler Horror-Elemente sorgt Sebastian Fitzek für Gänsehaut-Garantie. Auch der neue Psychothriller von Deutschlands erfolgreichstem Thriller-Autor weiß mit mehr als einer unvorhersehbaren Wendung zu überraschen. Dem Genre des Psychothrillers entsprechend behandelt dieser Roman sensible Themen wie Suizid.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 425
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Sebastian Fitzek
Die Einladung
Psychothriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Jahre der Psychotherapie hat Marla gebraucht, um ihre Vergangenheit zu verarbeiten. Die seltsame Nachricht, die sie in eine stillgelegte Geburtsklinik lockte. Die Gestalt, die versuchte, sie zu töten. Das seltsam pfeifende Husten des Psychopathen beim Kampf auf Leben und Tod. Sie hat gelernt: Das alles sind falsche Erinnerungen. Marla leidet unter Gesichtsblindheit. Ihr Gehirn spielt ihr in Extremsituationen Streiche, wenn es vergeblich versucht, Menschen an ihrem Gesicht zu erkennen.
Als Marla eine Einladung zu einem Klassentreffen in den Alpen bekommt, hofft sie darauf, ein verlängertes Wochenende lang mit ihren ehemaligen Mitschülern in schönen und echten Erinnerungen schwelgen zu können. Bei ihrer Ankunft in dem verschneiten Berghotel sind alle Zimmer bereits bezogen. Benutztes Geschirr steht auf dem Esstisch, der Kamin flackert, doch es ist niemand da. Marla beginnt die anderen zu suchen. Und dann hört sie es wieder. Wie jemand pfeifend hustet, draußen, in der eisigen Dunkelheit …
Inhaltsübersicht
Motto 1
Motto 2
Widmung
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
79. Kapitel
80. Kapitel
81. Kapitel
82. Kapitel
83. Kapitel
84. Kapitel
Nachwort & Danksagung
Das Quiz für dein nächstes Fitzek-Abenteuer
Leseprobe »Der Nachbar «
Berge ruhn, von Sternen überprächtigt –
aber auch in ihnen flimmert Zeit.
Ach, in meinem wilden Herzen nächtigt
obdachlos die Unvergänglichkeit.
Rainer Maria Rilke
Schlimmer als die Einsamkeit ist die Gesellschaft von Menschen, die dir das Gefühl geben, alleine zu sein.
Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein.
Johannes 8,7
Für Christian
Prolog
Wusstest du, dass es nur eine kurze Zeit auf Erden gab, in der es nicht tödlich war, sich zu vermehren?«, fragte der grauhaarige Mann und goss ihr einen Cognac ein, obwohl sie abgelehnt hatte.
Mit seinem Frack, dem weißen, knopflosen Hemd und den albernen Klavierlackschuhen erinnerte er an einen Pinguin. Sie versank in dem viel zu großen Bademantel, den er ihr nach dem Duschen rausgelegt hatte.
»Geschlechtskrankheiten wie Syphilis oder Tripper, dann die Gefahren der Geburt«, erklärte er ihr und leckte sich über die Oberlippe. »Ungeschützter Sex wurde und wird sehr häufig mit dem Tod bezahlt.«
Im Kamin knackte ein Holzscheit, und das Geräusch erinnerte sie an den Silvestermorgen. An dem die Welt noch in Ordnung, Mama noch nicht mit einem anderen Kerl durchgebrannt und ihr Vater nicht schon vor 18 Uhr betrunken gewesen war. Weswegen sie mit ihm gemeinsam Knallerbsen im Hof neben Eddys Autogarage werfen durfte.
Es war das letzte Mal, dass sie ihn gesehen hatte.
Ob Papa noch lebt? Hoffentlich nicht.
»Es gab nur eine Phase, in der wir es hemmungslos treiben konnten, ohne mit dem Schlimmsten rechnen zu müssen. Weißt du, welche ich meine?«
Sie nippte an dem bernsteinfarbenen Drink, spürte die angenehme, lang vermisste Wärme nun auch von innen und verfluchte sich. Sie hatte es geahnt. Bereits in dem Moment, als der alte Knacker das Seitenfenster heruntergelassen und sie zu sich ans Auto gewinkt hatte. Mit dem Typen stimmt was nicht. Er hatte falsche Augen in einem falschen Gesicht. Geliftet, gebotoxt oder was auch immer. Eine emotionslose, echsenhafte Maske.
Aber vermutlich wäre sie auch zu ihm eingestiegen, wenn er aus den Augen geblutet hätte. Alles war besser als eine weitere Nacht bei minus sieben Grad unter dem S-Bahn-Bogen am Stuttgarter Platz. Und auf den ersten Blick schien sie ja auch den Jackpot geholt zu haben: Mercedes S-Klasse, Doppelgarage vor der Villa, mindestens sechshundert Quadratmeter fußbodenbeheizter Luxus und ein Bademantel, der wärmer hielt als der Winterparka, den sie von der Stadtmission geschenkt bekommen hatte. Sein betrunkenes Gelaber hingegen war unerträglich und wohl ein Hinweis darauf, was er heute noch für Gegenleistungen von ihr erwartete.
»Es war die Phase, in der sowohl die Antibiotika als auch die Pille erfunden waren. Doch die währte nur kurz, bis Aids kam. Fünfzehn Jahre bloß, vom Ende der Sechziger bis zum Anfang der Achtziger. Ein Wimpernschlag in der Geschichte der Menschheit.«
Der Pinguin lachte und öffnete eine Holztruhe, die vor einem doppelflügeligen Fenster stand. Zum Hintergarten hin war es mit geschwungenen weißen Gitterstäben gesichert, wie alle Fenster im Erdgeschoss der Villa.
»Ist das nicht paradox? Der Akt, der Leben hervorbringt, war und ist stets mit der Gefahr des Todes verbunden.« Er entnahm der Truhe eine Segeltuchtasche. »Das ist für dich.«
Sie spähte in die Tasche, die der Pinguin aufs Sofa gelegt hatte, als wäre es eine Mülltüte.
»Komm, pack es aus.« Er nahm ihr den Cognacschwenker aus der Hand.
Nach und nach zog sie die Anziehsachen aus der Tasche hervor: einen blassgrauen Rock, schlichte Mädchenunterwäsche, eine weiße Bluse mit Trompetenärmeln.
»Zieh es an!«
Er machte eine auffordernde Handbewegung, und sie gehorchte. Der Pinguin hatte ihr dreihundert Euro versprochen, hundert davon steckten schon unter den Einlegesohlen ihrer Stiefel.
Sie ließ den Bademantel zu Boden gleiten und schlüpfte zunächst in die Unterwäsche.
»Dreh dich mal!«, forderte er sie auf, als sie alles angezogen hatte. Die Kleider passten wie angegossen. Sie sahen unbenutzt aus, rochen aber frisch gewaschen.
»Perfekt«, urteilte der Pinguin. Er schob sie aus dem Wohnzimmer (das er Salon genannt hatte) zu einer geschwungenen Marmortreppe, die in den ersten Stock führte. Barfuß nahm sie Stufe um Stufe. Sie ging hinauf, hatte aber das eigenartige Gefühl, in einen eisigen Keller hinabzusteigen.
»Hier entlang!«
Sie folgte ihm in ein Badezimmer, das größer war als die Wohnung in der Neuköllner High-Deck-Siedlung, aus der ihr pegelsaufender Vater zuerst ihre Mutter und dann sie selbst vergrault hatte.
»Sieh doch nur, wie hübsch du bist«, jauchzte der Pinguin und stellte sein Cognacglas auf den Rand eines Whirlpools. Sie sah kurz in den goldgerahmten Spiegel über dem Doppelwaschbecken, senkte aber sofort wieder den Blick. An der Szenerie hier gab es nichts Natürliches. Ein bestimmt fünfundfünfzigjähriger betrunkener Mann im Frack neben einem vierzehnjährigen vor Furcht und Kälte zitternden Mädchen.
»Unglaublich. Darf ich dir die Haare schneiden?«
Sie zuckte mit den Achseln. Verglichen mit dem, was sie sich an Forderungen ausgemalt hatte, war diese Bitte noch harmlos.
»Haare kosten extra.«
»Kein Problem«, sagte er, und sie glaubte es ihm. Allein die Uhr an seinem Handgelenk stank nach Reichtum. Vermutlich würde er ihr für jedes Haar einen Tausender zahlen können und es auf seinem Konto nicht einmal bemerken.
»Warte, vielleicht reicht es auch, wenn du sie hochsteckst«, sagte er und näherte sich ihr mit konzentrierter Miene. Sie schloss die Augen und spürte, wie der Freak mehrere Klammern setzte, dann zurücktrat und lachend in die Hände klatschte. »So, jetzt noch etwas Lipgloss und Puder. Du bist zu blass.«
Sie fühlte, wie er ihr etwas auf die Lippen strich, dann einen Pinsel im Gesicht. Es roch angenehm und fühlte sich dennoch falsch an.
»Das ist so erstaunlich«, hörte sie ihn, und jetzt klang er traurig. »Wenn du nur wüsstest, was ich in dir sehe.«
Er atmete schnell. Gierig sog er die Luft durch seine spitzen Lippen ein. Sie roch den Cognac, aber auch noch etwas anderes, Bitteres in seinem Atem.
»Komm!«
Er nahm sie an die Hand, führte sie aus dem Badezimmer hinaus in den Flur, zwei Zimmer weiter. »Du siehst genauso aus wie sie.«
»Wie wer?«, traute sie sich zu fragen.
»Und sogar die Stimme ist ähnlich.«
»Von wem reden Sie?«
Vor einer angelehnten Zimmertür blieben sie stehen.
»Schhh.« Der Mann legte ihr den Zeigefinger auf die Lippen. »Du stellst zu viele Fragen. Sie ist eher schweigsam.«
Dann stieß er sie in das Zimmer hinein. Ein pastellfarbener Mädchentraum in Violett und Weiß. Schränke, ein kleines Sofa, die vielen Kissen auf der Tagesdecke – alles harmonisch Ton in Ton. Selbst die Torte vor dem kleinen Schminktisch hatte eine violette Füllung. Auf ihr brannte mindestens ein Dutzend Kerzen. Passend dazu hing eine Girlande über dem Bett. Happy Birthday stand darauf mit pinkfarbenen Lettern auf silberner Folie, in der sie sich selbst spiegelte und nicht wiedererkannte.
»Herzlichen Glückwunsch, mein Schatz«, sagte der Mann hinter ihr.
Sie drehte sich zu ihm um. »Was soll das hier?«
Er nickte ihr zu. Mit Tränen in den Augen. »Alles Gute zum Vierzehnten«, sagte er. Dann schloss er die Tür hinter sich. Drehte den Schlüssel zweimal um und zog ihn ab.
Hilfe!
Ihre Kehle schnürte sich zusammen, als hätte der Pinguin ihr eine unsichtbare Schlinge um den Hals gelegt.
Schwer atmend trat er näher, leckte sich wieder über die Lippe.
»Bitte, darf ich gehen?«, fragte sie. Ihre Stimme flatterte vor Angst.
Zu spät.
Der Alte kniff die Augen zusammen, als würde er geblendet.
»So perfekt war es noch nie, Marla«, befand er.
»Wer ist Marla?«
Beim Aufblitzen der Klinge fragte sie sich, wie das Messer so schnell in die Hand des Pinguins gekommen war.
»Wusstest du, dass Rot die einzige Farbe ist, die sowohl das Leben und die Liebe als auch den Tod symbolisiert?«, fragte er.
Dann stach er zu. Einmal. Zweimal. Das Eindringen der Klinge hörte sich an, als würde er eine geschälte Orange mit bloßen Händen zerquetschen. In ihrem Inneren schien etwas zu zerbrechen. Wie wenn ein schweres Glas auf einem harten Boden zerschellte. Sie spürte es mehr, als dass sie es hörte. Dabei schrie sie so laut wie niemals zuvor. Es war, als ob er sie mit einer Wasserpistole bespritzte. Sie blinzelte, drehte den Kopf zur Seite, wischte sich instinktiv über die Augen und sah alles durch einen roten Schleier. Gleich darauf wurde ihr schlecht.
Weil sie das Blut schmeckte, das ihr über die Brauen von der Stirn in den Mund lief, während sie gurgelnd aufschrie.
»Bitte nicht, nein!«, presste sie hervor, doch es war schon zu spät. Der Pinguin hatte die Halsschlagader durchtrennt. Sie hörte ihn nur noch röcheln: »Es tut mir leid, ich kann nicht anders, Marla.« Dann hörte sie nichts mehr. Denn es war vorbei.
Der alte Mann, der sich das Messer zuerst selbst in beide Augen und schließlich in den Hals gerammt hatte, war längst tot.
1. Kapitel
Statistisch gesehen sterben die meisten Menschen, die einem natürlichen Tod erliegen, zwischen zwei und fünf Uhr morgens. Über den durchschnittlichen Todeszeitpunkt infolge eines Mordes gibt es keine Erhebung.
Zumindest war sie Marla Lindberg nicht bekannt, dabei hätte ihr Tagebuch Statistikern einige Anhaltspunkte geben können. Ihre Seele zum Beispiel war an einem 23. April um halb neun Uhr morgens im Wohnzimmer ihres Dahlemer Elternhauses getötet worden. Endgültig sollte sie vier Jahre später an einem extrem heißen Frühsommerabend in einer ehemaligen Geburtsklinik in Berlin-Wannsee ums Leben kommen.
Um exakt 19:51 Uhr. In wenigen Minuten.
Marla stieg aus dem klapprigen Kleinstwagen, den ihr der Kurierdienst zur Verfügung gestellt hatte. Sie arbeitete aushilfsweise für Carry&Co, seitdem die mündlichen Abiprüfungen durch waren. Heute hätte sie lieber freimachen sollen. Die Hitze schlug ihr wie aus einem geöffneten Backofen entgegen. Sie wischte sich den Schweiß von der Stirn und sah noch einmal auf ihr Handy.
Hier?
Laut Google Maps stand sie vor dem richtigen Gebäude, auch wenn es sich nicht so anfühlte. Schon die Zufahrt auf das Gelände war merkwürdig gewesen. »Klinik Schilfhorn« hatte auf dem Klinker-Rundbogen gestanden, unter dem sie hindurchgefahren war, an einem leeren Pförtnerhäuschen vorbei. Aber ein Krankenhaus konnte hier unmöglich noch betrieben werden, so unkrautüberwuchert und aufgeplatzt, wie allein der Asphalt war, von den baufälligen Baracken am Wegesrand mal ganz abgesehen. Und doch war Marla nicht sofort wieder umgedreht, sondern weiter ihrem Navi gefolgt. Denn hin und wieder waren renovierte Blockhäuser aufgetaucht mit Schildern von Start-up-Firmen, die auf diesem morbiden Campusgelände offenbar die nötige kreative Umgebung für ihre Geschäftsmodelle zu finden glaubten.
Und so stand sie nun vor einem klobigen, sechsstöckigen Flachdachbau mit eingeschlagenen Scheiben. Die helleren Fassadenplatten waren mit unleserlichen Graffiti-Symbolen besprüht.
Marla ging um das Auto herum und öffnete den Kofferraum.
Normalerweise lieferte sie Lebensmitteleinkäufe oder Restaurantbestellungen aus. Dass sie heute als Postbotin fungieren sollte, war neu für sie. Der Auftrag war als Direktnachricht per WhatsApp von ihrem Schichtleiter Steve reingekommen, als sie schon das Auto abstellen und Feierabend hatte machen wollen.
Ganz vergessen: Letzte Lieferung für heute. Zum Schilfhorn 18–24, Gebäude Nr. 14, Raum 012. Paket habe ich schon in den Kofferraum gelegt. Wichtig: Exakt um 19:49 Uhr übergeben. Nicht davor, nicht danach.
Gruß, S.
Was für ein seltsamer Auftrag.
Ein solch enges Zeitfenster, auf die Minute genau, hatte es noch nie gegeben. Aber wenn Marla eines war, dann akkurat und pünktlich, und das wusste natürlich auch ihr Arbeitgeber.
Sie sah auf ihre Uhr.
19:34 Uhr. Der Sonnenuntergang ließ noch gut zwei Stunden auf sich warten, und sie fragte sich, wie trostlos das schuhkartonförmige Gebäude wohl im Dunkeln aussehen mochte. Selbst in der Sonne weckte es den unheimlichen Eindruck eines von allen Hoffnungen verlassenen Ortes.
So wie mein ehemaliges Elternhaus, dachte Marla, obwohl ihre Dahlemer Villa auf den ersten Blick nichts mit der Klinik hier gemein hatte. Unwissende, die damals einen Blick über die dichten, immergrünen Hecken zu dem säulenbewehrten Eingang der Villa Lindberg geworfen hatten, mochten bei dem Anblick der sorgfältig geharkten Kiesauffahrt und der warmen Lichter in den Flügelfenstern gedacht haben, was für ein Glück es sein musste, als Kind in solch einer Umgebung aufzuwachsen. Dass der Schein trog, war Nachbarn wie Passanten vor vier Jahren klar geworden, als in der Nacht zum 23. April, wenige Stunden vor ihrem vierzehnten Geburtstag, eine Armada an Einsatzfahrzeugen vor dem lindbergschen Anwesen in der Podbielskiallee mit wild flackernden Signallichtern parkte. Am nächsten Morgen, als Marla rechtzeitig zu ihrer geplanten Geburtstagsfeier von einer Chorfahrt aus dem Frankenwald zurückkehrte, war das Wohnzimmer noch immer voller Polizisten.
Die Beamtin war viel zu jung, als dass man sie mit einer solch traurigen Aufgabe hätte betrauen dürfen, hatte sie später in der Therapie zu Papier gebracht. Ihre Psychologin hatte ihr zu den Briefen geraten, die sie an sich selbst schreiben sollte, um das Geschehene besser zu verarbeiten.
Die Polizistin hatte die Tür geöffnet und Marla zu ihrer Mutter Thea geführt, die mit ausdruckslosen Augen auf dem Sofa saß und in den kalten Kamin starrte.
»Leven?«, hatte Marla voller Panik den Namen ihres geliebten älteren Bruders gerufen. Der Gedanke, dass ihm etwas zugestoßen war, lag nahe, immerhin befand er sich mit seinen neunzehn Jahren nun schon das zweite Mal in einer Entzugsklinik. Aber die Polizistin stellte klar: »Es tut mir leid, Liebes. Dein Vater ist nicht mehr am Leben.«
Einbruchsmord im Nobelviertel titelte ein Boulevardblatt am nächsten Tag, obwohl es den Tatbestand im Strafgesetzbuch gar nicht gab. Auch sonst war die Sensationsmeldung falsch. Denn weder war in die Villa Lindberg eingebrochen worden, noch hatte es einen Mord gegeben.
Die Obduktion ergab einwandfrei, dass Edgar Lindberg Suizid begangen hatte. Sein Abschiedsbrief, den man im Tresor fand, offenbarte das Ausmaß des unvorstellbar tiefen Abgrunds, in den er am Ende absichtlich hineingesprungen war.
Liebste Marla,
ich liebe Dich so sehr, mein Kind, dass es ungesund ist. Ich begehre Dich auf eine Art und Weise, wie ein Vater niemals seine Tochter begehren darf. Mir ist klar, dass ich ein krankes Subjekt bin mit abscheulichen, widerwärtigen Gedanken. Um mich nicht an Dir zu vergehen, habe ich anderen wehgetan. Stets habe ich nach Mädchen gesucht, die mich an Dich erinnern, die Dir ähnlich sind. Habe sie so gekleidet, wie Du gekleidet bist. Es ist nie etwas passiert, das schwöre ich, auch wenn der Schwur menschlichen Abschaums wohl wenig wert ist.
So, wie ich nie Hand an Dich anlegte, so habe ich mich nie an den anderen armen Mädchen vergangen, die ich überall suchte. Im Internet und auf der Straße. Keine war je so schön wie Du, keine kam an Dein wundervolles Antlitz auch nur annähernd heran. Meine Gedanken wurden immer morbider, immer tödlicher. Vielleicht hast Du es mitbekommen. Anfangs, wenn Du geschlafen hast, habe ich mich neben Dein Bett gesetzt. Später, als Du größer wurdest, habe ich mich daruntergelegt. Dir beim Atmen zugehört, während Du schliefst. Deine Finger berührt, wenn Dein Arm über das Bett baumelte und Deine Hand direkt neben meinem Kopf hängen blieb.
Ich war Dein Schatten, der Dich hinter der Hecke am Schulzaun auf dem Pausenhof beobachtete. Der auf dem U-Bahnsteig gegenüberstand, wenn Du vom Klavierunterricht kamst.
Manchmal hast Du Dich umgedreht, bist schneller gegangen, und ich wollte Dir zurufen, dass keine Gefahr besteht. Dass ich Dein Schutzengel und kein Verfolger bin.
Aber dann hast Du Mama von Deinem Schatten erzählt. Von dem dunklen Begleiter, den Du im Nacken spürst. Sie hat es als einen imaginären Freund abgetan, den viele Kinder haben. Aber wir beide wussten, dass das, was Dir Gänsehaut erzeugte, keine Einbildung war. Und Thea wusste es irgendwann auch. Sie entdeckte meine Schminksachen, die falschen Bärte und Augenbrauen, mit denen ich mich verkleidete, damit Du mich nicht sofort erkennst, wenn ich in der Fußgängerzone an Dir vorbeischlendere. Mama hat es nie angesprochen, aber sie ist aus dem gemeinsamen Schlafzimmer ausgezogen und hat Abstand von mir gehalten. Was es mir einerseits erleichterte, mehr Zeit damit zu verbringen, Dich zu beobachten. Andererseits wuchs meine Scham vor mir selbst ins Unermessliche.
Du bist jung, mein wundervoller Schatz. Irgendwann, wenn die Zeit reif ist, wird Mama Dir diesen Brief zu lesen geben. Dann habe ich euch hoffentlich schon eine Weile von der Last meiner Existenz befreit, indem ich wenigstens den Anstand besaß, Hand an mich und nicht an jemand anderes anzulegen. Vielleicht wirst Du es eines Tages schaffen, mich zu verstehen. Nicht, weshalb ich mich so nach Dir verzehre. Dafür gibt es kein Verständnis, kein Verzeihen. Aber wieso ich mich dafür selbst bestrafte, indem ich mich in dem Moment meiner größten Schwäche umgebracht habe.
Der Brief endete mit einer tieftraurigen letzten Liebesbekundung.
Gefolgt von einem PS.
Und das Postskriptum war das Schlimmste an Edgars letztem Schreiben.
2. Kapitel
Marla wedelte eine Mücke fort, die sich auf ihrem Gesicht niederlassen wollte. Sie bemerkte, dass sie – wieder einmal von ihren Tagträumen paralysiert – schon eine geraume Weile in den geöffneten Kofferraum gestarrt haben musste. Vier Jahre war es nun her, und noch immer verging kaum ein Tag, an dem sie nicht an ihren Vater dachte.
Und ihn spürte. Seinen Schatten. Seinen Atem.
PS: Ich bin fort. Aber ich werde immer bei Dir sein.
Wie recht du doch damit hast, Edgar.
Selbst in Gedanken nannte sie ihn nur noch beim Vornamen in dem Versuch, innerlich Abstand zu ihm zu gewinnen. Vergeblich. Er hatte es ja selbst geschrieben: Er würde immer bei ihr sein.
In Bezug auf den Abschiedsbrief hatte er sich allerdings geirrt.
Die Mutter hielt ihn nicht zurück, um ihre Tochter zu schonen. Nachdem die Spurensicherung ihn freigegeben hatte, zögerte Thea keine Sekunde, ihn Marla auszuhändigen. Zuvor hatte sie ihr etliche Zeitungsausschnitte auf den Küchentisch gelegt, deren Schlagzeilen alle einen ähnlichen Tenor hatten:
Sie sollten so aussehen wie sein kleines Mädchen!
Neue Erkenntnisse im spektakulären Selbstmordfall des Edgar L.: Der perverse Luxusmakler kostümierte Straßenmädchen, damit sie wie seine eigene Tochter aussahen, bevor er sich aus Scham selbst richtete.
»Und das ist alles deine Schuld, Marla!«
Worte, die ihre Mutter nie sagte, und doch fühlte Marla sie, als wären sie laut ausgesprochen worden.
Sie sah sie in Theas vorwurfsvollem Blick, erlebte sie in der Nichtachtung, mit der sie sie strafte. Spürte sie als Schmerz an dem Tag, an dem sie ihr sagte, sie könne nicht länger bei ihr im Elternhaus wohnen und müsse zu Oma Margot ziehen.
Die Tochter hatte beim Vater eine unnatürliche, unstillbare Begierde geweckt, und daran wurde Thea Lindberg jeden Tag aufs Neue erinnert, wenn sie in Marlas Gesicht sah.
So jedenfalls die Theorie von Dr. Jamal Bayaz, der Jugendpsychologin, zu der Marla zur Traumatherapie ging, kurz nachdem ihre Mutter sie zur Großmutter abgeschoben hatte. Dr. Bayaz hatte die Idee mit der Schreibtherapie, und ihr vertraute sie auch ihre Paranoia an.
»Manchmal habe ich das Gefühl, dass Edgar noch immer bei mir ist. Dass er mich permanent beobachtet. Ich sehe ihn nicht, aber ich spüre seinen Schatten. Wenn ich mit dem Fahrrad vom Einkaufen nach Hause fahre oder mit der U-Bahn zur Klavierstunde. Nachts habe ich noch immer Angst, die Hand aus dem Bett baumeln zu lassen, weil ich befürchte, er könnte mich zu sich hinabziehen.«
Ihre Psychologin hatte ihr Methoden gezeigt, um die Sinnestäuschungen loszuwerden – doch es hatte nicht geholfen. Und leider war Marla so dumm gewesen, diesen Eintrag auch ihrer besten Freundin vorzulesen. Cora Aichinger hatte das ihr anvertraute Geheimnis brühwarm in der Klasse weitererzählt.Kein Wunder, dass der Spitzname »Mad Marla« schnell die Runde in der Schule machte.
Alles nur deinetwegen, Edgar.
Marla wurde von ihren Mitschülern nicht offen gemobbt, aber gemieden. Als wäre das, was ihr passiert war, die Folge eines Unglücksvirus und sie hochgradig ansteckend. Die Isolation, ihr Außenseitertum in der zehnten Klasse, machte Marla depressiv, und wer weiß, vielleicht hätte sie es irgendwann ihrem Vater gleichgetan, wenn er nicht gewesen wäre.
Kilian.
Wie auf jeder Schule gab es auch auf dem Hohenstein-Gymnasium eine unauffällige Schüler-Mehrheit. Und daneben einige wenige bunte Paradiesvögel, die wie Popstars auf dem Schulhof aus der grauen Masse hervorstachen. Kilian war so ein Star. Im Unterschied zu Marla machte er sich absichtlich rar. Jeder wollte ihn auf seiner Party, aber er folgte nur selten einer Einladung. Sie hingegen wäre gerne gegangen, wurde aber nicht eingeladen. Selbst ihr Bruder Leven fand ihn cool, und der gab sich normalerweise nicht einmal mit Gleichaltrigen ab, es sei denn, sie verkauften ihm Dope oder bezahlten ihn für seine Auftritte als DJ. Im Grunde war es Leven gewesen, der Marla auf den »einzigen vernünftigen Typen in deinem Jahrgang« hinwies, nachdem er Kilian in einem Neuköllner Vinyl-Laden getroffen hatte. Verband die beiden Männer ihr gemeinsamer Musikgeschmack, so war es bei Marla und Kilian ein Streit, der sie einander näherbrachte. Es geschah in der Philosophie-AG. Jeder Teilnehmer sollte ein Motto vortragen, nach dem er oder sie das Leben ausrichtete. Kilian hatte die Sinnhaftigkeit dieser Aufgabe bezweifelt und gespöttelt: »Das Leben ist zu kurz, um es mit Kalenderweisheiten zu verplempern.«
Marla hatte ihm Paroli geboten und erklärt, dass eine Weisheit nicht deswegen an Bedeutung verliere, nur weil sie auch von Küchentischphilosophen zitiert wurde. Ihre Debatte dominierte die AG-Stunde und endete erst am nächsten Tag. Mit einer Sensation. Kilian räumte nicht nur ein, dass Marla ihn überzeugt hatte. Sondern er war von ihrem Lebensmotto offenbar so beeindruckt, dass er es sich auf den Unterarm tätowiert hatte!
Jeder Mensch hat zwei Leben. Das zweite beginnt in dem Moment, in dem man erkennt, dass man nur ein Leben hat.
Mit diesem für alle sichtbaren Zeichen der Wertschätzung begann ihre platonische Freundschaft (oder war es mehr?), in der der selbstbestimmte Einzelgänger und die unfreiwillige Außenseiterin sich über Lerninhalte und Privates austauschten, Schulhefter und Sorgen teilten und am Ende mehr übereinander wussten als so manche Jungvermählten. Ihr gegenseitiges Vertrauen war so weit gegangen, dass sie einander sogar ihre Tagebücher zu lesen gaben.
Ein Schwarm Vögel flatterte hoch über ihrem Kopf Richtung Wannsee und riss Marla aus ihren Gedanken.
Sie sah auf die Uhr. 19:37 Uhr. Genug Spielraum, um das Zeitfenster einzuhalten.
Sie nahm das schuhkartongroße Paket aus dem Kofferraum. So seltsam wie die Übergabeanweisung war auch der handschriftlich notierte Hinweis auf dem Paket.
Für Frau Hansen persönlich. Bitte in Gegenwart des Zustellers öffnen und quittieren. Aber nicht vor 19:49 Uhr öffnen.
Keine Sekunde zuvor.
3. Kapitel
Hansen?
Soweit sie wusste, kannte Marla niemanden mit diesem Nachnamen. Dennoch brachte er in Kombination mit den seltsamen Übergabeanweisungen im Resonanzkasten ihres Unterbewusstseins eine Saite zum Klingen. Allerdings eine nicht gestimmte, deren schräger Ton in Marla ein leichtes Unbehagen erzeugte.
»Komm, Marla, reiß dich zusammen!«, ermahnte sie sich selbst.
Das Paket hatte einen Tragegriff, was praktisch war, weil es etwa so viel wog wie ein Ziegelstein. Mit ihm in der Hand machte sie sich auf den Weg über den Mitarbeiterparkplatz zum Gebäude. Sie trug nur eine leichte Leinenbluse, Shorts und Sandaletten, dennoch schwitzte sie schon nach wenigen Metern. Der Rand des Parkplatzes war zu einer Seite von Bäumen gesäumt, deren Äste und Blätter sich nicht bewegten. Die Windstille verstärkte den Backofeneffekt.
In Barcelona ist es jetzt bestimmt noch heißer, versuchte sie sich das Wetter schönzureden. Dort, das wusste sie, würde sie es lieben. Marla freute sich wie wild, dass Kilian per E-Mail gefragt hatte, ob sie sich nicht doch der Abifahrt anschließen wolle.
»Bitte, lass mich da nicht allein mit dem ungebildeten Suff-Pack. Wir sind doch vom gleichen Schlag, Marla. Wenn die ihre Sangria durch den Strohhalm ziehen, wollen wir die Durchflussgeschwindigkeit in der Verengung nach Bernoulli berechnen. Wie soll ich das ohne deine Hilfe hinbekommen?«
Marla hatte gelacht und ihm geantwortet, sie werde es sich noch überlegen, aber in Wahrheit hatte sie sich schon entschieden. Nur deshalb nahm sie doch bei diesem Kurierjob jeden Auftrag mit! Damit sie die Kosten für den einwöchigen Trip finanzieren konnte. Ihre Mutter bezahlte ihr nur das Nötigste, Leven war mal wieder verschollen, und Oma war seit einem Monat im Heim und brauchte dort jeden Cent. Also fehlte Marla noch einiges für Flug, Hotel, Clubbesuche, Restaurants und Andenken.
Aber es bleiben mir ja noch fünfzehn Tage bis zum Abflug.
Mit dem Paket in der Hand kam sie an einem Hinweisschild vorbei, auf dem die im Gebäude untergebrachten Firmen aufgeführt waren. Einige Namen waren unleserlich, die Logos vergilbt, die Schrift abgeblättert.
Auf keinem erkannte sie HANSEN.
Sie nahm die erste der Granitstufen, die zum Eingang führten, als sich die Abendsonne am Himmel verdunkelte, ohne dass eine Wolke aufgezogen war.
Marla betrachtete ihren Unterarm, als wäre er ein nicht zu ihr gehörender Körperteil. Er war von Gänsehaut überzogen.
Was ist hier los?
Sie drehte sich um und bemerkte den schwarzen Kombi. Er stand am Rand des Parkplatzes in der Nähe einer Eiche.
Marla musterte das Auto, das an einen Leichenwagen erinnerte.
Und in dem Marla einen Schatten bemerkte.
Auf der Rückbank.
Nur kurz.
Dann war er verschwunden.
Sie erstarrte. Und zwang sich zur Ruhe.
Es ist 19:39 Uhr an einem wunderschönen Sommerabend. Was soll schon passieren?
Schön, der Schatten könnte die Tür des Kombi aufreißen und sie anspringen. Aber wenn Edgar das gewollt hätte, hätte er schon sehr viel bessere Möglichkeiten gehabt, ihr etwas anzutun. In der Dunkelheit ihres Schlafzimmers zum Beispiel. Doch das war natürlich Blödsinn.
Er lebt nicht mehr. Er ist tot. Edgar kann mir nichts anhaben.
Marla machte auf dem Absatz kehrt. Sie würde die Gelegenheit nutzen, sich davon zu überzeugen, dass da nichts war, was ihr gefährlich werden könnte. Im Gegensatz zu den verschwitzten Händen war ihre Kehle wie ausgedörrt. Sie schluckte, was zur Folge hatte, dass es in ihren Ohren knackte und sie die Umgebungsgeräusche sehr viel lauter hörte: das stetige Rauschen der nahen Stadtautobahn, Gelächter in einiger Entfernung aus einem Bürogebäude, das Zirpen der Grillen. Und das Schaben. Es kam aus dem Wagen. Von der Rückbank. Als kratzten lange Fingernägel auf einem Ledersofa.
Mit klopfendem Herzen beschattete sie ihre Augen und versuchte so einen Blick durch die Seitenscheibe zu erhaschen, in der sich das Sonnenlicht spiegelte. Und sah …
Keinen Edgar. Natürlich nicht. Keine Gefahr, sondern im Gegenteil ein hilfloses Lebewesen, das dem Tod näher schien als dem Leben.
4. Kapitel
Verdammt, wie lange bist du schon da drin?«, sprach Marla durch die Scheibe zu dem kleinen Hund, der apathisch auf dem Rücksitz lag. Hatte das grauschwarze Fellbündel (sie tippte auf einen Schnauzerwelpen) eben noch die Kraft gehabt, aufzustehen und sich hinter der Scheibe als Schatten zu zeigen, schien ihm jetzt sogar die Energie zu fehlen, um die Zunge zu kontrollieren. Sie hing ihm wie ein toter Luftballon schlaff aus dem Maul. Kein Wunder bei der sengenden Hitze. Hier draußen herrschten bestimmt fünfunddreißig Grad, wie unerträglich heiß mochte es erst im Inneren des schwarzen Wagens sein? Nicht einmal ein Fensterschlitz stand offen. Eine Sauna musste sich gegen das Wageninnere wie ein Kältebecken anfühlen.
»Hey …« Marla klopfte an die Scheibe, aber das arme Tier regte sich kaum.
Wer tut so etwas? An einem der heißesten Tage des Jahres?
Sie hob das Paket an seinem Tragegriff an. Nickte sich selbst zu und schmiss ohne Zögern damit die Scheibe ein.
Das Sicherheitsglas bröselte in den Fußraum des Fonds.
Marla zog den Stift der Türverriegelung hoch und öffnete den Wagen.
»Hey, Kleiner, alles gut. Alles wird gut«, sagte sie beruhigend.
Das Tier hatte sich nicht einmal bewegt. Kein Wunder.
Marla beugte sich vor und hatte das Gefühl, sie würde den Kopf in einen Ofen stecken. Als sie nach dem Köpfchen tastete, versuchte ihr der arme Hund über die Hand zu lecken.
Gut, es ist nicht zu spät. Hoffentlich.
Sachte hob sie ihn hoch. Ein kleines, schwaches Bündel mit wild pochendem Herzen. »Halte durch!«, raunte sie ihm zu.
In der Getränkeablage zwischen den Vordersitzen entdeckte sie eine angebrochene Sprudelflasche.
Zuerst musste das Tier in den Schatten. Sie trug den Hund unter die Eiche und legte ihn behutsam auf den ausgetrockneten Erdboden. Dann holte sie die Wasserflasche aus dem Kombi, öffnete sie und benetzte erst ihre Finger, dann die Zunge des Hundes. Seine Augen öffneten sich und schenkten ihr einen erschöpften, dankbaren Blick. Marla spürte, wie ihr Herz vor Freude wild zu klopfen begann.
»Gut, mein Kleiner. Sehr gut. Trink bitte.« Sie hielt ihm die Flasche hin. Der Mischlingshund leckte die Öffnung ab, und sie kippte ihm etwas Wasser direkt ins Maul.
»Gut so, ja.«
Die Lebensgeister des Hundes erwachten langsam, aber stetig. Das Tier versuchte, sich auf die Vorderbeine zu kämpfen, doch im nächsten Moment sackte der Schnauzer zurück in die Bauchlage.
Marla sah sich um. Niemand in der Nähe. Sie kniete sich vor den Welpen und kraulte ihm das Kinn, was er sichtlich genoss. Dann löste sie sein Halsband, damit es nicht scheuerte, und entdeckte ein kleines Geheimfach in der Innenseite.
In der Hoffnung, den Namen des Hundes und damit die Kontaktdaten des Halters zu bekommen, öffnete sie den Klettverschluss.
Na sieh mal einer an.
Im Inneren des Fachs steckte ein kleiner Zettel. Sie wählte die Nummer, die darauf stand und die ihr eigenartig vertraut vorkam.
Es klingelte, und Marla verschluckte sich vor Schreck an ihrer eigenen Spucke. Denn sie hörte das Klingeln nicht nur in ihrem Telefon, sondern zeitgleich wenige Schritte von sich entfernt; was nichts anderes bedeutete, als dass das Handy, das sie anrief, direkt hinter ihr lag.
In dem schwarzen Kombi.
Sie ging zum Wagen zurück. Langsam, als müsste sie damit rechnen, jemanden im Kombi auf sich aufmerksam zu machen, der sie wie ein tollwütiges Tier ansprang, öffnete sie noch einmal die Beifahrertür. Wieder setzte sie sich auf die Rückbank und entdeckte das Mobiltelefon im Fußraum des Beifahrersitzes.
Es vibrierte wie eine Klapperschlange, das Display funkelte hell beleuchtet. Und zeigte etwas, das Marla an ihrem Verstand zweifeln ließ.
Was soll das?
Je länger sie den Bildschirm anstarrte, desto kälter wurde es ihr, obwohl der Wagen noch immer überhitzt war. Sie wollte wegrennen, konnte aber ihren Blick nicht lösen – von dem Foto einer jungen Frau mit einer etwas zu großen und leicht schiefen Nase in einem freundlichen Gesicht, das von lachenden Augen dominiert wurde. Darüber die Textzeile:
MARLA LINDBERG, DIENSTHANDY RUFT AN!
O Gott.
Sie hätte am liebsten geschrien.
Welchen Tierquäler auch immer sie gerade anrief, er hatte das Telefon, das sie in der Arbeit benutzte, als Kontakt abgespeichert.
5. Kapitel
Im Inneren des alten Klinikgebäudes empfing Marla eine wohltuende Kühle. Das allerdings war das einzig Angenehme, das sich über die Umgebung sagen ließ.
»Hey, was soll das? Ist das ein vorgezogener Abischerz?«, rief sie in den leeren, offenbar fensterlosen Gang hinein. Nirgends drang Tageslicht ins Innere. Marla hatte beim Eingang einen Bewegungsmelder ausgelöst, der mehrere Deckenlampen im Flur aktivierte. Jetzt lief sie mit Mr Grill im Arm (so hatte sie den armen Hund getauft, der beinahe gegrillt worden wäre) an verschlossenen Türen vorbei, die sie an einen Gefängnisgang denken ließen.
Seltsam.
Wenn Marla etwas Positives aus all dem Schrecken ziehen konnte, den sie schon als Kind erlitten hatte, dann war es die Tatsache, dass Edgar Lindbergs krankhaftes Verhalten ihr zu einer unfassbar guten Auffassungs- und Beobachtungsgabe verholfen hatte. Damals hatte Marla das noch nicht realisiert. Erst in der Therapie waren ihr die frühen Anzeichen bewusst geworden, an denen sie schon in jungen Jahren hätte ablesen können, dass an dem Verhalten ihres Vaters etwas nicht stimmte. Etwa, wenn er sie einen Tick zu lange ansah, einen Moment zu lang die Hand auf ihrer Schulter liegen ließ. Leven hatte es auch gesehen, wie er ihr später gestand, und ihre Mutter darauf angesprochen. Thea war fuchsteufelswild geworden und hatte Leven obszöne, krankhafte Gedanken unterstellt. Das war der Moment des endgültigen Bruchs des siebzehnjährigen Leven mit seinen Eltern, den er noch am selben Abend mit zwei Flaschen Tequila besiegelte. Damals begann er aus Selbstmitleid zu trinken. Später, nach seinem Auszug, betrank er sich, um die Schuldgefühle zu verdrängen, weil er seine kleine Schwester in diesem Elternhaus im Stich gelassen hatte.
Da sie nicht hatte wahrhaben wollen, dass ihr dunkler, Furcht einflößender Begleiter aus dem engsten Familienkreis kam, hatte Marla sich mit aller Macht bemüht, eine andere Ursache für ihre Empfindungen zu finden.
Auch heute noch suchte sie jeden unbekannten Raum intuitiv nach Gefahrenquellen ab. Fragte sich: Wer hielt sich in ihm auf? Gab es Winkel oder Ecken, in denen man sich verstecken konnte? Welche Fluchtmöglichkeiten standen zur Verfügung? Sie hatte ein bestens geschultes Auge für ihre Umgebung. Auch jetzt fielen ihr Dinge auf, die anderen in dieser aufregenden Situation womöglich verborgen geblieben wären.
Der Krankenhausbau wirkte wie erwartet heruntergekommen und verfallen. Doch eher so, als habe sich ein Requisiteur die Mühe gemacht, ihn wie seit Jahren leer stehend aussehen zu lassen, obwohl in Wahrheit hier täglich Menschen ein und aus gingen.
Die Gegensprechanlage an der nur angelehnten Eingangstür war herausgerissen gewesen, das Schild »Geburtsklinik Schilfhorn« jedoch blank geputzt. Der teilweise aufgeplatzte Linoleumboden im Flur roch nach Reinigungsmitteln, auf dem Boden lagen Papiere, aber selbst die schienen dort absichtlich drapiert, ähnlich wie die zum Teil aufgeplatzten Müllsäcke, die vor fast jeder vom Gang abgehenden Tür standen, und das in einem verdächtig gleichmäßigen Abstand.
In einem von ihnen entdeckte Marla eine Schüssel, die sie an sich nahm.
»Frau Hansen?«, rief sie, obwohl sie längst davon überzeugt war, dass ihr irgendwer, vermutlich ihre Mitschüler, einen Streich spielte. Der Einzige, der darauf reagierte, war Mr Grill, der versuchte, ihr übers Kinn zu lecken.
Sie öffnete mit dem Fuß eine Tür mit dem Schild »Patienten-WC«. Die Leitungen funktionierten. Das Wasser lief kühl aus dem Hahn in die Schüssel. Gierig tauchte Mr Grill das Köpfchen hinein.
»Hier auf den Fliesen ist es angenehm, wartest du hier kurz? Ich bin gleich wieder da, Kleiner!«
Normalerweise war Marla eher scheu und hätte sich niemals auf eigene Faust in dieses verlassene Gebäude gewagt. Sie hätte kehrtgemacht und ihrem Chef gesagt, jemand anderes müsse das Paket übergeben. Kurzzeitig hatte die Wut über das, was Mr Grill angetan worden war, sie aufgebracht und übermütig werden lassen. Doch nun war die erste Erregung verraucht, und sie beschloss, nicht länger hier zu bleiben.
In dem Moment sah sie, vor welchem Raum sie stand.
Nummer 012.
Direkt unter der Nummer stand »Kreißsaal«. Die Tür war breit genug, um ein Krankenbett hindurchzuschieben.
Und sie stand einen Spalt offen.
Marla sah sich um, überlegte kurz, schaute unschlüssig auf das Paket in ihrer einen, auf das Telefon in der anderen Hand. Dann obsiegte die Neugier.
Sie steckte ihr Handy ein und klopfte an, obwohl sie sich sicher war, dass das überflüssig und nutzlos war.
Hier ist keiner.
Wie erwartet bekam sie keine Antwort.
»Hallo?«
Sie betrat den Raum. Gleichzeitig erlosch hinter ihr das Flurlicht.
6. Kapitel
Ihre Augen brauchten eine Weile, um sich an die gespenstische Szenerie zu gewöhnen. Hatte Marla schon am Eingang der verlassenen Klinik den Eindruck gehabt, dass hier etwas ganz und gar nicht stimmte, war sie sich nun dessen sicher. Es sah aus, als hätte ein morbider Geist einem frisch vermählten Brautpaar das Schlafzimmer für die Hochzeitsnacht dekoriert. Die Fenster waren mit blickdichten, schwarzen Filzvorhängen komplett verdunkelt. Auf dem Fußboden brannten mindestens zwei Dutzend Teelichte. Rosenblüten markierten den Weg vom Eingang des ehemaligen Kreißsaals bis zu etwas, das wie eine Mischung aus Krankenbett, OP-Tisch und Zahnarztstuhl aussah.
Jetzt erst hörte Marla leise klassische Musik. Sie musste an Oma Margot denken, die das Air von Bach auch so liebte, doch ganz gewiss nicht in dieser entsetzlichen Umgebung.
Mit diesem verstörenden Anblick.
Denn auf dem, was vermutlich einst ein Entbindungsbett gewesen war, in dem junge Mütter in den Wehen gelegen hatten, lag nun … Es.
Marla wollte im ersten Moment nicht wahrhaben, dass Es ein Mensch war. Und keine Puppe, deren Kopf man mit einer milchigen Plastikfolie umwickelt hatte. Die Geräusche, die Es auf einmal von sich gab, hätten alles sein können. Die eines gequälten Tieres. Oder eines sterbenden Menschen.
Doch dann gewöhnten sich ihre Augen an das flackernde Kerzenlicht, und sie sah die Beine, die in einer Anzughose steckten, wie ihr Vater sie getragen hatte. Sah die Lederschuhe, ähnlich jenen, mit denen er zur Arbeit gegangen war.
Edgar?
Nein, dafür war der Mann zu klein.
Und Edgar ist tot, oder etwa nicht?
Marla verspürte keine Angst. Sie stand unter Schock. Zitterte. Sehnte sich nach der Sonne und dem Tageslicht zurück, das die Kälte, die ihr Innerstes erfasst hatte, vertreiben mochte.
Sie sah sich um, entdeckte einen Schalter an der Wand, legte ihn um, und ein mattes Energiesparlicht verstärkte die unheimliche Atmosphäre. Sie beugte sich über Es. Und sah: Augen. Lippen. Aufgequollen. Durch die dicke Folie kaum sichtbar, aber ohne Zweifel menschlichen Ursprungs. Sie war nun sicher, dass da ein Mensch unter der Plane steckte, dem Erstickungstod so nahe wie Mr Grill dem Hitzschlag vor wenigen Minuten.
Unmöglich, dass man derart eingewickelt ausreichend Luft bekommen konnte, auch wenn der Unbekannte es versuchte.
Herr im Himmel, er stirbt …
Der Brustkorb des Opfers hob und senkte sich in einer hyperventilierenden Frequenz. Sie versuchte, die Plane von dem Kopf zu lösen, und merkte, dass es in Wahrheit ein Sack war, den das Opfer mit jedem krampfhaften Atemzug über sein Gesicht saugte. Der Planen-Sack war mit einem Zipper am Hals zugezogen. So fest, dass Marla ihn mit bloßen Händen nicht lösen konnte.
Marla drehte sich um und trat dabei mit dem Fuß einige Teelichte um. Sie entdeckte einen Instrumentenschrank und zwei Kommoden an der Wand. Riss alles auf, jede Schranktür, jede Schublade, doch sie waren leer, wie Attrappen. Kein Skalpell, kein Messer, mit dem sie die Plane hätte aufstechen können.
Sie überlegte, ob sie mit einer Kerze die Folie vor dem Mund des Opfers aufschmelzen sollte, aber wenn das nicht zu grausamen Verbrennungen führte, dann vermutlich zu tödlichen Vergiftungen.
Nichts, hier gibt es nichts, dachte sie, außer …
Das Paket!
Natürlich.
Der Psycho, der das eingefädelt hatte, musste sie ja aus einem Grund hierhergelotst haben. Marla rutschte auf den Rosenblättern aus, als sie zur Tür zurückhastete, dort, wo sie vor Schreck das Päckchen hatte fallen lassen.
Kurz hielt sie inne.
Wie spät war es?
19:47 Uhr.
Das Paket sollte nicht vor 19:49 Uhr geöffnet werden. Und dann auch nur von einer Frau Hansen.
Was, wenn etwas Schlimmes passierte, sollte sie sich nicht daran halten?
»Völlig egal!«, schrie sie sich selbst an.
Was gab es Schlimmeres als das hier?
Eilig riss sie die Pappe auf und schrie vor Verzweiflung, als sie tatsächlich nur einen nutzlosen Stein darin fand. Ansonsten war es leer, bis auf …
Ein Brief?
Er war sehr lang, im Schummerlicht nur schlecht lesbar und ohnehin komplett nutzlos. Die handbeschriebenen Seiten würden das Leben dieses Menschen hier ebenso wenig retten können wie der Gegenstand, der klirrend auf den Boden gefallen war, als sie das Paket umgedreht und geschüttelt hatte in der Hoffnung, doch noch etwas übersehen zu haben.
Marla bückte sich und griff nach einem Bund mit zackenlosen Schlüsseln.
Was soll ich damit?
Hier gab es keine abgeschlossenen Türen, Schränke oder Tische. Nur einen kleinen Kasten an der Wand.
Es war ein Schockgeber. Auch als Defibrillator bekannt.
Ein blaues Gerät, so groß wie ein Kinderkassettenrekorder, mit Tragegriff und Display, das tatsächlich noch funktionierte, als sie panisch draufpatschte.
Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, leuchtete auf. An dem Defi hingen zwei handtellergroße Kellen, mit denen der Strom in den Brustkorb geleitet wurde. Marla starrte sie hilflos an.
Was mache ich jetzt nur?
Der Mann (in Gedanken ging sie von einem männlichen Opfer aus) ist doch noch gar nicht tot. Ich muss ihn nicht wiederbeleben, ich muss ihn befreien, ich muss …
Ihr kam eine Idee.
Sie riss den Kasten von der Wand und schmiss den Defibrillator auf den Boden. Einmal. Zweimal.
Nach dem dritten Wurf lagen seine Einzelteile auf dem Linoleum verstreut. Unter ihnen auch, wie erhofft, ein Metallstück, scharfkantig wie Schrapnell.
Marla bückte sich danach und spürte einen stechenden Schmerz. Sie hatte sich in den Zeigefinger geschnitten. Blut quoll hervor.
Gut, es würde also funktionieren.
Allerdings zitterte sie jetzt so sehr, dass sie den Mann kaum von der Plane würde befreien können, ohne ihm ins Fleisch zu schneiden.
Oder Schlimmeres.
Doch Marla hatte keine Wahl. Als sie mit dem improvisierten Messer im Bereich des Mundes in die Plane stach, fühlte es sich an, als würde sie eine straff gespannte Haut durchtrennen.
Sie wusste nicht, ob sie aus Versehen die Lippen oder gar die Zunge des Mannes erwischt hatte, denn das Blut aus ihrem Finger hatte die Plane über dem Gesicht vollgetropft.
Sie schob jeweils zwei Finger in die Öffnung und versuchte, die durchstochene Folie weiter aufzureißen. Die anstrengende Arbeit war erst nach mehreren Ansätzen von Erfolg gekrönt. Marla wischte sich den Schweiß von der Stirn. Roch ihren eigenen süßsauren Körpergeruch, ein Gemisch verschiedener Sorten Schweiß: Arbeit, Erschöpfung, Angst. Mit der blutigen Hand hatte sie sich einen Schleier über die Augen gezogen, durch den sie nicht mehr klar sehen konnte. Am wenigsten das Gesicht des Opfers. Dafür hörte sie ein gedämpftes Husten. Nicht keuchend oder erstickt, sondern eher melodisch pfeifend.
Wie die Trillerpfeife des Teufels, dachte Marla, irr vor Angst. Sie meinte, nie zuvor etwas so Furchteinflößendes gehört zu haben, und das Grauen wurde rasch von einem zweiten Laut übertroffen. Ein einziges Wort. Eine gestöhnte Frage:
»Warum?«
Die Stimme war ihr im Unterschied zu dem Pfeifen vertraut, ohne dass sie hätte sagen können, zu wem sie gehörte. Eigenartigerweise klang das Opfer keine Spur dankbar darüber, dem Tod in letzter Sekunde entkommen zu sein.
Es schien eher verwirrt. Verzweifelt. Und panisch.
Und das, obwohl der Mensch unter der Plane nicht nur wieder ausreichend Luft bekam. Sondern zudem gar nicht mehr gefesselt war, auch wenn Marla sich das nicht erklären konnte.
Wie hat er das geschafft? Ich habe seine Hände doch noch gar nicht befreit, oder …
Waren sie gar nicht gefesselt gewesen? Ich habe es nicht kontrolliert, ich bin einfach davon ausgegangen, dass …
Sie brachte den Gedanken nicht zu Ende.
Die Gestalt bäumte sich auf, schlug um sich und rammte ihr dabei das Metallstück mit der eigenen Hand durch das Kinn bis in die Mundhöhle.
Marla taumelte zurück. Wartete auf den Schmerz, der mit kurzer Verzögerung kam, dafür aber umso heftiger.
Sie riss sich das Metall aus dem Kinn, was sich als Fehler erwies, weil sie jetzt Blut spuckte, so viel, dass sie die rettende Tür nicht mehr zu erreichen glaubte, da sie in einer Lache ausrutschte. Gerade als sie nach der Klinke greifen wollte, um sie aufzuziehen, spürte sie die Hand an ihrem Knöchel. Der Planen-Mensch musste sich von dem Gebärbett abgerollt haben und zu ihr gekrochen sein. Jetzt riss er sie an ihrem Bein nach hinten. Marla ruderte mit den Armen, verlor das Gleichgewicht und fiel der Tür entgegen, die auf einmal sehr viel näher war. So nahe, dass sie mit voller Wucht mit dem Kopf gegen die hervorstehende Klinke schlug.
Ihr Nasenbein zersplitterte. Es knirschte, als wäre es eine Nuss, die man unter dem Stiefelabsatz zertrat.
Noch mehr Schmerzen, noch mehr Blut.
Das Erstaunliche allerdings war: Obwohl der Schmerz die Grenze dessen überschritten hatte, was ein Mensch bei Bewusstsein ertragen konnte, sorgte er nicht dafür, dass Marla sämtlicher anderer Empfindungen beraubt war. Neben dem Ziehen und Pochen und Brüllen all ihrer Wunden schaffte es eine weitere, sehr viel subtilere Wahrnehmung in eine entlegene Kammer ihres Bewusstseins.
Etwas, was sie im Sturz für den Bruchteil einer Sekunde aus den Augenwinkeln heraus sah.
Ein Stativ. In der Zimmerecke.
Ich werde gefilmt, war ihr letzter Gedanke.
Mein Tod wird gefilmt!
7. Kapitel
Es gab nur zwei Menschen in ihrer Verwandtschaft, die wussten, womit sie ihr Geld verdiente. Sonst erzählte sie keinem davon. Offiziell arbeitete sie an ihrer Bachelorarbeit im Bereich Verhaltensbiologie zum Thema »Angeborene und erlernte Aggressionsstrategien des Menschen in Extremsituationen«. Dieser sperrige Titel reichte flüchtigen Bekanntschaften aus (wenn sie denn welche machte), ihre Beschäftigung nicht weiter zu hinterfragen.
Wäre sie auf Partys gegangen, hätte sie eher ein Cocktailschirmchen heruntergeschluckt, als den Gästen von ihrem Arbeitstag zu erzählen. Niemand wollte das wissen. Keiner wollte wahrhaben, dass es so etwas Entsetzliches in der Welt überhaupt gab.
Leider gab es so etwas sogar so häufig, dass Menschen wie sie für diesen grauenhaften Job eingestellt wurden. Für den es nur einen fensterlosen, klimatisierten Raum, einen Notizblock mit Bleistift und natürlich einen Computer mit mehreren Monitoren brauchte. Vor diesem saß sie mit geräuschreduzierenden Kopfhörern, die die meisten ihrer in der Regel männlichen Kollegen ablehnten. Sie ertrugen die Schreie, das Weinen und vor allem das Flehen längst nicht mehr.
»Bitte nicht, Papa. Hör bitte auf. Du tust mir weh.«
Von den Abertausend Missbrauchs- und Misshandlungsvideos, die sie als Cyber-Analystin für das LKA Berlin bislang hatte sichten müssen, gab es eine Kategorie, die jede Grenze des Vorstellbaren sprengte. Und zwar die, in der die Opfer ihre Peiniger nicht einmal um Gnade anbetteln konnten, weil es sich bei ihnen um Säuglinge handelte.
Auf dem Video, das sie sich gerade ansah, war zum Glück niemand mehr zu sehen. Die abscheuliche Tat war vorbei, das Badezimmer, in dem sie begangen worden war, wieder leer. Seine Ansicht füllte als Standbild einen der drei Monitore auf dem Schreibtisch.
Weiße Eckbadewanne, Modell Sirion, Anfang 2017 aus dem Sortiment des Herstellers genommen, notierte sie auf dem Block. Nach langer Suche hatte sie das taxiweiße, bauchige Modell auf E-Bay gefunden. Am Ende des heutigen Arbeitstages würde sie es in die Cybercrime-Datenbank einspeisen. Wichtige Informationen für den Fall, dass Ermittler in anderen Fällen ebenfalls auf dieses Tatortobjekt stießen.
Sie spürte, wie hinter ihr die Tür aufging, und nahm den Kopfhörer ab.
Kristin Vogelsang, die Abteilungsleiterin, saß in ihrem Rollstuhl und nickte ihr vom Flur aus zu. Wie immer trug sie einen ordentlich hochgesteckten Dutt und ein Bleistiftrock-Kostüm, das so mausgrau war wie die Farbe ihrer wachen, hinter einer Goldrandbrille versteckten Augen. Und wie immer roch sie angenehm nach einem pudrigen Eau de Toilette, das im Laufe des fortgeschrittenen Tages allerdings nur noch dezent an ihr haftete.
Kristin lächelte und fragte mit der für sie typischen rauchigen Stimme: »Könnte ich dich bitte kurz sprechen, Marla?«
8. Kapitel
Marla nickte, schaltete den Bildschirm schwarz und stand auf. Beim Rausgehen warf sie Mr Grill einen liebevollen Blick zu. Er gähnte schläfrig und blieb in seinem gemütlichen Hundebettchen vor der Heizung liegen.
»Bin gleich wieder da.« Sie bückte sich und tätschelte ihm vor dem Rausgehen den Kopf.
Wäre Mr Grill nicht gewesen, hätte sie vor drei Jahren komplett den Verstand verloren. Der Hund war der einzige Beweis dafür, dass sie sich die Vorkommnisse in der Geburtsklinik nicht eingebildet hatte. Sie hatte keine Ahnung, wie sie dem Wahnsinnigen aus dem Kreißsaal entkommen war. Wie sie erst stürzte, sich dann wieder aufrappeln und ins Freie rennen konnte.
Das Letzte, woran sie sich erinnerte, war, wie sie, den Atem des Planen-Menschen im Nacken spürend, auf die Zufahrt gelaufen war und sich einem Auto in den Weg gestellt hatte.
Leider war der Fahrer gerade mit seinem Handy beschäftigt. Sammy Kalla, ein siebenundzwanzigjähriger Schlagzeuger auf dem Weg zu seinem Proberaum, erfasste sie, ohne abzubremsen. Sie schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Allein der Schädelbasisbruch hätte sie beinahe das Leben gekostet.
Die Beamten hatten das Gebäude untersucht, allerdings erst vier Tage später. Da war Marla nach der zweiten Operation zum ersten Mal wieder ansprechbar gewesen und hatte der Polizei erzählt, woran sie sich erinnerte. Dabei kam es ihr so vor, als wäre das meiste nicht ihr, sondern einer anderen Person zugestoßen. Sie erinnerte sich daran, als sähe sie einen Film über ihre Vergangenheit, wie in diesen modernen True-Crime-Dokus, in denen reale Personen durch Schauspieler ersetzt werden. Doch mit der Zeit gelang es ihrer Psyche nicht mehr, sich in die Rolle der unbeteiligten Beobachterin zu flüchten. Mit fortschreitender körperlicher Gesundung wuchs auch die mentale Klarheit. Dass sie all das selbst erlebt hatte: die Geburtsklinik, den Planen-Menschen, die Metallscherbe im Kinn, die Hand an ihrem Knöchel, ihr Nasenbein, das an der Türklinke zersplitterte.
Der Unfall.
Vor Ort hatten die Ermittler jedoch weder einen Kombi noch ein Gebärbett, noch irgendwelche Hinweise auf einen versuchten Mord in dem alten Kreißsaal gefunden. Kein Blut, keine Kampfspuren. Auch ihr Handy blieb spurlos verschwunden. Dafür sagte der Hausmeister der Polizei gegenüber aus, dass das Gebäude für Krankenhausserien oder Horrormovies an Filmproduktionen vermietet, dort im Moment aber nicht gedreht werde.
Marla versuchte die Beamten davon zu überzeugen, dass ein Krankenhaus-Filmset leicht zu reinigen sei und sie lange genug auf der Intensivstation gelegen habe, dass der Täter seine Spuren verwischen konnte. Aber da keinerlei Indizien für ein Verbrechen gefunden wurden, verzichtete die Polizei auf eine gründlichere Spurensicherung. Zumal Steve, der Chef des Kurierdiensts, bestritt, Marla ein Paket in den Kofferraum gestellt und sie zum Wannsee beordert zu haben. Tatsächlich fand sich keine entsprechende WhatsApp-Nachricht im Ausgang seines Handys.
Einzig ihr Bruder hatte nicht eine Sekunde an ihren Darstellungen gezweifelt und sogar heimlich an den Schwestern vorbei Mr Grill an ihr Klinikbett geschleust, den die Beamten in dem Krankenhausgebäude gefunden hatten.