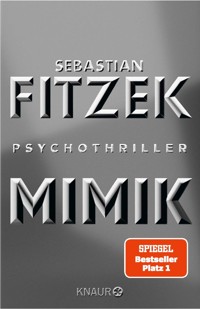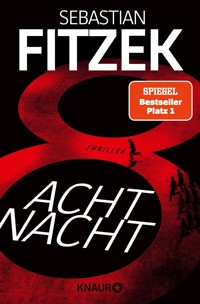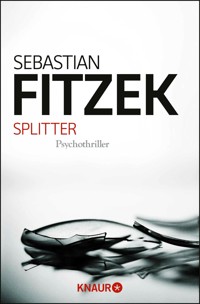14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Nr. 1 Spiegel Bestseller-Thriller von Sebastian Fitzek » Das Geschenk« in attraktiver Geschenk-Ausstattung! »Das Geschenk« ist ein nervenzerreissender Psychothriller mit der bislang faszinierendsten, moralisch ambivalenten Heldenfigur: einem Analphabeten, der die geheimnisvollen Botschaften einer Entführten entschlüsseln muss. Milan Berg schlägt sich geschickt durchs Leben, auch wenn er ein wohlgehütetes Geheimnis hat: Er ist Analphabet. Nicht einmal seine Freundin ahnt, dass er nicht lesen kann. Doch genau das wird ihm zum Verhängnis: Als er an einer Ampel steht, hält ein Wagen neben ihm – auf dem Rücksitz sieht er ein völlig verängstigtes Mädchen, das einen Zettel gegen die Schreibe presst. Handelt es sich um einen Hilferuf? Zwar kann Milan die Botschaft nicht lesen, aber er spürt ganz genau: Das Kind ist in tödlicher Gefahr! Ein fesselnder Entführungsthriller Die Suche nach dem entführten Mädchen wird zu einer albtraumhafte Irrfahrt, an deren Ende die grausame Erkenntnis steht: Manchmal ist die Wahrheit zu entsetzlich, um mit ihr zu leben - und Unwissenheit das größte Geschenk auf Erden. Begeisterte Pressestimmen zu Fitzeks Bestseller-Psychothriller »Wie eine böse Variante von 1001 Nacht!« – dpa »Was diesen Thriller besonders lesenswert macht: Fitzek ist tief in die Welt der Analphabeten eingetaucht und präsentiert ein wahres Horrorszenario, wenn man in der Welt der Buchstaben nicht zuhause ist.« – Berliner Kurier online
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 375
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Sebastian Fitzek
DAS GESCHENK
Psychothriller
Knaur e-books
Über dieses Buch
Milan Berg steht an einer Ampel, als ein Wagen neben ihm hält. Auf dem Rücksitz ein völlig verängstigtes Mädchen. Verzweifelt presst sie einen Zettel gegen die Scheibe. Ein Hilferuf? Milan kann es nicht lesen – denn er ist Analphabet! Einer von über sechs Millionen in Deutschland. Doch er spürt: Das Mädchen ist in tödlicher Gefahr. Als er die Suche nach ihr aufnimmt, beginnt für ihn eine albtraumhafte Irrfahrt, an deren Ende eine grausame Erkenntnis steht: Manchmal ist die Wahrheit zu entsetzlich, um mit ihr weiterzuleben – und Unwissenheit das größte Geschenk auf Erden.
Inhaltsübersicht
Psychopathie (…) hat vermutlich genetische Ursachen.
Bestimmte Gehirnareale, etwa die für Mitgefühl und Impulskontrolle,
sind bei ihnen von Geburt an unterentwickelt.
Fanny Jiménez, So erkennen Sie einen Psychopathen,
Die Welt, 14.08.2014
Alles wirklich Böse beginnt in Unschuld.
Ernest Hemingway
Der Mensch ist von Natur aus böse.
Er tut das Gute nicht aus Neigung,
sondern aus Sympathie und Ehre.
Immanuel Kant, Reflexionen zur Anthropologie
Psychopathie ist eine Persönlichkeitsstörung.
Schätzungen gehen davon aus, dass eine von
hundert Personen diese Störung hat.
Männer sind viermal häufiger davon betroffen als Frauen.
Zwillingsstudien zeigen, dass Vererbung eine Rolle spielt.
Hildegard Kaulen, Ein Schalter für Empathie, FAZ, 16.03.2018
Wie die Welt von morgen aussehen wird, hängt in großem Maß von der Einbildungskraft jener ab, die jetzt lesen lernen.
Astrid Lindgren
1.
Er war nackt und wurde in zwei Hälften zerteilt.
Es fühlte sich nicht nur so an. Es geschah tatsächlich. Hier und jetzt in der alten Gefängniswäscherei, auf dem Fliesenboden, direkt neben dem Industrietrockner.
Milan hörte sich selbst nur unmenschlich grunzen. Ohne den Sockenknebel hätte er die ganze Anstalt zusammengeschrien. Nicht, dass es einen Unterschied gemacht hätte. Die Truppe hatte gut dafür bezahlt, dass man sie die Nacht über mit dem Neuen allein ließ.
Es waren fünf. Zwei knieten auf seinen Schultern, zwei hielten ihm die Beine fest, und der Fünfte, ein stark keuchender 120-Kilo-Sack mit Mettwurstatem, schob ihm gerade etwas ins Rektum, das sich wie ein stacheldrahtbewehrter Morgenstern anfühlte. Womöglich war es aber auch nur eine Faust, mit der er ihn vergewaltigte.
Plötzlich hörte der Druck auf, so unvermittelt, dass Milan einen Krampf bekam und am ganzen Körper zitterte. Der Schmerz dauerte an, etwas, das heißer war als ein Saunaofen, brannte in seinem Innersten, aber wenigstens konnte er die Arme wieder frei bewegen und sich auf den Rücken rollen.
Ein neues, sechstes Gesicht schwebte über ihm. Der ältere Mann mit strengem Seitenscheitel und karibikblauen Augen hinter dicken Brillengläsern war noch nicht dabei gewesen, als sie ihn unter der Dusche zusammengeschlagen und hierher verschleppt hatten.
Er musterte ihn mit der Neugierde von Kindern, die ein Insekt unter der Lupe grillen. »Du bist also der Polizist?«
Milan nickte, während der Mann ihm den Knebel entfernte.
»Ich bin Zeus. Du kennst mich, oder?«
Zeus, der Gefängnisgott. Milan nickte wieder. Nur Hirntote oder Komatöse wussten nicht, wer der Mann war, der den Namen der griechischen Gottheit missbrauchte und der hier in der JVA Tegel wirklich das Sagen hatte.
»Hör mir gut zu. Leute wie du stehen bei uns ganz unten in der Nahrungskette. Du hast hier weniger Rechte als die Fusseln in Plättes Bauchnabel.«
Zeus lächelte dem Fettsack zu, der sich gerade die Hose hochzog. Milan hätte sich am liebsten zum Sterben in eine Ecke verzogen. Wenn das der Penis des Kerls gewesen war, der eben noch in ihm gesteckt hatte, musste der die Größe eines Feuerlöschers haben.
»Du hast nur eine Chance – es sei denn, du willst, dass Plätte seine wahre Spezialität auspackt. Weißt du, weswegen wir ihn Plätte nennen?«
Weil er alles plattmacht?
»Weil er so gerne bügelt. Er liebt Plätteisen. Wie das hier.«
Zeus ließ sich von einem seiner tätowierten Handlanger ein altertümliches Bügeleisen reichen.
»Plätte wird es gleich auf zweihundert Grad hochheizen. Und während es auf Betriebstemperatur kommt, hast du die Chance, mir alles zu erzählen. Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit, so wahr dir Gott helfe.«
Zeus ging in die Knie und testete mit der flachen Hand, ob sein Scheitel noch saß, dabei sagte er: »Du sitzt mit Zecke in einer Zelle. Der Kleine ist okay. Und du hast Glück. Er hat sich für dich verbürgt. Sagt, du weinst im Schlaf. Und dass du wirklich ein Yeti sein könntest.«
»Ein was?«
»Ein Unschuldiger. Sieht man hier drinnen so häufig wie draußen einen Yeti.«
Zeus’ Schergen lachten über den Witz, den sie garantiert schon hundertmal gehört hatten.
»Erzähl mir deine Geschichte!«, forderte der Anführer ein weiteres Mal.
»Was?«
»Sprech ich Chinesisch?« Zeus verpasste Milan eine Ohrfeige. »Ich will wissen, weshalb du hier bist, Polizist. Aber hey, sei vorsichtig.« Der Alte nahm die Brille ab und zeigte auf seine Augen. »Weißt du, was das ist?«
Milan ignorierte die rhetorische Frage, auch weil er sich bemühte, sich nicht zu übergeben, während der Schmerz wie eine Flamme neu aufzüngelte.
»Das sind meine beiden Lügendetektoren. Wenn sie ausschlagen, sieht Plätte das. Ich muss nur ein Mal blinzeln, und er rammt dir das glühende Eisen bis in den Zwölffingerdarm. Haben wir uns verstanden?«
Plätte nickte grinsend. Milan hatte Tränen in den Augen.
Spucke sammelte sich in seinem Mund. Er musste zweimal schlucken, bis er so weit war.
So weit, seine letzte Chance wahrzunehmen, indem er Zeus alles erzählte. Die ebenso unglaubliche wie grauenhafte Geschichte, die ihn einmal quer durch die Hölle bis hierher ins Gefängnis geführt hatte.
Und um Zeit zu schinden, um wenigstens noch einige Stunden am Leben zu bleiben, begann er von Anfang an.
2.
Sind Sie allein?«
»Ja.«
»Was ist mit dem Küchenpersonal?«
»Die sind schon gegangen. Ich mache die Abrechnung. Hier ist außer mir keiner mehr.«
»Okay. Sie müssen trotzdem keine Angst haben«, sagte Milan.
Die Frau am Telefon lachte hysterisch auf. »Keine Angst? Seid ihr bei der Polizei jetzt völlig plemplem? Ihr ruft mich an, erzählt mir was von einem Psycho, der euch durch die Lappen gegangen ist und der mich in wenigen Sekunden als Geisel nehmen wird, und ich SOLL KEINE ANGST HABEN?«
Die junge Kellnerin, die sich ihm als Andra Sturm vorgestellt hatte, klang so, als könnte sie einhändig ein Stück Holz aus dem Tresen des Restaurants reißen, um sich damit einem potenziellen Angreifer in den Weg zu stellen. Aber Milan wusste, dass eine raue, kräftige Telefonstimme nicht immer so gut zum Äußeren passte wie bei ihm. Vielleicht war Andra ein zierlicher Engel und ihr Reibeisentimbre nur die Folge der Todesangst, in die er sie versetzt hatte. In jedem Fall war sie nicht auf den Mund gefallen, was Milan imponierte. Andra machte den Eindruck einer Frau, die er unter normalen Umständen gerne näher kennengelernt hätte, auch wenn das in dieser Situation natürlich ein höchst unprofessioneller Gedanke war.
»Hören Sie mir zu?«
»Nein, ich halte mir die Ohren zu. Natürlich höre ich noch zu.«
Milan sah durch die Windschutzscheibe zum Eingang des Diners hinüber, atmete tief durch und sagte dann, so ruhig es die Situation zuließ: »Erstens, der Täter ist uns nicht entwischt. Wir beobachten ihn seit zwei Stunden und tracken sogar seine Handygespräche. Deshalb wissen wir, dass er Sie kurz vor meiner Kontaktaufnahme angerufen hat. Ist das korrekt?«
»Ja«, sagte Andra mit einiger Verzögerung. Vermutlich hatte sie genickt, bevor ihr klar wurde, dass er das durchs Telefon nicht hatte hören können.
»Er wollte wissen, ob um diese Zeit noch jemand im Restaurant ist.«
Ein Wunder, dass die Kellnerin überhaupt an den Apparat gegangen war. Ein Anruf fünf Minuten vor Feierabend konnte eigentlich nur Ärger bedeuten, zumal das All-American-Diner kein Ort war, wo man reservierte. Die Gäste, die auf Burger, Pommes, Nachos, T-Bone-Steaks, Milchshakes und andere Diätkiller aus waren, kamen ohne Voranmeldung in das kleine Restaurant in der Seitenstraße des Rosenecks.
»Und zweitens«, setzte Milan seine Aufzählung fort, »wird der Mann Sie nicht als Geisel nehmen. Er will nur Bargeld.«
Andra lachte auf. »Woher wissen Sie das so genau, Sie Klugscheißer?«
Milan musste lächeln. Andra sprach mit der selbstbewussten Erregung einer Berlinerin, die kein Blatt vor den Mund nahm. Und das vermutlich nicht nur in solch extremen Ausnahmesituationen wie dieser. Er schätzte sie auf Ende zwanzig, Anfang dreißig. Etwa sein Alter.
»Der Täter hat schon eine Geisel«, beantwortete er ihre Frage.
»Wie bitte?«
»Ein Mädchen. Er hat sie entführt. Heute Vormittag ist die Lösegeldübergabe fehlgeschlagen. Seitdem überwachen wir ihn.«
Pause.
Offenbar musste Andra das Gehörte verdauen. Vermutlich lagen ihr diese Informationen weitaus schwerer im Magen als die fettigen Pancakes, mit denen das Diner seine Frühstücksgäste mästete.
Milan versuchte erneut, von seinem Standpunkt aus einen Blick in den Innenraum zu erhaschen, doch die zur spärlich beleuchteten Straße ausgerichtete Fensterfront war hinter dem Dauerschneeregen kaum auszumachen.
Verdammt schlechte Einsatzlage.
Alles sah aus wie durch die Scheibe einer laufenden Waschmaschine betrachtet, und Milan hätte nicht einen einzigen Gegenstand im Inneren des Restaurants identifizieren können, hätte er die klischeeartigen Requisiten nicht in tausend anderen Diners dieser Welt schon gesehen: das auf alt getrimmte Route-66-Straßenschild, die Jukebox-Attrappe im Eingang, das Stars-and-Stripes-Banner sowie mehrere Elvis- und Uncle-Sam-Plakate an den Wänden.
Milan verwettete seine ungezeugten Kinder darauf, dass die Sitzecken aus rot gepolstertem Kunstleder gefertigt waren und auf einem laminierten Fußboden mit Schachbrettmuster standen.
»Wieso schnappen Sie sich den Dreckskerl nicht, sobald er hier reinschneit?«
»Weil wir nicht wissen, wohin er sein Opfer verschleppt hat.«
»Wie bitte?«, fragte Andra erneut, diesmal klang sie regelrecht entgeistert.
»Während der Täter bei Ihnen im Restaurant ist, werden wir sein Fluchtauto präparieren, damit er uns zu seiner Geisel führt, selbst wenn wir ihn aus den Augen verlieren.«
»Ist er sehr gefährlich?«
Milan räusperte sich. Fuhr sich durch die dunkelbraunen, kurzschlafgeformten Haare, die seit Monaten keinen Friseur mehr gesehen hatten.
»Ich will nicht lügen. Ja. Das ist er. Er ist etwa eins fünfundachtzig groß, muskulös – und bewaffnet.«
»Großer Gott.« Sie schluckte hörbar.
»Bitte. Ich weiß, es ist viel verlangt. Aber solange Sie nicht anfangen, die Heldin zu spielen, besteht keine Gefahr. Geben Sie ihm das Geld aus der Kasse und was immer er noch will, vielleicht hat er ja Hunger und braucht Proviant. Wir sorgen dafür, dass Ihnen nichts passiert.«
»Wie das?« Ihre Stimme kiekste. Milan hörte Schritte durchs Telefon. Gummisohlen quietschten. Vermutlich suchte die Kellnerin Schutz hinter der Bar. Hoffentlich. An der Tür, in der direkten Gefahrenzone, konnte er keine Bewegung ausmachen.
Zum Glück.
Sein Funkgerät knackte. Er griff danach, sprach einen kurzen »Abwarten«-Befehl hinein und legte es wieder weg.
»In diesem Moment sind drei Zielfernrohre auf den Restauranteingang gerichtet«, versuchte er, Andra zu beruhigen. »Bei dem geringsten Anzeichen einer Unregelmäßigkeit gebe ich meinen Männern den Einsatzbefehl.«
»Was verstehen Sie unter Unregelmäßigkeit? Eine Kugel im Kopf? Dass mein Gehirn über den Tresen spritzt?«
Milan flüsterte jetzt, nicht, weil es notwendig war, sondern weil er gelernt hatte, dass aufgebrachte Menschen dann konzentrierter zuhörten. »Der Täter tritt jede Minute durch Ihre Eingangstür. Bleiben Sie ruhig, tun Sie, was er sagt. Und flippen Sie jetzt bitte nicht aus, aber er trägt eine schwarze Skimaske.«
»Das ist nicht Ihr Ernst?«
»Sie legen jetzt auf. Er sollte Sie nicht am Telefon sehen. Der Täter ist extrem misstrauisch.«
»Okay«, hörte er Andra sagen, aber es klang nicht überzeugt. Verständlicherweise gefiel es ihr überhaupt nicht, die Verbindung zur Polizei zu kappen.
»Tun Sie einfach, was er sagt. Und sobald er weg ist, warten Sie, bis meine Leute zu Ihnen kommen. Alles wird gut«, versprach Milan ihr ein letztes Mal, dann knackte es, und die Leitung war tot.
Er schloss die Augen.
Alles wird gut?
Milan hatte ein seltsames Gefühl bei der Sache.
Etwas lief hier schief.
Abbruch?
Er sah auf die Uhr. Atmete tief durch. Und beschloss, die innere Stimme zu ignorieren.
Seufzend griff Milan Berg nach der Skimaske auf dem Beifahrersitz und zog sie sich über den Kopf, bevor er ausstieg, um sich auf den Weg zum Diner zu machen.
3.
Die Masche, deretwegen man ihm auf der Straße den Spitznamen »Polizist« verpasst hatte, hatte schon siebenmal funktioniert.
Milan suchte sich Läden mit wenig Personal und möglichst viel Bargeld aus. Cafés, Kneipen, Restaurants, einmal eine Tankstelle. Immer kurz vor Ladenschluss oder Schichtwechsel. Möglichst in Seitenstraßen, fernab vom Trubel.
Es war erstaunlich, wie kooperativ Menschen waren, wenn sie von einer einschüchternd tiefen Stimme am Telefon aufgefordert wurden, einem Räuber anstandslos die Tageseinnahmen zu überlassen. Jede drittklassige Krimiserie lehrte ihre Zuschauer, den Beamten nach dem Ausweis zu fragen. Aber das galt offenbar nur an der Haustür. Am Telefon reichte den meisten eine Vorstellung als »Hauptkommissar Stresow, Sondereinsatzleitung« oder ähnlicher Blödsinn völlig aus. Hin und wieder ließ Milan sein Spielzeugfunkgerät knacken und sprach etwas hinein. Mehr war für eine authentische Kulisse nicht nötig.
Schwieriger war es, den richtigen Moment abzupassen. So wie jetzt, wenn die Läden geschlossen, die Feiertagseinkäufe erledigt und die Straßen verwaist waren, weil man zu Hause das Essen und die Bescherung vorbereitete. Immerhin war Heiligabend, kurz vor sechzehn Uhr.
Von den drei Objekten, die Milan im Internet ausgesucht hatte, war nur dieses Diner in Schmargendorf noch geöffnet, und das wie erhofft mit Sparflammenbesetzung.
Er musste husten, die Skimaske pappte schon nach wenigen Schritten unangenehm feucht auf der Haut.
An diesem Tag, bei diesem Wetter, traf man nicht einmal auf Hundebesitzer, und falls doch, hielten die den Kopf geneigt, um den Matsch nicht frontal ins Gesicht zu bekommen.
Okay, es geht los.
Die dreißig Meter von dem geklauten Wagen bis zum Eingang mit dem obligatorischen Neonlicht-Logo über der Tür hatte Milan ohne Zeugen hinter sich gebracht.
Also dann.
Er betrat das Restaurant. Es war schummrig, bis auf die kleinen Lampen auf den Resopaltischen war nur die Notbeleuchtung eingeschaltet. Ein Mix aus Frittierfett, Burger und Blut schoss ihm in die Nase.
Blut?
Das Knacken jagte ihm erst mit einiger Verzögerung durch den Kopf. Wie der Überschallknall eines Flugzeugs. Dann kam der Schmerz, und ihm wurde bewusst, dass er sich nicht geirrt hatte: Das Diner hatte wirklich einen Schachbrettfußboden. Und darauf kniete er nun – unfähig, sich wieder aufzurichten.
Ich hätte auf mein Bauchgefühl hören sollen.
Ein Tritt in den Magen ließ ihn um die eigene Achse rotieren. Er fiel auf den Rücken, sah erst einen Cadillac-Kühlergrill über sich schweben, den irgendein Innenarchitekt unter der Decke aufgehängt haben musste, dann eine Frau mit leicht gebogener Nase, viel hübscher als sein grober Zinken, der sich gerade mit Blut füllte.
Andra, dachte Milan. Sie sieht wirklich so aus wie eine Frau, mit der ich mich gerne mal treffen würde.
»Frohe Weihnachten, Penner«, sagte sie.
Dann brach sie ihm mit einem Baseballschläger den Schädel.
4.
Wie haben Sie sich kennengelernt?«, fragte die Therapeutin. Vermutlich dachte sie, das vor ihr sitzende Pärchen würde sich gerade lächelnd an einen romantischen Schlüsselmoment erinnern. Ein erster Ansatzpunkt für eine erfolgreiche Paartherapie, zu der sie beide sich kurzfristig angemeldet hatten. Zehn Sitzungen à neunzig Minuten. Zweihundert Euro pro Termin. Ein Schnäppchen, sollte es Dr. Henriette Rosenfels tatsächlich gelingen, ihnen einen Wegweiser durch den Problemdschungel ihrer jungen Beziehung aufzustellen. Oder wenigstens einen Ratschlag zu geben, wie man den Tag überstand, ohne sich den Kopf einzuschlagen.
Wobei, genau so hat es ja angefangen, dachte Milan, und das war der Grund, weshalb auch Andra lächelte.
»Ich hab ihm mit dem Baseballschläger eins übergezogen«, beantwortete sie die Frage der Eheberaterin, und Milan ergänzte: »Es war Liebe auf den ersten Hit.«
Beim ersten Händeschütteln am Eingang der Moabiter Altbaupraxis hatte er noch gedacht, Dr. Rosenfels wäre eine Großkundin der Botoxindustrie. Für eine Frau von achtundfünfzig Jahren hatte die grauhaarige Brillenträgerin eine ungewöhnlich straffe Haut (als hätte sie sich einen Luftballon übers Gesicht gestülpt, war sein erster Gedanke gewesen), doch jetzt lag Rosenfels’ Stirn in Falten.
»Wie darf ich das verstehen?«, fragte sie stirnrunzelnd.
»Andra ist Kellnerin. Vor zwei Jahren wollte ich an Heiligabend ihr Restaurant überfallen. Doch ihr kluger Kopf hatte meine Masche durchschaut.«
»Sie legen jetzt besser auf?«, hatte Andra ihn höhnisch zitiert, als Milan wieder zu sich gekommen war. »Mann, mein Ex war Polizist. Nicht die hellste Kerze auf der Torte, aber selbst der hätte bei einer Geiselnahme die Verbindung zum Opfer gehalten.«
Der ungläubige Blick der Therapeutin wanderte zu Andra, die mit einem »Traurig, aber wahr«-Seufzer Milans Geständnis wortlos bestätigte.
»Ich glaube, ich kann schon jetzt sagen, dass Sie ein wahrlich ungewöhnliches Paar sind.« Dr. Rosenfels lächelte, und Milan musste ihr recht geben. Schon äußerlich passten Andra und er nicht zusammen. Er, der konservativ-unauffällig gekleidete College-Boy mit Sneakers, Jeans und Poloshirt. Sie, drei Jahre älter als er, die ihr Outfit als »Rummel-Gören-Style« beschrieb. Schwarze Biker-Boots, stahlblau gefärbte, schulterlange Haare, knallbunte Leggings, ein Faltenminirock mit Totenkopfmotiven, dazu ein grüner Hoodie mit der Aufschrift: »Jesus liebt dich. Alle anderen halten dich für ein Arschloch.«
Derselbe Hoodie, den sie am Tag ihres Kennenlernens getragen hatte.
Wobei »kennenlernen« eine durchaus euphemistische Umschreibung für »halb totschlagen und bewusstlos in ein Hinterzimmer verschleppen« war.
Laut Dr. Google hatte Andra ihm damals mit der Baseballkeule eine Kalottenfraktur ohne zerebrale Beteiligung zugefügt, auch wenn es sich für ihn eher danach angefühlt hatte, als hätte sie ihm zur Begrüßung die Stirnplatte durchs Gehirn gejagt. Selbst Monate später noch hatte Milan hektische Bewegungen mit tränenden Augen bezahlen müssen, und auch heute wachte er manchmal mit einer Abrissbirne hinter der Stirn auf, einfach nur, weil er in seinen Albträumen den Kopf zu heftig hin- und hergerissen hatte.
Doch immerhin hatte er den Schädelbruch ohne ärztliche Behandlung überlebt. Anders als die Kopfverletzung in seiner Kindheit. Milan war auf Rügen groß geworden. Als Vierzehnjähriger hatte er mehrere Wochen im Krankenhaus verbringen müssen, nachdem er zu Hause die Kellertreppe hinuntergefallen war. Den zweiten Schädelbruch seines Lebens hatte er allein mit Katadolon und Kühlkissen auskuriert. Ein Wunder, wie seine Recherche in diversen medizinischen Foren ihm immer wieder bescheinigte. Aber kein so großes Wunder wie seine Beziehung zu Andra.
Als Milan eine halbe Stunde nach dem missglückten Überfall aufwachte – auf dem Sofa im Büro des Restaurantleiters liegend, mit einem Orchester schief gestimmter Instrumente im Kopf –, hatte er damit gerechnet, dass Andra das zu Ende bringen würde, womit sie angefangen hatte. Erst eine Woche zuvor hatten die Medien über einen Späti-Besitzer berichtet, der im Prenzlauer Berg einen Ladendieb totgeprügelt hatte, stellvertretend für all die anderen Halunken, die ihm all die Jahre durch die Lappen gegangen waren. Doch die überraschend zierlich gebaute Frau mit dem Engelsgesicht krümmte ihm kein weiteres Haar mehr. Auch rief sie nicht die Polizei. Andra tat etwas, womit Milan im Leben nicht gerechnet hatte: Sie machte ihm ein Jobangebot.
»Was für eine Verschwendung. Ein hübscher Kerl wie du mit so einer kreativen Intelligenz. Wieso machst du so einen Scheiß und hast keinen normalen Beruf?«
Es verging kein Tag, an dem er sich nicht mehrmals an ihre ersten Worte erinnerte. Und an die Antwort, die er ihr bis heute schuldig geblieben war: »Ich bin Analphabet. Ich kann nicht lesen und nicht schreiben. Hab es nie gelernt, so wie Millionen andere Menschen in Deutschland.«
»Manchmal denke ich, Milan ist eine gespaltene Persönlichkeit«, sagte Andra, die noch immer keine Ahnung hatte. So sehr schämte sich Milan für das, was ihn von all seinen Mitmenschen unterschied.
»Ich meine, er hat mir von seinem Vater erzählt, für dessen Betreuung er sich verantwortlich fühlt. Und von den Schulden, die er hat. Das war wohl auch der Grund, weshalb Milan mit allen Mitteln versucht hat, an Kohle zu kommen.«
»Weswegen Sie kriminell wurden?«, hakte Dr. Rosenfels bei ihm nach.
Andra nickte für Milan. Der eigentliche Grund für seine Karriere als Trickbetrüger war, dass Analphabetismus in Deutschland nicht als Behinderung galt, weswegen er kein Anrecht auf Versorgungsleistungen hatte. Doch für den eigenen Lebensunterhalt konnte er selbst nur sehr schlecht sorgen. Als Mann mit zwei linken Händen kamen rein körperliche Tätigkeiten für ihn kaum infrage. Und von geistiger Arbeit, für die sein hochintelligenter Kopf geradezu geschaffen war, hatte die Gesellschaft ihn ausgeschlossen.
Irgendwann hatte Milan keine Lust mehr, selbst am Hartz-IV-Formular zu scheitern, und versuchte, seine intellektuellen Fähigkeiten für den einzigen Beruf zu verwenden, der keine Zulassungsprüfung verlangte und in dem man dennoch über Mindestlohn bezahlt wurde: der Beruf des Kriminellen.
»Die Geschichte von seinem verarmten Vater hat natürlich direkt an mein Helfersyndrom angedockt«, sagte Andra. »Außerdem tat es mir leid, ihn so grob behandelt zu haben. Ich war aufgeregt und hatte Angst.«
»Weswegen sie dann aus Mitleid mit mir geschlafen hat.«
»Arschloch«, fauchte Andra ihn an. »Das war ein halbes Jahr später, und ich hatte mich in dich verliebt.«
Hatte.
»Sie arbeiten jetzt zusammen?«, fragte die Therapeutin.
»Ja, im selben Diner, in dem sie versucht hat, mich zu töten.«
»In dem du versucht hast, mich auszurauben.«
Milan sah zu Dr. Rosenfels. »Wieso hat sie den Überfall verschwiegen und sich sogar bei Hulk für mich eingesetzt, wenn nicht aus Mitleid?«
»Hulk?«
»Der Geschäftsführer. Eigentlich Harald. Wir nennen ihn so, weil er am liebsten Grün trägt.«
»Du nennst ihn so, weil du es lustig findest, ein Fünfzig-Kilo-Fliegengewicht Hulk zu nennen«, korrigierte ihn Andra und schüttelte den Kopf. »Ich werde nicht schlau aus dir, Milan. Ich meine, du bist ein Kopfrechengenie, ich kenne keinen, der sich eine Bestellung von über zwanzig Leuten ohne eine einzige Notiz merken kann und nie etwas vergisst. Du bist künstlerisch unglaublich begabt, Sie müssten mal die Zeichnungen sehen, die er von den Gästen macht. Er hat ein fotografisches Gedächtnis, ehrlich. Und dann kellnert er?«
»Moment, ich bin verwirrt«, sagte Dr. Rosenfels. »Ich dachte, Sie wollten, dass er mit Ihnen zusammen in dem Diner arbeitet?«
»Klar, kurzfristig«, sagte Andra. »Aber doch nicht bis zur Rente. Ich meine, ich hab mit Ach und Krach meinen Hauptschulabschluss geschafft. Milan dagegen steht alles offen. Doch er will sich gar nicht verwirklichen. Er hat keine Pläne, keine Ziele. Und er ist erst achtundzwanzig!«
Und buchstabenbehindert, dachte Milan.
Selbst Andras dreizehnjährige Tochter Louisa kam besser in der realen Welt zurecht, in der Analphabeten Menschen vierter Klasse waren. Ohne Schulabschluss, ohne Ausbildung, ohne Führerschein. Louisa hatte schon in der ersten Klasse die Straßenschilder lesen können, für Milan wurde ein einfacher Wochenendeinkauf zum Horrortrip.
»Schatz, hier ist mein Einkaufszettel, kannst du das erledigen?«
»Na klar. Nur eine Frage: Was bedeutet Χοζα Χολα? Ist das die braune, bauchige Flasche mit dem weißen Schnörkelschriftzug auf rotem Untergrund?«
In Deutschland lebten über sechs Millionen funktionale Analphabeten. Menschen, die in der Schule gerade mal so viele Sätze zu erkennen gelernt hatten, dass sie sich durchs Leben mogeln konnten.
Bei Milan war es noch schlimmer. Sicher, er war zur Schule gegangen, hatte das Alphabet gelernt, und es gab sogar einzelne Wörter und Ziffern, die er wiedererkannte. Aber er hatte nie ein Diktat geschrieben oder gar einen Aufsatz. Hatte immer kurz davor randaliert, krank gespielt oder sich die Hand verletzt, um sich zu drücken. Mit der Folge, dass er die Digitaluhr lesen, die Rechnung in die Kasse bongen und seinen eigenen Namen wiedererkennen konnte. Aber er konnte keinen Kinderbuchsatz entschlüsseln, wenn er ihm nicht vorgelesen wurde.
»Also sind es seine mangelnden Ambitionen, die Sie hierhergeführt haben?«, fragte die Therapeutin mit Blick auf die Uhr. Es waren erst zwanzig Minuten vorbei. Milan kam es vor wie eine Ewigkeit.
»Nein.«
Wenn Andra nervös war, fummelte sie unbewusst an ihrem winzigen Nasenring. »Er verheimlicht mir etwas.« Sie hob abwehrend die Hand. »Und das ist keine andere Frau, das wäre nicht mein Problem. Ich kann Sex und Liebe trennen.«
Diese Aussage schien Dr. Rosenfels weitaus weniger zu verblüffen als Milan, der das so von ihr noch nie gehört hatte.
»Jetzt schau nicht wie ein Bus. Ihr Männer seid für die Monogamie so geschaffen wie der BER zum Fliegen. Theoretisch denkbar, praktisch wird es damit nichts.«
Die Therapeutin räusperte sich. »Das ist bestimmt ein spannendes Thema, aber darf ich noch mal auf die Heimlichtuerei zurückkommen?«
»Ich verheimliche nichts«, log Milan.
Einmal hätte er es ihr fast gesagt. Als sie an ihrem Jahrestag im 893 in der Kantstraße saßen und Andra ihn bat, etwas für sie von der exotischen Speisekarte auszusuchen. Und diesmal wollte er nicht wieder seine Standard-Brillen-Notlüge benutzen. Hin und wieder trug Milan eine hässliche, klobige Fensterglasbrille, um diese immer dann »vergessen« zu können, wenn man ihn voraussichtlich mit Geschriebenem konfrontierte. »Sorry, mit meinen schlechten Augen kann ich das gerade leider nicht entziffern.«
Doch an jenem Abend hatte er sich nicht herausreden wollen. Er hatte ihr die Wahrheit gestehen wollen.
Noch während Milan all seinen Mut zusammenkratzte, begann Andra, ihm von dem unsympathischen Macho zu erzählen, den sie tags zuvor hatte bedienen müssen und der sie angebaggert hatte. »Und dabei hat er sich als kompletter Idiot geoutet. Der Kerl hat mich tatsächlich gefragt, ob mein Parfum von Beh Fau El Gari ist.«
»Was soll das sein?«
»Ich hab es auch nicht sofort gecheckt. Aber er meinte Bulgari! Der Schwachkopf hatte einfach die Buchstaben des Logos abgelesen: BVLGARI.«
Ein kompletter Idiot also, hatte Milan gedacht und gezwungen mitgelacht. Ein Schwachkopf. Und selbst der Schwachkopf kann noch besser lesen als ich.
An diesem Tag hatte Milan sich weder geoutet noch etwas gegessen, von der »Notfallpille« einmal abgesehen. Penicillin, fünfhundert Milligramm. Milan war hochallergisch, nicht einmal zwei Minuten nach der Einnahme bekam er kaum noch Luft. Weswegen er immer eine Tablette in der Hosentasche trug. Er hatte einmal von einer Analphabetin gehört, die auf einer Hochzeit gebeten worden war, spontan einen Trauspruch vorzulesen. Um sich nicht vor versammelter Mannschaft outen zu müssen, war sie kurz aufs Klo gegangen, hatte die Hand in die Tür gesteckt und zugeschlagen. Milan musste sich nicht alle Finger brechen. Ihm hatte an jenem Tag ein anaphylaktischer Schock gereicht, um nicht aufzufliegen.
»Er führt ein mentales Doppelleben«, sagte Andra und sah die Therapeutin an. »Ich kann es nicht erklären. Aber in der Öffentlichkeit, mit Freunden, wenn wir unterwegs sind, da kann Milans Stimmung von einer Sekunde auf die andere kippen. Dann wird er nervös, unsicher. Das kann aus heiterem Himmel passieren. Beim U-Bahn-Fahren oder in der Schlange vorm Kino.«
Oder während der Paartherapie.
»Dann flüchtet er. Buchstäblich. Er lässt mich allein, versucht das Problem, was immer es auch ist, mit sich selbst auszumachen. Und das ertrage ich nicht mehr. Ich liebe ihn, Gott weiß, warum, aber wenn er das nächste Mal aufsteht und geht, bin ich weg.«
Die Therapeutin nickte vielsagend, dann fragte sie Milan. »Was denken Sie?«
Dass sie recht hat. Ich lüge sie an. Morgens, mittags, abends.
So wie jeden Menschen in meinem Umfeld. Doch ich kann damit nicht aufhören. Denn wann immer ich mich jemandem anvertraut habe, hat derjenige mich ausgelacht, mir den Job gekündigt oder mich verlassen.
»Sie sieht Gespenster«, widersprach er Andra halbherzig.
»Nun denn.« Ein erneuter Blick auf die Uhr, dann reichte die Therapeutin ihnen jeweils ein weißes Blatt Papier. Milan nahm es mit einem Kloß im Hals entgegen, auch wenn ein leeres Blatt weitaus weniger bedrohlich war als ein beschriebenes.
Während der folgenden Sätze der Therapeutin schwoll der Kloß auf Medizinballgröße an.
»Ich möchte, dass Sie die folgenden zehn Minuten nutzen, um für mich aufzuschreiben, was für Ihre Beziehung die absolut nicht verhandelbare Basis ist.«
Schreiben?
Sein Puls zog an. Ihm brach der Schweiß aus.
»Welche Werte sind für Sie wichtig? Was tun Sie dem Partner zuliebe? Und wo lassen Sie auf gar keinen Fall mit sich reden?«
Milan wurde schlecht. Er wollte sich übergeben. Oder noch besser, ohnmächtig werden. Fast schon reflexartig wanderte seine Hand zur Notfallpille in seiner Hosentasche.
5.
Das war’s dann wohl.«
»Vermutlich.«
Milan trat in den dichten Novembernebel, der am Morgen schon für Unfälle in den Berliner Randbezirken gesorgt und nun die Innenstadt erreicht hatte. Der Frost pausierte bis zur Nacht, dafür stiegen Schwaden vom Landwehrkanal über die Gotzkowskybrücke. Obwohl man keine zwanzig Meter weit blicken konnte, sah Milan so klar wie selten zuvor in seinem Leben: Es war vorbei mit ihm und Andra. Die Lebenslüge, die sie zusammengeführt hatte, brachte sie letztlich auch wieder auseinander.
»Hab ich das richtig verstanden? Du bist einfach aufgestanden und mit wehenden Fahnen aus der Paartherapie marschiert?«
»Ja, Papa.«
Milan bat Kurt, einen Moment am Apparat zu bleiben, während er sich Kopfhörer in die Ohren stöpselte. So hatte er die Hände frei, um mit kalten Fingern sein Fahrrad von dem Brückengeländer zu lösen, an dem er es nachlässig angelehnt hatte. Andras Wagen war beim Reifenwechsel, und er hatte vorgeschlagen, mit dem Taxi zur Therapie zu fahren, aber ebenso gut hätte er vorschlagen können, ein Spaceshuttle zu benutzen. Andra hasste Taxis und weigerte sich, sie zu benutzen. Weswegen sie beide das Rad genommen hatten. Ihr neues Rennrad war mit mehreren Schlössern gesichert, sein Flohmarkt-Esel hingegen so klapprig, dass kein Fahrraddieb sich daran die Finger schmutzig machen würde. Eher nahm die Müllabfuhr es irgendwann versehentlich mit.
»Dann hättest du Andra auch dein Geheimnis gestehen können. Hätte denselben Effekt gehabt.«
»Sagt mir der Mann, der Mama verschwieg, dass er die Rolling Stones eigentlich gar nicht leiden kann.«
Sein Vater seufzte schwer. Die vom Raucherhusten gegerbte Stimme wurde theatralisch. »Ja, und glaube mir, ich habe bitter dafür bezahlt. Zu Hause, im Auto, monatelang immer dieselben Lieder. Sogar ein Konzert musste ich über mich ergehen lassen. Mick Jaggers Gejaule in der Waldbühne verfolgt mich noch heute, nach dem Tod deiner wundervollen Mutter, bis in meine Albträume«, witzelte er. »Das Einzige, was diesen Schlauchbootlippenkasper für mich halbwegs erträglich machte, war, wenn Jutta mir dabei den Reißverschluss öffnete und …«
»Papa!«
»… und ich bequem meine Jacke ausziehen konnte. Was hast du denn gedacht, mein Junge? Du hast wirklich eine kranke Fantasie.« Das dröhnende Lachen seines Vaters hallte durchs Telefon wie früher über die Krankenhausgänge. Andere Hausmeister ärgerten sich vermutlich über defekte Schließanlagen, von Patienten achtlos abgerissene Schranktüren oder verstopfte Toiletten. Kurt »Kurtchen« Berg hingegen konnte den meisten Problemen, zu deren Beseitigung er gerufen wurde, eine komische Seite abgewinnen. Das war damals in der Inselklinik auf Rügen schon so gewesen, und auch später, nach dem Umzug nach Berlin, im Unfallkrankenhaus Marzahn. Wobei Kurtchens Hang, über alles und jeden Witze zu reißen, Milans Mutter oft hochnotpeinlich gewesen war. Legendär war seine Bemerkung auf der Beerdigung seines Schwiegervaters. Der Krankenpfleger hatte lange in der Kardiologie gearbeitet und sich für seine Bestattung eine Urne in Herzform gewünscht, was Kurtchen zu der Bemerkung verleitete, man könne froh sein, dass Schwiegerpapa nicht in der Gynäkologie tätig gewesen sei.
Milan radelte über den Bürgersteig auf die Straße und hielt im für Radfahrer markierten Fahrbahnbereich direkt vor der Ampel Franklin-, Ecke Helmholtzstraße.
»Du hast zwölf Monate gebraucht, bis du ihr die Wahrheit gestanden hast.«
»Eigentlich hat deine Mutter mich nur dabei erwischt, wie ich im Reflex das Küchenradio ausgestellt habe, als der Gröldackel loslegte. Ich dachte, sie wär noch beim Einkaufen. Mann, war die sauer, als ich reinen Tisch machte. Für sie war das so, als hätte ich sie mit ihrer besten Freundin betrogen.«
»Tja, hättest du Mama beim ersten Date die Wahrheit gesagt …«
»… hätte ich deine Mutter nie rumgekriegt. Jutta wäre nie mit einem Pilzkopffan ausgegangen. Aber bei dir geht es nicht um so was Banales wie Beatles oder Krach, Milan. Es geht um dich, Junge. Um dein Leben. Um das, was dich ausmacht und so belastet wie nichts anderes auf der Welt.«
»Eben. Und das macht meine Anfangslüge noch schlimmer.«
Wenn ein normaler Mensch sich schon hintergangen fühlte, wenn man ihn monatelang wegen seines Musikgeschmacks anlog, wie musste Andra sich dann erst fühlen, wenn er ihr so etwas Grundlegendes wie seinen Analphabetismus verheimlichte? Zumal sie im Grunde so empathisch war, dass er von ihr sicher keine Häme zu erwarten hätte. Doch er hatte den Moment verpasst, sich zu outen, und mit der Zeit war die Scham, die ihn sein Leben lang begleitete und sich wie ein Tattoo auf Dauer in seinem Gemüt festgesetzt hatte, auch Andra gegenüber immer größer geworden.
Trotz des Verkehrslärms konnte er über die Handy-Kopfhörer hören, wie sein Vater sich eine Zigarette anzündete.
»Rauchen ist auf den Zimmern verboten.«
»Klugscheißern auch. Ich steh auf dem Balkon und schau von hier oben der neuen Pflegerin in den Ausschnitt. Eine Aussicht, die du dir bei Andra wohl auf Dauer verbaut hast.«
Sein Vater lachte gequält und erkannte selbst, dass der Witz nicht den gewünschten Erfolg hatte. »Tut mir leid. Ich wollte dich nur aufmuntern.«
»Hat nicht funktioniert.« Milan blies sich etwas warme Atemluft in die Hände.
»Okay, wie wär’s mit dem hier. Ich überlege, ob ich eine Kontaktanzeige schalte. Text: Wir suchen dringend jemanden für einen Dreier. Wir sind ein Mann und suchen zwei Frauen.«
Der Abbiegepfeil leuchtete auf, und das Auto, das neben Milan gestanden hatte, bog nach links in die Franklinstraße. Milan, der geradeaus musste, blieb stehen, den kalten Wind, der merkwürdigerweise den Nebel nicht vertreiben wollte, in den tränenden Augen.
»Sehr lustig, Papa.«
»Ich weiß. Hör mal, wieso kommst du nicht zu mir, und wir quatschen mal wieder bei einem kühlen Blonden. Bei mir im Heim …«
»… ist Alkohol tabu, und ich muss jetzt zur Arbeit, tut mir leid.«
»Wollt’s ja nur angeboten haben. Übrigens hat sich heute Vormittag ein Mann nach dir erkundigt.«
Milan blinzelte. Er spürte ein Zwicken im Bauch. »Wer?«
Von hinten nutzten weitere Fahrzeuge die Abbiegespur, obwohl die Pfeilampel schon gelb blinkte.
»Keine Ahnung. Er wollte seinen Namen nicht sagen. Ich hab ihn auch nicht gesehen. Er hat sich von der Rezeption mit mir verbinden lassen. Die Stimme kam mir bekannt vor, ein alter Knacker, irgendwie komisch, er …«
»Was wollte er?« Das Magenzwicken wurde schmerzhaft.
»Deine Handynummer, einen Kontakt. Ich hab sie ihm nicht gegeben, doch …«
In diesem Moment hielt der Nachrücker an der jetzt wieder roten Abbiegeampel, und von da an war an eine Fortsetzung des Gesprächs mit seinem Vater nicht mehr zu denken. Auch das unangenehme Gefühl in der Magengegend war in den Hintergrund gerückt. Das Auto neben ihm beanspruchte Milans volle Aufmerksamkeit.
Er wusste selbst nicht, ob er zufällig zur Seite geblickt hatte oder weil es ein unvermeidlicher Reflex war. Die grüne Volvo-Limousine war sehr dicht an ihn herangefahren und stand mit zwei Reifen auf der Markierung seines Fahrradwegs. Milans Blick war sogleich ins Innere des Fahrzeugs gefallen. Und das, was er darin sah, sollte sein Leben für immer verändern.
6.
Im ersten Moment dachte er, ein kleines Kind würde auf dem Rücksitz herumspielen und zum Spaß einen Werbezettel an die Scheibe pressen.
Doch als sich der Zettel für einen kurzen Augenblick löste und der Kopf dahinter zu sehen war, wurde Milan klar, dass da kein Kleinkind saß, sondern ein Mädchen, das bitterlich weinte.
Was zum Teufel …?
Ihr Gesicht war angstverzerrt. Die großen Augen waren so aufgequollen wie Milans eigene, wenn er Heuschnupfen hatte oder zu wenig Schlaf bekam. Kakifarben, dachte er, war sich aber nicht sicher, ob diese besondere Färbung ihrer Iris an der Tönung der Scheibe lag, hinter der das Mädchen weinte. Sie hatte weizenblonde Haare, zum Pferdeschwanz gebunden. Eine pinkfarbene Spange mit funkelnden Strasssteinen hielt den Pony aus der Stirn, die für einen so jungen Menschen schon viel zu viele Sorgenfalten aufwies.
Die Kleine war höchstens dreizehn, doch in dem Moment, in dem sich ihre Blicke kreuzten, hatte er den Eindruck, dass ihre Augen genug für ein ganzes Leben gesehen hatten. Und da war noch etwas, was er in ihnen erkannte.
Sich selbst.
In einer Fernsehdokumentation hatte er einmal von der psychologischen Theorie gehört, nach der Menschen immer dann Zuneigung füreinander empfinden, wenn sie in der Kindheit ähnliche seelische Verletzungen erleiden mussten.
Ein solches Zusammengehörigkeitsgefühl, ein gemeinsames Band, gewebt aus psychischen Grausamkeiten, spürte Milan beim Anblick der Kleinen, was extrem verstörend war, konnte er sich doch an keine seelische Verletzung erinnern, die ihm in jungen Jahren absichtlich zugefügt worden wäre.
Die Lippen des Mädchens bewegten sich nicht. Es war ein stummes Flehen. Das, was sie angstvoll in die Welt hinausschreien wollte, hatte sie offenbar auf den linierten Zettel geschrieben, den sie nun wieder gegen die Scheibe drückte. Eine in der Mitte gefaltete DIN-A4-Seite, wie hastig aus einem Schülerblock herausgerissen.
Ein Hilferuf?
Milan schossen Tränen in die Augen.
»Ich bin Analphabet«, flüsterte er dem Mädchen die Worte zu, die er Andra schuldig geblieben war. Er hätte diese Worte auch laut gesagt, sie geschrien, wenn er eine Chance gesehen hätte, dass die Kleine ihn verstehen würde – bei geschlossenen Fenstern im Verkehrslärm. Denn aus jenem logisch nicht erklärbaren Gefühl der Verbundenheit heraus vertraute er ihr.
Es zerriss ihm das Herz. Sie brauchte Hilfe, und die konnte er ihr nicht geben. Er verstand ihre Not, aber nicht, was sie ihm mitteilen wollte.
Ηιλφ μιρ.
δασ σινδ νιχτ ϻεινε Ελτερν
Vor Milans Augen taten die Buchstaben auf dem Zettel das, was sie immer taten, wenn er Wörter betrachtete: Sie formten sich zu unlösbaren Zeichenrätseln. Bildeten sinnlose Hieroglyphen.
Er sah nach vorne, zu Fahrer und Beifahrer; etwas, was er früher hätte tun sollen, denn nun fuhr der Volvo an, wechselte die Spur und schoss Richtung City die Helmholtzstraße hoch.
Ein schwarzhaariger Mann am Steuer, eine Blondine auf dem Beifahrersitz.
Zu spät kam Milan in den Sinn, sich das Nummernschild einzuprägen. Es im Album seines fotografischen Gedächtnisses abzuheften. Stattdessen beschäftigte ihn die Frage, ob er sich nicht geirrt und einen langhaarigen männlichen Beifahrer gesehen hatte, und noch bevor ihm bewusst wurde, dass er einen miserablen Zeugen abgeben würde, verschwammen die Rücklichter im Nebel.
Würfel am Rückspiegel.
Das war das Einzige, was sich ihm einprägte. Angeblich ein Zeichen, dass der Fahrer ein »Player« war und sich gerne auf Wettrennen einließ.
Und Kinder entführte?
Milan stieg auf sein Fahrrad, trat in die Pedale; sah, wie der Fahrer an der nächsten Ecke den Blinker setzte. Dann bog der Volvo nach links, und in der nächsten Sekunde hatte die neblige Hauptstadt den klobigen grünen Wagen mit dem verzweifelten Mädchen auf der Rückbank verschluckt.
7.
Dein Vater hatte recht. Du bist ein Weichei. Warum hast du es deiner Schlampe, dieser Andra, nicht einfach gesagt?«
Milan zögerte mit der Antwort, war noch völlig in jenem schicksalhaften Moment in der Vergangenheit verfangen. Die Kälte, die ihm von den Bodenfliesen der alten Gefängniswäscherei in die Knochen kroch, verstärkte die Erinnerung an den nasskalten Wintermittag auf der Gotzkowskybrücke. Da half das klamme Laken, das Zeus ihm in einem Anflug unerwarteter Milde gegeben hatte, auch nicht viel. Es bedeckte gerade mal seinen Oberkörper und war längst rot verfärbt.
»Sie haben keine Ahnung«, murmelte er.
Ein Erwachsener, der nicht lesen und schreiben kann?
Das gesamte Leben wurde durch ein einziges Wort definiert: Stress. Stress am Fahrkartenautomaten, wenn hinter einem ungeduldig mit der Zunge geschnalzt wurde, während vor einem die Buchstaben und Zahlen wild durcheinandertanzten.
Stress in der Behörde, wenn man den Sachbearbeiter bat, das Formular mit nach Hause nehmen zu dürfen, um es in Ruhe ausfüllen zu können. Stress allein beim Anblick von Buchhandlungen und Bibliotheken, die man mied wie ein Dealer die Polizeiwache. Zwar hatte Milan von Betroffenen gehört, denen eine Stigmatisierung erspart geblieben war, als sie sich endlich trauten, sich als Analphabeten zu outen. Doch er hatte Pech gehabt und war wie ein Aussätziger behandelt worden, als er beim Bewerbungsgespräch für einen hirnlosen Fabrikjob nicht einmal die richtige Tür gefunden hatte.
»Sind Sie bekloppt, junger Mann? Was stimmt denn nicht mit Ihnen?«
Um sich dem nicht weiter auszusetzen, war er ein Meister der Täuschung geworden. Hatte bereits in der Schule die Hörbuchfassungen der Deutschlektüre auswendig gelernt, um beim Vorlesen nicht aufzufliegen. In der Schraubenfabrik hatte er von über zehntausend Produkten die Lagernummer im Kopf gehabt, die sein Vater mit ihm anhand eines telefonbuchdicken Katalogs einstudiert hatte, und im Diner zeichnete er die Gäste an den jeweiligen Tischen, um sich ihre Bestellungen zu merken. Doch wie sehr er sich auch bemühte, sein Leben schien in einer Sackgasse zu stecken. Seit seinem Umzug von Rügen nach Berlin, als er all seine Freunde zurücklassen musste und in der anonymen Großstadt kaum mehr Anschluss fand, lebte er in der permanenten Angst, geoutet zu werden.
»Wieso hast du es nie gelernt?«, wollte Zeus wissen. Er lehnte sich in seinem Stuhl zurück, den ihm seine Männer gebracht hatten, bevor sie die Tür schlossen. Hinter der sie vermutlich auf weitere Befehle warteten, sobald ihr Anführer mit der Befragung des Neuen durch war.
»Wieso bist du kein Opernsänger? Ich hab mir meine Talente nicht ausgesucht.«
Milans Stimme hatte einen eigenartigen Nachhall in dem fensterlosen, weiß getünchten Raum, in dem es nach Waschpulver und Scheuermittel stank.
Und nach Kotze.
Schon nach den ersten Sätzen hatte er sich übergeben müssen, und Zeus hatte ihn gezwungen, die Sauerei mit einem Lappen aufzuwischen, bevor er weitersprechen durfte.
»Und du kannst überhaupt nichts entziffern? Nicht mal das, was auf meinem T-Shirt steht?«
Zeus zog ein himmelblaues Shirt mit weißem Schriftzug von seinem dünnen Oberkörper weg.
Milan schüttelte den Kopf.
Das unterschied ihn von den meisten funktionalen Analphabeten, die zumindest die Bedeutung einzelner Wörter und oft sogar Sätze begriffen, auch wenn sie für die Entschlüsselung der Wortbilder unendlich viel Zeit brauchten. Er hingegen litt unter Alexie, dem vollständigen Unvermögen, etwas lesen zu können, obwohl sein Sehvermögen uneingeschränkt funktionierte.
»Kein einziges Wort?«
»Nein.«
Zeus seufzte und sah auf seine Armbanduhr. »Nun, ich bin froh, dass du nicht mit diesem sentimentalen Rührstück deine Geschichte angefangen hast. Kommen wir zurück zum Thema. Was war mit dem Volvo?«
Milan blinzelte. Es bedurfte nur der Erwähnung der Automarke, und die Erinnerung an das leidende Mädchen mit dem mysteriösen Zettel war wieder präsent.
»Ich hab versucht, mir einzureden, dass da nichts gewesen ist. Ich meine, was hatte ich schon gesehen? Einen Zettel und ein weinendes Mädchen, das konnte alles und nichts bedeuten.«
»Es kommt im Leben selten darauf an, was die Augen sehen«, sagte Zeus mit seltsam nachdenklichem Gesichtsausdruck, und Milan fragte sich, ob ihm bewusst war, dass er damit den Kleinen Prinzen zitierte mit dessen Spruch, man sehe nur mit dem Herzen gut. Aus diesem Buch hatte seine Mutter ihm vorgelesen. Und tatsächlich hatte sein Herz an jenem Tag auf der Brücke die Führung übernommen, als er sich, seiner Intuition folgend, wieder auf den Sattel schwang.
»Ich hab die Verfolgung aufgenommen«, sagte Milan und fühlte sich in diesem Moment genauso erschöpft und durchgefroren wie damals. Er konnte förmlich wieder den Wind spüren, der sich gegen ihn stemmte, als er dem Wagen hinterherzuradeln versuchte. Ein schneidender, eisiger Wind, der seine Haare nach hinten drückte und an den Klamotten zerrte, je schneller er wurde. Ohne auf Ampeln und andere Verkehrsteilnehmer zu achten, schoss er quer über die Straße, über den Bürgersteig hinweg auf das Volkswagen-Gelände zu. Er hoffte, dass der riesige Verkaufs- und Wartungskomplex, der sich über einen gesamten Straßenblock erstreckte, auch eine Ausfahrt in die Gutenbergstraße hatte, in der der Volvo um die Ecke verschwunden war. Und tatsächlich wurde sein Mut zur Abkürzung belohnt.
Einem rücksichtslos parkenden Umzugswagen verdankte Milan eine zweite Chance. Die Limousine hatte sich gerade in Gletschergeschwindigkeit durch das Nadelöhr gezwängt, das der Lkw zur Durchfahrt gelassen hatte, und nahm nun Kurs Richtung Salzufer. Von dort ging es weiter zur Straße des 17. Juni. Immer wieder verschwand der Wagen zwischen Bussen und Lastern, hinter Ampeln oder im Kreisverkehr. Und immer wieder blitzten die Rücklichter erneut im Nebel vor ihm auf, wobei das alltägliche Berliner Verkehrschaos rund um das Regierungsviertel Milan in die Karten spielte.
Die Verfolgungsjagd endete in der Nähe des Botschaftsviertels, unweit des Hotels Interconti, einer beliebten Wohn- und Ausflugsgegend mit Townhouses und Wohnungen, die sich Normalsterbliche kaum leisten konnten.
Milan hatte durch den Tiergarten abgekürzt und dadurch den Volvo auf den letzten Metern erneut aus den Augen verloren. Ziellos fuhr er nun die Straßen rund um das Café am Neuen See ab. Er wollte schon aufgeben und sich auf den Weg zur Nachmittagsschicht im Diner machen, da wäre er in der Rauchstraße beinahe in die Familie hineingerauscht.
»Familie?«, fragte Zeus, dem Milan den kurzen Abriss seiner Aufholjagd gegeben hatte.
»Ja.«