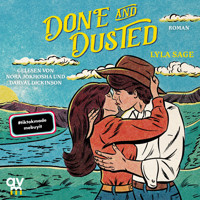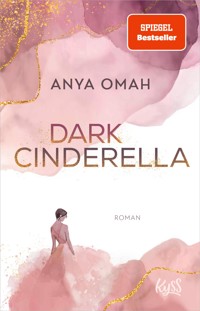15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein sommerlicher Großstadtroman zwischen Platte und Glamour von Sara Gmuer – »Hart und rau und schön.« (Mareike Fallwickl)
»Unerfüllte Träume sind auch Träume. Sie sind bloß viel gefährlicher.« – Wanda hat sich ihr Leben anders vorgestellt. Ganz anders. Statt auf Filmdrehs und Premieren verbringt sie die heißen Sommertage im Hof einer Berliner Platte, wo sie mit ihrer fünfjährigen Tochter Karlie im achtzehnten Stock wohnt. Der Lift ist defekt und das Treppenhaus ein einziges Funkloch, in dem man, wenn man Pech hat, das ganze Leben verpasst. Am anderen Ende der Stadt scheint dagegen alles möglich. Als Wanda eine einmalige Chance bekommt, taucht sie ein in eine Welt, in der Geld keine Rolle spielt und Türen immer offenstehen. Doch wie weit sie auch geht, die Platte in ihrem Rücken wird nie wirklich kleiner.
Ein rauer und zärtlicher, temporeicher und fein beobachteter Roman über Zusammenhalt und Selbstverwirklichung und darüber, dass das Glück manchmal näherliegt, als wir denken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 266
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über das Buch
Wanda, Anfang 30, wohnt mit ihrer fünfjährigen Tochter Karlie im achtzehnten Stock einer Berliner Platte. Der Lift ist defekt und das Treppenhaus ein einziges Funkloch, in dem man, wenn man Pech hat, das ganze Leben verpasst, und Wanda weiß nur eins: Sie muss hier raus.Von den anderen Müttern im Hochhaus belächelt, hangelt sie sich von Casting zu Casting, um ihren Traum von der Schauspielerei zu verwirklichen, und ergattert schließlich tatsächlich eine begehrte Rolle. Doch der Weg in ein neues Leben ist steinig, und Wanda muss sich entscheiden, wie viel sie sich und ihrer Tochter zumutet und was ein Zuhause eigentlich ausmacht.Ein temporeicher, fein beobachteter Roman, der mit einem ganz eigenen, frischen Sound aufwartet und von der ersten Seite an in den Bann zieht.
Sara Gmuer
Achtzehnter Stock
Roman
hanserblau
Für Ava & Gian
Das Haus schwankt. Der Beton bewegt sich im Wind wie die Krone einer Pappel. Das Hochhaus taumelt bei jedem Windstoß, als wäre es besoffen. Ich wohne im achtzehnten Stock. Unten vertrocknen die Bäume am Straßenrand. Jeden Tag ein neuer Hitzerekord, als gäbe es etwas zu gewinnen. Der Straßenbelag schmilzt unter der sengenden Sonne, Reifenabdrücke und ausgefahrene Spuren ziehen sich wie Muster über die Frankfurter Allee, der Teer bleibt wie Kaugummi an den Reifen kleben, und die Hunde der Obdachlosen verbrennen sich die Pfoten am Asphalt.
Die Wohnung läuft über meinen Onkel, eine asbestgraue Zweizimmerwohnung mit faserigem Schimmelpilz unter dem Waschbecken, aber er denkt, er habe hier ein Kronjuwel, und erzählt seinen Freunden in Krakau von seiner Zweitwohnung in Berlin mit Aussicht auf den Fernsehturm. Der Hausnazi im sechsten Stock hat sich die Fenster mit Deutschlandflaggen zugehängt. Er hat wie alle hier einen alten Mietvertrag und sich wie Ungeziefer eingenistet, man kriegt ihn nicht mehr raus. Der Lift ist entweder defekt oder voller Sperrmüll. Die Leute stellen alte Röhrenfernseher und durchgebumste Matratzen rein, zu verschenken, und hoffen, dass irgendjemand den Müll aus dem Fahrstuhl in die Wohnung zieht.
Karlie hat Schnupfen. Kranke Kinder sind pflegeleicht wie eine Katze. Sie sind warm und weich und schlafen den ganzen Tag, die schreien nicht herum und machen nichts kaputt. Aylins Mama bringt Hühnerbrühe vorbei. Hühnchen sei kein Fleisch, sagt sie, dabei hat sie selbst das Blut abgewaschen und das Fleisch vom Knochen gelöst, aber am Ende, wenn die Küche in schwülen Dampf getaucht ist, dass es bis ins Treppenhaus riecht und einem das Wasser im Mund zusammenläuft, erinnert nichts mehr an die gebrochenen Flügel und Beine, die Druckstellen und die Blutergüsse. Dann ist es kein Tier mehr, dann ist es nicht mal mehr Fleisch. Karlie rührt die Brühe nicht an. Die Luft ist stickig und die Vorhänge zugezogen wegen der Mittagshitze, die sich über den ganzen Tag zieht. Ich hätte heute ein Casting, aber man kann ein fünfjähriges Kind nicht allein zu Hause lassen, nicht mal, wenn es die ganze Zeit schläft, und ich will auch nicht ständig Aylins Mama fragen, ob sie auf Karlie aufpassen kann. Sie verdreht jedes Mal die Augen, wenn ich Casting sage. Sie sagt, ich solle besser mal was Ordentliches machen, der Zug sei abgefahren, sie sei doch nur ehrlich, Schauspielerin sei eh gar kein richtiger Beruf. Hartz IV ist auch kein Beruf, möchte ich ihr antworten, aber ich beiße mir auf die Zunge und sage nichts. Auf dem Couchtisch liegen Essensreste von gestern Abend und klebrige Taschentücher. Der Fernseher läuft, und Karlie hockt mit schweren Augen auf dem Sofa mit einer Styroporbox auf dem Schoß und isst kalte Kartoffelecken. Sie sagt, sie habe Kopfschmerzen. Ich setze mich zu ihr und streichle ihren warmen Körper. Dr. Haus hat ihr Nasentropfen für die Nacht verschrieben. Ich hatte ihn wegen seines Namens ausgesucht, aber er ist nicht Dr. House, er ist ein ganz gewöhnlicher Kinderarzt, der nicht einmal einen Arztkittel trägt und nach kaltem Kaffee riecht.
Karlie legt sich hin, und unter ihrem Kopf bildet sich eine Pfütze, als würde sie auslaufen, als hätte ihr Ohr ein Leck. Ihr Kissen ist nass. Ich hebe sie hoch und renne rüber zu Aylins Mama. Sie wohnt am Ende des Flurs. Ihre Tür ist die mit der Deko. Sie steht mit platt gelegenen Haaren am Hinterkopf im Türrahmen und sagt, Kinder hätten ständig was mit den Ohren. Der Schnodder müsse raus, dann lasse der Druck nach. Sie war mal in der Pflege und hat eine Kinderapotheke zu Hause. Apotheke klingt aufregender, als es ist. Es ist nur eine weiße Kiste mit einem roten Kreuz drauf, vollgestopft mit Fieberzäpfchen, Mullbinden, Wundsalben und Tabletten in allen Farben. Sie wühlt sich durch die Medikamente, und ihre Augen funkeln dabei wie schwarze Hämatite. Sie liebt es, gebraucht zu werden. Sie packt mir eine ganze Tüte voll mit Aspirin Complex und sagt, ich solle mir keine Gedanken machen, wenn alles draußen sei, brauche Karlie später wenigstens keine Paukenröhrchen.
Karlie schläft vor dem Fernseher ein, noch bevor sich das Aspirin im Wasser aufgelöst hat. Der Fernseher flackert lautlos vor sich hin, und die bunten Trickfilmfarben nehmen der Wohnung das Grau. Ich habe mir mein Leben anders vorgestellt. Ganz anders. Ich wollte nie so werden wie die anderen hier. Ich wollte nie eine von ihnen sein, mit platt gedrückten Haaren vom vielen Fernsehen. Ich räume den Müll vom Sofatisch in die Küche und lasse ihn neben dem Spülbecken liegen. Es ist ganz still. Nur das milchige Wasser sprudelt wie Kohlensäure vor sich hin. Schade um die Medizin. Ich trinke das Glas auf ex, vielleicht betäubt Aspirin ja auch Gedanken.
Karlies Trommelfell ist stecknadelgroß verletzt. Dr. Haus hat ihr Paracetamol und Ibuprofen im Wechsel verschrieben. Alle vier Stunden. Er meinte, Antibiotika gebe man bei einer Mittelohrentzündung nur noch selten, sie heile in den allermeisten Fällen von selbst ab. Aylins Mama hatte recht. Durch die Verletzung konnte alles abfließen, und über die Schmerzen legte sich eine schorfige Kruste. Kinder sind nicht nachtragend. Sie vergessen den Schmerz, sobald er weg ist, und nur die karamellfarbenen Flecken auf dem Sofa erinnern an das triefende Ohr.
Der Lärm aus dem Innenhof hallt bis nach oben. Ein Grundrauschen aus Lachsalven und Beleidigungen. Das ganze Haus ist draußen. Der hundertste Lockdown ist vorbei. Die Pandemie ist fast vergessen, oder sie haben nie daran geglaubt. Niemand weiß mehr, was man darf und was nicht, man hat schon lange den Überblick verloren, die Kitas sind wieder offen, haben aber kein Personal. Jeder macht wieder, was er will, und man redet übers Wetter und über die Kinder, aber auf keinen Fall über Viren, weil immer jemand dabei ist, der hinter eine weltweite Verschwörung gekommen ist und eifrig finstere Theorien propagiert.
Karlie will in den Hof. Die Jungs aus dem Block spielen Fußball gegen die Hauswand, und Aylins Mama sitzt wie ein Bademeister auf einem Campingstuhl und hält Wache. Seit im Hof ein Mann masturbiert hat, lassen wir die Kinder nicht mehr allein runter. Esther ist sich sicher, dass es der Hausmeister war, man habe ja gesehen, wie der drauf ist, als im Hof die tote Taube lag. Die Kinder seien heute noch traumatisiert davon. Die hätten das arme Ding beerdigen wollen, Abschied nehmen, da sei er angestampft gekommen und habe mit schmalen Augen gemurrt, »dit is keen Vogel, dit is Hausmüll.« Dann habe er sich eine Plastiktüte über die Hand gestülpt, die Taube in die schwarze Mülltonne geschmissen und sich gefreut wie ein Schnitzel.
Aylins Mama schüttelt den Kopf. »Nee, der war’s nicht.« Es sei bestimmt ein Vater gewesen, der sich im Hof einen runtergeholt habe. Väter seien die schlimmsten, sagt sie. »Wenn zu Hause nichts mehr läuft, kommen sie auf komische Gedanken.«
»War ja klar«, sage ich, »die Frauen sind schuld.«
»Das hab ich doch gar nicht gesagt.«
»Du hast gesagt, wenn zu Hause nichts mehr läuft.«
»Ich weiß, was ich gesagt hab«, sagt Aylins Mama.
»Ach, Mädels«, sagt Esther, »es kann doch jeder gewesen sein. Männer sind alle gleich.«
Alle nicken, auch Ming. Ihr Typ steht oben am Fenster und raucht. Sie küssen sich schon lange nicht mehr. Nur flüchtig auf den Mund mit geschlossenen Lippen. Aylins Mama schaut kurz hoch. Ein Kind reiche ihr, stöhnt sie. Sie habe lange genug ihren Ex durchgefüttert. Kinder, Haushalt, Stunden schrubben und dann soll auch noch gekocht werden. Nee, da mache sie nicht mehr mit.
Das Wetter zieht sich zu. Im Hof staut sich die Hitze. Die Luft drückt, sie strotzt vor Feuchtigkeit. Frank ruft an, mein Agent. Sein Büro liegt in Kreuzberg, mit Hunden unter dem Schreibtisch und einer Katze, die den ganzen Tag in der Sonne brät. Er kennt Gott und die Welt, die Typen von der Straße und die Stars, und hat mich schon durch die Küche auf Filmpartys geschleust. Frank redet wie ein Zuhälter. Er nennt mich eines seiner Pferdchen, die er am Laufen hat, und lacht dabei so breit, dass man es ihm nicht übel nehmen kann.
»Die Beulwitz«, schnauft er ins Telefon, »du bist zum Casting eingeladen. Romanverfilmung, was ganz Großes.«
»Fick dich«, lache ich. »Undine Beulwitz castet schon ewig. Das Ding ist bestimmt längst abgedreht.«
»Nee, so was dauert. Finanzierung, Entwicklung, dies, das.« Ich solle meine Mails checken. Er schicke mir gleich die Szenen rüber. Eine schöne Rolle. Streng vertraulich. Es ist immer das Gleiche, erst muss alles superschnell gehen, und dann hört man nie wieder was. Mein letzter Drehtag ist über zwei Jahre her. Eine Werbung für Persil, in der ich high von zu viel Frauengold an strahlend weißer Wäsche schnüffeln musste. Ein Drehtag in zweieinhalb Jahren. Ich kriege eine Absage nach der anderen, und es bringt auch nichts, wenn Frank mir aufzählt, welche Stars mal ganz unten waren, bevor sie es geschafft haben. Tellerwäschergeschichten funktionieren erst in der Retrospektive, davor hält man besser seinen Mund und tut so, als hätte man alles im Griff.
Ich gehe rüber in den Späti. Im hinteren Raum stehen alte Computer und volle Aschenbecher, die meisten kommen her, um Geld über Western Union zu überweisen oder Unterlagen fürs Jobcenter auszudrucken. Der Laden gehört zwei Brüdern und hat vierundzwanzig Stunden geöffnet, auch an Weihnachten und am Zuckerfest. Ich setze mich an den hintersten Rechner, gleich neben der Toilette, und drucke die Szenen aus. Das gebleichte Papier riecht nach Chlor wie in einer Schwimmhalle. Ich bezahle die Kopien. Der jüngere der Brüder legt für Karlie eine Gummischlange obendrauf und sagt, ich solle beim Casting fragen, ob sie nicht noch eine Rolle für ihn haben. Er könne alles spielen. »Kanacke, Kartoffel, egal was«, und grinst, »du kannst dann immer umsonst kopieren.«
Draußen bringen sich schwere Wolken in Stellung und plustern sich vor der Sonne zu Atompilzen auf. Das Gewitter ist schon ganz nah. Aylins Mama ist mit offenem Mund auf dem Campingstuhl eingeschlafen. Der Wind wirbelt den Müll auf, weiße Plastiktüten fliegen durch die Luft, es zieht durch den Hof, als möchte mir der Wind die Blätter aus den Händen reißen. Karlie und Aylin kommen auf mich zugerannt. Die anderen Kinder flattern wie Tauben in alle Himmelsrichtungen. Aylins Mama bringt sich mit dem Stuhl über dem Kopf in Sicherheit, und in dem Moment kracht und donnert es, irgendwo schlägt ein Blitz ein, das Hochhaus torkelt wie angeschossen, Blumentöpfe fallen von oben in den Hof, Türen knallen, und im Nachbarhaus geht das Licht aus. Wir rennen hoch in unsere Wohnung, die wie ein Baumhaus in den Ästen hängt und Karlie geduldig in den Schlaf wiegt.
Das Papier ist klamm, aufgequollen vom vielen Text, und die Seiten wellen sich unter dem neongelben Leuchtmarker. Ich streiche alles an, jedes Wort, jedes Leerzeichen. Ich solle den Text über Nacht in mich reinprügeln und beim Vorsprechen alle an die Wand klatschen, hat Frank gesagt. Er nennt mich einen Rohdiamanten. Er hat immer an mich geglaubt, und wenn er von mir spricht, erzählt er allen, ich sähe aus wie die junge Jane Birkin. 68er-Ausstrahlung. Lang und dünn, mit hohen Wangenknochen und den Stirnfransen in den Augen. Ich darf ihn nicht enttäuschen.
Das Vorsprechen ist am anderen Ende der Stadt, am Viktoria-Luise-Platz. Schöneberger Altbau mit hohen Decken, Stuck und geöltem Fischgrätenparkett. Alles unter Denkmalschutz. Sie casten schon den ganzen Tag. Die Luft ist verbraucht. Niemand nimmt mich wahr. Bis jetzt sei noch nichts dabei gewesen, sagt der Regisseur gelangweilt. Er brauche zwei Minuten, um zu wissen, ob jemand die Richtige sei, zwei Minuten und keine Shakespeare-Monologe. Die Produzentin Undine Beulwitz sitzt rauchend daneben und unterhält sich mit der Casterin über den zeitkritischen Gehalt und die gesellschaftliche Relevanz von diesem und jenem. Sie ist die Einzige, die hier rauchen darf.
Ich frage sie nach einer Kippe. Stille. Undine Beulwitz hebt den Blick und schaut mich zum ersten Mal an. Das ist meine Chance. Ich stelle mich vor, Name, Wohnort, Alter, zeige mein Profil und meine Hände, erst die Innenflächen und dann die abgekauten Fingernägel. Der Regisseur unterbricht mich. Das sei hier kein Werbecasting. Meine Hände interessieren ihn nicht. Er suche nur nach der Richtigen. Ich solle erst mal vor der Tür in die Emotion kommen, und wenn ich so weit sei, ihnen etwas anbieten. »Und ach«, sagt er hinterher, »vergiss bitte den Text.« Er brauche jetzt etwas Frisches. Er könne den Text nicht mehr hören.
Ich habe keine Ahnung, was er will. Schlechte Schauspieler würden jetzt anfangen zu diskutieren, noch mal nachfragen und so. Ich würde auch gerne noch mal nachfragen. Aber ich mache es nicht. Wenn man auf dem Zehnmeterturm steht, muss man springen. Springen oder wie ein Idiot rückwärts wieder runterklettern. Bloß nicht runterschauen. Ich würde am liebsten abhauen. Zwei Schritte bis zum Abgrund. Ich strecke die Füße durch, presse die Arme an den Körper, spanne alles an und zähle auf drei, und auf drei gehe ich rein, und während ich falle, sage ich zu mir, bis hierher lief’s noch ganz gut, bis hierher lief’s noch ganz gut, bis hierher lief’s noch ganz gut … Aber wichtig ist nicht der Fall, sondern die Landung.
Das Wasser fängt mich auf. Ich berühre mit den Füßen den Boden. Das Licht verliert in der Tiefe seine Farben. Ich sehe nichts mehr, ich vergesse die Leute im Raum. Das Wasser trägt mich, schwenkt mich vor und zurück und schleudert mich immer wieder an den Sandstrand. Er hat gesagt, er wolle etwas Frisches. Emotionen, keine Shakespeare-Monologe. Meine Stimme bricht. Ich stürze mich zurück ins Meer und verschwinde in den Wellen. Überall Wasser, nur Wasser, viel zu viel schweres Wasser, schwarz und zäh wie Kindspech. Das Meer hat eigene Regeln, man wird von einer Welle gepackt und taucht irgendwo im Nichts wieder auf. Ich lasse mich treiben, das Meer drückt mich runter und dann wieder rauf, wie ein grober Liebhaber, bis es mich an den Strand spült und ich erschöpft auf dem sandfarbenen Parkett liegen bleibe.
Nach zwei Minuten hat der Regisseur genug gesehen. Kein Lächeln, kein Danke, nichts. Ich stehe auf und sammle meine Sachen ein. Ich brauche einen anderen Job, einen richtigen. Ich bin zu alt für so eine Scheiße.
Aus dem Bäcker in unserer Straße wurde während des Lockdowns eine Teststation. Ugur sagt, er habe lange genug kleine Brötchen gebacken. Es heißt, er habe ausgesorgt. Ich kenne ihn schon seit Jahren. Ich habe vor Corona bei ihm ausgeholfen, Aufbackbrötchen und Lottoscheine verkauft. Minijob auf 450-Euro-Basis. Den Rest schwarz auf die Hand und immer schön lächeln und immer scheißfreundlich sein. Mir hat das nie etwas ausgemacht. Ich kann alles machen, auch putzen und so, ist ja nicht für immer. Hauptsache flexibel und um die Ecke. Mit Kind ändern sich die Prioritäten, und wenn man nicht aufpasst, verliert man jeglichen Anspruch an sich selbst.
Wir sitzen im Schatten der Hochhäuser und trinken Kaffee, während die Mädchen auf dem Wäschegerüst klettern, und ich höre mir den ganzen Tag an, wie alle immer noch darüber reden, wer alles auf einmal systemrelevant wurde und wer nicht, wer in die Kita durfte und wer zu Hause bleiben musste. Aylins Mama zieht an ihrer Zigarette und sagt: »An die Muttis hat wieder keiner gedacht.« Als Mutter könne man schauen, wo man bleibt. »Kinder braucht ja keiner«, lacht sie. Esther nickt. Die aus der Dritten grüße nicht mal mehr, seit sie systemrelevant sei. »Arbeitet bei Netto und glaubt, sie sei was Besseres.«
Karlie und Aylin haben Hunger und schwirren wie aggressive Wespen um uns herum. Aylin ist für Karlie so was wie eine große Schwester, sie trägt ihre Klamotten nach und beneidet sie um ihre Zahnlücke. Aylins Mama verteilt Milchbrötchen, und Ming stillt links und rechts ihre Zwillinge. Jason und Jackie. Ming nennt beide nur Jay-Jay, ich glaube, sie kann sie selbst nicht unterscheiden. Die Babys ziehen an ihren petroleumschwarzen Haaren, die so glatt sind, dass man sich darin spiegelt. Sie reißen ganze Büschel raus, und Ming bleibt dabei ganz ruhig. Stress sei nicht gut für die Milch, sagt sie.
Die Sonne brennt sich in die Hauswand. Die Leute flüchten um Punkt zwölf Uhr in ihre dunklen Wohnungen mit den zugehängten Fenstern und kommen erst abends wieder raus. Die Mittagssonne war schon immer die gefährlichste. Ming fächert sich Luft zu, die Mullwindel verrutscht, und ihre milchigen Brüste glänzen in der Sonne. Sie muss hoch. Mittags braucht ihr Mann etwas Richtiges. Er kann nicht kochen, nicht einmal ein Spiegelei kriegt er hin, und Windeln wechseln kann er auch nicht. Er wollte keine Zwillinge. Höchstens eins, habe er gesagt, aber sie habe ja nicht auf ihn gehört, und jetzt müsse sie halt selber schauen, wie sie klarkomme.
Karlie hat Kopfschmerzen. »Sonnenstich«, sagt Aylins Mama und holt im Späti Eis gegen die Hitze. Der Zucker nimmt die Schmerzen und peitscht die Kinder durch den Hof. Mein Handy vibriert. Ich kenne die Nummer nicht. Es gibt Leute, die gehen nicht ans Handy, wenn sie die Nummer nicht kennen. Als ob sie so wichtig wären. Wenn ich die Nummer nicht kenne, gehe ich erst recht ran.
»Könnte ja Hollywood sein«, scherzt Aylins Mama.
Ich drehe mich weg und tue so, als hätte ich sie nicht gehört. Am Telefon ist Frank, er hat tausend Handys, wie ein Dealer.
»Du hast die rasiert, Mann«, lacht er. »Keine Ahnung, was du gemacht hast, die lieben dich, du hast die Rolle!«
Ich bringe kein Wort raus. Meine Stimme ist weg. Aylins Mama fragt, was los sei. Ich würde wie ein abgestochenes Kalb glotzen. Wahrscheinlich hat sie recht. Die Luft flirrt. Meine Augen flackern. Frank sagt, ich solle mir schon mal eine Flasche Moët holen, aber mich nicht abschießen. Er brauche später sein Pferdchen im Bellman, die Beulwitz habe mich eingeladen.
Ich brauche keinen Moët. Ich trinke Cola aus der Zweiliterflasche und schreie mein Glück durch den Hof. Mein Herz rast, und die Motoren auf der Frankfurter bollern und knallen wie Champagnerkorken. Aylins Mama fragt, wer dran war, und ich grinse: »Hollywood, du Arsch.«
Sollen die doch alle denken, was sie wollen. Glück lässt sich von Pisse im Treppenhaus nicht abschrecken, Glück findet von Zeit zu Zeit sogar in den achtzehnten Stock.
Aylins Mama steht verschwitzt in der Küche. Ich habe noch nie vom Kochen geschwitzt. Sie formt Bällchen aus Hackfleisch, Ei und Semmelbrösel und streicht sich mit dem Handrücken die Haare aus dem Gesicht. »Rindfleisch«, sagt sie, »kein Schwein.« Bei ihr muss immer alles halal sein, ganz wichtig, außer bei Donuts, da ist es ihr egal, ob sie in Schweinefett frittiert wurden oder nicht. Ich lasse meinen Zweitschlüssel bei ihr, falls sie was von drüben braucht, und bleibe nicht zu lange in ihrer Küche, denn ich weiß, wie man danach riecht. Karlie und Aylin spielen mit Barbies und einem echten Prinzessinnenschloss. Aylins rosarotes Kinderzimmer ist bis unter die Decke mit Plastikschrott aus China vollgestopft. Sie kriegt von ihrer Mama alles, was sie will, damit nicht auffällt, dass sie nichts haben. Karlie gibt mir einen Kuss und verspricht mir, auf Aylins Mama zu hören. Sie verspricht es hoch und heilig, hebt dabei die rechte Hand, als würde sie einen Eid ablegen, und wirft im nächsten Moment Muffins aus dem achtzehnten Stock. Von wegen Prinzessin. Vor dem Haus mache ich mir eine Zigarette an und schmecke die Marlboro-Freiheit. Fast so wie früher, als noch alles möglich war. Als zu Hause niemand auf mich wartete. Ich kam tagelang nicht nach Hause. Ich war immer unterwegs, die ganze Torstraße kannte mich.
Das Bellman ist voll. Die Kellner tragen schwarze Atemschutzmasken von Alexander Wang und sehen aus wie aus einem dystopischen Film, in dem sie den Gästen ein mit Mikrochips lardiertes Jungbullenfilet an einem mit biochemischen Prozessen der Molekularküche gelierten Jus servieren. Der Tisch ist auf Beulwitz reserviert. Ich bin die Erste und werde umständlich an meinen Platz geführt. Die Polster sind aus safrangelbem Leder. Der schwere Teppich, die dunkle Tapete und der Kronleuchter erinnern an frühere Epochen. Hinter mir hängt ein barocker Spiegel, der aus jedem Investmentbanker einen Churchill macht, aus dem Raum ein Gemälde, neunzehntes Jahrhundert, Salonmalerei, Ölfarben oder so. Auf meinem Schoß liegt meine Tasche wie eine Katze, und es dauert nicht lange, bis ich freundlich darauf hingewiesen werde, dass Handys im Etablissement nicht erwünscht sind. Die Männer am Nebentisch schwärmen von den mit feinen Fettäderchen marmorierten Kobe-Steaks, angeblich die besten der Welt, und die Frauen tupfen sich mit den weißen Stoffservietten die Mundwinkel, essen Carpaccio und spülen mit Weißwein. Die Katze auf meinem Schoß knurrt. Ich habe Hunger und bestelle einen Gin Tonic. Safran Gin, passend zu den Polstern. An der Bar aus dunklem Mahagoniholz sitzt ein Typ, unbeeindruckt und breitbeinig, als wäre er einer der Köche, der vor seiner Schicht noch schnell Koks vom Tresen zieht. Er sitzt schräg hinter mir. Er passt hier nicht rein. Er wirkt nicht so langweilig wie die anderen. Es gibt Leute, die können einem ins Gesicht schlagen, und man spürt nichts, und bei anderen spürt man selbst Blicke im Nacken. Er starrt mich an. Der ganze Raum muss es merken.
Undine Beulwitz kommt irgendwann nach neun. Die Kellner prügeln sich um ihren Mantel, und die Gäste drehen sich lautlos nach ihr um. Sie kommt lächelnd auf mich zu. Ich stehe auf und mache einen gottesfürchtigen Hofknicks. Ich habe noch nie jemanden so lange warten lassen. Wahrscheinlich, weil niemand so lange auf mich warten würde. Der Typ, der an der Bar saß, kommt an unseren Tisch. Ich kenne ihn vom Sehen. Er ist Schauspieler. Kein Wunder, habe ich seine Blicke gespürt. Schauspieler können so was, die üben den ganzen Tag Blicke vor dem Spiegel.
»Das ist Adam«, sagt Undine Beulwitz, »Adam Ezra. Er ist für die Hauptrolle besetzt.« Sie lehnt sich nach hinten, kneift die Augen zusammen, schaut zu mir, dann zu ihm und sagt, sie brauche nicht mal mehr einen Screen-Test, sie habe gleich gewusst, dass wir zusammen funktionieren. Sie bestellt katalanischen Amphorenwein. Adam sagt, Undine habe schon viel von mir erzählt, und lässt dabei den Blick nicht von mir, als möchte er prüfen, ob es stimmt, was sie gesagt hat. Meine Knie fühlen sich an wie Butter, aber ich zeige nichts. Ich schaue zurück und tausche den letzten Schluck Gin Tonic gegen ein Glas Naturwein. Ungeschwefelt und ungeschönt. Undine Beulwitz schwenkt das Glas. Niemand trinke mehr glatt polierte Weine. Heute gehe es um die Winzer. »Junge Wilde«, sagt sie, »die in Steillagen Reben per Hand schneiden und die Branche revolutionieren.«
Die Kellner bringen Melonenkaviar auf gefalteten Salatblättern mit kandierten Walnüssen, und zwischen den Gängen stehen alle draußen vor der Tür, mit Weinglas und Zigarette, und reden über Kunst, Film und Politik. Die Zigaretten sind Teil des Menüs, geschmacklich abgestimmt, wie kleine Amuse-Bouche. Auf der anderen Straßenseite läuft ein Typ am Stock hin und her wie ein Straßenhund. Würde man ihm ein trockenes Stück Brot rüberwerfen, würde er danach schnappen. Sein hungriger Blick bleibt an uns hängen. Er nimmt Fährte auf, schleppt sich über die Straße und kommt direkt auf uns zu. Er wirft sich auf den Boden, wie eine Attraktion auf einem mittelalterlichen Jahrmarkt, die die Aufmerksamkeit der Menge auf sich zieht. Er windet sich auf den Pflastersteinen und hält die Hand wie einen pickenden Schnabel vor seinen Mund, Fingerkuppen am Daumen, als wären Pest und Cholera zurück. Die Frauen halten ihre Handtaschen fest und flüchten zurück an ihre Tische. Ich würde mich niemals vor dem Bellman auf den Boden werfen, ich würde lieber eine Woche nichts essen und nur noch kalt duschen, als mich hier bloßzustellen. Adam zieht einen knittrigen Fünfzigeuroschein aus seiner Hosentasche. Als ob der Typ wechseln könnte. Der Typ greift nach dem Schein und braucht auf einmal den Gehstock nicht mehr.
»Direkt Zeugin einer Spontanheilung«, lache ich.
Er kenne den, sagt Adam, der sei praktisch Stammgast.
Wir wollen gerade wieder reingehen, als mein Handy vibriert. Aylins Mama ruft an. Ich mache ein paar Schritte zur Seite. Wenn Aylins Mama anruft, bedeutet das nichts Gutes, sie hat den Stolz einer sorbischen Amme und würde niemals anrufen, wenn nichts ist. Sie sagt, Karlie habe wieder Ohrenschmerzen. Ich drehe mich weg und frage, ob sie es schon mit Trickfilmen versucht hat.
»Logo«, sagt sie.
»Ibu?«
»Vor ’ner Stunde.«
»Ich kann nicht weg«, zische ich, »unmöglich, es geht hier gerade um alles.«
»Warum flüsterst du?«
Sie kapiert es nicht.
»Wichtig ist das hier, wahnsinnig wichtig«, sage ich, »ich lerne gerade alle kennen.« Adam Ezra sei auch hier, und der Regisseur schaue später auch noch vorbei. Aylins Mama atmet laut aus und sagt, es tue ihr leid, aber sie habe einfach kein gutes Gefühl. Kein gutes Gefühl, hat sie gesagt. Scheiß auf ihr Gefühl, es geht hier gerade um die Chance meines Lebens.
Karlie sei weinerlich und habe nichts gegessen. Keinen Bissen habe sie runtergebracht, nicht mal Fruchtzwerge, und das Ohr stinke wie eine verfaulte Kartoffel.
»Okay«, sage ich. »Scheiße, ich komme. Sag ihr, dass ich komme.«
Ich drücke die Zigarette in den Aschenbecher und gehe rein an unseren Tisch, wo die Beulwitz mit Champagner auf uns wartet. Ich habe keine Ahnung, wie ich aus der Nummer rauskomme. Ohrenschmerzen klingen viel zu harmlos, wegen Ohrenschmerzen haut man nicht ab, aber ich will auch nicht lügen, also erzähle ich ihr von Karlie, ganz leise, dass nur sie es hört, und sie legt ihre warme Hand auf meine und sagt, es sei alles in Ordnung. Die Kleine solle erst mal wieder gesund werden. Sie winkt einem Kellner, und alle kommen angerannt. Ich liebe diese Frau. Meine Jacke wird gebracht. Ich bedanke mich für die Einladung und merke erst draußen, dass meine Handtasche weg ist. Ich renne zurück zum Tisch. Ich hatte sie eben noch bei mir. Auf meinem Schoß und draußen auf dem Stehtisch. Adam springt auf, die Kellner hetzen hinterher. Sie sind sich alle sicher, dass es der Typ von vorhin war. Der Typ, der sich vor unsere Füße geworfen hat. Er versuche es immer wieder, sagen sie. Man kriege ihn nicht los. Er ziehe jedes Mal die gleiche Show ab, aber die Polizei schaue nur zu.
Ich laufe mit Adam die Straße ab. »Solche Typen nehmen nur das Geld und schmeißen die Tasche ins nächste Gebüsch«, sagt er. Vielleicht hat er recht, und sie liegt irgendwo, weggeworfen und ausgeschlachtet wie ein lebloses Tier. Wir wühlen uns am Straßenrand durch den Abfall, ich leuchte mit dem Handy wie eine Rentnerin auf der Suche nach Pfandflaschen in die Mülleimer und bleibe erst stehen, als ich merke, wie aussichtslos das ist. Wir haben keine Chance. Schlüssel, Geld, Perso, alles weg. Ich könnte heulen. Ich habe nur noch mein Handy und fast keinen Akku und ein krankes Kind, das auf mich wartet.
Adam gibt mir seine Nummer. Ich solle ihn anrufen, wenn ich was brauche. Wenn er wüsste, was ich alles brauche, würde er mir niemals seine Nummer geben.
»Wanda, warte!«, ruft er mir hinterher. Ich drehe mich um, und er schmeißt mir seinen Wohnungsschlüssel zu. Ich kann ihn gerade noch auffangen. Keine Ahnung, was das soll. Er ist Schauspieler, und Schauspieler lieben große Gesten. Ich werfe ihn zurück. Ich bin auch Schauspielerin, ich kann das auch und verschwinde kurz vor Mitternacht Richtung U-Bahnhof.
Karlie schläft wie ein Stein. Aylins Mama sagt, sie sei gerade eingeschlafen, als ich kam. Würde ich an ihrer Stelle auch sagen. Sie hat mich aus dem Abend gerissen wie aus dem Tiefschlaf, als würde sie mir mein Glück nicht gönnen. Aufgepeitscht vom Alkohol sitze ich in ihrer Küche und weine meiner Handtasche hinterher. Jede noch so kleine Clutch in dem Laden wäre tausendmal wertvoller gewesen.
»Was für ein Idiot«, sagt Aylins Mama. »Der denkt wohl, er ist Robin Hood.«
»Robin Hood macht es andersrum.«
»Egal«, sagt sie, »du weißt, was ich meine.«
Ich erzähle von den Kronleuchtern aus Elfenbein und geschliffenen Bergkristallen, die das Licht in allen Spektralfarben brechen, und von dem teuren Wein, der wie Wasser auf den Tischen steht. Aylins Mama hat die Arme vor der Brust verschränkt und hört mir unbeeindruckt zu. Ich erzähle ihr von Adam, und sie ist der einzige fucking Mensch, der ihn nicht kennt.
»Adam wer?«, fragt sie.
»Adam Ezra. Der aus Russisch Koks.«
»Und wenn schon«, sagt sie und hat auch schon das Handy in der Hand, um ihn zu googeln.
»Aman tanrım!«, kreischt sie. Ich solle mich bloß nicht in den verknallen.
»Keine Sorge«, lache ich.
Solche Typen seien alle gleich, sagt sie, und ob der überhaupt größer sei als ich. Sogar Tom Cruise sei in Wirklichkeit ein Zwerg, und ich hätte ja Teymur, der würde alles für mich tun und der sehe wenigstens ordentlich aus.
Sie hat recht, Tey würde alles für mich tun. Er ist in Neukölln aufgewachsen und könnte dort eigentlich jede haben. Letztens wurde er auf der Straße angesprochen, ob er für McFit modeln will. Er hat Nein gesagt. Er hängt lieber den ganzen Tag mit seinen Jungs rum und macht gar nichts.
Karlie liebt ihn, er macht es ihr einfach, er sagt immer Ja zu Süßigkeiten, und Trickfilme lässt er laufen, bis sie vor dem Bildschirm einschläft. Habe ihm auch nicht geschadet, sagt er. Ich kann ihn mitten in der Nacht anrufen, er fragt nie warum, er kommt einfach. Er sagt, dass wir irgendwann zusammenkommen werden, und lässt sich von seiner Tante die Zukunft aus dem Kaffeesatz lesen. Ich brauche keinen Kaffeesatz dafür. Er wird genau wie sein Vater den ganzen Tag rauchen und Tee trinken, kein Spiel von Galatasaray Istanbul verpassen und sich einmal im Jahr ein ganzes Lamm vom Schlachter holen. Wir passen nicht zusammen, doch nackt auf dem Sofa im flimmernden Netflixlicht fällt es nicht so auf.
Karlie liegt in Aylins Zimmer. Ich lege mich zu ihr zwischen malträtierte Barbies und einäugige Puppen und falle mit weit aufgerissenen Augen in den Schlaf. Ich träume wie auf Drogen von einer rosigen Zukunft.
Ich weiß nicht, wie lange ich geschlafen habe, wahrscheinlich gar nicht. Die Sonne knallt durch das Fenster direkt auf meinen Kopf. Mein Schädel brummt. Aylin klettert über mich drüber und macht alle wach. Karlie wankt seekrank durchs Zimmer und stolpert über ihre eigenen Beine. Sie jault wie ein Hund, und ich bin nicht sicher, ob sie wegen des Ohrs oder des blauen Schienbeins schreit. Aylins Mama zieht sie hoch und sagt, Indianer würden keine Schmerzen kennen. Sie solle sich jetzt mal nicht so haben. Der Eiter sei raus. Es sei jetzt auch mal gut. Sie habe ein Kind in Steißlage zur Welt gebracht, sie wisse, was Schmerzen sind, und Schmerzen würden nicht kommen und gehen, wie es einem gerade passt.
»Was denn jetzt?«, frage ich sie. »Nachts bestellst du mich her, weil du kein gutes Gefühl hast, und jetzt ist alles nur Theater? Und übrigens«, sage ich, »Indianer sagt keiner mehr.«
Aylins Mama verdreht die Augen, und Karlie schmeißt sich trotzig zurück auf den Boden. Aus ihrem Ohr rinnt auf einmal wieder Eiter. Ich nehme meinen Schlüssel vom Schlüsselbrett und trage Karlie durch den flackernden Hausflur auf unser Sofa. Der Eiter versickert lautlos zwischen den Polstern. Ich betäube sie mit Schmerzmitteln und Trickfilmen und google nach HNO-Praxen. Die meisten gehen gar nicht erst ans Telefon. Die anderen nehmen keine neuen Patienten auf, und nein, ich bin nicht privat versichert und habe auch keine Überweisung, ich habe nur eine Scheißangst, dass mit meiner Tochter etwas nicht stimmt.