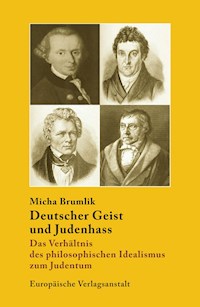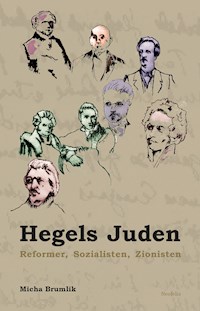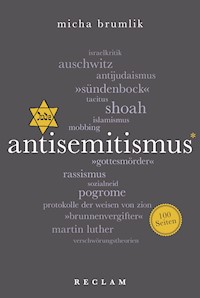12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CEP Europäische Verlagsanstalt
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Eine advokatorische Ethik ist der Einsicht verpflichtet, dass die Neuankömmlinge in der Welt zunächst nicht in der Lage sind, ihre Interessen eigenständig zu artikulieren. Welchen Prinzipien eine solche stellvertretende Interessenwahrnehmung zu folgen hat, darüber klärt die "advokatorische Ethik" auf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Micha Brumlik erhielt 2016 die Buber-Rosenzweig-Medaille und hatte im Sommersemester 2016 die Rosenzweig-Professur in Kassel inne. 2000-2013 war er Professor am Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft der J. W. Goethe-Universität Frankfurt am Main und bis 2005 Direktor des Fritz Bauer Instituts, Studien- und Dokumentationszentrum zur Geschichte und Wirkung des Holocausts. Seit 2013 Senior Professor am Zentrum Jüdische Studien Berlin/Brandenburg. Veröffentlichungen u.a.: »Aus Katastrophen lernen?« (2004), Sigmund Freud. Der Denker des 20. Jahrhunderts (2006), »Schrift, Wort und Ikone. Wege aus dem Bilderverbot« (2006), »Kritik des Zionismus« (2007), »Entstehung des Christentums« (2010), »Messianisches Licht und Menschenwürde. Politische Theorie aus Quellen jüdischer Tradition« (2013), »Vernunft und Offenbarung« (2001/2014), »Wann, wenn nicht jetzt – Versuch über die Gegenwart des Judentums« (2015), »Luther, Rosenzweig und die Schrift. Ein deutsch-jüdischer Dialog« (2017).
Micha Brumlik
Advokatorische Ethik
Zur Legitimation pädagogischer Eingriffe
Neuausgabe mit einem Vorwort zur dritten Auflage
CEP Europäische Verlagsanstalt
© der ebook-Ausgabe CEP Europäische Verlagsanstalt GmbH, Hamburg 2017
Bildnachweis der Coverabbildung: bpk | Hamburger Kunsthalle | Elke Walford
Covergestaltung: Susanne Schmidt, Leipzig
Satz: Datagrafix GmbH, Berlin
Signet: Dorothee Wallner nach Caspar Neher »Europa«, 1945
ePub-Konvertierung: Datagrafix GmbH, Berlin
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Übersetzung, Vervielfältigung (auch fotomechanisch), der elektronischen Speicherung auf einem Datenträger oder in einer Datenbank, der körperlichen und unkörperlichen Wiedergabe (auch am Bildschirm, auch auf dem Weg der Datenübertragung) vorbehalten.
ISBN 978-3-86393-540-5
Informationen zu unserem Verlagsprogramm finden Sie im Internet unter www.europaeische-verlagsanstalt.de
Inhalt
Verantwortung, Vertrauen und Würde.
Vorwort zur dritten Auflage 2017
Vorwort zur zweiten Auflage
Vorwort zur ersten Ausgabe
I.Auf dem Weg zu einer pädagogischen Ethik
Emanzipation und Operationalisierung
Zum Verhältnis von Pädagogik und Ethik
Pflicht zu Dankbarkeit und Fortpflanzung? Zu einer Ethik des Generationenverhältnisses
II.Systematische Versuche
Vom Leiden der Tiere und vom Zwang zur Personwerdung
Über die Ansprüche Ungeborener und Unmündiger
Diskurs- und Mitleidsethik in Begründung und Anwendung
Integrität und Mündigkeit. Ist eine advokatorische Ethik möglich?
Allgemeine Menschenwürde und philosophisches Expertentum
Advokatorische Ethik in Grenzsituationen
III.Zu einer ethischen Berufswissenschaft
Normative Grundlagen der Sozialarbeit
Zur Sittlichkeit pädagogisch-professioneller Interaktionen
Sind soziale Dienste legitimierbar?
IV.Bildung und Moral
Kohlbergs »Just Community«-Ansatz als Grundlage einer Theorie der Sozialpädagogik
Bildung zur Gerechtigkeit
„Politische Kultur des Streits“ im Licht sozialisationstheoretischer Überlegungen
Drucknachweise
Micha Brumlik
Verantwortung, Vertrauen und Würde. Vorwort zur dritten Auflage 2017
Vorbemerkung
Mehr als fünfundzwanzig Jahre nach dem Erscheinen der ersten Beiträge zur advokatorischen Ethik ist es unwiderruflich an der Zeit, dieses Projekt grundbegrifflich zu erweitern und damit neu zu begründen. Das wird an einem Fall aus jüngster Zeit besonders deutlich: Die Presse1 berichtete vom im Great Ormond Street Hospital in London behandelten elf Monate alten Baby Charlie Gard, das – bei der Geburt „normal“ wirkend, dann doch bald – aufgrund eines bei beiden Eltern vorhandenen defekten Gens sichtlich an einem „Mitochondrialen DNA Depletionssyndroms“ litt und daher weder sehen noch hören noch sich bewegen konnte. Die Ärzte des eher patriarchalischen britischen Medizinssystems wollten die lebenserhaltenden Maßnahmen einstellen und das Baby sterben lassen; die Eltern klammerten sich an den Umstand, dass in den USA ein Arzt an einer Therapie für diese Krankheit forscht. Ebenso hatten die verzweifelten Eltern unter ihrer Website „Charlie´s Fight“ über das Instrument des „Crowd Funding“ bereits 1,4 Millionen Euro für eine Behandlung in den USA gesammelt, sowohl Papst Franziskus als auch Präsident Trump haben sich dafür ausgesprochen, indes: nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs waren die Maschinen gemäß britischen Rechts abzustellen, denn – so die behandelnden Ärzte: das Abschalten der Maschine sei im
„best interest des Kindes...man quäle Charlie sonst nur unnötig, Hoffnung auf Besserung gebe es nicht, habe doch die Krankheit Charlies Gehirn...irreversibel geschädigt.“2
Der europäische Gerichtshof für Menschenrechte hatte geurteilt, daß Eltern als gefühlsbetonte und voreingenommene Wesen minder objektiv seien als Ärzte, die – nicht emotional involviert – besser im Interesse des Patienten entscheiden könnten.
Der Fall, aber nicht nur dieser Fall gibt Anlass, das Projekt einer „advokatorischen Ethik“ um mindestens zwei Grundbegriffe zu erweitern: den Begriff der „Verantwortung“ und den Begriff der „Würde“. Zuvor ist aber noch einmal aus der Perspektive einer philosophischen Anthropologie, die notwendigerweise auch immer eine pädagogische Anthropologie sein muss, auf das Verhältnis von Vertrauen und Verantwortung, sodann – im Anschluss – auf das Problem menschlicher Würde einzugehen.
1. Die Zeitgestalt des menschlichen Lebens
In pädagogischen, d.h. immer auch in intergenerationellen, Beziehungen hängen Verantwortung und Vertrauen eng miteinander zusammen – geht es doch um die Verantwortung der Erwachsenen für die „noch-nicht“ sowie die „nicht-mehr Mündigen“ – für die Alten oder die Kinder. Der Begriff der „Verantwortung“ signalisiert, dass es hier um eine Ethik der Lebensalter geht. Dabei ist mindestens zweierlei zu klären: erstens die Frage, was genau ein Lebensalter, manche sprechen auch von Entwicklungsabschnitten, ist, und zweitens, in welchem Ausmaß und aus welchen Gründen hieraus wem gegenüber welche Pflichten enstehen.
Indes: „Verantwortung“ ist – wie zuletzt Valentin Beck mit Blick auf die Verantwortung der Länder des Westens für die unter Armut, Hunger und Krieg leidenden Länder des Südens gezeigt hat – nicht mit einer unmittelbaren moralischen Verpflichtung identisch.3 Bei der Zuschreibung bzw. Übernahme von „Verantwortung“ geht es nach Beck um Folgendes:
„Für das eigene Tun und Unterlassen einzustehen und von anderen zu fordern, dass sie dies ebenfalls tun, schließt zudem ein, sich und anderen bestimmte Handlungen und Handlungsfolgen zuzurechnen.“4
Damit können nur Personen, erwachsene und im weitesten Sinne gesunde Personen im vollen Umfang Verantwortung sowohl für sich selbst als auch für andere übernehmen; die volle Bedeutung des Verantwortungsbegriffs umfasst mithin, dass jemand sich in Bezug auf normative Standards vor einer Rechtfertigungsinstanz rückblickend oder vorausschauend in einem sozialen Kontext für alle Folgen seines Handelns oder Unterlassens für zuständig erklärt. In diesem Sinne hat etwa der Sozialphilosoph Rainer Forst ein „Recht auf Rechtfertigung“ postuliert.5 Müssen Eltern für ihre Erziehungsweisen Verantwortung übernehmen und haben Kinder demgemäß ihren Eltern gegenüber eine Dankesschuld?
In der modernen Ethik ist von der Verantwortung im Generationenverhältnis – vornehmlich bei Kant – lediglich eine paradox anmutende „Tugendpflicht der Dankbarkeit“ übriggeblieben.6 Dankbarkeit dafür, dass andere für uns, als wir noch nicht handlungsfähig waren, Verantwortung übernommen haben oder übernehmen mussten. Dankbarkeit ist nach Kant die pflichtgemäße Verehrung einer Person ob einer erwiesenen Wohltat. Die Tugendpflicht der Dankbarkeit, nach Kant keine Klugheitsregel, sei als eine Sinnbedingung moralischer Bildung anzusehen: Dankbarkeit müsse als heilige Pflicht angesehen werden, also als eine solche Pflicht, „deren Verletzung die moralische Triebfeder zum Wohltun in dem Grundsatze selbst vernichten kann.“7
Auf eine Ethik des Generationenverhältnisses bezogen und im vollen Bewußtsein, dass Kinder in zahlreichen Fällen ihren Eltern gegenüber nur wenig Anlass zur Dankbarkeit haben, lässt sich gleichwohl festhalten, dass jener Dank – und die damit einhergehende Fähigkeit zur Dankbarkeit – nach Kants Meinung die Basis jeder moralischen Motivation ist. Dass diese Auffassung durch die Sozialisationsforschung eindrucksvoll bestätigt worden ist, muss hier nicht eigens belegt werden. Zu fragen ist jedoch, ob die auch für die ganze Lebensspanne, für die Zeitgestalt des ganzen menschlichen Lebens gilt? Auf jeden Fall materialisiert sich diese Verantwortung in einem zunächst unterstellten und zu unterstellenden alternativlosen Vertrauensverhältnis. Aber was genau ist Vertrauen?
2. Zur Phänomenologie von Vertrauen
Auf den ersten Blick scheint Vertrauen ein moralisches Gefühl zu sein, jedoch: trifft diese Erläuterung tatsächlich zu? Ist „Vertrauen“ ein moralisches Gefühl? Haben wir nicht vielmehr zu akzeptieren, dass „Vertrauen“ eine der basalsten Bedingungen jeglichen menschlichen Handelns, instrumentellen und kommunikativen Handelns ist, ganz unabhängig davon, ob die Ziele dieses Handelns moralisch ausweisbar sind? Auch und gerade Verschwörungen mit moralisch verächtlichen Zielen fordern ja ihren Teilnehmern, den Mitverschworenen, ein Minimum an wechselseitigem Vertrauen ab. Ist Vertrauen überhaupt ein moralischesGefühl? Ein Gefühl erster Ordnung wie z. B. Liebe, Hass, Ärger, Wut oder Empörung? Man mag vertrauensvoll handeln oder sich des Vertrauens von jemandem würdig erweisen. Man mag um Vertrauen werben und Vertrauen verlieren. Auf jeden Fall ist „Vertrauen“ ein affektiver Zustand, indem sich Personen gegenüber anderen Personen, Personengruppen oder Institutionen befinden. Dabei ist „Vertrauen“ jedoch nicht mit „Verlässlichkeit“ identisch, obwohl eine bestimmte Grundeinstellung, nämlich die mindestens zeitweise fraglose Akzeptanz von Gegebenheiten, die für die Akteure im Prinzip Risiken bergen, beiden gemeinsam sind. Wir vertrauen darauf, dass der Erdboden uns trägt, dass ein Küchengerät wie angegeben funktioniert und dass andere, nächste Personen im Konfliktfall auch dann auf Gewaltausübung verzichten, wenn sie das nicht explizit versprochen haben. Im Unterschied zur Verlässlichkeit von Dingen, die einer moralischen Bewertung direkt nicht zugänglich sind, ist das Vertrauen gegenüber Personen durchaus in Begriffen der Zurechenbarkeit und Verantwortung zu fassen. Jemand kann unser Vertrauen verdienen oder hat es eben verspielt. Der Soziologe Niklas Luhmann hat die berühmt gewordene Vermutung ausgesprochen, dass „Vertrauen“ ein Mechanismus zur Reduktion von Komplexität sei. Eine Definition von Vertrauen könnte demnach lauten: „Vertrauen ist die akzeptierte Verletzlichkeit gegenüber dem stets möglichen, aber doch nicht erwarteten bösen Willen eines anderen, der die Möglichkeit hat, uns Übel zu wollen und übel zu tun.“8. Beispiele lassen sich vom Besuch beim Zahnarzt über die riskante Entblößung bei Sexualkontakten mit neuen Partnern bis zum Informantenschutz von Journalisten schnell finden. Gefühle aber sind holistische prima facie Einstellungen der Welt gegenüber, und so vertrauen wir einer Person oder vertrauen ihr eben nicht. Dort, wo wir uns dieses Vertrauens nicht sicher sind oder wir nach Gründen für unser Vertrauen suchen, mögen wir diese Person immer noch schätzen oder gar lieben, ihr aber eben nicht vertrauen.
Ein moralisches Gefühl ist Vertrauen, weil es auf Gründen beruht, die explizierbar sind, ohne dass damit – ein gern begangener Irrtum – das Vertrauen hinfällig werden muss. Eine Ethik des Vertrauens würde sich dementsprechend, mit den jeweiligen Gründen für das Vertrauen und im zweiten Schritt mit jenen Verhaltensweisen oder Einstellungen auseinandersetzen, die bei anderen zu Recht Vertrauen hervorrufen können. Wenn es nämlich richtig ist, dass Vertrauen in einer prinzipiell kontingenten Welt nicht nur – wie Niklas Luhmann meint9 – ein unverzichtbarer Mechanismus zur Reduktion von Komplexität ist, sondern auch eine schätzenswerte Einstellung von Personen, also ein Gut darstellt, dann ist es in gewisser Weise auch ein Gut, vertrauenswürdig zu sein – sogar, wenn sich dieses Vertrauen auf die Ausführung von sonst abzulehnenden Handlungszwecken bezieht.
Freilich: Auf dieser basalen Ebene überzeugt die Erläuterung nicht. Sollte nicht vielmehr gelten, dass Vertrauenswürdigkeit nur dann ein Gut ist, wenn diejenigen, denen Vertrauen geschenkt wird, dies auch verdienen oder benötigen, also ihrerseits Gründe dafür liefern, ihre eigene Verletzlichkeit angstfrei präsentieren zu können? Eine weitere Schwierigkeit betrifft den Charakter der Gründe, die jedem „Vertrauen“ zu Grunde liegen. „Gründe“ sind explizierbare, kognitiv ausweisbare Aussagen oder Forderungen über oder an die Welt.10
Zu fragen ist gleichwohl: Wäre angesichts des weitgehend affektiven Charakters von „Vertrauen“ nicht eher von angemessenen, keineswegs notwendigerweise bewussten Erfahrungen zu sprechen, die zwar argumentativ entfaltet werden können, aber keineswegs entfaltet werden müssen? Also einer Art von affektivem „know how“ im Unterschied zu einem affektiven „know that“? Die Gründe jedenfalls, die die Haltung des Vertrauens untermauern oder schaffen, bestehen demnach in bestimmten zwischenmenschlichen Erfahrungen, und eine „Ethik des Vertrauens“ würde als ersten Schritt eine Phänomenologie dieser Erfahrungen zu liefern haben. Dabei lässt sich eine normativ gehaltvolle Unterscheidung zwischen verlässlichen, d. h. kontrollierbaren und sicheren menschlichen Beziehungen hier sowie vertrauensvollen Beziehungen dort treffen.
Die Philosophin Annette Baier11 hat als Test auf die interne Gültigkeit einer Vertrauensbeziehung die Frage vorgeschlagen, ob das Gefühl des Vertrauens auch dann noch fortbestehen werde, wenn dem Partner, dem vertraut wird, die Gründe bekannt sind, derentwegen der andere ihr/ihm vertraut. Übersteht etwa eine Liebesbeziehung das Wissen des einen Partners, dass der andere nur aus Dummheit oder mangelnden Gelegenheiten treu ist? Kann das Vertrauen eines Herrn auf seinen Knecht andauern, wenn er weiß, dass es nur die nackte Angst ist, die den Knecht zur Loyalität anhält?
Es empfiehlt sich, eine weitere terminologische Unterscheidung zu treffen: zwischen einer kontrollierbaren Verlässlichkeit auch im zwischenmenschlichen Bereich hier und einem „geschenkten“ und „verdienten“ Vertrauen dort. Sodann ist im Sinn einer Theorie moralischer Gefühle zu unterstreichen, dass die Haltung des Vertrauens im Unterschied etwa zur Bereitschaft, Verträge zu akzeptieren, unbewusst sein kann und bisweilen auch unbewusst sein muss. Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass eine Ethik des Vertrauens – anders als alle kontraktbasierten Moralen von Freien und Gleichen – nicht von symmetrischen, sondern von asymmetrischen Beziehungen ausgeht, in Beziehungen also, wie sie typischerweise weniger in der Öffentlichkeit denn in den intimen Institutionen von Haushalt und Familie ent- und bestehen; in Beziehungen, die keineswegs rückstandslos in Verhältnisse zwischen Freien und Gleichen umgewandelt werden können.12
Endlich – und damit nähern wir uns dem Thema einer intergenerativen Ethik – ist auf den zeitlichen und zeitbezogenen Charakter der Vertrauensbeziehung hinzuweisen. Vertrauen ist stets Vertrauen in Bezug auf wichtige Güter in einem kontingenten, zukunftsoffenen Zeitraum. Wer sich auf jemanden anderen verlässt, bzw. ihr oder ihm vertraut, geht damit zugleich eine Option, eine Wette auf die Zukunft ein und umgekehrt. Wer sich so verhält, dass ihm oder ihr in Bezug auf bestimmte Hinsichten vertraut wird, gibt damit eine Art implizites Versprechen, d. h. eine Selbstverpflichtung zu bestimmten Handlungen oder Unterlassungen in der Zukunft ab. Damit ist Vertrauen eine – auch aus rationalen Gründen akzeptierte Verletzlichkeit durch den Willen anderer – deutlichster Ausdruck der notwendig fragilen und intersubjektiven Verfasstheit der Angehörigen der Gattung Mensch. In der unabdingbaren Verwiesenheit jedes Menschen auf Vertrauen wird deutlich, dass Menschen sich prinzipiell zur Sicherung ihrer Lebensumstände nicht selbst genügen können – was für jene Menschen, die noch nicht einmal jenes geminderte Maß an wechselseitiger Abhängigkeit und relativer Autonomie erreicht haben, das dem Erwachsenenstatus zugeschrieben wird, in besonderem Maße gilt: für Babys, Kinder und Heranwachsende. Diese grundlegende Einsicht hat die lange Zeit in einer systematischen Moralphilosophie nicht ernst genommene philosophische Anthropologie schon vor Jahren in vorbildlicher Klarheit formuliert:
„Wir bedürfen zur Befriedigung unserer Bedürfnisse nicht nur jeweils dieser und jener Dinge, die wir uns durch eigenes Handeln selbst verschaffen können, sondern wir bedürfen stets auch des Zusammenwirkens mit anderen, sind aufeinander angewiesen – obzwar zugleich einander im Wege. Anders gesagt: Wie bedürfen nicht nur der Güter, sondern auch der Mitmenschen. Dem ist hinzuzufügen: Wir sind auf andere angewiesen nicht allein, um mit ihrer Hilfe zu den Gütern zu gelangen, derer wir bedürfen, sondern wir sind auch aufeinander angewiesen, um z. B. miteinander zu reden, unsere Situation zu besprechen, einander Geborgenheit zu gewähren, um im wechselseitigen Vertrauen unser menschliches Lebens zu bestehen.“13
Es scheint der Logik der Sache geschuldet, dass diese Perspektive jüngst auch von der angelsächsischen Moralphilosophie entfaltet wird.14 Vertrauen ist endlich stets mehr als nur eine intersubjektive Beziehung zwischen zwei Menschen; es erweist sich als ein vielfältig verflochtenes Netz von akzeptierten Abhängigkeiten unterschiedlicher Intensität; ein Netz, das sehr wesentlich das Unterfutter dessen darstellt, was gerne als „moralische Atmosphäre“ von Beziehungen oder Institutionen bezeichnet wird.
Eine intergenerationelle Ethik wird insbesondere auf die Qualität dieser moralischen Atmosphäre zu achten haben. Nicht zuletzt ist darauf hinzuweisen, dass die im Handeln angelegte Zukünftigkeit auf die Basis allen Handelns, den menschlichen Leib verweist. Handeln und Vertrauen sind demnach wesentlich leibbezogene Existenzialien.
Das führt zu weiteren Betrachtungen einer pädagogischen, einer philosophischen Anthropologie: Philosophische Anthropologie hat nicht zuletzt die Zeitlichkeit des menschlichen Lebens als ihren sachlichen Kern. In dieser Perspektive stehen Phänomene wie Plastizität, Mündigkeit oder Bildsamkeit, Lernfähigkeit, Ausdrucks- und Kommunikationsfähigkeit im Zentrum, ein genauerer Blick offenbart indes sogleich, dass all diese Begriffe direkt oder indirekt auf das Phänomen der Entwicklung und damit wiederum auf die Zeitgestalt des Menschen bzw. auf die von ihm zu gestaltende Zeit, auf das zu führende Leben bezogen sind. Das Substrat dieser Lebensgeschichte, das Impulse zur Veränderung des menschlichen Individuums durch es selbst sowie durch seine signifikanten Anderen (G. H. Mead) vorgibt und damit überhaupt erst ermöglicht, ist des Menschen Körper, den er als seinen ausdruckshaften, sich auch ohne seinen Willen verändernden Leib erlebt und bewohnt. Des Menschen Körper, sein Leib, der mehr und anderes ist als sein Gehirn, war bisher, bei aller geschichts- und kulturrelativen Unterschiedlichkeit die Basis aller Phänomene der Bildung, Entwicklung und Erziehung. Ob der menschliche Leib heute, im anbrechenden Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit noch jene naive Spontaneität aufweisen wird, die bisher die Gestaltung von Leib und Leben ermöglichte und erzwang, muss derzeit mit einem Fragezeichen versehen werden.
3. Generation und Evolution
Womöglich naht ja mit dem Ende des „Menschen“ in seinem alten Begriff als eines leibgebundenen Wesens auch das Ende dessen, was als „Bildung“ und „Pädagogik“ wir uns zu bezeichnen angewöhnt haben. Allerdings: Vor einem endgültigen Abgesang ist es sinnvoll, sich noch einmal dieser Leiblichkeit theoretisch zu versichern, dabei aber – anders als die Phänomenologie – den kindlichen Leib nicht isoliert zu betrachten, sondern ihn in jenes Verhältnis zu stellen, in dem alleine er erst seine Bedeutung gewinnt: in das Generationenverhältnis, also in eine ganz besondere „Bezogenheitsstruktur“. Aus anthropologischer wie aus gesellschaftlicher Perspektive wird die generative Differenz durch die „Entwicklungstatsache“ der Zweizeitigkeit der menschlichen Entwicklung konstituiert:
„Groß“ – stellt etwa Luise Winterhager-Schmid in gezielter Naivität fest – sind diejenigen, die in der Lage sind, „Kleine“ zu zeugen. Das können „Kleine“ noch nicht... Das genealogische Generationenverhältnis ist allen anderen Generationsverhältnissen vorgelagert. Es ist unlösbar verknüpft mit der körperlichen Zweigeschlechtlichkeit des Menschen. Geschlechterdifferenz ist Voraussetzung für Generativität und Generation.“15
Geschlechter- und Generationendifferenz aber haben ihren Ursprung und ihre Ursache im Prozess der Evolution: Bisher jedenfalls wurzelt die Geschichte einer sich selbst gar nicht anders denn historisch verstehen könnenden Menschheit in der Naturgeschichte nicht nur der eigenen Gattung, sondern mindestens der warmblütigen Säugetiere. Die sexuelle und zweigeschlechtliche Vermehrung tierischer Gattungen vollzieht sich durch die Verschmelzung des Erbguts zweier, sexuell differenter zeugungs-und gebärfähiger, nicht zwittriger Partner. Dabei gilt die Sexualität auch einer strikt biologischen Betrachtungsweise inzwischen nicht mehr als Motor der Replikation des Erbguts, sondern als ein Verfahren für das Reparieren und Variieren individueller Genprogramme.16 Die Replikation des Erbguts durch zwei unterschiedlich spezialisierte, eingeschlechtliche Exemplare einer Gattung hat sich im Zuge der Evolution vor „jungfräulicher“, dann vor zwittriger Fortpflanzung durchgesetzt, weil erstens die Zweigeschlechtlichkeit eine größere Variation des Erbguts ermöglicht und zweitens die Spezialisierung auf die alleinige Produktion von Eizellen hier und Spermien dort den jeweiligen Exemplaren größere Replikationschancen einräumt als wenn sie zwittrig wären. Spermienproduzenten – Männchen – können hinfort die Verbreitung ihres Erbguts nicht mehr nur durch Begattung, sondern auch durch Kampf und Ausschaltung des Nachwuchses anderer befördern, ohne sich um Aufzucht und Pflege kümmern zu müssen, während die Eizellenproduzenten – Weibchen – der Pflege und Aufzucht nachgehen können, und die Ausschaltung fremden Nachwuchses den Spermienproduzenten überlassen können. Soziobiologie und Populationsgenetik konnten vor diesem Hintergrund zwei grundsätzlich verschiedene Replikationsstrategien identifizieren: während unter Bedingungen riskanter Umwelten die schnelle und häufige Zeugung von Nachwuchs unter Inkaufnahme einer nicht intensiven Brutpflege optimal erscheint, prämieren stabile Umwelten seltener auftretende und langsamer verlaufende Zeugungs- und Gebärstrategien und eine hoch intensivierte Brutpflege, die im Fall dieser Strategie ein hohes Investment an Kraft, Zeit, Geld, Liebe und Sorge der Eltern erfordert.17
Der Nachwuchs von Exemplaren der biologischen Gattung „homo sapiens“ ist als extrauterine Frühgeburt und sekundärer Nesthocker von seiner stammesgeschichtlichen Anlage her auf Strategien der zweiten Art eingestellt. Die Gattung „homo sapiens“ weist so unter allen Primaten die längsten Schwangerschaften, die niedrigsten Fortpflanzungsraten auf. Dem entspricht die evolutionäre Bedeutung jener bei der Gattung ebenfalls besonders langen Lebensphase vor dem reifungsbedingten Einsetzen des Fortpflanzungsapparats, der hier als „biologische Kindheit“ bezeichnet wird, deren Sinn darin besteht, eine lange Lehrzeit für das erfolgreiche Funktionieren als Erwachsener zu ermöglichen.
„Die zu erlernenden sozialen Umweltvariabeln“ – resümiert Athanasios Chasiotis – „ wie etwa kulturelle Normen verändern sich zwar auch mit der Zeit, aber vergleichsweise langsam im Vergleich zur Lebensspanne der Menschen. Deshalb ist die optimale evolutionäre Strategie, für das Lernen besonders empfängliche „sensible Situationen“ in der frühen Kindheit zu etablieren, in denen das Erlernen bestimmter Verhaltensweisen erleichtert wird. Die kindliche Pflegebedürftigkeit wird dabei als Voraussetzung gesehen, mit der der Mensch seine Nachkommen zu „besseren“, reproduktiv überdurchschnittlich erfolgreichen Erwachsenen großzuziehen in der Lage ist. Um dieses Ziel zu erreichen, ist in den ersten ungefähr fünf Lebensjahren von einer sensitiven Periode auszugehen, in der das Kind die Fortpflanzungsstrategien der erwachsenen Familienmitglieder übernehmen lernt....“18
Diese evolutionstheoretischen Befunde stimmen nicht nur mit den Einsichten der Psychoanalyse und den empirischen Befunden der Bindungsforschung überein, sondern auch mit den Befunden einer entwicklungsorientierten Gehirnforschung.19 In diesem Sinne lässt sich auch durch transkulturelle, vergleichende Studien eine eindeutig bestimmbare, allenfalls in Geschwindigkeit und Ausprägung, nicht aber in Abfolge und Entwicklungslogik differierende Lebensphase der biologischen Kindheit des Nachwuchses von „homo sapiens“ bestimmen.
Diese evolutionspsychologischen Hinweise gewinnen ihren ethisch-moralischen und damit pädagogischen Sinn, wenn man sich vor dem Hintergrund der für die Gattung typischen Reproduktions- und Aufzuchtstrategien hier und der für die Gattung andererseits ebenso typischen „exzentrischen Positionalität“ dort (H. Plessner) dem Umstand stellt, dass sich die relevanten Bezugspersonen Neugeborener – in der überwiegenden Mehrheit aller Fälle noch immer die biologische Mutter – ihren neugeborenen Kindern gegenüber in einer eigentümlichen Mischung aus vorbewussten Selektionsstrategien, moralischen Imperativen und partnerschaftsbezogenen Lebensentwürfen verhalten. Entsprechend lautet das Fazit der evolutionspsychologisch arbeitenden Anthropologin Sarah Blaffer Hrdy zum Rätsel der Adoption ausgesprochen schwächlicher Kinder:
„Im Gegensatz zu anderen Tieren sind Menschen in der Lage“ „bewußt Entscheidungen zu treffen, die ihrem Eigeninteresse zuwiderlaufen... Ein solches freiwilliges Verhalten, das im Widerspruch zu allen biologischen Eigeninteressen steht, besitzt die Merkmale wahren Heldentums, eines moralischen Heldentums, wie es George Eliot im Sinn hatte, als sie die Menschen von Darwins „albernen Tieren“ unterschied und betonte, daß unsere Handlungen uns ebenso sehr bestimmen wie wir unsere Handlungen.“20
Handlungen aber emergieren im Zuge der gesellschaftlichen Evolution zu Institutionen und Normensystemen, die im Zuge der Sozialisation des einzelnen Kindes dessen Selbstverständnis und Handlungsoptionen bestimmen sowie eingrenzen. Für die ethische Dimension einer pädagogischen Theoriebildung kommt es daher darauf an, zu überprüfen, ob und inwieweit eine realistische Betrachtung des evolutionär vorgegebenen Generationenverhältnisses mit den Imperativen einer universalistischen Moral kompatibel ist.
Lässt sich diese „Lehrzeit“, die „Lehrzeit“ einer langen Lebensspanne, durch das gezielte, technische Einsetzen von am Genom ansetzenden Reproduktionsstrategien verkürzen oder optimieren? Neue Formen der Entstehung von Menschen lassen das zunehmend fragwürdiger erscheinen.21
4. Exkurs: Gezielte Replikation von Menschen, Transhumanismus der Fortpflanzung – das gattungsethische Problem
So scheint sich schließlich zu zeigen, dass es um das geht, was Jürgen Habermas als ein Problem der „Gattungsethik“ bezeichnet hat. Auf jeden Fall ist als Erstes der Begriff der „Ethik“ im Unterschied zu dem der „Moral“ zu klären. Der Begriff der „Ethik“ bezeichnet in der herkömmlichen philosophischen Terminologie Lehren vom „guten Leben“, ohne dass letztendlich entscheidbar wäre, welche Formen des guten Lebens eine systematische normative Auszeichnung verdienen. Im Unterschied zur „Ethik“ geht es dann aber wiederum all jenen Normensystemen, die als „Moral“ bezeichnet werden, um die Frage, ob sich bestimmte Handlungsweisen, genauer bestimmte Weisen des Tuns oder Unterlassen, also Pflichten, systematisch und eindeutig nachweisen lassen. Von „Ethik“ und „Moral“ ist wiederum das „Recht“ zu unterscheiden, dessen Normen des Tuns oder Unterlassens im zwischenmenschlichen Umgang wiederum durch in der Regel staatlich vorgehaltene Gewaltmittel gedeckt sind.
Was eine gattungsethische Problematik ist, wurde vor allem an der Auseinandersetzung mit dem, was Habermas als eine „liberale Eugenik“ bezeichnet, deutlich.22 Dabei geht es um die Frage, ob – und wenn ja – ethische, moralische und schließlich Kriterien bezüglich der Erforschung, Analyse und schließlich technischen Bearbeitung des menschlichen Genoms sinnvoll und nötig sind. Lassen sich ernsthafte Gründe dafür mobilisieren, dass Menschen mit Kinderwunsch sich ihr späteres Kind nicht gleichsam nach dem Prinzip eines Menüs zusammenstellen – d.h. durch den Einsatz gentechnischer Verfahren nicht nur das Geschlecht eines Kindes, sondern auch dessen Augen- und Haarfarbe, am Ende gar die Ausprägung seiner Intelligenz und seiner Begabungen vorher zu bestimmen. Sei es, dass künftige Mütter das Erbgut aus qualifizierten Samenbanken beziehen, sei es, dass etwa Männer, die aus welchen Gründen auch immer eine Partnerin zu Erzeugung und Geburt nicht finden oder Frauen, deren Empfängnisfähigkeit etwa durch Krankheit oder Alter nicht mehr gegeben ist, ihr eigenes Erbgut klonen und das so planvoll konstruierte Kind von einer Leihmutter austragen lassen? Ein solches Kind wäre im somatischen Bereich eine genaue Replik von klonendem Vater oder klonender Mutter – dafür, dass es nicht zu einer 1:1 Replik kommen kann, sorgen dann freilich die epigenetischen Prozesse, mehr die sozialisatorischen Prozesse, denen das dann geborene Kind ausgesetzt ist.
Auch die neuerdings erörterte Frage des „Transhumanismus“ oder des „Posthumanismus“23 stellt sich somit als gattungsethisches Problem so: Wie weit ist es für die Angehörigen der biologischen Gattung „Homo Sapiens“ gut, ihre seit Anbeginn ihres Existierens gegebene Fähigkeit, die vorgebenen somatischen Möglichkeiten zu intensivieren und auszubauen – bis hin zu Organergänzungen, bei denen somatisch-menschliches Substrat und Maschinen zu in sich geschlossenen biomaschinellen Einheiten integriert werden? Von dieser gattungsethischen Frage ist dann wiederum die moralische Frage zu unterscheiden, ob derartige Weiterentwicklungen der somatischen Basis möglicherweise deontologisch begründete zwischenmenschliche Ansprüche oder Pflichten verletzen können; schließlich ist zu prüfen, ob überhaupt, und gegebenenfalls, welche rechtlichen Regelungen in diesem Bereich zu etablieren sind, um vorhandene Rechte zu schützen.
Vor diesem Hintergrund setzt sich Habermas mit der Frage auseinander, ob es „postmetaphysische Antworten auf die Frage nach dem „richtigen Leben“ gibt. Indem Habermas zunächst postuliert, dass die abstrakte, universalistische Moral der Menschenwürde und Menschenrechte in einem „vorgängigen, von allen moralischen Personen geteilten ethischen Selbstverständnis der Gattung ihren Halt findet“24, muß er schließlich die Frage beantworten, „ob die Technisierung der Menschennatur das gattungsethische Selbstverständnis in der Weise verändert, daß wir uns nicht länger als ethisch freie und moralisch gleiche, an Normen und Gründen orientierte Lebewesen verstehen können.“25
Unter Bezug auf die Anthropologie Helmut Plessners26 mit ihrer grundlegenden Unterscheidung von „Leib“, der man ist, aus dem heraus und mit dem man „existiert“. und „Körper“, den man hat, vermutet Habermas, dass das Wissen etwa geklonter Menschen, dass sie „künstlich“, „technisch“ mit all ihren Anlagen „hergestellt“ worden sind, ihr Selbstverständnis grundlegend verändern würde. Könnte doch die damit einhergehende Entdifferenzierung des Unterschieds zwischen „Gewachsenem“ und „Gemachtem“ ,
„das Schwindel erregende Bewusstsein auslösen, dass in der Folge eines gentechnischen Eingriffs vor unserer Geburt die von uns als unverfügbar erlebte subjektive Natur aus der Instrumentalisierung eines Stücks äußerer Natur hervorgegangen ist. Die Vergegenwärtigung der vorhergegangenen Programmierung eigener Erbanlagen mutet uns gewissermaßen existenziell zu, das Leibsein dem Körperhaben nach- und unterzuordnen ist.“27
Indem Habermas des Weiteren vermutet, dass Personen sich mit sich selbst und ihrem Leib nur dann als eines empfinden können, wenn dieser ihr Leib als „naturwüchsig“ geworden und nicht als „technisch gemacht“ erfahren wird, ist der Schluss unvermeidlich, dass auch alle Formen einer universalistischen Moral, die die Einzigartigkeit und Würde einer menschlichen Person postulieren, auf der Annahme basieren müssen, dass diese sich in ihren Handlungen, Entscheidungen und damit auch in ihrem moralischen Verhalten, das wiederum auf durch Einsicht gewonnenen „Gründen“ beruht, als „unverfügt“ verstehen müssen. Mit Blick auf Hannah Arendts Konzept der „Natalität“28, kann Habermas dann annehmen, dass Akteure sich jene performativen Selbstzuschreibungen zurechnen können, ohne die sie sich gar nicht als Initiatoren eigener Handlungen und Ansprüche verstehen können. Mit Arendt lässt sich sagen, dass jede menschliche Geburt, „als Wasserscheide zwischen Natur und Kultur“ einen Neubeginn markiert.“29 Nun mag man natürlich fragen, ob das Wissen von Personen, von genau welchen Eltern mit welchen Eigenschaften sie „natürlich“ gezeugt und später bewusst erzogen worden sind, ihnen ebenfalls den Eindruck vermitteln kann, jedenfalls in ihrem „Charakter“ gemacht worden zu sein. Ist es tatsächlich so, dass das Wissen, „technisch gemacht“ worden zu sein, das subjektiv empfundene Freiheitsbewusstsein stärker beeinträchtigt als das Wissen etwa einer leidvoll erfahrenen Erziehung. Und wie ist es – so wäre weiterzufragen – um jene frühen Gesellschaften bestellt, in denen genetisches Wissen ebensowenig vorlag wie ein Wissen darum, dass es der männliche Same ist, der die Geburt eines Kindes bewirkt? Tatsächlich sind tribale Gesellschaften bekannt, in denen die Zeugung eines Kindes einem Windhauch oder einem Bad im Wasser zugeschrieben wird. Ist es also wirklich so, dass – wie Habermas meint – es nur das Wissen um die Unverfügbarkeit der Genlotterie ist, dass ein minimales Freiheitsbewusstsein verbürgt? Habermas, der für eine strikte Regelung von Embryonenforschung und PID eintritt, kann daher für eine gattungsethische Selbstbeschränkung plädieren:
„Normative Schranken im Umgang mit Embryonen ergeben sich aus der Sicht einer moralischen Gemeinschaft von Personen, die die Schrittmacher einer Selbstinstrumentalisierung der Gattung abwehrt, um – sagen wir – in der gattungsethischen Sorge um sich selbst – ihre kommunikativ strukturierte Lebensform intakt zu halten.“30
Ist also das Wissen der zufälligen Zeugung und damit der Kontingenz des eigenen Gewordenseins das Unterpfand des Bewusstseins der Freiheit und damit auch der moralischen Autonomie? Am Ende seiner Ausführungen jedenfalls votiert Habermas dafür, Klonen, PID u.ä. zu unterlassen und zwar deshalb, weil alleine das Wissen um den Zufall der Verschmelzung von Samen- und Eizelle ein Selbstbewusstsein im Sinne von Kontingenz und damit Freiheit ermögliche. Dann ist freilich zu fragen, ob in Gesellschaften, in denen dieses Wissen noch nicht bestand, Menschen insofern keine Personen waren, insofern sie über kein Freiheitsbewusstsein verfügten. Was ist von Gesellschaften zu halten, in denen die Schwangerschaft einer Frau einem Windstoß, einem Bad im Wasser oder einem Geist zugerechnet wird?31
So überzeugend Habermas gattungsethische Einwände gegen das Klonen und gegen PID auch wirken mögen, so wenig überzeugt die Übertragung der ganzen Beweislast auf das Wissen der Individuen um die Kontingenz ihrer Erzeugung und die daraus resultierende Verwiesenheit auf vertrauenswürdige Bezugspersonen aus vorhergehenden Generationen.
5. Vertrauen und Verantwortung
Die vorhergehenden Erörterungen dienten vor allem dem Zweck, den bereits angedeuteten, jetzt sytematisch zu entfaltenden Begriff der „Verantwortung“ als das Korrelat von „Vertrauen“ einzuführen. Wenn Valentin Beck recht hat, besteht „Verantwortung“ nicht in eindeutigen moralischen Imperativen, sondern in der grundsätzlichen Bereitschaft von Personen oder Institutionen, sich die im ungünstigen Falle negativen Folgen ihres Tuns oder Unterlassens im Sinne materieller oder normativer Sanktionen folgenreich zurechnen zu lassen.
Dabei ist zunächst zwischen „Verantwortung“ und „Haftung“ zu unterscheiden. Unter „Haftung“ lässt sich eine positiv-rechtliche Zurechenbarkeit von Handlungsfolgen verstehen – auch und sogar, wenn die Folgen einer Haftung gar nicht absehbar waren: „Das Betreten des Rasens ist verboten – Eltern haften für ihre Kinder“...
Ob und warum welche Personen sich für welche anderen Personen „Verantwortung“ zuschreiben lassen müssen, ist demgegenüber eine offene, eine offene ethische und moralische Frage. Liegt eine „Verantwortung“ auch dann vor, wenn jene, für die man „Verantwortung“ zu übernehmen hat, gar nicht in einem besonderen Vertrauensverhältnis zum „Verantwortungsträger“ standen? Empirisch ist ja durchaus auszuschließen, dass notleidende Menschen in den Ländern des Südens jenen westlichen Staaten, die nach Valentin Beck einen Teil ihrer Misere verursachten, vorher besonders vertraut haben?
Ich lasse diese brisante, offene Frage einer politischen Ethik an dieser Stelle auf sich beruhen, um lediglich darauf hinzuweisen, dass in interpersonellen Kleingruppen wie Paaren, Familien oder von Menschen betriebenen pädagogischen Institutionen freiwillig oder unfreiwillig, weil entwicklungsbezogen alternativlos, entgegengebrachtes Vertrauen von Abhängigen die Übernahme von Verantwortung impliziert. Zwar mögen Politiker oder Heiratsschwindler sich mit dem Hinweis aus der Verantwortung ziehen, dass jene, die ihren blumigen Versprechungen geglaubt haben, eben blöde waren – mit Blick auf unmündig Abhängige, etwa kleine Kinder oder ihrer kognitiven Fähigkeiten nicht mehr gewisse Alte, ist dieser Verantwortungsentzug weder moralisch hinnehmbar noch anthropologisch sinnvoll. An dieser Stelle spätenstens kommt nun – nach Einführung der Begriffe „Vertrauen“ und „Verantwortung“ der Begriff der „Würde“ ins Spiel.
6. Verantwortung und Würde
Womit wir schließlich bei der Frage nach der „Würde“ der generationell und pädagogisch Abhängigen angelangt sind – eine Problematik, die insbesondere im Bereich der „Nicht-mehr-Mündigen“, im Bereich gerontologisch oder gerontopsychiatrisch informierter Alten- und Sozialarbeit angelangt ist.32 Indes – und dies wird im Weiteren zu erläutern sein, es keineswegs nur um die Würde von Älteren, etwa Dementen geht, sondern auch um die Würde der „Noch-nicht- Mündigen“ .
Aber was ist genau „Würde“? Es scheint, als sei das Prinzip der „Menschenwürde“ zunächst in der italienischen Renaissance entfaltet worden, etwa bei Pico della Mirandola (1463-1494) mit seinem gleichnamigen Traktat „De dignitate hominis“, „Über die Würde des Menschen“33, oder bei Giannozzo Manetti34 (1396-1459).
Es war nach einer längeren Rezeptionsphase dieses Begriffs35 schließlich die kosmopolitische Philosophie der deutschen Aufklärung, zumal Immanuel Kants36, die die nach dem Nationalsozialismus geschaffene deutsche Verfassung, das Grundgesetz wesentlich geprägt hat. Als oberstes Prinzip der Tugendlehre weist Kant in der Metaphysik der Sitten Folgendes aus:
„Nach diesem Prinzip ist der Mensch sowohl sich selbst als andern Zweck und es ist nicht genug, dass er weder sich selbst noch andere bloß als Mittel zu brauchen befugt ist, sondern den Menschen überhaupt sich zum Zwecke zu machen, ist des Menschen Pflicht.“37
Einen Menschen als Zweck seiner selbst zu betrachten, bedeutet, ihn in mindestens drei wesentlichen Dimensionen nicht nur zur Kenntnis zu nehmen, zu tolerieren, sondern auch anzuerkennen, d.h. nicht nur hinzunehmen, sondern zu bejahen in der Dimension körperlicher Integrität, personaler Identität und soziokultureller Zugehörigkeit. Dieser Anerkennung korrespondiert ein Demütigungsverbot. Das Demütigungsverbot aber bezieht sich auf die „Würde“ eines Menschen. Diese „Würde“ eines Menschen ist der äußere Ausdruck seiner Selbstachtung, also jener Haltung, „die Menschen ihrem eigenen Menschsein gegenüber einnehmen, und die Würde ist die Summe aller Verhaltensweisen, die bezeugen, dass ein Mensch sich selbst tatsächlich achtet.“38 Diese Selbstachtung wird verletzt, wenn Menschen die Kontrolle über ihren Körper genommen wird, sie als die Person, die sie sprechend und handelnd sind, nicht beachtet oder ernst genommen bzw. wenn die Gruppen oder sozialen Kontexte, denen sie entstammen, herabgesetzt oder verächtlich gemacht werden. Die Verletzung dieser Grenzen drückt sich bei den Opfern von Demütigungshandlungen als Scham aus.39 Entsprechend gibt es eine absolute Scham. In Primo Levis kristallklarem und nüchternem Bericht über seine Haft in Auschwitz wird den Erfahrungen absoluter Entwürdigung Rechnung getragen; der Ausdruck von der „Würde des Menschen“ gewinnt vor dieser Kulisse von Auschwitz eine gebieterische und einleuchtende Kraft:
„Mensch ist„, so notiert Levi für den 26. Januar 1944, einen Tag vor der Befreiung des Lagers, „wer tötet, wer Unrecht zufügt oder erleidet; kein Mensch ist, wer jede Zurückhaltung verloren hat und sein Bett mit einem Leichnam teilt. Und wer darauf gewartet hat, bis sein Nachbar mit Sterben zu Ende ist, damit er ihm ein Viertel Brot abnehmen kann, der ist, wenngleich ohne Schuld, vom Vorbild des denkenden Menschen weiter entfernt als der roheste Pygmäe und, der grausamste Sadist.“ Unter diesen Bedingungen schwindet dann auch die natürliche Neigung zur Nächstenliebe. Levi fährt fort: “Ein Teil unseres Seins wohnt in den Seelen der uns Nahestehenden: darum ist das Erleben dessen ein nicht-menschliches, der Tage gekannt hat, da der Mensch in den Augen des Menschen ein Ding gewesen ist.“40
Einen Menschen als Zweck seiner selbst zu betrachten, bedeutet somit, ihn in mindestens drei wesentlichen Dimensionen nicht nur zur Kenntnis zu nehmen, zu tolerieren, sondern auch anzuerkennen, d.h. nicht nur hinzunehmen, sondern zu bejahen: in der Dimension körperlicher Integrität, personaler Identität und soziokultureller Zugehörigkeit. Dieser Anerkennung korrespondiert ein Demütigungsverbot. Die „Würde“ eines Menschen ist – wie der israelische Philosoph Avishai Margalith gezeigt hat41 – der äußere Ausdruck seiner Selbstachtung, also jener Haltung, „die Menschen ihrem eigenen Menschsein gegenüber einnehmen, und die Würde ist die Summe aller Verhaltensweisen, die bezeugen, dass ein Mensch sich selbst tatsächlich achtet.“ Diese Selbstachtung wird verletzt, wenn Menschen die Kontrolle über ihren Körper genommen wird, sie als die Person, die sie sprechend und handelnd sind, nicht beachtet oder ernst genommen bzw. wenn die Gruppen oder sozialen Kontexte, denen sie entstammen, herabgesetzt oder verächtlich gemacht werden. Mit dem Begriff der „Würde des Menschen“ wird lediglich ein Minimum angesprochen, der kleinste gemeinsame Nenner nicht von Gesellschaften, sondern von jenen politischen Gemeinwesen, von Staaten, die wir als „zivilisiert“ bezeichnen.
Bei alledem ist die Einsicht in die Würde des Menschen nicht auf kognitive, intellektuelle Operationen beschränkt, sie ist mehr oder gar anderes: Das Verständnis für die Würde des Menschen wurzelt in einem moralischen Gefühl. Dieses Gefühl ist moralisch, weil es Beurteilungsmaßstäbe für Handlungen und Unterlassungen bereitstellt, es ist indes ein Gefühl, weil es sich bei ihm nicht um einen kalkulatorischen Maßstab, sondern um eine umfassende, spontan wirkende, welterschließende Einstellung handelt. Wer erst lange darüber nachdenken muss, ob einem oder mehreren Menschen die proklamierte Würde auch tatsächlich zukommt, hat noch nicht verstanden, was „Menschenwürde“ ist. Es handelt sich beim Verständnis der Menschenwürde also um ein moralisches Gefühl mit universalistischem Anspruch, das unter höchst voraussetzungsreichen Bedingungen steht.
1.Die Anerkennung der Integrität anderer ist an die Erfahrung eigener Integrität und Anerkennung, die sich in Selbstgefühl, Selbstrespekt und Selbstachtung artikuliert, gebunden.
2.Niemand kann Selbstgefühl, Selbstrespekt und Selbstachtung entfalten, der nicht seinerseits in allen wesentlichen Bezügen toleriert, akzeptiert und respektiert worden ist.
3.Selbstgefühl, Selbstrespekt und Selbstachtung sind die logischen und entwicklungsbezogenen Voraussetzungen dafür, Einfühlung, Empathie in andere entfalten zu können.
Daraus folgt, dass das Empfinden für Menschenwürde unter den Voraussetzungen des Akzeptiertseins des Kindes im Sinne des von Erik Erikson ausgesprochenen Urvertrauens bzw. des von der Psychoanalyse in den Blick genommenen „Glanzes im Auge der Mutter“, also unter Bedingungen einer nicht als fragmentarisch erfahrenen vorsprachlichen Sozialisation ebenso steht wie unter der Bedingung von peer group bezogenen Sozialisationsformen, die Individuierung und Anerkennung ermöglichen: gehaltvolle Freundschaften und individualisierte, romantische Liebe. Aber auch dann ist noch nicht gesichert, dass auch ein Verständnis für Menschenwürde im Allgemeinen gegeben ist – auch unter den genannten Bedingungen ist nicht auszuschließen, dass zwar ein Gefühl für die Würde und Integrität partikularer Gruppen entwickelt wird, die Menschheit als Ganze, alle Menschen jedoch noch kein Gegenstand des Respekts geworden sind.
7. Würdevolles Altern und würdevolles Heranwachsen
Nun ist die „Würde des Menschen“ das oberste Prinzip der deutschen Verfassung und hat – wie bereits oben gezeigt – einen langen Vorlauf nicht nur in der deutschen Nationalgeschichte, sondern auch in der Geschichte der (west)europäischen Moderne seit der Renaissance, spätestens – wie oben gezeigt – seit Pico della Mirandola.
„Jeder Mensch“ – so heißt es in Art. 18 der am 10. Dezember 1948 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verkündeten „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte – „hat Anspruch auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; dieses Recht umfasst die Freiheit, seine Religion oder seine Überzeugung zu wechseln sowie die Freiheit, seine Religion oder seine Überzeugung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, in der Öffentlichkeit oder privat, durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Vollziehung von Riten zu bekunden.“
Diese Menschenrechtsgarantie reagiert auf eine Problemlage, die zuerst in den konfessionellen Bürgerkriegen Europas als solche notorisch wurde (tatsächlich bestand sie schon lange vorher) und Ende des 18. Jahrhunderts zum Beispiel bereits von Immanuel Kant prägnant charakterisiert wurde:
„Auch sind die sogenannten Religionsstreitigkeiten, welche die Welt so oft erschüttert und mit Blut besprützt haben, nie etwas anderes, als Zänkereien um den Kirchenglauben gewesen, und der Unterdrückte klagte nicht eigentlich darüber, daß man ihn hinderte, seiner Religion anzuhängen (denn das kann keine äußere Gewalt), sondern daß man ihm seinen Kirchenglauben öffentlich zu befolgen nicht erlaubte.“42
Festzuhalten ist auf jeden Fall, dass das Konzept der „Würde des Menschen“ zumal in seiner Funktion als eines absoluten, weder erläuterungsbedürftigen, noch gar erläuterungsfähigen Grundprinzips der Begründung der Menschenrechte zunehmend in die Kritik geraten ist. So sei das angebliche „absolute“ Prinzip mehrdeutig und unklar, so müsse – so jedenfalls die jüngste Diskussion – auch dieser Begriff wie alle philosophischen Begriffe erläuterbar, wenn nicht gar „entsorgt“43 werden; geschehe aber dies –so vor allem Eva Weber–Guskar, werde der Begriff, werde das Prinzip „kontingent“ und in seinen Voraussetzungen nachvollziehbar. Dazu liegen nun eine Reihe von Vorschlägen vor und zwar so, dass zunächst – unter Berücksichtigung der Begriffsgeschichte – zwei Dimensionen, nämlich „Status“ hier und „Haltung“ dort, unterschieden werden. Erläutert man den Begriff im Sinne von „Status“, so benennt er eine soziale Position, die im Unterschied zu anderen – besondere Achtung, besonderen Respekt gebietet. Betrachtet man den Begriff indes unter dem Gesichtspunkt der Haltung, geht es weniger um die Frage, was von anderen jeweils an Respekt zu erwarten ist, als darum, was die menschlichen Subjekte selbst tun oder unterlassen, um dem von ihnen gewählten oder zugeschriebenen Status gerecht zu werden. Ein anderer Vorschlag zielt darauf, jeweilige „Würde“ als Übereinstimmung von Verhalten, Handeln und jeweils gegebenen, persönlichen normativen Erwartungen zu erläutern.
Im pädagogischen Bereich, also dort, wo die von mir vertretene „Advokatorische Ethik“ ihren besonderen Anwendungsbereich hat, ist diese Konzeption zumal im Bereich der Altenarbeit – wo es ja häufig um Ungeschicklichkeit, Vergesslichkeit bis hin zur Demenz von KlientInnen geht – inzwischen zumindest systematisch angedacht worden. „In Würde altern“ wurde dort inzwischen zum Thema.44 Indes: tatsächlich wird der Begriff der „Würde“ seit je mit dem Altern verbunden, allerdings – wenn der Anlass dafür die Frage abnehmender Lebensalter angemessener Haltungen ist, es also – in den Begriffen einer advokatorischen Ethik – um die Würde „Nicht-mehr-Mündigen“ geht, warum ist dann – mit geringen Ausnahmen, etwa bei Janusz Korczak – die Frage der Würde von Babys, Kleinstkindern und Heranwachsenden noch nicht systematisch erörtert worden?45 Immerhin: die UN-Kinderrechtskonvention sowie die von Bundestagsparteien im Wahlkampf 2017 ins Spiel gebrachte Einführung von Kinderrechten ins Grundgesetz entspricht der Logik dieser Argumentation. Mithin soll es – analog zum Altern in Würde – in Zukunft auch ein Heranwachsen in Würde geben – eine Bestimmung, die ohnehin alle zu unterlassenden Straftaten gegen Kinder wie Kindesmisshandlung und Kindesmissbrauch für unzulässig erklärt – auch den berühmten „Klaps auf den Po“, gar nicht zu sprechen von Fällen sexuellen Kindesmissbrauchs. Dazu liegen seit einiger Zeit grundlegende Untersuchungen zum Begriff menschlicher Autonomie im Grundsätzlichen46 vor.
Vor allem aber wird es – und das muss einer künftigen Kasuistik überlassen bleiben – um gegenwärtig heiß diskutierte Grenzfälle gehen: Lässt sich sinnvoll – mit Blick auf den anfangs geschilderten Fall – sinnvoll von einer „Würde von Babys„ sprechen – wie ist etwa mit sog. „Schreibabys“ umzugehen, wie steht es um die derzeit umstrittenen Fragen eines frühen, kindgerechten Sexualunterrichts etc.? Nicht zufällig ist die These von der „kindlichen Unschuld“ seit der „Erfindung der Kindheit“ (P. Aries) ein heftig debattiertes Thema, das unter dem Gesichtspunkt der „Würde des Kindes“ neu zu erörtern wäre.
Auf jeden Fall: Wie gezeigt, war auch die von mir bisher vertretene „Advokatorische Ethik“ mit Blick auf ihre alleinige Fokussierung auf „Mündig/Unmündig“ unterbestimmt. Zumal die neueren Debatten gezeigt haben, dass sie grundbegrifflich um die Konzepte von „Vertrauen“, „Verantwortung“ und „Würde“ nicht nur zu ergänzen, sondern auch grundbegrifflich neu zu konzipieren ist. Worum es in Zukunft gehen wird, das ist die Frage „würdevollen Aufwachsens“ – ein Thema, das noch seiner Entfaltung harrt.
Berlin, im Juli 2017
Anmerkungen
1SZ vom 5. Juli 2017, S. 9.
2a.a.O.
3V. Beck, Eine Theorie der globalen Verantwortung, Berlin 2016, S. 34 f.
4a.a.O., S.35.
5ders., Das Recht auf Rechtfertigung, Ffm. 2007.
6M. Brumlik, Pflicht zu Dankbarkeit und Fortpflanzung, in: ders., Advokatorische Ethik, a.a.O., S. 47-81; vgl. auch MacIntyre, Anerkennung der Abhängigkeit, a.a.O., S. 141 f.
7Kant, Metaphysik der Sitten, a.a.O., S. 395.
8A. Baier, a.a.O., S. 99.
9N. Luhmann, Vertrauen. Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität. Stuttgart 1989.
10C. Larmore, Das Selbst in seinem Verhältnis zu sich und zu anderen, Ffm. 2017, S. 131 f.
11A. Baier, Vertrauen und seine Grenzen, in: M.Hartmann/C.Offe (Hg.), Vertrauen. Die Grundlage des sozialen Zusammenhalts, Ffm. 2001, S. 37-85.
12M. Brumlik, Universalistische Moral ohne Gott? Emmanuel Levinas Ethik der Asymmetrie, in: Forum für Philosophie (Hg.), Nachmetaphysisches Denken und Religion, Würzburg 1996, S. 99-114.
13W. Kamlah, Philosophische Anthropologie – Sprachliche Grundlegung und Ethik, Mannheim 1973, S. 95.
14A. MacIntyre, Die Anerkennung der Abhängigkeit. Über menschliche Tugenden, Hamburg 2001.
15L. Winterhager–Schmid, „Groß“ und „Klein“ – Zur Bedeutung der Erfahrung mit Generationendifferenz im Prozeß des Heranwachsens, in: dies. (Hg.), Erfahrung mit Generationendifferenz, Weinheim 2000, S. 26.
16W. Wickler u. U. Seibt, Männlich – Weiblich. Ein Naturgesetz und seine Folgen, Heidelberg/Berlin 1998, S. 36.
17A. Scheunpflug, Biologische Grundlagen des Lernens, Berlin 2001, S. 117.
18A. Chaniotis, Kindheit und Lebenslauf. Untersuchungen zur evolutionären Psychologie der Lebensspanne, Bern 1999, S. 14; S. Blaffer Hrdy, Mutter Natur. Die weibliche Seite der Evolution, Berlin 2000, S. 550 f.
19L. Eliot, Was geht da drinnen vor? Die Gehirnentwicklung in den ersten fünf Lebensjahren, Berlin 2001.
20Blaffer Hrdy, a.a.O., S. 253.
21A. Bernard, Kinder machen. Samenspender, Leihmütter, Künstliche Befruchtung. Neue Reproduktionstechnologien und die Ordnung der Familie, Ffm. 2014.
22J. Habermas, Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik?, Ffm. 2001; vgl. auch A. Bernard, Kinder machen. Samenspender, Leihmütter, Künstliche Befruchtung. Neue Reproduktionstechnologien und die Ordnung der Familie, Ffm. 2014.
23R. Braidotti, Posthumanismus. Leben jenseits des Menschen, Ffm./N.Y. 2014.
24a.a.O., S. 74.
25a.a.O.
26Die Stufen des Organischen und der Mensch. Einleitung in die philosophische Anthropologie, Ffm. 2003.
27a.a.O., S. 95.
28H. Arendt, Vita activa oder Vom tätigen Leben. 10. Auflage. München, Zürich 1998.
29a.a.O., S. 102.
30a.a.O., S. 122.
31S. Blaffer Hrdy, Mutter Natur. Die weibliche Seite der Evolution, Berlin 1999, S. 290 f.
32R. Stoecker, In Würde altern, in: M. Brandhorst/E. Weber-Guskar (Hrsg.). Menschenwürde. Eine philosophische Debatte über Dimensionen ihrer Kontingenz, Berlin 2017, S. 338-360; K. Gröning/K. Heimerl, Menschen mit Demenz in der Familie. Ethische Prinzipien im täglichen Umgang, Wien 2012.
33Giovanni Pico della Mirandola, Über die Würde des Menschen, Zürich 2001.
34G. Manetti, Über die Würde und Erhabenheit des Menschen, Hamburg 1990; vgl. auch Th. Leinkauf, Grundriss Philosophie des Humanismus und der Renaissance (1350-1600), S. 128–158, Hamburg 2017.
35M. Brandhorst, Zur Geschichtlichkeit menschlicher Würde, in: Brandhorst/Guskar-Weber, a.a.O., S. 113–153.
36O. Sensen, Kants erhabene Würde, in: a.a.O., S. 154-177.
37I. Kant, Die Metaphysik der Sitten, in: ders., Werke Bd. 7, Darmstadt 1968, S. 526.
38A. Margalith, Politik der Würde, Berlin o. J., S.,72.
39Dazu ausführlich: M. Brumlik, Bildung und Glück. Versuch einer Theorie der Tugenden, Berlin 2002, S. 65 f.
40P. Levi, Ist das ein Mensch?; Die Atempause, München 1986, S. 164.
41A. Margalith, Politik der Würde, Ffm. 1999.
42I. Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft (RGV), B 155.
43R. Bittner, Abschied von der Menschenwürde, in: a.a.O., S. 91-112; U. Lohmar, Falsches moralisches Bewusstsein. Eine Kritik der Idee der Menschenwürde, Hamburg 2017.
44Ralf Stoecker, In Würde altern, in: E. Weber-Guskar, M. Brandhorst, a.a.O., S.
45J. Korczak, Das Recht des Kindes auf Achtung, Gütersloh 2007, sowie: G. Lohmann, Wohl und Würde. Zum antiautoritären Charakter der Bestimmung des Kindes in der Kinderrechtskonvention, in: Berliner Debatte Initial 28 (2017) 2, S. 1-9.
46B. Rössler, Autonomie. Ein Versuch über das gelungene Leben; sowie mit Bezug auf eine Ethik der Erziehung: J. Giesinger, Autonomie und Verletzlichkeit. Der moralische Status von Kindern und die Rechtfertigung von Erziehung, Bielefeld 2007.
Vorwort zur zweiten Auflage
Als die erste Auflage der Advokatorischen Ethik vor elf Jahren erschien und damit die Frage nach der „Legitimation pädagogischer Eingriffe“ gestellt wurde, waren ethisch-moralische Fragen weder in der Pädagogik noch im gesellschaftlichen Diskurs im allgemeinen so selbstverständlich wie heute. Ebensowenig hatten sich die heute höchst beunruhigenden gattungsethischen Fragen nach dem Verhältnis von Biologie, Individualität und Biotechnik, nach einem vorgeburtlichen Leben und einem „guten“ Tod in der Schärfe gestellt, wie das heute der Fall ist. Zwar etablierten sich in einzelnen therapeutischen Institutionen die ersten Ethik-Kommissionen, aber Fragen nach der rechtmäßigen Klonierung von Menschen, der Verwendung adulter Stammzellen zu therapeutischen Zwecken sowie Fragen nach den von den „Posthumanisten“ angedachten Umbauprogrammen der menschlichen Physis erregten die Öffentlichkeit keineswegs wie heute. Kurz: Die Debatte um „Anthropotechniken“, um den „Menschenpark“ und darüber, wer wie und warum festlegt und festlegen darf, welchen Wesens ein Mensch, ein einzelner Mensch sein soll, war noch nicht entbrannt. Debattiert wurde allenfalls, anhand später Ausläufer von antiautoritärer Erziehung und „Antipädagogik“, ob „Erziehung“ – seit jeher Inbegriff und Utopie der Menschenformung – zulässig sei oder nicht. Diese Frage, die in der zuständigen Wissenschaft sogar über Jahre dazu geführt hatte, den ungeliebten Begriff zu verbannen und ihn durch den vermeintlich mehr Freiheit verheißenden Begriff der „Bildung“ zu ersetzen bzw. sich mit der soziologischen Systemtheorie die quälende Frage zu stellen, ob Erziehung überhaupt möglich sei – diese Frage kann heute nur noch verwundern. Der Verkaufserfolg schlichter Erziehungsratgeber, verfaßt von FernsehsprecherInnen, Pfarrern und Journalisten beiderlei Geschlechts, zeigt eine Nachfrage an, die auf eine tiefe Verunsicherung schließen läßt. Ohne einem billigen kulturkritischen Tonfall nachzugeben, müssen sogar ernsthafte, keinem Katastrophismus zugeneigte Wissenschaftler wie der Kriminologe Christian Pfeiffer auf empirische Daten pochen, die unwiderleglich auf ein um sich greifendes Phänomen der durch Fernsehen und elektronisches Spielzeug bewirkten Wohlstandsverwahrlosung schließen lassen. Die PISA-Studien lassen zudem keinen Zweifel daran, daß geringe elterliche Sorge eine direkte Ursache von Leseschwäche ist, die ihrerseits zu erheblichen Lebensrisiken bei heranwachsenden, vor allem männlichen jungen Menschen führt.
Erziehung, das wird jetzt – angesichts guten sowie angesichts schlechten Rezeptwissens – wieder deutlich, ist nicht nur ein unumgehbares anthropologisches Faktum, sondern eine moralische Pflicht, die die jeweils älteren Generationen den nachrückenden schulden. Diesem Grundgedanken Immanuel Kants, daß nämlich das Zeugen und Gebären eines Menschen einem von ihm nicht gewollten Verpflanzen in eine zunächst feindliche Umwelt gleichkommt, ist der vorliegende Band ebenso verpflichtet, wie der frühen Einsicht, daß die entscheidenden ethischen Fragen sich eben nicht zwischen mündigen Menschen, sondern zwischen Mündigen und Unmündigen stellen. Als 1986 die „Ansprüche Unmündiger und Ungeborener“ zum ersten Mal als Problem der Diskursethik auftauchten, setzte sich derlei noch dem Verdacht eines unbegründeten Substantialismus aus, der sich – wie nur fünfzehn Jahre später in Habermas’ Entwurf einer „Gattungsethik“ unabweisbar deutlich wurde – nicht nur nicht vermeiden läßt, sondern offensiv aufzunehmen ist. Auf jeden Fall wurde diese Frage jetzt in einer „Ethik der Achtsamkeit“, wie sie Elisabeth Conradi im Jahr 2001 vorgelegt hat, ebenso expressis verbis aufgenommen, wie sie auch in der Professionstheorie der Sozialpädagogik, die inzwischen ihr Defizit an Ethik entdeckt hatte, intensiv diskutiert wurde. Ernst Martin ist der Professionstauglichkeit dieser advokatorischen Problematik in seiner ebenfalls im Jahr 2001 erschienenen Sozialpädagogischen Berufsethik, die sich „auf der Suche nach dem richtigen Handeln“ wähnt, gründlich nachgegangen. Auch im engeren Bereich der Sozialpädagogik, zumal dort, wo sie mit Fragen des Kindesrechts zu kollidieren scheint, hat zumindest der Begriff Karriere gemacht, in der Behindertenpädagogik, systematischen Überlegungen zu psychiatrischen Behandlungen und Unterbringungen ist er ebenso zu finden wie er die ethischen Debatten innerhalb von Diakonie und Caritas befruchtet hat.
Wenn ich nach vielen Jahren von meinen damaligen Überlegungen etwas zurückzunehmen hätte, dann den Titel und die mit ihm verbundene Sichtweise: Suggeriert er doch – aber so war der Zeitgeist, als einzelne Teile des Buches entstanden –, daß pädagogische Handlungen überhaupt legitimationsbedürftig seien. Pädagogische Handlungen sind – da für die materielle und geistige Reproduktion der Gattung unumgänglich – im Grundsatz nicht legitimationsbedürftig! Legitimationsbedürftig sind hingegen jeweils bestimmte Erziehungshandlungen, -institutionen und -systeme und dies vor der Folie ihrer selbst gesetzten Ziele. Das mag vor dem Hintergrund einer über sich selbst aufgeklärten Soziologie des Erziehungssystems naiv erscheinen, ist aber ebenso unumgänglich wie das Faktum der Erziehung selbst. Aus dieser Einsicht heraus habe ich mich Jahre später daran versucht, allgemeine, aber nicht nur formale Erziehungsziele unter dem Begriff anzustrebender Tugenden, die in moralischen Gefühlen wurzeln, zu postulieren, und konnte dabei an das anknüpfen, was im Vorwort zur ersten Auflage angestrebt wurde: eine Theorie moralischer Gefühle im menschlichen Entwicklungsprozeß. Auch in dieser Hinsicht hat sich der Wind in der allgemeinen ethisch-moralischen Debatte gedreht: Heute gilt sowohl unter Humanwissenschaftlern als auch unter MoralphilosophInnen kaum noch als fraglich, daß Gefühle alles andere als nur blinde Affekte sind. Es handele sich bei ihnen – wie die US-amerikanische Philosophin Martha Nussbaum soeben gezeigt hat – um zwar spontan und holistisch wirkende, auf jeden Fall lebensgeschichtlich verankerte Stellungnahmen, ohne die gleichwohl ein menschenwürdiges Aufziehen von Kindern und ein ebenso menschenwürdiges Sorgen um Alte und Gebrechliche unmöglich sei. Worauf es also ankomme, sei nicht, die Gefühle aus Theorien der Erziehung zu bannen, sondern sich darüber klar zu werden, wie sie zum Führen eines guten Lebens gebildet werden sollen: Das Projekt einer éducation sentimentale stellt sich aktueller denn je.
Frankfurt/Main im September 2003
Vorwort
Daß zwischenmenschliche Konflikte auf ihre Sachhaltigkeit hin zu überprüfen sind, daß Streitigkeiten, die durch widersprüchliche Ansprüche von Menschen auf Güter – auch zwischen den Generationen – entstehen, nach Kriterien von Fairness und Gerechtigkeit zu entscheiden sind, erscheint heute, zu Beginn der neunziger Jahre, selbstverständlich. Spätestens seit dem Entstehen der „Neuen Sozialen Bewegungen“, von Friedens-, Frauen- und Ökologiebewegung trägt auch die politische Debatte weitgehend moralische Züge. Sei es in der Frage nach der Legitimität nuklearer Rüstung, in den Debatten über die Zumutbarkeit der Restrisiken von Atomkraftwerken oder Gefahren genetischer Grundlagenforschung, handele es sich um Forderungen nach der Bestrafung von Vergewaltigung in der Ehe hier und dem Verbot der Abtreibung dort – die Einsicht, daß der Rückgriff auf Klasseninteressen oder Funktionserfordernisse alleine kein Problem löst, hat um sich gegriffen.
Das war nicht immer so. Als vor mehr als zwanzig Jahren eine systemkritische Opposition an den Universitäten die von den Nationalsozialisten verfemten Wissenschaftsrichtungen Psychoanalyse und Marxismus aufnahm und als ideologiekritische Hermeneutik des Verdachts wider die verkrusteten und verlogenen Verhältnisse im westlichen Teil Nachkriegsdeutschlands in Stellung brachte, schien unbezweifelbar, daß moderne Sozialwissenschaft vor allem Kritik zu sein habe. Dieser Einstellung hat gerade die neuere Erziehungswissenschaft, zumal in der Sozialpädagogik, unendlich viel zu verdanken. Der nüchterne Blick hinter jene objektiven Interessen, die die „Entwicklungstatsache“ Erziehung (S. Bernfeld) jeweils zurichteten und dann mit der Weihe höherer Begriffe zu verschleiern suchten, versetzte die neuere Erziehungswissenschaft überhaupt erst in die Lage, sich ihres Gegenstandsbereiches mit den Mitteln einer Sozialwissenschaft anzunehmen. Die „Hilfe zur Selbsthilfe“, der „pädagogische Bezug“, das „Wohl des Kindes“, das „Individualitätsprinzip“, die „pädagogische Autonomie“, all jene Begriffshülsen verloren ihren ohnehin schon dünn gewordenen Nimbus und wurden als ideologischer Ausdruck von Herrschaftsstrategien entlarvt.