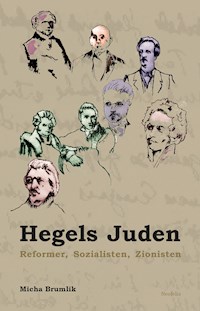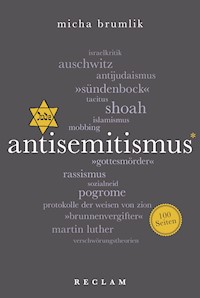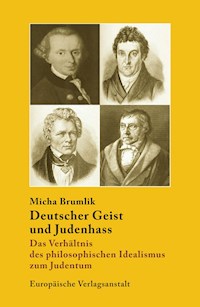
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CEP Europäische Verlagsanstalt
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Kant, Fichte, Schleiermacher, Hegel, Schelling oder Marx – alle haben sich auf die eine oder andere Weise mit dem Judentum auseinandergesetzt – entweder traten sie für die Rechte der Juden ein oder nicht, befürworteten die Gleichstellung oder waren dagegen. Dieses Verhältnis prägte ihr Denken und damit die deutsche Geistesgeschichte. Der deutsche Idealismus ist von weltanschaulichen Neuorientierungen geprägt. Die Zeit nach der Französischen Revolution war die Epoche der Judenemanzipation, die aber auch durch einen neu aufkommenden Antisemitismus geprägt war. Vor diesem Hintergrund untersucht Micha Brumlik die Kernbestandteile der Philosophie aus Deutschland auf ihren Antisemitismus und Verhältnis der deutschen Idealisten zum Judentum. Die Spanne reicht von Kant, der die Erhabenheit der Gesetzte im Judentum bewunderte, ihm aber zugleich die "Euthanasie" wünschte, über Fichte, dem ohne persönliche Leidenschaft argumentierenden Judenfeind, bis hin zu Marx, dem Juden unsympathisch waren, auch wenn er selbst jüdischer Herkunft war. Auch die Haltung Schleiermachers, dem sehr viel an der Bekehrung seiner jüdischen Freundin Henriette Herz lag, der jedoch sonst keine jüdischen Konvertiten mochte, wird untersucht. Eine zentrale Rolle spielen Hegel, der sich für die politischen Rechte der Juden einsetzte und sich gegen die antisemitische Deutschtümelei wandte und Schelling, der ein hervorragender Kenner der Kabbala war. Brumlik klärt dieses von Hass bis Achtung reichende hochkomplexe Verhältnis, welches den Idealismus stärker prägte als bisher angenommen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 506
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Der deutsche Idealismus ist von weltanschaulichen Neuorientierungen geprägt. Die Zeit nach der Französischen Revolution war die Epoche der Judenemanzipation, die aber auch durch einen neu aufkommenden Antisemitismus geprägt war. Micha Brumlik untersucht die Kernbestandteile der Philosophie aus Deutschland auf ihren Antisemitismus und Verhältnis der deutschen Idealisten zum Judentum. Die Spanne reicht von Kant, der die Erhabenheit der Gesetze im Judentum bewunderte, ihm aber zugleich die „Euthanasie“ wünschte, über Fichte, den ohne persönliche Leidenschaft argumentierenden Judenfeind, bis hin zu Marx, dem Juden unsympathisch waren, auch wenn er selbst jüdischer Herkunft war. Eine zentrale Rolle spielen Hegel, der sich für die politischen Rechte der Juden einsetzte und sich gegen die antisemitische Deutschtümelei wandte, und Schelling, der ein hervorragender Kenner der Kabbala war. Brumlik klärt dieses von Hass bis Achtung reichende hochkomplexe Verhältnis, welches den Idealismus stärker prägte als bisher angenommen.
Micha Brumlik lehrte Erziehungswissenschaft in Hamburg und Heidelberg. 2000–2013 Professor am Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft der J. W. Goethe-Universität Frankfurt/M. und bis 2005 Direktor des Fritz Bauer Instituts. Seit 2013 ist er Senior Professor am Zentrum für Jüdische Studien Berlin/Brandenburg und seit 2017 auch an der J. W. Goethe-Universität, Frankfurt/M. 2003 erhielt er die Hermann-Cohen-Medaille und 2016 die Buber-Rosenzweig-Medaille. Zahlreiche Veröffentlichungen, bei EVA erschienen u.a.: »Aus Katastrophen lernen«; »Vernunft und Offenbarung“; »Advokatorische Ethik. Zur Legitimation pädagogischer Eingriffe«, »Luther, Rosenzweig und die Schrift. Ein deutsch-jüdischer Dialog«, »Bildung und Glück«, »ad Ernst Bloch. Naturrecht und menschliche Würde«.
Micha Brumlik
Deutscher Geist und Judenhass
Das Verhältnis des philosophischen Idealismus zum Judentum
E-Book (EPUB)
© CEP Europäische Verlagsanstalt GmbH, Hamburg 2022
Alle Rechte vorbehalten.
EPUB: ISBN 978-3-86393-597-9
Auch als gedrucktes Buch erhältlich:
Print: ISBN 978-3-86393-139-1
Informationen zu unserem Verlagsprogramm finden Sie im Internet unter www.europaeischeverlagsanstalt.de
Inhalt
Vorwort zur Neuausgabe
Einleitung
I.Kants Theorie des Judentums – Die Euthanasie des statutarischen Gemeinwesens
II.Poetischer Geist und nüchterne Wahrnehmung: Johann Gottfried Herders Blick auf Judentum und Juden
III.Geheimer Staat und Menschenrecht – Fichtes Antisemitismus der Vernunft
Benjamin Netanjahu, Johann Gottlieb Fichte und die Idee des Zionismus
IV.Schleiermacher – Ein Glaube und eine Freundin
V.Hegel – Der Jude Jesus, die Positivität des Christentums und die Religion des Erhabenen
VI.Schelling – »Dem Reich Gottes vorbehalten«
VII.Karl Marx – Emanzipation vom Judentum?
Anmerkungen
Personenregister
LASST EUCH aber nicht bange sein, ihr deutschen Republikaner; die deutsche Revolution wird darum nicht milder und sanfter ausfallen, weil ihr die Kantsche Kritik, der Fichtesche Transzendental-Idealismus und gar die Naturphilosophie vorausging. Durch diese Doktrinen haben sich revolutionäre Kräfte entwickelt, die nur des Tages harren, wo sie hervorbrechen, und die Welt mit Entsetzen und Bewunderung erfüllen können. Es werden Kantianer zum Vorschein kommen, die auch in der Erscheinungswelt von keiner Pietät etwas wissen wollen, und erbarmungslos mit Schwert und Beil den Boden unseres europäischen Lebens durchwühlen, um auch die letzten Wurzeln der Vergangenheit auszurotten. Es werden bewaffnete Fichteaner auf den Schauplatz treten, die in ihrem Willensfanatismus weder durch Furcht noch durch Eigennutz zu bändigen sind. […] Doch noch schrecklicher als alles wären Naturphilosophen, die handelnd eingriffen in eine deutsche Revolution und sich mit dem Zerstörungswerk selbst identifizieren würden.
Heinrich Heine,Zur Geschichte der Religion undPhilosophie in Deutschland, 1834
Vorwort zur Neuausgabe
In diesem Jahr, 2022, ist es mehr als zwanzig Jahre her, dass mein Buch „Deutscher Geist und Judenhass“ erstmals erschien, dem zwei Jahre später eine unveränderte Taschenbuchausgabe folgte. Damals, um die Zeit der Jahrtausendwende, beschäftigte mich diese Thematik wieder einmal intensiv, war ich doch seit Beginn meines Philosophiestudiums an der Frankfurter Goethe-Universität im WS 1969/70 von der Philosophie des Deutschen Idealismus fasziniert – nicht zuletzt durch die Vorlesungen des Philosophen Wolfgang Cramer. Vermittelt über meine Freunde Dieter Maier, der sich bis heute unermüdlich für die Menschenrechte zumal in Lateinamerika einsetzt, und den viel zu früh verstorbenen Norbert Gersch eignete ich mir die Philosophie Johann Gottlieb Fichtes an, und zwar in den Seminaren des 1979 verstorbenen glühenden Idealisten und Fichteaners Dr. Willi Lautemann. Es war dieses Milieu, das mich zum Kantianer und damit zum Gegner der damals am philosophischen Seminar vorherrschenden Kritischen Theorie werden ließ. Anders Gertrud Koch und Hauke Brunkhorst, über die ich diese Theorie denn doch schätzen lernte und die mir nicht nur Freundin und Freund, sondern unverzichtbare GesprächspartnerInnen waren und bis heute geblieben sind.
Erst mit den Jahren – immer wieder mit der „Dialektik der Aufklärung“ konfrontiert – verstand ich die antijudaistischen Teile der idealistischen Philosophie besser: die erste Auflage meines Buches zeugt von diesem Lernprozess. Dabei war und ist, wenn es um modernen Antisemitismus geht, Cilly Kugelmann nicht nur Freundin, sondern ein unbestechlicher, kritischer Geist.
Zwei Jahrzehnte nach dem Erscheinen der ersten Auflage, viel zu spät, wurde ich durch die Lektüre von Jürgen Habermas’ monumentaler „Auch eine Geschichte der Philosophie“ auf Johann Gottlieb Herder aufmerksam, bei dem ich einen ganz anderen, nicht im geringsten antijudaistischen Blick auf das Judentum, bzw. dessen biblischen Glauben vorfand.
Davon zeugt das neue zweite Kapitel dieser Ausgabe. Darüber hinaus enthält sie noch weitere Ergänzungen: u.a. eine Darstellung der ausgerechnet jüdischen, positiven Rezeption des judenfeindlichen Fichte durch den frühen Prager Zionismus; sowie Hinweise darauf, dass nicht einmal Karl Marx die Sklavenwirtschaft der amerikanischen Südstaaten richtig eingeschätzt hat, und weitere Hintergrundinformationen zum Streit zwischen Karl Marx und Bruno Bauer über die „Judenfrage“.
Dass ich diese Arbeit in Muße und Gelassenheit fertigstellen konnte, ist nicht zuletzt Christina von Braun zuzurechnen: sie hat mich 2013 an das „Selma Stern Zentrum für Jüdische Studien Berlin/Brandenburg“ berufen. Dafür sei ihr herzlich gedankt. Meiner ebenfalls am Selma Stern Zentrum tätigen Kollegin und Freundin Irmela von der Lühe danke ich für intensive, ungemein produktive Gespräche und Debatten. Wie nur wenige andere ist sie in der Geschichte der deutschen, der jüdischen Exilliteratur sowie dem Werk von Thomas Mann, seiner Familie und somit der gesamten deutschen Geistesgeschichte bestens vertraut.
Schließlich habe ich Irmela und Axel Rütters nicht nur für die gelungene Edition meiner erziehungsphilosophischen Schriften zu danken, sondern auch dafür, diese überarbeitete, durchgesehene und ergänzte Auflage meines Buches ermöglicht zu haben.
Last but not least habe ich jedoch meiner Lebensgefährtin, meiner Frau Renate Nyssen-Brumlik zu danken, die mir seit mehr als fünfzig Jahren in jeder Hinsicht zur Seite steht und es mir erst so ermöglicht hat, ein Buch wie das vorliegende zu schreiben; daher sei dieses Buch ihr gewidmet.
Berlin, 4.3.2022
Micha Brumlik
Einleitung
Utopien, so lehrt uns Ernst Bloch am Ende des Prinzips Hoffnung, sind Ausdruck der Vorgeschichte des Menschen und verweisen auf eine Genesis, die nicht am Anfang geschah, sondern am Ende geschehen wird. Der arbeitende, schaffende Mensch, die Wurzel der Geschichte, soll seine Gegebenheiten umbilden und überholen. Hat er das Seine erfasst und es ohne Entfremdung in realer Demokratie begründet, so entsteht in der Welt etwas, »das allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war: Heimat«,1 schrieb Bloch, Atheist, Kommunist und Jude. Wenn es in der deutsch-jüdischen Symbiose um etwas ging, dann um Heimat, um ersehnte und verweigerte Heimat. Utopien sind Unorte. Sie bezeichnen etwas, das fehlt, und gehen mit Schmerz einher, in dem sich Sehnsucht verbirgt. In die Sehnsucht mischt sich gelegentlich die Hoffnung auf Erfüllung. Ob sich die Sehnsucht erfüllen wird, ist schwer zu ermessen, und die Hoffnung, in die sie mündet, ist von keiner Zuversicht getragen.
Wenn ich an deinem Hause
Des Morgens vorübergeh
So freuts mich, du liebe Kleine
Wenn ich dich am Fenster seh.
Mit deinen schwarzbraunen Augen
Siehst du mich forschend an:
Wer bist du, und was fehlt dir,
Du kranker, fremder Mann?
Ich bin ein deutscher Dichter
Bekannt im deutschen Land;
Nennt man die besten Namen,
So wird auch der meine genannt.
Und was mir fehlt, du Kleine
Fehlt manchem im deutschen Land;
Nennt man die schlimmsten Schmerzen,
So wird auch der meine genannt.2
Der Dichter, der diese Verse in den frühen zwanziger Jahren des neunzehnten Jahrhunderts verfasste, starb nicht im deutschen Land, sondern etwa dreißig Jahre später in der Pariser Emigration. Das Bild, das er in diesem Gedicht von sich zeichnete, ist von Selbstbewusstsein ebenso geprägt wie von Selbsterkenntnis. Indem er zur Kenntnis nahm, dass jenes Wesen, an dem er sich freute, ihn als fremd und krank identifizierte, zögerte er nicht, den beobachteten Mangel zu beglaubigen. Scham schien er nicht zu kennen. Aber fehlt das, was ihm fehlte, wirklich auch anderen? Was ihm fehlte und was die Schmerzen verursachte, verschweigt das lyrische Ich. Die Antwort scheint zwanzig Jahre später zu ergehen:
Und als ich die deutsche Sprache vernahm,
Da ward mir seltsam zumute;
Ich meinte nicht anders, als ob das Herz
Recht angenehm verblute.3
Der Schmerz, der hier aufgerufen wird, ist der Schmerz der Sehnsucht, der Sehnsucht nach der deutschen Sprache. Sie zu hören und zu sprechen, so wollte uns Heinrich Heine 1844 offenbar mitteilen, schmerzte ihn auf angenehme Weise. War es die fehlende Zugehörigkeit, die das Mädchen mit den dunklen Augen erkannte? Die Sprache, deren Klang ihm das Herz bluten ließ, die ihn in ihrer Schönheit und Vertrautheit überwältigte, war seine Sprache. Und trotzdem fehlte etwas. Denn mehr als die Sprache noch schien ihn Hoffnung auf Heimkehr zu beflügeln:
Seit ich auf deutsche Erde trat,
Durchströmen mich Zaubersäfte –
Der Riese hat wieder die Mutter berührt,
Und es wuchsen ihm neue Kräfte.4
Das berühmte »Caput I« des Wintermärchens hat in den meisten Strophen mit der Nation und ihrer Sprache nur wenig zu tun. Bekannt wurde dieses Gedicht als Ausdruck einer übermütigen, provokativ materialistischen Haltung, die den Himmel den Engeln und den Spatzen überlassen will und feststellt, dass es hienieden für alle Menschenkinder genug Brot gebe und Zuckererbsen für jedermann: Das, was am Ende dieses Jahrhunderts als Erbsünde aller Totalitarismen gilt, forderte Heine unverblümt:
Wir wollen hier auf Erden schon
Das Himmelreich errichten.
Waren es die miserablen sozialen und politischen Verhältnisse in Deutschland, die Heine schon früh in seine Krankheit trieben? Die oben zitierte, entscheidende Strophe hält fest, dass es die Berührung der deutschen Erde war, die ihm neue Kräfte gab. Utopien sind Unorte wie die Sprache, deren schöner Klang die schmerzlich-unerfüllbare Sehnsucht hervorruft. Im Unterschied zur Sprache flößt das Betreten deutscher Erde neue Kräfte ein. Schöner Schmerz durch die Sprache, Kraft aus der Erde, beide umreißen den Mangel.
Aber ist nicht auch die deutsche Erde ein Unort? Heine besang sie in einem Gedicht, das in deutscher Sprache verfasst ist. Sie hat ihren Platz in einem mit überwältigenden Gefühlen verbundenen Unort, der deutschen Sprache. Die Erde, die Heine meinte – vielleicht können wir von Heimat sprechen –, findet sich nur im »Unort« seiner deutschen Sprache. Als fremd und krank erkannt, suchte er auf der nur im Gedicht berufenen deutschen Erde sein Leid zu lindern. Der Widerspruch zwischen der Erfahrung der unaufhebbaren Trennung und dem Wissen um die magische Kraft der sprachlichen Heimat, die Spannung zwischen eigener Fremdheit und Vertrautheit der deutschen Sprache sowie die Hoffnung, sie zu lösen – das war das Fundament der sogenannten deutsch-jüdischen Symbiose.
Ihr beziehungsweise den Anstrengungen mancher Jüdinnen und Juden, sie zu leben, war nur eine knappe Zeit bemessen. Sie währte einhundertunddreiundsiebzig Jahre – vom Jahr 1743, in dem der Philosoph Moses Mendelssohn, aus Dessau kommend, in Berlin eintraf, bis zum Frühjahr 1916, als die deutsche Heeresleitung, von antisemitischen Massenorganisationen bedrängt und selbst judenfeindlich eingestellt, eine »Judenzählung« durchführen ließ.
Schon 1834 hatte Heine eine deutsche Revolution vorausgesagt, die – geführt vom Geist der Philosophie des Deutschen Idealismus – verheerender sein werde als alle bisherigen. Und wiewohl er es war, der schon damals wusste, dass dort, wo man Bücher verbrannte, auch bald Menschen brennen würden, konnte er den Nationalsozialismus, dem sechs Millionen europäischer Juden zum Opfer fallen sollten, weder erahnen noch vorhersagen. Dass das Biedermeier, in dem Heine lebte, weit weniger harmlos war, als gemeinhin geglaubt, hat die historische Forschung erwiesen. Die Rückseite der Idylle war allemal die Mordlust – eine Tatsache, von der die Prügelszene in Wagners »Meistersingern« zeugt, unabhängig davon, ob der antisemitische Komponist in Beckmesser einen jüdischen Intellektuellen karikierte oder nicht.
Mehr als einhundertundfünfzig Jahre nach der Blütezeit des Deutschen Idealismus, durch die unüberbrückbare Zäsur Auschwitz von ihr getrennt, wurde die Frage nach dem mörderischen Potential von Teilen der deutschen Kultur mit dem Streit über Daniel Jonah Goldhagens Buch Hitlers willige Vollstrecker von neuem gestellt. Die Schachzüge des Autors, sich fachlicher Kritik zu entledigen, haben es der Öffentlichkeit leicht gemacht, die Debatte ad acta zu legen. Aber auch der Nachweis methodischer Mängel erübrigt die Auseinandersetzung über zwei Fragenkomplexe, die hier aufgeworfen wurden, nicht: Zum einen, was ist unter »eliminatorischem Antisemitismus« zu verstehen, und, daran anschließend, wie unterscheiden sich »eliminatorische« und »dissimilatorische« (Hans Mommsen) Judenfeindschaft? Zum zweiten, welche verhaltens- und einstellungsprägende Funktion kommt Ideologien und Theorien zu, und wie kann sie im Einzelfall erwiesen werden?
Es ist sozialgeschichtlich inzwischen unbestritten, dass wesentliche Teile des akademisch gebildeten deutschen Bürgertums an der Massenvernichtung, sei es als Täter oder als Mitläufer, mitgewirkt haben. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage nach der Rolle der idealistischen Philosophie. Dass Adolf Eichmann irrte, als er sich während seines Prozesses auf Immanuel Kant und dessen Pflichtbegriff bezog, liegt auf der Hand. Weniger abwegig ist die Legitimität der Bezugnahme auf Johann Gottlieb Fichte durch Angehörige der völkischen Intelligenz. Fraglich ist auch, ob sich judenfeindliche Theologen der deutschen Christen zu Unrecht auf Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher bezogen. Andererseits fällt auf, dass Bezugnahmen auf Friedrich Wilhelm Joseph Schelling und Georg Wilhelm Friedrich Hegel in diesem Kontext eher dünn gesät sind. Schließlich – aber hier tritt der Bezug zum Nationalsozialismus in den Hintergrund – müsste untersucht werden, ob und in welchem Ausmaß Karl Marx’ früher Text »Zur Judenfrage« die anders gelagerte Form der Judenfeindschaft im sowjetischen Machtbereich und später in Teilen der westlichen neuen Linken befördert hat. Marx steht als bedeutendster Schüler Hegels am Ausgang des Deutschen Idealismus, einer Tradition, der er noch im Bruch mit ihr angehört.
1798, neun Jahre nach Ausbruch der Französischen Revolution und acht Jahre nach der bürgerlichen Gleichstellung der Juden im republikanischen Frankreich, verfasste Kant eine Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, in der er nüchtern vermerkte, dass die »unter uns lebenden Palästiner […] durch ihren Wuchergeist seit ihrem Exil in den nicht unbegründeten Ruf des Betruges«5 gekommen seien. Ein Reisender berichtete von Gesprächen mit Kant zur selben Zeit, in welchen dieser die Juden als die »Vampyre der Gesellschaft« bezeichnet habe.6 Heute, nach der Massenvernichtung der europäischen Juden, schockieren Äußerungen Kants wie die folgende: Die rein moralische Religion sei die »Euthanasie des Judentums«.7 In Königsberg, das Kant zeit seines Lebens nicht verließ, war 1756 die erste Synagoge errichtet worden. Ende des achtzehnten Jahrhunderts lebten dort etwa siebenhundert Juden. Die Universität Königsberg wurde zu einem Zentrum der jüdischen Aufklärung.
In den deutschen Staaten mit Ausnahme der Habsburger Monarchie lebten zu Beginn des Jahrhunderts ungefähr siebzigtausend Jüdinnen und Juden; die Spanne reichte von etwa drei Prozent der Gesamtbevölkerung in Baden bis 0,2 Prozent in Ostpreußen8 Mitte des achtzehnten Jahrhunderts war die Anzahl auf eine Viertelmillion gestiegen, immer noch kaum mehr als ein Prozent. Das war in den deutschsprachigen Teilen der Habsburger Monarchie, in Böhmen, Mähren und Niederösterreich kaum anders. Die Vielfalt und Unübersichtlichkeit verschiedenster Gewerbeordnungen erlaubt nur ungefähre Aussagen über ihre ökonomische Lage. Nach offiziellen Statistiken ging der Anteil der im Handel tätigen Juden gemessen an der jüdischen Gesamtbevölkerung in den deutschen Staaten vom Beginn des achtzehnten Jahrhunderts bis zur Jahrhundertmitte von siebzig bis achtzig Prozent auf etwa fünfzig Prozent zurück; demgegenüber stieg der Anteil jüdischer Unternehmen in Landwirtschaft und Handwerk.9
Im Jahr 1843 verfasste Marx die ein Jahr darauf in Paris erschienene Rezension »Zur Judenfrage«, in der er sich mit zwei Artikeln des Junghegelianers Bruno Bauer kritisch auseinandersetzte. Die Abhandlung strotzt nur so von antisemitischen Bemerkungen wie der folgenden: »Wir erkennen also im Judentum ein allgemeines gegenwärtiges antisoziales Element.«10
Die vorliegende Studie untersucht einen Zeitraum von knapp sechzig Jahren zwischen dem Ausbruch der Französischen Revolution und der bürgerlichen Revolution von 1848, also die erste Hälfte des »langen neunzehnten Jahrhunderts« (Eric Hobsbawm). Sie beginnt mit der Frage nach Kants Haltung zum Judentum in den neunziger Jahren des achtzehnten Jahrhunderts und endet mit dem Marx des Vormärz.
Es geht nicht – wie in den Untersuchungen von Hans Liebeschütz, Edmund Silberner und Daniel Goldhagen – um den sattsam erbrachten Nachweis, dass sich im Werk dieser Autoren judenfeindliche Äußerungen finden, sondern um die Frage, welche Funktion, welches Gewicht und welche Bedeutung diese Äußerungen im Kontext des Gesamtwerks der Philosophen und damit in der gesamten »Deutscher Idealismus« genannten Denkbewegung haben. Diese Aufgabe wirft eine Reihe methodischer und methodologischer Schwierigkeiten auf. Jeder Text, und damit auch die Texte der hier behandelten Autoren, wird vor allem von drei Aspekten geprägt: der Zeit, in der er verfasst wurde, das heißt der sozioökonomischen Situation mit ihren Einschränkungen und Chancen, der idiosynkratisch-biographischen Erfahrung, die der Autor während seines Sozialisationsschicksals macht, und der Stringenz und Wahrheit der Argumentation, die der Autor wiederum innerhalb einer vorgefundenen und weiterentwickelten Semantik entfaltet. Ob, wie und schließlich warum die Philosophen Juden und das Judentum so und nicht anders sahen, lässt sich demnach nur beantworten, wenn historische und gesellschaftliche Fakten mit lebensgeschichtlichen Daten und systematischer Argumentation konfrontiert werden.
Wie diese drei Aspekte aufeinander zu beziehen sind, lässt sich nicht pauschal festlegen. Eine biografiebezogene Ideologiekritik sollte wohl erst unternommen werden, wenn sich herausgestellt hat, dass die Sichtweise eines Autors im Widerspruch zu erwiesenen Tatsachen steht. Die Frage, ob dieser Autor überhaupt die Chance hatte, die Dinge anders denn verzerrt wahrzunehmen und zu bewerten, ist allerdings schwer zu beantworten und durch die unbearbeiteten Hinterlassenschaften der Goldhagen-Debatte nicht leichter geworden. Die folgende Studie hat allerdings den Vorteil, dass die Auffassungen, Sichtweisen und Bewertungen der Autoren nicht unterschiedlicher sein könnten.
Für Kant, der einem moralistischen Agnostizismus das Wort redete, war das Judentum im besten Falle eine Instanz, die die Erhabenheit des moralischen Gesetzes illustrierte, während er die Juden im Allgemeinen und einzelne ihm bekannte Juden auf der Basis gängiger Vorurteile verachtete. Ob sein Wunsch nach einer »Euthanasie des Judentums« tatsächlich Todeswünsche enthielt, wird zu untersuchen sein; ähnliche Wünsche bezüglich des Christentums äußerte er jedenfalls nicht. Sein Schüler Johann Gottlieb Fichte stellt demgegenüber den instruktiven Fall eines ohne persönliche Leidenschaft argumentierenden Judenfeindes dar, der von seinen ersten bis zu seinen letzten Schriften mal politische, mal religionsphilosophische Abwertungen des Judentums vortrug. Hegels Bild des Judentums wandelte sich im Laufe seines Lebens mehrere Male – angefangen von seinen theologischen Jugendschriften, in denen das Judentum als Inbegriff der Positivität herhalten musste, bis zu seinen späten systematischen Erörterungen, in denen es – weitaus stärker als bei Kant – als Ausdruck einer Kultur und Religion der Erhabenheit fungierte. Hegel war in engster Fühlung mit den politischen Ereignissen der Epoche willens und in der Lage, seine ursprüngliche Konzeption zu ändern. Was indes der vermeintlich Konservative vermochte, misslang einem liberalen Geist wie Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, der in seiner Berliner Jünglingszeit im Unterschied zu den anderen Philosophen engsten persönlichen Kontakt zu emanzipationswilligen Juden und vor allem Jüdinnen hatte. Am Falle Schleiermachers wird deutlich, wie eng das idealistische Programm mit dem Christentum verknüpft war, ohne dass behauptet werden kann, der Deutsche Idealismus sei ausschließlich eine Philosophie aus dem Geist des Christentums. Allerdings ist jede Aussage dieser Autoren über das Judentum zugleich eine Auskunft über ihr Christentum, und ihr Verständnis des Christentums impliziert immer – so wie es in der gesamten Geschichte des Christentums war – eine bestimmte Deutung des Judentums. Dies zeigt sich in besonderer Weise bei Schelling, dem wohl einzigen Autor, der das Judentum, seine Sprache und insbesondere seine mystische Tradition studierte und in sein System aufnahm. Marx, der als einziger selbst als Jude geboren wurde, nahm systematisch nur einmal, in der schon erwähnten frühen Schrift »Zur Judenfrage«, auf das Judentum Bezug. Dieser Text zehrt von Hegels System, Ludwig Feuerbachs Materialismus und dem französischen Frühsozialismus, dessen Vertreter mit wenigen Ausnahmen Antisemiten waren. Dass Marx seine systematische Argumentation nie wiederholt hat und seinem Judenhass allenfalls in persönlichen Invektiven freien Lauf ließ, mag indes am systematischen Problem seiner frühen Schrift gelegen haben. Die Frage, warum die linken Hegelianer auch dann noch, als sie die christlich getönte Philosophie des Deutschen Idealismus aufgegeben hatten, gleichwohl an dessen antijudaistischen Einstellungen festhielten, ist zugleich die Frage nach dem nicht nur expliziten, sondern eben auch implizit christlichen Gehalt dieser Philosophie. Ihn genauer zu bestimmen wird durch eine symptomatologische Untersuchung der Bilder vom Judentum möglich.
Diese Untersuchung möchte symptomatische Zusammenhänge und Muster ihrer Deutung aufzeigen. Dabei geht es um die Frage, wie bestimmte Konzeptionen des christlichen Glaubens, der Freiheit, der Geschichte und der Erlösung sich in der Vorstellung vom Judentum niedergeschlagen haben. Sollte sich erweisen, dass bestimmte Konzeptionen immer mit artikulierter Judenfeindschaft einhergehen, während andere bis in den Bereich des Politischen frei davon sind, wären nicht nur Anfragen an eine bis heute gültige, systematische christliche Theologie zu stellen, sondern es öffnete sich zugleich ein neuer Weg innerhalb des christlich-jüdischen Dialogs. Hier galten die Bemühungen in den letzten drei Jahrzehnten vor allem exegetischen Fragen neutestamentlicher Wissenschaft und einer ethischen Selbstvergewisserung der christlichen Kirchen vor dem Hintergrund des Holocaust und ihrer Beteiligung an dem Massenmord an den europäischen Juden.
Die idealistischen Philosophen haben auch außerhalb ihrer religionsphilosophischen Schriften eine Höhe der Argumentation über den Glauben des Abendlandes vorgegeben, die heute noch hilfreich sein kann, wenn es um die Klärung letzter Entscheidungen in religiösen Fragen beziehungsweise um die vernunftgemäße Vergewisserung unserer Annahmen über Geschichte, Existenz und Heil geht. Das liegt insbesondere daran, dass die im Idealismus kulminierende Aufklärung in Deutschland niemals atheistisch oder agnostisch vorging. Wo in England ein Agnostizismus oder Deismus eine mehr oder minder zwanglose Verbindung mit einem den Kirchgang als Institution schätzenden, konventionellen Feiertagschristentum einging, herrschte in Frankreich ein radikaler Atheismus vor, der in seiner Absolutheit der christlichen Religion gleichwertig sein wollte. In Deutschland hingegen blühte spätestens seit Lessing eine die universalistischen Gehalte der christlichen Religion aufnehmende und transformierende Aufklärung, die sich zunächst neben der entstehenden, historisch arbeitenden Bibelkritik behaupten musste. Frühestens mit Johann Salomo Semler, spätestens mit Johann David Michaelis und Hermann Samuel Reimarus wandte sich die Aufklärung der historischen Kritik unüberprüfter orthodoxer Wahrheiten zu. Durch Lessing kam sie zu dem Schluss, das Wesen der Evangelien eher in künftig zu realisierenden Verheißungen als in vergangener Offenbarung zu sehen.
Das hatte mehr sozial- und weniger geistesgeschichtliche Gründe. Die intellektuellen Bannerträger der Aufklärung in Deutschland entstammten einem christlichen, meist protestantischen Milieu. Diesen jungen Männern waren als nicht besitzenden, nicht adligen Kleinbürgern in den spätabsolutistischen höfischen Staaten und Kleinstaaten große Karrieren im Allgemeinen versagt. Als Tätigkeit, die eine sichere Lebenszeitstellung mit einem hohen Prestigewert verbinden konnte, blieb häufig nur das Pfarramt, das aber erst nach einer meist als bedrückend erlebten Zeit als Hauslehrer in einer wohlhabenden Familie erreicht werden konnte. Auf jeden Fall galt vor der preußischen Reform von 1812 das Studium der evangelischen Theologie als gleichsam natürliche Voraussetzung einer Laufbahn im Bildungswesen.
So hatten mit Ausnahme von Kant und Marx alle hier untersuchten Denker: Fichte, Schleiermacher, Hegel und Schelling, ihren Bildungsgang als Theologen begonnen. Ihr Studium verhalf ihnen zur Kenntnis der alten Sprachen einschließlich des Hebräischen sowie der biblischen Schriften. Alle letztgenannten entstammten einem christlichen Milieu, Fichte einer Familie kleinbürgerlicher Lutheraner, Schleiermacher der Herrnhuter Brüdergemeinde, Hegel dem Milieu des schwäbischen Pietismus und Schelling ebenfalls dem lutherischen Bürgertum. Katholische oder calvinistische Hintergründe spielten auffälligerweise keine Rolle. Dass zumindest bei Schelling katholische Motive im Laufe seines Lebens immer wichtiger wurden, lässt sich jedenfalls nicht mit seiner Herkunft erklären, sondern mit den systematischen Erfordernissen seiner philosophischen Theoriebildung.
Der lutherische und pietistische Hintergrund legte das Hauptgewicht auf drei Motive, die später wieder und wieder aufgenommen, systematisiert, variiert und weiterentwickelt wurden: ein Christozentrismus, eine von Luther geprägte paulinische Gesetzeskritik und eine mit einer Theologie des Heiligen Geistes versehene Lehre von der christlichen Gemeinde. Demgegenüber blieben das calvinistische Motiv eines radikalen Wortglaubens, dem es um die gerechte Ordnung des Diesseits ging, das katholische Programm einer nicht nur an Worten orientierten, sondern auch auf Taten ausgerichteten Rechtfertigung des Gläubigen sowie ein die menschliche Vernunft als göttliche Gabe, als natürliches Licht anerkennender scholastischer Rationalismus im Hintergrund. Dass letzteres Motiv, das wie gesagt den hier behandelten Denkern nicht in die Wiege gelegt worden war, sie später dennoch provozieren musste, lag an ihrem Willen zur Philosophie; so wollten sie den Geist des Christentums aus einer anderen Instanz als der des Glaubens erklären. Die scholastische Lehre, vor allem der ontologische Gottesbeweis, sollte wieder zum fruchtbaren Anstoß werden. Lässt sich – so könnte man die Fragerichtung Fichtes, Schleiermachers, Hegels und Schellings charakterisieren – eine Philosophie aus dem Geist des Christentums entfalten, die das Problem nicht wie die späte Scholastik durch eine Setzung, nämlich den Glauben an das lumen naturale der Vernunft, löst?
Die damalige gebildete Welt war durch zwei Debatten erregt worden, zum einen durch Kants Widerlegung aller bisherigen Gottesbeweise, die im Sinne der fideistisch-lutherischen Orthodoxie dem Glauben als einer ungeschützten und unbeweisbaren Zuwendung zu Gott Raum gab und dabei außer der Feststellung der Faktizität des Sittengesetzes keine Vorgaben zuließ, zum anderen durch die von Jacobi angezettelte Debatte um Spinoza, der mit seinem Pantheismus der neuen Natur- und Gefühlsfrömmigkeit entsprach, mit seinen metaphysischen Argumenten hingegen die Wirklichkeit der menschlichen Freiheit zu bezweifeln schien. War die Geschichte mit einem naturfrommen und gleichwohl rationalen Determinismus zu erfassen? War dies überhaupt mit dem Streben der Aufklärung nach Mündigkeit und politischer Freiheit und der Vorgabe des lutherischen Christentums, dem Glauben an einen gnädigen Gott, der in seiner Menschwerdung eine Synthese von Absolutem und Kontingentem darstellte, zu vereinbaren? Wo Kants Lehre vom Sittengesetz die Gnade ausschloss, schien Spinoza bei allem Pantheismus sogar auf die lutherisch eingeschränkte, vom Erbsündengedanken geprägte, ermäßigte Freiheitskonzeption zu verzichten.
Eine im Schatten der Französischen Revolution und des deutschen Spätabsolutismus groß gewordene Generation von Intellektuellen stand vor der Aufgabe, die politisch erfahrene Freiheit begrifflich zu begründen. Diese Konzeption musste in Einklang mit der christlichen Religion gebracht werden. Darüber hinaus wollte man am Postulat der Aufklärung festhalten, eine andere, gar höhere Instanz als das Denkvermögen nicht anzuerkennen. Die Philosophen setzten damit jene Bemühungen fort, die sowohl die alte Kirche und die Patristik als auch das hohe Mittelalter mit der Scholastik umgetrieben hatten: die Durchdringung und Begründung der christlichen Religion mit und aus der Philosophie. Doch wo die späte Antike noch vom Sein aus dachte und die Scholastik seit dem Universalienstreit und dem Nominalismus vor allem mit dem Verhältnis von Absolutem und Kontingentem befasst war, liegt die Philosophie des Deutschen Idealismus bereits nach der cartesianischen Revolution und der neuzeitlichen Bewusstseins- und Selbstbewusstseinsphilosophie. Auf einen Nenner gebracht, versuchten die Idealisten, den Geist des Christentums aus einer Metaphysik des Selbstbewusstseins zu entfalten. Das Christentum freilich, das da in seiner Geltung entfaltet werden sollte, war eben das Christentum der lutherischen und pietistischen Tradition.
Wenn es zutrifft, dass das Verhältnis der idealistischen Philosophie zu Juden und Judentum ihrer Haltung zur eigenen, christlichen Tradition entsprang und darüber hinaus ihre philosophischen Anstrengungen sich darauf richteten, den Geist des Christentums aus einer Metaphysik des Selbstbewusstseins zu entfalten, folgt daraus, dass ihre Stellungnahmen zum Judentum zugleich Aussagen über die innere Gestalt dieses Selbstbewusstseins sind. In einer Selbstbewusstseinsphilosophie, die auf Freiheit dringt, haben diese Aussagen immer auch politischen Charakter. Dass dies bei Fichte, Schleiermacher, Hegel und Schelling der Fall ist, soll im Folgenden gezeigt werden.
Ob diese Aussage auch für den Ausgangspunkt der idealistischen Philosophie, das philosophische Werk des an einer moralischen Funktion der christlichen Religion interessierten Aufklärers und Agnostikers Kant, beziehungsweise für den Endpunkt der idealistischen Philosophie, den frühen Marx, zutrifft, ist eine andere Frage. Auf keinen Fall wird man von Kant statuieren können, dass es ihm in praktischer Hinsicht um eine Entfaltung des Christentums aus einer Metaphysik des Selbstbewusstseins ging. Obwohl Kant Selbstbewusstsein als transzendentales Bewusstsein in den Mittelpunkt seines Denkens stellte, war ihm doch die christliche Religion niemals mehr als eine kontingente Gegebenheit, die einer moralischen Nutzung zuzuführen sei. Damit stand er unausgesprochen in der Tradition Spinozas, der in seinem Theologisch-politischen Traktat die Inhalte der historisch geronnenen Religionen mitsamt ihren Mythen als empirische Stütze für ein Moralbewusstsein ansah, das die breite Masse ohne diese Narrative kaum aufrechterhalten könne. Entsprechend schien Kant auch das Judentum weniger eine systematische als eine kontingente Größe zu sein, die vor allem daraufhin zu befragen sei, ob und in welchem Ausmaß sie der Ausbreitung eines aufgeklärten Bewusstseins dienlich sei.
Für den Hegelianer Marx waren beide Religionen, Judentum und Christentum, nicht mehr nützliche Vorgaben, sondern systematische Konstituenzien eines falschen Bewusstseins, die ununterscheidbar die materiellen Verhältnisse, unter denen sie existieren, artikulieren und bewahren. Das junghegelianische Credo, dass die Kritik der Religion beinahe schon die ganze Kritik einer nicht mehr wahren, unvernünftigen Wirklichkeit sei, galt zumal für den jungen Marx. In seiner Geschichtsphilosophie konnte das Judentum deshalb nur als eine bestimmte Praxis, die der christlichen Praxis zugleich entsprach und auch entgegengesetzt sei, erscheinen. Marx ging es nicht um eine Entfaltung, sondern um eine Kritik des Christentums. Das Verwerfen der absoluten Religion implizierte die Ablehnung ihrer Vorläufer. Dass freilich beim jungen Marx die Kritik der Vorläuferreligion so viel schärfer ausfiel als die Kritik des herrschenden Christentums, mag an biographischen Gründen oder den Themen des Idealismus gelegen haben. Obwohl oder gerade weil Marx seine Philosophie nicht mehr als eine Entfaltung der absoluten Religion verstanden sehen wollte, exemplifizierte er deren konkreten historischen Gehalt. Der Verzicht auf eine philosophische Rechtfertigung dieser Religion führte bei ihm zunächst dazu, ihre populären Gestalten und Gehalte der Form nach zu kritisieren – eine Wiederaufnahme des aufklärerischen Programms Kants mit dem Unterschied, dass Marx’ Kritik nicht auf eine Nutzbarmachung des Glaubens, sondern auf dessen Aufhebung durch revolutionäres Handeln zielte. Dort, wo es Fichte, Schleiermacher, Hegel und Schelling um eine Durchdringung und Vertiefung des Christentums zu tun war, ging es Kant und Marx um seine Aufhebung. Marx sah daher im Judentum kein systematisches, sondern ein politisches Problem, während die Idealisten aus einer wie auch immer gearteten Theorie des Judentums systematische Schlüsse zogen, die dann eine politische Praxis anleiten sollten. Die jungen Fichte und Hegel standen hier Marx näher als Kant, was an ihrem revolutionären Eifer und noch mehr daran lag, dass sie dem Christentum ihrer Zeit eine weltumstürzende Kraft nicht mehr zutrauten. Beinahe alle Autoren wollten den moralischen Gehalt der religiösen Überlieferung ausschöpfen. Da ihnen diese religiöse Überlieferung aber wesentlich aus dem Christentum und indirekt aus dem Judentum bekannt war, konnten sie ihr Anliegen nur über die unterschiedlichen christlichen Strömungen und den Gegensatz von Christentum und Judentum artikulieren.
Die entscheidenden Weichen für alle folgenden philosophischen Systeme und ihre Begründungen wurden von Kant gestellt. Die Darstellung und Rekonstruktion von Kants Verhältnis zum Judentum, die sich aus seiner allgemeinen aufklärerischen Theorie der Religion ergibt, steht daher am Anfang. Es wird sich zeigen, ob und inwieweit Vorurteil und systematische Argumentation schon hier ineinander übergingen. Die Darstellung folgt dem von Marx und Friedrich Engels propagierten Vorschlag, die klassische deutsche Philosophie mit Feuerbach und ihnen selbst ausklingen zu lassen. Allerdings stehen am Ende des Deutschen Idealismus zwei Auswege, der von Schelling und der von Marx. Nimmt man die Rolle, die das Judentum für die Philosophie des Deutschen Idealismus spielte, ernst, so setzte den Schlussakkord nicht Marx, sondern Schelling, der etwa für den jüdischen Zukunftsdenker Franz Rosenzweig zur überragenden Anregung wurde.
I.Kants Theorie des Judentums – Die Euthanasie des statutarischen Gemeinwesens
In der heutigen Auseinandersetzung mit Immanuel Kant geht es zentral um die sogenannte Dialektik der Aufklärung, eine Debatte, die in den letzten fünfundzwanzig Jahren oberflächlicher und ideologischer geführt wurde, als es sich die Autoren des gleichnamigen Werks, Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, am Ende des Zweiten Weltkrieges hätten träumen lassen. Während sie in der Tradition Kants und Georg Wilhelm Friedrich Hegels darum bemüht waren, einen Begriff der Vernunft zu entfalten, der ihre instrumentellen Vernutzungen selbst noch zu kritisieren vermochte, und damit dem Projekt der Aufklärung, dem Kampf um die Beherrschung von Natur, Mensch und Gesellschaft die Treue hielten, sind heute Vertreter einer sich dezisionistisch auf Moral stützenden politischen Ethik nur allzugerne bereit, die rationalitätskritischen und damit rationalitätssteigernden Potentiale dieser Philosophie en bloque zu verurteilen. Das wird in der Auseinandersetzung mit dem Deutschen Idealismus besonders deutlich. Von André Glucksmann, einem ehemaligen Maoisten, bis Paul Lawrence Rose, einem zionistischen Historiker, haben die Teilnehmer dieser Debatte die verschiedenen Philosophen des Deutschen Idealismus auf die Anklagebank gesetzt. Der Verdacht, dass Johann Gottlieb Fichte, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling und Hegel die geistigen Urheber des Nationalsozialismus und damit der massenindustriellen Ermordung der europäischen Juden waren, ist weder neu noch spektakulär, weder völlig abwegig noch haltbar. Schon Herbert Marcuse sah sich 1941 im US-amerikanischen Exil genötigt, mit seinem Buch Reason and Revolution dem Missbrauch Hegels durch völkische Juristen entgegenzutreten. Bei keinem Philosophen des Deutschen Idealismus jedoch scheint der Verdacht, er gehöre in die Vorgeschichte von Auschwitz, absurder als bei Kant, jenem Philosophen der Autonomie, der unbedingten Rechtlichkeit und der unverletzbaren Menschenwürde, dem sich ein großer Teil des deutschen Judentums im neunzehnten Jahrhundert bis weit in die Orthodoxie hinein verpflichtet fühlte. In seinem unableitbaren Sittengesetz artikulierte sich systematisch und vernunftgemäß genau das, was die Bibel mit ihrer Erinnerung an den Bund und die gebietende Stimme vom Sinai in erzählender Sprache entfaltet.
»Vielleicht«, so heißt es in Kants Kritik der Urteilskraft von 1790, »gibt es keine erhabenere Stelle im Gesetzbuche der Juden, als das Gebot: Du sollst dir kein Bildnis machen, noch irgend ein Gleichnis, weder dessen, was im Himmel, noch auf Erde, noch unter der Erden ist, u.s.w. Dieses Gebot allein kann den Enthusiasmus erklären, den das jüdische Volk in seiner gesitteten Epoche für seine Religion fühlte, wenn es sich mit andern Völkern verglich, oder denjenigen Stolz, den der Mohammedanism einflößt.«1 Darin erkannten sich jene Juden, die im frühen neunzehnten Jahrhundert aus der Enge des Gettos ausbrechen wollten, wie Lazarus Bendavid, Saul Ascher, Markus Herz und David Friedländer, ebenso wieder wie jene, die ihrer Tradition einen vernünftigen Sinn verleihen wollten, etwa Hermann Cohen,2 oder jene, die gar zeigen wollten, dass sich mit Kant die wörtlich verstandene Offenbarung am Sinai beweisen ließ, von Samson Rafael Hirsch bis zur neoorthodoxen Rabbinerdynastie Breuer. Freilich war nicht zu übersehen, dass derselbe Kant die Juden seiner Zeit als »betrügerische Palästiner« bezeichnete und in seinen religionstheoretischen Schriften wie auch im Nachlass wiederholt die »Euthanasie des Judentums« gefordert hatte – ein Ausdruck, der spätestens nach den nationalsozialistischen Massenmorden an den Geisteskranken Entsetzen hervorruft. Adolf Eichmann hatte sich immerhin auf Kant berufen.3
Glucksmann veröffentlichte sein Buch über die Maîtres penseurs, die Meisterdenker, 1977. Darin ist von Kant keine Rede. Nichts, so beteuerte der Autor, verbinde die deutschen Denker mit dem Nazismus außer dem Umstand, dass sie Antisemiten gewesen seien. Der menschenrechtlich entflammte Begründer einer »neuen Philosophie« unterlag freilich der eigenen Dialektik, wenn er unmittelbar darauf feststellt: »Paradoxerweise musste man auf Heidegger warten, um eine deutsche Philosophie zu finden, die nicht antisemitisch ist: Rom, nicht Judäa, versperrt uns den Weg nach Griechenland. Die Übersetzungen des Imperium Romanum sind ebenso verheerend wie seine Friedensschlüsse.«4 In Glucksmanns Buch spukt Kant als finanzieller Förderer des erklärtermaßen antisemitischen Fichte und als Kritiker der Deutschen durch die Seiten.5 Ob Glucksmann die seit 1968 erscheinenden Arbeiten des Antisemitismushistorikers Léon Poliakov kennt, lässt sich nicht mit Sicherheit feststellen, ist aber wahrscheinlich. Für Poliakov war der Fall Kant klar, obwohl Generationen jüdischer Kantianer dessen judenfeindliche Texte mit dem Ziel kritisierten, Kant zu entschuldigen. »Lektüren und Quellen, von welchem Gewicht auch immer, haben möglicherweise weniger gezählt als der abgründige Hass eines Denkers, der in mehreren Schriften und bei verschiedenen Anlässen auf eine Weise die Euthanasie des Judentums empfahl, die nichts anderes bedeuten konnte als die metaphysische Form des Schreis: ›Tod den Juden!‹«6 Rose schließlich, der Poliakovs eher anspruchslose Kompilation für eine brillante Synthese hält,7 sieht bei Kant den Ursprung des Nationalsozialismus als Idee. Kants Antisemitismus, der sich in seinen Meinungen ausdrücke, dass das Judentum eine unmoralische Religion und die Juden eine fremde Nation von Schacherern seien, werde durch den zentralen Begriff der moralischen Freiheit zusammengehalten. Beider Verbindung habe sich in der idealistischen Philosophie als Kern einer spezifisch deutschen Revolution entpuppt. Rose, der an einer nüchternen Analyse interessiert zu sein vorgibt, macht zu Recht auf Rezeptionshindernisse wie die Unkenntnis des Deutschen beziehungsweise unzureichende Übersetzungen aufmerksam, die ein angemessenes Verständnis der »deutschen Revolution« verhindern. Indem er zwischen dem Judaismus als Religion, der jüdischen Nation und jüdischen Eigenschaften unterscheidet, geht er einen ersten Schritt in Richtung auf ein genaueres Verständnis der idealistischen Judenfeindschaft. Aber auch für ihn gilt wie für Poliakov, Glucksmann und Joshua Halberstam,8 dass sie das unterlassen haben, was einzig einem philosophischen Text angemessen ist: ihn auch philosophisch zu lesen. Um Kants Auseinandersetzung mit dem Judentum zu verstehen, führt kein Weg daran vorbei, sich auch mit jenen Menschen, mit jenen Juden näher zu befassen, die sein systematisches Denken prägten und anregten.
Am Anfang stand Moses Mendelssohn. Die Ankunft des 1729 in Dessau geborenen Sohns eines Toraschreibers, der seinem Rabbi David Fränkel 1743 nach Berlin folgte, sollte das Denken der Gebildeten in Deutschland über die Juden und das Judentum nachhaltig verändern. Mendelssohn, der sein Leben zunächst als Hauslehrer fristete, dann als erfolgreicher Kaufmann lebte, wurde schnell zum Mittelpunkt der Berliner Aufklärung. Seit 1750 mit Gotthold Ephraim Lessing befreundet, begann er einige Jahre später mit einer regen Publikationstätigkeit. Mit seinem Freund, dem Berliner Buchhändler und Verleger Friedrich Nicolai, kämpfte er für das Entstehen einer deutschsprachigen Literatur wider das vom absolutistischen Hof geförderte Französisch.
Mendelssohn setzte sich nicht nur mit den damals in Philosophie und Gesellschaft zentralen Themen wie Ästhetik und Empfindsamkeit auseinander, sondern auch mit der Philosophie der Religion, die er als rationale Theologie zu begründen versuchte. Mendelssohn war bestrebt, die Unsterblichkeit der Seele, die Existenz Gottes und die menschliche Willensfreiheit zu beweisen; seine Annahmen der Beweisbarkeit Gottes widerlegte Kant später in der Kritik der reinen Vernunft.
Als gefeierter Philosoph der Aufklärung blieb Mendelssohn gleichwohl sein Leben lang ein orthodoxer Jude, eine Tatsache, die einen Teil seiner Bewunderer zunehmend provozierte. Als ihm der Schweizer Geistliche Johann Caspar Lavater 1769 ein von ihm übersetztes Werk christlicher Religionsphilosophie widmete und ihn zugleich respektvoll aufforderte, zum Christentum überzutreten, war Mendelssohn gezwungen, sein Lebensprojekt, die Verbindung von Judentum und Aufklärung, zu verteidigen. In seinem Schreiben an Lavater 1770 brachte er vor allem pragmatische und lebensgeschichtliche Gründe für sein Festhalten am Judentum vor. Zwölf Jahre später entfaltete er nach gründlichem Studium seine Argumentation in dem Werk Jerusalem oder Über religiöse Macht und Judentum.
Er setzte an der Frage an, die die Aufklärung von Anfang an umgetrieben hatte, am Verhältnis von Staat und Religion. Als Anhänger der Vertragstheorie des Staates gestand er dem Staat bezüglich der Verbesserung des leiblichen Wohls der Bürger Zwangsbefugnisse zu, während Kirchen und Religionsgemeinschaften das gleiche Ziel ausschließlich durch Überzeugen verfolgen können sollten. Als Aufklärer allen Offenbarungstheoremen gegenüber skeptisch, war er von der sachlichen Identität wahrer, moralischer Religion und rationaler Reflexion über Gott, Freiheit und Unsterblichkeit überzeugt. Religion war für ihn der Inbegriff einer höheren moralischen Haltung, die in den vielfältigen jüdischen Zeremonialgesetzen auf den ersten Blick nicht zu finden ist. Die Schwierigkeit, die den Juden offenbarten sinaitischen Satzungen nicht als Religion verstehen zu können, löste Mendelssohn, indem er das Geschehen am Sinai als Offenbarung des Gesetzes und nicht der Religion, als eine vom jüdischen Volk beglaubigte historische Tatsache ansah. Das Judentum als Glaube enthielt mithin nichts anderes als den Kern, den jede auf Vernunft gegründete Religion in sich tragen muss; die Juden waren dadurch nicht vom Rest der Menschheit unterschieden. Die Weisung am Sinai hingegen enthält nichts anderes als die spezifische Wegweisung zu Leben und Wohlergehen von Gott an die Juden. Diese Ansicht steht in der Tradition rabbinischer Theologie, die niemals auf Mission setzte. Die von vielen Aufklärern kritisierte Einheit von Staat und Religion im Judentum ist damit aufgesprengt und für historisch erklärt. Während die Wahrheit der jüdischen Religion in einsichtigen, nicht offenbarungsfähigen Vernunfttatsachen besteht, stellt das sinaitische Gesetz mitsamt seinen Anweisungen zur staatlichen Organisation, seinen äußeren Zwangsbefugnissen, lediglich eine historisch kontingente Form dar, die diese Vernunftwahrheiten annahmen. Sie führten zur Idee einer unmittelbaren politischen Souveränität des göttlichen Willens. Dieser Religion zu folgen bedeutet keinen irrationalen Akt des Glaubens, sondern, wie Mendelssohn unter Hinweis auf einschlägige Bibelstellen ausführte, Einsicht und Erkenntnis. So heiße es im »Höre Israel« »vernimm Israel« und nicht etwa »glaube Israel«, und Deuteronomium 4,30 spreche davon, Israel solle erkennen, dass Gott einer sei. Dass das historische Judentum mit seinen als zwanghaft angesehenen Zügen lediglich als Hülle für eine auf Gewissensund Entscheidungsfreiheit, auf rationaler Einsicht beruhende Vernunftreligion dienen sollte, wurde Mendelssohn später immer wieder vorgehalten. Haltbar scheint dieses Konstrukt nur durch eine religionsgeschichtliche Spekulation, die aber erst nach Mendelssohn das Reformjudentum9 unter Berufung auf die prophetischen Schriften anstellte, dass nämlich das Ende des antiken jüdischen Staates einen höheren Sinn, ja geradezu einen göttlichen Willen artikuliere, die weltweite Verbreitung der am Sinai in Gesetze gehüllten aufklärerischen Vernunftreligion. Mendelssohns Ablehnung von Wundern als Beweisen musste zu einer harschen Kritik an den christlichen Dogmen von Jungfrauengeburt, Trinität und Auferstehung führen. Anders als bei der sinaitischen Gesetzesoffenbarung war er nicht bereit, sie als historische Fakten anzuerkennen. Damit behauptete Mendelssohn indirekt, dass das Judentum gegenüber dem Christentum die rationalere und also aufgeklärtere Religion sei – eine Behauptung, deren provokative Wirkung nicht hoch genug eingeschätzt werden kann.
Mendelssohn, der nach der Auseinandersetzung mit Lavater neben seinem wissenschaftlichen Werk eine deutsche Übersetzung der hebräischen Bibel in Angriff nahm und etwa durch Gründung hebräischsprachiger Zeitschriften, das Fördern jüdischer Freischulen und das Verfassen religiöser Propädeutika unermüdlich für die jüdische Gemeinschaft wirkte, stand als Person und Symbol gelebter Aufklärung im Zentrum der Gesellschaft. In ihm schienen die Verheißungen der Aufklärung, wechselseitige Toleranz, Respekt vor historisch gewachsenen Traditionen und Anerkennung der Vernunft verwirklicht.
Auch Kant, der in seiner 1781 erschienenen Kritik der reinen Vernunft die von Mendelssohn vertretene rationale Theologie systematisch widerlegt hatte, war persönlich an ihm interessiert. 1783 übersandte ihm Mendelssohn sein Jerusalem und erhielt ein überaus freundliches Antwortschreiben, obwohl Kant nach eigenem Bekunden ein eher nachlässiger Briefschreiber war. Unter Bezugnahme auf den aus Königsberg stammenden gemeinsamen Bekannten Friedländer teilte Kant Mendelssohn mit:
Herr Friedländer wird Ihnen sagen, mit welcher Bewunderung der Scharfsinnigkeit, Feinheit und Klugheit ich Ihren Jerusalem gelesen habe. Ich halte dieses Buch für die Verkündigung einer großen, obzwar langsam bevorstehenden und fortrückenden Reform, die nicht allein Ihre Nation sondern auch andere treffen wird. Sie haben Ihre Nation mit einem solchen Grade von Gewissensfreiheit zu vereinigen gewusst, die man ihr gar nicht zugetraut hätte und dergleichen sich keine andere rühmen kann. Sie haben zugleich die Notwendigkeit einer unbeschränkten Gewissensfreiheit zu jeder Religion so gründlich und hell vorgetragen, dass endlich auch die Kirche unsrerseits wird denken müssen, wie sie alles, was das Gewissen belästigen und drücken kann, von der ihrigen absondere, welches endlich die Menschen in Ansehung der wesentlichen Religionspunkte vereinigen muß, denn alle das Gewissen belästigenden Religionssätze kommen uns von der Geschichte, wenn man den Glauben an deren Wahrheit zur Bedingung der Seligkeit macht. Ich missbrauche aber Ihre Geduld und Ihre Augen und füge nichts weiter hinzu, als dass niemandem eine Nachricht von Ihrem Wohlbefinden und Zufriedenheit angenehmer sein kann als Ihrem ergebensten DienerI. Kant.10
Dieser von dem immerhin fünf Jahre älteren, inzwischen berühmten Philosophieprofessor an einen zudem schon systematisch widerlegten autodidaktischen Popularphilosophen abgefasste Brief fällt bei dem sonst eher zurückhaltenden Kant auf. Sie kannten sich, wenn auch flüchtig. 1777 war Mendelssohn zu Gast in Königsberg, und Kant rühmte sich in einem Brief an seinen jüdischen Schüler, den Arzt Markus Herz, der später Henriette Lemos heiratete, »seines würdigen Freundes« Mendelssohn.11 Immerhin sollen sich Kant und Mendelssohn anlässlich einer Vorlesung des ersteren, zu der letzterer gekommen war, in aller Öffentlichkeit umarmt haben.
So kann keine Rede davon sein, dass Kants Auseinandersetzung mit dem Judentum von Anfang an, wie Rose meint, von ausgesprochener Feindseligkeit geprägt war.12 Gleichwohl ist zu fragen, warum Kant, der Mendelssohn und seinen Theoremen anfänglich aufgeschlossen gegenüberstand und viele ihm herzlich verbundene jüdische Freunde und Schüler hatte, in seinem späteren Werk seine im Dankesbrief geäußerte Anerkennung zurücknahm. Was bewog den aufgeklärten Kant, sich in seiner Anthropologie in pragmatischer Hinsicht zwar nicht rassistisch, aber doch pauschalierend negativ über die Juden auszulassen und sich zudem in persönlichen Bemerkungen abfällig zu äußern? Den von ihm in einem Brief an Herz als »scharfsinnig« und »tiefgründig« bezeichneten Salomon Maimon, nahm er fünf Jahre später in einem Brief an Karl Leonhard Reinhold zum Anlass einer antisemitischen Bemerkung. Ärgerlich über von ihm nicht autorisierte Debatten über die Transzendentalphilosophie, beklagte er Maimons »Nachbesserung der kritischen Philosophie (dergleichen die Juden gerne versuchen, um sich auf fremde Kosten ein Ansehen von Wichtigkeit zu geben)«.13 Und was in aller Welt ging im Kopf dieses großen Aufklärers vor, als er, wie der Bildungsreisende und Theologe Abegg berichtet, Folgendes sagte:
»Es wird nichts daraus kommen; so lange die Juden Juden sind, sich beschneiden lassen, werden sie nie in der bürgerlichen Gesellschaft mehr nützlich als schädlich werden. Jetzo sind sie Vampyre der Gesellschaft.«14 Waren es zu viele jüdische Schüler, waren es ungeschickte Versuche der jüdischen Gemeinde in Königsberg, Kant zu ehren,15 oder grundsätzliche Überlegungen, die derlei Urteile motivierten? Ohne eine genaue Analyse der von Kant verwendeten religionstheoretischen Kategorien sind diese Fragen nicht zu beantworten: der Kategorien des Glaubens als einer subjektiv gültigen, aber objektiv unzureichenden Überzeugung, der Religion als des Inbegriffs symbolischer Deutungsmuster für die moralische Entwicklung, der Kirche als eines institutionalisierten Systems von Riten, dementsprechend des Kirchenglaubens als des Glaubens an Riten und Symbole sowie des Religionsglaubens als eines von Religion geleiteten Kirchenglaubens.
In seinen Schriften stellt Kant das Judentum als einen Glauben dar, der in keiner Verbindung zum Christentum stehe, eigentlich gar keine Religion, sondern lediglich eine Satzung politischer Gesetze sei, in denen Gott als weltlicher Regent verehrt werde und dessen Gesetze daher nur Zwangsgesetze seien. Das Judentum kenne keinen Glauben an ein ewiges Leben, damit widerspreche es der Vernunftreligion und sei zudem partikularistisch. Das insgesamt negative Urteil über das Judentum kam nicht etwa nur deshalb zustande, weil Kant im Judentum-historisch durchaus zutreffend – eine ethnisch und historisch von starken Riten geprägte Lebensgemeinschaft sah, sondern vor allem deshalb, weil Kant dem Christentum im Unterschied zum Judentum zugestand, ein religiös inspirierter Kirchenglauben mit universalistischem Anspruch zu sein. Ihm blieb verschlossen, dass der Glaube von Jesus, den er unter Berufung auf Bendavid als gemeinsame Basis aufgeklärter Religiosität akzeptierte, nur der jüdische sein kann. Der Mathematiker Bendavid (1762 bis 1832), ein Freund von Herz, wurde, ohne Kant je gehört zu haben, zu einem seiner glühendsten Anhänger und trat vehement für die Aufhebung des Zeremonialgesetzes sowie die Neubegründung des Judentums aus dem Geist der Bibel und Mosis ein; dabei berücksichtigte er nicht, dass schon Mendelssohn die Eigentümlichkeit des Judentums gerade in seinen Ritualgesetzen und nicht in seinem vernunftorientierten religiösen Kern sah.16
Warum konnte sich Kant dieser Sicht nicht anschließen? Handelte es sich bei seiner kritischen, wenn nicht abwertenden Sicht des Judentums um Vorurteile, die in tiefsitzenden Erfahrungen wurzelten, womöglich dem von der Mutter vermittelten Kinderglauben entstammten?17 War es Eigensinn oder Unfähigkeit zu Freundschaft? »Kultureller Fortschritt, das wusste Kant, beginnt im Umgang mit Menschen, deren Urteil ich auch dann vertraue, wenn es mir den Spiegel vorhält, weil Einigkeit des moralischen Anspruchs besteht, und Freundschaft ist erst dort, wo der gegenseitige Respekt vor echter Verletzung schützt. Kant hat offenbar Freunde gehabt. Er hätte nur besser zuhören müssen.«18 Die überraschende Schlusspointe von Bettina Stangneths Essay »Antisemitische und Antijudaistische Motive bei Immanuel Kant?« besteht in der These, dass Kant die Überlegungen seiner jüdischen Freunde nicht ernst genommen habe. Sie ließe sich zu einer Argumentationsethik ebenso wie zu einer Ethik der Freundschaft, einer Tugendlehre ausweiten.
Wäre Kant besser beraten gewesen, wenn er auf Mendelssohn und Herz gehört hätte? Haben die sich damals emanzipierenden Juden ihr Judentum angemessen verstanden? Waren nicht Friedländer, Bendavid und Ascher aus ganz ähnlichen Gründen wie Nichtjuden vom talmudischen Judentum abgestoßen? Konvertierten Rahel Levin, Henriette Herz und Dorothea Schlegel, weil sie nicht die richtigen Freunde hatten? Mit anderen Worten, lässt sich Kants Ungleichbehandlung von Judentum und Christentum wirklich durch den Hinweis auf seine frühe Sozialisation erklären? Wäre eine kritische Analyse des christlich-protestantischen Glaubens, mit dem Kant vertraut war und der seine Philosophie in vieler Hinsicht bis hin zu seiner Zweiweltenlehre prägte, nicht der Weg, Kants Verhältnis zum Judentum auf die Spur zu kommen? Von einigen zeitgenössischen Biographen wissen wir, dass er sich mit christlicher Dogmatik und Kirchengeschichte, sogar mit dem Katechismus auseinandergesetzt hat.19 Womöglich hatten die jüdischen Kantianer von Herz, Friedländer und Maimon über Cohen bis zu Samson Raphael Hirsch und Isaak Breuer darin recht, dass Kant den rationalen Kern des Judentums erkannt hatte. Womöglich hatte Kant keine Vorurteile, sondern war entgegen seinem sonstigen aufklärerischen Mut bezüglich eines offenen Bekenntnisses zu den Juden nur ängstlicher als sein Zeitgenosse Lessing. Als Judenfreund mochte er nicht gelten. Wenn er schon aufgrund seiner Freunde und des von ihm als Respondenten seiner Dissertation gewählten Herz entsprechenden Verdächtigungen ausgesetzt war wollte er wenigstens sein Werk von derlei Einflüssen freihalten. Dabei stand ihm die Beziehung zu Mendelssohn immer wieder im Wege.
1786 musste sich dieser, der massiv gegen öffentlich proklamierten Atheismus und gegen Atheisten eintrat, mit einer Attacke gegen seinen verstorbenen Freund Lessing auseinandersetzen. Der Philosoph Friedrich Heinrich Jacobi behauptete mit seiner Schrift Über die Lehre des Spinoza. In Briefen an Moses Mendelssohn,20 dass ihm Lessing bekannt habe, Spinozist, also nach damaliger Meinung kein Pan-, sondern ein Atheist zu sein.21 Das war eine für den theistischen und rationalistischen Mendelssohn niederschmetternde Behauptung, der er in einem umfangreichen Schriftsatz, der Verteidigungsschrift »Moses Mendelssohn an die Freunde Lessings« entgegentrat. Sein Arzt Herz berichtet, dass er das Manuskript am Silvesterabend 1785 noch selbst in die Vossische Druckerei gebracht und sich dabei erkältet habe. Am 4. Januar 1786 starb Mendelssohn.
Als Atheist wollte auch Kant nicht gelten. Er äußerte sich 1786, ein Jahr nach dem Erscheinen von Jacobis Buch und Mendelssohns Tod zu der Kontroverse. Er ließ sich dabei aber nicht auf die philologische Frage ein, ob Lessing ein Spinozist gewesen sei, sondern wandte sich dem Kern der Debatte zu. Strittig war zwischen Mendelssohn und Jacobi vor allem, ob ein nur auf Vernunft gegründeter Gottesbegriff unter Umgehung des biblisch bezeugten Glaubens nicht notwendig zu Schwärmerei und Mystizismus führe. Jacobi zielte, indem er jede rationalistische Religion als Spinozismus beziehungsweise den Spinozismus als einzige überhaupt mögliche rationale Religion ansah, auf das Projekt der Aufklärungsreligion im Ganzen. Freundlich sowohl gegen Mendelssohn als auch Jacobi, suchte Kant beiden Kontrahenten nachzuweisen, dass sie mit ihren Beiträgen, ohne es zu wollen, »aller Schwärmerei, Aberglauben, ja selbst der Atheisterei eine weite Pforte geöffnet«22 hätten. Im August 1789 sah er sich noch einmal bemüßigt, Jacobi mitzuteilen, kein Spinozist zu sein. Bei aller Begeisterung für Spinoza war das Bewusstsein, dass es sich bei ihm um einen zwar freien, aber seiner Herkunft nach jüdischen Geist handelte, nie geschwunden. So stellt sich die Frage, ob Kants Kritik des Judentums aus persönlichen Motiven und zeitbedingten Vorurteilen zu erklären ist oder nicht doch an einem Grundwiderspruch liegt, nämlich an einem aufklärerisch motivierten, rationalistischen Denken, das sich über seine zutiefst christlichen Wurzeln keine Rechenschaft ablegte.
Die Auseinandersetzung über Theismus und Atheismus ersetzte unter deutschen Gebildeten eine Debatte, die in anderen europäischen Ländern politischer geführt wurde, nämlich über das Verhältnis von Staat und Kirche. Allgemein kannte die Aufklärung, beginnend bei Rousseaus Auseinandersetzung mit dem Christentum im Contrat social, zwei Haltungen zur Religion. Entweder enttarnte sie sie herrschafts- und ideologiekritisch als ein Mittel des Priestertums zur Verunsicherung und Unterwerfung des Volkes, oder sie sah – im besten Fall – in der religiösen Überlieferung Metaphern für vernünftige moralische Wahrheiten. So argumentierte Spinoza in seinem Theologischpolitischen Traktat.
Kant, der diese Sicht grundsätzlich teilte, gab ihr in seiner transzendental begründeten praktischen Philosophie eine radikal neue Wendung. Er stellte klar, dass weder die Religionen noch deistische Annahmen das Moralgesetz erklären könnten, sondern umgekehrt das in sich einsichtige Sittengesetz auf Zwecke verweise, die einen Gottesbegriff erforderten. Die Frage nach einer unter diesem Gesetz stehenden Gemeinschaft beantwortete er mit der Definition des Staates als Form eines moralisch bestimmten Gemeinwesens. Er zeichnete zwei Idealtypen einer moralischen Gemeinschaft aus, das jüdische Volk und die wahre Kirche.
Damit lag eine aufklärerische Ekklesiologie vor, in der mit der Begrifflichkeit der transzendentalen praktischen Philosophie die christliche Differenz von Kirche und Israel und auch von Gesetz und Evangelium wieder aufgerufen war. Diese Differenz lässt sich in zwei Perspektiven deuten. Die ethnisch nicht gebundene christliche Kirche sei im Unterschied zur Synagoge – ein Ausdruck den Kant übrigens nie verwandte – eine mindestens der Tendenz nach universalistische Gemeinschaft, die zweitens aufgrund eines wesentlich anderen Glaubens als des der Tora nicht auf Moralität, sondern – so die lutherische Deutung – auf der im Glauben empfangenen Gnade beruhe. Die Annahme, dass Kant, der Philosoph sittlicher Verantwortung und eines nicht ableitbaren Sittengesetzes, letztlich dem lutherischen Fideismus anhing, scheint auf den ersten Blick unplausibel. Hier sei angemerkt, dass die kantische Zweiweltenlehre eine spezifische Antwort auf das schon zwischen Luther und Erasmus heftig debattierte Problem von sittlicher Freiheit und göttlicher Gnade enthält.23 Kant argumentierte in der Sache »jüdisch-gesetzlich«, der Form nach aber »lutherisch-evangelisch«, und zwar insofern, als er die Annahme moralischer Willensfreiheit nur unter Vorbehalt gelten ließ. Dieser Vorbehalt, den die rationalistische Schule einschließlich Mendelssohns ablehnte, bildete den Kern von Kants Kritik des Judentums und fand sich in seinem Konstrukt der »wahren Religion« wieder.
Kants systematische Auseinandersetzung mit dem Judentum vollzog sich in den neunziger Jahren. Sie begann mit der 1793 publizierten Untersuchung zur Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft und wurde mit dem 1798 erschienenen Streit der Fakultäten sowie der im gleichen Jahr und in zweiter Auflage 1800 veröffentlichten Anthropologie in pragmatischer Hinsicht abgeschlossen. Während in der Religionsschrift das Judentum noch als »statutarisches« System kritisiert wird, begann Kant im Streit der Fakultäten in seinem Urteil zu schwanken. Die Einsicht, dass Christentum und Judentum sich als historische Religionen in ihrer Distanz zu einer vernünftigen Moralreligion kaum unterscheiden, setzte sich zunächst durch, um schließlich doch zugunsten einer moralisch motivierten Auflösung des Judentums und der Annahme einer intellektuellen Überlegenheit des christlichen Gedankens wieder verdrängt zu werden.
In der Schrift über Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft kommt Kant zu dem Schluss, dass der sittlich gebotene Übertritt des Menschen aus dem Naturzustand in ein ethisches Gemeinwesen zur Pflicht der Menschengattung gegen sich selbst gehöre:
Jede Gattung vernünftiger Wesen ist nämlich objektiv, in der Idee der Vernunft, zu einem gemeinschaftlichen Zwecke, nämlich der Beförderung des höchsten, als eines gemeinschaftlichen Guts, bestimmt. Weil aber das höchste sittliche Gut durch die Bestrebung der einzelnen Person zu ihrer eigenen moralischen Vollkommenheit allein nicht bewirkt wird, […] die Idee aber von einem solchen Ganzen, als einer allgemeinen Republik nach Tugendgesetzen, eine von allen moralischen Gesetzen […] ganz unterschiedene Idee ist, nämlich auf ein Ganzes hinzuwirken, wovon wir nicht wissen können, ob es als ein solches auch in unserer Gewalt stehe: so ist die Pflicht, der Art und dem Prinzip nach, von allen andern unterschieden. – Man wird schon zum voraus vermuten, dass diese Pflicht der Voraussetzung einer andern Idee, nämlich der eines höhern moralischen Wesens bedürfen werde, durch dessen allgemeine Veranstaltung die für sich unzulänglichen Kräfte der einzelnen zu einer gemeinsamen Wirkung vereinigt werden.24
Kant kennzeichnete Gemeinschaften, die sich bei ihrem Zusammenschluss der motivierenden Kraft eines höheren moralischen Wesens versichern, mit dem Begriff eines »ethischen gemeinen Wesens«, was dem »Volk Gottes unter ethischen Gesetzen« entspreche. Im Unterschied zu »ethischen« Gemeinwesen zeichneten sich »juridische« Gemeinwesen dadurch aus, dass sie wechselseitige Freiheitseinschränkungen durch gesetzlichen, von Gewalt gedeckten Zwang erreichten. Juridische Gemeinwesen zielten auf äußere Legalität und seien allenfalls an der Einschränkung bestimmter Handlungen interessiert. Im Gegensatz dazu gehe es ethischen Gemeinwesen nicht einfach um die Normierung von Handlungen oder Unterlassungen, sondern um die Prägung von Gesinnungen. Während das juridische Gemeinwesen bestimmte Handlungen unterbinde oder negativ sanktioniere, befördere das ethische Gemeinwesen bestimmte Zwecke und Handlungen. Dem könne, so Kant, nur eine im weitesten Sinne theokratische und keine demokratische Konstitution genügen:
Soll das gemeine Wesen aber ein ethisches sein, so kann das Volk als ein solches nicht selbst für gesetzgebend angesehen werden. Denn in einem solchen gemeinen Wesen sind alle Gesetze ganz eigentlich darauf gestellt, die Moralität der Handlungen (welche etwas Innerliches ist, mithin nicht unter öffentlichen menschlichen Gesetzen stehen kann) zu befördern, da im Gegenteil die letzteren, welches ein juridisches gemeines Wesen ausmachen würde, nur auf die Legalität der Handlungen, die in die Augen fällt, gestellt sind, und nicht auf die (innere) Moralität, von der hier die Rede ist.25
Mit dieser Konstruktion schloss Kant aus, dass sich ethische Gesinnungsgemeinschaften – im Unterschied zu politisch-juridischen Gemeinwesen – einvernehmlich und demokratisch konstituierten. Kant folgte dem Argument Mendelssohns in Jerusalem von der Möglichkeit einer faktischen Souveränität Gottes über das jüdische Volk. Die Unmöglichkeit einer demokratischen Konstitution liege in der behaupteten Innerlichkeit der entsprechenden Einstellungen begründet, die einer kommunikativen Einigung nicht fähig seien. Kant war offenbar der Auffassung, dass die Moralität, welche die Individuen in sich vorfänden oder erzeugten, ihre persönliche Angelegenheit sei. Ein weiteres Argument für jene Behauptung findet sich nicht. Umgekehrt dürfe der Stifter oder Erlasser moralischer Gesetze aber keine kausal wirkende Gesetzesquelle mit Befehlsgewalt sein – hier rückte Kant von Mendelssohn ab –, »weil sie alsdann keine ethischen Gesetze, und die ihnen gemäße Pflicht nicht freie Tugend, sondern zwangsfähige Rechtspflicht sein würde. Also kann nur ein solcher als oberster Gesetzgeber eines ethischen gemeinen Wesens gedacht werden, in Ansehung all dessen alle wahren Pflichten, mithin auch die ethischen zugleich als seine Gebote vorgestellt werden müssen; welcher daher auch ein Herzenskündiger sein muss, um auch in das Innerste der Gesinnungen eines jeden zu durchschauen.«26
Aus der Idee einer ethischen Gemeinschaft und der ihr zugrunde liegenden Motivationsquelle resultierte jener Begriff, der die im engeren Sinne ekklesiologischen Überlegungen Kants begründete und damit auch seine systematische Theorie des Judentums bestimmte: »Dieses aber ist der Begriff von Gott als einem moralischen Weltherrscher. Also ist ein ethisches gemeines Wesen nur als ein Volk unter göttlichen Geboten, d. i. als ein Volk Gottes, und zwar nach Tugendgesetzen, zu denken möglich.«27
Der Begriff eines unter göttlichen Gesetzen stehenden Volkes schließt nicht aus, dass sich das Volk im juridischen Sinne einem moralischen Weltherrscher unterwirft, sich mithin als ein Volk Gottes nach »statutarischen Gesetzen« konstituiert, das nicht an der Moralität, sondern der Legalität der befohlenen Handlungen interessiert ist. Aber eine solche Glaubensform lehnte Kant ab; sie als den richtigen Gottesdienst zu verstehen und »zur obersten Bedingung göttlichen Wohlgefallens am Menschen zu machen, ist ein Religionswahn, die Befolgung ein Afterdienst«.28 Da der Idealtyp der »statutarischen Religion« die jüdische Religion war, wurde diese somit abgeurteilt. Das historischen Theokratien entgegengesetzte, theoretisch postulierte Gemeinwesen stellte sich als »erhabene, nie völlig erreichbare Idee«29 dar, die nicht von Menschen gegründet, sondern von Gott gestiftet wurde. Ein als göttliche Stiftung verstandenes Gemeinwesen müsse die Eigenschaften der Allgemeinheit und Einheit aller Menschen, die Lauterkeit ihrer Mitglieder sowie eine geschichtstranszendierende Unveränderlichkeit besitzen und dürfe der »politischen« Form nach weder Monarchie noch Aristokratie oder gar Demokratie sein, sondern eher »Hausgenossenschaft (Familie) unter einem gemeinschaftlichen, obzwar unsichtbaren, moralischen Vater […], sofern sein heiliger Sohn, der seinen Willen weiß […] dieselbe Stelle darin vertritt«.30
Diese These bringt in staats- und moraltheoretischer Weise das systematische Ineinander der alt- und der neutestamentlichen Botschaft zum Ausdruck. Jesus gilt als der mit dem Vater einige Sohn, der alleine den göttlichen Willen in einer menschlichen Gemeinschaft symbolisiere. Dieses Gemeinwesen bilde den aus rein moralphilosophischen Überlegungen gewonnenen Begriff der wahren Kirche ab: »Ein ethisches gemeines Wesen unter der göttlichen Moralsgesetzgebung ist eine Kirche, welche, sofern sie kein Gegenstand möglicher Erfahrung ist, die unsichtbare Kirche heißt (eine bloße Idee von der Vereinigung aller Rechtschaffenen unter der göttlichen unmittelbaren aber moralischen Weltregierung, wie sie jeder von Menschen zu stiftenden zum Urbilde dient.«31 Kants moralische Kirche aller Rechtschaffenen, die der Form, nicht aber ihren Lehrinhalten nach alle Züge einer idealen katholischen Kirche trägt, stellt eine moralphilosophische Konstruktion dar, mit der sich die verschiedenen Religionen und ihre Institutionen erklären und bewerten lassen. Kants aufklärerische Ekklesiologie zielt auf die Form der Gesetze, welche die jeweilige Religion ihrem göttlichen Urheber zuschreibt, beziehungsweise auf die Regeln, nach denen die Gottheit in historischen Religionen verehrt werden wollte. Sofern diese Gesetze sich als Gesetze erwiesen, die durch vernünftige Überlegungen zustande kämen, handele es sich um moralische Gesetze, also um genau die Gesetze, die in der postulierten idealen Kirche gelten sollten. Lasse sich jedoch für die Gesetze keine vernünftige Begründung finden, so erweise sich die entsprechende Religion als einem aufklärerischen Weltverständnis diametral entgegenstehend, nämlich als Offenbarungsreligion, deren Gesetze nicht einmal als moralisch gelten könnten: »Wenn wir aber statutarische Gesetze desselben annehmen, und in unserer Befolgung derselben die Religion setzen, so ist die Kenntnis derselben nicht durch unsere eigene bloße Vernunft, sondern nur durch die Offenbarung möglich, welche, sie mag nun jedem einzelnen insgeheim oder öffentlich gegeben werden, um durch Tradition oder Schrift unter Menschen fortgepflanzt zu werden, ein historischer, nicht ein reiner Vernunftglaube sein würde.«32
Seine Analyse führte Kant zum Umkehrschluss: überall dort, wo Offenbarungsglaube, gleich welchen Inhalts, herrsche,