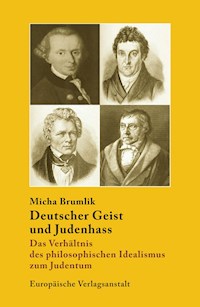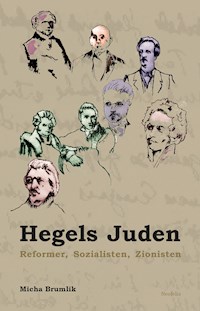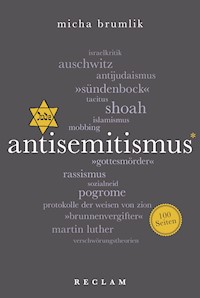9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CEP Europäische Verlagsanstalt
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Micha Brumlik legt hier die Wurzeln der jüdischen Siedlungsbewegung im europäischen Antisemitismus des 19. und 20. Jahrhunderts frei und fragt nach den faktischen, moralischen und kulturellen Bedingungen, unter denen das jüdische Volk sich »zu einer modernen Nation mit einem modernen Nationalstaat« bildete. Zahlreiche Stimmen u.a. von Theodor Herzl, Hermann Cohen und Hannah Arendt die das Projekt der zionistischen Staatengründung von Beginn bis in die Gegenwart begleitete, unterzieht er einer kritischen Reflexion. Trotz seiner grundlegenden »Kritik des Zionismus« setzt sich Micha Brumlik für unbedingte Solidarität mit dem israelischen Volk ein und plädiert für eine pragmatische, an den Realitäten des Nahen Ostens orientierte Politik.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Micha Brumlik, geboren 1947 in Davos, Schweiz, lehrte Erziehungswissenschaft u. a. in Hamburg und Heidelberg. Seit 2000 Professor am Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. Von 2000 bis 2005 Direktor des Fritz Bauer Instituts, Studien- und Dokumentationszentrum zur Geschichte und Wirkung des Holocaust. Zahlreiche Veröffentlichungen bei PHILO & PhiloFineArts, zuletzt „Aus Katastrophen lernen“ (2004), „Advokatorische Ethik“ (2004) und „Schrift, Wort und Ikone. Wege aus dem Bilderverbot“ (2006).
Micha Brumlik
Kritik des Zionismus
E-Book (EPUB):
© CEP Europäische Verlagsanstalt GmbH, Hamburg 2022
Alle Rechte vorbehalten.
Print-Erstausgabe: © EVA | Europäische Verlagsanstalt, Hamburg 2007
Covergestaltung: Qart, Hamburg
EPUB:ISBN 978-3-86393-605-1
Informationen zu unserem Verlagsprogramm finden Sie im Internet unter www.europaeischeverlagsanstalt.de
Inhaltsverzeichnis
Vorbemerkung
Kapitel I
Selbsthass oder universalistische Moral – Jüdische Zionismuskritik der Gegenwart
Kapitel II
Zur Methode der Kritik
Kapitel III
Staatsbildender Zionismus
Kapitel IV
Deutsch-jüdische Philosophie der Krise und der Zionismus
Hermann Cohen
Franz Rosenzweig
Leo Strauss
Hannah Arendt
Gershom Scholem
Ernst Bloch
Margarete Susman
Emil Fackenheim
David Novak
Yael Tamir
Kapitel V
„Infiltration“. Die zionistische Gründung im Vergleich
Kapitel VI
Postzionismus – Von Europa nach Europa
Anmerkungen
Vorbemerkung
„Der nationale Begriff des Judentums führt nach Palästina, der jüdische nach Zion.“
Gershom Scholem1
2008 wird der Staat Israel mit seiner 1967 zur Hälfte annektierten Hauptstadt Jerusalem sechzig Jahre alt. Mehr als hundert Jahre nach ihrem ersten Auftritt befinden sich Idee und Staat der jüdischen Nationalbewegung nicht nur in der Krise – gegenwärtig zeichnet sich nicht weniger als die Selbstzerstörung des zionistischen Vorhabens ab. Diesem Selbstzerstörungsprozess liegen jene widersprüchlichen Tendenzen des modernen Judentums zugrunde, die zu lösen die zionistische Bewegung mit ihrem Nationalgedanken angetreten war.2 Der Zionismus trat in Konkurrenz zu anderen Entwürfen zur Behebung der je unterschiedlich ausgeprägten „Judennot“: zum westeuropäischen Assimilationismus, der das Judentum konfessionalisieren wollte, zu unterschiedlichen Spielarten des jüdischen Sozialismus, die alle darauf setzten, mit der Lösung der sozialen Frage zugleich jede Form der Judenfeindschaft zum Verschwinden zu bringen, sowie zu Varianten eines ethnisch verstandenen Kulturjudentums, das sich im Russland des späten Zarismus als ethno-kultureller Sozialismus verstand (die jiddisch sprechende Gewerkschaftsbewegung) oder als hebräischsprachiger, aber nicht staatsbildender „Kulturzionismus“ auftrat. Tatsächlich gingen diese idealtypisch so verschiedenen Motive in der Realität beinahe beliebige Kombinationen ein, die zu entfalten hier nicht der Ort ist. Von ihnen allen unterschied sich der politische Zionismus sowohl durch seinen Territorial- als auch durch seinen Staatsgedanken, wobei keineswegs immer klar war, dass als einziges Territorium für einen Judenstaat Regionen des biblischen Landes Israel in Frage kamen.
Als Reaktion auf die Judenfeindschaft entstanden – voneinander zunächst unabhängig – zuerst in Russland,3 dann nach der französischen Dreyfus-Affäre4 und mit dem Auftreten des Wiener Journalisten Theodor Herzl5 auch in England, Deutschland und Österreich kleine jüdische Nationalbewegungen, die die Judenfeindschaft als mittelfristig oder überhaupt nicht behebbare gesellschaftliche, ja sogar biologische Tatsache ansahen und daher den Exodus der bedrohten Juden in ein ungefährdetes, selbstregiertes Territorium am Rande der Einflusszonen der damaligen Großmächte erwogen, also den Exodus in eine nationale Heimstätte im südlichen Lateinamerika, Argentinien, in Ostafrika oder eben im osmanischen Reich: im Sinai oder dem biblischen Land Israel, in Palästina.6 Die ersten zionistischen Einwanderergruppen nach Palästina – vor und nach dem Ersten Weltkrieg – trachteten zudem nach der Erlösung des in der Diaspora deformierten jüdischen Körpers durch kollektive Arbeit an der Scholle.7 Schließlich verband sich dieser lebensreformerische Sozialismus8 nicht nur mit einem romantischen Nationalismus9, sondern eben auch mit einem bürgerlichen Machtstaatsdenken, das die Rettung des in Europa bedrohten jüdischen Volkes allein durch den Aufbau einer jüdischen Armee, die militärische Eroberung des künftigen Territoriums beiderseits des Jordans und die Masseneinwanderung in Städte und nicht-sozialistische Siedlungen garantiert sah.10 Es war endlich der Junikrieg des Jahres 196711 und die mit ihm verbundene Eroberung der Sinaiwüste, der Golanhöhen, Ostjerusalems und der Klagemauer sowie des Westjordanlandes, die die Selbstzerstörung des zionistischen Vorhabens einleitete.12 Der auf Vertreibungs- und nicht auf Vernichtungsantisemitismus hin angelegte jüdische Staat – ein Staat, der den Holocaust auch dann nicht hätte verhindern können, wenn er vor 1933 gegründet worden wäre13 – sah sich 1967 einer Vernichtungsdrohung ausgesetzt, gewann aber mit seinem raschen Sieg jene Territorien, um die es dem religiösen Judentum immer gegangen war. Seither stellt Jerusalem14 – politisch gesehen – nicht die Lösung, sondern das Problem in seiner intensivsten Form dar. An der Frage, wie der Staat Israel, der sich seit mehr als sechzig Jahren durch mindestens fünf Kriege und eine prekäre Besatzungsherrschaft selbst erhalten hat, mit den von ihm beherrschten Palästinensern, seinen Nachbarn, Frieden finden soll, scheiden sich seither immer wieder die Geister, nicht zuletzt auch unter den Juden selbst.15
Der Zionismus und der Staat Israel sind für den Autor dieser Zeilen immer wieder Anlass zu Diskussion und persönlicher Reflexion gewesen. Der vorliegende Essay schließt sowohl an seine Studie „Weltrisiko Naher Osten“ aus dem Jahr 1991 als auch an biographische Aufzeichnungen an, die 1996 unter dem Titel „Kein Weg als Deutscher und Jude“ erschienen sind. Doch geht es diesmal, anders als in den biographischen Aufzeichnungen, nicht darum, persönlich über das Verhältnis zu Zionismus und Antizionismus Rechenschaft abzulegen, sondern um den Versuch einer geschichtsphilosophischen Kritik. Anhand der neu entbrannten innerjüdischen Debatte zum Staat Israel und seiner Politik gegenüber den Palästinensern führt das erste Kapitel in die Thematik ein, während im zweiten Kapitel die Grundsätze einer geschichtsphilosophischen Kritik skizziert werden. Das dritte Kapitel klärt den Begriff des „Nationalstaats“, während das vierte Kapitel die Gründe des internen Scheiterns der zionistischen Idee über jenen Jahrzehnte währenden Dialog nachzeichnet, den die deutsch-jüdische Philosophie der Krise geführt hat. Das fünfte Kapitel gilt dem Versuch, die Perspektive zu weiten und zu belegen, dass das externe Scheitern dieses europäischen Expansionsversuchs aus seiner Ungleichzeitigkeit mit anderen Entwicklungen zu erklären ist. Das letzte, sechste Kapitel ist der gegenwärtigen Epoche des Postzionismus gewidmet und soll zeigen, dass nach vermeintlichem Erfolg und letztendlichem Scheitern des Zionismus, also nach dem Ende dieser Weltanschauung, nur noch die Sorge um die jüdische und arabische Bevölkerung Israels und Palästinas sowie eine dem entsprechende entschiedene Solidarität bleibt – eine Solidarität, die sich freilich nie anmaßen darf, den verfeindeten Akteuren, seien sie nun Juden oder Palästinenser, Ratschläge zu erteilen, deren Folgen die Ratgeber ja selbst nicht auszutragen haben.
Kapitel I
Selbsthass oder universalistische Moral – Jüdische Zionismuskritik der Gegenwart1
„Wir fordern die deutsche Regierung auf, mit der Europäischen Union die israelische Besatzungspolitik nicht länger zu tolerieren, kurzfristig den Boykott der Palästinensischen Autonomiebehörde zu beenden …“
Berliner Erklärung „Schalom 5767“
Mehr als einhundert Jahre nach den ersten jüdischen Siedlungsversuchen2 im osmanischen Millyet Falestin, bald sechzig Jahre nach der Gründung des Staates Israel und nun vierzig Jahre nach der Eroberung der Westbank durch Israel scheint der Palästinakonflikt einer Lösung ferner zu sein denn je. Beides, die aussichtslose aktuelle Lage wie der im symbolischen Gedächtnis auffällig präsente Konflikt, führt nicht nur in der Weltöffentlichkeit, sondern auch innerhalb des Judentums zu heftigen, in den Jahren 2006–2007 immer gereizteren Debatten. Um sich über die Bedeutung dieser vor allem in den USA und Großbritannien, kaum in Frankreich und erst jetzt in Deutschland neu geführten Debatten klar zu werden, ist es unerlässlich, eine erste Verständigung über das, was der Begriff „Judentum“ bezeichnen soll, herbeizuführen.
Die auf dem Glauben der hebräischen Bibel beruhende, in der späten Antike kodifizierte jüdische, rabbinische Religion unterscheidet sich als Religion von Christentum und Islam dadurch, dass man ihr durch Geburt angehört – als Jüdin oder Jude gilt nach rabbinischem Recht, wer von einer jüdischen Mutter geboren wurde – oder aber durch Übertritt angehören kann. Da weder in der Antike, noch im Mittelalter oder gar in der Moderne alle Jüdinnen oder Juden gläubig waren, hat das Judentum – im Unterschied zu den anderen monotheistischen Religionen – der geburtlichen Zugehörigkeit wegen immer auch einen mehr oder minder ethnischen Charakter. Allerdings ist die ethnische Zugehörigkeit für den einzelnen Juden oder die einzelne Jüdin in komplexen, ausdifferenzierten Gesellschaften weder zwingend noch bindend – die Rede von „jüdischer Herkunft“ einzelner Personen oder – ebenso vage – von einer „Schicksalsgemeinschaft“ aller Juden belegt das. Andererseits weist diese Religion, weist dieser ethnische Verband mehr oder minder große, konfessionelle Institutionen, ethnisch organisierte Allianzen sowie vielfältige, kulturelle Ausdrucksformen auf. Die gewichtigste Institution dieser Art dürfte neben Synagogengemeinden, jüdischen Wohlfahrtsverbänden und jüdischen NGOs der Staat Israel sein, der über institutionelle und verwandtschaftliche Bindungen in mehr oder weniger intensivem Kontakt mit Institutionen und Personen der diasporisch lebenden jüdischen Diaspora steht. Mit dem Staat Israel hat sich ein Teil der jüdischen Ethnie die Form eines eigenen Nationalstaats gegeben – eines Nationalstaats, der nach dem Völkermord der Nationalsozialisten trotz seiner prekären Lage in einer feindlichen geographisch-politischen Umwelt zunächst Hoffnung bündelte, um zuletzt immer mehr Sorge auf sich zu ziehen. Heute identifizieren sich weltweit etwa 16 Millionen Menschen in welcher Weise auch immer mit dem Judentum, von denen etwa 5 Millionen im Staat Israel leben, während sich die anderen in der Diaspora – mit einem Schwerpunkt in den USA – ungleichmäßig auf andere Länder verteilen. So stellt das Judentum einen ethnisch-religiösen Konnex dar, einem vernetzten System konzentrischer Kreise gleich, mit starken Kernen, Mitgliedschaften und Identifikationen bei all jenen, die in und mit jüdischen Institutionen leben, bzw. abgeschwächtem Zugehörigkeitsempfinden jener, die weder durch Sozialisation noch durch Lebenslauf oder Überzeugung motiviert ihr Leben jenseits der institutionellen Kerne verbringen. Der jüdische Staat ist aufgrund seiner Bedrohung, seiner grundsätzlich völkerrechtswidrigen, im Einzelnen oft menschenrechtswidrigen Besatzungs- und Siedlungspolitik im Westjordanland3 sowie aufgrund des immer wieder aufflammenden, mörderischen palästinensischen Terrors in einen auf den ersten Blick unlösbaren Konflikt geraten. Dieser schafft nicht nur Verdruss, zerstört nicht nur Illusionen, sondern führt auch in Israel und der jüdischen Diaspora zu Solidarisierungen und gruppenbezogenen Feindschaften, die neuerdings in Vorwürfen, entweder jüdischer Antisemit oder ganz unjüdischer, chauvinistischer Rassist zu sein, gipfeln.
Die internationale Debatte begann im Jahr 2006 mit Beiträgen der realistischen Schule der US-Außenpolitik zugehörigen, in Harvard lehrenden Politologen John Mearsheimer und Stephen Walt. Sie waren in einem Aufsehen erregenden Beitrag im „London Review of Books“ vom 23. März 2006 um den empirischen Nachweis bemüht, dass eine „Israel Lobby“, als deren Kern das konservativen Demokraten und Republikanern nahestehende AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) gilt, die Nahostpolitik der Bush-Administration nicht nur massiv beeinflusst, sondern damit auch den nationalen Interessen der USA schadet. Die detailreiche Studie, die auf einen die Interessen der Palästinenser und der arabischen Nachbarn Israels berücksichtigenden Kurswechsel in der US-Außenpolitik zielt, fand deutlichen, zum Teil wütenden Widerspruch – nicht selten wurde sogar der Vorwurf des Antisemitismus erhoben. Freilich merkte sogar ein jeder Solidarität mit israelischer Politik unverdächtiger Zeuge wie Noam Chomsky an, dass es doch vor allem die Interessen der Ölindustrie seien, welche die aktuelle US-amerikanische Nahostpolitik bis zum Irakkrieg bestimmten – und eben nicht irgendwelche vor allem ideologischen Vorfeldorganisationen.4
Ohne direkt von ihr verursacht worden zu sein, kam es im Anschluss an die von Mearsheimer/Walt angezettelte Debatte auch in der jüdischen Diaspora zu verschiedenen Protesten gegen die israelische Besatzungspolitik – vorgetragen von jüdischen Persönlichkeiten, deren Auftritt immer wieder als mutiger Tabubruch gerühmt wird. Doch ist dieses Lob schon deshalb falsch, weil nichts von diesen Argumenten und Einwänden aus der Diaspora in irgendeiner Weise originell ist: Die führende israelische Tageszeitung „Haaretz“ betreibt seit Jahren nichts anderes als eine präzise und prägnante Kritik der israelischen Besatzungs- und Siedlungspolitik,5 während israelische Menschenrechtsorganisationen wie die „Women in Black“ in der Praxis etwas beweisen, wovon der kostenlose, papierene Protest der Verfasser von Erklärungen weit entfernt ist: Zivilcourage im Belagerungszustand. Die intensive Debatte innerhalb der israelischen Öffentlichkeit zeigt auf, dass es den meisten jüdischen Interpellanten in der Diaspora gar nicht um den Palästinakonflikt geht, sondern um einen durchaus legitimen eigenen Entwurf jüdischer Identität, den sie gegen vermeintlich pro-israelische Gemeindevorstände zu Gehör bringen wollen.
In gewisser Weise beerben diese jüdischen Kritiker israelischer Besatzungspolitik ein entleertes biblisches Motiv: Sie stellen sich in eine kaum noch erkennbare, säkularisierte Tradition des alttestamentlichen Heiligkeitsgesetzes („Heilig sollt ihr mir sein“ – Leviticus 19,2) bzw. des Zuspruchs in Jesaja 42,6, worin dem Volk Israel die Aufgabe zugesprochen wird, ein Licht unter den Völkern zu sein. Im frühen 20. Jahrhundert, im Zeitalter der Assimilation, des bürgerlichen Aufstiegs der Juden nach der Befreiung aus den Ghettos, aber auch im Zeichen der russischen Revolution wurde dies säkularisierte Heiligkeits- und Gerechtigkeitsmotiv für viele, keineswegs die meisten jungen jüdischen Intellektuellen zum Restbestand eines Judentums, das sie ob seines Konservativismus verlassen und unter dem sie nur noch eine radikalisierte universalistische Moral verstehen wollten.6
Ein besonders prägnantes Beispiel für diese Haltung liefert Alfred Grosser, der als Kind in die französische Emigration getriebene Politologe, der über seine stets betonte jüdische Herkunft hinaus in jüdischen Angelegenheiten völlig unbewandert ist. Freilich verbindet Grosser abgesehen von seiner jüdischen Herkunft nichts mit dem Judentum, was er selbst mit Aplomb öffentlich eingeräumt hat. Nach eigener Auskunft steht ihm das Christentum sehr viel näher als das Judentum.7 Grossers in mehreren deutschen Medien publizierter Beitrag „Warum ich Israel kritisiere“8 artikuliert dies in idealtypischer Klarheit. Grosser, der sich als Sprössling einer deutschnationalen, hochassimilierten jüdischen Familie offenbart, bekundet, sich gerade der erlittenen Verfolgung wegen nicht nur um den demokratischen Wiederaufbau Deutschlands sorgen zu müssen, sondern auch, aus der Erfahrung der eigenen Verfolgung heraus besondere Lehren gezogen zu haben. Daher auch seine Solidarität mit den deutschen Opfern des Zweiten Weltkrieges, „weil wir von keinem jungen Deutschen verlangen konnten, das Ausmaß von Hitlers Verbrechen zu verstehen, wenn wir nicht Verständnis zeigten für das Schicksal der Seinen. Ebenso kann man von keinem jungen Palästinenser verlangen, die Opfer der schrecklichen Attentate zu beklagen, wenn das Leiden der Seinen ignoriert wird.“ Jude zu sein, gerade aufgrund der eigenen Erfahrung von Verfolgung – das gipfelt für Grosser, der nach eigenem Bekunden ein echter, „sein Vaterland liebender Franzose“ ist, darin, ein konsequenter moralischer Universalist sein zu wollen, der überall, wo Unrecht und Menschenrechtsverletzungen geschehen, seine Stimme zu erheben hat – so schon früh gegen die von der Kolonialmacht Frankreich begangenen Greuel im Algerienkrieg. Vor diesem Hintergrund kann es Grosser, der nach eigener Auskunft keine Gelegenheit auslässt, sich kritisch auch mit Formen des islamistischen Judenhasses auseinanderzusetzen, nur schmerzen, dass ausgerechnet der jüdische Staat völker- und menschenrechtswidrig handelt. Indes: Grosser verstärkt mit seinem Beitrag auf fatale Weise den antisemitischen und grundfalschen Eindruck, als dürfe eine öffentliche Kritik an der Politik israelischer Regierungen nicht geäußert werden, was aber in Israel und außerhalb Israels durchaus und andauernd geschieht.
Zudem bringt er mehr oder minder deutlich das „Rückkehrrecht“ der Palästinenser ins Spiel, gewiss ohne es zu fordern, aber wohl wissend, dass die vollzogene Rückkehr das demographische Ende des jüdischen Staates bedeutete; darüber hinaus kritisiert er nicht nur die Linienführung des Grenzzauns, sondern diesen selbst, ohne auf den Umstand einzugehen, dass durch den Zaun die Häufigkeit von Selbstmordanschlägen gegen die israelische Zivilbevölkerung nachweislich zurückgegangen ist. Der vaterlandsliebende Franzose zitiert mit gebremster Empörung eine Umfrage von „Haaretz“, nach der 68% der jüdischen Israelis zu Protokoll gegeben haben, lieber nicht mit Arabern in einem Hause leben zu wollen. Grossers Zurechnung zielt auf den moralischen Verfall der israelischen Juden – die nahe liegende Frage, wie viele Araber denn gerne mit Juden in einem Haus leben würden, zieht er ebenso wenig in Erwägung wie die mögliche Frage, wie denn seine französischen Landsleute auf eine solche Frage geantwortet hätten.
An alledem wird das grundsätzliche Dilemma dieser Form eines ebenso distanzierten wie elitären Humanismus deutlich: Während es in der globalisierten Welt das selbstverständliche Recht, vielleicht sogar die Pflicht eines jeden Menschen ist, gegen Menschenrechtsverletzungen allüberall einzutreten, wirken besondere – mit der Zugehörigkeit zum Judentum begründete – Ermächtigungsklauseln beim Eintreten für mehr Moral fragwürdig. Eines gilt für all jene, die sich aufgrund eines auch nur marginal gelebten Judentums in der Diaspora ermutigt und ermächtigt sehen, die Politik israelischer Regierungen anzuklagen: dass sie selbst die Folgen einer veränderten Politik im Guten wie im Schlechten nicht zu tragen haben. Das Gewicht, nicht die Berechtigung von Kritik aber ist allemal an die Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung gebunden – eine Verantwortung, die der universalistisch gesonnene Grosser völlig zu Recht als vaterlandsliebender Franzose in Frankreich, in Europa, nicht aber für Israel wahrnehmen kann.
Eine folgenreiche Übernahme von Verantwortung aber wiegt moralisch schwerer, als lediglich Moral zu predigen und es allenfalls zu riskieren, da und dort einmal ausgeladen zu werden. So wie es dem einem traditionellen jüdischen Milieu entstammenden Historiker Tony Judt ergangen ist, der in mehreren Beiträgen und Interviews zur Geschichte des Staates Israel und seiner aktuellen Politik kritisch Stellung nahm und als Ausweg aus der Krise schon 2003 die linkszionistische Idee eines binationalen Staates wieder aufgriffen hat.9 Judt hatte in diesem Beitrag schlüssig nachgewiesen, dass ein ethnisch-jüdisch geprägter Nationalstaat ein historischer Anachronismus ist und dass die tatsächliche Alternative, vor der sowohl die Weltgemeinschaft als auch die jüdische Bevölkerung des Staates Israel steht, „jene zwischen einem ethnisch gesäuberten Großisrael und einem einheitlichen, integrativen, binationalen Staat sein“ werde, „bestehend aus Juden und Arabern, Israelis und Palästinensern“.10 Aufgrund dieses Artikels wurde Judt – angeblich nach Interventionen amerikanisch-jüdischer Lobbyorganisationen, des American Jewish Committee und der Anti-Diffamation League – vom polnischen Generalkonsulat in New York von einem bereits zugesagten Vortrag im Oktober 2006 wieder ausgeladen. So sehr die bisher keineswegs sicher belegten Interventionen dieser Lobbyorganisationen zu bemängeln sind, so sehr fällt auf, dass es denn doch eine polnische Institution war, die Judt erst ein- und dann wieder ausgeladen hat. Ist der Stand Polens, eines der treuesten Verbündeten der USA im Irak und bei der Stationierung von Raketenabwehrsystemen, in den USA wirklich so schwach? Herrscht dort am Ende eine antisemitische Phantasmagorie von der „Macht der Ostküstenpresse“? Worum ging es in der Sache?
Judt, Direktor der Remarque-Instituts an der New York University, ein glänzender Kenner der europäischen Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg, machte sich für die genannten Lobbyorganisationen dadurch missliebig, dass er das Scheitern der Friedensbemühungen im Zeichen der „road map“ feststellte und angesichts der demographischen und siedlungsgeographischen Trends für das vermeintlich Undenkbare eintrat: für einen jüdisch-palästinensischen, binationalen Staat, wie er nicht wenigen linken Zionisten, etwa Martin Buber, bis 1948 vorschwebte.11 Nach einhundert Jahren Hass und Gewalt zwischen Juden und Palästinensern ist diese Vorstellung, das dürfte auch Judt bewusst sein, unrealistisch und ihr später Vertreter dürfte wissen, dass mittelfristig an einer Zweistaatenlösung nichts vorbeiführt. Denn obwohl der Nationalstaat weltweit als politisches Organisationsmodell strukturell längst überholt ist,12 wird man doch derzeit auch in gemäßigteren Regionen Zeuge der immer neuen Gründung von schon bei ihrem Entstehen veralteten Nationalstaaten: so im ehemaligen Jugoslawien, so bei der einvernehmlichen Scheidung zwischen Tschechien und der Slowakei, so beim Streit um den Status des Kosovo, so sogar bei den immer wieder neu aufflammenden Debatten und Abstimmungen in Nordamerika um die mögliche Unabhängigkeit der Provinz Québec. Judts Vorschlag ist deshalb eher Ausdruck politischer Verzweiflung vor dem Hintergrund einer lebenslang favorisierten linkszionistischen Utopie denn ein ernsthaftes politisches Programm. Die Wut, die er sich seitens jüdischer Organisationen zugezogen hat, dürfte vor allem daraus resultieren, dass hier jemand, den man der „eigenen“ Seite zurechnete, auf die vermeintlich „andere“ Seite wechselte.
An den Einlassungen Grossers und Judts lässt sich eine wesentliche Differenz beobachten: Dort ein Intellektueller, für den das Judentum zu einem ausgedünnten, höchst selektiv verwendeten Erinnerungsposten universalistischer Moral geschrumpft ist, eine Person, die allen Formen jüdischer Gemeinschaft weitgehend entfremdet lebt, hier ein anderer Intellektueller, der sich zeit seines Lebens dem ethnisch-religiösen Konnex des jüdischen Volkes zugerechnet und sich an dessen vielfältigen Debatten beteiligt hat. Das Gewicht, das dem patriotischen Franzosen und engagierten Europäer Alfred Grosser in Fragen etwa des deutsch-französischen Verhältnisses zukommt, wird er im Hinblick auf das Israel/Palästina-Problem nie erlangen. Das erklärt auch die weitgehend kommentarlose Hinnahme seiner Einlassungen. Vergleichbares ist an zwei öffentlichen Erklärungen jüdischer Initiativen in Großbritannien und Deutschland zu beobachten.
So hat eine im Vereinigten Königreich gegründete Organisation „Independent Jewish Voices“ eine in Tonfall und Inhalt maßvolle Erklärung publiziert, die bisher etwa 350 jüdische, meist akademische Persönlichkeiten unterschrieben haben, unter ihnen etwa der bekannte Historiker Eric Hobsbawm und der Dramatiker Harold Pinter – beides Persönlichkeiten, die sich übrigens – ähnlich wie Alfred Grosser – in ihrem bisherigen Leben nicht durch besondere Identifikation mit der jüdischen Gemeinschaft hervorgetan haben. Die Erklärung selbst weist fünf Punkte auf:
„1. Human rights are universal and indivisible and should be upheld without exception. This is as applicable in Israel and the occupied Palestinian territories as it is elsewhere. 2. Palestinians and Israelis alike have the right to peaceful and secure lives. 3. Peace and stability require the willingness of all parties to the conflict to comply with international law. 4. There is no justification for any form of racism, including anti-Semitism, anti-Arab racism or Islamophobia, in any circumstance. 5. The battle against anti-Semitism is vital and is undermined whenever opposition to Israeli government policies is automatically branded as anti-Semitic.“13
Diese untadeligen Stellungnahmen werden um die nicht weiter belegte Unterstellung ergänzt, dass die etablierten Organisationen des britischen Judentums jede Aktion jeder israelischen Regierung rechtfertigen; brisant ist jedoch die weitere Unterstellung, dass jede mögliche Kritik an israelischen Regierungen von deren Verteidigern als antisemitisch gebrandmarkt wird. Ist dem tatsächlich so? Ein paar Belege dafür hat allenfalls der durch seine Angriffe auf die von ihm sogenannte „Holocaust-Industrie“ bekannt gewordene Autor Norman G. Finkelstein in seinem polemischen Buch „Antisemitismus als politische Waffe. Israel, Amerika und der Missbrauch der Geschichte“14 vorzulegen versucht.
Ein Beispiel für das, was dieser tendenziöse Autor meint, könnte etwa in der zu Beginn dieses Jahres vom American Jewish Committee veröffentlichten, von der deutschen Zweigstelle in Berlin unter Verschluss gehaltenen Broschüre des in Bloomington, Indiana lehrenden Professors der Literaturwissenschaft, Alvin H. Rosenfeld, vorliegen. Unter dem Titel „‚Progressive‘ Jewish Thought and the New Anti-Semitism“15 setzt sich Rosenfeld mit dem auseinander, was er vor dem Hintergrund des populären Judenhasses in der islamischen Welt als mindestens problematische, wenn nicht sogar antisemitische oder doch antisemitisch wirkende Beiträge jüdischer Persönlichkeiten wertet. Rosenfeld nennt pazifistische Organisationen progressiver RabbinerInnen, Intellektuelle wie die britische Autorin Jacqueline Rose, den kanadischen Philosophieprofessor Michael Neumann oder eben Tony Judt. Die britische Literaturwissenschaftlerin Jacqueline Rose etwa war eine intellektuelle Weggefährtin des inzwischen verstorbenen, postmodern-kritischen, US-amerikanisch-palästinensischen Autors Edward Said, dessen Studie zum „Orientalismus“ ein Wegbereiter der postkolonialen Debatte wurde. Jacqueline Rose publizierte 2005 in der Princeton University Press einen Essay unter dem Titel „The Question of Zion“16, dem Rosenfeld unbegründet eine Reihe schwerer, sachlicher Fehler nachzuweisen sucht, dem er aber vor allem Roses Behauptung ankreidet, dass Israel die Sicherheit der jüdischen Diaspora gefährde, Israel also „schlecht für die Juden“ sei. Vor allem aber weist er Roses Meinung zurück, dass die kriegerischen Verstrickungen Israels sinnvoll im Vokabular der Tragödie beschrieben werden können. Schließlich moniert Rosenfeld ihre Behauptung, dass die zionistische Vision von Anfang an die Keime der späteren politischen Katastrophen in sich getragen habe. So wenig Alvin Rosenfeld der komplexen Argumentation von Roses Essay gerecht wird, so sehr scheint er im Fall des bisher völlig unbekannten kanadischen Philosophen Michael Neumann recht zu haben. So hat sich Neumann zu Äußerungen hinreißen lassen, wonach die Klage über jedes Vergießen jüdischen Blutes als welterschütternder Katastrophe „schlicht und ergreifend rassistisch“ sei: „the valuing of one races blood over all others“. Neumann unterstelle Israel eine genozidale Haltung gegenüber den Palästinensern, so Alvin Rosenfeld, und bekenne: „if saying these things is anti-Semitic, then it can be reasonable, to be anti-Semitic“.
Damit ist man am schmerzhaftesten Punkt einer Debatte unter Juden angelangt: dem Umstand, dass einige Juden andere Juden als „Antisemiten“ bezeichnen.17 Wer das tut, begeht jedoch keinen grundsätzlichen Fehler. Denn so wie es frauenfeindliche Frauen oder schwulenfeindliche Homosexuelle gibt, kann es auch jüdische Antisemiten geben. Ob es sie gibt, ist eine empirische, keine begriffliche Grundsatzfrage. Diesem Phänomen hat der Philosoph Theodor Lessing18 bereits 1930 seine klassische Studie „Der jüdische Selbsthass“19 gewidmet, wobei dieser Begriff – den Lessing am Schicksal des jungen Philosophen Otto Weininger20 gewonnen hatte, der sich nach dem Verfassen eines juden- und frauenfeindlichen Traktats aus Verzweiflung über seine jüdische Herkunft umgebracht hat – unpräzise ist. Denn das, wogegen jüdische Antisemiten vorgehen, ist ja nicht in jedem Fall ihr jüdisches „Selbst“, sondern eine Konzeption des Judentums, die nicht die ihre ist. So dürfte es auch nach hiesigem Verständnis keine besondere Schwierigkeit bereiten, den ultraorthodoxen Wiener Rabbiner Moshe Aryieh Friedman als jüdischen Antisemiten zu bezeichnen – und das dem Umstand zum Trotz, dass er sich als Verkörperung eines wahren, radikal antizionistischen Judentums versteht, das den Staat Israel ablehnt, weil er Gottes messianischer Verheißung zuwiderlaufe. Derselbe Friedman nahm an der Konferenz zur Leugnung des Holocaust teil, die vom iranischen Präsidenten Ahmadinedschad ausgerichtet wurde, und schon Jahre vorher hat er der „Deutschen National- und Soldatenzeitung“ gerne Interviews gegeben. Inzwischen ist Friedman aus der Jüdischen Gemeinde Wien ausgeschlossen worden. Aber trifft die Bezeichnung „jüdischer Antisemit“ auch auf Personen wie Rose, Judt oder progressive „Rabbis for a Just Peace“ zu? Die politisch engagierte Antisemitismusforschung scheint in der Bewertung dieser Bewegungen uneins zu sein. Als zu Beginn des Jahres 2007 in Jerusalem ein „Weltforum gegen Antisemitismus“ tagte,21 das von der israelischen Außenministerin Livni unter Verlesung von Auszügen aus der nach wie vor gültigen Charta der „Hamas“ eröffnet wurde, sorgte der Vortrag eines Professors der London University, Anthony Julius, für heftige Debatten. Julius, der sich mit den Differenzen zwischen dem Antisemitismus der Nationalsozialisten und dem sogenannten „Neuen Antisemitismus“ befasste und diesen „Neuen“ auch von Juden getragenen „Antisemitismus“ nicht dem Staat, sondern der Zivilgesellschaft zurechnete, stieß er auf Widerspruch, als er sich denn doch dafür entschied, nicht von „Neuem Antisemitismus“, sondern von „Neuem Antizionismus“ zu sprechen.