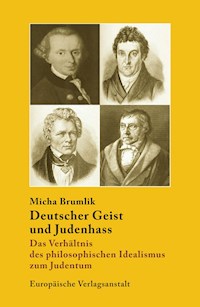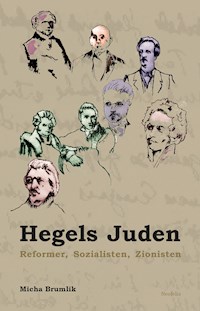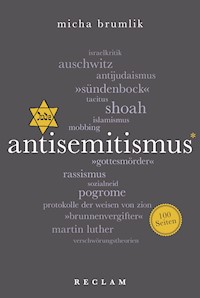14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CEP Europäische Verlagsanstalt
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Gerechtigkeit, Mut, Klugheit, Besonnenheit sowie Glaube, Liebe, Hoffnung – in welcher Weise hat der überkommene Tugendkatalog immer noch Gültigkeit und wie bewährt er sich innerhalb der heutigen Zeit? Das sind die zentralen Fragen dieses Buches. Micha Brumlik, Autor zahlreicher erziehungs- und kulturwissenschaftlicher Bücher, analysiert die Bedingungen und Möglichkeiten der Entwicklung sozialen Verhaltens und unternimmt dabei den Versuch, den Zusammenhang von Moral, Glück, Gefühlen und der Bildung des Individuums neu zu formulieren. Dabei versteht er den Begriff »Tugend« im Sinne des lateinischen »virtus«, also als Fähigkeiten und Handlungskompetenzen, über die Individuen verfügen müssen, um sich gesellschaftlichen Zumutungen gegenüber zu behaupten und ein glückliches Leben im Verein mit anderen anstreben zu können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Micha Brumlik lehrte Erziehungswissenschaft zunächst in Hamburg und Heidelberg. 2000–2013 Professor am Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft der J. W. Goethe-Universität Frankfurt am Main und bis 2005 Direktor des Fritz Bauer Instituts, Studien- und Dokumentationszentrum zur Geschichte und Wirkung des Holocausts. Seit 2013 ist Brumlik Senior-Professor am Zentrum für Jüdische Studien Berlin/Brandenburg und seit 2017 Senior-Professor der J. W. Goethe-Universität in Frankfurt am Main. 2003 erhielt er die Hermann-Cohen-Medaille und 2016 die Buber-Rosenzweig-Medaille.
Zahlreiche Veröffentlichungen, u.a.: »Aus Katastrophen lernen« (2004), »Sigmund Freud. Der Denker des 20. Jahrhunderts« (2006), »Schrift, Wort und Ikone. Wege aus dem Bilderverbot« (2006), »Kritik des Zionismus« (2007), »Entstehung des Christentums« (2010) sowie »Messianisches Licht und Menschenwürde. Politische Theorie aus Quellen jüdischer Tradition« (2013), »Vernunft und Offenbarung« (2001/2014), »Wann, wenn nicht jetzt – Versuch über die Gegenwart des Judentums« (2015), »Advokatorische Ethik. Zur Legitimation pädagogischer Eingriffe« (2004/2017), »Luther, Rosenzweig und die Schrift. Ein deutsch-jüdischer Dialog« (2017).
Herausgeber und Autor von Essays und Artikeln in Zeitungen und Zeitschriften. (www.michabrumlik.de)
Micha Brumlik
Bildung und Glück
Versuch einer Theorie der Tugenden
Neuausgabe
E-Book (EPUB):
© CEP Europäische Verlagsanstalt GmbH, Hamburg 2022
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlagmotiv: Allegorie der Tugend aus Cesare Ripa, Iconologia
Umschlaggestaltung: Susanne Schmidt, Leipzig
EPUB:
ISBN 978-3-86393-613-6
Auch als gedrucktes Buch erhältlich:
© der aktualisierten Neuausgabe CEP Europäische Verlagsanstalt GmbH,
Hamburg 2019
Print: ISBN 978-3-86393-091-2
Informationen zu unserem Verlagsprogramm finden Sie im Internet unter
www.europaeischeverlagsanstalt.de
Inhalt
Vorwort zur Neuausgabe
Vorbemerkung
Einleitung: Moralische Gefühle und Die Leichtigkeit des Seins
I.Menschliche Natur und Tugendethik
II.Skizze einer Theorie des Lasters
III.Vertrauen und Scham – Grundzüge einer Theorie moralischer Gefühle
IV.Evolution, Altruismus und Moral
V.Die Leidenschaft der Pädagogik
VI.Glück und Lebenslauf
VII.Humanontogenese und der Sinn des Lebens
VIII.Tugend und Charakter
IX.Die Tugenden
Gerechtigkeit
Mut
Mäßigung und Besonnenheit
Hoffnung
Glaube
Liebe
X.Freundschaft
XI.Tugend und demokratischer Charakter
XII.Toleranz – Tugend der Citoyens?
Bibliographische Notiz
Anmerkungen
Micha Brumlik
Vorwort zur Neuausgabe
Die vor mehr als fünfzehn Jahren erschienene erste Ausgabe von „Bildung und Glück“ endete mit Überlegungen zur Frage der Toleranz, der Frage, ob Toleranz eine Tugend von Citoyens sei. Als Antwort wurde damals ein Zitat des US-amerikanischen, pragmatistischen Philosophen John Dewey gegeben, eine Antwort, die in unserer Gegenwart des frühen einundzwanzigsten Jahrhunderts, geprägt vom Aufstieg rechtspopulistischer Parteien aktueller nicht sein könnte: „The only cure for the shortcomings of democracy is more democracy.“ Dies kommentierte ich damals mit der womöglich zu optimistischen Bemerkung, dass die Citoyens einer toleranten Gesellschaft einander freund seien. Das freilich scheint weniger denn je der Fall zu sein – es ist mehr als nur ein Zufall, dass die radikalste Analyse der Krisen westlicher Gesellschaften in Zeiten von Globalisierung und Digitalisierung, im Zeichen des Aufstiegs der zu bequem als „Rechtspopulismus“ bezeichneten autoritärnationalistischen Bewegungen1 den Titel „Die Gesellschaft des Zorns“2 trägt. Von Freundschaft in irgendeinem Sinne kann hier keine Rede mehr sein.
Ich möchte daher die Gelegenheit zum Vorwort einer Neuausgabe von „Bildung und Glück“ nutzen, um genau dieser Frage, also der Frage, was es heißen kann, einander auch in antagonistisch auseinanderstrebenden Gesellschaften aufgrund von Bildung politisch freund zu werden, mit einer Reflexion auf einschlägige Debatten in der Philosophie des Deutschen Idealismus3 nachzugehen.
„Nur wolle man ja nicht … glauben, daß der Mensch erst jenes lange und mühsame Raisonnement anzustellen habe, welches wir geführt haben, um sich begreiflich zu machen, daß ein gewisser Körper außer ihm einem Wesen seines Gleichen angehöre. Jene Anerkennung geschieht entweder gar nicht, oder sie wird in einem Augenblicke vollbracht, ohne daß man sich der Gründe bewußt wird. Nur dem Philosophen kommt es zu, Rechenschaft über dieselben abzulegen.“4
Anders als man vielleicht glauben möchte, stammt diese Bemerkung jedoch nicht von dem inzwischen weltweit als Anerkennungstheoretiker par excellence anerkannten Hegel5, sondern von einem anderen, freilich in derselben Epoche wirkenden Denker – doch dazu später mehr. Bevor ich darauf zurückkomme, will ich mich zunächst der grundlegenden bildungs-philosophischen, bildungstheoretischen Fragestellung zuwenden, die ich unter dem Titel „Allgemeinbildung“ verhandele (1), um dann einige Annahmen der hegelschen Bildungsphilosophie im engeren Sinne zu skizzieren (2). In einem weiteren Schritt will ich dann skizzieren, was der hegelschen Philosophie für eine aktuelle Theorie der Allgemeinbildung zu entnehmen ist (3), um abschließend eine zwar ebenfalls idealistische, aber evtl. doch einschlägigere Theorie der Anerkennung vorzuschlagen.
1.Was heißt heute „Allgemeinbildung“?
Was „Allgemeinbildung“ heute heißen kann, ist heute nicht nur ob der im engeren Sinne bildungspolitischen Lage schwer zu beantworten, sondern auch einer Theorieentwicklung wegen, die den Begriff bereits Mitte der 1960er Jahre für obsolet hielt. Zwar ging es Theodor W. Adorno in seiner berühmten Studie zu einer „Theorie der Halbbildung“ nicht um das Problem der „Allgemeinbildung“, sondern lediglich um die Frage, ob unter den gegebenen gesellschaftlichen Umständen einer verwalteten Welt, eines monopolistischen Kapitalismus, eines exponentiell wachsenden, nur noch fragmentiert wahrnehmbaren Wissenszuwachses und eines zur Industrie verkommenden Kulturbetriebs der altbürgerliche Begriff der „Bildung“ überhaupt noch einen Halt in der Realität haben könne. Adorno selbst verabschiedete mit dem altbürgerlichen, noch autonomen Subjekt zugleich einen normativ gehaltvollen Begriff von „Bildung“ und setzte an dessen Stelle, wo er selbst wähnte, normativ bleiben zu sollen, einen sozialpsychologisch-politischen Begriff von „Mündigkeit“ als der Fähigkeit, weitgehend autonom und selbstreflexiv den Zumutungen eines totalitär werdenden gesellschaftlichen Zusammenhangs widerstehen zu können. Mit dem auch immer inhaltlich bestimmten Begriff einer „Allgemeinbildung“, also einer „allgemeinen Bildung“, die doch wesentliche Wissensbestände sowie Verständnisformen einer bestehenden Gesellschaft umfasst, hat dies nichts mehr zu tun.
Die Systeme höherer Bildung wie weiterführende Schulen oder Universitäten haben sich derzeit einem Wettbewerbsdruck ökonomischer Art ausgesetzt wie nie zuvor. Mit der politisch-rechtlichen Einebnung von Staatsgrenzen wurde das Angebot höherer Bildung von einem staatlichen Auftrag der Daseinsvorsorge und der Humankapitalproduktion zu einem Markt nachfragbarer Dienstleistungen zum individuellen Erwerb wissenschaftlicher Kompetenzen zum Zweck ökonomischer Wertschöpfung im globalen Raum. Dem entspricht die in der Bundesrepublik seit zehn Jahren vollzogene, in allen Bundesländern und von allen Parteien betriebene Umwandlung des Hochschulwesens von einem Sammelsurium körperschaftlicher Institutionen mit mehr oder minder großer Autonomie in managerial geführte Anstalten mit Haushaltshoheit und selbst erstellten, mit Regierungen und Parlamenten abzustimmenden Leistungspaletten. Institutionen höherer Bildung gehören insgesamt in gleichem Maß, in ihrer Feinstruktur jedoch in unterschiedlichem Ausmaß dem Wissenschafts- und dem Bildungssystem an. Während sich das Wissenschaftssystem alleine an der Leitunterscheidung von wahr/unwahr orientiert, folgt das Bildungssystem der Leitunterscheidung von Leistung oder Versagen. Keineswegs jedoch kommt beides zum Schnitt: Auch hochrangige Wissenschaft kann Unwahrheiten und Fehler produzieren, derweil auch misslungene Studienbiografien generalisierbare Einsichten hervorbringen können. Die entstehende Wissensgesellschaft und ihre politischen Exekutoren mahnen derzeit verstärkte Investitionen in jene Bereiche der Wissenschaft an, die aller Wahrscheinlichkeit nach zu profitablen Industrien und Technologien führen werden. Demgegenüber scheint die Frage nach allgemeiner Bildung im Medium der Wissenschaft zu verblassen. Bei alledem wird die Organisationsform angelsächsischer Universitäten als besonders effizient und wirtschaftsfreundlich angesehen und dabei immer stärker, wenn auch halbiert, nachgeahmt. Übersehen wird dabei zum Beispiel, dass im angelsächsischen System mit der dem professionsbezogenen Hauptstudium vorgeordneten Collegestufe ein allgemeinbildendes Element sehr viel stärker institutionalisiert ist, als es in Deutschland mit dem zunehmend an Prestige und Gehalt einbüßenden Abitur noch vorliegt. Es ist kein Zufall, dass gerade in den USA einer „Neohumboldtianisierung“ der Colleges das Wort geredet wird.
Das heißt für das deutsche Bildungswesen: Mit einer sinnvollen, durchgängigen Übernahme von angelsächsisch inspirierten B.A.- und M.A.-Studiengängen müsste die Schulzeit verkürzt und an den Universitäten ein mindestens vier Semester währendes allgemeinbildendes Studium in Richtung auf das B.A. eingerichtet werden, während die Fachhochschulen unter Ausbau der Wissenschaftlichkeit ihrer Fächer fortgeschrittenen, professionsbezogenen Studiengängen zugeschlagen werden. Derzeit, zehn Jahre nach Beginn der sog. „Bolognareformen“ scheint sogar das politische Establishment allmählich einzusehen, dass die Einführung modularisierter, dreijähriger B.A.-Studiengänge noch nicht einmal dem erklärten Ziel, einer akademisch getönten „Beschäftigungsfähigkeit“ (employability) genutzt hatte — weswegen derzeit, im Herbst 2019 allerorts von einer „Reform der Reform“ gesprochen wird. Infrage steht dabei auch, ob und in welchem Maß im Zuge dieser Reform der Reform allgemeinbildende Elemente zumindest in den Grundstudien Eingang finden werden.
Vor diesem Hintergrund erscheint es sinnvoll, einen Blick auf Überlegungen zu werfen, die vor etwa zweihundert Jahren diesem Thema galten. Was hieß überhaupt „Bildung“ und welche Aufgaben wurden ihr zugeschrieben?
Der Begriff der „Bildung“, der in den deutschen Ländern noch im frühen achtzehnten Jahrhundert als „Neuling“ galt, verweist auf biblische Quellen.6 Jener Begriff, der im achtzehnten Jahrhundert in den deutschen Ländern noch neu schien, hatte damals freilich eine schon verdrängte, drei- bis vierhundert Jahre alte Vergangenheit hinter sich. Tatsächlich wurde dieser Begriff erstmals im dreizehnten Jahrhundert, in der deutschsprachigen Mystik, beginnend mit Eckhart, systematisch verwendet. Bei Eckhart und den Mystikern ging es um die Frage, in welchem Sinn Gott, Christus Eingang in die Seele des Menschen findet, ein Vorgang, durch den der Mensch überhaupt erst zum wahren Ebenbild Gottes wird, bzw. ob er überhaupt nicht nur dort zu finden sei. Im Buch Genesis wird ja berichtet, dass der Mensch nach seinem Bilde geschaffen wird (Gen. 1,26). Die Ein-Bildung Gottes in die menschliche Seele vollendet also in jedem einzelnen Menschen den Schöpfungsakt aufs Neue. Der Mensch als imago Gottes wird zu dem, was er ist, nur durch genau diese Imagination.
Diese, der Theologie entsprossenen Begriffe „Geist“ und „Bildung“ haben in der Philosophie des deutschen Idealismus eine systematische Begründung erhalten und stellen heute eine Tradition dar, die zwar noch erinnert, aber nicht mehr wirklich ernst genommen wird – zumal nicht in einer Erziehungswissenschaft, die zunehmend missvergnügt zur Kenntnis nehmen muss, dass es sich zumindest beim Begriff der „Bildung“ um einen Begriff handelt, der als solcher nur im deutschsprachigen Raum bekannt ist, für den es in anderen Sprachen keine angemessene Übersetzung gibt und der – wie das heute heißt – international weder sichtbar noch anschlussfähig ist. Daher ist es unerlässlich, sich einiger Grundannahmen der Bildungstheorie des deutschen Idealismus zu versichern.
2.Hegel
Eine der menschlichen, individuellen wie kollektiven Entwicklung gemäße Theorie der Anerkennung wird sich zu Recht vor allem auf die von Hegel in der „Phänomenologie des Geistes“7 entfaltete Theorie des Kampfes um Anerkennung sowie die von ihr geprägte Theorie der Bildung beziehen.8 Dabei kann sie sich auf Arbeiten stützen, die den „Kampf um Anerkennung“ als Sammelbegriff für eine „moralische Grammatik sozialer Konflikte“ auf der Basis neuerer sozialwissenschaftlicher Überlegungen rekonstruieren.9
Die Frage der Bildung stellt sich bei einem der maßgeblichen Vertreter eines idealistischen Bildungsbegriffs, bei Hegel, dann – analog zum Bildungsbegriff der deutschen Mystik – als die Frage danach, wie sich der an und für sich seiende Geist der Sittlichkeit in den einzelnen Menschen, das einzelne Subjekt ein-bildet. Unter Sittlichkeit, unter dem Selbstbewusstsein des Geistes, versteht der Hegel der „Phänomenologie des Geistes“, das geteilte normative Wissen der Individuen über die Formen ihres Zusammenlebens. Hegel bezeichnet die Form dieses Subjekts in der Phänomenologie als „Individualität“ und widmet ihr in dem Kapitel mit dem rätselhaften Titel „Das geistige Tierreich und der Betrug oder die Sache selbst“ komplexe Analysen. Von besonderem Interesse ist dabei, wie Hegel das Verhältnis von Anlage und Umwelt sieht: Hegel spricht im Falle der einzelnen Individuen von besonderen Fähigkeiten, von „Talent, Charakter usf.“10.
Grundsätzlich unterliegt die von Hegel analysierte „Individualität“ einer zweckgerichteten Struktur und zwar so, dass sie das, was sie sein soll und kann, erst durch ihr Handeln erfahren kann, während ihr Handeln umgekehrt einem vorausgesetzten Zweck unterliegt. Im Ergebnis des Handelns, in dem, was Hegel – womöglich mit einer Metapher aus dem Bereich der Kunst – als „Werk“ bezeichnet, wird die Individualität Wirklichkeit und damit zum Fokus des Interesses anderer Personen; darin, dass die Individualitäten sich angeblich auf die Sache, auf das Werk beziehen und nicht auf ihr je eigenes Interesse, sich zu entäußern und zu objektivieren, wird ein Verhältnis sichtbar, in dem die Individuen ihre Individualität verleugnen, ein Verhältnis, das damit als „Betrug“ gekennzeichnet werden muss. Indes: Die „Phänomenologie des Geistes“ enthält noch keine Auskünfte, wie genau die einzelne Individualität zu jener wird, die sie schließlich ist, nämlich, wie ihre Talente und Anlagen sich mit jenem allgemeinen Interesse zusammenschließen, das dann später zum werkgerichteten Handeln führt.
Dieser Frage widmete sich Hegel erst, als er 1808 Gymnasialprofessor des Nürnberger Ägidiengymnasiums wurde. In den dort zu unterschiedlichen Anlässen gehaltenen, so genannten Gymnasialreden sieht sich der Philosoph, der noch in der „Phänomenologie“ unterstellen musste, dass u.a. in ihm und in seinem Wissen der absolute Geist zu sich selbst gekommen sei, und der mithin aus einer Beobachterperspektive heraus urteilte, nunmehr in eine Teilnehmerposition versetzt; in die Position eines Individuums, das mit seiner Tätigkeit daran mitzuwirken hatte, dass Andere, Jüngere zu ihrer Individualität finden und damit das, was in der „Phänomenologie“ als „Geist“, genauer als „sittliche Wirklichkeit“ bezeichnet wurde, zu erhalten. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass „Bildung“ für Hegel auch immer mehr als nur ein Prozess der intergenerationalen Vermittlung von Wissen und Erfahrungen ist, nämlich jener durch Kampf und Entfremdung gekennzeichnete Prozess, in dem der Weltgeist zu sich selbst kommt.
Gleichwohl: Ohne an dieser Stelle auf die bisher in der historischen Erziehungswissenschaft zu stark vernachlässigte Schultheorie Hegels einzugehen, die nicht nur ein differenziertes Verhältnis von Elternhaus und Schule sowie deren unterschiedlichen Funktionen bietet, sondern auch auf instruktive Weise das Verhältnis von Disziplin und Eigeninitiative so ansetzt, dass „sie wesentlich mehr Unterstützung als Niederdrückung des erwachenden Selbstgefühls, eine Bildung zur Selbständigkeit sein müsse“11, sei im Folgenden der Kern von Hegels Theorie der Bildung von Individuen als Individuen vorgestellt. In der Abschlussrede zum Schuljahr 1811 thematisiert er den schulischen Bildungsprozess als einen dialektischen Prozess zwischen der wirklichen Welt und der Jugend:
„Die wirkliche Welt ist ein festes, in sich zusammenhängendes Ganzes von Gesetzen und das Allgemeine bezweckenden Einrichtungen; die Einzelnen gelten nur, insoweit sie diesem Allgemeinen sich gemäß machen und betragen, und es kümmert sich nicht um ihre besonderen Zwecke, Meinungen und Sinnesarten.“12
Damit ist – zumindest im Grundsatz – das Prinzip einer idealistischen Theorie der Allgemeinbildung benannt, wobei deutlich wird, das alles darauf ankommt, wie das hier beschworene „Allgemeine“ bestimmt ist. Ohne auf Details einzugehen, darf aber gesagt werden, dass Hegels „Allgemeines“ die wirklich gewordene Vernunft ist, nämlich eine sittlich-politische Ordnung, die es effektiv ermöglicht, dass Individuen, die ihren Namen verdienen, unter rechtlichen Bedingungen in Freiheit zusammenleben können. Soziologisch ist damit – wenn man so will – die Intention der etwa von Parsons ausgeführten strukturfunktionalistischen Sozialisationstheorie vorweggenommen: Eine jeweils bestehende normative Ordnung erzeugt sich in gewissen Schwankungsbreiten (abweichendes Verhalten ist in einem gewissen Ausmaß unvermeidlich) genau jene Individuen, die ihre Anforderungen erfüllen. Hegels Betrachtung im Jahre 1811 ist indes durchaus dynamisch, wenn er unmittelbar anschließt:
„In dieses System der Allgemeinheit sind aber zugleich die Neigungen der Persönlichkeit, die Leidenschaften der Einzelheit und das Treiben der materiellen Interessen verflochten; die Welt ist das Schauspiel des Kampfs beider Seiten miteinander. In der Schule“ – so stellt Hegel hoffend fest – „schweigen die Privatinteressen und Leidenschaften der Eigensucht; sie ist ein Kreis von Beschäftigungen, vornehmlich um Vorstellungen und Gedanken …“13,
womit sie auf ein bestimmtes Ergebnis zielt, nämlich:
„Was durch die Schule zustande kommt, die Bildung des Einzelnen, ist die Fähigkeit derselben, dem öffentlichen Leben anzugehören“14; die außer der Schule fallende Anwendung von Wissenschaft und Geschicklichkeit ist ihr wesentlicher Zweck. Vor allem aber sind beide in der Schule als lediglich vermittelnde Funktion nur insofern von Bedeutung als sie, wie Hegel ausdrücklich unterstreicht, „als sie von diesen Kindern erworben werden, die Wissenschaft wird darin nicht fortgebildet, sondern nur das Vorhandene …“15
Schule, das ist für Hegel der prozessierende Ort der Konfrontation des Fertigen mit dem Unfertigen:
„Wenn aber der Inhalt der Sache, der in der Schule gelernt wird, etwas längst Fertiges ist, so sind dagegen die Individuen, die erst dazu gebildet werden, noch nicht etwas Fertiges, es kann diese Vorarbeit, die Bildung, nicht einmal vollendet, nur eine gewisse Stufe erreicht werden.“16
Bildung, zumal die Bildung der Individuen stellt damit nichts anderes dar als jenen durchaus auch konflikthaften Prozess, in dem die einzelnen Individuen es auf das Niveau dessen gebracht haben, was sich als der „Geist“ eines – wie das bei Hegel noch heißt – jeweiligen „Volkes“, in kognitiven Wissensbeständen und einer normativen Ordnung als wirklich manifestiert. Ob und wie die Individuen selbst an deren Veränderung wesentlich beteiligt sind, darüber ist jedenfalls aus den Gymnasialschriften nichts zu erfahren – auch die von Hegel geforderte Erziehung zur Selbständigkeit, die darauf zielt, dass die Jugend „frühe gewöhnt werde, das eigene Gefühl von Schicklichkeit und den eigenen Verstand zu Rate zu ziehen“17 stellt einen Fall von Bildung als Anpassung dar – und zwar einfach deshalb, weil das von Hegel präferierte Staatswesen, nämlich die auf bürgerlichem Eigentum beruhende konstitutionelle Monarchie eigenständig urteilender und handelnder Bürger bedarf. Zum Problem und der Frage, ob und wie ggf. der Bildungsprozess der Individuen seinerseits den jeweils wirklichen Geist formt oder auch verändert, scheint sich – sieht man vom Hegel der Jugendschriften ab – in seinem reifen Werk keine Spur zu finden.
3.Hegelsche Allgemeinbildung
Hegels politische Theorie mit ihrer Präferenz einer konstitutionellen Monarchie und einer beinahe ständisch aufgebauten Gesellschaft, entspricht den tatsächlichen gesellschaftlichen Entwicklungen in keiner Weise – in Frage steht, ob seine Grundintention, dass „allgemeine Bildung“ all das enthalten müsse, was erstens die Individuen zu Individuen bildet und sie damit zweitens dazu in die Lage versetzt, als Individuen an einer politischen Ordnung der Freiheit nicht nur zu partizipieren, sondern sie durch ihr Handeln gleichsam kontinuierlich aufrecht zu erhalten, rekonstruierbar ist. Das ist dann der Fall, wenn man einsieht, dass „Allgemeinbildung“ sich nicht an der Fülle dessen orientieren kann, was derzeit von den Natur- über die Bio- und Neurowissenschaften bis hin zu reflexiven Kultur- und Gesellschaftswissenschaften, von den Künsten ganz zu schweigen, erforscht wurde und gewusst werden kann. „Allgemeinbildung“ erschöpft sich aber auch nicht in dem, was eine managerial orientierte Pädagogik, die sich gerne an der Erwachsenenbildung sowie an Programmen beruflicher Weiterbildung bzw. am Konzept des „lebenslangen Lernens“ orientiert, darunter verstanden wissen will: eher formale Kompetenzen, gelegentlich auch „Schlüsselqualifikationen“ genannt, wie „Lernen des Lernens“, „Teamfähigkeit“ oder „Kompetenzen digitaler Kommunikation“, „Rhetorik“ o.ä. Das heißt: Eine zeitgemäße Allgemeinbildung wird sich auf bestimmte thematische Felder beschränken und zwar auf genau jene, die die Bereiche von Gesellschaft, Geschichte und Politik ausmachen, die es den Individuen also ermöglichen, ein Leben in Freiheit zu führen: Dazu müssen sie
1.wissen, welcher Art die Gesellschaft ist, in der sie leben; welche Optionen und Restriktionen, welche Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten sie enthält, wie sie funktioniert, welchen Gefährdungen sie ausgesetzt ist – national und global. Soweit naturwissenschaftliche Erkenntnisse, etwa ökologischer, genetischer oder informationstechnischer Art für diese Fragen – aber auch nur für diese Fragen – relevant sind, gehören auch sie zur allgemeinen Bildung.
2.Als situierte Individuen in einer situierten Nation, Kultur oder auch konfessionellen Gemeinschaft können sie sich in ihrer Gewordenheit bzw. die Eigenart anderer jedoch auch nur verstehen, wenn sie die Geschichte nicht nur ihres eigenen Gemeinwesens, sondern auch der für ihre Gesellschaft bedeutsamen anderen Gemeinwesen wenigstens ansatzweise kennen und verstanden haben. Historische Kenntnisse vermitteln zudem eine gewisse Einsicht in die Geschichtlichkeit auch von für absolut gehaltenen Wertsetzungen, eine Einsicht, die keineswegs zum Relativismus führt, jedoch vor naivem, unreflektiertem Bejahen der je eigenen Lebensform schützen kann.
3.Wirkliche Freiheit, also individuelle Freiheit, die ihren Namen verdient, aber besteht – zumindest nach Hegel – in einer rechtlich institutionalisierten Demokratie, in der die Individuen ihren Interessen in möglichst moralisch aufgeklärter Weise nachgehen können. Daher gehört zu einer allgemeinen Bildung nicht nur die je altersgerecht präsentierte Kenntnis dessen, was Recht und was eine Demokratie ist, sondern auch das Einüben moralischer Sichtweisen durch moralische Argumentation, wie sie etwa Lawrence Kohlberg18 vorgeschlagen hat, ohne dabei zu verkennen, dass eine nur sprachlich geübte moralische Argumentation ohne die Möglichkeit, im Blick auf zu verantwortende Folgen zu urteilen, lediglich sophistische Wortverdreherei, nicht aber moralische Einsichten fördert. Am Ende eines solchen allgemein bildenden Prozesses sollten bei den Individuen Strukturen und Kompetenzen mindestens einer konventionellen Moral, die das in westlichen Demokratien bestehende Rechts- und Normensystem stützt, verankert sein, wenn nicht sogar Elemente einer postkonventionellen Moral, die jenseits von gesetztem und positiviertem Recht autonome Prinzipien der Moral wie etwa Kants kategorischen Imperativ einsichtig erworben hat.
Die empirische Jugendforschung belehrt uns seit Jahren darüber, dass derzeit nicht nur die Jugend der unteren Schichten, sondern zusehends mehr auch die Jugend der Mittelschichten westlicher Gesellschaften, bedrängt sowohl von sozialen Abstiegsängsten als auch des anfangs genannten, an den Universitäten durchgesetzten Leistungsdrucks, jene Kenntnisse und Kompetenzen, die es zu einem Leben in institutionalisierter Freiheit bedarf, preisgeben. Derzeit zeichnet sich eine neue Unmündigkeit, eine willenlose Bereitschaft, Systemanforderungen zu willfahren, ab; eine Unmündigkeit, die mit dem Begriff des „Autoritarismus“ und des „autoritären Charakters“ falsch charakterisiert wäre. Vielmehr passt auf diese, neuerdings zu beobachtenden Phänomene ein soziologisches Konstrukt, das erstmals in den 1950er Jahren zur Analyse der US-amerikanischen Gesellschaft entwickelt wurde. David Riesmans in seinem Buch „Die einsame Masse“19 entwickelte Begrifflichkeit von „außen“-bzw. „innengeleitetem“ Mensch trifft die Situation genauer und wird nicht zuletzt den Dispositionen im Zeitalter einer radikal veränderten, digitalisierten Öffentlichkeit20 thematisch.
Ein im hegelschen Sinn politisch verstandenes Konzept von Allgemeinbildung könnte dazu beitragen, Individuen dabei zu helfen, Systemimperativen angstfrei und im Wissen um eine vernünftig gestaltete gesellschaftliche Wirklichkeit zu widerstehen. Wo, so werden Sie sich nun fragen, bleibt aber bei alledem der Begriff der Anerkennung? Auf jeden Fall: Für Hegel galt unbedingt: „Der Mensch ist, was er sein soll, nur durch Bildung.“ Im Paragraphen 387 der „Enzyklopädie“ hebt Hegel noch einmal hervor, dass jenes, das den Begriff „Geist“ zu Recht verdient, sich seinem Begriffe nach als „bildend und erziehend“ betrachtet.21
4.Hegel oder Fichte?
Eine bildungstheoretisch informierte Theorie der Anerkennung wird sich daher zu Recht vor allem auf die von Hegel in der „Phänomenologie des Geistes“22 entfaltete Theorie des Kampfes um Anerkennung sowie die von ihr geprägte Theorie der Bildung beziehen.23 Dabei kann sie sich auf Arbeiten stützen, die den „Kampf um Anerkennung“ als Sammelbegriff für eine „moralische Grammatik sozialer Konflikte“ auf der Basis neuerer sozialwissenschaftlicher Überlegungen rekonstruieren.24 Freilich war der Hegel der 1806 erstmals gedruckten „Phänomenologie“ weder der erste noch der einzige seiner Generation, der sich mit der Thematik der Anerkennung auseinandergesetzt hat. Damit komme ich auf das anfangs vorgetragene Zitat zurück, das noch einmal wiederholt sei; indes:
„Nur wolle man ja nicht … glauben, daß der Mensch erst jenes lange und mühsame Raisonnement anzustellen habe, welches wir geführt haben, um sich begreiflich zu machen, daß ein gewisser Körper außer ihm einem Wesen seines Gleichen angehöre. Jene Anerkennung geschieht entweder gar nicht, oder sie wird in einem Augenblicke vollbracht, ohne daß man sich der Gründe bewußt wird. Nur dem Philosophen kommt es zu, Rechenschaft über dieselben abzulegen.“25
Vor Hegel also hat sich bereits Johann Gottlieb Fichte in seiner „Grundlage des Naturrechts nach Principien der Sittenlehre“26 im Jahr 1796 dieser Frage zugewendet.
Fichtes Überlegungen27 sind für eine pädagogische Theorie der Anerkennung und damit einer nur intersubjektiv möglichen Bildung in mehrfacher Hinsicht von Interesse:
1.hat Fichte – klarer als Hegel – seine Anerkennungstheorie unmittelbar auf Intersubjektivität hin angelegt und darauf verzichtet, seine Theorie der Anerkennung – wie Hegel es tat – zugleich religionstheoretisch und gesellschaftsgeschichtlich einzubetten;
2.hat Fichte ein deutliches Bewusstsein davon, dass „Anerkennung“ eine vorreflexive Gegebenheit des sozialen Lebens von Menschen ist, die die Philosophie nur nachzuzeichnen, aber nicht zu begründen hat;
3.sind bei Fichte die vorsprachlich leiblichen Aspekte dessen, was „Anerkennung“ bedeuten kann, deutlicher herausgearbeitet als bei Hegel. Damit legt Fichte einen Ansatz vor, der vertragstheoretischen und dezisionistischen Missverständnissen der Anerkennungstheorie für den Bereich des sozialen Lebens – im Unterschied zur Rechtssphäre – von Anfang an den Weg verstellt.28
4.Fichtes intersubjektivistische Theorie der Freiheit und der Selbstbestimmung ist von Anfang an im weitesten Sinne „pädagogisch“. Menschliche Wesen, die gar nicht anders können, als sich wechselseitig die Fähigkeit zum freien Handeln zuzuschreiben, kommen auch nicht umhin, sich zur freien Selbsttätigkeit aufzufordern:
„Die Aufforderung zur freien Selbstthätigkeit ist das, was man Erziehung nennt. Alle Individuen müssen zu Menschen erzogen werden, außerdem würden sie nicht Menschen.“29
Indem Fichte – deutlicher noch als vor ihm Kant – autonome Subjektivität mit guten Gründen nicht abstrakten Vernunftwesen, sondern den Angehörigen der Gattung Mensch zuschreibt und damit einen normativen Begriff des Menschen postuliert, legt er zugleich eine pädagogische Anthropologie vor, die auf einem vorsprachlichen und leibbezogenen, nicht nur dezisionistischen Anerkennungsbegriff beruht. Dieser leibbezogene Anerkennungsbegriff erheischt einen theoretisch entfalteten Begriff vom „Menschen“, der in den letzten Jahrzehnten aus unterschiedlichen Gründen in den Geistes-, Sozial- und Kulturwissenschaften entweder in die Kritik geriet oder unzeitgemäß erschien. Schließlich erweist sich Fichte als Theoretiker einer Pädagogik der Anerkennung und Freiheit.
Aufklärung ist – so hatte es Immanuel Kant im Jahre 1783, sechs Jahre vor der französischen Revolution definiert – der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Mündigkeit sei indessen die Fähigkeit, sich seines Verstandes ohne Leitung anderer zu bedienen. Die im Jahre 1803 postum herausgegebene Vorlesung über Pädagogik hält zudem – scheinbar widersprüchlich fest – dass der Mensch nur durch Erziehung Mensch werden kann.
„Er ist nichts, als was die Erziehung aus ihm macht. Es ist zu bemerken, daß der Mensch nur durch Menschen erzogen wird, durch Menschen, die ebenfalls erzogen sind.“30
Beide Aussagen zusammengenommen scheinen zunächst widersprüchlich, werden aber miteinander vereinbar, wenn man festsetzt, dass überhaupt nur Menschen mündig oder unmündig sein können, dass aber nicht jedes Exemplar der Gattung Mensch im vollen Sinn bereits Mensch ist. Das Problem der Hörigkeit oder Aufklärung stellt sich als solches überhaupt erst dann, wenn der Mensch zum Menschen erzogen worden ist – womit eine Nachordnung der Aufklärung hinter die Erziehung festgelegt wäre. Ohne Erziehung keine Menschwerdung, ohne Menschwerdung nicht die Fähigkeit und Möglichkeit zum Erringen oder Verfehlen der höchsten menschlichen Fähigkeit, nämlich sich und andere als höchste Zwecke aus Vernunft und Freiheit heraus zu bestimmen. Diese bei Kant nur in der Fluchtlinie seines Denkens liegenden Konsequenzen sind von seinem Verehrer und Schüler Johann Gottlieb Fichte systematisch zu Ende gedacht worden, weswegen Fichte ebenso als Philosoph der Freiheit wie als der Philosoph der Erziehung gelten kann. Dabei erscheint es leichter, festzuhalten, was Erziehung heißen kann denn was „Freiheit“ bedeutet. In der populärwissenschaftlich gehaltenen „Anweisung zum seligen Leben“, die Fichte auch als „Religionslehre“ bezeichnet hat – eine Vorlesung, in der Fichte den Versuch unternimmt, das Verhältnis von individuellem Bewusstsein und dem allgemeinen göttlichen Grund dieses Bewusstseins zu demonstrieren, findet sich folgender Satz:
„So lange das Ich noch durch seine ursprüngliche Selbsttätigkeit an seiner Selbsterschaffung zur vollendeten Form der Realität zu arbeiten hat, bleibet in ihm freilich der Trieb zur Selbsttätigkeit und der unbefriedigte Trieb als der heilsam forttreibende Stachel und das innige Selbstbewußtsein der Freiheit, welches bei dieser Lage der Sachen absolut wahr ist und ohne Täuschung; wie er sich aber vollendet, fällt dieses Bewußtsein, das nun allerdings trügen würde, hinweg. Und ihm fließt von nun an die Realität ruhig ab in der einzig übrig gebliebenen und unaustilgbaren Form der Unendlichkeit.“31
Ohne hier näher auf den systematischen Zusammenhang, in dem dieser Satz steht, einzugehen, enthält er doch gleichsam in nuce die zentralen Begriffe von Fichtes Denken: Ich, ursprüngliche Selbsttätigkeit, Selbsterschaffung, Trieb, Realität, Selbstbewusstsein, Freiheit, Unendlichkeit. Freilich scheint Fichte in dieser Passage auch anzudeuten, dass eine Bornierung auf diese Größen unzureichend ist; dass ein Bewusstsein also, das sich selbst absolutes Ich, das ursprünglich selbsttätig ist und sich als solches selbst erschafft und gleichsam von Natur aus dazu getrieben wird, sich als frei, absolut und eben selbst erschaffen anzusehen, in der Täuschung lebt. So sehr also Fichte der Philosoph der Selbsterschaffung des Bewusstseins, der absoluten Freiheit und Autonomie des Bewusstseins ist, so wenig war er mindestens in seinem späteren Denken der Auffassung, dass das Bewusstsein diesen Glaube an sich selbst und diese Fähigkeit, sich selbst zu erschaffen, sich selbst verdankt. Erst die Einsicht, dass es in und durch diese Tätigkeiten hindurch an einem allgemeinen göttlichen Grund teilhat, wird ihm Beruhigung – ein seliges Leben in der Wahrheit – bescheren. Derlei Begriffe wirken heute – im Zeitalter der Sozialwissenschaften – eigentümlich unzeitgemäß. Wir haben gelernt, dass Bewusstsein und Bewusstseinszustände das Ergebnis von Lern-, Sozialisations- und Bildungsprozessen sind, dass Denken letzten Endes nichts anderes als ein verinnerlichtes, interaktives und kommunikatives Handeln ist, internalisierte Sprache, und dass „Freiheit“ sehr viel mit Spielräumen des Handelns, materiellen Lebensbedingungen und daher auch mit bürgerlicher Ideologie zu tun hat. Indessen: Das, was bei Fichte exotisch und emphatisch klingt, wird in veränderter Sprache, unter anderen theoretischen Vorzeichen und mit anderen praktischen Ambitionen auch heute in den systemtheoretisch inspirierten Sozialwissenschaften vor allem bei Niklas Luhmann unter dem Begriff der „Autopoiese des Bewußtseins“32 ebenfalls verhandelt.
Bildung – das hat bereits Fichte gesehen – ist daher der Prozess der leiblich verankerten Bewusstseine – zu fragen ist am Ende allenfalls nach den Glückspotentialen dieses Prozesses. Während Immanuel Kant darauf beharrte, dass man durch ein konsequent moralisch gelebtes Leben allenfalls „glückwürdig“ sein könnte, jedoch nicht „glückselig“ werden könne33, lesen wir bei Fichte zwar nichts vom Glück, wohl aber vom seligen Leben und zwar in der ersten Vorlesung zum Thema „Die Anweisung zum seligen Leben“:
„Das Leben ist selber die Seligkeit, sagte ich. Anders kann es nicht seyn: denn das Leben ist Liebe, und die ganze Form und Kraft des Lebens besteht in der Liebe und entsteht aus der Liebe. – Ich habe durch das soeben Gesagte einen der tiefsten Sätze der Erkenntniss ausgesprochen; der jedoch, meines Erachtens, jeder nur wahrhaft zusammengefassten und angestrengten Aufmerksamkeit auf der Stelle klar und einleuchtend werden kann. Die Liebe theilet das an sich todte Seyn gleichsam in ein zweimaliges Seyn, dasselbe vor sich selbst hinstellend, – und macht es dadurch zu einem Ich oder Selbst, das sich anschaut, und von sich weiss; in welcher Ichheit die Wurzel alles Lebens ruhet. Wiederum vereiniget und verbindet innigst die Liebe das getheilte Ich, das ohne Liebe nur kalt und ohne alles Interesse sich anschauen würde.“34
Berlin, im Juni 2019
Vorbemerkung
Die vorgelegte Arbeit verknüpft und entfaltet Motive aus mehr als fünfundzwanzig Jahren erziehungswissenschaftlicher Reflexion. Das 1973 in meiner Arbeit Der Symbolische Interaktionismus und seine pädagogische Bedeutung erstmals postulierte, aber nie ausgeführte „biographische Interesse“1 findet hier in Überlegungen zum Verhältnis von Glück und Lebenslauf seine Entfaltung und verbindet sich mit den in den letzten Sätzen meiner (nicht publizierten) Dissertation angeführten Sätzen Kants zum Verhältnis von Gefühl und Tugend.2 Im Vorwort zur 1992 publizierten Advokatorischen Ethik, die wesentlich von einer Rezeption Kohlbergs inspiriert war, wird das Programm einer „Theorie moralischer Gefühle im menschlichen Entwicklungsprozeß“ angekündigt.3 Die 1995 erschienene Studie Gerechtigkeit zwischen den Generationen präludiert schließlich das Thema der Tugend, verblieb aber noch im Programmatischen.4 Den Leserinnen und Lesern wird auffallen, daß bei alledem zwei theoretische Konstanten die Argumentation bestimmen. Die Theorie des symbolischen Interaktionismus, wie sie G. H. Mead entworfen hat, und der genetische Strukturalismus, vor allem Lawrence Kohlbergs, enthalten, das möchte ich zeigen, auch nach mehr als dreißig Jahren erziehungswissenschaftlicher Rezeption ein noch immer unausgeschöpftes Potential – freilich nur dann, wenn man sich nicht auf eine kognitivistische Lektüre beschränkt.
Dieses Buch ist während meines Wechsels von der Universität Heidelberg, an der ich zwanzig Jahre lehrte, an die Frankfurter Universität entstanden. Den Kollegen des Erziehungswissenschaftlichen Seminars der Universität Heidelberg verdankt dies Buch wesentliche Anregungen. Während Jochen Kaltschmid auf die existenzphilosophischen Elemente einer Theorie der Erwachsenenbildung aufmerksam machte, überzeugte mich Felix von Cube bei aller sonstigen Kontroverse von der Unabdingbarkeit einer evolutionsbiologischen Betrachtung von Erziehungsphänomenen. Volker Lenhart hingegen schärfte meinen Blick für die gesellschaftliche Evolution des Erziehungssystems und für die Notwendigkeit einer Pädagogik der Menschenrechte, die er mit aller Konsequenz vorantreibt. Fritz-Ulrich Kolbes Arbeiten zur professionellen Kompetenz von Lehrern schuldet die hier vorgetragene Tugendkonzeption einiges. Meike Baader und Sabine Andresen, Mitarbeiterinnen in Heidelberg, danke ich dafür, mir Werk und Bedeutung Ellen Keys, die dieses Buch wesentlich prägen, vermittelt zu haben.
Besonderer Dank gebührt den langjährigen Mitarbeitern in unserem Heidelberger Forschungsprojekt zur moralischen Entwicklung jugendlicher Strafgefangener, Hansjörg Sutter und Stefan Weyers, sowie Thilo Reinke. Sie haben den pädagogischen Reichtum wie die Problematik des Kohlbergschen Paradigmas theoretisch ausgelotet und empirisch untersucht. Ohne ihre Mitarbeit am Forschungsprojekt hätte ich dies Buch so nicht schreiben können. Marcus Dietenberger danke ich dafür, den Tugenddiskurs aufgenommen und in eine fruchtbare schulpädagogische Fragestellung transformiert zu haben.
Ich widme dieses Buch meiner Frau Renate Nyssen-Brumlik in Theorie und Praxis.
Einleitung: Moralische Gefühle und Die Leichtigkeit des Seins
Die Gedenkstättenpädagogik ist einer jener raren Fälle, der die von der geisteswissenschaftlichen Pädagogik aufgestellte Behauptung bestätigt, daß die Erziehungswissenschaft die nachträgliche Reflexion einer vorgängigen Praxis sei. Ohne daß damit nennenswerte Ansprüche verbunden gewesen wären, hat die gedenkpolitische Konjunktur der achtziger Jahre zur Einrichtung einer Fülle von Bildungs- und Begegnungsstätten sowie von Museen am Ort ehemaliger Konzentrations- und Vernichtungslager, verbrannter Synagogen und mittelalterlicher Ghettos, aber auch von ehemaligen nationalsozialistischen Erziehungsanstalten geführt. Diese meist von den Kommunen, bisweilen von den Ländern, seltener vom Bund getragenen Institutionen entstanden als Ergebnis eines guten und aufgeklärten politischen Willens, ohne daß die Initiatoren in der Regel wußten, was sie wem gegenüber mit derartigen Einrichtungen bezweckten. Die naheliegenden, den theoretischen Überlegungen der sechziger Jahre entstammenden Programme hielten den neuen Herausforderungen nicht mehr stand. Alexander und Margarete Mitscherlichs Buch Die Unfähigkeit zu trauern1, eine Arbeit, die – meist ungelesen – eher zitiert als verarbeitet wurde, ließ sich für die Praxis in Gedenkstätten kaum verwenden. Denn erstens war es gerade die These der Mitscherlichs, daß die unterbliebene Trauer um Hitler die wesentliche Ursache des deutschen Neurotizismus war, zweitens wäre sogar beim Akzeptieren von Trauer als Lernziel die Frage offengeblieben, ob man in einem gehaltvollen Sinn um ferne und fremde Opfer tatsächlich trauern kann. Aber auch der Rückgriff auf Adornos „Erziehung nach Auschwitz“ geriet an seine Grenzen. Adorno konnte nicht wissen, daß eine Pädagogik entstehen würde, der es nicht nur darum ging, die Wiederholung von Auschwitz unmöglich zu machen, sondern vor allem darum, dieses Ziel durch ein Lernen über „Auschwitz“, also durch ein historisches Lernen zu erreichen, das Pogrom, Massaker, Entwürdigung und Ermordung zum sachlichen Gegenstand hatte. Zudem ließ sich mit Adornos auf die Nichtwiederholbarkeit des Verbrechens zielender, sensibilisierender Didaktik eine zentrale Intuition aller Gedenkstätten nicht mehr einholen: das Eingedenken der Opfer, das in Sonntagsreden mit zu Redensarten verkommenden traditionellen Glaubenssätzen wie „Das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung“ beschworen wurde.
Damit schälten sich bald zwei Paradigmen der Gedenkstättenpädagogik heraus: erstens eine Pädagogik der Erschütterung und der historischen Information, die zum Motor einer zukunftsgerichteten Menschenrechtsdidaktik wurde, sowie zweitens eine Pädagogik des Eingedenkens,2 deren Ziel in einer nicht instrumentalisierenden symbolischen Wiedereingemeindung der Ermordeten besteht. Die Gedenkstättenpädagogik3 artikulierte damit alle Spannungen, die das Thema kollektiver Erinnerung in der öffentlichen Debatte und im wissenschaftlichen Diskurs provozierte: Ist eine historische Vergewisserung möglich und nötig, die sich darauf beschränkt, zu sagen, wie es gewesen ist – das wäre Erinnerung –, oder führt eine am Gedanken des Respekts und der Versöhnung mit den Opfern ausgerichtete „Unterweisung ins Eingedenken“ nicht zu grundlegenden Veränderungen im Selbstverständnis jener, die sich historisch betrachtend mit dem mörderischen historischen Geschehen befassen? Der von Walter Benjamin erwogene spekulative Gedanke eines Vermächtnisses der Opfer der Geschichte an die Heutigen war in diesem Zusammenhang im Prinzip der anamnetischen Solidarität auch über seine theologischen Gehalte hinaus4 sozialwissenschaftlich zu entfalten. Auf jeden Fall: Die naturwüchsig entstandene Gedenkstättenpädagogik erzwang eine Klärung von Begriffen wie „Schuld“, „Scham“, „Verantwortung“ und „Respekt“ – allesamt Begriffe, die nicht anders denn als Begriffe für „moralische Gefühle“ zu bezeichnen sind.
In einer anderen, aktuellen sozialpädagogischen Debatte geht es um das Gerechtigkeitsempfinden. Lawrence Kohlbergs in der Tradition der US-amerikanischen Reformpädagogik, der „progressive education“, stehende „Just community“-Programme, in denen eine Steigerung der moralischen Urteilsfähigkeit nicht nur durch eine Erörterung hypothetischer Dilemmata, sondern durch die Auseinandersetzung über reale Regelverletzungen und Regelsetzungsprozesse in demokratisch strukturierten Schulen und Jugendgruppen, aber auch in Gefängnissen erreicht werden sollte, wurden in Deutschland und in den USA unter unterschiedlichen Bedingungen wiederholt.5 Inzwischen ist bekannt, daß sich zentrale Annahmen der letzten Fassung von Kohlbergs Theorie nicht halten ließen. Gertrud Nunner-Winkler hat gezeigt, daß sich die von Kohlberg postulierte präkonventionelle Phase moralischer Urteilsbildung einer nur am Eigennutz orientierten Haltung bei Kindern nicht nachweisen ließ und mithin die unterstellte Präkonventionalität jugendlicher Straftäter nicht als Fixierung, sondern als innertheoretisch schwer erklärbare und eigentlich nicht vorgesehene Regression anzusehen war. Sie fand heraus, daß Kinder und Jugendliche im Prozeß des Heranwachsens über ein deutlich ausgeprägtes moralisches Wissen, aber über ungenügende motivationale Kräfte verfügen, sie mithin eher ein Integrations- denn ein kognitives Defizit aufweisen. Zudem konnten sie zeigen, daß sogar die entwickelte Fähigkeit zu affektiver Wahrnehmung, d. h. ein geschärftes Verständnis für den Schaden, den bestimmte Handlungsweisen anderen Kindern zufügen, gegeben war.6 Wäre es denkbar, daß jugendliche Strafgefangene im Vergleich zu ansonsten identischen, aber nicht inhaftierten Kontrollgruppen sich vor allem durch die mangelnde Integration von vorhandenem Regelwissen und moralischen Gefühlen auszeichneten? Oder war anzunehmen, daß die Ausbildung von Empathie unterentwickelt war?
Das Bild gewinnt an Tiefenschärfe, wenn die Entwicklung moralischer Urteilsfähigkeit mit Robert S. Selman als semantisch eigenständige Ausformung sozio-moralischer Perspektivenübernahme verstanden wird. Moralisches Wissen und moralische Motivation erscheinen jetzt als regelbezogene Verdichtungen mehr oder minder wechselseitiger, mehr oder minder einfühlsamer Beziehungen vor dem Hintergrund bedeutsamer affektiver, intimer Beziehungen zwischen Gleichaltrigen, die ihnen sowohl zu einem reichen Konzept der Person als auch der damit einhergehenden Fähigkeit zur Einfühlung in andere Nächste verhalfen.7 Damit rückte ein in der Nachkriegspädagogik weitgehend vernachlässigtes Thema ins Scheinwerferlicht: die sozialisatorische Funktion von Freundschaften, die von Monika Keller und Wolfgang Edelstein erforscht wurde.8 So ergaben neuere deutsche Forschungen9 im Unterschied zu US-amerikanischen Untersuchungen, daß männliche jugendliche Strafgefangene in aller Regel nicht auf der präkonventionellen Ebene der Urteilsbildung stehen und daß ihre Fähigkeit, Freundschaften zu schließen, ein wichtiger Indikator auch für ein Lernen von einem sehr schwachen zu einem gefestigteren Konventionalismus darstellt. Darüber hinaus zeigte sich, daß die Fähigkeit zur sachlichen Auseinandersetzung über Regeln im gelockerten Vollzug, verbunden mit der Bereitschaft zur realen Übernahme sozialer Verantwortung, die moralische Urteilsfähigkeit wie das tatsächliche ausgeübte Verhalten fördert. Mit diesen Ergebnissen zeichnet sich ein anderer Ausgang der klassisch gewordenen Kohlberg-Gilligan-Debatte ab.10 Während in der ersten Runde Kohlbergs Verteidiger gegen eine mißverständlich rezipierte Carol Gilligan darin recht behielten, daß es keine wesensmäßigen Unterschiede in der Moralentwicklung zwischen Männern und Frauen gibt, die „andere Stimme“ also nicht differentialpsychologisch zu lesen war, konnten sie mit ihrer weitergehenden Behauptung, daß Gilligans an realen Lebensproblemen von Frauen deutlich werdende beziehungsorientierte Moral nicht lediglich eine Anwendungsform von Prinzipien war, nicht überzeugen. Gilligan behielt – so unhaltbar ihre Ergebnisse und Methoden im einzelnen auch waren11 – im grundsätzlichen sowohl mit ihrer Skepsis gegenüber dem Erkenntniswert rein theoretischer Dilemmata als auch mit ihrer Betonung affektiver sozialer Bindungen recht. Mit den durch Forschung und die theoretische Weiterentwicklung des sozialkognitivistischen Paradigmas hervortretenden Elementen emotionaler Motivation, affektiv getönter Beziehungen wie Freundschaften und einer auf Loyalität und Bindung beruhenden Beziehungsmoral ist die Frage nach der Rolle „moralischer Gefühle“ auch in dem ansonsten als ausgesprochen kognitivistisch geltenden genetischen Strukturalismus in den Mittelpunkt gerückt.
Die Theorie der Bildung und Erziehung im Kontext der Einwanderungsgesellschaft Bundesrepublik hat in den letzten fünfundzwanzig Jahren einen tiefgreifenden Wandel von einer defizitorientierten „Ausländerpädagogik“ über eine im wesentlichen an Bildungsinhalten ausgerichteten „multikulturellen Pädagogik“ zu einer vor allem die Konstruktion des Selbstverständnisses von Kindern und Jugendlichen im Immigrationsprozeß thematisierende „interkulturelle“ Pädagogik durchlaufen. Dabei schwankt die interkulturelle Pädagogik der späten achtziger Jahre12 zwischen einer Pädagogik besserer Lebenschancen für alle Kinder im Horizont einer gerechten Republik sowie einer postmodern instrumentierten Ermutigung zur Differenz, die zugleich mit der kritisch-befreienden Dekonstruktion bestehender Selbstverständnisse einhergehen soll. Ein näherer Blick auf vielfältige pädagogisch-politische Konfliktfelder wie den muttersprachlichen Unterricht, die Auflösung eigenständiger Ausländerfachbereiche an kommunalen Volkshochschulen, den Streit um die eventuelle fundamentalistische Orientierung in ihren Lebenschancen eingeschränkter muslimischer Jugendlicher und die nach wie vor überdurchschnittlich hohe Sonderschulüberweisungsrate von Kindern italienischer und türkischer Herkunft zeigt auch ein anderes Bild: Wenn nicht alles täuscht, klagen unterschiedliche Minderheitengruppen mit ihren zum Teil strittigen politischen Vorschlägen wie Quotierungen, Maßnahmen zur Subventionierung ethnischer Zusammenhänge sowie staatsrechtlicher Anerkennung als Minderheiten etwas ein, das sich der einfachen Alternative von Ethnisierung bzw. Selbstethnisierung hier und staatsbürgerlich-demokratischer Assimilation dort entzieht. Dabei geht es um mehr als lediglich darum, in unterschiedlichen Bildungseinrichtungen zu einer wechselseitigen Erweiterung der Kenntnis von Lebensformen für Kinder mit und Kinder ohne deutschen Paß zu gelangen. Im Kern aller vermeintlichen oder wirklichen Wünsche nach ethnischer Segregation oder einer am Vorbild der USA gewonnenen Quotierungsdiskussion geht es um das Einklagen nicht nur besserer sozialer Chancen, sondern auch und vor allem um eine Politik der Achtung,13 mit anderen Worten: um den Kampf für ein Bildungssystem, in dem sich niemand für seine Herkunft schämen muß bzw. in dem alle – trotz unterschiedlicher Herkunft – auf mindestens einige Gehalte der ihnen zugeschriebenen Tradition stolz sein können. Wie das Verhältnis von Repräsentation und Artikulation von Migrantenkulturen im Bildungswesen im einzelnen umgesetzt wird, wird auch in Zukunft Gegenstand politischen Streits sein. Worauf es ankommt, ist die Behauptung, daß die Theorie der interkulturellen Bildung neben ihrem Beharren auf Chancengleichheit, auf Toleranz und Erweiterung von sozialer Wahrnehmungsfähigkeit den Fragen von Selbstachtung, Selbstrespekt und Selbstwert – also wiederum Begriffen, die einer Semantik moralischer Gefühle entspringen – bisher noch nicht genügend Aufmerksamkeit gewidmet hat.14
Trauer, Schande, Scham, Schuld und Verantwortung, Gedenken und Erinnerung waren die zentralen Begriffe der Gedenkstättenpädagogik; Probleme der moralischen Motivation, bedeutsamer affektiver Beziehungen und einer loyalitätsgebundenen Moral die Hauptthemen der Weiterentwicklung des sozialkognitivistischen Paradigmas; Selbstachtung und Selbstrespekt die wichtigsten Bezugspunkte einer interkulturellen Bildung, die die Herstellung materieller Chancengleichheit, eines universalistischen Verfassungspatriotismus15 und einer kulinarischen Erweiterung von Lebenschancen nicht für das Ende der Debatte hält. In allen drei Feldern rückte die Frage nach den „moralischen Gefühlen“ ins Zentrum: bei der Gedenkstättenpädagogik in ihrer begrifflichen und sachlichen Begründung; bei der sozialpädagogischen Moralerziehung als Ausweg aus der Erklärungsschwäche eines reinen Kognitivismus; bei der interkulturellen Bildung als politisch-moralische Hypothese über eine bisher weitgehend übersehene wesentliche Dimension.
Eine auf einer Theorie moralischer Gefühle aufbauende grundbegriffliche und forschungsbezogene Neuorientierung wird die normative Grundlegung der Pädagogik nicht unberührt lassen. In einer Zeit, in der eine blinde und oftmals staatstreue Wertediskussion sowie der anschwellende Ruf nach einer Erneuerung der Erziehung zu politischer Loyalität nach wie vor die öffentliche Debatte bestimmen, kommt es darauf an, jene Charaktereigenschaften intellektueller und eben affektiver Art zu identifizieren, die es Kindern und Heranwachsenden ermöglichen, zu Wertzumutungen aller Art reflektiert Stellung zu beziehen und ein gutes, weil selbstbestimmtes und auf andere bezogenes, ja glückliches Leben zu führen. Ich bezeichne diese Charaktereigenschaften mit einem bewußten Rückgriff auf die antike Bildungstheorie als „Tugenden“. Tugenden lassen sich – unabhängig davon, ob man das klassische Gespann von Gerechtigkeit, Mut, Klugheit, Besonnenheit sowie Glaube, Liebe und Hoffnung oder einen anderen Kanon in Betracht zieht – als das Ensemble jener individuellen Verhaltensdispositionen analysieren, deren Zusammenspiel ein befriedigendes menschliches Leben verheißt.
In der antiken Philosophie bezeichnete der Begriff Tugend (griechisch „Arete“, lateinisch „virtus“) ganz allgemein die spezifische Leistungsfähigkeit oder Tauglichkeit – heute sprechen wir von Funktionalität – von Dingen, Organen, Menschen oder auch Handlungen, von der Tauglichkeit des Leibes, eines Nutztieres, der Dienlichkeit argumentativer Praxis, ja sogar von Diebstählen. Bei Aristoteles erst wird Tugend zum Begriff für eine spezifisch menschliche Eigenschaft, zu einer anthropologischen Kategorie. Vor allem aber stehen die so ausgewiesenen menschlichen Fähigkeiten für ihn immer im Horizont der Frage nach dem Glück.16
Gleichwohl: Wer von Tugenden hört, fühlt sich schnell an „Werte“ erinnert, an moralisierende Zumutungen der Gesellschaft, sich so oder so zu verhalten. Eben darum geht es nicht. Es geht vielmehr um die Frage, über welche Fähigkeiten, heute spricht man von Handlungskompetenzen oder auch von „Schlüsselqualifikationen“, Individuen verfügen müssen, um sich gesellschaftlichen Zumutungen gegenüber behaupten und ein glückliches Leben im Verein mit anderen anstreben zu können. Damit ähnelt die Tugendlehre auf den ersten Blick der in den späten sechziger Jahren entwickelten Konfliktpädagogik sowie der emanzipatorischen Erziehung, die ja vor allem auf die Stärkung individueller Kritikfähigkeit setzten. Auf den zweiten Blick unterscheidet sie sich von beiden erheblich. Sie unter- und überbietet nämlich beide Positionen. Anders als die klassenkampftheoretisch ansetzende Konfliktpädagogik verfügt sie über keine politischen Vorgaben mehr, anders als die emanzipatorische Erziehung aber traut sie sich gleichwohl zu, die Frage nach dem „Wozu“ der Emanzipation zu stellen, ohne sie indes abschließend beantworten zu wollen. Anders auch als die stark von moralischen, christlichen Fragestellungen bestimmten Pädagogiken der achtziger und neunziger Jahre mit ihrem Akzent auf Frieden, Verschonung der Umwelt sowie Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern und Generationen nimmt die Theorie der Tugenden den unvertretbaren Glücksanspruch der Individuen ernst. Sie verhält sich damit zu Forderungen einer universalistischen Moral positiv, aber nicht mehr naiv. Sie weiß, daß auch das allgemeine Wohl nur zu erzielen ist, wenn jenseits aller wertenden Vorgaben Lebensglück und Lebenssinn der einzelnen nicht nur berücksichtigt werden, sondern im Zentrum politischer und pädagogischer Bemühungen stehen. Genauer: Sie weiß, daß umfassende Gerechtigkeit in einer Gesellschaft nur zu erreichen ist, wenn dieses Ziel mit den Wünschen und Ansprüchen der Individuen auf ein erfülltes Leben wenigstens nicht kollidiert und dazu in einem fruchtbaren Spannungsverhältnis steht. Daß keine Politik Glück – sei es individuell oder kollektiv – herstellen kann, ist die leidvolle Lehre aus der Geschichte des Kommunismus im zwanzigsten Jahrhundert. Daß das Streben nach dem Glück jedoch, wenn es der materiellen und gesetzlichen Absicherung ermangelt, schnell in massives Unglück umschlagen kann, das lehren nicht nur bald fünfzehn Jahre Neoliberalismus. Daß eine Gesellschaft, die die Frage nach dem Glück nicht öffentlich stellt und sie ganz und gar im Umkreis des Privaten hält, stagniert, war und ist die Herausforderung, die der Feminismus einer patriarchalisch geprägten Welt nach wie vor stellt.
Niemand hat die inneren Spannungen, die einer materialistischen Tugendlehre innewohnen, genauer gesehen als der heute bisweilen für veraltet gehaltene Bertolt Brecht. Am Ende der Flüchtlingsgespräche läßt er seinen Helden Kalle sagen: „Ich fordere Sie auf, sich zu erheben und mit mir anzustoßen auf den Sozialismus – aber in solch einer Form, daß es hier im Lokal nicht auffällt. Gleichzeitig mache ich Sie darauf aufmerksam, daß für dieses Ziel allerhand nötig sein wird. Nämlich die äußerste Tapferkeit, der tiefste Freiheitsdurst, die größte Selbstlosigkeit und der größte Egoismus.“17
Das Thema der Tugenden, der persönlichen Eigenschaften zumal von Politikern, hat in den letzten Jahren besonders in Deutschland eine überraschende Aktualität gewonnen. Der eine hat kurz nach seinem Amtsantritt sein politisches Amt als Finanzminister fluchtartig aufgegeben, der andere gibt die Rolle des „elder statesman“: Erinnert sich noch jemand an die bittere Auseinandersetzung zwischen Oskar Lafontaine und dem damaligen Kanzler Helmut Schmidt in den frühen achtziger Jahren, als dieser – schon damals besorgt um den „Standort Deutschland“ – Disziplin, Fleiß und Ausdauer forderte? Der Chef der saarländischen SPD hielt dem Kanzler damals vor, lediglich „Sekundärtugenden“ gefordert zu haben, mit denen man ebenso gut ein Konzentrationslager leiten könne. Schmidt, als ehemaliger Wehrmachtsoffizier verständlicherweise tief getroffen, reagierte beleidigt. Dabei hatte Lafontaine, der bei den Jesuiten in die Schule gegangen ist, ganz recht. Die Tradition der abendländischen Tugendlehre bezieht bezüglich der Unterschiede von Primär- und Sekundärtugenden keine andere Position. Unter den „Kardinaltugenden“, so meinte etwa Thomas von Aquin im dreizehnten Jahrhundert, sei die vornehmste die Klugheit, die Gerechtigkeit die zweite, die Tapferkeit die dritte, Zucht und Maß aber die vierte.18 „Klugheit“ bedeutet bei Thomas nicht die Fähigkeit zum vorsichtigen Abwägen, sondern die Fähigkeit zum Erkennen der Wahrheit.
Aber sogar wenn Lafontaine gegen Schmidt recht gehabt hätte – was spricht in einer weitgehend von Traditionsschwund, Pluralismus und Multikulturalismus bestimmten Gesellschaft dafür, den alten abendländischen und zopfig gewordenen Tugenddiskurs wieder aufzunehmen? Sollte Helmut Kohls vor zwanzig Jahren pathetisch verkündete „geistig-moralische Wende“, die glücklicherweise eine Wortblase blieb, vor derlei Begriffen nicht ebenso warnen wie die letztlich konservativen Appelle der Kommunitaristen, die zur Lösung aller Gegenwartsprobleme immer nur das „Ehrenamt“ anzubieten haben?19 Über Tugenden und ihre Theorie zu reden ist schon allein deshalb sinnvoll, weil sie nach Lage der Dinge das einzige Programm darstellen, das eine materialistische Ethik zeitgemäß zu Wort kommen läßt. Man mag zu dem britischen Soziologen Anthony Giddens, der sich zum intellektuellen Sprachrohr des zwar der Labour Party angehörenden, jedoch neoliberal regierenden Premiers Tony Blair gemacht hat, stehen wie man will – wenn er in seinem Buch Jenseits von links und rechts20 gegen den allgemeinen Produktivismus eine „Politik des Glücks“ fordert, nimmt er das zentrale Problem einer Arbeitsgesellschaft ohne Arbeit ins Visier. Das „Glück“ aber, der Wunsch nach einem materiell mehr oder minder sorgenfreien, von sinnvollen Zielen und befriedigenden menschlichen Beziehungen erfüllten Leben ist – jedenfalls der Tradition nach – auf das engste mit den Tugenden verbunden. So sah es Aristoteles, der in der Nikomachischen Ethik notierte: „Es liegt weiterhin auf der Hand, daß wir nach der menschlichen Tugend fragen. Denn wir suchten von vornherein das menschliche Gute und die menschliche Glückseligkeit.“21
Tatsächlich scheinen die Beziehungen zwischen Glück und einem erfüllten, guten Leben22 jedoch komplex, geradezu paradox zu sein: „Das schwerste Gewicht beugt uns nieder, erdrückt uns, preßt uns zu Boden. In der Liebeslyrik aller Zeiten aber sehnt sich die Frau nach der Schwere des menschlichen Körpers. Das schwerste Gewicht ist also gleichzeitig ein Bild intensivster Lebenserfüllung. Je schwerer das Gewicht, desto näher ist unser Leben der Erde. Desto wirklicher und wahrer ist es. Im Gegensatz dazu bewirkt die völlige Abwesenheit von Gewicht, daß der Mensch leichter wird als Luft, daß er emporschwebt und sich von der Erde, vom irdischen Sein entfernt, daß er nur noch zur Hälfte wirklich ist und seine Bewegungen ebenso frei wie bedeutungslos sind.“23
Milan Kunderas Roman Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins erschien 1985 im französischen Exil, vier Jahre vor dem Fall der Berliner Mauer. Mit dem Jahr des Mauerfalls verbindet sich nicht nur die Erinnerung an das Ende des Kalten Krieges und an die Vereinigung der getrennten deutschen Teilstaaten, sondern auch an das unwiderrufliche Ende einer verzerrten, mißbrauchten und falsch verwirklichten Utopie, des Sozialismus. Gleichwohl fällt auf, daß der Niedergang der staatsbürokratischen Diktaturen in Ost- und Mitteleuropa keineswegs überall der Demokratie den Sieg gebracht hat und daß der Kapitalismus, auf sich allein gestellt, nicht so effizient ist, wie es vor dem Hintergrund des Staatssozialismus schien. Seit die alten Gespenster, nämlich massenhafte Arbeitslosigkeit und vermeintlich steigende gesellschaftliche Gewalt, auferstanden sind, scheint auch im siegreichen Westen der Eindruck unüberwindbar, daß die guten Zeiten endgültig vorüber sind. Von den USA bis nach Deutschland wird verkündet, daß die Generation der heute Achtzehn- bis Zwanzigjährigen den durchschnittlichen Lebensstandard ihrer Eltern nicht mehr werde halten können, daß das über Steuern verteilbare Bruttosozialprodukt abnehme, daß angesichts der globalen und nationalen Probleme Maßhalten, Solidarität, Bescheidenheit, Patriotismus und Disziplin auf der Tagesordnung stünden. Der Begriff „Individualismus“, einst hochgeschätzt, wurde wieder zu einem Slogan, der nicht nur positive Assoziationen hervorrief; der Begriff der „Gemeinschaft“, in Deutschland des Mißbrauchs wegen, den die Nationalsozialisten mit ihm getrieben haben, verpönt, gewann über die US-amerikanische Kommunitarismusdebatte neue Dignität, eine einst hedonistische Linke sucht Bindung, Verantwortung, Verbindlichkeiten und Autorität. Ging es einst um die Kritik an einem oft als repressiv empfundenen Moralismus, so beherrschen heute ethische Debatten, religiöse Sehnsüchte und – aller Rede von „Streitkultur“ zum Trotz – neue Formen der Unduldsamkeit das öffentliche Terrain.
Milan Kunderas Roman, der sich mit den politischen und erotischen Schicksalen dissidenter Intellektueller unter der tschechoslowakischen Parteidiktatur auseinandersetzt, spielt in den letzten Jahren des „Realen Sozialismus“, in der Zeit des Spätstalinismus, einer Epoche, die nicht wenige Beobachter mit einem Etikett aus der neueren Geschichte als „Ancien Régime“ bezeichnet haben. Als „Ancien Régime“ gelten in der Historiographie jene Jahrzehnte vor der Französischen Revolution, als sich die bürgerliche Gesellschaft ökonomisch zwar schon durchgesetzt hatte, das politische und kulturelle Leben aber nach wie vor von einem mehr oder minder verantwortungslosen Adel geprägt wurde, der sich objektiv überlebt hatte.
Der französische Staatsmann, Schriftsteller und Diplomat Talleyrand, der 1754 noch unter dem Ancien Régime geboren war und bis 1838, im Zeitalter der Restauration, lebte, begann seine Karriere als kirchlicher Funktionär, um sich dann der siegreichen Revolution zur Verfügung zu stellen und kirchliches Vermögen zu liquidieren. Als Royalist verdächtigt, emigrierte er 1792 in die USA, kehrte 1799 nach Frankreich zurück, um Napoleon als Außenminister zu unterstützen und ihm schließlich, weil er mit dessen Eroberungspolitik nicht einverstanden war, die Gefolgschaft aufzukündigen. Nach Napoleons endgültiger Niederlage vertrat Talleyrand Frankreich auf dem Wiener Kongreß, trat 1815 zurück, um fünfzehn Jahre später die bürgerliche Julirevolution zu unterstützen und als Botschafter in London zu wirken. Von Talleyrand, dem der Verrat – an einzelnen Personen und politischen Regimes – ebenso nahe war wie die Treue zu sich selbst und zu Frankreich, wird ein Ausspruch aus seiner letzten Lebensphase überliefert: Niemand könne die ganze Süße des Lebens erfahren haben, der nicht unter dem Ancien Régime gelebt habe. Daß die Revolutionäre diese Süße ablehnten, sich schon in ihrer äußeren Gestalt ernst und gefaßt gaben, wird an den vielfältigen Porträts deutlich, in denen streng wirkende, schwarz gekleidete Männer auftreten. Auf den klassizistischen, historischen Gemälden etwa Jacques Louis Davids präsentieren sich die Revolutionäre im Gewande altrömischer Senatoren mit strengem Faltenwurf und kühlen Farben. In Talleyrands Aussage über die Süße des Lebens, die sofort Erinnerungen an das Rokoko, an Bilder anmutig tändelnder, leichtsinniger höfischer Gesellschaften, etwa auf den Bildern Watteaus oder in den Opern Rossinis, provoziert, drückt sich in nostalgischer Weise die Erfahrung eines Epochenbruchs aus. Heute wissen wir, daß diese Süße kaum für verarmte und hungernde Bauern, unterdrückte Frauen, bettelarme Tagelöhner oder gepreßte Soldaten, kurz: für die Mehrheit der Bevölkerung galt.
Über Sinn und Unsinn, über den offensichtlich ideologischen Charakter wie kulturgeschichtlichen Erfahrungsgehalt von Talleyrands Aussage soll hier nicht gesprochen werden. Worum es hingegen gehen soll, ist die Frage, ob das Bild, das wir uns im Rückblick – sei es von der Bundesrepublik Deutschland, sei es von der DDR – machen, tatsächlich dem Blick Talleyrands auf das Ancien Régime entspricht, wonach das Leben im „Realen Sozialismus“ in Wirklichkeit – wie Milan Kundera es suggeriert – bei aller Repression leicht, weil verantwortungslos war und dementsprechend das Leben in den westlichen Gesellschaften des Kalten Krieges eine leichtsinnige Existenz unter der Käseglocke sinnlos gewordenen Wohlstandes gewesen ist. Eine reumütige Linke, die angesichts rechter Jugendgewalt die Rückkehr zu konservativen Tugenden in Politik, Erziehung und Gesellschaft fordert, unterstützt diesen Eindruck: „Es ist leider so“, so schon vor Jahren ein reumütiger Altachtundsechziger, „daß die ‚Rechten‘ näher an der neuen Realität sich bewegen. Die alten Themen des konservativen Weltbildes – Leistung, Werte, Verantwortung, Autorität, Orientierung – haben eine neue Aktualität. Es ist mithin überaus leicht und verführerisch, die gesellschaftlichen Veränderungen, die den konservativen Wertekanon plausibel machen, darum als einen allgemeinen Rechtsruck wahrzunehmen. Es ist paradox: Die linken Bedrohungsbilder von der rechten Übermacht sind zum ersten Mal realistisch, nicht weil die Rechte stark ist, sondern die Linke gegenüber der Realität schwach. Der konservative Wertekanon ist nicht zufällig näher an der Aktualität. Denn er entspringt einer pessimistischen Anthropologie und der Bewahrung des historisch älteren Wissens von dem barbarischen Kern der Zivilisation.“24