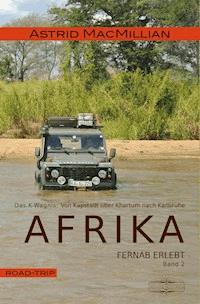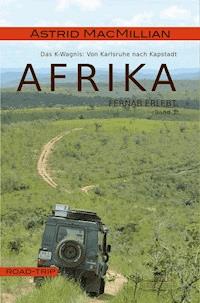
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Der Kleine Buch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Afrika fernab erlebt
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Das K-Wagnis: Von Karlsruhe nach Kapstadt Astrid MacMillian und ihr Ehemann Loyal verwirklichen ihren Traum: Sie reisen ein Jahr lang durch Afrika. Die sprachbegabte Gymnasiallehrerin und der sportbegeisterte Ingenieur kappen ihren komfortablen Alltag um Karlsruhe und fahren im August 2012 los: In ihrer Stella, einem eigens umgebauten Land Rover, geht es – immer der Küste entlang – durch 25 afrikanische Länder. In ihrem persönlichen Reisebericht lässt uns Astrid MacMillian teilhaben an ihrer Leidenschaft für diesen Kontinent, ihren Reisevorbereitungen, ihren Begegnungen, Freuden und Nöten während dieses turbulenten Jahres auf Rädern. Gleich zu Beginn ihrer Reise trifft das Paar auf herzliche marokkanische Gastfreundschaft. Später, in einem kleinen Ort an der Küste von Guinea-Bissau, verbringen sie auf dem Hof von Souleymane und seiner Familie das traditionelle Tabaskifest. Dort kommen sie nicht nur unter, sondern auch auf den Hund – Paule reist von da an mit. Aber es ist bei Weitem nicht alles rosa: Das langwierige Beschaffen von Visa, die zeitintensiven Grenzübergänge und die vielen Straßensperren strapazieren ihr Nervenkostüm ebenso wie so manche kulturelle Eigenheit der Bevölkerung, Sprachbarrieren und schlechte Straßenverhältnisse – nicht selten geht es über Steinbrocken nur im Schritttempo voran. AFRIKA. FERNAB ERLEBT ist ein persönlicher Bericht über einen spannenden, emotionalen sowie informativen Road-Trip, in dem man schmökern und kann und zugleich allerlei Verschiedenes über Afrika, die vielen Länder des Kontinents und seine Bewohner erfährt. Die vielen Fotos geben dazu einen visuellen Eindruck. Man staunt, lacht, kann es kaum glauben, fühlt mit. Hautnah erlebt man, wie vielfältig die Welt, ihre Landschaften, Menschen und Kulturen sind.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 440
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
FERNAB ERLEBT
Das K-Wagnis:
Von Karlsruhe nach Kapstadt
Band 1
Road-Trip
Impressum
Alle Informationen und Angaben dieses Werkes wurden von der Autorin sorgfältig recherchiert und vom Verlag gewissenhaft geprüft. Dennoch können sachliche und inhaltliche Fehler nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben erfolgen deshalb ohne Gewähr. Weder Verlag noch Autorin haften für inhaltliche und sachliche Richtigkeit. Die im Buch wiedergegebenen Aussagen spiegeln die Meinung der Autorin wider und müssen nicht zwingend mit den Ansichten des Verlags übereinstimmen.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter www.dnb.de abrufbar.
© 2016 Der Kleine Buch Verlag, Karlsruhe
Projektmanagement & Lektorat: Tatjana Weiß
Korrektorat, Karten, Satz & Layout: Beatrice Hildebrand
E-Book Konvertierung und Formatierung: Angela Hahn
Kartengrundlage: © Central Intelligence Agency; www.cia.gov
Umschlaggestaltung: Sonia Lauinger
Umschlagabbildung: Astrid MacMillian
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes (auch Fotokopien, Mikroverfilmung und Übersetzung) ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt auch ausdrücklich für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen jeder Art und von jedem Betreiber.
E-Book ISBN: 978-3-7650-1303-4
Dieses Buch ist auch als Printausgabe erschienen:
ISBN: 978-3-7650-8903-9
www.derkleinebuchverlag.de
www.facebook.com/DerKleineBuchVerlag
Für Loyal
Überblick über beide Bände
Band 1
Afrika fernab erlebt
Das K-Wagnis: Von Karlsruhe nach Kapstadt
Wie alles begann
Europa
Nordwestafrika
Westafrika
Zentralafrika
Südliches Afrika
Die westafrikanische Küste – eine Bilanz
Ostafrika, wir kommen!
BAND 2
Afrika fernab erlebt
Das K-Wagnis: Von Kapstadt über Khartum nach Karlsruhe
Was bisher geschah
Ostafrika
Nordostafrika
Afrika – eine Bilanz
Europa
Rückblick und Ausblick
Ich glaubte, es wäre ein Abenteuer,
aber in Wirklichkeit war es das Leben.
Joseph Conrad
Wie alles begann
Wieso Afrika?
Afrika – wieso gerade dieser Kontinent? Eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird. Ja, warum gerade Afrika? Woher kommt diese Sehnsucht, diese Träume und das Gefühl, unbedingt diesen Kontinent, seine Natur, seine Bewohner und ihre Mentalität kennenlernen zu müssen? Wieso zieht es mich immer wieder auf diesen Kontinent?
Ganz genau kann ich mir meine Liebe zu Afrika noch heute nicht erklären. Ein Jahr mit dem Land Rover um den afrikanischen Kontinent herumzufahren, das ist lange mein Traum gewesen, den ich jetzt endlich verwirklichen werde. Für viele meiner Freunde und Verwandte hören sich meine Reisepläne »einfach nur verrückt« an. Die Familie meines US-amerikanischen Mannes Loyal und seine Freunde sind überzeugt, dass sie uns nie wiedersehen werden. Zu groß ist ihre eigene Angst vor dem großen Unbekannten, haben die Medien Afrika in den letzten Jahren ja nicht allzu rosig dargestellt. Bei mir haben sich inzwischen schon alle daran gewöhnen können, dass ich ständig in Afrika unterwegs bin. Denn eigentlich begann alles schon vor 15 Jahren ...
Ich war damals siebzehn, verliebt und träumte von allem Möglichen. Wenn ich erst einmal erwachsen wäre, würde ich so vieles machen – ich träumte vom Reisen, unabhängig und selbständig wollte ich sein und sah in nichts und niemandem Grenzen – wenn ich erst einmal erwachsen wäre ... Das war ich aber noch nicht: Wie viele andere in meinem Alter ging ich zur Schule, lebte noch bei meinen Eltern, und meine größte Freiheit sah ich bis dahin darin, an den Wochenenden zu meinem Freund zu fahren, der sechzig Kilometer entfernt wohnte. Ich erinnere mich noch sehr genau an dieses Wochenende, als ich ihn besuchte und irgendwie alles seinen Lauf nahm.
Ich hatte eigentlich gar keine so große Lust, zu ihm zu fahren, war von einer Freundin auf eine Party eingeladen worden, auf die ich ihn auch gerne mitgenommen hätte. Er hatte aber schon Karten für einen Diavortrag namens Mit dem Fahrrad durch Afrika gekauft. Ich war wirklich nicht besonders erpicht auf den Vortrag. Vortrag hörte sich für mich irgendwie langweilig an und außerdem ging für den Eintritt ein Drittel meines damaligen Monatstaschengeldes drauf.
Schlecht gelaunt machte ich mich auf den Weg und war geschockt angesichts des vor allem älteren Publikums. Auf der großen Leinwand begannen Geschichten lebendig zu werden. Die Farben und die Natur Afrikas zogen alle in ihren Bann. Auch ich konnte mich der Faszination nicht mehr erwehren, tauchte ein in die fremdartigen Bilder, ließ mich von der Musik und den Eindrücken mitreißen.
So etwas hatte ich noch nie zuvor gesehen, noch geahnt, dass es so etwas gab. Ich saß, staunte und fühlte immer mehr eine Sehnsucht in mir aufsteigen, die sich tief in meinem Inneren einnistete. Das war Afrika – der große Kontinent, von dem ich bereits gehört hatte, mir aber bis auf schwarze Menschen nicht viel darunter hatte vorstellen können.
Dieser Vortrag hinterließ einen tiefen Eindruck bei mir. Als er zu Ende ging, war ich wie betäubt, verließ den Saal, blieb jedoch in meiner Traumwelt. Ich sah immer noch die Farben vor mir, hörte die Musik und spürte wieder diese Sehnsucht, die sich in mir breit gemacht hatte. Das Erste, was ich nach diesem Erlebnis sprach, war: »Sobald ich kann, reise ich nach Afrika. So etwas wie die beiden Reisenden möchte ich auch erleben!« Mein Freund freute sich sehr, dass es mir so gut gefallen hatte und den ganzen Abend sprachen wir über nichts anderes mehr.
Der Wunsch, Afrika mit eigenen Augen zu sehen und zu entdecken, ließ mich nicht mehr los. Was manche meiner Freunde und meine Eltern als Jugendschwärmerei abgetan hatten, blieb. Wo immer ich das Wort Afrika las, war mein Interesse geweckt. Ich las sämtliche Bücher, die ich in der Bücherei fand, ging zu weiteren Reise- und Diavorträgen. Mein Abitur rückte näher und in mir entstand die Idee, danach, vor Beginn des Studiums, nach Afrika zu reisen. Ich ließ mir viele Prospekte schicken, ging in Reisebüros und informierte mich, wo ich nur konnte. Die Recherche war sehr aufwendig und schwierig, da das Internet zu dieser Zeit in Deutschland nur wenig verbreitet war. Doch schon bald landete ich wieder auf dem Boden der Tatsachen: Eine Afrikareise kostete Geld, viel Geld, und ich als arme Gymnasiastin hatte keines. Da konnte ich suchen, soviel ich wollte – Impfungen, Flüge, Workcamps ... Alles kostete viel, viel Geld.
Vorerst war der Traum ausgeträumt. Das würde wohl nichts mit meinem Afrikatrip nach dem Abi werden.
Erste Reisen
Doch ich gab nicht auf: Nach meinem ersten Studienjahr hatte ich genug Geld zusammen und flog mit einer Gruppe nach Ghana, um dort an einem Workcamp teilzunehmen. Es war ein Gefühl des Nach-Hause-Kommens, als ich in Accra aus dem Flugzeug stieg. Ein Gefühl, das auf allen weiteren Reisen wiederkehrte.
Jedesmal, wenn ich aus dem Flugzeug stieg, fühlte ich eine unglaubliche Ruhe in mir aufsteigen. Obwohl an den afrikanischen Flughäfen meist Chaos herrscht, war ich nicht gestresst und hatte das Gefühl, am richtigen Ort zu sein. Die Hitze, die die verstaubte Luft über dem Boden flimmern ließ, die bunten Farben der afrikanischen Gewänder, die ungewohnten Gerüche, das Lächeln der Menschen – all das war für mich Leben. Ganz im Gegensatz zum Alltag in Deutschland, der mir im Vergleich trist und grau erschien, mit ungemütlichem Wetter, einheitlich gekleideten und unzufrieden dreinblickenden Menschen. Es war beim Aussteigen jedesmal so, als wäre ich am Ort meiner Sehnsucht angekommen.
Es folgten viele weitere Reisen: Ich bereiste Ghana, Togo, Benin und Burkina Faso. Ich lebte zusammen mit meinem einheimischen Freund in Lehmhütten im Niger und reiste danach mit ihm weiter über Burkina Faso bis nach Mali. Afrikanische Kultur hautnah, das hatte ich nun fast jedes Jahr. Ich vermied Übernachtungen im Hotel und suchte immer den nahen Kontakt zu den Menschen. Teilweise lebte ich wochenlang ohne Toilettenpapier und ernährte mich täglich fast ausschließlich von Reis. Ich vermied regelrecht touristische Attraktionen. Mir stand nicht der Sinn nach einer Safarireise, sondern nach »echtem« afrikanischen Leben, wenngleich das manchmal einfach hieß, viel Zeit zu vergammeln.
Doch so romantisch wie meine Reisen jedes Mal begannen, so desillusioniert kehrte ich auch wieder nach Deutschland zurück. Afrika war nicht nur der Ort, an dem ich mich entspannen, lächeln, tanzen und Spaß haben konnte. Afrika war vor allem anstrengend. Es war eben dieser »echte« afrikanische Alltag, der meine Toleranz immer wieder auf eine harte Probe stellte. Die hierarchischen Strukturen wiesen mir einen Platz unterhalb dem der Männer zu, an den ich mich nur schwer gewöhnen konnte. Das viele Herumhängen empfand ich immer wieder als eine Zumutung und Zeitverschwendung. Ich konnte nicht einfach zur »Afrikanerin« werden, so sehr ich mir auch wünschte, ein Teil der Kultur und der dort lebenden Menschen zu sein. Zudem erwischten mich immer wieder heftige Infektionen, ich war tagelang krank, musste auch noch nach der Reise viele Untersuchungen und Medikamentenbehandlungen über mich ergehen lassen. Mit der Zeit war mein Körper von den Afrikaaufenthalten regelrecht erschöpft. Während meiner Zeit im Niger zog ich mir auch noch eine Salmonellenvergiftung mit gleichzeitigem Parasitenbefall zu und lag schließlich mit über 40 Grad Fieber vor einer Hütte bei 50 Grad im Staub. Mein Freund betete für eine Wunderheilung. Die Tatsache, dass der einzige Arzt weit und breit, zu dem ich im Delirium gebracht wurde, sich weigerte, auch nur einen Blick auf mich zu werfen, weil ich eine Frau war, ließ mich völlig verzweifeln.
Glücklicherweise brachte mich mein Freund trotz meines Zustands nach Burkina Faso, wo eine Ärztin mich untersuchte und mir die richtige Medizin verschrieb. Ich überlebte, allerdings war meine Afrikabegeisterung vorerst gebrochen. Dachte ich jedenfalls. Ich reiste im nächsten Jahr nach Asien, begann aber schon auf dem Hinflug zu weinen, weil ich mich nicht in einem Flieger in Richtung Afrika befand. So schön die von mir in Asien bereisten Länder auch waren, es war eben nicht Afrika und ich war unzufrieden.
Nach meiner Rückkehr buchte ich bald einen neuen Flug, diesmal allerdings nach Tansania in Ostafrika. Mit Westafrika hatte ich innerlich abgeschlossen, nun hoffte ich, mein »erträumtes« Afrika im Osten des Kontinents zu finden. Ich hoffte auf eine Welt, von der ich ein Teil sein konnte. Eine Welt, in der ich mich nicht nur unterordnen und gegen Krankheiten kämpfen musste. Ich wollte nicht nur das Gefühl haben, angekommen zu sein, sondern auch dortbleiben zu können. Ich hoffte darauf, die Kultur der dort lebenden Menschen nicht nur zu sehen und daran teilzunehmen, sondern sie auch zu verstehen. Letzteres war mir während all der Reisen nach Westafrika weitgehend verwehrt geblieben.
Ostafrika empfand ich völlig anders als das, was ich in den westafrikanischen Ländern erlebt hatte. Tansania war sehr weit entwickelt, man konnte vieles kaufen, von dem man in Westafrika nur träumen konnte. Das Essen war sehr gut, ich wurde nicht krank. Ich hatte nicht einmal Durchfall. Im Gegensatz zu meinen früheren Reisen plante ich diesmal eine touristische Safari in die Serengeti und wollte danach um den Viktoriasee herumreisen. Vor Ort änderten sich allerdings meine Pläne, weil ich merkte, dass diese Art zu reisen und touristisch unterwegs zu sein einfach nicht zu mir passte. Schnell lernte ich in Tansania viele tolle Menschen kennen, sodass ich schließlich lieber bei ihnen bleiben, als unterwegs sein wollte. Da ich allerdings schon von Deutschland aus eine Safari in die Serengeti und den Ngorongoro-Krater gebucht hatte, war ich vier Tage in diesen Nationalparks unterwegs. Ich sah viele wilde Tiere in freier Wildbahn und war beeindruckt. Allerdings vermisste ich schon jetzt meine neu gewonnenen Freunde in Arusha und zu allem Überfluss wurde ich wieder krank. Merkwürdigerweise verschwand meine Krankheit auf rätselhafte Weise, als unser Safarifahrzeug die Stadt erreichte. Mir wurde bewusst, dass nicht diese Safari der Grund war, warum ich nach Afrika gekommen war. Mir ging es nicht um die Naturerlebnisse und die Tiere, ich wollte Menschen kennenlernen, Menschen in ihrem Alltag, bei ihnen leben, von ihnen lernen und so einmal im Jahr ein ganz anderes Leben führen. Das holte mich aus meinem Alltag heraus. Das Nichtstun stellte einen Gegenpol zu dem dar, was ich hier in Deutschland mit dem Wort Stress verband.
In den folgenden Sommern flog ich nun immer wieder nach Ostafrika. Als Lehrerin übertrug ich meine Begeisterung für den afrikanischen Kontinent auch auf einige meiner Schülerinnen: Ich gründete eine Eine-Welt-AG an meiner Schule und reiste schließlich mit Schülerinnen, einem Kollegen und einem Vater nach Kenia und Tansania. Für mich eine völlig neue Erfahrung, die ich gerne wiederholen würde.
Meine Erlebnisse in afrikanischen Ländern waren insgesamt sehr unterschiedlich: Auf der einen Seite liebte ich den Kontinent und die Menschen, auf der anderen Seite litt ich unter den fremden kulturellen Regeln und Verhaltensweisen. Trotzdem festigte sich in mir immer mehr der Wunsch, eines Tages dort zu leben. Wo, da war ich mir unsicher. Deshalb wollte ich möglichst viele Länder kennenlernen, um mich danach zu entscheiden.
Am Anfang war der Jeep
Meine Faszination für Geländewagen jeglicher Art hat mit meinen Fahrschulstunden begonnen. Ich träumte nicht von einem schicken, schnellen Wagen, sondern von einem robusten Jeep. Eine meiner ersten Fahrten nach dem Führerscheinerwerb war mit einem offenen Jeep: Ich liebte es. Da ich mir nicht vorstellen konnte, hier in Deutschland in einer Stadt mit dem Geländewagen zu fahren, festigte sich die Idee, einen Land Rover zu kaufen, um damit den afrikanischen Kontinent zu umrunden. Ein großes Projekt, das lange geplant sein muss und während meiner Studienzeit immer wieder an mangelnden finanziellen Ressourcen scheiterte.
Ich zog nach dem Studium schließlich für ein Jahr nach Mexiko, um dort mein im Studium erlerntes Spanisch zu perfektionieren, absolvierte danach in Deutschland mein zweijähriges Referendariat und beantragte noch im ersten Jahr meiner festen Stelle ein Sabbatjahr.
Da ich unabhängig von anderen Mitreisenden sein und mein Unternehmen nicht von der Laune anderer abhängig machen wollte – ich hatte schon zu oft erlebt, dass viele gerne mitplanen, kurz vor Abfahrt allerdings kalte Füße bekommen –, bewarb ich mich für ein Praktikum als Mechanikerin bei einer Land Rover-Werkstatt in Karlsruhe – und wurde genommen. Ich hoffte, bei diesem Praktikum zumindest Grundkenntnisse für die Reparatur eines Land Rovers zu erwerben, damit ich in Afrika nicht völlig hilflos neben meinem liegengebliebenen Gefährt stehen würde und auf die Hilfe von Passanten angewiesen wäre.
Die Männer in der Werkstatt hatten mit mir viel zu lachen, kannte ich mich doch bisher noch gar nicht mit Autos aus, war zierlich und hatte schon mit dem Winterreifenwechsel meine Mühe. Aber ich hielt durch und hatte das Gefühl, mir den Respekt der Mechaniker verdient zu haben. Während der Praktikumszeit lernte ich meinen jetzigen Mann, Loyal, kennen, der beeindruckt war, dass ich nicht nur solch ein Praktikum, sondern auch eine Jahresreise um den afrikanischen Kontinent alleine durchziehen wollte. Zuerst war er skeptisch, nach einer gemeinsamen Ostafrikareise aber auch Feuer und Flamme und von da an planten wir die große Reise zusammen.
Reisevorbereitungen
Stella, unser Land Rover, war der erste Wagen, den wir uns anschauten und der uns gleich begeisterte. Während Loyal sich um den Umbau kümmerte, versuchte ich, möglichst viele Informationen zur Visumbeschaffung und zur politischen Lage in den einzelnen Ländern zu bekommen. Das war gar nicht so einfach, da sich beides in vielen Ländern teilweise täglich ändert. So fand ich ständig neue Angaben über Visagebühren und -voraussetzungen. In vielen Ländern schwelten Unruhen, die plötzlich aufbrachen und ein Weiterreisen hätten schwierig machen können. Für unsere Reisezeit waren viele Wahlen angekündigt, die die politische Situation in einem Land von einem Tag auf den anderen verändern konnten. Ich nahm Kontakt zu anderen Reisenden auf, um aus ihren aktuellen Erfahrungen Sicherheitsvorkehrungen abzuleiten, was auch nicht immer gelang.
Gleichzeitig bereiteten wir die Reise gesundheitlich vor, gingen mehrmals zum Tropenarzt und ließen uns impfen. Das nahm sehr viel Zeit in Anspruch.
Da wir nicht sicher waren, wann und ob wir nach der Reise sofort wieder nach Deutschland zurückkehren würden, gaben wir unsere Wohnung auf, was bedeutete, dass wir alles, was uns noch blieb, in einer Lagerbox unterbringen mussten.
Außerdem galt es, uns von unseren Freunden zu verabschieden und in vielen Gesprächen ihre Ängste auf ein Minimum zu reduzieren. Immer wieder hörten wir: »Das ist verrückt! Wie wollt ihr das machen? Habt ihr keine Angst? Das ist doch gefährlich!«
Angst hatten wir tatsächlich keine, da das Risiko in unseren Augen kalkulierbar war, sofern man einige Sicherheitsmaßnahmen traf und sich vor Ort nicht leichtsinnig verhielt.
Da ich während meiner Afrikreise mit meinen Schülerinnen in der BNN (Badische Neueste Nachrichten) einige Artikel veröffentlicht hatte, nahm ich Kontakt zu den Redakteuren auf und wir verabredeten, dass ich über meine Tour um den afrikanischen Kontinent berichten sollte. Wir besprachen, dass alle ein bis zwei Wochen ein Artikel und Fotos gedruckt werden sollte. Zu diesem Zeitpunkt war mir noch nicht klar, dass uns das Schreiben und Versenden der Texte und Bilder manchmal regelrecht in Stress versetzen würde, da wir durch viele Gebiete fahren würden, in denen es weder Strom noch Internet geben würde.
Die Vorbereitung der Reise zog sich in die Länge: Wir verbrauchten drei Wochen unserer Schon-Urlaub-Zeit, um die Wohnung auszuräumen und uns in Deutschland weitestgehend abzumelden. Wir hatten nie geglaubt, dass es so schwierig werden würde, unser deutsches System ganz zu verlassen: Nicht nur die Post musste geregelt werden, auch Telekom und Handyanbieter stellten Anforderungen, ganz zu schweigen von der GEZ. Außerdem wollten wir einen guten Krankenversicherungsschutz für unsere Reise.
Als wir Karlsruhe am 21. August 2012 gegen 18 Uhr schließlich verließen, waren wir völlig fertig und brauchten eigentlich Urlaub.
Europa
Supermärkte und Tankstellen in Frankreich: Fehlanzeige!
Nachdem wir die erste Nacht bei Freunden in Straßburg genächtigt haben, geht es los, mitten durchs französische Land. Wir wollen die Autobahnen meiden, weil wir so mehr vom Land zu sehen bekommen. Wir sehen viel, fahren auf Straßen in top Zustand durch wunderschöne Landschaften. Als der Premierminister im Radio zitiert wird, dass er sich unbedingt um die »verlassenen Regionen«, die sich im Stich gelassen fühlen, kümmern wolle, wissen wir, wovon er spricht. Als wir durch die Ardenne, Franche-Comté, die Bourgogne und das nördliche Auvergne fahren, ist kilometerweit kaum ein offenes Geschäft zu finden. Die Dörfer scheinen verlassen, die Geschäfte sind verschlossen oder stehen zum Verkauf.
An einem der ersten Tage passiert es uns, dass wir mehrere Stunden keinen einzigen Supermarkt finden und erst in Dijon 15 Minuten vor Kassenschluss fündig werden. Ähnlich ergeht es uns mit den Tankstellen: Als wir in Dijon ankommen, ist unser neu eingebauter Reservetank von 106 Litern fast leer. Eigentlich haben wir den Doppeltank, weil wir in Afrika mit langen, tankstellenlosen Strecken rechnen. Nun bekommen wir schon hier in Frankreich Probleme – wer hätte das gedacht? Heute haben wir schon wieder seit Mittag keine Tankstelle und keinen Supermarkt mehr gesehen. Wir fragen uns, wo wohl die Einheimischen ihr Essen und ihr Benzin herbekommen.
Es stellt sich außerdem heraus, dass wir bei der Kartenwahl für Europa nicht genügend bedacht haben, dass wir nicht über Autobahnen fahren wollen. Viele der Landstraßen, die wir nehmen, sind auf der Karte nicht verzeichnet. Meine Sprachkenntnisse helfen mir weiter. Immer wieder fragen wir Einheimische nach dem Weg. »Ihr fahrt ohne GPS? Und das durch Frankreich? Ohlala …«, zeigt sich eine Einheimische sehr verwundert. Tatsächlich fällt es uns viel schwerer, von der bekannten Navistimme Abstand zu nehmen und selbst den Weg auf einer Karte zu suchen, als zuvor gedacht. Gut, dass wir für die afrikanischen Länder genauere Karten mit im Gepäck haben.
Apropos Sprachkenntnisse: Im »Innern« Frankreichs hat man ohne Französischkenntnisse meiner Meinung nach kaum eine Chance. Nachdem ich Loyal dreimal darauf hingewiesen habe, dass das Schild am Straßenrand einen Bauernhof ausweist, der frischen Käse verkauft und er trotzdem wieder daran vorbeifährt, verlange ich eine Erklärung. »Aber die haben doch alle geschlossen!«
Wie kommt er denn darauf? »Da steht doch ferme und das heißt doch geschlossen, oder?«, zeigt er sich stolz auf seine »soliden« Kenntnisse der französischen Sprache.
»Nein, da steht nicht fermé, sondern ferme, und das heißt Bauernhof.« Mein Lehrerinnenherz kommt mal wieder zum Vorschein.
Wir kommen durch Orte, die ich aus meinem eigenen Französischunterricht noch kenne: Ax-les-Thermes – den Ort mit dem komischen Namen gibt es wirklich! »Ich dachte, das wäre eine Erfindung in unserem Lehrbuch gewesen. Soweit ich mich erinnere, kann man hier Skifahren. Die Geschichte handelte von einem Mädchen, das sich verirrt, weil es plötzlich neblig war«, erzähle ich, als uns der Nebel und ein schwacher Nieselregen auch schon einhüllen und wir beschließen, einen Schlafplatz für die Nacht zu suchen. In dieser Nacht in den Bergen wird es ungemütlich kalt.
Es ist nicht unsere erste ungemütliche Nacht: Schon in der zweiten Nacht unserer Reise erleben wir nach tropischen Temperaturen am Tag ein Unwetter, das im Landy noch bedrohlicher wirkt, als es sowieso schon ist. Anderthalb Zentimeter große Hagelkörner fallen vom Himmel, gefolgt von mehreren Gewittern, die sich alle gleichzeitig genau über uns zu entladen scheinen. So liege ich lange wach mit der Angst, dass die Hagelkörner unser Dachfenster zerstören und mir direkt aufs Gesicht fallen könnten, und Loyal befürchtet einen Tornado, der sich über unseren Landy Stella hermachen könnte, wie er es in den USA schon häufiger erlebt hat. Wir drei überleben allerdings das Unwetter ohne Schaden zu nehmen.
Andorra – Das Skifahrerparadies schlechthin
Loyals Wunsch ist es, über Andorra zu fahren, »um zu sehen, wie es ein so kleines Land in den Bergen geschafft hat, unabhängig zu werden und zu bleiben.« Das Land empfängt uns mit einer gigantischen Stadt, die direkt in die Berge gebaut ist. Vielstöckige Hotels und glitzernde Werbeschilder schmiegen sich an die Felsen. Man fühlt sich wie in eine andere Welt versetzt, obwohl die Lifte alle außer Betrieb sind und weit und breit kein Schnee in Sicht ist. Das ganze Land scheint zu boomen, ein Skidorf reiht sich ans nächste und auch andere Freizeitangebote wie Klettern werden angeboten. Wir wollen auf jeden Fall irgendwann im Winter wiederkommen.
Gemütlichkeit im trockenen Spanien
Trockenheit und Arbeitslosigkeit
Nach dem Boom in Andorra erleben wir in Spanien genau das Gegenteil: Viele Häuser und Wohnungen scheinen leer zu stehen oder werden zum Verkauf angeboten. Auch hier sind, wie auf dem Land in Frankreich, viele Geschäfte geschlossen. Außerdem fällt uns überall die große Trockenheit auf. Noch in den Pyrenäen, kurz nach der Grenze, suchen wir vergeblich nach dem in der Karte dargestellten See, an dem wir picknicken wollen. Irgendwann erkennen wir ihn an einer großen Brücke, die in der Gegend herumsteht. Überall, wo wir dieser Tage entlangkommen, fehlt das Wasser in den angekündigten Flüssen. Die vielen leeren Flussbetten sind ein trauriger Anblick.
Ähnlich fühlen wir uns, nachdem wir Cartagena hinter uns gelassen haben und weiter an der Küste gen Süden fahren. Kilometerweit sieht man keine Erde oder Natur mehr, sondern nur Gewächshäuser, die von Weitem an Flüchtlingslager erinnern. Planen so weit man blicken kann. »Das hat sich wirklich massiv geändert«, meint Loyal dazu, der 2007 in der Gegend unterwegs war. »Als ich das letzte Mal hier war, gab es kaum Gewächshäuser zu sehen.«
Beim Anblick dieser verwandelten Landschaft denkt man über den eigenen Tomatenkonsum und die allgemeine Wirtschaftskrise nach. Wir fragen uns, was uns wohl auf dem afrikanischen Kontinent erwarten wird, wenn die Trockenheit und Arbeitslosigkeit sich schon hierzulande so dramatisch darstellt. Und Spanien wird in den nächsten Jahren mit noch mehr Menschen aus Afrika rechnen müssen, die den weiten Weg in kleinen Booten auf sich nehmen, um in Europa, in ihren Augen dem Kontinent des Reichtums, ihr Glück zu (ver-)suchen.
20 Stundenkilometer erlaubt – 40 empfohlen!
Wir sind erst kurze Zeit im Land und schon bin ich von der Straßensituation ziemlich genervt. Nicht dass die Straßen in schlechtem Zustand sind – nein, sie sind top gepflegt. Allerdings ist es so gut wie unmöglich, außerhalb der Autobahnen im Land vorwärts zu kommen. Die Nationalstraßen führen direkt durch die Städte und in diesen darf man maximal 40 Stundenkilometer fahren, oft sogar nur 30. Sobald man etwas zu schnell wird, springen Ampeln, die alle 50 Meter aufgestellt sind, auf Rot, oder aber Erhöhungen auf der Straße, die auch von zwei Augenpaaren nicht immer leicht zu erkennen sind, erinnern den Fahrer daran, nicht zu schnell zu fahren. Insgesamt sind in Spanien sehr viele Schilder aufgestellt, die ständig an die Höchstgeschwindigkeit erinnern sollen (teilweise alle 50 Meter). Einige Aufrufe sind geradezu absurd: So finden wir in den Bergen das 20 km/h-Schild dicht gefolgt von einem Schild, das als empfohlene Geschwindigkeit 40 Stundenkilometer angibt. Auf vielen kleinen Straßen wird uns eine höhere Geschwindigkeit »empfohlen« (rechteckige blaue Schilder) als eigentlich erlaubt ist (runde Schilder mit rotem Rand). Als es uns zu bunt wird, wechseln wir dann doch auf die Autobahn, aber nach nur wenigen Metern überholen wir Fahrradfahrer, die ihr Morgentraining absolvieren. Diese Radfahrergruppe bleibt nicht die Einzige, die wir auf spanischen Autobahnen antreffen!
Auf der Suche nach Schlafplätzen
Viel Zeit verbringen wir jeden Tag mit der Suche nach Schlafplätzen. Da wir festgestellt haben, dass die Zeltplätze hier meist sehr luxuriös sind und uns eine Übernachtung etwa 50 Euro kosten würde, versuchen wir, unsere Nächte außerhalb der offiziellen Plätze zu verbringen. An manchen Tagen werden wir schnell fündig, an anderen Tagen dauert es drei Stunden, bis wir einen geeigneten Platz finden. Einmal geben wir die Suche im Zuge der einbrechenden Dunkelheit irgendwann ganz auf und verbringen die Nacht mitten in einem Wohngebiet. Am nächsten Morgen sind wir beim Anblick der Straße und der Bürgersteige geschockt: Alles ist von Hundekot bedeckt. Abends haben die Leute ihre Tiere Gassi geführt und alles liegen gelassen. Wenige Meter von unserem Auto entfernt liegt ein riesiger Haufen mitten auf der Straße. Eine große Sauerei. So etwas haben wir beide noch nie gesehen. Wir machen, dass wir fortkommen. Insgesamt ist übrigens auffällig, dass es hier in Spanien kaum Campingplätze gibt. An der Costa del Sol haben wir an der Küste und im Inland insgesamt nur fünf entdeckt.
Endlich ausschlafen!
Ich scheine in meinem Land angekommen zu sein: Bei der Fahrt durch Valencia stellen wir fest, dass um kurz vor zehn am Vormittag weder viele Autofahrer noch Menschen auf der Straße unterwegs sind. Alles hat noch geschlossen. In wenigen Cafés sitzen Leute und nehmen ihr Frühstück ein. Während wir durch einen Park fahren, sehen wir viele Jogger, die noch gemütlich vor der Arbeit ein bisschen Sport treiben. »Ich glaube, ich war in einem früheren Leben mal Spanierin – hier könnte ich endlich morgens so lange schlafen, wie ich will, ohne aufzufallen«, meine ich zu Loyal.
Auf unserem Weg in den Süden des Landes sehen wir an den Landstraßen nicht nur enorm viele Rotlicht-Clubs, sondern auch immer wieder junge wie ältere Damen, die direkt an der Straße auf einem Stuhl sitzend auf Kundschaft warten. Wir fragen uns, ob das schon immer so war oder ob das erst in den letzten Jahren so auffällig zugenommen hat. In Frankreich haben wir das gar nicht gesehen. Je näher wir Marokko und damit der muslimischen Welt kommen, desto mehr Damen sitzen am Straßenrand.
Wir landen auf einem Campingplatz, wo ich in der zweiten Nacht in der Ferne ein riesiges Feuer entdecke. »Schau mal da hinten! Vielleicht sollten wir uns bereit machen, damit wir im Notfall gleich losfahren können!?« Loyal beruhigt mich damit, dass das Feuer sehr weit weg sei und der Wind in die entgegengesetzte Richtung gehe.
Am nächsten Morgen ist unser Auto voller Asche: Der Wind hat in der Nacht gedreht! Loyal erfährt aus dem Internet, dass das Feuer zwar um die 40 Kilometer weit weg ist, sich allerdings über eine Fläche von 20 Kilometern ausgedehnt hat. Erst 24 Stunden nach dem Ausbruch konnte es unter Kontrolle gebracht werden. Es soll der größte Brand an der Costa del Sol gewesen sein. Noch jetzt, zwei Tage später, sieht man Rauchwolken aufsteigen. Wir denken an unsere bevorstehende Reise und fragen uns, wie es wohl in diesem Jahr in Afrika mit den Buschbränden aussieht.
Das Leben hier auf dem Campingplatz ist irgendwie anders, als ich es mir vorgestellt habe. Die Leute haben ihre »halben Häuser« dabei, fast niemand ist ohne Fernseher angereist. Trotzdem ist es insgesamt sehr ruhig. Auch gegen zehn Uhr morgens herrscht noch angenehme Ruhe.
Seit unserer Abreise aus Deutschland sind wir zum ersten Mal auf einem »richtigen« Zeltplatz und es erscheint mir schon heute als eine Wohltat, mich unter eine richtige Dusche stellen zu können, obwohl wir noch gar nicht in Afrika sind! Welch großer und angenehmer Vorteil der Zivilisation. Wie lange ich wohl in Afrika ohne Dusche auskommen muss?
Nordwestafrika
Marokko
Einreisen auf Marokkanisch
Bei unserer Überfahrt nach Marokko ist der Himmel bewölkt. Wir sind froh, Spanien den Rücken zu kehren, hatten wir doch während der letzten Tage täglich starken Wind und mussten lange Kleidung tragen.
Als wir darauf warten, auf die Fähre fahren zu können, hält ein großer, ausgebauter Iveco-Lkw mit Karlsruher Kennzeichen neben uns. Der erste deutsche Wagen seit Tagen kommt aus Karlsruhe! Stefan und Michaela leben momentan in Brüssel, haben ihren Wagen aber in Karlsruhe angemeldet und wollen sechs Wochen nach Marokko. Zu unserem Glück kennen sie sich aus und bringen uns an Deck gleich zu dem »wichtigen Tisch« in der Cafeteria, an dem ein Marokkaner sitzt und Pässe stempelt. So können wir schon während der Überfahrt offiziell einreisen. Die beiden versorgen uns noch mit weiteren guten Tipps. Sie sind schon das zweite Mal mit dem Auto in Marokko unterwegs.
Die Einreise am marokkanischen Zoll ist total relaxt: Die Beamten sind freundlich und machen Witze. In meiner Aufregung »vergesse« ich, dass ich verheiratet bin und schreibe meinen Mädchennamen auf das Einreiseformular. Das stiftet Verwirrung. Nun wird mein Pass genauestens studiert und plötzlich klappt der Zöllner meinen Pass mit einem lauten »Ha!« zu. »Ist das wirklich dein Geburtsdatum?«, will er auf Französisch von mir wissen. Ich bejahe. »Genau wie ich!«, informiert er nicht nur mich, sondern auch alle anderen herumstehenden Zöllner freudestrahlend. Von diesem Moment an nennt er mich nur noch »Skorpion« und duzt mich. So kommen wir schnell durch den Zoll.
Kurz danach sieht unsere Situation schon wieder ganz anders aus: Da ich missverständlich davon ausgegangen bin, dass unsere deutsche Versicherung in Marokko nicht greift und es keine »grüne Karte« für Marokko gibt, haben wir uns vorgenommen, bei unserer Ankunft eine Versicherung für Marokko abzuschließen. Im Internet hatten wir dazu schon Informationen eingeholt. Nun scheint die Lage allerdings ganz anders: Plötzlich sollen wir die Gebühr für einen riesigen Lastwagen bezahlen. Wir sind geschockt. Das Problem: Wir haben nur zwei Sitzplätze im Landy und hinten keine Fenster. Ich muss wohl ziemlich entmutigt ausgesehen haben, denn plötzlich winkt uns einer der zwei Angestellten ins Büro. Gemeinsam beratschlagen wir, wie es weitergehen kann. »Wir Jungen müssen zusammenhalten«, zwinkert mir der eine dann zu. Die Lösung: Ich muss zurück zum Zoll, einer der Zöllner schreibt auf mein Einreiseformular »Campingcar« und so müssen wir nur noch die normale Pkw-Gebühr bezahlen – ein Monat kostet so viel wie drei Lkw-Tage! Wir sind erleichtert, bedanken uns überschwänglich und schon geht´s los ins marokkanische Leben.
Das bietet einem manchmal Hindernisse, die es zu überwinden gilt. Abseits der Touristenpfade ist vieles nur noch in arabischer Schrift gekennzeichnet und nur sehr wenige Marokkaner verstehen Französisch. Schon am ersten Tag stehe ich vor Toiletten und kann mich nicht entscheiden, welche der Schriftarten weiblicher wirkt. Niemand ist weit und breit zu sehen. Als der Security-Guide vorbeischlendert, bewege ich mich auf eine Tür zu und sehe seine entsetzten Augen. Also doch die andere!
Auf dem Campingplatz zu Tee und Fleisch geladen
Marokkos Hauptstadt Rabat empfängt uns wie der Zoll: ziemlich entspannt. Ohne belästigt zu werden schlendern wir durch die Medina, die marokkanische Innenstadt mit Geschäften und Marktständen. Die gepflegten Gassen sind sehr schmal und von hohen Häusern begrenzt, die Orientierung fällt nicht leicht. Auf der Suche nach einer Frühstücksmöglichkeit stellen wir fest, dass in Marokko scheinbar nur Männer in der Öffentlichkeit frühstücken. Nach fast einer Stunde erfolgloser Suche fragen wir in einem Café nach, ob es auch mir erlaubt ist, dort Tee zu trinken. Wir werden zu einem Tisch geführt, erhalten unsere gewünschte Bestellung. Die Nebentische scheinen über meine Anwesenheit allerdings auf Arabisch informiert zu werden, viele Passanten starren mich an und drehen sich nach mir um. Wir beeilen uns, unser Omelette zu essen. In Zukunft müssen wir das mit dem Frühstück irgendwie anders hinbekommen.
In Rabat finden wir keine Möglichkeit, unseren Landy sicher zu parken und fahren deshalb auf einen Campingplatz etwas außerhalb der Stadt. Leider entpuppt sich der Strand und das Meer als nicht besonders einladend, da Loyal gleich zwei benutzte Kondome vor die Füße schwimmen. Das Leben auf dem Campingplatz ist mit dem in Spanien gar nicht zu vergleichen. Hier ist vor allem nachts etwas los: Wer keinen Lärm verträgt, sollte lieber woanders übernachten. Aus allen Ecken ertönt lautstarke Musik. Alle auf dem Platz scheinen zu einer großen Familie vereint. Wir werden gleich von unserem »Campingnachbarn« Rachid auf einen Tee und Gebäck eingeladen. Am Sonntag verbringen wir sogar den ganzen Tag mit unseren neuen Brüdern.
Bei Rachid (mittig im weißen Shirt) und seiner Familie erlebten wir schon auf dem Campingplatz umwerfende Gastfreundschaft
Das Leben in dieser Familie ist streng geregelt: Obwohl sie äußerlich nicht streng religiös scheint – die Frauen sind nicht verschleiert, es wird nicht gebetet –, wird sich an andere Traditionen gehalten: Frauen und Männer essen getrennt. Gegessen wird gemeinsam mit der rechten Hand von einem großen Teller. Uns Gästen schiebt man die dicksten Fleisch- und Fettbrocken zu. Leider spricht nur der Familienvater französisch, alle anderen kommunizieren auf Arabisch, was die Unterhaltung erschwert. Die Stimmung ist sehr herzlich. Für den nächsten Tag laden sie uns zu sich nach Hause ein. »Die Gastfreundschaft der Leute hier ist ja wirklich unglaublich!«, freut sich Loyal, der vor ein paar Jahren schon einmal in Marokko war und sich in den Touristenhochburgen nur ausgenommen und betrogen fühlte. Hier zeigt sich uns ein völlig anderes Bild. Ob wir in Deutschland Touristen gegenüber auch so gastfreundlich sind?
Das Leben in einer marokkanischen Familie: Viel Geben
Wir nehmen die Einladung an und ziehen am Montag zu Rachid und seiner Familie. Rachid besitzt eine kleine Wohnung in der Medina von Salé, der früheren Hauptstadt Marokkos. Heute sind Rabat und Salé fast zu einer Stadt zusammengewachsen, nur teilweise durch einen Fluss getrennt.
Seit einer Woche sind wir nun in Salé und wohnen bei Rachid und seiner Familie. Diese besteht aus seiner Frau und seinen drei Kindern. Der Älteste ist 26 und hat gerade ein Studium begonnen. Seine Tochter Sara ist 21, hat vor zwei Jahren einen in Italien lebenden Marokkaner geheiratet, den sie im Internet kennengelernt hat. Nun sind die beiden mit ihrem neun Monate alten Sohn auf Besuch in Marokko. Die jüngste Tochter, Aisha, ist etwa 12 und geht noch zur Schule. Neben Rachid wohnt sein jüngerer Bruder Hassan mit seiner Frau, die bei der Polizei arbeitet, und zwei Kindern. Und da wären auch noch die fast 80-jährige Frau, die Oma genannt wird, und eine Freundin der Familie. Es sind wirklich viele, die hier zusammenleben.
Das Zuhause der Familie liegt mitten in der Medina, wo man mit Autos nicht reinkommt. Die Gassen sind sehr eng und unübersichtlich, ohne offizielle Straßennamen. Die Wohnung ist typisch marokkanisch und sehr stilvoll eingerichtet. Da das Haus schon mehrere Jahrhunderte alt ist, sind die Mauern über einen halben Meter dick. Dadurch ist es in den Räumen angenehm kühl.
Die Wohnung der Familie liegt mitten in der Medina von Salé.
Wir gewöhnen uns schnell an feuchte Unterhosen, da es auf der Toilette kein Toilettenpapier gibt, sondern nur einen Eimer mit Wasser und Seife. Die Toilette ist gleichzeitig der Duschraum, in dem ein Eimer mit Wasser steht, mit dem man sich nach dem Toilettengang säubert beziehungsweise das man sich mit einem Becher über den Körper schüttet, um so zu duschen. Fließendes Wasser gibt es nicht. Der Raum ist so niedrig, dass man nicht aufrecht stehen kann, was vor allem das Duschen sehr schwierig und anstrengend macht.
Das Leben in einer marokkanischen Familie ist ein umwerfendes Erlebnis. Wir haben das Gefühl, schon richtig zur Familie zu gehören. Jeder Wunsch wird uns von den Augen abgelesen. Die köstlichsten marokkanischen Speisen werden für uns zubereitet. Aus Gastfreundschaft sitzen wir alle zusammen – Männer und Frauen – um den Tisch und essen mit den Händen von einer großen Platte. Gestern Abend haben Loyal und ich versucht, etwas Deutsches zuzubereiten. Herausgekommen sind ein Kartoffel- und ein Nudelsalat. Beides war für den Geschmack der Familie sehr ungewohnt, wurde aber aufgegessen. Wir freuen uns darüber sehr.
Die einzelnen Familienmitglieder teilen alles mit uns, was sie haben: Loyal hat eine Djellaba, das typische marokkanische Gewand, das die meisten einheimischen Männer tragen, von Rachid bekommen, seine Frau hat mir ein neu gekauftes Kleid geschenkt (Würde ich jemals ein Kleidungsstück, das ich mir gerade selbst neu gekauft habe, jemandem weiterverschenken?), Sara hat mir eine Strumpfhose geschenkt, von der Familie seines Bruders haben wir ein ganzes Schüsselservice bekommen. Wir fühlen uns schon richtig schlecht bei so viel Gastfreundschaft, weil uns bewusst ist, dass wir selbst Besuchern in Deutschland nicht so offen gegenübertreten würden. Bisher haben wir zumindest noch nie wildfremde Menschen zu uns nach Hause eingeladen und beschenkt. Zu groß ist unsere Angst vor Unbekannten. Vielleicht sollten wir das ändern.
Momentan ist Loyal mit den Männern des Hauses in einem marokkanischen Bad. Die Geschlechtertrennung bekomme vor allem ich stark zu spüren, obwohl Rachid sehr nett zu mir ist und ich auch diejenige bin, die alles übersetzen muss. So schön es ist, mit den Frauen zusammenzusitzen, so schwierig ist dabei allerdings die Verständigung. Nicht, dass ich es nicht gewöhnt bin, dass man mich nicht versteht (ich erlebe immer wieder im Fremdsprachenunterricht, dass meine Schüler nicht ganz verstehen, was ich sage), aber die Frauen sprechen nur arabisch und das hat irgendwie mit keiner der Sprachen, mit denen ich mich bisher beschäftigt habe, Ähnlichkeit. Ich kann es auch nicht lesen. So bleibt es dabei, dass wir uns anlächeln, ich bei den Haushaltstätigkeiten ein bisschen helfe und mit Saras Baby spiele. Apropos Baby: Ich habe selbst ja noch keine Kinder, aber ich bin sicher, dass alle, die selbst Kinder haben, hier Zustände kriegen würden. Das Kind wird ständig von irgendjemand anderem durch die Gegend getragen und mit allem gefüttert, was gerade greifbar ist: Cola, Chips, (scharfem) Couscous, mit Essig angemachtem Salat, Käse … Wir können es kaum glauben, aber der Kleine schluckt alles und scheint zumindest zu überleben!
Ein goldener Käfig für die Braut
Eines Tages zeigt uns Rachid das Hochzeitsvideo seiner Tochter: »Die härtesten drei Tage im Leben einer Frau«, wie er uns mit einem Lächeln erklärt. Die Feier beginnt am Freitag, der »Henna-Nacht«. Die Braut sitzt etwa sechs Stunden bewegungslos auf einer Couch und wird mit Henna bemalt. Um sie herum tanzen, singen und machen überwiegend Frauen Musik. Hochzeiten sind die einzige Gelegenheit im Leben einer verheirateten Frau zu tanzen.
Irgendwann kommt der zukünftige Ehemann und bringt die Geschenke für die Braut. Zu diesen gehören Schminke, Schmuck und Kleider, aber auch eine lebendige Kuh, die in den nächsten Tagen gegessen wird! An diesem Freitagabend zieht sich die Braut einmal um. Zwei prächtige Gewänder, sogenannte Kaftane mit passendem Schmuck müssen getragen werden.
Am Samstag ist dann das große Fest: Die Braut muss sich insgesamt fünf Mal umkleiden. Neben den Kaftanen, die wie Königsgewänder aussehen, muss an diesem Tag auch das Brautkleid getragen werden. Es ist weiß und ähnelt einem klassischen Brautkleid, wie man es auch bei uns kennt. Es kommen sehr viele Gäste. Längere Zeit wird die Frau in einer Art goldener Sänfte durch die tanzende Menge getragen. »Ein Zeichen dafür, dass die Ehe für die Frau ein Leben in einem goldenen Käfig bedeutet«, erklärt Rachid. Sonntag wird dann nochmal im Kreise der Familie gefeiert. Drei wirklich anstrengende Tage.
Interessant für uns ist, dass sich Rachid der Tradition sehr wohl bewusst ist. »Hier werden nur wenige Ehen geschieden«, erzählt er uns. »Das liegt daran, dass sich die Frau dem Mann von Anfang an unterordnet. Das Leben der Frauen hier ist schwieriger als das der Männer.« Wir hätten nicht gedacht, dass ein Mann das so offen äußern würde.
Rachid ist ein sehr kluger Mann, der sich auch in der Weltpolitik ganz gut auskennt und den Wahlkampf in den USA beobachtet. Schulbildung findet er sehr wichtig. Allerdings können sich nur die wirklich reichen Familien eine Privatschule für die Kinder leisten: Der Grundschulbesuch kostet monatlich etwa 130 Euro, für die Sekundarstufe fallen in einer Privatschule 260 Euro pro Kind an. Dazu kommen noch die Fahrtkosten. Familien mit Einzelkindern gibt es fast nicht. In einem Land, in dem die Miete für eine bessere Fünf-Zimmer-Wohnung um die 250 Euro beträgt, ist eine gute Schulbildung für die meisten unerschwinglich.
Ein Visum für Mauretanien: Alles andere als relaxt
Weniger angenehm als unsere Zeit bei Rachid gestaltet sich unsere Zeit vor der mauretanischen Botschaft in Rabat. Wir beeilen uns am Freitag, zur Botschaft in Rabat zu kommen, um noch vor dem Wochenende das benötigte Visum zu beantragen. Doch schon vor dem Botschaftsgelände spüren wir den strengen mauretanisch-islamischen Wind, der hier weht: Wir dürfen uns noch nicht einmal auf dem Gehsteig vor der Botschaft aufhalten, sondern werden sofort weggeschickt mit dem Hinweis, dass Freitag der heilige Tag sei und dass wir Montag wiederkommen sollten. Heute würde die Botschaft geschlossen bleiben. Wir sind frustriert, zumal auf der Homepage der Botschaft kein Hinweis auf die besonderen Öffnungszeiten zu finden war.
Montag stehen wir wieder vor der Botschaft, diesmal sind wir allerdings »zu spät«. Der Visaservice ist maximal zwei Stunden am Tag »offiziell« geöffnet. Als wir wieder weggeschickt werden, spricht uns der Straßenwachmann an: Wieso wir denn wieder gehen würden? Das wäre doch alles nur eine Frage des Geldes. Er macht die international bekannte Geste mit den Fingern. Nun wird uns klar, warum immer noch so viele auf dem Bürgersteig gegenüber der Botschaft warten. Wir gesellen uns zu den Wartenden und es werden Tipps ausgetauscht, wie man die korrupten Beamten am besten für sich gewinnen könnte. Manche erhalten dann plötzlich doch ihr Visum, andere können zumindest ihren Antrag abgeben. Als wir an der Reihe sind und uns hinter unserem Landy versteckt mit einem der mauretanischen Beamten treffen, erhöht sich der Preis für den »Zusatzaufwand« bei unserem Anblick auf das Dreifache. Das wollen wir nicht akzeptieren. Der Botschaftsangestellte ist sehr verärgert. Wir müssen am nächsten Tag wiederkommen. Mal wieder.
Am Dienstag stehen wir nach nur fünf Stunden Schlaf schon um sieben Uhr auf, um auf keinen Fall wieder »zu spät« zu kommen. Wir stellen uns in die Schlange der Wartenden und dringen langsam bis zum offiziellen Schalter vor. »Oh, ich habe euch gestern schon gesehen, ja?«, meint der Mitarbeiter auf Französisch zu uns. Er erinnert sich an uns und man sieht ihm an, dass er immer noch verärgert ist, dass wir das Geld für den »Zusatzaufwand« nicht zahlen wollten. »Gehört ihr wirklich zusammen?«, fragt er zweifelnd, als er Loyals amerikanischen Pass sieht.
»Ja!« Der Pass wird genauestens untersucht, alle Seiten angeschaut, unter eine kleine Lampe gehalten und das Foto mit Loyals Gesicht verglichen. Der Beamte scheint nicht überzeugt, überreicht uns dann allerdings gegen die normale Visagebühr unseren Abholschein. »Gibt es eine Möglichkeit, das Visum schon heute zu erhalten?«, frage ich vorsichtig.
»Nein!« Wir sollen am nächsten Tag um 15 Uhr wiederkommen. Als wir den Wachmann nach dem Preis für den »Zusatzaufwand« fragen, wenn wir das Visum noch am gleichen Tag wollen, meint er: »Das lohnt sich nicht. Die Visa kosten dann fast das Doppelte.« Na gut. Wir machen uns wieder auf den Weg zu Rachid und beschließen, am nächsten Tag wiederzukommen.
Am Donnerstag holt Loyal die Visa schließlich ab. Auf dem Weg dorthin gerät er mitten in eine Demonstration, die von Hunderten von Polizisten abgesichert wird. Er muss umdrehen. Das Problem dabei: Er kennt nur den einen Weg zur Botschaft und der führt über die Hauptstraße. Er hat keinen Stadtplan dabei, fragen kann er auch nicht, weil er kein Französisch spricht. Loyal bekommt Schweißausbrüche beim Gedanken an die strikten Regeln der Botschaft. Wer nicht genau dann da ist, wenn das Fenster der Botschaft geöffnet wird, hat verloren und darf am nächsten Tag wiederkommen. Doch er hat Glück: Er schafft es auch über Umwege pünktlich und bekommt unsere Pässe mit Visum ausgehändigt. Trotz des Anschlags auf die amerikanische Botschaft in Libyen und Protesten in vielen Städten der arabischen Welt hat auch er als Amerikaner ein Visum für Mauretanien erhalten.
Unruhen in Rabat
Die Lage in Rabat ist momentan angespannt. Loyal berichtet uns nach seiner Rückkehr von der Demonstration, in die er geraten ist. Ein ohrenbetäubender Lärm, skandierte Verse, aufgebrachte Menschen, die schreien. Und viele Polizisten in Kampfanzügen. Loyal gelingt es, auf der Gegenfahrbahn zu wenden. Rachid erklärt uns, warum die Leute protestieren: »Die Menschen sind sehr aufgebracht wegen eines amerikanischen Films.« Wir recherchieren im Internet und finden heraus, dass ein Mohammed-Video auf youtubein der arabischen und muslimischen Welt für Unruhe gesorgt hat. Rachid macht sich deshalb große Sorgen. »Wir finden das nicht gut. Warum wurde dieser Film nur ins Netz gestellt? Jetzt toben viele Muslime. Das alles wird die Fronten wieder verhärten. Nicht alle Moslems sind schlecht. Was sollen die Amerikaner nur von uns denken!«, äußert er seine Bedenken. Er weist uns darauf hin, dass wir bei ihm und seiner Familie sicher sind, denn: »Ihr seid ja eigentlich schon Teil unserer Familie!«
Die Eskalation in einem muslimischen Land im Kreise von Einheimischen mitzuerleben, eröffnet uns eine ganz neue Perspektive. In den nächsten Tagen wird das Thema immer wieder diskutiert. Die Marokkaner, die wir bei diesen Diskussionen erleben, haben eine sehr liberale und westlich geprägte Einstellung. Sie sind sehr unglücklich über die Situation und haben Angst davor, dass sich auch Marokko von der westlichen Welt abspalten könnte. Aktuell unterhält die Regierung gute Beziehungen zu Europa und auch zu Amerika. Andererseits wird der Druck anderer arabischer Staaten auf Marokko immer größer: Die Marokkaner sollen sich entscheiden, zu wem sie wirklich gehören (wollen).
Loyal bekommt regelmäßig E-Mails vom U.S. Department of State, das alle amerikanischen Bürger dazu aufruft, die arabische Welt zu verlassen. Die amerikanische Botschaft in Casablanca ist seit zwei Tagen geschlossen.
Langsam werden wir beide ein bisschen nervös. Als Nächstes wollen wir nämlich die Islamische Republik Mauretanien (so der offizielle Landesname) durchqueren.
Marokkanische »Push-ups«
In der Medina in Rabat habe ich etwas wirklich Witziges gesehen: Ausgestopfte Unterhosen werden zum Verkauf angeboten. In Deutschland ist inzwischen fast jeder BH »gepolstert«. Hier sind »gepolsterte« Unterhosen im Angebot: Sie machen einen riesigen Po. Auffallend viele Frauen schauen sich die meiner Meinung nach viel zu großen Höschen an. Ich habe mich aber nicht getraut, ein Foto zu machen!
Lebensmittelvergiftung
Es hat uns erwischt! Beide, und sehr heftig! Während ich schon am Dienstagabend beim Einschlafen heftige Bauchkrämpfe wegzuträumen versuche, ist Loyal noch ziemlich fit und schreibt Blogeinträge. Als ich am Mittwochmorgen aufwache, finde ich ihn auf dem Sofa liegend. »Mir geht´s nicht gut. Ich habe Durchfall und Bauchschmerzen«, ist seine Erklärung. Er hat gerade zu Ende gesprochen, als ich schon das unbändige Gefühl verspüre, auch sofort die Toilette aufsuchen zu müssen. Zurückgekehrt gebe ich nur ein : »Ich auch ...«, von mir und verziehe mich wieder ins Bett. Es ist etwa sieben Uhr morgens. Von da an geht es mit uns stündlich bergab. Um zehn Uhr bin ich so geschwächt, dass ich es kaum noch zum Klo schaffe, geschweige denn in die Hocke zu gehen, da es sich ja um ein marokkanisches Plumpsklo handelt, bei dem es nur ein Loch im Boden gibt und man sich konzentrieren muss, das Gleichgewicht zu halten und nicht nach hinten zu kippen. Mir wird immer wieder schwarz vor Augen.
Rachid ist sehr besorgt, was uns sehr leid tut. So wie es aussieht waren es die Eier vom Vortag, die uns krank gemacht haben. Seine Frau hatte sie nur für uns zubereitet. Wir versuchen möglichst munter zu wirken, wenn er ins Zimmer kommt, denn wir wollen auf keinen Fall, dass er sich schlecht fühlt. Irgendwann wissen wir nicht mehr, was schlimmer ist: Unser Kranksein oder unser schlechtes Gewissen der Familie gegenüber. Was vor allem mir zu denken gibt, ist die Tatsache, dass wir beide Fieber haben. In meinem schlauen Buch Wo es keinen Arzt gibt heißt es: »Bei Durchfall mit Fieber sollte ein Arzt aufgesucht werden.« Gegen Mittwochmittag ist uns beiden klar, dass wir Medikamente brauchen. Rachid will uns zum Krankenhaus bringen, aber mein Kreislauf ist im Keller und ich kann nicht laufen.
Unter Tausend Entschuldigungen bitten wir Rachid, einen Arzt ins Haus kommen zu lassen. Rachid kommt unserem Wunsch nach und schafft es sogar, den Arzt in dessen Mittagspause zu uns zu bringen. »Das ist ganz eindeutig eine heftige Lebensmittelvergiftung!«, ist die Diagnose. Rachids Augen füllen sich mit Tränen. Er tut uns so leid, wie auch seine Frau, die das Essen immer so liebevoll für uns zubereitet hat. Der Arzt verschreibt uns ein Antibiotikum und andere Medikamente.
Ich fühle mich so, wie Menschen auf kaltem Entzug in Filmen dargestellt werden. Filmsequenzen aus Trainspotting, Candy und anderen Drogenfilmen gehen mir durch den Kopf. Alles tut mir weh. »Ich spüre meinen linken Arm nicht mehr«, meint Loyal plötzlich zu mir. Er ist so am Ende, dass er noch nicht einmal mehr die Kraft findet, sich im Bett zu drehen. »Ich dachte, wenn die Medikamente nicht in den nächsten zehn Minuten kommen, muss ich sterben«, erzählt er mir im Nachhinein.