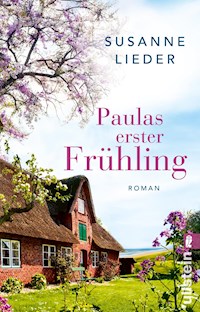10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Mutige Frauen zwischen Kunst und Liebe
- Sprache: Deutsch
»Mein lieber Poirot, Sie waren in der Tat oft eine echte Plage. Aber dank Ihnen, werter Hercule, mag ich mich nun doch Schriftstellerin nennen.« Agatha wollte eigentlich Pianistin werden. Doch der große Erfolg bleibt aus. Mehr zum Zeitvertreib beginnt sie, Geschichten zu schreiben. Als sie bei ihrer Arbeit in der Apotheke mit Giften zu tun hat, drängt sich ihr die Idee zu einer Kriminalgeschichte mit einem Giftmord auf, die sie nicht mehr loslässt, bis sie sie aufs Papier gebannt hat. Der Detektiv Hercule Poirot ist fortan ihr ständiger Begleiter, auch die scharfsinnige Miss Marple gesellt sich zu ihr – und Agatha Christie wird als Krimiautorin weltberühmt. Nach dem Bestsellererfolg von »Astrid Lindgren« der neue Roman über die Queen of Cosy Crime.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 376
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Agatha hat ihren eigenen Kopf – statt eine Vernunftehe einzugehen, will sie Pianistin werden. Doch die Träume von der Karriere als Musikerin platzen, und auch die große Liebe lässt auf sich warten. Um dem Alltag zu entfliehen, beginnt Agatha zu schreiben – zunächst Kurzgeschichten, später erfindet sie einen Detektiv namens Hercule Poirot. Als sie Archibald Christie kennenlernt und ihr endlich der ersehnte Durchbruch als Schriftstellerin gelingt, scheint ihr Glück perfekt. Doch dann erleidet sie gleich zwei Schicksalsschläge. Hilft ihr das Schreiben, sich ihr Leben zurückzuerobern?
Über Susanne Lieder
Susanne Lieder ist in der Nähe von Bad Oeynhausen aufgewachsen und lebt mit ihrer Familie südlich von Bremen. Seit 2012 arbeitet sie hauptberuflich als Schriftstellerin und hat sich damit ihren Kindheitstraum erfüllt. Sie schreibt Unterhaltungsromane, historische Romane und Romanbiografien.Im Aufbau Taschenbuch liegt ihr Roman »Astrid Lindgren« vor, der ein Bestsellererfolg wurde.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Susanne Lieder
Agatha Christie
In der Liebe sucht sie nach Hoffnung, mit ihren Krimis erobert sie die Welt
Roman
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
Motto
Haus Ashfield in Torquay, im Sommer 1926
I. — Die Jahre 1908—1910 Reisejahre
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Haus Ashfield im Sommer 1926
II. — Die Jahre 1912—1914 Ambitionen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Haus Ashfield im Sommer 1926
III. — Die Jahre 1917—1920 Einschnitte
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Haus Ashfield im Sommer 1926
Sunningdale, vier Wochen später
IV. — Die Jahre 1927 und 1928 Ein neues Kapitel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Nachwort
Impressum
Wer von diesem Roman begeistert ist, liest auch ...
Für meine unvergleichliche Agentin
Seit Lucrezia Borgia bin ich die Frau, die am meisten Menschen umgebracht hat, allerdings mit der Schreibmaschine.
— Agatha Christie —
Haus Ashfield in Torquay, im Sommer 1926
Auf den Knien saß Agatha im Wohnzimmer ihres Elternhauses, um sich herum Kisten, Koffer, Hutschachteln und Schmuckkästchen. Manche bereits leer, warteten andere noch darauf, von ihr durchsucht und genauestens inspiziert zu werden. Dann würde sie entscheiden, was sie behalten oder weggeben wollte.
Agatha war in diesem Haus aufgewachsen. Ihre Eltern hatten es nach der Geburt ihrer älteren Schwester bezogen, und im Laufe der Zeit hatte sich mehr und mehr angesammelt. So viel, dass Agatha vor ein paar Tagen, als sie angekommen war, von Raum zu Raum ging und sich fragte, wo um alles in der Welt sie nur anfangen sollte.
Der Tod ihrer Mutter im Frühjahr hatte ihr vollkommen den Boden unter den Füßen weggezogen. Er hatte sie sprachlos – im Sinne des Wortes – und zunächst auch handlungsunfähig gemacht. Tag für Tag, Stunde um Stunde hatte sie bloß dagesessen und vor sich hin gestarrt. Ihr Leben würde weitergehen, natürlich, das tat es ja immer, aber wie?
Agatha stand träge auf und wanderte durchs Zimmer. Die Vorhänge waren halb zugezogen, ein Sonnenstrahl fiel durchs Fenster und ließ Staubkörnchen tanzen. Früher hätte sie das Schauspiel betrachtet, hätte gelächelt und die Hand ausgestreckt, als könne sie das Licht einfangen und für einen Moment festhalten.
Sie ging zum Fenster, verschränkte die Arme und schaute in den Garten. Wie durch einen Nebel nahm sie wahr, wie die Zweige der Rotbuche sacht im Wind schaukelten, und eine Amsel angeflogen kam, sich auf einem der Äste niederließ und begann, ihr Gefieder zu putzen. Ein paar verblühte Rosen an den Sträuchern zeugten davon, dass ihre Mutter sich schon eine Weile nicht mehr darum hatte kümmern können. »Der Garten ist das Aushängeschild eines jeden Engländers«, hatte sie stets erklärt. »So wie die Scones zum Nachmittagstee.« Wie hatte sie ihn zelebriert!
Und wie habe ich es geliebt, mit ihr auf dem Sofa zu sitzen und ein Tässchen zu trinken, dachte Agatha und rang den Impuls nieder, ihren Kummer laut herauszuschreien. Es würde nichts bringen, außerdem hatte sie das längst getan.
Wieder durchschritt sie das Zimmer, stellte sich vor, wie es hier früher ausgesehen hatte. Als sie noch ein kleines Mädchen gewesen war und ihre Welt aus Spielen und Plänen bestanden hatte. Pläne, die nur den kommenden Tag betroffen hatten. Die Frage, etwa, ob sie im Wäldchen umherstreifen sollte, um Ausschau nach Eichhörnchen zu halten. Oder doch lieber auf der Mauer balancieren und darauf hoffen, eine Eidechse zu finden.
Ihr Vater hatte ihr zum fünften Geburtstag einen Hund geschenkt, einen Yorkshire-Terrier. Tony hatte sie auf Schritt und Tritt begleitet. Du darfst ihn aber nicht allzu sehr verwöhnen, hatte ihr Vater gemeint. Er muss wissen, wo seine Grenzen sind. Du musst sie ihm zeigen.
Feierlich hatte sie versprochen, es zu beherzigen.
Sie sah ihren Vater im Sessel dort drüben am Fenster sitzen, die Zeitung aufgeschlagen. Setz dich zu mir, Agatha. Ich lese dir etwas vor.
Sie sah ihre Geschwister durchs Zimmer toben und den kleinen Beistelltisch beinahe umrennen. Hinter ihnen, dicht auf ihren Fersen, Nursie, die Kinderfrau. Wenn ich euch erwische! Vorsicht, die Vase! Gebt um Himmels willen acht!
Die Erinnerungen waren noch so lebendig, und sie machten Agatha traurig. Sie verließ das Wohnzimmer und ging in die Küche, um Teewasser aufzusetzen. Tee hilft immer, hörte sie Nursie sagen. Wenn man Bauchweh oder sich das Knie aufgeschlagen hat, und sogar, wenn man traurig ist.
Während es im Kessel rauschte und zischte, stand Agatha mit versteinerter Miene da, die Zähne so fest aufeinandergepresst, dass ihr Kiefer zu schmerzen begann. Als der Kessel pfiff, goss sie das dampfende Wasser in die Kanne. Tränen verschleierten ihren Blick, und sie räusperte sich energisch. Hör auf zu heulen! Als würde das irgendwas helfen!
Erst jetzt fiel ihr auf, dass sie vergessen hatte, Teeblätter in die Kanne zu geben.
Mit einem leisen Aufschluchzen sank sie auf einen Stuhl und verbarg das Gesicht in ihren Händen.
Gott noch mal, sie war fast sechsunddreißig und fühlte sich wie eine alte Frau. Sie war verwirrt, vergesslich und so erschöpft, dass sie sich kaum auf den Beinen halten konnte.
Es geht weiter, Agatha, das weißt du doch. Kopf hoch, sieh nach vorn! Immer nur nach vorn.
Sie trank ihren Tee, und als die Sonne unterging, legte sie sich angezogen auf ihr früheres Bett und rief sich das Gesicht ihrer Mutter in Erinnerung. Was, wenn sie es irgendwann vergessen würde?
Ihr Vater starb, als Agatha elf Jahre alt war.
Damit endete nicht nur abrupt ihre bis dahin sorglose Kindheit, ihr ganzes Leben veränderte sich.
Die finanziellen Schwierigkeiten hatten bereits Jahre zuvor angefangen. Ihr Vater stammte aus wohlhabendem Haus und hatte stets ein sicheres Einkommen zur Verfügung gehabt, ohne auch nur einen Finger krumm machen zu müssen. Einer der Treuhänder, die ihm all die Jahre zur Seite gestanden und dafür gesorgt hatten, dass er und später seine Familie ein unbekümmertes Leben führen konnten, verstarb, ein anderer erkrankte schwer. Außerdem hatten sie sich offenbar alle eifrig in die eigene Tasche gewirtschaftet. Für Agathas Vater ein schwerer Schock. Er verstand etwas davon, den lieben Gott einen guten Mann sein zu lassen, aber nicht das Geringste von den Geschäften seines Vaters, denen er seinen Wohlstand verdankte.
Im Laufe der Jahre hatte Agathas Vater unzählige Ölgemälde und kostbare, äußerst geschmackvolle Möbelstücke angeschafft, die nun nach und nach verkauft werden mussten. Sparsamkeit war die Devise, so würden sie hoffentlich über die Runden kommen.
Das Verkaufen der Möbel und Gemälde war für Agatha nicht schlimm, ihr bereitete es Kummer, dass ihr Vater still und kränklich wurde. Sie kannte ihn bis dahin als strahlenden, unbekümmerten Mann, der morgens das Haus verließ, mit der Kutsche in seinen Club fuhr und abends gut gelaunt wieder heimkam.
Doch alles Sparen half nichts, und so beschlossen ihre Eltern, Ashfield samt Dienstboten zu vermieten und für eine Weile nach Frankreich zu ziehen, wo das Leben erschwinglicher war.
Die Ehe ihrer Eltern war für Agatha ein Juwel, das man still betrachtet und an dem man sich erfreute. Ihre Eltern liebten sich aufrichtig, sie gingen rührend und behutsam miteinander um, als wagten sie nicht, in Gegenwart des anderen auch nur die Stimme zu erheben. Irgendwann, das wusste sie schon früh, wollte Agatha auch ein solches Juwel haben. Sie wäre gern Pianistin oder Sängerin, eine glückliche Ehe zu führen jedoch stand an erster Stelle.
In Frankreich hatte ihr Vater bereits zweimal einen Arzt aufsuchen müssen, der eine Nierenkrankheit diagnostiziert hatte. Zurück in England, wurde es nicht besser, und er begab sich in die Hände seines Hausarztes. Der stellte jedoch eine andere Diagnose, und so wurden weitere Ärzte, alles sogenannte Spezialisten, zu Rate gezogen. Jeder stellte eine andere Diagnose und hielt sie für die richtige. Am Ende wusste man gar nicht mehr, woran ihr Vater erkrankt war.
Er wurde schwächer, litt unter Atemnot.
Agatha litt mit ihm, und sie litt auch mit ihrer Mutter, die nicht von seiner Seite weichen wollte. Nie zuvor hatte sie sie so verzagt, so niedergeschlagen erlebt.
Auch die finanziellen Sorgen ebbten nicht ab. Ihr Vater hatte auch Häuser in New York geerbt, die verpachtet waren, aber praktisch nichts abwarfen. Irgendwann kam zu seinem ohnehin angeschlagenen Gesundheitszustand eine Erkältung hinzu, die zu einer Lungenentzündung wurde.
Agatha stromerte unruhig und voll böser Vorahnung durch das Haus. Würde er sterben? Würde ihr geliebter Vater von ihr gehen?
Als sie die Treppe hochkam, sah sie, wie ihre Mutter mit einem erstickten Schluchzen aus dem Schlafzimmer gelaufen kam und im Zimmer nebenan verschwand. Der Schlüssel wurde umgedreht, und Agatha stand wie erstarrt da, das Herz pochend bis zum Hals, das Blut rauschte wie Seewind in ihren Ohren.
Ihr Vater war tot. Sie wusste es, bevor es ihr jemand sagte.
Das war der Tag, an dem ihre Kindheit jäh endete.
Danach lebte sie allein mit ihrer Mutter und ein paar wenigen Dienstboten in Ashfield. Die Angst, auch ihre Mutter zu verlieren, wollte sie manchmal übermannen, doch das hatte sie verheimlicht, um ihrer Mutter nicht noch mehr Kummer zu bereiten.
Agatha hatte ein paar Stunden schlafen können, doch als sie aufstehen wollte, war es, als gehörten ihre Beine nicht zu ihrem Körper. Nie zuvor hatte sie sich so elend, so krank gefühlt. Sie war stets eine äußerst robuste Person gewesen, nicht zimperlich, nicht wehleidig. Jetzt jedoch meinte sie, ernstlich krank zu werden oder es bereits zu sein. Sie verspürte weder Hunger noch den leisesten Appetit. Wann hatte sie überhaupt das letzte Mal etwas zu sich genommen? Sie erinnerte sich nicht.
Wie schon am vorherigen Tag und den Tagen davor wanderte Agatha rastlos durchs Haus. In einem der Zimmer fand sie einen Umschlag mit mehreren Fünfpfundnoten darin und schließlich, eingewickelt in einem Strumpf, die Diamantbrosche ihrer Großmutter. Überrascht und nun zielstrebiger suchte sie weiter: unter dem Bett, ganz hinten im Kleiderschrank, darauf und darunter – dazu musste sie sich flach auf den Bauch legen und mit dem ausgestreckten Arm fischen – und anschließend sogar unter einer losen Bodendiele. Wer konnte schon wissen, was ihre Großmutter – Agatha hegte keinerlei Zweifel, dass sie es gewesen war – sonst noch versteckt hatte?
Bäuchlings blieb sie auf dem Läufer liegen, die Augen geschlossen. Nach wenigen Minuten stand sie wieder auf.
Sie würde den Wagen nehmen und ein bisschen umherfahren. Vielleicht würde sie das auf andere Gedanken bringen und wenigstens für eine Weile ablenken.
Ausgehfertig stand sie kurz darauf vor ihrem Wagen, den sie an der Straße geparkt hatte. Mit einer Hand strich sie über die Motorhaube, die in der Sonne glänzte. Das Automobil hatte sie sich selbst zum Geschenk gemacht.
Der Himmel war fast wolkenlos, die Vögel zwitscherten, und es roch nach Meer, süßen Blüten und reifen Kirschen.
Torquay war ein hübsches kleines Städtchen an der Südküste; ein Erholungsort mit mildem Klima und daher sehr beliebt bei Touristen, die gern am Strand entlangpromenierten und sich den meist lauen Wind um die Nase wehen ließen. Die Gärten der Bewohner waren gepflegt, manche sehr überschaubar, andere weitläufig wie ein Park. Die meisten waren von einer Hecke umgeben, viele auch von einer Steinmauer, über die man dennoch leicht hinwegklettern konnte. Und auf denen es sich herrlich und manchmal auch recht wagemutig herumbalancieren ließ. Wieder wurde Agatha kurz in ihre Kindheit zurückkatapultiert. Wie oft hatte ihre Mutter geschimpft, wenn sie mal wieder von den mit Moos bedeckten Steinen abgerutscht war und sich die Knie aufgeschrammt hatte.
Ein älteres Ehepaar spazierte an Agatha vorbei, grüßte freundlich und schlenderte weiter. Touristen, ging ihr durch den Kopf, sie genießen das Leben, den Sommer, ihre Zweisamkeit.
Sie hörte sich seufzen. Ich sollte aufhören, mich zu quälen, dachte sie und beugte sich kopfschüttelnd hinunter und griff nach der Handkurbel. Ein sehr flüchtiges Gefühl von kindlicher Vorfreude auf eine kleine Spazierfahrt erfasste sie. Es war so herrlich, mit dem Automobil umherzubrausen.
Das Gefühl verging so rasch wieder, wie es gekommen war, und sie schämte sich, dass sie überhaupt so empfunden hatte. Wie konnte sie auch nur den Hauch von Glück empfinden, wo sie doch in Trauer war!
Agatha drehte die Kurbel. Drehte und drehte. Drehte erneut.
Der Motor sprang nicht an. Sie streckte sich, versuchte es wieder. Verfluchter Wagen! Willst du wohl so gut sein!
Doch er gab keinen Mucks von sich. Sie spürte Tränen aufsteigen und fragte sich verwirrt, ob sie so verärgert war.
Sie nahm ihre Handtasche, die sie auf der Motorhaube abgelegt hatte, presste sie an ihre Brust und stapfte zum Haus zurück. Sie schloss auf, blieb fassungslos in der Diele stehen und schnappte nach Luft. Erst als sie laut schluchzte, bemerkte sie, dass sie weinte. Mit bebenden Schultern lief sie ins Wohnzimmer und warf sich auf das Sofa.
Irgendwann setzte sie sich auf und putzte sich die Nase, und das, was ihr durch den Kopf ging, fühlte sich ganz und gar nicht gut an. Vielmehr war es erschreckend und zutiefst beunruhigend. Ob sie dabei war, den Verstand zu verlieren?
Sie brach in Tränen aus, weil ihr Wagen nicht ansprang, das musste doch ein Zeichen sein, dass etwas mit ihr nicht stimmte.
Agatha griff nach einem der Kissen und schlang die Arme darum. Sie würde alles dafür geben, ihrer Mutter nur noch ein einziges Mal sagen zu dürfen, wie sehr sie sie geliebt hatte. Und wie sehr sie sie nun vermisste.
Aber sie würde sich mit ihren Erinnerungen zufriedengeben müssen, mehr hatte sie nicht.
I.
Die Jahre 1908—1910 Reisejahre
1.
Paris
Agatha saß auf dem Klavierschemel, die Hände auf den Tasten, die Augen geschlossen. Rücken und Schulterblätter schmerzten vor Anspannung.
Konzentrier dich!
Sie war bereits zwei-, dreimal ins Stocken geraten, hatte einen falschen Ton gespielt und wäre am liebsten im Erdboden versunken. Sie setzte erneut an und wusste schon da, dass es wieder ein falscher Ton war.
Ängstlich blickte sie nach rechts, wo Madame Legrand, ihre Klavierlehrerin, stand; die Miene besorgniserregend finster, der Mund verkniffen.
Agatha schwitzte. Sie hatte sich bereits bis auf die Knochen blamiert, nicht zum ersten Mal übrigens. Dabei hatte sie am Tag zuvor Beethovens Sonate Pathétique noch fehlerfrei spielen können, auch wenn sie ihr nicht leicht von der Hand gegangen war. Vielleicht sollte sie es endlich einsehen: Sie mochte die Vorstellung, Pianistin zu sein, aber sie spielte nur leidlich.
Besonders schlimm war es, wenn sie vor Publikum spielen sollte. Dann fühlten sich ihre Finger steif und unbeweglich an, als gehörten sie ihr gar nicht, unmöglich, damit über die Tasten zu gleiten.
»Mademoiselle Miller.« Madame Legrand räusperte sich. »Vielleicht lassen wir es gut sein.« Ein Seufzen, das deutlich machte, dass sie ein hoffnungsloser Fall war. »Am besten, Sie und Ihre Mutter reisen zurück nach England.«
Bevor sie heulen würde, sprang Agatha auf und rannte zur Tür. Und dort begriff sie, dass sie träumte.
Mit einem erleichterten »Huh!« fuhr sie hoch und setzte sich im Bett auf. Das Kopfkissen war feucht, vermutlich nicht von ihren Tränen, sondern vom Schweiß. »Gott sei Dank, nur ein Traum«, murmelte sie und sank zurück aufs Laken.
Sie war fünfzehn gewesen, als sie mit ihrer Mutter nach Paris kam, um ein Mädchenpensionat zu besuchen. Mehr als zwei Jahre war das nun her, im Spätsommer wurde sie achtzehn.
Das Pensionat, das schon ihre Schwester Madge besucht hatte, hatte sich verändert. »Es geht damit bergab«, meinte ihre Mutter. Und Agatha ahnte, was das bedeutete: dass sie sich bereits nach einem neuen Pensionat umsah. Ihre Mutter fackelte nie lange, und wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, musste es angegangen werden. So oder so. Ernüchterungen, Enttäuschungen schreckten sie nicht im Geringsten. In Windeseile hatte sie neue Pläne.
Agatha liebte es, mit der Metro oder dem Bus durch die Stadt zu fahren und über den Blumenmarkt zu schlendern. Nicht allein, versteht sich, sondern stets in Begleitung einer älteren Frau, die Madame Legrand oder ihre Mutter ihr zur Seite stellte. Als junges Fräulein hatte man in Paris nicht allein umherzustreifen, das wusste Agatha natürlich längst. Es würde ein schlechtes Licht auf die Erziehung werfen und noch dazu die Herren womöglich auf dumme Gedanken bringen.
Daheim in England sah man es ein wenig lockerer.
Agatha wusste, dass sie sich besser früher als später einen Ehemann suchen müsste. So recht behagte ihr die Vorstellung nicht, weil ihr bislang noch kein Mann begegnet war, in den sie sich verlieben könnte. Aber was nicht war, konnte ja noch werden.
Sie besuchte leidenschaftlich gern das Museum, das Theater und die Oper. Alles saugte sie auf wie ein Schwamm.
Bis ihre eigensinnige Mutter ihr wie befürchtet eröffnete, dass es besser war, das Pensionat zu wechseln. »Wie gesagt, Agatha, es geht bergab, und ich will, dass du eine vernünftige Ausbildung erhältst.«
Und so kam Agatha zu Miss Dryden, die zwölf Mädchen in ihrer Obhut hatte; Engländerinnen, Amerikanerinnen und natürlich Französinnen. Agatha mochte das Pensionat. Der Unterricht machte ihr Spaß, sicher auch, weil das Hauptaugenmerk auf der Musik lag. Da sie in England keine Schule besucht hatte, sondern von ihrer Mutter unterrichtet worden war, genoss sie vor allem aber das Zusammensein mit ihren Mitschülerinnen. Das Plaudern, Kichern und Herumalbern und das Tuscheln über hübsche junge Burschen.
Abend für Abend, wenn Agatha in ihrem Bett lag, sagte sie sich, dass aus ihr vielleicht ja doch noch eine mehr als passable Klavierspielerin werden könnte. Doch so recht mochte sie nicht mehr daran glauben.
Agatha sang auch für ihr Leben gern und nahm Gesangsstunden bei Monsieur Boué, einem Opernsänger mit schöner Baritonstimme. Er wohnte in einem mehrstöckigen Haus ohne Aufzug. In England hatte Agatha Golf, Kricket und Tennis gespielt, war geritten und mit großer Begeisterung Rollschuh gelaufen. Bewegung war sie folglich gewöhnt, das Treppensteigen hinauf in den fünften Stock jedoch bereitete ihr Probleme. Keuchend und schwer atmend kam sie bei Monsieur Boué an.
Er musterte sie ohne jegliches Mitgefühl und meinte, sie solle sich erstens nicht so haben und zweitens sei es kein Wunder, dass sie so schnaufe, sie würde ja vollkommen falsch atmen.
Wie konnte man falsch atmen? Agatha war es schleierhaft, doch sie wollte ihn nicht verärgern.
Monsieur Boué klopfte auf ihre Schulterblätter und befahl ihr, tief Luft zu holen. Das tat sie, und er eilte davon, um ein Maßband zu holen, das er um ihren Oberkörper schlang, dort, wo sich ihr Zwerchfell befand. »Und nun atmen Sie schön tief ein und aus, Mademoiselle. Himmel, doch nicht so! Was tun Sie da?«
»Ich atme.«
»Falsch, ganz falsch.« Er schüttelte den Kopf, seufzte fassungslos und machte es ihr vor.
Agatha musste grinsen, konnte es aber verbergen.
»Singen ist eine Frage des Atmens. Versuchen Sie es wieder, Mademoiselle, nur nicht aufgeben.«
»Ich würde nie aufgeben zu atmen«, erwiderte sie, und er bedachte sie mit strengem Blick.
»Das richtige Atmen ist eine ernste Angelegenheit, Mademoiselle. Wie wollen Sie singen, wenn Sie nicht richtig atmen?«
»Tja …«
Monsieur Boué schnalzte mit der Zunge, betrachtete das Maßband, das sich hob und senkte und nickte schließlich. »Schon besser.«
Ihre Stimme war »akzeptabel«, wie er behauptete, doch er riet ihr, es mit Mezzosopran zu versuchen, um die mittlere Stimmlage zu entwickeln. Beim Singen umkreiste er sie, die Arme verschränkt, das Kinn auf die rechte Hand gestützt, und murmelte vor sich hin. »Wie lange sind Sie schon in Paris, Mademoiselle?«
»Zwei Jahre, Monsieur.«
»Sie sprechen recht gut Französisch.«
»Merci.«
Wäre doch auch ihre Grammatik so gut, aber die ließ sehr zu wünschen übrig. Agatha hatte gelernt, sich die französische Sprache nach Gehör anzueignen, und sie war gut darin. Hieß es aber, sie solle das, was sie eben gehört hatte, niederschreiben, standen Wörter auf dem Papier, die ihre Lehrer schier verzweifeln ließen. »Nicht autel, Mademoiselle, sondern hôtel«, bekam sie zum Beispiel zu hören. »Und es geht nicht um Ihren Glauben, sondern um die gebratene Leber. Foie, Mademoiselle, nicht foi.«
»Aber es klingt vollkommen gleich, und ich dachte …« Es war egal, was sie dachte, sie verwechselte auch weiterhin ähnlich klingende Wörter.
»Noch mal von vorn«, ordnete Monsieur Boué an und stellte sich vor sie hin. »Mund weit auf. Weiter.«
Wenn er mir noch tiefer in den Hals schaut, wird er sehen, was ich zu Mittag gegessen habe, dachte sie und verschluckte sich, weil sie lachen musste.
Er sah sie fragend und ein wenig empört an, als verstünde er beim besten Willen nicht, was so lustig war.
»Pardon.« Sie räusperte sich.
»Tzz.« Er schüttelte wieder den Kopf.
Er wird heute Abend Nackenschmerzen haben, ging ihr durch den Kopf, und erneut zwickte es sie im Zwerchfell.
»Sie möchten Sängerin werden?«, fragte er plötzlich.
»Oui. Oder Pianistin. Oder beides.«
»Soso.« Er sah sie an. »Na, wir werden sehen.«
Verstohlen schaute sie auf die Kaminuhr. Zeit für einen Tee. »Mademoiselle?«
»Pardon.« Einen wunderbar heißen, belebenden Tee, dazu ein, zwei Scones oder etwas Ingwergebäck. Ihr Magen knurrte, und sie unterdrückte ein Seufzen.
Als sie später die Tür hinter sich schloss, musste sie das Heimweh niederringen. Sie war gern in Frankreich, aber Frankreich war nun mal nicht England. Außerdem hatte sie das ungute Gefühl, von ihrem Ziel, eines Tages eine berühmte Musikerin zu sein, weiter entfernt denn je zu sein.
Unermüdlich lernte Agatha weiter, machte Fortschritte und genoss das Leben. Genauso unermüdlich kämpfte sie gegen das Heimweh. Einmal hörte sie zufällig, wie sich drei Mitschülerinnen über sie unterhielten. »Sie ist so herrlich verschroben, findet ihr nicht? Aber sie ist nett.«
Verschroben?, hatte sie verwundert gedacht. Was war an ihr verschroben?
Theatermitglieder der Comédie Française kamen ins Pensionat und hielten Vorträge, zum Beispiel über Molière, und Sänger des Konservatoriums sangen für sie. Es war wundervoll, und Agatha saß stets in der vorderen Reihe und applaudierte am lautesten. Ihre Lehrerin Madame Legrand schaute sie dann und wann missbilligend an, und sie tat so, als sähe sie es nicht.
»Sie müssen lernen, Ihr Temperament zu zügeln«, würde sie sich später anhören müssen.
Abends besuchten die jungen Studentinnen hin und wieder die Comédie Française, und Agatha hielt vor Aufregung die Luft an, als die berühmte Sarah Bernhardt die Bühne betrat. Sie hatte sie sich ganz anders vorgestellt und raunte Marie, die neben ihr saß, ins Ohr: »Ich gebe zu, ich bin ein bisschen enttäuscht.«
»Wieso?«
»Sie ist so … alt.«
Das stimmte, dennoch strahlte die Bernhardt Würde und Eleganz aus.
Miss Dryden bot einen Schauspielkurs für die Studentinnen an, an dem Agatha mit Begeisterung teilnahm und besonders gern tragische Heldinnen spielte. Sie legte sich mächtig ins Zeug, hob die Stimme und gestikulierte theatralisch.
»Das war recht schön, Mademoiselle«, meinte Miss Dryden hinterher. »Aber weniger ist manchmal mehr.«
Seit einiger Zeit besuchte Agatha den Klavierunterricht bei Monsieur Fürster, der kein Franzose, sondern Österreicher war.
Er war ein guter, wenn auch überaus strenger, wenn nicht gar angsteinflößender Lehrer. Während sie spielte, schritt er durchs Zimmer, schaute in die Töpfe seiner Zimmerpflanzen, begutachtete deren Blätter, nickte oder schüttelte auch den Kopf, wenn er vergessen hatte zu gießen, spazierte weiter, nahm ein Buch aus dem Regal und schlug es auf. Er blätterte darin, murmelte etwas, klappte es wieder zu und stellte es zurück.
Anfangs hatte Agatha geglaubt, er sei gar nicht bei der Sache.
Warum nahm er Schülerinnen auf, wenn ihn ihr Spiel überhaupt nicht interessierte? Nur des Geldes wegen?
Bis sie eine falsche Note spielte, er plötzlich neben ihr stand und am Klavierdeckel rüttelte. Erschrocken hatte sie die Finger zurückgezogen.
»Mademoiselle!«, rief er fassungslos. »Was war das denn gerade?«
»Pardon, Monsieur«, sagte sie leise, den Blick beschämt gesenkt.
»Pardon?« Er schnaubte. »Damit ist es nicht getan, Mademoiselle! Wollen Sie mich oder gar Chopin beleidigen?«
»Oh, das war ganz und gar nicht meine …«
»Mon dieu!« Er wollte sich gar nicht beruhigen, als nähme er die falsch gespielte Note persönlich.
Doch mit der Zeit gewöhnte Agatha sich an seine sonderbaren Ausbrüche und verstand, dass seine Verehrung für Chopin der Grund dafür war. Jede falsche Note tat ihm in der Seele weh.
»Spielen Sie nicht nur mit den Händen, Mademoiselle«, sagte er einmal, als er neben dem Klavier stand und einem Walzer lauschte. »Sie müssen Chopin auch mit dem Herzen spielen.« Er neigte den Kopf, und sie bildete sich ein, es sei ein Zeichen von Wohlwollen. Er schürzte die Lippen und nickte. »Das war schon recht ordentlich. Noch einmal von vorn, Mademoiselle Miller.«
2.
Beliebt waren auch die Sonntagsspaziergänge mit Miss Dryden im Bois de Boulogne, einem herrlichen Waldgebiet.
An diesem sonnigen Nachmittag gingen die jungen Mädchen paarweise nebeneinanderher, manche hatten sich untergehakt, und schnatterten unablässig. Miss Dryden ließ sie, vermutlich, weil sie selbst tief in Gedanken versunken schien. Die Hände auf dem Rücken spazierte sie vor ihnen her, den Blick mal in den Himmel, mal in die Bäume gerichtet. Dann und wann huschte ein versonnenes Lächeln über ihr Gesicht, und Agatha fragte sich, ob sie wohl gerade an einen Mann dachte.
Im Wald gab es einen bezaubernden See mit glasklarem Wasser, in dem das Sonnenlicht glitzerte, das durch die Baumkronen fiel. Die jungen Mädchen blieben stehen und schwiegen ehrfürchtig. Er war so wunderschön anzuschauen.
Ein Reiher landete am Ufer und stolzierte gemächlich umher. Miss Dryden legte den Finger auf die Lippen. »Schsch, Mesdemoiselles«, wisperte sie. »Wir wollen ihn nicht aufschrecken.«
»Ich wünschte, ich hätte meinen Zeichenblock dabei«, flüsterte Helène, die neben Agatha stand.
»Und ich wünschte, ich könnte meine Kleider abstreifen und ins Wasser springen.«
Helène sah sie an, als habe sie ihr anvertraut, den Reiher zum Abendessen verspeisen zu wollen. »Du möchtest baden gehen?« Es klang angeekelt.
»Zu gerne.« Agatha seufzte schwer.
»Ganz ohne, ähm Kleider?«, raunte Helène schockiert.
»Ich könnte schlecht in meinem besten Sonntagskleid in den See springen, oder?«
Der Reiher stob auf, und Miss Dryden sah die beiden anklagend an.
Es ging weiter. Die Schar war kaum ein paar Schritte vom See entfernt, als plötzlich ein Mann vor ihnen auf dem Weg stand. Helène war so erschrocken, dass sie nach Agathas Hand griff und fest zudrückte. Sie schlug die Hand vor den Mund, wahrscheinlich, um einen Schrei zu unterdrücken.
Agatha dagegen war mehr überrascht als erschrocken. Wo war der Mann hergekommen? Und wieso um alles in der Welt trug er keine Hosen? Am Oberkörper vornehm mit Jackett und Weste gekleidet, war er von der Taille an vollkommen unbekleidet.
So schnell, wie er aufgetaucht war, verschwand er wieder hinter einem der Bäume. Ihre Augen mussten ihr einen Streich gespielt haben. Warum sollte ein Mann ohne Hosen im Wald umherlaufen? Sie wünschte, sie könnte mit Miss Dryden darüber sprechen, doch deren Gesichtsausdruck verhieß nichts Gutes.
Den Sonnenschirm schwenkend, nein, vielmehr drohend, stürmte sie an ihr vorbei. »Was fällt Ihnen ein, Monsieur!«, rief sie aufgebracht. Hatte sie vor, den Mann zu verfolgen? Und ihre Schützlinge sich selbst zu überlassen?
Agatha war fasziniert, so hatte sie Miss Dryden noch nie erlebt. Andererseits war auch noch nie etwas Derartiges vorgefallen.
Miss Dryden blieb stehen, reckte den Schirm in die Luft und wandte sich schließlich zu den jungen Mädchen um, die betreten dastanden, die Blicke auf ihre Schuhspitzen gerichtet. »Mesdemoiselles.« Sie rang nach Atem. »Das, was Sie gerade glauben, gesehen zu haben, vergessen Sie am besten so schnell wie möglich wieder. Haben Sie verstanden?«
Die Mädchenschar schwieg, die Wangen gerötet, der Rest ihrer Gesichter blass. Ein paar nickten, ohne den Kopf zu heben.
»Hast du gesehen, was ich gesehen habe?«, flüsterte Helène.
»Ich weiß es nicht«, musste Agatha zugeben.
»Er hatte keine Hosen an«, wisperte Helène schockiert. »Wenn ich das maman erzähle …«
»Dann lässt du’s besser.« Agatha gluckste.
»Findest du das etwa komisch?«
»Nein, eigentlich nicht.« Sie bemühte sich um ein ernstes Gesicht, doch es wollte ihr nicht gelingen. »Wie Miss Dryden hinter ihm hergelaufen ist.«
Helène kicherte leise. »Ja, und wie sie mit dem Schirm gefuchtelt hat.«
Während sie weiterspazierten, fragte Agatha sich, ob sie ihrer Mutter davon erzählen würde.
Ein paar Tage hielt sie es aus, dann jedoch sprudelte es aus ihr hervor. »Wir waren neulich mit Miss Dryden im Wald, und plötzlich stand ein Mann vor uns.« Sie machte eine bedeutungsvolle Pause, wollte es spannend machen. »Er trug keine Hosen.«
Ihre Mutter sah sie verwundert an, dann schnappte sie hörbar nach Luft. »Wie bitte? Ich höre ja wohl nicht recht!«
»Du hättest Miss Dryden sehen sollen, Mama. Mit ihrem Schirm ist sie hinter ihm her. Aber er war schon fort, irgendwo zwischen den Bäumen verschwunden.«
Ihre Mutter errötete bis zu den Ohrläppchen. »Und? Hast du …« Sie räusperte sich verlegen. »Hast du etwas … sehen können?«
»Wie gesagt, er trug keine Hosen.«
»Das meinte ich ja, Agatha. Hast du …« Ein Hüsteln. »Hast du ihn angestarrt? Ich meine, hast du genau hingeschaut?«
Nun errötete auch Agatha. »Natürlich nicht, Mama.«
»Schwörst du’s?«
»Bei meinem Leben.«
»Nun werde nicht gleich dramatisch, Agatha.«
»Es ging alles viel zu schnell. Darf ich dich etwas fragen, Mama? Warum läuft ein Mann ohne Hosen durch einen Wald? Ich begreife das nicht.«
Ihre Mutter hob die Augenbrauen und hüstelte wieder. »Kannst du dir das nicht denken?«
»Würde ich dich dann fragen?«
»Er hat Freude daran, sich vor jungen Mädchen zu entblößen.«
»Aber warum?« Sie verstand es wirklich nicht.
Ein gedehntes Seufzen ließ sie vermuten, dass ihre Mutter mit ihren Fragen überfordert war. »Manche Männer sind einfach so, Agatha. Besser kann ich es dir nicht erklären, fürchte ich.«
Damit gab Agatha sich vorerst zufrieden, aber bei Gelegenheit wollte sie ihre Schwester danach fragen.
Im Sommer veranstaltete Miss Dryden gelegentlich Tanznachmittage, zu denen ehemalige Schülerinnen eingeladen waren.
Agatha bekam von ihrer Mutter für die kommende Party ein neues Kleid in Taubengrau, das sie sehr liebte. Es stand ihr gut, der Stoff war angenehm leicht und fließend. Ihr langes Haar dagegen bereitete ihr Probleme, ohne Hilfe kam sie nicht damit zurecht. Aber so ging es allen jungen Mädchen, und man half sich gegenseitig. Flocht Zöpfe, wickelte auf, steckte hoch, schob Kämme und Spangen hinein. Agathas Haar war noch dazu lockig, so dass es etliche Kämme brauchte, um es einigermaßen zu bändigen. Aber sie wurde um ihr Haar beneidet.
Zur Party war diesmal eine frühere Schülerin eingeladen, die inzwischen mit einem Grafen verheiratet war. Sie hatte geschrieben, dass sie ihren Sohn mitbringen würde, der ungefähr im Alter der Schülerinnen war. Miss Dryden hatte ihnen am Tag vor der Party davon berichtet. »Er wird mit Ihnen allen tanzen, Mesdemoiselles, da bin ich sicher. Aber ich bitte Sie, sich Ihrer guten Erziehung zu erinnern. Überrennen Sie ihn nicht.«
Die eine oder andere kicherte hinter vorgehaltener Hand.
»Gaffen Sie nicht und fassen Sie ihn bloß nicht an«, ergänzte Gisèle flüsternd Miss Drydens Ermahnung.
Agatha, die neben ihr in der Bank saß, unterdrückte ein Prusten. Aber gespannt war sie schon auf ihn.
Seit sie Alexandre Dumas gelesen hatte, glaubte sie fest daran, dass junge Männer etwas Heldenhaftes an sich hatten. In ihrem Kopf spielten sich besondere Szenen ab: ein gut aussehender Bursche kam auf einem dunklen Pferd aus einem Wald. Selbstverständlich ritt er ausgezeichnet. Er war elegant, aber nicht zu elegant gekleidet, hatte einen gepflegten Schnauzbart und eine wohlklingende Stimme. Eine Stimme, mit der er sie, Agatha, bat, zu ihm aufs Pferd zu steigen. »Ich möchte Sie hinunter zum Bach bringen und Ihnen die Salamander zeigen, die ich eben entdeckte«, würde er sagen und die Hand ausstrecken. Nein, er würde natürlich absteigen und ihr aufs Pferd helfen. Und natürlich wäre er beeindruckt, wie sicher sie im Sattel saß und ihre Haltung loben. »Ich sehe, wir beide reiten gern«, würde er sagen und lächeln. Und ihr Magen würde sich zusammenziehen und ihr Herz stürmisch pochen. In diesem Moment wäre sie sicher, dass sie ihn heiraten würde. Vorher hätten sie vermutlich noch das eine oder andere Abenteuer zu bestehen, er würde sie mit seinem Leben beschützen, und sie würde es genießen. Er war ihr Held, ein Held mit Namen Aramis oder Porthos.
»Warum grinst du denn so?«, wisperte Gisèle, und sie fuhr zusammen. Hatte sie gegrinst?
»Er heißt Rudi«, raunte Gisèle, und damit war es um Agatha geschehen.
Um einen Lachanfall zu verschleiern, presste sie beide Hände vor den Mund und bot einen Hustenanfall dar, der in einer Erstickung zu enden drohte.
Miss Dryden kam herbeigelaufen. »Mon dieu, was hat sie denn nur?« Sie klopfte Agatha auf den Rücken, fächelte ihr Luft zu.
»Stehen Sie auf, Mademoiselle.« Sie zog Agatha vom Stuhl hoch. »Und jetzt beide Arme über dem Kopf ausstrecken. So ist’s gut. Und tief ein- und ausatmen.«
Rudi sah in der Tat recht gut aus, aber er hatte nichts, aber auch gar nichts von einem strahlenden Helden. Und er kam auch nicht auf einem dunklen Pferd, er kam mit der Kutsche, stieß sich den Kopf beim Aussteigen und blickte sich kurz um. Als er die jungen Mädchen entdeckte, die sich vor dem Haus aufgereiht hatten, um die Gäste zu begrüßen, huschte etwas wie Entsetzen über sein Gesicht. Vielleicht hatte Agatha sich aber auch getäuscht. Wieso sollte er entsetzt sein? Er rang sich ein flüchtiges Lächeln ab und streckte die Hand aus, um seiner Mutter beim Aussteigen behilflich zu sein. Sie war bildschön und trug ein wunderhübsches Kleid mit Rüschen. Oh, sie sah so vornehm, so würdevoll aus!
Ein Raunen ging durch die Mädchenreihe, und Miss Dryden zischte: »Mesdemoiselles!«
Rudi begrüßte jede Einzelne mit Diener und Handkuss und murmelte: »Enchanté.«
Seine Mutter schritt langsam die Reihe ab, schenkte jeder ein Lächeln und sagte schließlich mit heller, wohlklingender Stimme: »Ich war gern hier, und ich vermisse das alles. Sie sind zu beneiden.«
Wie überaus freundlich von ihr! Miss Dryden nickte erfreut und führte sie und ihren Sohn ins Haus.
Die Mädchenschar folgte ihnen in gebührendem Abstand.
Rudi forderte jede Einzelne zum Tanz auf, und die meisten konnten es kaum erwarten, bis er endlich zu ihnen kam und sie auf die Tanzfläche geleitete. Als Agatha an der Reihe war, musste sie zugeben, dass es kein sehr beeindruckendes Erlebnis war. Als Sohn eines Grafen hatte er sicher eine exzellente Erziehung genossen, und er benahm sich wirklich vorbildlich. Er war auch ein recht guter Tänzer und Gesprächspartner, doch er war auch furchtbar … farblos. Ein anderes Wort fiel Agatha nicht ein, so sehr sie auch später darüber nachdachte, während sie ihm und Gisèle beim Tanzen zusah.
»Was meinst du denn damit?«, fragte Helène, als sie ihr davon erzählte.
»Ich weiß es nicht«, gab sie zu und zuckte die Schultern. »Er hatte nichts Interessantes zu erzählen, lächelte immer nur und … Ach, ich weiß es eben nicht.«
»Aber es ist doch sehr schön, wenn jemand immer lächelt.«
»Nicht, wenn er gar nichts anderes macht.«
»Hmm«, darüber schien ihre Freundin nachdenken zu müssen.
Als Agatha schlafen ging, überkam sie ein eigenartiges Gefühl. Sie hatte begriffen, dass Romantik und Heldentum nicht in die wirkliche Welt passten. Sie gehörten in Bücher und auf die Theaterbühne. Das wahre Leben sah anders aus. Da bekam ein junger Mann rote Ohren, wenn er mit einem Mädchen tanzte, er glitt aus, weil der Tanzboden gebohnert war und stammelte herum, wenn er eine Unterhaltung begann.
Schließlich sagte sie sich, dass sie es positiv betrachten sollte. Es war vielleicht gut, wenn sie ihre romantischen, verklärten Jungmädchenträume endlich begrub und stattdessen den Tatsachen ins Auge blickte. Wer keine allzu großen Träume hatte, konnte nicht enttäuscht werden.
3.
Ein weiteres Schuljahr neigte sich dem Ende, und die jungen Mädchen wurden mit jedem Tag unruhiger und plapperten lauter. Gisèle und Helène würden zu ihren Familien nach Südfrankreich zurückkehren, und viele andere würden ebenfalls heimreisen. Agatha war an diesem Tag bereits im Morgengrauen aufgestanden und hatte lange am Fenster gestanden und zugesehen, wie die Sonne über der Stadt aufging. Ein überwältigend schöner Anblick, der sie jedes Mal wieder in Staunen versetzte.
An diesem Nachmittag wollte eine bekannte Pianistin kommen, die früher Schülerin bei Miss Dryden gewesen war. Die jungen Mädchen sollten ihr etwas vorspielen.
Agatha betete, dass sie davonkommen würde. Sie war grauenvoll darin, anderen vorzuspielen. Sobald sie am Klavier saß, wurde eine andere aus ihr. Eine Agatha mit zwei linken Händen, die bebend vor Anspannung über den Tasten verharrten, und einem Gehirn, das verzweifelt versuchte, sich an die folgenden Noten zu erinnern. Tags zuvor hatte sie noch leichthändig gespielt, sogar dazu gesungen. Aber da hatte sie ja auch nur für sich gespielt.
Ich werde es gehörig vermasseln, dachte sie, als sie die berühmte Pianistin begrüßte und ein wenig Konversation machte. Und als es dann hieß: »Mademoiselle Miller wird Ihnen etwas vorspielen«, brannte ihr Gesicht, als hätte sie zu nahe am Kamin gesessen. Auf wackeligen Beinen ging sie zum Klavier, setzte sich umständlich und richtete eine Ewigkeit den Rock ihres Kleides.
Konzentrier dich und bleib ruhig. Schön tief ein- und ausatmen. Du schaffst das!
Als ob! Gleich bei der ersten Strophe verspielte sie sich, die Wangen glühend vor Scham, und stammelte: »Pardon, ich fange noch mal an.«
Sie hörte, wie Miss Dryden sich räusperte und wünschte, der Fußboden würde sich auftun und sie mitsamt Klavier und Schemel verschlingen und erst wieder ausspeien, wenn alles vorbei war. Wenn alle gegangen waren und sie und ihr jämmerliches Spiel vergessen hätten.
Nach dieser entsetzlichen Blamage fasste Agatha sich ein Herz und fragte ihren Klavierlehrer, ob sie sich, wenn sie sich kräftig ins Zeug legen und alles in die Waagschale werfen würde, zu einer Konzertpianistin mausern könnte.
Monsieur Fürster war freundlich und höflich wie immer, wahrscheinlich brachte er es nicht über sich, ihr die Wahrheit zu sagen. Die schonungslose Wahrheit. »Nun, Mademoiselle«, begann er zögernd. »Sie sind recht talentiert ohne Frage.«
Das klang nach einem Aber, und das kam prompt. »Aber ich glaube, Sie sind nicht dazu gemacht, vor Publikum zu spielen.«
Agatha atmete heftig aus. »Es ist dieses verflixte Lampenfieber. Wenn ich das nur irgendwie ablegen könnte.«
»Lampenfieber sorgt dafür, dass man sein Bestes gibt, Mademoiselle.« Er schenkte ihr ein Lächeln, vielleicht ein kläglicher Versuch sie aufzumuntern, auch wenn er bereits resigniert hatte. »Bei Ihnen sieht das jedoch anders aus. Ihr Lampenfieber spornt Sie nicht an, es lähmt Sie. Es tut mir sehr leid.«
»Merci, Monsieur. Merci, dass Sie nicht um den heißen Brei herumreden.« Sie meinte es ernst, sie war froh, dass er nicht sagte, sie müsse sich bloß anstrengen, dann habe sie sich irgendwann daran gewöhnt, vor Publikum zu spielen.
Agatha hatte Aufrichtigkeit schon immer geschätzt, sie brauchte niemanden, der sie mit Samthandschuhen anfasste. Sie konnte die Wahrheit aushalten.
Sie erzählte ihrer Mutter davon, die wie üblich nicht viel Federlesens machte und auch nicht in Hoffnungslosigkeit verfiel, weil die jüngste Tochter nicht so begabt war, wie man geglaubt hatte. »Ich fürchte, es liegt auch an deinem Temperament, Agatha. Du musst lernen, es zu zügeln, es zu beherrschen. Es kommt dir immer wieder in die Quere. Als Konzertpianistin müsstest du dich im Griff haben, egal, wie schlimm dein Lampenfieber wäre.«
»Ich werde nie eine Konzertpianistin sein, Mama.«
»Gleichgültig, was du aus deinem Leben machst, Schatz, dein Temperament darf dir nicht in die Quere kommen.«
Ihre Mutter hatte ja recht, mit allem, was sie sagte. Nur, wie beherrschte man sein Temperament? Wie stellte man das an, und konnte man es wirklich lernen?
Am Sonntag darauf stand Agatha eine Ewigkeit vor dem Kleiderschrank. Sie konnte sich nicht für ein Kleid entscheiden. Sie war lustlos und missgestimmt, wusste jedoch nicht recht, warum. Es war offen ausgesprochen worden, was sie schon lange wusste, sich aber nicht hatte eingestehen wollen. Es wäre zu schön gewesen, als Pianistin durch die Welt zu reisen und die Menschen zu erfreuen. Nun hing sie in der Luft, und das war etwas, was sie überhaupt nicht mochte. Sie brauchte ein Ziel, einen Plan, und zwar schnell. Andererseits wollte es gut überlegt sein.
Mit einem Seufzen ließ Agatha sich aufs Bett fallen.
Dann schlug ihre Stimmung um, und mit einem Ruck setzte sie sich auf. Sie würde das hellgraue Kleid mit dem hübschen Rüschenkragen anziehen. Mit einer Drehung tanzte sie zum Schrank, nahm das Kleid vom Bügel und hielt es sich an. So tanzte sie weiter durchs Zimmer, drehte Pirouetten und summte ein Lied, das ihr spontan in den Kopf kam.
Es klopfte, und sie blieb stehen. Das Klopfen konnte sie sofort ihrer Mutter zuordnen: einmal kräftig, zweimal etwas weniger energisch.
»Komm nur herein, Mama.«
Ihre Mutter trat ein. »Kannst du durch die Tür schauen?«
»Ein besonderes Talent.«
»Was machst du da, Agatha?«
»Ich tanze.«
»Mit deinem Kleid?«
»Jemand anderes war leider nicht zur Stelle.« Sie legte das Kleid sorgfältig aufs Bett und streckte die Arme aus. »Es sei denn, du bist bereit für ein Tänzchen.«
Ihre Mutter lachte kopfschüttelnd, nahm ihre Hände und tanzte mit ihr einmal linksherum, dann gleich wieder rechtsherum, bis ihr schwindelig wurde. »Puh!« Sie hielt an und blinzelte.
Vorsichtig ging sie zum Toilettentisch und zog sich den Stuhl heran. »Bist du so gut und hilfst mir mit meinem Haar?«
Sie seufzte wohlig, als ihre Mutter mit geschickten, äußerst sanften Händen begann, ihr Haar zu entwirren und zu bürsten.
»Ich habe mir etwas überlegt, Agatha. Wir werden zum Ende des Schuljahres nach Torquay zurückreisen.« Es klang entschlossen, und doch war herauszuhören, dass sie mit sich reden lassen würde, sollte Agatha bitten, doch weiterstudieren zu wollen.
»Au!« Agatha runzelte die Stirn, als ihre Mutter eine Haarsträhne aufwickelte und feststeckte.
»Mehr hast du nicht zu sagen?«
»Nein, ich bin einverstanden, Mama.« Das Heimweh hatte sie nie so ganz niederringen können, oft hatte es irgendwo hinter einer Bemerkung, einem besonderen Geruch oder einer Erinnerung gelauert und sie hinterrücks überfallen. Aber sie hatte sich Mal um Mal damit getröstet, dass es ja nicht für ewig wäre und sie früher oder später nach England zurückkehren würde. »Findest du mich eigentlich verschroben, Mama?«
»Wie bitte? Wie kommst du denn darauf?«
»Eine Mitschülerin nannte mich so.«
»Verschroben.« Ihre Mutter schnalzte mit der Zunge. »Du bist Engländerin, Liebling.« Als erklärte das alles. Sie wechselte das Thema. »Es wird Zeit, dich in die Gesellschaft einzuführen. Halt bitte still, ja? Die Zeit wird kommen, und du wirst nach einem Ehemann Ausschau halten.« Ihre Mutter sah sie an und lächelte. »Wäre das nicht schön? Du heiratest einen netten, aufmerksamen Mann und bekommst ein paar hübsche Kinder.«
»Ein paar?« Wieder verzog Agatha das Gesicht. Sie erinnerte sich noch gut an den überwältigenden Leib ihrer Schwester. Dass auch sie eines Tages so aussehen könnte, war ihr vollkommen unvorstellbar erschienen. Als sie ihren kleinen Neffen später im Arm halten durfte, hatte sie sich gefragt, wie er in Madges Bauch passen konnte. Schlimmer noch, wie er wohl aus ihr herausgekommen war. Über diese körperlichen Vorgänge sprach man für gewöhnlich nicht. Am besten, man dachte auch gar nicht groß darüber nach.
»Na, du würdest ja erst mal mit einem anfangen.« Ihre Mutter lachte.
Agatha nicht.
»Wir werden sehen.« Ihre Mutter legte Bürste und Kamm weg, zupfte hier und da und nickte. »Fertig. Dann ist es also abgemacht, dass wir heimfahren?«
»Ja, es ist abgemacht.«
4.
Torquay
Der Winter war vorbei, das hatte Agatha an diesem Morgen mehr als deutlich gespürt, gesehen und gerochen. Die ersten Hyazinthen schauten aus der Erde, und der Fliederstrauch war voller dicker Knospen. Glitzernder Tau lag auf dem Gras, und der Gesang der Vögel in den Bäumen war in eine andere Tonart übergegangen.
Agatha hatte eine Handvoll Narzissen gepflückt und in eine Vase auf den Wohnzimmertisch gestellt. Sie warf einen Blick auf die Kaminuhr und runzelte die Stirn. Es war ungewöhnlich, dass ihre Mutter so lange schlief. Ob sie sich nicht wohlfühlte?
Ausgerechnet heute, wo sie eine Dinnerparty geben wollte?
Es war schon alles vorbereitet, die Möbel glänzten, genau wie der Fußboden, auf dem am Abend hoffentlich ausgiebig getanzt wurde. Es duftete nach Frühlingsblühern und Bohnerwachs und je näher man der Küche kam, nach lauter Leckereien, die die Köchin zubereitet hatte.
Agatha lief die Treppe hinauf, blieb stehen und lauschte, ob aus dem Schlafzimmer etwas zu hören war. Nein. Also ging sie zur Tür und klopfte zaghaft, dann etwas kräftiger. »Mama? Du schläfst doch nicht etwa noch?«
»Nein, komm rein, Agatha.« Das klang ganz und gar nicht nach ihrer energischen Mutter.