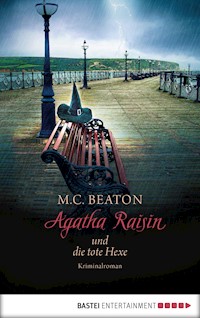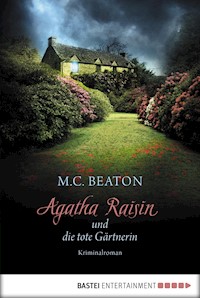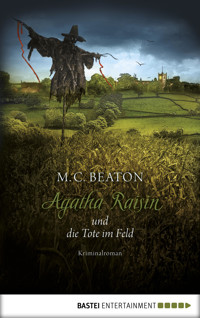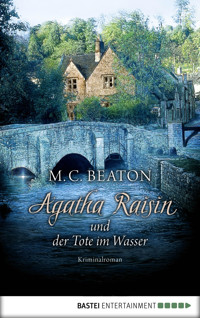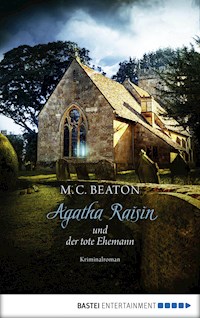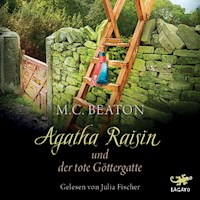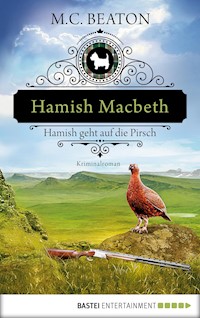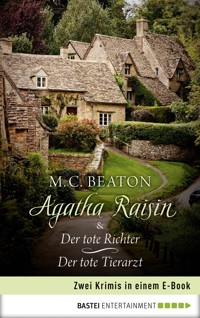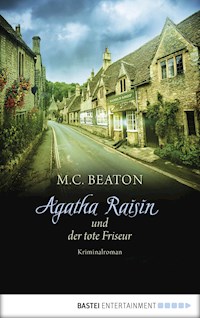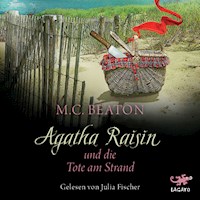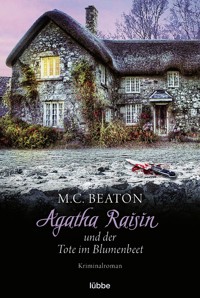
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Krimi
- Serie: Agatha Raisin Mysteries
- Sprache: Deutsch
Stille Nacht, tödliche Nacht
Agatha Raisin hat mit Weihnachten zwar nicht viel am Hut, aber ihr kleines Dorf Carsely war schon immer stolz auf seine Festtagstraditionen. Dieses Jahr jedoch hat John Sunday, ein Beamter der Sicherheitsbehörde, gerade die besinnlichen Tage als Zeitpunkt gewählt, um gegen das vorzugehen, was er als grobe Fahrlässigkeit ansieht: so ziemlich alles. Selbst der Weihnachtsbaum entpuppt sich als Sicherheitsrisiko. Doch damit ist Sunday eindeutig zu weit gegangen. Kein Wunder, dass er bald tot im Vorgarten des Pfarrhauses gefunden wird. Agatha übernimmt den Fall, aber bei so vielen Leuten, die dem Opfer feindlich gesinnt waren, weiß sie kaum, wo sie mit der Suche nach dem Mörder beginnen soll ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 281
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Epilog
Über das Buch
Stille Nacht, tödliche Nacht
Agatha Raisin hat mit Weihnachten zwar nicht viel am Hut, aber ihr kleines Dorf Carsely war schon immer stolz auf seine Festtagstraditionen. Dieses Jahr jedoch hat John Sunday, ein Beamter der Sicherheitsbehörde, gerade die besinnlichen Tage als Zeitpunkt gewählt, um gegen das vorzugehen, was er als grobe Fahrlässigkeit ansieht: so ziemlich alles. Selbst der Weihnachtsbaum entpuppt sich als Sicherheitsrisiko. Doch damit ist Sunday eindeutig zu weit gegangen. Kein Wunder, dass er bald tot im Vorgarten des Pfarrhauses gefunden wird. Agatha übernimmt den Fall, aber bei so vielen Leuten, die dem Opfer feindlich gesinnt waren, weiß sie kaum, wo sie mit der Suche nach dem Mörder beginnen soll ...
Über die Autorin
M. C. Beaton ist eines der zahlreichen Pseudonyme der schottischen Autorin Marion Chesney. Nachdem sie lange Zeit als Theaterkritikerin und Journalistin für verschiedene britische Zeitungen tätig war, beschloss sie, sich ganz der Schriftstellerei zu widmen. Mit ihren Krimi-Reihen um die englische Detektivin Agatha Raisin und den schottischen Dorfpolizisten Hamish Macbeth feierte sie große Erfolge in über 17 Ländern. Sie verstarb im Dezember 2019 im Alter von 83 Jahren.
M. C. BEATON
Agatha Raisin
und derTote im Blumenbeet
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Sabine Schilasky
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Deutsche Erstausgabe
Für die Originalausgabe:Copyright © 2010 by M. C. BeatonPublished by Arrangement with M. C. BEATON LIMITEDTitel der englischen Originalausgabe:»Agatha Raisin and the Busy Body«M. C. BEATON® and AGATHA RAISIN® are registered trademarks of M. C. Beaton LimitedDieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.
Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2023 by Bastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6–20, 51063 Köln
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Umschlaggestaltung: Kirstin OsenauUmschlagmotiv: © Arndt Drechsler, LeipzigeBook-Erstellung: two-up, DüsseldorfISBN 978-3-7517-4215-3
luebbe.delesejury.de
Für Hope Dellonin Liebe
Eins
Nachdem sie festgestellt hatte, dass die Liebe zu ihrem Exmann James Lacey mehr oder minder verpufft war, beschloss Agatha Raisin, die nicht mehr ganz junge Inhaberin einer Detektei in den englischen Cotswolds, sich auch von einer zweiten Obsession zu trennen.
Die letzten zwei Jahre war Agatha entschlossen gewesen, das perfekte Weihnachtsfest auszurichten, den kompletten Dickens’schen Traum; beide Male mit enttäuschendem Ergebnis. Daher wollte sie in diesem Jahr Weihnachten entfliehen und einen langen Urlaub auf Korsika machen. Ihre rechte Hand im Büro, Toni Gilmour, war mehr als imstande, mit den üblichen hässlichen Scheidungsfällen und vermissten Haustieren zurechtzukommen, die das täglich Brot der Detektei waren.
Agatha hatte sich ein Hotelzimmer in Porto Vecchio im Süden der Mittelmeerinsel gebucht. Den Ort hatte sie im Internet recherchiert und erfahren, dass es sich um eine alte genuesische Hafenstadt mit Wintertemperaturen um die zwanzig Grad handelte.
Sie kam spät im Hotel an, weil sie über eine Stunde gebraucht hatte, bis sie am Flughafen Figari ein Taxi fand. Nun freute sich Agatha darauf, Weihnachten mit einem Hummerdinner zu feiern. Kein Truthahn mehr.
Die Rezeptionistin begrüßte sie mit den Worten: »Sie haben bei uns für drei Wochen gebucht. Warum?«
Agatha blinzelte verwirrt. »Warum? Ich mache Urlaub!«
»Aber was wollen Sie hier tun?«, fragte die Frau. »Die meisten Geschäfte und Restaurants sind geschlossen, und Sie haben kein Auto. Es gibt nicht viele Taxis hier, und die, die wir haben, nehmen ungern kurze Fahrten an.«
»Ich überlege mir etwas«, antwortete Agatha erschöpft. »Jetzt habe ich Hunger. Haben Sie ein Restaurant?«
»Nein, aber wenn Sie aus dem Hotel nach rechts und dann die nächste Straße links hinauf zur Festung gehen, finden Sie dort einige Restaurants.«
Agatha ließ ihr Gepäck zurück und machte sich auf zu dem steilen Anstieg. Die Weihnachtsdekoration war die schönste, die sie jemals gesehen hatte, doch die Straßen waren wie ausgestorben. Sie gelangte zu einem Platz in der Mitte der alten Festung. Dort hatten zwei Restaurants geöffnet, und in der Platzmitte befand sich eine leere Schlittschuhbahn, die von Männern mit Wasser befüllt wurde, damit es über Nacht gefror. Agathas Stimmung wurde noch mieser. Sie hatte nicht gedacht, dass es auf Korsika Frost geben könnte.
In einem der Restaurants gab es einen beheizten Außenbereich für Raucher. Dort setzte sie sich und bestellte sich ein Essen, das sich als nichts Besonderes entpuppte, aber stolze zweiundvierzig Euro kostete, was satten zweiundvierzig Pfund entsprach.
Agatha rauchte eine Zigarette und rang mit sich, ob sie ein Auto mieten sollte oder nicht. Das Problem war, dass sie nicht seitlich einparken konnte. Genau genommen kamen für sie gar keine Parklücken in Betracht, in die nicht auch ein Lastwagen passen würde. Hier hingegen standen die Wagen überall dicht an dicht. Wie parkten die überhaupt aus, ohne die Autos vor und hinter sich zu rammen?
Doch Agatha wollte sich keine Niederlage eingestehen, nach Hause zurückkehren und sagen müssen, sie hätte einen Fehler gemacht. Was sie brauchte, war eine Nacht ungestörter Schlaf, weiter nichts. Sie trottete durch die verlassenen Straßen mit den funkelnden Lichterkränzen um sämtliche Laternen zurück zum Hotel.
Am nächsten Tag schien die Sonne. Nach einem anständigen Frühstück erkundigte sich Agatha nach dem Weg zum Hafen, wo sie sicher war, ein paar sehr gute Fischrestaurants zu finden. »Es gibt eine Abkürzung von der Festung nach unten«, sagte die Frau an der Rezeption, »aber die ist furchtbar steil.« Ein schmerzhafter Stich fuhr durch Agathas arthritische Hüfte. »Was ist mit dem Weg an der Straße entlang?«, fragte sie. »Wie lange brauche ich da?«
»Ungefähr eine halbe Stunde.«
Also ging Agatha los. Und ging und ging, bis sie sich anderthalb Stunden später am Hafen wiederfand. Dort hatte ein Restaurant geöffnet, bot jedoch keinen Hummer an. Sie bestellte sich ein Lachssteak, das Angebot des Tages, und dachte, dass sie das Gleiche auch leicht in England bekommen hätte. Nach dem Essen bat sie die Kellnerin hoffnungsvoll, ihr ein Taxi zu rufen. Doch keines wollte sie fahren. »Sie nehmen nur längere Strecken von einer Stadt zur anderen an«, erklärte die Kellnerin.
Also beschloss Agatha, es mit der Abkürzung zur Festung zu probieren. Der Weg war unglaublich steil. An einer Stelle wollte sie schwören, dass das Pflaster fast senkrecht vor ihr aufzuragen schien. Der Schmerz in ihrer Hüfte war enorm, und sie keuchte auf dem gesamten Weg nach oben. Als sie den Platz erreichte, sank sie in einem Restaurant auf einen Stuhl und bestellte sich ein Bier. Sie holte ihre Zigaretten hervor, steckte sie jedoch gleich wieder weg, weil sie noch vom Aufstieg aus der Puste war.
Ich muss hier weg, dachte sie. Bonifacio soll schön sein. Verdammt, ich miete mir einen Wagen und fahre dorthin. Da muss es Hummer geben.
Im Hotel googelte sie Bonifacio auf ihrem Laptop. Sie las, dass der Hafen sehr exklusiv war und viele gute Restaurants bot. Auf den Klippen oberhalb des Hafens gab es eine mittelalterliche Stadt. Viele Hotels schienen nicht geöffnet zu haben, doch Agatha fand eines, das vielversprechend aussah, und buchte dort, wobei sie vorsichtshalber angab, sie wisse noch nicht, wie lange sie bleiben würde.
Als sie früh am nächsten Morgen mit ihrem Mietwagen losfuhr, war sie froh, dass kein Verkehr auf den Straßen herrschte und alles gut ausgeschildert war. Während die Sonne aufging, um einen weiteren schönen Tag zu versprechen, und es hinauf in die Berge ging, war Agatha glücklich. Es würde doch alles gut.
Wie sich herausstellte, lag das Hotel außerhalb der Stadt. Man gab ihr in der Anlage ein kleines Haus, das mit seinem alten Stein und dem roten Ziegeldach wie aus einem Märchenbuch anmutete. Darin waren ein großes Wohnzimmer, ein Schlafzimmer und ein Bad mit einer gigantischen Wanne. Im Hotel wurde nur Abendessen serviert, also fuhr Agatha nach dem Auspacken zum Hafen.
Praktisch alle Restaurants hatten geschlossen. In der kurzen Zeit seit ihrer Ankunft hatte sich der Himmel verdunkelt. Ein eisiger Wind bog die Palmen entlang des Hafens und heulte in der Takelage der Jachten, die am Kai vertäut waren. Agatha aß in einem der wenigen noch offenen Restaurants. Das Essen war gut, obwohl es auch hier keinen Hummer gab. Weil sie unbedingt die Altstadt sehen wollte, fuhr Agatha hinterher dort hinauf und fand sich in einem beängstigenden Labyrinth verteufelt enger Gassen wieder. Mehrmals hätte sie beinahe eine Schramme in den Wagen gefahren, und wiederholt verirrte sie sich, bevor sie schließlich eine Straße zurück zum Hafen entdeckte und erleichtert aufatmete. Regen klatschte gegen die Windschutzscheibe.
»Ach verdammt, ich geb’s auf!«, rief Agatha den gleichgültigen Elementen entgegen. »Ich fahre nach Hause.«
Bis sie in Charles de Gaulle ankam, hatte sie Halsschmerzen und verfluchte die Tatsache, dass sie von Terminal E2 statt von 2F weiterfliegen musste. Dieser Terminal war riesig und verwirrend, und der Check-in verlief chaotisch. Der einzige Lichtblick war, als sie ihr Gepäck durch die Sicherheitsschleuse brachte und der Mann um ihren Pass bat. Er betrachtete das Foto. »Dies, Madame, ist das Foto einer schönen Frau, und Sie sind heute sogar noch schöner.«
Agatha war mit der französischen Neigung zum Flirten vertraut. »Monsieur, solch ein Kompliment von einem gut aussehenden Mann wie Ihnen gibt mir das Gefühl, wahrhaftig schön zu sein«, antwortete sie. Er lächelte, alle Kollegen in der Sicherheitsschleuse lächelten, und Agatha wurde warm ums Herz. Sind die Franzosen nicht wunderbar, wenn es ums Flirten geht, dachte sie. Es war eine Technik, die in England mit der Einführung der Antibabypille verloren gegangen war. Flirtete man in ihrem Heimatland mit einem Mann, hörte man lediglich: Jetzt lass den Quatsch, und zieh dich aus.
Das Gate für den Flug nach Birmingham war im Untergeschoss. Dann wurden alle Passagiere in einen Bus geschickt, der so lange zum Flugzeug unterwegs war, dass Agatha sich schon fragte, ob sie bis nach Calais gebracht wurden.
Auf der Fahrt hinunter nach Carsely und zu ihrem Cottage überlegte sie, dass sie Weihnachten hier genauso gut ignorieren konnte wie auf Korsika. Dennoch schaute sie automatisch zu dem Weihnachtsbaum oben auf dem Kirchturm. Nur dass dort gar keiner war. Verwundert blinzelte sie. Jedes Jahr leuchtete der Weihnachtsbaum von dem eckigen Kirchturm herab. Agatha fuhr um den Dorfanger, und auch hier fehlte der alljährliche Baum. Dasselbe galt für die Lichterketten, die üblicherweise über die Hauptstraße gespannt waren.
Im Geiste zuckte Agatha mit den Schultern. Wahrscheinlich waren alle zur Vernunft gekommen und hatten genug von dem kommerziellen Brimborium um Weihnachten. Andererseits konnte man der Kirche schwerlich vorwerfen, konsumorientiert zu sein. Agatha ahnte ja nicht, dass ein einzelner Mann hinter dieser Dunkelheit steckte und dieser Mann Tod und Angst in die Cotswolds bringen sollte.
Alles hatte an dem Tag nach ihrem Abflug gen Korsika begonnen. Da war der Vikar Alf Bloxby mit zwei kräftigen Helfern und einem Weihnachtsbaum die steile Treppe hinauf zum Kirchendach gestiegen. Oben angekommen, waren sie gerade auf der Suche nach der Truhe mit den Kabeln, um den Baum festzuzurren, als eine Stimme unten vom Turmeingang rief: »Stopp!«
Alf drehte sich verwundert um. Unten stand Mr. John Sunday vom Amt für Gesundheit und Arbeitsschutz in Mircester.
»Sie dürfen den Baum nicht aufstellen«, sagte er. »Er ist eine Gefahr für die Öffentlichkeit, denn er könnte vom Turm fallen und jemanden erschlagen.«
Mr. Sunday war ein kleiner Mann mit gewölbtem Brustkorb, streitlustiger Miene und dichtem, graumeliertem Haar. »Kraft meiner Befugnis als Officer des Gesundheitsamts von Mircester sage ich Ihnen, sollten Sie darauf bestehen, den Baum aufzustellen, bringe ich Sie vor Gericht«, erklärte er. »Darüber hinaus werde ich ein Absperrband um die Grabsteine auf dem Kirchhof anbringen.«
»Warum das denn?«, rief Alf.
»Weil sie umkippen könnten.«
»Hören Sie mal, Sie dummer Mann, diese Grabsteine stehen da seit Jahrhunderten und sind noch nie umgefallen.«
»In Yorkshire ist ein Grabstein umgefallen und hat jemanden verletzt. Es ist meine Aufgabe, für Sicherheit zu sorgen.«
»Ach, gehen Sie mir weg.« Alf schnaubte verdrossen. »Kommt, Leute, stellen wir den Baum auf.«
Zwei Tage später erhielt der Vikar ein offizielles Schreiben vom Amt, das ihn anwies, den Baum herunterzuholen. Andernfalls würde ihm eine Klage drohen.
Der Gemeinderat von Carsely wurde informiert, sollte man Lichterketten auf der Hauptstraße anbringen wollen, wäre es untersagt, Leitern zu benutzen. Stattdessen müsse ein Hubwagen benutzt werden, den ausschließlich ausgewiesene Fachkräfte bedienen dürften. Das wiederum hätte für das Dorf Kosten von zweihundert Pfund für die entsprechenden Kurse plus Lohn und Hubwagenmiete bedeutet. Obendrein müssten alle Lichterbefestigungen einem »Zugtest« unterzogen werden, um sicherzustellen, dass sie der Belastung standhielten. Straßenlaternen als Halterungen wurden als zu unsicher bewertet.
John Sunday verdiente sich den Spitznamen Rammschädel-John, während seine Unbeliebtheit wuchs. Dem Dorfladen wurde mitgeteilt, dass die Warenregale aus Holz, die seit den Zeiten Königin Victorias dort standen, auszutauschen seien, »falls jemand mit der Hand über die Fächer streicht und sich einen Splitter zuzieht«. Der Dorfschule wurde befohlen, nachts in sämtlichen Räumen Licht brennen zu lassen, »damit unbefugte Eindringlinge nicht stolpern und zu Fall kommen«.
Und Kinder wurden vor dem Spielen mit »Spielgeld« gewarnt, nachdem festgestellt wurde, dass auf diesem ein Bild der Queen fehlte.
Rammschädel-John fühlte sich mit jedem seiner Berichte wichtiger und glaubte, der Hass, der ihm von den Dorfbewohnern entgegenschlug, wäre auf Neid zurückzuführen.
All dies erfuhr Agatha, als sie einen Tag nach ihrer Rückkehr ihre Freundin aufsuchte, die Vikarsfrau Mrs. Bloxby. Doch zu Mrs. Bloxbys Verwunderung schien Agatha nicht sonderlich an den Missetaten von Rammschädel-John interessiert. Insgesamt wirkte sie sehr gleichgültig. Auf die Frage, wann sie wieder arbeiten wollte, antwortete sie vage: »Wahrscheinlich irgendwann nach Neujahr.«
Mrs. Bloxby hatte sich oft gewünscht, ihre Freundin würde ihren albernen Obsessionen entwachsen. Jetzt jedoch fand sie, dass Agatha ohne jedwede Obsession irgendwie leblos schien.
Agatha Raisin war nach wie vor eine elegante Erscheinung. Sie hatte dickes, schimmerndes braunes Haar, makellose Haut und hübsche Beine, war aber leider um die Taille herum recht rund und hatte kleine, bärenartige Augen. An diesem Tag trug sie einen maßgeschneiderten, dunkelblauen Hosenanzug aus Kaschmir über einer goldfarbenen Seidenbluse. Doch ihre Mundwinkel waren nach unten gebogen, und ihr Blick schien stumpf.
»Unser Frauenverein trifft sich heute Abend mit dem von Odley Cruesis. Kommen Sie doch mit. Dort ist man ebenfalls Mr. Sunday zugeteilt worden, und die Frauen möchten mit uns zusammen besprechen, was wir tun können. Sie sind schon lange nicht mehr bei den Treffen gewesen.«
»Ich kenne dort niemanden«, antwortete Agatha. »Immer mehr Leute hier verkaufen, und die, die neu dazu ziehen, werden beständig älter.«
»Abgesehen von Miss Simms und mir haben Sie die früheren Mitglieder auch nicht sonderlich gemocht«, wandte Mrs. Bloxby ein. »Ach, kommen Sie bitte mit.« Ihre für gewöhnlich milde, angenehme Stimme bekam einen scharfen Unterton. »Was wollen Sie denn sonst machen? Zu Hause sitzen und grübeln?«
Agatha sah ihre Freundin erschrocken an. Im Frauenverein war es Tradition, dass sie einander siezten, was noch aus vergessenen Zeiten rührte, als man es für vulgär hielt, sich mit Vornamen anzureden.
»Anscheinend interessiert mich nichts und niemand mehr«, gestand Agatha seufzend. »Na schön, ich fahre Sie hin. In Odley Cruesis bin ich noch nie gewesen.«
»Es ist ein hübsches Dorf. Mit netten Leuten. Das Treffen findet im Pfarrhaus statt. Die Vikarsfrau, Penelope Timson, kann hervorragend backen. Ihre Kuchen sind in der ganzen Nachbarschaft berühmt.«
Odley Cruesis war zehn Meilen von Carsely entfernt, und der Weg dorthin führte über frostglitzernde Straßen. Mit seinen alten Reetdachhäusern aus der Tudor-Zeit sah der Ort wie ein kleiner Teil von England aus, den die Zeit vergessen hatte. Zu Agathas Unglück standen die Wagen vor dem Pfarrhaus Stoßstange an Stoßstange. »Hier kann ich nie und nimmer einparken«, jammerte sie.
»Doch, können Sie«, erwiderte Mrs. Bloxby. »Gleich da ist eine Lücke.«
»Ich fahre keinen Mini!«, sagte Agatha.
»Dann lassen Sie mich für Sie einparken.«
Agatha stieg aus, und Mrs. Bloxby lenkte den Rover passgenau zwischen zwei andere Wagen, sodass zu beiden Seiten kaum mehr Platz blieb.
Agatha ging auf das Pfarrhaus zu. Sie konnte Stimmen hören und seufzte wieder. Kuchen und Langeweile. Warum war sie bloß hergekommen?
Das Wohnzimmer im Pfarrhaus war sehr groß, und es schienen an die fünfundzwanzig Frauen anwesend zu sein. Doch abgesehen von Miss Simms erkannte Agatha niemanden aus Carsely.
Mrs. Bloxby flüsterte enttäuscht, dass die anderen wohl entschieden hatten, nicht zu kommen. Agatha winkte Miss Simms zu, Carselys einziger lediger Mutter, die einen sehr kurzen Rock, spitze Halbstiefel und einen dieser unechten französischen Fischerpullover trug. An ihren Ohren baumelten lange Ohrringe. Im Kamin brannte ein Feuer, das ein weiches Licht in den Raum warf und hin und wieder eine Rauchwolke folgen ließ.
Agatha lehnte Tee und Kuchen ab, weil sie keine Lust hatte, mit Teller und Tasse zu balancieren. Und sämtliche gemütlichen Sessel waren besetzt. Es wurden zusätzliche Stühle hereingeholt. Agatha nahm Platz und fragte sich, wie lange dieser öde Abend dauern würde. Es war kalt im Zimmer. In eine Wand waren Terrassentüren eingebaut worden, die bereits vom Atem der frierenden Gäste beschlugen.
Mit Begeisterung wurde eine Frau begrüßt, von der Agatha schätzte, dass sie in den Siebzigern sein musste. Sie hatte ledrige, faltige Haut, dichtes schwarzes Haar mit grauen Strähnen und leuchtende blaugraue Augen. »Draußen ist es eisig«, sagte sie und legte ihren Mantel und ihre Pashmina-Stola ab. »Es heißt, dass wir heute Abend noch einen Schneesturm bekommen.«
»Wer ist das, und was ist das für ein Akzent?«, fragte Agatha.
»Mrs. Miriam Courtney, verwitwet, Südafrikanerin und Millionärin«, flüsterte Mrs. Bloxby. »Sie hat vor ungefähr zwei Jahren das Herrenhaus hier gekauft.«
Miriam blickte sich strahlend im Zimmer um. »Soll ich mich etwa auf einen dieser Stühle setzen, auf denen mir der Hintern taub wird?«
»Nehmen Sie meinen Sessel«, bot Miss Simms prompt an und machte ihren Platz frei.
Agatha verspürte einen Anflug von Eifersucht.
»Meine Güte, ist das kalt«, sagte Miriam. »Da drüben in dem Eimer ist Kohle. Wie wäre es, wenn Sie welche ins Feuer schütten, damit es richtig brennt?«
»Die ist nicht rauchfrei«, erwiderte Penelope Timson, eine große hagere Frau mit sehr großen Händen und Füßen und gebeugten Schultern, als hätte sie einen Buckel davon bekommen, sich jahrelang zu kleineren Gemeindemitgliedern zu beugen. Sie trug zwei Strickjacken über einem Pullover, einen weiten Tweedrock und eine Wollstrumpfhose, die kurioserweise in einem Paar pinkfarbener Plüschpantoffeln in Mäuse-Form endete. »Sie wissen doch, wie Mr. Sunday ist. Er läuft überall herum und sucht nach Rauch. Wir sollen nur Rauchfreies verbrennen.«
»Ach, hören Sie nicht auf ihn. Nur Mut! Werfen Sie ein paar Kohlestücke nach«, drängte Miriam.
Penelope beugte sich dem stärkeren Willen, nahm die Kohlenzange auf und legte einige Stücke auf das Feuer. Es loderte auf, doch nun qualmte es noch mehr.
»Verdammt, ich habe Brandy mitgebracht und ihn im Wagen gelassen. Den hole ich mal«, sagte Miriam. »Warten Sie nicht auf mich. Fangen Sie schon an.«
»Ich dachte, wir sollen nichts trinken, wenn wir noch fahren«, murmelte Agatha.
»Wahrscheinlich denkt sie an sich«, antwortete Mrs. Bloxby. »Und sie kann zu Fuß nach Hause gehen. Mich wundert, dass sie mit dem Wagen gekommen ist.«
»Mich wundert, dass überhaupt jemand von hier mit dem Auto unterwegs ist. Können die nicht alle zu Fuß kommen?«
»Vermutlich bewegen sich nur noch die Städter zu Fuß von A nach B«, sagte Mrs. Bloxby. »Auf dem Land scheint man dieser Tage sogar für wenige Meter das Auto zu nehmen.«
Penelope eröffnete das Treffen, und Agathas Gedanken schweiften ab. Vielleicht könnte sie das, was von ihrem Urlaub noch übrig war, retten und irgendwohin reisen, wo es warm war. Strandurlaube mochte sie allerdings nicht mehr, und Miriams Haut war ein Paradebeispiel dafür, was passierte, wenn man zu lange in der Sonne schmorte. Wie dämlich diese Gier nach Sonnenbräune war! Sie mochte in früheren Zeiten verständlich gewesen sein, als nur die Reichen im Winter verreisen konnten und Leute wie Jetsetter wirken wollten; aber heute konnte jeder Engländer an einen exotischen Ort fliegen und vorher noch ins Sonnenstudio gehen. Im Ernst, dachte Agatha, man lässt doch auch gutes Leder nicht in der Sonne liegen, wo es austrocknet und bricht, also warum stellt man das mit seiner Haut an? Sie erinnerte sich an den Slogan Black is beautiful. Was ja auch stimmte. Doch würde sie den Slogan White is beautiful erfinden, würde sie wohl wegen ethnischer Diskriminierung vor das Race Relations Board zitiert.
Dann wurde ihr bewusst, dass Penelope fragte: »Wo bleibt Mrs. Courtney? Sie müsste doch längst zurück sein. Hoffentlich ist sie nicht auf dem Eis draußen ausgerutscht.«
»Ich sehe mal nach«, bot Miss Simms direkt an.
Die Sitzung ging weiter. Beschreibungen von Rammschädel-Johns Untaten wanderten zu Agathas einem Ohr herein und zum anderen wieder hinaus. Sie fragte sich, wo ihr Exmann sein mochte, und überlegte, wie froh sie war, dass sie endgültig über ihn hinweg war, und wie leer ihr das Leben jetzt vorkam.
»Ich habe sie gefunden! Mrs. Courtney musste nach Hause fahren, um den Fusel zu holen. Der war nicht in ihrem Wagen«, rief Miss Simms von der Tür aus. Sie kam herein, dicht gefolgt von Miriam, und beide brachten Flaschen mit. Penelope ging raus und kehrte wenig später mit einem Tablett voller Gläser zurück.
Bald wurde überall höflich gemurmelt. »Ach, einer wird sicher nicht schaden.« »An solch einem frostigen Abend braucht man etwas.« »Oooh, nicht so viel!« Währenddessen wurde Brandy ausgeschenkt.
»Ich glaube, es gibt noch Schnee«, sagte Miriam. »Der Wind frischt auf.«
»Für Schnee ist es zu kalt«, entgegnete Agatha, die plötzlich den Wunsch verspürte, Miriam bei jedem Thema zu widersprechen, das sie aufbrachte.
Das Zimmer füllte sich mit Qualm. Penelope wedelte mit den großen Händen. »Ich muss den Schornsteinfeger kommen lassen.«
Sie blickte zu den Terrassentüren und schrie. Das Tablett mit den wenigen Gläsern, die noch darauf standen, fiel zu Boden. Alle sprangen auf und drehten sich ebenfalls zu den Türen um, und schon füllten weitere Schreie den verrauchten Raum.
John Sunday hatte das Gesicht und die blutigen Hände von außen an das Glas gepresst und sank langsam zu Boden, wobei er die Scheiben verschmierte. Durch das beschlagene Fensterglas wirkte das alles so unwirklich wie in einem Horrorfilm.
Jene lange Nacht sollte Agatha nie vergessen. Sie waren in dem kalten Wohnzimmer der Pfarrei gefangen, während draußen die Spurensicherung in ihren weißen Overalls arbeitete und ein Polizist Wache stand. Die Leute schienen ewig zu brauchen. Dann musste noch lange auf den Gerichtsmediziner gewartet werden. Nachdem er fertig war, trafen Detective Inspector Wilkes, Agathas Freund Detective Sergeant Bill Wong und Agathas Erzfeindin, die säuerliche Detective Sergeant Collins, ein. Einer nach dem anderen wurden sie befragt. Bill tat, als würde er Agatha nicht kennen, nachdem er ihr nur kurz zugeraunt hatte, er würde sie demnächst besuchen. Collins bestand darauf, dass sie alle ins Röhrchen pusteten, bevor man ihnen erlaubte, nach Hause zu fahren. Miriam und Miss Simms wurden zur eingehenderen Befragung mit auf die Wache genommen, weil sie als Einzige zwischendurch das Zimmer verlassen hatten.
Um das Elend noch zu steigern, war es bei Agathas und Mrs. Bloxbys Aufbruch draußen gerade warm genug geworden, dass dichter Schnee fiel. Die Wagen, die vor und hinter Agatha geparkt hatten, waren bereits fort.
Flocken tanzten hypnotisierend vor ihrer Windschutzscheibe und deckten alles weiß zu, als Agatha die enge Landstraße entlangfuhr.
Sie setzte Mrs. Bloxby am Pfarrhaus in Carsely ab und bewältigte die restliche Strecke durch weiße Wildnis.
Ihre schläfrigen Kater kamen, um sie im Haus zu begrüßen, und Agatha blickte auf die Uhr. Fünf Uhr morgens! Sie war hundemüde, dennoch juckte es sie in den Fingerspitzen. Ein Mord!
Ihr letzter Gedanke vor dem Einschlafen war, dass sie zurück ins Büro musste.
Spät am nächsten Tag wachte sie auf und stellte fest, dass sich der Schnee vor den Fenstern türmte und die Zentralheizung der Kälte nicht ganz gewachsen schien. In einem dicken Morgenmantel ging Agatha nach unten ins Wohnzimmer und zündete das Kaminfeuer an, das ihre Hilfe Doris Simpson schon vorbereitet hatte. Dann begab sie sich in die Küche, um sich Frühstück zu machen: eine Tasse schwarzen Kaffee. Sie kehrte wieder ins Wohnzimmer zurück und rief Toni Gilmour an, denn ihre junge Assistentin wohnte um die Ecke vom Büro und war gewiss schon dort.
»Wie war Ihr Urlaub?«, fragte Toni.
»Furchtbar. Aber das erzähle ich Ihnen später. Es hat einen Mord gegeben.«
Agatha schilderte, was geschehen war. »John Sunday scheint sich in den Dörfern so viele Feinde gemacht zu haben, dass es schwierig wird, den Schuldigen zu finden. Vielleicht hatte er auch bei der Arbeit welche. Könnten Sie sich beim Gesundheitsamt in Mircester umhören? Und bitten Sie Patrick, bei seinen alten Polizeikontakten nachzufragen, ob es irgendwelche Informationen gibt, wie genau der Mann gestorben ist«, endete sie.
Patrick Mulligan, ein pensionierter Polizist, arbeitete schon länger für Agatha, zusammen mit Phil Marshall, einem älteren Mann aus Carsely, Sharon Gold, einer lebhaften jungen Freundin von Toni, und Mrs. Freedman, der Sekretärin. Paul Kenson und Fred Auster hatten von der Detektei zu einer Sicherheitsfirma im Irak gewechselt.
Agatha blickte wütend hinaus zu dem immer noch fallenden Schnee. Sie machte sich ein Käsesandwich und noch einen Kaffee und schaltete die BBC-Nachrichten im Fernsehen ein. Auf dem Trafalgar Square fand eine Demonstration wegen der Erderwärmung statt, allerdings waren die Demonstranten inmitten des Schneetreibens kaum auszumachen. Geduldig sah Agatha sich die gesamte Sendung an, doch es kam nichts über den Mord an John Sunday.
Der Tag zog sich in eintönigem Weiß hin. Agathas zwei Kater, Hodge und Boswell, hockten an der Küchentür und wunderten sich, warum Agatha sie nicht nach draußen ließ.
Mittags klingelte das Telefon. Es war Toni. Sie sagte, dass Patrick wenig erfahren hatte, außer dass es laut Polizei so aussähe, als wäre Sunday mit einem Küchenmesser oder Ähnlichem erstochen worden. Er hatte sich zu wehren versucht, daher die Schnitte an seinen Händen und Unterarmen.
Agatha verfiel in eine schneebedingte Starre. Nachmittags schlief sie auf dem Sofa ein und wachte erst wieder auf, als es eine Stunde später an der Tür läutete.
Draußen war Miriam Courtney, die sich ein Paar Skier abschnallte. »Es hat aufgehört zu schneien, und da dachte ich mir, ich besuche Sie mal«, sagte Miriam. »Die Straßen sind noch nicht gestreut, aber die Farmer haben sie geräumt, und da habe ich mir meine Skier geschnappt. Gott sei Dank, dass es nicht mehr schneit! Wollen Sie mich nicht ins Haus bitten?«
»Entschuldigung«, antwortete Agatha. »Kommen Sie rein.«
Miriam lehnte die Skier draußen an die Mauer. »Kommen Sie mit in die Küche«, sagte Agatha. Sie mochte Miriam nicht, aber jede Gesellschaft war besser als gar keine. »Kaffee?«
»Gerne.« Miriam zog ihre Daunenjacke aus, nahm die Mütze ab und setzte sich an den Küchentisch.
»Was führt Sie her?«, fragte Agatha und machte sich an der Kaffeemaschine zu schaffen.
»Ich habe gehört, dass Sie eine Detektei haben, und möchte Sie anheuern. Ich bin nämlich die Hauptverdächtige.«
»Warum?«
»Weil ich, abgesehen von Miss Simms, die einzige Person bin, die für längere Zeit den Raum verlassen hatte. Außerdem ist bekannt, dass ich beim Gesundheitsamt angerufen und gedroht habe, Sunday umzubringen.«
»Warum?«
»Im Sommer öffne ich das Herrenhaus zweimal die Woche für Besucher. Es ist ein alter Tudor-Bau, und es werden recht viele Führungen gebucht. Sunday hat gesagt, der Zugang über die Eingangsstufen ist nicht barrierefrei, und ich müsste eine Rampe installieren. Dann hat man mir ein Metallungetüm vorgeschlagen, das sich über die halbe Einfahrt erstrecken würde. Ich habe gesagt, dass ich bisher nur wenige Besucher im Rollstuhl hatte und sie einfach rückwärts über die flachen Stufen ins Haus ziehe. Sunday hat behauptet, ohne Rampe dürfte ich keine Besichtigungen mehr durchführen. Und da habe ich gesagt, ich bringe diesen Mistkerl von Bürokraten um. Die Polizei ist heute Morgen mit einem Durchsuchungsbeschluss bei mir aufgekreuzt.«
»Wie sind die durch den Schnee gekommen?«, fragte Agatha, die Miriam eine Tasse Kaffee hinstellte.
»Irgendwie haben sie es in Land Rovers geschafft. Sie haben alle meine Küchenmesser mitgenommen. Ich möchte, dass Sie herausfinden, wer es wirklich war. Ich bin eine Außenseiterin im Dorf, und der Ärger geht schon los. Die zwei Frauen, die bei mir putzen, haben mich heute Vormittag angerufen und gesagt, sie wollen nicht mehr für mich arbeiten.«
»Weshalb müssen Sie das Herrenhaus für Besucher öffnen? Brauchen Sie das Geld?«
»Ganz und gar nicht. Aber ich genieße es, das Haus zu zeigen. Ich habe da ja sehr viel renoviert.«
»Hier habe ich keinen Vertrag, doch den schickt Ihnen mein Büro, damit Sie unterschreiben können. Fällt Ihnen jemand ein, der es gewesen sein könnte?«
»Er hat so viele Leute gegen sich aufgebracht, dass ich Ihnen nicht mal sagen könnte, wo Sie anfangen sollen. Hören Sie das! Endlich kommen die Streuwagen.«
»Gut«, sagte Agatha. »Allmählich bekomme ich hier einen Stubenkoller.«
»Ist da nicht jemand an der Tür?«
Agatha ging hin. Es war der dick vermummte Sir Charles Fraith, einer von Agathas engsten Freunden. »Himmel, ich dachte, ich komme nie hier an«, sagte er und stampfte sich Schnee von den Stiefeln. »Ich musste mir den Land Rover vom Gärtner leihen. Meine Einfahrt ist wie der Cresta Run in St. Moritz. Ich habe in den Morgennachrichten von dem Mord gehört.«
Charles folgte Agatha in die Küche, und sie stellte ihm Miriam vor. »Ein ›Sir‹«, sagte Miriam. »Wie vornehm!« Und zu Agathas Verärgerung gab sie sich beinahe kokett.
Miriam erklärte ihm den Grund ihres Besuchs. »Ah, das wird Aggie schon regeln«, verkündete Charles und nahm sich Kaffee.
Er war ein mittelgroßer Mann mit stets perfektem Haarschnitt und ebenmäßigen Gesichtszügen. Agatha fand ihn oft so eigenwillig wie ihre Kater. Er kam und ging in ihrem Leben und betrachtete ihr Cottage bisweilen als eine Art Hotel.
»Du hast deinen Schlüssel nicht benutzt«, sagte Agatha. »Hast du ihn verloren?«
»Nein, aber letztes Mal bist du sauer geworden, als ich einfach reingekommen bin.«
Miriam blickte die beiden mit neugierig blitzenden Augen an. »Sind Sie zwei ein Paar?«
»Nein!«, antwortete Agatha. »Tja, gehen wir es an. Ich würde gerne nach Odley Cruesis fahren und mal sehen, was ich dort ausgraben kann.«
»Ich fahre dich rüber«, sagte Charles. »Wie sind Sie hergekommen, Miriam?«
»Auf meinen Skiern.«
Charles lachte. »Was für eine Frau! Ich habe einen Dachgepäckträger, auf den wir Ihre Skier binden können. Dann fahren wir alle zusammen.«
Agatha wandte sich rasch ab, damit man ihr Stirnrunzeln nicht sehen konnte. Sie besaß nur wenige Freunde und war entsprechend besitzergreifend. »Ich gehe nach oben und ziehe mich um.«
Während Agatha sich warme Sachen anzog, hörte sie Miriams glockenhelles Lachen und Charles’ tieferes, verhaltenes von unten.
Ich wette, dass sie mich engagiert, ist ein Trick, dachte Agatha. Garantiert ist sie es gewesen. Lieber Gott, lass Miriam die Mörderin sein!
Zwei
Dies ist mein Prunkstück«, sagte Miriam stolz und führte sie in den großen Saal des Herrenhauses.
Charles blickte zu den blitzblanken Rüstungen, dem langen Tisch, den gekreuzten Hellebarden an den Wänden, den zerfransten Kriegsflaggen und den gasbetriebenen Wandfackeln und verkniff sich ein Grinsen. Er bezweifelte, dass sich in diesem Raum auch nur ein Originalstück befand. Aber Agatha war offensichtlich eifersüchtig auf Miriam, und ihm war danach, sie noch ein wenig aufzuziehen. Vielleicht erkannte sie dann einige ihrer schlechtesten Eigenschaften, wie etwa Aufdringlichkeit, bei Miriam wieder und schaltete einen Gang zurück.
»Entzückend!«, rief er aus.
Agatha fand, dass alles wie ein Bühnenbild aussah. »Also, kann ich Ihnen etwas zu trinken anbieten?«, fragte Miriam. »Ich habe das Gefühl, dass wir drei gute Freunde werden.« Doch dabei hatte sie Agatha den Rücken zugekehrt und strahlte Charles an.
»Ich denke, es wäre eine gute Idee, wenn wir anfangen«, entgegnete Agatha laut. »Und zwar beim Pfarrhaus.«
In dem kleinen Dreieck des Dorfangers im Zentrum von Odley Cruesis hatte man eine mobile Polizeiwache eingerichtet. Und der Bereich vor dem Pfarrhaus war mit Band abgesperrt. Vor der Tür stand ein Polizist.
Agatha duckte sich unter dem Absperrband durch, gefolgt von Miriam und Charles. »Sie dürfen hier nicht rein«, sagte der Polizist.
»Der Mord hat draußen stattgefunden«, erwiderte Agatha und zeigte zu der von einem Zelt geschützten Stelle vor der Terrassentür. »Es ist nur ein Freundschaftsbesuch.«
Der Polizist blickte hinüber zu der mobilen Wache, als erhoffte er sich Hilfe von dort, dann zu dem Zelt, in dem sich Schattenfiguren im Halogenlicht bewegten. »Warten Sie hier«, befahl er und ging zu der Wache.
Sie warteten bibbernd im Schnee, und Agatha fragte Miriam: »Was hat Sie in die Cotswolds verschlagen?«
»Ich bin vor Jahren im Urlaub hier gewesen und habe es nie vergessen. So schön und friedlich. Na ja, bisher jedenfalls. Oh, da kommt der Polizist.«
»Sie dürfen reingehen«, sagte er. »Mrs. Courtney?«
»Ja, das bin ich.«
»Sie sollen mit mir zur Polizeieinheit kommen. Man hat noch Fragen an Sie.«
»Also wirklich!«, beschwerte sich Miriam. »Sie haben mich schon fast die ganze Nacht wachgehalten. Dazu wird mein Anwalt noch einiges zu sagen haben, sobald er es durch den Schnee geschafft hat!«
Sie ging mit dem Polizisten weg, und Agatha klingelte an der Pfarrhaustür.
Penelope öffnete. Sie hatte dieselben Sachen wie gestern Abend an, und Agatha fragte sich, ob sie in ihnen geschlafen hatte. Penelope blinzelte sie kurzsichtig an. »Falls Sie von der Presse sind, ich habe nichts zu sagen.«
»Ich bin Agatha Raisin«, antwortete Agatha. »Und dies ist mein Freund, Sir Charles Fraith.«
Penelope strahlte. »Tut mir schrecklich leid, dass ich Sie nicht erkannt habe, Sir Charles. Letztes Jahr war ich bei dem Sommerfest auf Ihrem wundervollen Anwesen. Kommen Sie herein!« Sie schien vergessen zu haben, dass Agatha existierte.
Das Wohnzimmer im Pfarrhaus war kälter denn je. Vor dem noch schmutzigen Kamin stand ein zweistrahliger Elektroheizer. Ein großer hagerer Mann kam herein. »Dies ist mein Mann«, sagte Penelope und machte alle miteinander bekannt. Er schüttelte Agatha und Charles die Hände. »Ich bin Giles Timson«, stellte er sich mit einer hohen, dünnen Stimme vor. »Eine schlimme Geschichte, was? Setzen Sie sich doch bitte.«
»Ich bin eine Freundin von Mrs. Bloxby«, begann Agatha, die sich in einen Sessel neben dem Heizstrahler fallen ließ. »Und ich habe eine Detektei. Mrs. Courtney hat mich engagiert, damit ich ermittle.«
»Warum?«, fragte der Vikar. Er blickte auf Agatha herab wie ein erstaunter Reiher auf einen seltsamen Fisch in einem Teich. Der Mann hatte auch das passende graue Haar und eine lange, schmale Nase.
»Miriam scheint als Hauptverdächtige zu gelten.«