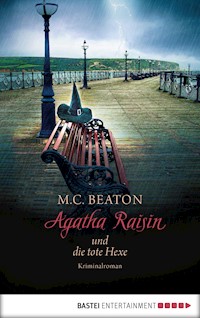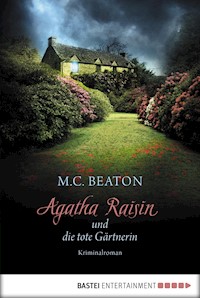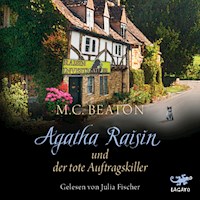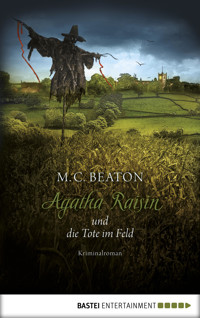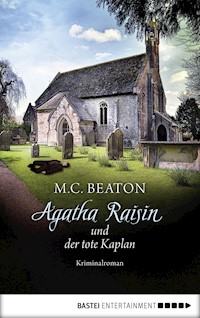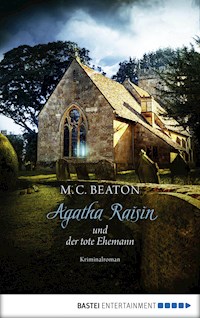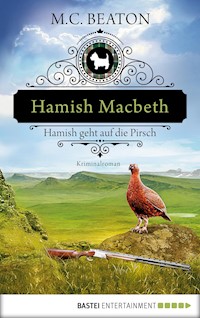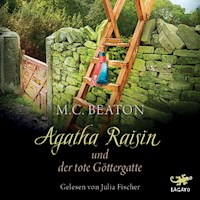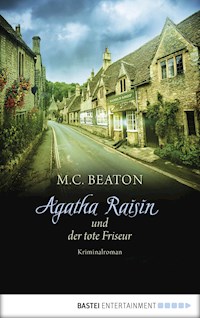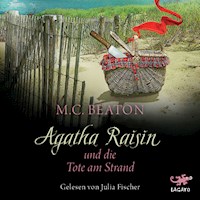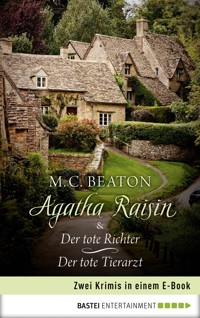
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Krimi
- Serie: Agatha Raisin Sammelband
- Sprache: Deutsch
Ruhiges und friedliches Landleben? Von wegen!
Eigentlich wollte sich die ehemalige PR Beraterin Agatha Raisin in den beschaulichen Cotswolds zur Ruhe setzen. Doch statt idyllischem Landleben warten mysteriöse Kriminalfälle auf Miss Raisin, die sie auf eigene Faust und mit viel Charme zu lösen versucht.
Die ersten beiden Fälle von Agatha Raisin jetzt in einem Band!
Agatha Raisin und der tote Richter.
Ein eigenes Cottage in den malerischen Cotswolds - davon hat Agatha Raisin schon immer geträumt. Jetzt ist dieser Wunsch endlich wahr geworden. Womit die Ex-PR-Beraterin aus London allerdings nie gerechnet hätte, ist die Abneigung ihrer neuen Nachbarn: Die Dörfler wollen offenbar lieber unter sich bleiben! Doch Agatha ist es gewohnt, ihren Kopf durchzusetzen. Um Eindruck zu schinden, reicht sie beim örtlichen Backwettbewerb eine Feinkost-Quiche ein, die sie als ihre eigene ausgibt. Dumm ist allerdings, dass einer der Preisrichter stirbt und in Agathas Quiche Gift gefunden wird. Nun muss sie nicht nur zugeben, dass sie gemogelt hat, sondern auch versuchen, den Mordverdacht gegen sich auszuräumen.
Agatha Raisin und der tote Tierarzt.
Auch nach einigen Monaten in den Cotswolds hat sich Agatha Raisin noch immer nicht recht an das beschauliche Landleben gewöhnt. Doch es geht voran, Agatha konnte sogar eine Essenseinladung vom neuen Dorftierarzt ergattern, einem äußerst attraktiven Mann. Pech nur, dass dieser wenig später bei der Behandlung eines Rennpferdes stirbt. Ein Unfall, sagt die Polizei, doch Agatha zweifelt, dafür sind die Todesumstände zu verdächtig. Schließlich ermittelt sie auf eigene Faust - und gerät damit ins Visier eines hundsgemeinen Gegners.
"M.C. Beatons Krimis sind Kult!" THE TIMES.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 548
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über das Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Agatha Raisin & Der tote Richter
Widmung
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Agatha Raisin & Der tote Tierazt
Widmung
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Über das Buch
Ruhiges und friedliches Landleben? Von wegen!
Eigentlich wollte sich die ehemalige PR Beraterin Agatha Raisin in den beschaulichen Cotswolds zur Ruhe setzen. Doch statt idyllischem Landleben warten mysteriöse Kriminalfälle auf Miss Raisin, die sie auf eigene Faust und mit viel Charme zu lösen versucht.
Die ersten beiden Fälle von Agatha Raisin jetzt in einem Band!
„M.C. Beatons Krimis sind Kult!“ THE TIMES
Agatha Raisin und der tote Richter
Ein eigenes Cottage in den malerischen Cotswolds – davon hat Agatha Raisin schon immer geträumt. Jetzt ist dieser Wunsch endlich wahr geworden. Womit die Ex-PR-Beraterin aus London allerdings nie gerechnet hätte, ist die Abneigung ihrer neuen Nachbarn: Die Dörfler wollen offenbar lieber unter sich bleiben! Doch Agatha ist es gewohnt, ihren Kopf durchzusetzen. Um Eindruck zu schinden, reicht sie beim örtlichen Backwettbewerb eine Feinkost-Quiche ein, die sie als ihre eigene ausgibt. Dumm ist allerdings, dass einer der Preisrichter stirbt und in Agathas Quiche Gift gefunden wird. Nun muss sie nicht nur zugeben, dass sie gemogelt hat, sondern auch versuchen, den Mordverdacht gegen sich auszuräumen.
Agatha Raisin und der tote Tierarzt
Auch nach einigen Monaten in den Cotswolds hat sich Agatha Raisin noch immer nicht recht an das beschauliche Landleben gewöhnt. Doch es geht voran, Agatha konnte sogar eine Essenseinladung vom neuen Dorftierarzt ergattern, einem äußerst attraktiven Mann. Pech nur, dass dieser wenig später bei der Behandlung eines Rennpferdes stirbt. Ein Unfall, sagt die Polizei, doch Agatha zweifelt, dafür sind die Todesumstände zu verdächtig. Schließlich ermittelt sie auf eigene Faust – und gerät damit ins Visier eines hundsgemeinen Gegners.
Über die Autorin
M.C. Beaton ist eines der zahlreichen Pseudonyme der schottischen Autorin Marion Chesney. Nachdem sie lange Zeit als Theaterkritikerin und Journalistin für verschiedene britische Zeitungen tätig war, beschloss sie, sich ganz der Schriftstellerei zu widmen. Mit ihren Krimi-Reihen um den schottischen Dorfpolizisten Hamish Macbeth und die englische Detektivin Agatha Raisin feiert sie bis heute große Erfolge in über 15 Ländern. M.C. Beaton lebt und arbeitet in einem Cottage in den Cotswolds.
M.C. BEATON
Agatha Raisin&Der tote Richter /Der tote Tierarzt
Zwei Agatha Raisin Fälle in einem Band
Aus dem Englischen vonSabine Schilasky
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen
Vollständige E-Book-Ausgabe der in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werke »Agatha Raisin und der tote Richter« (© 2013) und »Agatha Raisin und der tote Tierarzt« (© 2014)
Für die Originalausgaben:
Copyright © 1993 by M. C. Beaton
Titel der englischen Originalausgaben:
„Agatha Raisin and the Quiche of Death“ und „Agatha Raisin and the Vicious Vet”
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat/Projektmanagement: Esther Madaler
Covergestaltung: Thomas Krämer unter Verwendung von Motiven © shutterstock/Kanuman
E-Book-Produktion: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-7325-1681-0
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
M.C. BEATON
Agatha Raisinundder tote Richter
Kriminalroman
Aus dem Englischen vonSabine Schilasky
Für Patrick Heininger, seine Frau Caroline und ihren Sohn Benjamin aus Bourton-on-the-Water, in Liebe.
Eins
Mrs. Agatha Raisin saß am Schreibtisch ihres soeben leergeräumten Büros in der South Molton Street im Londoner Stadtteil Mayfair. Aus dem Vorzimmer hörte sie Stimmengewirr und Gläserklirren. Ihre Mitarbeiter machten sich bereit, ihr Lebewohl zu sagen.
Agatha ging in den vorzeitigen Ruhestand. In vielen, vielen Jahren harter Arbeit hatte sie die Public-Relations-Firma aufgebaut. Für ein Arbeiterkind aus Birmingham hatte sie es in der Tat weit gebracht. Sie hatte eine unglückliche Ehe hinter sich gelassen – ziemlich angeschlagen, aber entschlossen, es zu etwas zu bringen. Und all ihre geschäftlichen Anstrengungen hatten nur einem Zweck gedient: der Verwirklichung ihres Traums von einem Cottage in den Cotswolds.
Die Cotswolds in den Midlands sind zweifellos eine der wenigen von Menschenhand geschaffenen Schönheiten auf dieser Welt – malerische Dörfer mit goldfarbenen Häusern, hübschen Gärten, gewundenen Alleen und uralten Kirchen. Agatha war verzaubert von den Cotswolds, seit sie als Kind dort die Ferien verbracht hatte. Ihre Eltern hatten es gehasst und gesagt, sie hätten lieber in dasselbe Feriendorf fahren sollen wie sonst, aber für Agatha verkörperten die Cotswolds alles, was sie sich vom Leben wünschte: Schönheit, Ruhe und Sicherheit. Also hatte sie schon als Kind entschieden, dass sie eines Tages in einem dieser schönen, friedlichen Dörfer leben würde, weit weg vom Lärm und Gestank der Großstadt.
Während ihrer ganzen Zeit in London war sie nie wieder dort gewesen, weil sie sich den Traum bewahren wollte. Erst vor Kurzem war sie ein zweites Mal hingereist und hatte sich ihr Traum-Cottage im Dorf Carsely gekauft. Ein Jammer, dass der Ort schlicht Carsely hieß, dachte Agatha, und nicht einen dieser faszinierenden Namen wie Chipping Campden, Aston Magna oder Lower Slaughter trug. Aber das Cottage war perfekt und das Dorf abseits der Touristenrouten, was bedeutete, dass es keine Kunsthandwerkläden, Cafés und täglichen Busladungen mit verzückten Fremden gab.
Agatha war dreiundfünfzig, hatte glattes braunes Haar, ein unscheinbares, quadratisches Gesicht und war von eher stämmiger Statur. Wenn sie sprach, hörte sie sich so sehr nach Mayfair an,wie es nur möglich war, ausgenommen in Momenten, in denen sie sehr aufgebracht oder aufgeregt war; dann kam schon mal der nasale Birmingham-Tonfall ihrer Jugend durch. In ihrem Metier, der Werbung, half es, ein gewisses Maß an Charme zu besitzen – doch Agatha besaß keinen. Sie verdiente ihr Geld damit, guter Cop und böser Cop in einer Person zu sein. Für ihre Kunden konnte sie Leute je nach Bedarf schroff abweisen oder beschwatzen. Oft ließen Journalisten ihre Schützlinge schon deshalb in Ruhe, weil sie Agatha lieber weiträumig aus dem Weg gingen. Darüber hinaus war sie Expertin in emotionaler Erpressung. Wer dumm genug war, sich von ihr zum Mittagessen einladen zu lassen, den nutzte sie schamlos aus, bis er die Gefälligkeit angemessen vergolten hatte.
Bei ihren Mitarbeitern war sie beliebt, weil diese ein ziemlich schwächlicher, frivoler Haufen waren, die Sorte Leute, die sich über jeden, vor dem sie Angst haben, haarsträubende Geschichten zusammenfantasieren. Agatha wurde gemeinhin als »eine Marke für sich« beschrieben, und wie alle Marken-für-sich hatte sie keine richtigen Freunde. Ihre Arbeit war zugleich ihr Privatleben – ein Umstand, der Agatha keineswegs die Tränen in die Augen trieb.
Als sie aufstand, um zur Party draußen zu gehen, tauchte eine kleine dunkle Wolke an Agathas sonst so ungetrübtem Horizont auf. Vor ihr lagen Tage des Nichts: keine Arbeit von morgens bis nachts, keine Hektik, kein Lärm. Wie würde sie damit klarkommen?
Sie tat den Gedanken mit einem Achselzucken ab und überschritt den Rubikon, um sich von allen zu verabschieden.
»Da ist sie ja!«, kreischte Roy, einer ihrer Assistenten. »Wir haben einen ganz speziellen Sektpunsch gemixt, Aggie. Der knallt ordentlich rein!«
Agatha nahm das angebotene Glas mit Punsch. Ihre Sekretärin Lulu kam und überreichte ihr ein Geschenk. Dann folgten die anderen, ebenfalls mit Geschenken. Agatha fühlte einen Kloß in ihrem Hals, während eine leise, beharrliche Stimme in ihrem Kopf schnarrte: »Was hast du getan? Was hast du getan?« Von Lulu bekam sie Parfüm, von Roy – wie sollte es anders sein? – einen sexy Slip mit offenem Schritt; dann waren da noch ein Buch übers Gärtnern, eine Blumenvase und Ähnliches.
»Eine Rede!«, schrie Roy.
»Ich danke euch«, sagte Agatha leicht gereizt. »Übrigens wandere ich nicht nach China aus. Ihr könnt alle kommen und mich besuchen. Eure neuen Chefs, Pedmans, haben versprochen, nichts zu verändern, also nehme ich an, dass es für euch größtenteils so weitergeht wie bisher. Danke für eure Geschenke. Ich werde sie in Ehren halten, ausgenommen deines, Roy. In meinem Alter ist ernsthaft zu bezweifeln, dass ich dafür Verwendung finde.«
»Man kann ja nie wissen«, antwortete Roy mit einem frechen Grinsen. »Irgendein spitzer Farmer wird dich sicher in die Büsche zerren wollen.«
Agatha trank noch mehr Punsch und aß ein Lachs-Sandwich. Dann, nachdem Lulu ihr geholfen hatte, alle Geschenke in zwei Tragetaschen zu verstauen, stieg sie zum letzten Mal die Treppe von Raisin Promotions hinunter.
In der Bond Street schubste sie einen dünnen, nervösen Geschäftsmann beiseite, der sich gerade ein Taxi herangewunken hatte. »Ich hab’s zuerst gesehen«, beharrte sie, stieg ohne einen Blick zurück ein und befahl dem Fahrer, zur Paddington Station zu fahren.
Dort erwischte Agatha den Zug um 15 Uhr 20 nach Oxford. Erschöpft sank sie in den Eckplatz der ersten Klasse. In den Cotswold stand alles bereit: Eine Innenarchitektin hatte das Cottage »überholt«, ihr Auto wartete am Bahnhof von Moreton-in-Marsh, um sie den kurzen Weg nach Carsely zu bringen, und eine Spedition hatte ihre Sachen aus der Londoner Wohnung geholt. Die war inzwischen verkauft, und Agatha war endlich frei. Sie durfte entspannen. Keine launischen Popstars mehr, mit denen sie sich herumschlagen musste, keine primadonnenhaften Haute-Couture-Firmen, denen sie einen glorreichen Auftritt verschaffen musste. Von jetzt ab konnte sie tun und lassen, was ihr gefiel … Ein herrliches Gefühl.
Agatha nickte ein und schrak auf, als der Zugbegleiter rief: »Oxford. Hier ist Oxford. Keine Weiterfahrt mit diesem Zug möglich. Bitte verlassen Sie den Zug!«
Nicht zum ersten Mal wunderte sich Agatha über die Ausdrucksweise der British Rail. Bei diesem Ton rechnete man ja fast damit, dass gleich sämtliche Waggons explodierten. Sie blinzelte hinauf zum Bildschirm, der über Bahnsteig 2 hing. Er teilte ihr mit, dass der Zug nach Charlbury, Kingham, Moreton-in-Marsh und allen weiteren Orte in Hereford von Gleis 3 abfuhr. Also schnappte sich Agatha ihre Tragetaschen und ging quer über den Bahnsteig. Es war ein kalter, grauer Tag. Die Euphorie, die sich mit der neuen Freiheit und Roys Punsch eingestellt hatte, verflog allmählich.
Der Zug bewegte sich schwerfällig aus dem Bahnhof. Zur einen Seite waren Kähne zu sehen, auf der anderen klapprige Gartenlauben, die bald endlosen Feldern wichen, überflutet vom letzten Regen und in Agathas zunehmend finsterer Wahrnehmung alles andere als ansprechend.
Das ist doch lächerlich, schalt Agatha sich. Ich habe erreicht, was ich mir immer gewünscht habe. Ich bin bloß müde, sonst nichts.
Der Zug bremste ein Stück vor Charlbury, wurde erst langsamer und hielt schließlich unvermittelt an, wie es für die Züge der British Rail fast schon zum guten Ton gehörte. Sämtliche Fahrgäste saßen stoisch da und lauschten dem heulenden Wind auf den matschigen Feldern. Wieso benehmen wir uns alle wie verirrte Schafe?, fragte Agatha sich. Warum sind die Briten so zahm und nicht aus der Ruhe zu bringen? Wieso ruft keiner den Zugbegleiter und verlangt nach dem Grund für den Halt? Andere, gesprächigere Leute würden den Stopp nicht einfach so hinnehmen. Sie überlegte, ob sie aufstehen und nach dem Zugbegleiter suchen sollte. Dann erinnerte sie sich daran, dass sie gar nicht in Eile war. Sie holte den Evening Standard aus ihrer Tasche, den sie am Bahnhof gekauft hatte, und begann zu lesen.
Nach zwanzig Minuten fuhr der Zug ächzend und kreischend wieder an. Weitere zwanzig Minuten nach Charlbury rollte er in den kleinen Bahnhof von Moreton-in-Marsh. Agatha stieg aus. Ihr Wagen stand noch genau da, wo sie ihn geparkt hatte. Während der letzten Minuten der Fahrt hatte sie sich schon Sorgen gemacht, er könnte gestohlen worden sein.
Es war Markttag in Moreton-in-Marsh, und Agathas Laune besserte sich sofort, als sie langsam an den Ständen vorbeifuhr, die alles von Fisch bis Unterwäsche feilboten. Dienstag. Markt war also dienstags. Das musste sie sich merken. Ihr neuer Saab schnurrte aus Moreton hinaus und die Hügel hinauf nach Bourton-on-the-Hill. Fast zu Hause. Zu Hause! Endlich zu Hause.
Sie bog von der A-44. Von hier führte eine schmale Straße bergab nach Carsely, das in einer Hügelsenke der Cotswolds lag.
Sogar für Cotswolds-Verhältnisse war es ein außergewöhnlich hübsches Dorf. Entlang der Hauptstraße standen zwei lange Häuserreihen, teils Fachwerkhäuser mit Reetdächern, teils Cottages aus warmem goldenem Sandstein mit Schieferdächern. Am einen Ende gab es einen Pub, der Red Lion hieß, am anderen stand die Kirche. Von dieser Hauptstraße gingen kleine Seitenstraßen ab, in denen sich Cottages einander zuneigten, als müssten sie sich gegenseitig stützen, so alt waren sie. Die Gärten leuchteten vor Kirschblüten, Forsythien und Narzissen. In Carsely gab es einen altmodischen Kurzwarenladen, eine Post, einen Krämerladen, eine Metzgerei und einen Laden, der ausschließlich Trockenblumen zu verkaufen schien und praktisch nie geöffnet hatte. Außerhalb des Dorfes, dezent verborgen hinter einem kleinen Hügel, lag eine Sozialsiedlung, und zwischen ihr und dem Dorf befanden sich das Polizeirevier, eine Grundschule sowie eine Bücherei.
Agathas Cottage stand allein ganz hinten in einer der kleinen Seitenstraßen. Es sah wie eines dieser Cottages auf Kalenderblättern aus, die Agatha als Kind so gemocht hatte: niedrig, mit einem frisch gedeckten Reetdach – Norfolk Reet, um genau zu sein – und Sprossenfenstern im goldgelben Cotswolds-Stein. Vorn gab es einen kleinen Garten, hinten einen langen schmalen. Im Gegensatz zu fast jedem sonst in den Cotswolds war der Vorbesitzer dieses Hauses kein leidenschaftlicher Hobbygärtner gewesen. Im Garten wuchs hauptsächlich Gras, unterbrochen von einigen deprimierenden Sträuchern jener zähen Sorten, wie sie in öffentlichen Parks gepflanzt werden.
Durch die Vordertür trat man zunächst in eine winzige dunkle Diele. Rechts ging das Wohnzimmer ab, links das Esszimmer. Die Küche nach hinten raus lag in einem neuen Anbau und war groß und quadratisch. Im ersten Stock befanden sich zwei niedrige Schlafzimmer und ein Bad, und sämtliche Räume hatten Balkendecken.
Agatha hatte der Innenarchitektin freie Hand gelassen. Alles war, wie es sein sollte, und dennoch … Agatha blieb an der Wohnzimmertür stehen. Eine dreiteilige Sitzgarnitur mit Leinenpolstern von Sanderson, Lampen, ein Couchtisch aus Glas, einen Feuerkorb im Kamin und darüber Zaumzeug aus Messing an den Sims genagelt; Zinnkrüge und Figurenbecher baumelten an Haken von den groben Holzbalken, und poliertes altes Gartenwerkzeug zierte die Wände. Es sah aus wie ein Bühnenbild. Agatha ging in die Küche und stellte die Zentralheizung an. Das erstklassige Umzugsunternehmen hatte sogar dafür gesorgt, dass ihre Kleidung im Schlafzimmerschrank hing und ihre Bücher in den Regalen standen, also gab es für sie nicht mehr viel zu tun. Sie ging ins Esszimmer. Dort stand ein langer schimmernder Tisch mit hitzebeständiger Oberfläche und umgeben von viktorianischen Stühlen. Ein edwardianisches Gemälde von einem kleinen Kind in einer Kittelschürze inmitten eines leuchtenden Blumenbeets hing an der Wand. Hier war noch ein Kamin, in dem ein elektrisches Kaminfeuer stand. Es gab ein walisisches Regal mit blau-weißem Geschirr darauf und einen Teewagen. Die Schlafzimmer oben waren Laura Ashley pur. Es fühlte sich wie das Haus einer anderen Person an, das Heim irgendeines gestaltlosen Fremden oder wie ein teures Ferien-Cottage.
Nun, Agatha hatte noch nichts zum Abendessen, und nach einem Leben mit Restaurantbesuchen und Take-away-Mahlzeiten hatte sie sich vorgenommen, Kochen zu lernen. Deshalb glänzte eine ganze Reihe von Kochbüchern auf einem Brett in der Küche. Doch zuerst wollte sie die wenigen Geschäfte im Dorf erkunden. Sie nahm ihre Handtasche und machte sich auf den Weg. Laut Makler waren viele der Geschäfte längst in »schicke Landhäuser« umgebaut worden. Die Dorfbewohner gaben den Zugezogenen die Schuld, dabei war eigentlich das Auto der Schuldige, denn auch die Einheimischen selbst fuhren lieber zu den Supermärkten in Stratford oder Evesham, statt in den teuren Dorfläden einzukaufen.
Als Agatha sich der Hauptstraße näherte, kam ihr ein alter Mann entgegen. Er tippte sich mit einem munteren »Tag!« an den Hut. Auf der Hauptstraße wurde Agatha ebenfalls von jedem mit ein paar Worten begrüßt – einem beiläufigen »Tag« oder »Was für ein Wetter!«. Nach London, wo Agatha nicht einmal ihre Nachbarn gekannt hatte, war diese Freundlichkeit eine angenehme Abwechslung.
Sie betrachtete die Auslagen der Metzgerei und entschied, dass das Kochen noch ein paar Tage warten konnte. Also ging sie in den Krämerladen, wo sie ein extrascharfes Vindaloo-Curry für die Mikrowelle und Reis kaufte. Auch in dem Geschäft waren alle sehr freundlich. An der Ladentür stand eine Kiste mit alten Büchern. In der Vergangenheit hatte Agatha fast ausschließlich Sachbücher gelesen. In der Kiste lag eine ziemlich abgegriffene Ausgabe von Vom Winde verweht, die Agatha spontan kaufte.
Zurück im Cottage stapelte sie ein paar falsche Holzscheite aus gepressten Sägespänen in den Kamin, zündete sie an und hatte bald ein knisterndes Feuer, das im Schornstein rauschte. Dann nahm sie das Spitzendeckchen weg, das die Innenarchitektin über dem Fernseher drapiert hatte, und schaltete den Apparat ein. Irgendwo herrschte Krieg, wie immer, und die Nachrichten widmeten ihm die übliche Aufmerksamkeit. Angeregt plauderten der Moderator und der Reporter miteinander. »Schalten wir zu dir, John. Was kannst du uns über die gegenwärtige Lage sagen? Nun, Peter …« Als sie den unvermeidlichen »Experten« im Studio begrüßten, fragte sich Agatha, wieso sie überhaupt einen Reporter in das Krisengebiet geschickt hatten. Es war wie eine Endlosschleife vom Golfkrieg, als in den Nachrichten immerfort Reporter zu sehen gewesen waren, die vor irgendeinem Hotel in Riad standen, eine Palme hinter sich. Was für eine Geldverschwendung! Informationen hatten sie sowieso nie nennenswerte, und es wäre allemal billiger gewesen, die Leute im Londoner Studio vor eine Kübelpalme zu stellen.
Agatha schaltete den Fernseher aus und nahm sich ihr Buch. Sie hatte sich schon auf ein wenig intellektuell unterfordernde Lektüre zur Feier ihrer neuen Freiheit gefreut, doch nun staunte sie, wie gut das Buch war, beinahe unanständig lesbar. Bisher hatte sie nur die Sorte Bücher gelesen, mit deren Titeln man bei anderen Leuten Eindruck schinden konnte. Das Feuer knackte und knisterte, und Agatha las, bis ihr knurrender Magen sie drängte, das Curry in die Mikrowelle zu schieben. Das Leben war schön.
Eine Woche verging. Eine Woche, in der Agatha, wie es ihrer anpackenden Art entsprach, die Sehenswürdigkeiten der Umgebung abklapperte. Sie war in Warwick Castle gewesen, dem Geburtsort von Shakespeare, im Blenheim Palace und durch die Dörfer der Cotswolds geschlendert. Alles bei Sturm und ununterbrochenem Regen. Jeden Abend kehrte sie mit einem neuentdeckten Buch von Agatha Christie in ihr Cottage zurück, das ihr über die langen Abendstunden half. Sie hatte den Pub ausprobiert. Das Red Lion hatte niedrige Decken, war ziemlich kitschig eingerichtet und wurde von einem gutgelaunten Wirt betrieben. Auch dort waren die Einheimischen ihr mit offener Freundlichkeit begegnet, bei der es allerdings auch blieb. Mit argwöhnischer Feindseligkeit konnte Agatha umgehen, nicht hingegen mit dieser oberflächlichen Heiterkeit, die offensichtlich dem Zweck diente, Agatha auf Abstand zu halten. Nicht dass Agatha es jemals verstanden hätte, Freundschaften zu schließen, aber etwas an diesen Dörflern sperrte sich gegen Zuzügler. Sie behandelten sie keineswegs mit offener Ablehnung. Nein, dem Anschein nach hießen sie hier jeden willkommen. Trotzdem wusste Agatha, dass ihre Anwesenheit nicht die geringste Wellenbewegung im stillen Teich des Dorflebens bewirkte. Niemand bat sie zum Tee. Keiner interessierte sich für sie. Nicht einmal der Vikar kam vorbei, von einem alten Colonel und seiner Gattin ganz zu schweigen. Jede Unterhaltung beschränkte sich auf »Morgen«, »Tag« oder Gerede über das Wetter.
Zum ersten Mal in ihrem Leben lernte Agatha Einsamkeit kennen – und die machte ihr Angst.
Von ihrem Küchenfenster aus blickte sie in die Cotswolds Hills, die hoch aufragten. Dahinter verbarg sich die Welt mit ihrer Geschäftigkeit und ihrem Trubel. Agatha kam sich wie ein verwirrtes Alien vor, gefangen unter dem niedrigen Dach ihres Cottages, abgeschnitten von allem. Die leise Stimme in ihr, die gerufen hatte: »Was hast du getan?«, wurde zu einem Brüllen.
Und dann musste sie plötzlich lachen. London war nur anderthalb Stunden mit dem Zug entfernt, nicht Tausende von Kilometern! Gleich morgen würde sie hinfahren, ihre früheren Mitarbeiter besuchen, im Caprice zu Mittag essen und anschließend vielleicht in den Buchläden nach mehr Lesestoff stöbern. Den Markttag in Moreton würde sie verpassen, aber dafür blieb ihr die nächste Woche.
Als wollte sie Agathas lichtere Stimmung teilen, schien am darauffolgenden Morgen tatsächlich die Sonne. Es war ein vollkommener Frühlingstag. Der Kirschbaum hinten im Garten, das einzige Zugeständnis an Beschaulichkeit, das ihr Vorbesitzer gemacht hatte, streckte seine schweren, blütenübersäten Äste einem klarblauen Himmel entgegen. Agatha saß beim Frühstück, bestehend aus einer Tasse schwarzem Instantkaffee und zwei Zigaretten, und betrachtete die Blütenpracht.
Ein Feriengefühl überkam sie, als sie den Hügel hinauf aus dem Dorf heraus und wieder hinunter durch Bourton-on-the-Hill nach Moreton-in-Marsh fuhr.
An der Paddington Station in London angekommen, inhalierte sie gierig die abgasgeschwängerte Luft und spürte, wie sie wieder lebendiger wurde. Im Taxi zur South Molton Street wurde ihr klar, dass sie keine einzige lustige Geschichte parat hatte, mit der sie ihre ehemaligen Mitarbeiter unterhalten konnte. »Unsere Aggie wird blitzschnell zur Dorfkönigin«, hatte Roy gesagt. Wie wollte sie ihnen erklären, dass die fantastische Agatha Raisin, was Carsely betraf, gar nicht existierte?
Sie stieg in der Oxford Street aus dem Taxi und ging die South Molton Street hinunter. Wie es wohl sein würde, »Pedmans« zu sehen, wo früher ihr Name gestanden hatte?
Unten an der Treppe, die zu ihrem früheren Büro über dem Ball- und Brautmodengeschäft führte, blieb sie stehen. Da war überhaupt kein Schild, bloß ein frisch gestrichenes Stück Mauer, wo vorher Raisin Promotions zu lesen gewesen war.
Agatha stieg die Eingangsstufen hinauf. Es herrschte Grabesstille. Sie drehte am Türknopf. Abgeschlossen. Verwundert ging sie wieder nach unten und blickte hinauf zu den Fenstern. In einer der Scheiben hing ein großes Schild, auf dem mit roten Buchstaben ZU VERKAUFEN stand und darunter der Name eines Maklers für teure Immobilien.
Grimmig nahm sie ein Taxi hinüber zur City, nach Cheapside, wo die Pedmans-Zentrale war, und verlangte, den Geschäftsführer Mr. Wilson zu sprechen. Eine gelangweilte Empfangssekretärin mit den längsten Fingernägeln, die Agatha jemals gesehen hatte, nahm den Telefonhörer ab und sprach hinein. »Mr. Wilson ist beschäftigt«, sagte sie, blickte wieder in die Frauenzeitschrift, in der sie bei Agathas Ankunft geblättert hatte, und las ihr Horoskop.
Agatha nahm ihr die Zeitschrift aus der Hand. Über den Schreibtisch gebeugt zischte sie: »Bewegen Sie Ihren knochigen Hintern, und sagen Sie diesem Mistkerl, dass er Zeit für mich hat.«
Die Empfangssekretärin starrte Agatha entgeistert an, gab ein Quieken von sich und stolperte die Treppe hinauf. Nach einer kurzen Weile, in der Agatha ihr Horoskop las – »Heute könnte der wichtigste Tag Ihres Lebens sein. Zügeln Sie Ihr Temperament« –, kam die Sekretärin auf ihren turmhohen Absätzen zurückgestöckelt und flüsterte: »Mr. Wilson empfängt Sie jetzt. Wenn Sie bitte mitkommen …«
»Ich kenne den Weg«, knurrte Agatha. In ihren vernünftigen flachen Schuhen stapfte sie die Stufen nach oben.
Mr. Wilson stand auf, als sie sein Büro betrat. Er war ein kleiner, adretter Mann mit schütterem Haar, einer Goldrandbrille, weichen Händen und einem salbungsvollen Lächeln, das ihn eher wie einen Arzt in der Harley Street erscheinen ließ als den Chef einer Public-Relations-Firma.
»Wieso bieten Sie mein Büro zum Verkauf an?«, fragte Agatha.
Er strich sich über den Kopf. »Mrs. Raisin, nicht Ihr Büro. Sie haben uns Ihre Firma verkauft.«
»Aber Sie haben mir versprochen, meine Mitarbeiter zu behalten.«
»Was wir auch getan haben. Die meisten von ihnen zogen jedoch eine Abfindung vor. Wir brauchen nun mal keine zusätzlichen Räumlichkeiten. Die Geschäfte können wir problemlos von hier erledigen.«
»Na hören Sie mal, das können Sie doch nicht machen!«
»Nein, hören Sie mir zu, Mrs. Raisin, ich kann tun und lassen, was ich will. Sie haben uns die Firma mit allem, was dazugehört, verkauft. Wenn Sie mich jetzt bitte entschuldigen wollen. Ich bin sehr beschäftigt.«
Er sank auf seinen Stuhl zurück, während Agatha Raisin ihm unmissverständlich und höchst bildhaft erklärte, was er mit sich selbst tun könnte. Dann stürmte sie hinaus.
Draußen auf der Straße stiegen ihr Tränen in die Augen. »Mrs. Raisin … Aggie?«
Sie fuhr herum. Roy stand hinter ihr. Statt seiner üblichen Jeans, einem psychedelischen Hemd und goldenen Ohrringen trug er einen nüchternen Anzug.
»Ich bringe dieses Schwein Wilson um«, wetterte Agatha. »Ich habe ihm gerade gesagt, was ich von ihm halte.«
Roy verzog das Gesicht und wich einen Schritt zurück. »Oh Mann, Schätzchen, dann sollte ich wohl besser nicht mit dir gesehen werden, was? Was ist denn los mit dir? Du hast ihm doch den ganzen Laden verkauft.«
Agatha rümpfte zutiefst empört die Nase. »Wo ist Lulu?«
»Die hat ihre Abfindung genommen und aalt sich an der Costa Brava in der Sonne.«
»Und Jane?«
»Arbeitet als PR-Frau für Friends Scotch. Kannst du dir das vorstellen? Einer Alkoholikerin wie der geben sie einen Job in einer Whisky-Firma? Die wird die Geschäftsgewinne binnen eines Jahres versoffen haben.«
Agatha erkundigte sich nach den anderen. Offensichtlich war Roy der Einzige, den Pedmans übernommen hatte. »Es ist wegen der Trendies«, sagte er. Gemeint war eine Popband, die zu Agathas früheren Kunden gehörte. »Josh, der Boss, mochte mich schon immer, wie du weißt. Also musste Pedmans mich behalten, wenn sie die Band behalten wollten. Gefällt dir mein neuer Stil?« Er vollführte eine Pirouette vor Agatha.
»Nein«, antwortete sie mürrisch. »Steht dir nicht. Ach, hast du nicht Lust, mich am Wochenende mal zu besuchen?«
Roy druckste herum. »Würde ich ja gern, Schätzchen, aber ich habe tonnenweise Arbeit. Wilson ist ein Sklaventreiber.« Hektisch riss er den Arm hoch, um auf seine Armbanduhr zu schauen. »Ich muss dann auch mal los.«
Er flitzte ins Gebäude, bevor Agatha noch etwas sagen konnte, und sie stand wieder allein da.
Sie versuchte, ein Taxi heranzuwinken, doch leider waren alle besetzt. Also ging sie zu Fuß bis zur Bank Station, wo ihr jemand sagte, dass die U-Bahnen bestreikt wurden. »Und wie soll ich von hier wegkommen?«, knurrte sie.
»Versuchen Sie’s mit einer Fähre«, schlug der Mann vor. »Unten an der London Bridge.«
Agatha marschierte weiter zur London Bridge. Nach und nach wich ihre Wut einem elenden Gefühl von Verlust. An der Anlegestelle der London Bridge erwartete sie ein Yuppie-Auflauf der besonderen Art: Die Pier war gerammelt voll mit nervös dreinblickenden jungen Männern und Frauen, die ihre Aktentaschen umklammerten und sich auf die kleine Flotte von Ausflugsdampfern drängelten.
Agatha stellte sich ans Ende der Schlange und bewegte sich Zentimeter für Zentimeter vorwärts. Sie war schon leicht seekrank, als sie endlich an Bord eines großen alten Ausflugsdampfers steigen konnte, der eigens für diesen Tag wieder in Betrieb genommen worden war. Immerhin hatte auch die Bar geöffnet. Agatha bestellte einen großen Gin Tonic, umklammerte das Glas fest und stieg hinauf an Deck, wo sie sich in einen der kleinen gold-roten Plüschsessel hockte, wie sie auf den Themse-Booten früher modern waren.
Der Dampfer bewegte sich im Sonnenschein hinaus auf den Fluss und glitt an allem vorbei, was Agatha weggeworfen hatte – das Leben und London. Unter den Brücken hindurch überholte er die Staus auf der Embankment. An der Anlegestelle Charing Cross stieg Agatha aus. Ihr war nicht mehr nach Mittagessen, Einkaufen oder irgendetwas anderem. Sie wollte nur noch zurück zu ihrem Cottage, ihre Wunden lecken und darüber nachdenken, was sie tun sollte.
Sie ging hinauf zum Trafalgar Square, dann die Mall hinunter am Buckingham Palace vorbei, den Constitution Hill hinauf, durch eine Unterführung und oben an der Decimus Burton’s Gate und dem Duke-of-Wellington-Haus in den Hyde Park. Quer durch den Park schritt sie in Richtung Bayswater und Paddington Station.
Bis heute hatte sie sich überall durchgekämpft, immer gewusst, was sie wollte. Obwohl sie eine kluge Schülerin gewesen war, hatten ihre Eltern verlangt, dass sie die Schule mit fünfzehn abbrach, weil es in der örtlichen Keksfabrik gute Jobs gab. Damals war Agatha ein dünnes, blasses, sensibles Mädchen gewesen. Die derben Umgangsformen der Frauen, mit denen sie in der Fabrik arbeitete, hatten an ihren Nerven gezerrt, ihre betrunkenen Eltern zu Hause sie angewidert. Deshalb machte sie Überstunden, legte das zusätzliche Geld auf ein Sparkonto, damit ihre Eltern es nicht in die Finger bekamen, bis sie eines Tages fand, dass sie genug zusammenhatte, um sang- und klanglos nach London zu verschwinden. Eines Abends, nachdem sich ihre Mutter und ihr Vater in den Schlaf getrunken hatten, schlich sie mit ihrem Koffer zur Tür hinaus.
In London hatte sie sieben Tage die Woche als Kellnerin geschuftet, damit sie sich Steno- und Schreibmaschinenkurse leisten konnte. Sobald sie sich qualifiziert hatte, bekam sie eine Stelle als Sekretärin in einer Public-Relations-Firma. Doch kaum hatte sie angefangen, das Geschäft richtig zu erlernen, verliebte Agatha sich in Jimmy Raisin, einen charmanten jungen Mann mit blauen Augen und dichten schwarzen Locken. Er schien keiner festen Arbeit nachzugehen, aber Agatha dachte, wenn er erst verheiratet war, würde er auch richtig Fuß fassen. Nach einem Monat Ehe begriff sie, dass sie vom Regen in die Traufe geraten war. Ihr Mann war ein Säufer. Trotzdem war sie zwei ganze Jahre bei ihm geblieben, hatte die Brötchen verdient und sich mit seinen zunehmenden Gewalttätigkeiten abgefunden. Eines Morgens dann hatte sie ihn angesehen, als er schnarchend im Bett lag, schmutzig und unrasiert. Da legte sie ihm einige Broschüren der Anonymen Alkoholiker auf die Brust, packte ihre Sachen und zog aus.
Er wusste, wo sie arbeitete, daher hatte sie gedacht, er würde kommen, und sei es nur, um sich Geld von ihr zu holen, aber das tat er nicht. Ein einziges Mal ging sie zurück zu dem armseligen Zimmer in Kilburn, in dem sie gewohnt hatten. Er war fort gewesen. Agatha hatte nie die Scheidung eingereicht, weil sie annahm, dass er tot war. Und sie hatte entschieden, nie wieder zu heiraten. Mit den Jahren wurde sie härter und härter, kompetenter, aggressiver. Langsam verschwand das schüchterne Mädchen von einst unter mehreren Schichten verbissenen Ehrgeizes. Ihr Job wurde ihr Leben, ihre Kleidung teurer und ihr Geschmack insgesamt zu dem, was man von einem aufgehenden PR-Stern erwartete. Solange die Leute Agatha beneideten, war sie zufrieden.
Während sie zur Paddington Station lief, wurde ihre Stimmung wieder zuversichtlicher. Sie hatte sich ihr neues Leben ausgesucht und würde es in den Griff bekommen. Sie würde dieses Dorf schon noch wachrütteln und den Leuten zeigen, wer Agatha Raisin wirklich war.
Es war später Nachmittag, als sie wieder zu Hause war, und ihr wurde klar, dass sie noch nichts gegessen hatte. Sie ging zu Harvey’s, dem Krämerladen, der gleichzeitig die Post war, und guckte sich in der Tiefkühlabteilung um. Sie fragte sich gerade, ob sie schon wieder Curry essen wollte, da blieb ihr Blick an einem Plakat an der Wand hängen. Großer Quiche-Wettbewerb stand dort in schnörkeliger Schrift. Der Wettbewerb sollte am Samstag in der Schulaula stattfinden. Es gab noch weitere Wettbewerbe, die in kleineren Buchstaben aufgeführt waren: für Obstkuchen, Blumengestecke und Ähnliches. Beim Quiche-Wettbewerb sollte ein Mr. Cummings-Browne den Gewinner bestimmen. Agatha nahm sich ein Chicken Korma aus der Tiefkühltruhe und ging zur Kasse. »Wo wohnt Mr. Cummings-Browne?«, fragte sie.
»Im Plumtrees Cottage, meine Liebe«, antwortete die Frau. »Hinten bei der Kirche.«
Agathas Gedanken überschlugen sich auf dem Weg nach Hause, und auch noch während sie das Chicken Korma in die Mikrowelle steckte. War es nicht das, worauf es in diesen Dörfern ankam? Die Beste in irgendwelchen häuslichen Dingen zu sein? Wenn also sie, Agatha Raisin, den Quiche-Wettbewerb gewann, würden die Leute auf jeden Fall Notiz von ihr nehmen. Vielleicht bat man sie dann sogar, beim Treffen des Frauenvereins über ihre Quiche-Künste zu reden.
Sie trug ihr wenig ansprechendes Mikrowellen-Essen ins Esszimmer und setzte sich. Stirnrunzelnd betrachtete sie die Tischplatte, die von einer dünnen Staubschicht überzogen war. Agatha hasste Hausarbeit.
Nach dem Essen ging sie hinaus in den Garten. Die Sonne war untergegangen, und ein blassgrüner Himmel erstreckte sich über den Hügeln um Carsely. Agatha hörte ein Geräusch und sah über die Hecke. Ein schmaler Pfad trennte ihren Garten vom nächsten.
Ihre Nachbarin bückte sich über ein Blumenbeet und jätete Unkraut.
Sie war eine hagere Frau, die trotz des kühlen Abends ein Blümchenkleid von der Sorte trug, wie sie die Frauen der Kolonialoffiziere einst bevorzugten. Ihr Kinn war fliehend, und sie hatte leichte Glupschaugen. Das Haar hatte sie im Vierziger-Jahre-Look wellenförmig nach hinten gesteckt. All dies konnte Agatha sehen, während die Frau sich aufrichtete.
»Guten Abend!«, rief Agatha.
Die Frau machte auf dem Absatz kehrt, ging in ihr Haus und schloss die Tür hinter sich.
Solch eine Unhöflichkeit kam Agatha nach all der Carsely-Freundlichkeit wie eine willkommene Abwechslung vor. Sie war ihr schlicht vertrauter. Kurzerhand ging sie zurück in ihr Cottage, zur Vordertür hinaus und zum Cottage nebenan, das New Delhi hieß. Dort betätigte sie den Messingklopfer.
Ein Vorhang am Fenster neben der Tür bewegte sich, sonst rührte sich nichts. Unverdrossen klopfte Agatha wieder, diesmal lauter.
Die Tür öffnete sich einen Spaltbreit, und ein Glupschauge starrte sie an.
»Guten Abend«, sagte Agatha und streckte ihre Hand aus. »Ich bin Ihre neue Nachbarin.«
Langsam öffnete sich die Tür weiter. Die Frau im Blümchenkleid nahm widerwillig Agathas Hand, als handelte es sich um einen toten Fisch, und schüttelte sie. »Ich bin Agatha Raisin«, stellte Agatha sich vor, »und Sie sind …?«
»Mrs. Sheila Barr«, sagte die Frau. »Verzeihen Sie, Mrs. … äh … Raisin, aber ich bin gerade sehr beschäftigt.«
»Ich will Sie auch nicht lange aufhalten«, entgegnete Agatha. »Ich brauche eine Putzfrau.«
Mrs. Barr stieß jene Art enervierendes Lachen aus, in dem Überheblichkeit mitschwang. »Da werden Sie im Dorf keine finden. Es ist beinahe unmöglich, jemanden zum Putzen zu bekommen. Ich habe meine Mrs. Simpson, also darf ich mich sehr glücklich schätzen.«
»Vielleicht könnte sie auch ein paar Stunden für mich arbeiten«, schlug Agatha vor. Die Tür schloss sich bereits wieder. »Oh, nein«, sagte Mrs. Barr. »Kann sie gewiss nicht.« Damit fiel die Tür vollständig zu.
Das werden wir ja sehen, dachte Agatha. Sie holte sich ihre Handtasche, begab sich hinunter in den Red Lion und setzte sich auf einen Barhocker. »N’ Abend, Mrs. Raisin«, begrüßte sie Joe Fletcher, der Wirt. »Heute war’s ja mal richtig nett, was? Vielleicht kriegen wir doch mal gutes Wetter.«
Zum Henker mit dem Wetter, erwiderte Agatha im Stillen, denn sie war es gründlich leid, über das Wetter zu reden. Laut sagte sie: »Wissen Sie, wo Mrs. Simpson wohnt?«
»In der Sozialsiedlung, glaub ich. Meinen Sie die Frau von Bert Simpson?«
»Weiß ich nicht. Sie putzt.«
»Ah, ja, dann ist es Doris Simpson. Die Nummer weiß ich nicht, aber es ist Wakefield Terrace, das zweite Haus mit den Gartenzwergen davor.«
Agatha trank einen Gin Tonic und machte sich auf den Weg zur städtischen Sozialsiedlung. Wakefield Terrace war nicht schwer zu finden und erst recht nicht das Haus der Simpsons, denn ihr Garten versank buchstäblich in einem Meer von Gartenzwergen. Sie standen nicht in kleinen Grüppchen um einen Gartenteich oder waren sorgfältig an einem Beet aufgestellt. Nein, es waren unzählige Zwerge, die willkürlich im Garten verstreut waren.
Mrs. Simpson kam an die Tür. Sie sah eher wie eine altmodische Lehrerin aus und nicht wie eine Zugehfrau. Ihr schlohweißes Haar war zu einem Knoten gebunden, und hinter ihrer Brille schimmerten blassgraue Augen.
Agatha erklärte, weshalb sie gekommen war, woraufhin Mrs. Simpson den Kopf schüttelte. »Nein, ich kann wirklich keine Stelle mehr annehmen, ehrlich nicht. Dienstags bin ich bei Mrs. Barr neben Ihnen, mittwochs bei Mrs. Chomley und donnerstags bei Mrs. Cummings-Browne. Und an den Wochenenden arbeite ich im Supermarkt in Evesham.«
»Wie viel zahlt Mrs. Barr Ihnen?«, fragte Agatha.
»Drei Pfund die Stunde.«
»Wenn Sie stattdessen für mich arbeiten, gebe ich Ihnen vier Pfund die Stunde.«
»Kommen Sie doch lieber erst mal rein. Bert! Bert, mach die Kiste aus. Das hier ist Mrs. Raisin, die jetzt in Budgen’s Cottage in der Lilac Lane wohnt.«
Ein kleiner, dürrer Mann mit Halbglatze schaltete den riesigen Fernsehapparat aus, der annähernd die Hälfte des winzigen, blitzsauberen Wohnzimmers einzunehmen schien.
»Ich hatte schon wieder ganz vergessen, dass die Straße Lilac Lane heißt«, sagte Agatha. »Anscheinend hält man hier nichts von Straßenschildern.«
»Wozu auch, bei den paar Straßen?«, fragte Bert.
»Ich bringe Ihnen eine Tasse Tee, Mrs. Raisin.«
»Agatha. Sagen Sie Agatha«, sagte Agatha mit einem Lächeln, bei dem jeder Journalist, mit dem sie zu tun gehabt hatte, sofort Bescheid wusste. Agatha Raisin war in Kampflaune.
Während Doris Simpson in der Küche verschwand, sagte Agatha: »Ich versuche, Ihre Frau zu überreden, bei Mrs. Barr aufzuhören und für mich zu arbeiten. Ich biete ihr vier Pfund die Stunde, einen vollen Tag Arbeit und natürlich ein freies Mittagessen.«
»Hört sich doch ganz gut an, aber da müssen Sie Doris fragen«, sagte Bert. »Könnte mir schon vorstellen, dass sie froh ist, wenn sie diese Barr in die Wüste schicken kann.«
»Ist die Arbeit dort anstrengend?«
»Die Arbeit nicht so. Ist mehr die Frau. Die sitzt Doris dauernd im Nacken, passt wie ein Geier auf, dass sie auch ja alles richtig macht.«
»Ist Mrs. Barr aus Carsely?«
»Nee, die ist eine Zugezogene. Ihr Mann ist schon eine ganze Weile tot. War irgendwas beim Ministerium, viel im Ausland und so. Die sind vor zwanzig Jahren hierhergekommen.«
Agatha verdaute noch die Information, dass selbst zwanzig Jahre in Carsely nicht ausreichten, um einen zum Einheimischen zu machen, als Mrs. Simpson mit dem Teetablett hereinkam.
»Der Grund, weshalb ich Sie von Mrs. Barr abwerben möchte, ist, dass ich sehr schlecht in Sachen Hausarbeit bin«, sagte Agatha. »Ich war mein Leben lang berufstätig. Und Leute wie Sie, Doris, sollten meiner Meinung nach in Gold aufgewogen werden. Ich zahle Ihnen einen guten Lohn, weil ich Putzen für eine sehr wichtige Arbeit halte. Und ich würde Sie auch bezahlen, wenn Sie krank oder im Urlaub sind.«
»Na, das ist doch mal ein Angebot!«, rief Bert. »Weißt du noch, wie du den Blinddarm rausgekriegt hast, Doris? Die Barr war nicht ein Mal auch nur in der Nähe vom Krankenhaus. Und sie hat dir in der Zeit auch keinen Penny bezahlt.«
»Stimmt«, sagte Doris. »Aber es ist regelmäßiges Geld. Was ist, wenn Sie wieder wegziehen, Agatha?«
»Oh, ich bleibe hier«, versicherte Agatha.
»Na gut, ich mach’s«, sagte Doris prompt. »Ja, ich ruf sie gleich an, dann hab ich’s hinter mir.«
Sie verschwand abermals in der Küche. Bert neigte den Kopf zur Seite und beäugte Agatha prüfend. »Sie wissen schon, dass Sie sich gerade eine Feindin gemacht haben, oder?«
»Und wenn schon«, antwortete Agatha schulterzuckend. »Sie wird darüber hinwegkommen.«
Als Agatha eine halbe Stunde später in ihrer Handtasche nach dem Hausschlüssel wühlte, kam Mrs. Barr aus ihrem Cottage und sah wütend zu ihr hinüber.
Agatha lächelte strahlend. »Ein herrlicher Abend, finden Sie nicht?«, rief sie.
Sie fühlte sich wieder ganz wie die Alte.
Zwei
Plumtrees Cottage, wo die Cummings-Brownes wohnten, stand gegenüber der Kirche und dem Pfarrhaus in einer Viererreihe uralter Steinhäuser. Vor den Häusern befand sich ein ovaler Platz mit glänzendem Kopfsteinpflaster. Statt Vorgärten gehörte zu jedem Haus nur ein schmaler Erdstreifen, in den Blumen gepflanzt waren.
Am Vormittag nach ihrem Besuch bei Doris klopfte Agatha an die Tür des Plumtrees Cottage und fand sich einen Moment später einer Frau gegenüber, die für sie auf den ersten Blick in die Kategorie Ex-Kolonialgattin gehörte, genau wie Mrs. Barr. Trotz der Kälte an diesem Frühlingstag hatte auch Mrs. Cummings-Browne nur ein geblümtes Sommerkleid an, das ein wenig sonnengebräunte Haut mittleren Alters entblößte. Ihre Stimme war hell und streng, und ihre blassblauen Augen musterten Agatha abschätzig. »Ja, Sie wünschen bitte?«
Agatha stellte sich vor und erklärte, dass sie gern am Quiche-Wettbewerb teilnehmen würde, allerdings nicht genau wüsste, wie sie das anstellen sollte, da sie neu im Dorf war. »Ich bin Mrs. Cummings-Browne«, erwiderte die Frau, »und eigentlich steht alles, was Sie tun müssen, auf den Plakaten. Die hängen übrigens überall im Dorf aus.« Sie lachte so spitz, dass Agatha sie gern geohrfeigt hätte. Stattdessen sagte Agatha überaus freundlich: »Wie ich bereits erwähnt habe, bin ich neu im Dorf und würde mich freuen, ein paar Leute kennenzulernen. Vielleicht hätten Sie und Ihr Mann Lust und Zeit, heute Abend mit mir zu essen. Kann man im Red Lion gut essen?«
Wieder lachte Mrs. Cummings-Browne spöttisch. »Im Red Lion würden Sie mich nicht einmal tot sehen! Aber im Feathers in Ancombe servieren sie sehr gutes Essen.«
»Wo in aller Welt ist Ancombe?«, fragte Agatha.
»Nur gut drei Kilometer von hier entfernt. Sie kennen sich anscheinend wirklich noch nicht aus. Wissen Sie was, wir fahren. Seien Sie um halb acht hier.«
Mit diesen Worten schloss sie die Tür. Na, das war einfach, dachte Agatha. Die beiden müssen Schmarotzer sein, was heißt, dass meine Quiche eine reelle Chance auf den ersten Preis hat.
Sie schlenderte durchs Dorf zurück und erwiderte lächelnd die »Morgen«-Grüße der Leute. Es steckten also Würmer in diesem hübsch polierten Apfel, ging es Agatha durch den Kopf. Die meisten der Dorfbewohner waren einfach, gehörten zur Arbeiter- oder unteren Mittelklasse, extrem höflich und freundlich. Falls Mrs. Barr und Mrs. Cummings-Browne als Maßstab taugten, waren es die Zugezogenen, die sich selbst zur Oberschicht ernannt hatten und sich entsprechend dünkelhaft und unhöflich gaben. Ein paar Kirschblütenblätter regneten auf Agatha herab. Die Häuser leuchteten golden im Sonnenschein. Schönes lockte nicht zwangsläufig angenehme Menschen an. Die Zugezogenen hatten ihre Cottages wahrscheinlich in schlechten Zeiten günstig erworben und benahmen sich nun wie dicke Fische im kleinen Teich. Doch soweit Agatha es beurteilen konnte, war es ihnen bisher nicht gelungen, die Dorfbewohner zu beeindrucken oder gar zu vertreiben. Was für die »Neuen« wiederum bedeutete, dass sie sich damit begnügen mussten, sich gegenseitig das Leben schwer zu machen. Dennoch blieb Agatha zuversichtlich, dass sie, wenn sie erst diesen Wettbewerb gewonnen hatte, ganz anders im Dorf dastand.
An diesem Abend saß Agatha im Feathers in Ancombe und sah sich unauffällig um. Mr. Cummings-Browne – »Nun, eigentlich Major, wie ich zu meiner Schande gestehen muss, aber ich benutze meinen Titel nicht, hoa, hoa, hoa« – war ebenso sonnengebräunt wie seine Frau. Die Haut der beiden hatte einen Orangestich, von dem Agatha vermutete, dass er aus einer Tube kam. Mr. Cummings-Browne hatte sein noch vorhandenes graues Haar sorgsam über den kahlen spitzen Schädel gekämmt, was seine trompetenartigen Ohren leider noch betonte. Er hatte in der britischen Armee gekämpft, freiwillig. Dann erwähnte er beiläufig, dass er früher »ein wenig Hühnerzucht« betrieben hätte, doch er sprach lieber über seine Armeezeit. Danach lauschte Agatha einer wirren Reihe von Anekdoten über die Diener, die er gehabt hatte, und seine Untergebenen im Regiment. Er trug ein Sportjackett mit Ellbogenflicken aus Leder über einem olivgrünen Hemd sowie eine Krawatte. Seine Frau hatte ein Laura-Ashley-Kleid an, das Agatha an den Bettüberwurf in ihrem Cottage erinnerte.
Sie hoffte bloß, dass ihre Quiche gewann, wenn sie sich dafür schon rupfen lassen musste, denn es bestand kein Zweifel daran, dass das Feathers seine Gäste ausnahm. Ein Wirt, der auf der falschen Tresenseite stand und mit seinen Kumpel trank, eine allzu protzige, völlig überteuerte Speisekarte und muffige Kellnerinnen waren genau die Dinge, die Agatha nicht leiden konnte. Die Cummings-Brownes hatten, wie nicht anders zu erwarten, den zweitteuersten Wein auf der Karte bestellt, zwei Flaschen. Agatha ließ die beiden reden, bis der Kaffee gebracht wurde. Dann kam sie zur Sache. Sie fragte, welche Art Quiche normalerweise den ersten Preis gewann. Mr. Cummings-Browne sagte, meistens wäre es eine Quiche Lorraine oder eine Pilz-Quiche. Daraufhin erklärte Agatha, sie würde ihre Lieblings-Quiche mitbringen: Spinat-Quiche.
Mrs. Cummings-Browne lachte. Wenn sie noch einmal so lacht, schlage ich sie, dachte Agatha. Dem Lachen folgte die Bemerkung, dass immer Mrs. Cartwright gewann. Agatha sollte sich später noch erinnern, wie merkwürdig still Mr. Cummings-Browne wurde, als Mrs. Cartwrights Name fiel, aber fürs Erste gab sie vor, nichts zu bemerken. Ihre eigene Quiche, sagte sie, war berühmt für ihren köstlichen Geschmack und den leichten Teigboden. Außerdem wäre ein bisschen Wettbewerbsgeist genau das, was das Dorf brauchte. Es war ganz schlecht für die Moral, wenn jahrein, jahraus dieselbe Frau gewann. Agatha war gut darin, andere emotional zu erpressen, ohne dabei zu konkret zu werden. Sie scherzte darüber, wie entsetzlich teuer das Essen im Feathers war, während ihre bohrenden Bärenaugen dem Paar gegenüber vermittelten, was Agatha nicht aussprach: Ihr zwei schuldet mir was.
Die Cummings-Brownes schienen jedoch aus einem besonders harten Holz geschnitzt. Während Agatha sich ans Bezahlen der Rechnung machte – wobei sie die Scheine langsam vorzählte, statt eine Kreditkarte zu benutzen –, bestellten ihre Gäste dreist noch jeder einen großen Cognac.
Trotz allem, was sie mittlerweile getrunken hatten, sahen sie noch so nüchtern aus wie zu Beginn des Essens. Agatha erkundigte sich nach den Leuten aus dem Dorf. Mrs. Cummings-Browne antwortete, sie wären recht nett und man täte für die armen Menschen, was man nur könne. Ihr Tonfall klang ganz nach einer Adligen, die über ihre Mägde und Knechte sprach. Sie fragten Agatha, was sie so gemacht hätte, doch ihre Antwort fiel knapp aus. Seichtes Geplänkel lag ihr nicht. Sie war es gewöhnt, ein Produkt an den Mann zu bringen oder Leute auszufragen, um sie später weichzuklopfen, wenn sie ihnen etwas verkaufen wollte.
Schließlich traten sie hinaus in die milde Nacht. Der Wind hatte sich gelegt, und die Luft roch bereits nach dem nahenden Sommer. Mr. Cummings-Browne fuhr seinen Range Rover gemächlich durch die Alleen nach Carsely zurück. Ein Fuchs schnürte im Scheinwerferlicht über die Straße, Kaninchen huschten in Sicherheit, und in den Hecken blühte es. Agatha fühlte sich einsam. Es war ein Abend, an dem man unter Freunden sein sollte, in netter Gesellschaft; keiner, den man mit Leuten wie den Cummings-Brownes verbrachte. Mr. Cummings-Brownes hielt vor seiner Haustür an und sagte: »Finden Sie den Weg von hier?«
»Nein«, antwortete Agatha verärgert. »Sie könnten mich wenigstens bis nach Hause fahren.«
»Beine sind zum Laufen da«, raunte er, seufzte gedehnt, fuhr sie aber dennoch zu ihrem Cottage.
Ich muss in Zukunft daran denken, ein Licht anzulassen, ging es Agatha beim Anblick ihres stockdunklen Hauses durch den Kopf. Ein Licht wäre schön, wenn sie abends heimkam. Bevor sie aus dem Wagen stieg, fragte sie ihn, wie genau sie sich für den Wettbewerb anmelden musste, und nachdem er es ihr erklärt hatte, stieg sie ohne einen Gutenachtgruß aus und ging in ihr verlassenes Cottage.
Am nächsten Tag trug sie ihren Namen wie besprochen in das Quiche-Wettbewerbsbuch in der Schulaula ein. Aus irgendeinem Klassenraum klang Kindergesang: »To my hey down-down, to my ho down-down.« Sie sangen also immer noch Among the Leaves So Green-O, dachte Agatha und blickte sich in der verlassenen Aula um. Tische waren an eine Wand gerückt, und ganz vorn gab es ein Podium. Kaum der richtige Rahmen für die Umsetzung ehrgeiziger Ziele.
Dann ging sie hinaus zu ihrem Wagen und fuhr nach London. Diesmal nahm sie nicht den Zug, sosehr es ihr auch vor den gefährlichen Autobahnen graute. Sie parkte in World’s End in Chelsea, wo sie einmal für kurze Zeit gewohnt hatte. Heute war sie froh, dass sie ihren Anwohnerparkausweis nie zurückgegeben hatte.
Kurz zuvor war ein Regenschauer heruntergekommen, und London roch wunderbar nach nassem Beton, Autoabgasen, Müll, heißem Kaffee, Obst und Fisch. Alles Gerüche, die für Agatha Heimat bedeuteten.
Als Erstes machte sie sich auf den Weg zur Quicherie, einem Feinkosthändler, der sich auf Quiches spezialisiert hatte. Dort kaufte sie eine große Spinat-Quiche, verstaute sie im Kofferraum ihres Wagens und lud sich anschließend zum Mittagessen ins Caprice ein, wo sie die berühmten Lachspasteten aß und sich unter »ihren« Leuten, den Reichen und Schönen, entspannte. Derweil kam ihr nicht eine Sekunde der Gedanke, dass sie keinen dieser Menschen kannte. Nach dem Essen begab sie sich zu Fenwick’s in die Bond Street, um ein neues Kleid zu kaufen, nicht mit Blümchendruck (Gott bewahre!), sondern ein elegantes, scharlachrotes Wollkleid mit weißem Kragen.
Dann ging es im frühen Abendlicht zurück nach Carsely und in die Küche. Dort holte sie die Quiche aus der Verpackung, steckte ihr selbstgemachtes Schildchen »Spinat-Quiche, Mrs. Raisin« hinein und wickelte alles betont amateurhaft in Klarsichtfolie. Zufrieden begutachtete sie ihr Werk. Diese Quiche würde fraglos die beste sein. Die Quicherie war berühmt für ihre Quiches.
Am Freitagabend brachte sie ihre Quiche in die Schule, wo sie sich vor der Aula in eine Schlange von Frauen mit Blumengestecken, Marmelade, Kuchen, Quiches und Keksen einreihen musste. Die Teilnehmerinnen hatten ihre Beiträge bereits am Abend vor dem Wettbewerb abzuliefern. Wie immer grüßten sie einige mit »N’ Abend. Wenigstens ist es ein bisschen wärmer geworden. Vielleicht kommt noch die Sonne raus«. Ein Glück, dass diese Menschen nichts Ernstes wie Wirbelstürme oder Erdbeben zu erwarten hatten (so hoffte Agatha jedenfalls), bei dem Gewese, das sie schon um Wolken und Regen machten! Eventuell täte ihnen ein handfester Tornado auch mal ganz gut und würde ihnen diese Unsitte austreiben, sich laufend über das wahrhaft gemäßigte Klima der Cotswolds zu beklagen.
Beim Zubettgehen an diesem Abend stellte Agatha fest, dass sie ziemlich nervös und aufgeregt wegen des kommenden Tages war. Lächerlich! Schließlich ging es nur um einen Dorfwettbewerb.
Der nächste Tag brach stürmisch und kalt heran. Der Wind wehte die letzten Kirschblüten von den Bäumen, als die Dorfbewohner zur Schule strömten. Ein verblüffend gutes Dorforchester spielte eine Melodienauswahl aus My Fair Lady. Die Musiker waren zwischen acht und achtzig Jahre alt. Es duftete nach den Blumengestecken und einzelnen Blüten in dünnen Vasen. Vor allem der Geruch von Narzissen lag in der Luft. Und in einem Klassenzimmer seitlich der Aula war sogar ein Café eingerichtet worden, in dem winzige Sandwiches und selbstgebackener Kuchen angeboten wurden.
»Natürlich gewinnt Mrs. Cartwright beim Quiche-Wettbewerb«, sagte eine Stimme in Agathas Nähe.
Sie drehte sich um. »Warum sagen Sie das?«
»Weil Mr. Cummings-Browne der Preisrichter ist«, antwortete die Frau und verschwand in der Menge.
Lord Pendlebury, ein dürrer älterer Herr, der wie ein Geist aus edwardianischer Zeit aussah und ein größeres Anwesen oberhalb des Dorfes besaß, sollte die Gewinnerin des Quiche-Wettbewerbs bekanntgeben, obgleich Mr. Cummings-Browne sie bestimmte.
Aus Agathas Quiche war ein sehr schmales Stück herausgeschnitten worden, genau wie aus den anderen. Sie schmunzelte. Ein Hoch auf die Quicherie. Die Spinat-Quiche war selbstverständlich die beste von allen hier. Die Tatsache, dass sie sie eigentlich selbst hätte zubereiten müssen, belastete Agathas Gewissen kein bisschen.
Das Orchester verstummte. Jemand half Lord Pendlebury auf das Podium vor den Musikern.
»Die Gewinnerin des großen Quiche-Wettbewerbs ist …«, begann Lord Pendlebury mit zittriger Stimme, dann hantierte er ungelenk mit einem Haufen loser Blätter herum, hob sie hoch, strich sie glatt und holte einen Zwicker hervor. Wieder blickte er hilflos auf die Papiere, bis Mr. Cummings-Browne auf das richtige Blatt zeigte.
»Ah, du meine Güte! Ja, ah, ja«, brabbelte Lord Pendlebury. »Äh-häm! Die Gewinnerin ist … Mrs. Cartwright.«
»Verdammter Mist«, murmelte Agatha.
Wütend beobachtete sie, wie Mrs. Cartwright, eine dunkelhaarige Frau mit recht dunklem Teint, auf die Bühne stieg, um ihren Preis entgegenzunehmen. Es war ein Scheck. »Wie viel?«, fragte Agatha die Frau neben sich.
»Zehn Pfund.«
»Zehn Pfund!«, rief Agatha, die überhaupt nicht gefragt hatte, welcher Preis zu gewinnen war, sondern naiv angenommen hatte, es wäre irgendein Silberpokal. Sie hatte ihn sich schon vorgestellt, wie er mit ihrem eingravierten Namen auf ihrem Kaminsims stand. »Wie soll sie das denn feiern? Mit einem Abendessen bei McDonald’s?«
»Es ist der Gedanke, der zählt«, sagte die Frau unsicher. »Sie sind Mrs. Raisin, nicht? Die, die Budgen’s Cottage gekauft hat. Ich bin Mrs. Bloxby. Mein Mann ist der Vikar. Dürfen wir hoffen, Sie am Sonntag in der Kirche zu sehen?«
»Wieso Budgen’s?«, fragte Agatha. »Ich habe das Cottage von einem Mr. Alder gekauft.«
»Es war schon immer Budgen’s Cottage«, sagte die Frau des Vikars. »Er ist zwar schon seit fünfzehn Jahren tot, aber für uns im Dorf ist und bleibt es Budgen’s Cottage. Er war ein guter Mann. Na, wenigstens brauchen Sie sich nicht um Ihr heutiges Abendessen zu sorgen, Mrs. Raisin. Ihre Quiche sieht köstlich aus.«
»Ach, werfen Sie sie meinetwegen weg«, fauchte Agatha. »Meine war die beste. Dieser Wettbewerb ist eine Lachnummer.«
Mrs. Bloxby bedachte Agatha mit einem ebenso traurigen wie vorwurfsvollen Blick, bevor sie ging.
Agatha war mulmig zumute. Sie hätte gegenüber der Vikarsfrau nicht so zickig sein dürfen. Mrs. Bloxby schien eine nette Frau zu sein. Aber leider kannte Agatha nur drei Formen von Gespräch, und in denen ging es darum, ihren Mitarbeitern Befehle zu erteilen, den Medien Aufmerksamkeit abzuringen oder ihren Kunden zu schmeicheln. Irgendwo in ihrem Hinterkopf regte sich der vage Gedanke, dass Agatha Raisin unter Umständen kein besonders liebenswerter Mensch war.
An diesem Abend ging sie hinunter zum Red Lion. Der Pub war wirklich ganz hübsch, fand sie, als sie sich in dem niedrigen, verqualmten Lokal umsah. Der Fußboden war aus Stein, in großen Schalen standen Frühlingsblumen, und die bequemen Stühle und befestigten Tische hatten eine anständige Höhe zum Essen und Trinken, nicht wie diese »Cocktail«-Tischchen in Kniehöhe, bei denen man sich den Magen einklemmte, um an sein Essen zu gelangen. Einige Männer waren an der Bar. Sie lächelten und nickten Agatha zu, dann unterhielten sie sich weiter. Agatha bemerkte eine Schiefertafel, auf der die angebotenen Speisen standen. Nachdem sie bei der hübschen Wirtstochter Lasagne und Pommes frites bestellt hatte, zog sie sich mit ihrem Getränk an einen Ecktisch zurück. Wie damals als Kind sehnte sie sich danach, zu diesen Leuten zu gehören, Teil dieser alten, ländlichen Tradition voller Schönheit und Sicherheit zu sein. Doch sie war eine Außenseiterin. Hatte sie eigentlich je irgendwo dazugehört, abgesehen von der flüchtigen Welt der PR? Wenn sie jetzt tot umfiele, gleich hier und jetzt auf den Fußboden des Pubs, würde dann irgendjemand um sie trauern? Ihre Eltern waren tot. Gott allein wusste, wo ihr Mann steckte, und auch der würde ihr gewiss keine Träne nachweinen. Mist, der Gin zieht einen runter, dachte Agatha verärgert und bestellte sich ein Glas Weißwein zur Lasagne. Letztere war eindeutig in der Mikrowelle erhitzt worden, so fest wie sie am Boden der Form klebte.
Aber die Pommes frites waren gut. Das Leben hielt eben doch kleine Freuden bereit.
Mrs. Cummings-Browne wollte sich auf den Weg zur Probe von Blithe Spirit im Gemeindesaal machen. Sie führte die Regie bei der Carsely Dramatic Society und bemühte sich vergebens, ihren Laienschauspielern den Gloucestershire-Akzent auszutreiben. »Warum kann nur keiner von ihnen vernünftig sprechen?«, jammerte sie, als sie ihre Handtasche holte. »Sie hören sich an, als würden sie Schweine ausweiden oder was immer man mit Schweinen tut. Apropos Schweine, ich habe die Quiche dieser furchtbaren Mrs. Raisin mitgebracht. Sie wollte sie nicht und meinte, wir sollen sie wegwerfen. Ich dachte, du magst vielleicht etwas davon zum Abendessen. In der Küche stehen ein paar Stücke. Ich hatte reichlich Kuchen und Tee, also esse ich heute nichts mehr.«
»Ich glaube, ich esse auch nichts mehr«, sagte Mr. Cummings-Browne.
»Tja, falls du es dir anders überlegst, kannst du die Quiche in der Mikrowelle aufwärmen.«
Mr. Cummings-Browne trank einen Whisky und sah fern, bedauerte allerdings, dass es vor neun Uhr war und mithin ausgeschlossen, nackte Haut zu sehen zu bekommen. Also begnügte er sich mit Natursendungen von kopulierenden Tieren. Er gönnte sich noch einen Whisky und bekam Hunger. Die Quiche fiel ihm wieder ein. Es hatte Spaß gemacht, Agatha Raisins Miene bei dem Wettbewerb zu beobachten. Sie hatte allen Ernstes erwartet, dass er sich für das spendierte Abendessen revanchierte, diese dumme Pute! Leute wie Agatha Raisin, diese Yuppiefrauen mittleren Alters, kannten einfach keine Manieren. Er ging in die Küche, stellte zwei Stücke Quiche in die Mikrowelle, entkorkte eine Flasche Claret und schenkte sich ein Glas ein. Dann nahm er sich ein Tablett für den Teller und das Glas und trug alles ins Wohnzimmer, wo er sich wieder vor den Fernseher setzte.
Zwei Stunden später und kurz vor der angekündigten Gruppenvergewaltigung in dem Film, den er inzwischen sah, begann sein Mund zu brennen, als stünde er in Flammen. Er fühlte sich todkrank, kippte vornüber aus seinem Sessel und wand sich würgend auf dem Teppich. Noch während er versuchte, zum Telefon zu kriechen, verlor er das Bewusstsein – ausgestreckt hinter dem Sofa liegend.
Mrs. Cummings-Browne kam kurz nach Mitternacht nach Hause. Sie sah ihren Mann nicht, weil er hinter der Couch lag. Ebenso wenig bemerkte sie im dämmrigen Licht die Lachen von Erbrochenem. Ärgerlich murmelte sie vor sich hin, löschte die Lampe und schaltete den Fernseher aus.
Dann ging sie in ihr Schlafzimmer – es war lange her, seit sie eines mit ihrem Mann geteilt hatte –, entfernte ihr Make-up, zog sich aus und schlief bald tief und fest.
Mrs. Simpson traf früh am nächsten Morgen ein. Auch sie war verärgert, weil ihr Arbeitsplan durcheinandergebracht worden war. Erst war da der Wechsel von Mrs. Barr zu Mrs. Raisin, und nun bestand Mrs. Cummings-Browne darauf, dass sie am Sonntagmorgen bei ihr putzte, weil die Cummings-Brownes am Montag in die Toskana reisen wollten und das Haus vorher sauber sein sollte. Aber wenn sie sich richtig anstrengte, konnte sie es immer noch rechtzeitig zu ihrem Job im Supermarkt von Evesham schaffen, der um zehn Uhr begann.
Sie ließ sich selbst mit dem Ersatzschlüssel unter der Fußmatte herein, brühte sich eine Tasse Kaffee auf und trank sie am Küchentisch. Dann fing sie mit der Küche an. Sie hätte lieber als Erstes die Schlafzimmer gemacht, aber sie wusste ja, dass die Cummings-Brownes lange schliefen. Sollten sie jedoch nicht wach sein, bis sie mit dem Wohnzimmer fertig war, musste sie die beiden wohl oder übel wecken. Die Küche hatte sie in Rekordzeit geputzt und ging zum Wohnzimmer, aus dem ihr ein säuerlicher Geruch entgegenschlug. Sie rümpfte die Nase und ging um das Sofa herum zum Fenster, um es aufzureißen, als sie mit dem Fuß gegen die Leiche von Mr. Cummings-Browne stieß. Das Gesicht verzerrt und bläulich lag er zusammengekrümmt am Boden. Mrs. Simpson wich zurück und hielt sich beide Hände vor den Mund. Unwillkürlich dachte sie, dass Mrs. Cummings-Browne aushäusig sein musste. Das Telefon stand auf dem Fensterbrett. Mrs. Simpson nahm all ihren Mut zusammen, beugte sich über den Toten und wählte den Notruf. Auf die Frage der Zentrale sagte sie, dass in dem Haus ein Krankenwagen und die Polizei gebraucht würden. Hinterher schloss sie sich in der Küche ein und wartete. Sie kam gar nicht auf die Idee nachzusehen, ob Mr. Cummings-Browne wirklich tot war, oder nach draußen zu laufen und um Hilfe zu rufen. Stattdessen hockte sie am Küchentisch, die Hände wie zum Gebet gefaltet, und war starr vor Schreck.
Der örtliche Polizist traf als Erster ein. Police Constable Fred Griggs war ein dicker, fröhlicher Kerl, der gewöhnlich damit zu tun hatte, gestohlene Autos während der Urlaubssaison zu suchen und den einen oder anderen angetrunkenen Fahrer zu verwarnen.
Er beugte sich gerade über die Leiche, als der Krankenwagen vorfuhr.
Inmitten des ganzen Gewusels erschien Mrs. Cummings-Browne auf der Treppe, einen karierten Morgenmantel um sich geschlungen.
Als man ihr sagte, dass ihr Ehemann tot sei, griff sie nach dem Treppenpfosten und sagte völlig entgeistert: »Nein, das kann nicht sein! Er war nicht mal hier, als ich nach Hause kam. Er hatte zu hohen Blutdruck. Es muss ein Schlaganfall gewesen sein.«
Doch Fred Griggs waren die Pfützen von getrocknetem Erbrochenem aufgefallen und das verzerrte bläuliche Gesicht des Toten. »Wir dürfen nichts anfassen«, sagte er zu den Sanitätern. »Ich bin mir verdammt noch mal ziemlich sicher, dass er vergiftet wurde.«
Agatha Raisin ging am Sonntagmorgen in die Kirche. Sie erinnerte sich nicht, jemals zuvor in einer Kirche gewesen zu sein, glaubte jedoch, dass hinzugehen eines der Dinge war, die man einfach tat, wenn man in einem Dorf lebte. Der Gottesdienst begann früh, um halb neun, weil der Vikar anschließend noch in zwei Nachbardörfern predigen musste.
Sie sah P. C. Griggs’ Wagen und einen Krankenwagen vor dem Haus der Cummings-Brownes stehen. »Was wohl passiert sein mag?«, fragte Mrs. Bloxby. »Mr. Griggs sagt uns nichts. Ich hoffe, dem armen Mr. Cummings-Browne ist nichts Schlimmes zugestoßen.«
»Ich schon«, entgegnete Agatha. »Könnte keinen ›netteren‹ Kerl treffen.« Mit diesen Worten marschierte sie an der Pfarrersfrau vorbei in die dämmrige St. Jude Kirche. Drinnen nahm sie sich ein Gebet- und ein Gesangsbuch und setzte sich in die hinterste Bank. Sie trug ihr neues rotes Kleid und einen breitkrempigen schwarzen Strohhut mit roten Mohnblumen. Als die Gemeinde nach und nach eintraf, stellte Agatha fest, dass sie viel zu auffällig gekleidet war. Alle anderen waren in ihren Alltagssachen gekommen.
Beim ersten Lied hörte Agatha die sich nähernden Polizeisirenen. Was in aller Welt war geschehen? Falls einer der Cummings-Brownes tot umgefallen sein sollte, würde es doch sicher nicht mehr brauchen als einen Krankenwagen und den hiesigen Polizisten. Die Kirche war klein, im 14. Jahrhundert erbaut, mit hübschen farbigen Fenstern und wunderschönen Blumenarrangements drinnen. Hier wurde die alte anglikanische Bibel benutzt und aus dem Alten wie dem Neuen Testament gelesen. Unterdessen rutschte Agatha unruhig auf ihrer Kirchenbank herum und fragte sich, ob sie sich nach draußen schleichen und herausfinden könnte, was vorgefallen war.