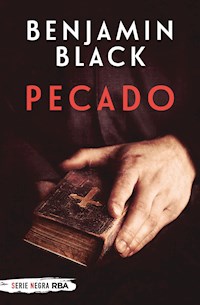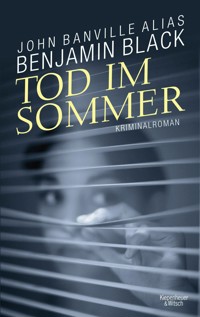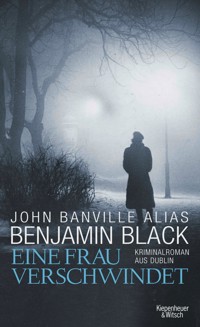9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Ein spannender und kenntnisreicher Krimi um den exzentrischen Kaiser Rudolf II. Christian Stern, unehelicher Sohn des Bischofs von Regensburg, kommt im Winter 1599 nach Prag, um dort sein Glück zu machen. Doch gleich in der ersten Nacht findet er die Leiche eines Mädchens. Christian wird zum Ermittler wider Willen. Winter 1599: Christian Stern, ein ehrgeiziger junger Gelehrter und Alchimist, will am Hof des paranoiden und unberechenbaren Habsburgers Rudolf II Karriere machen. Doch schon in der ersten Nacht findet er die Leiche einer jungen Frau, Magdalena, gerade erst 16 Jahre alt, in einer Gasse gleich neben dem Schloss. Ihr wurde die Kehle durchgeschnitten, sie trägt ein Samtkleid und ein goldenes Medaillon und ist ganz offenbar von edler Herkunft. Christian gerät in Verdacht – und in den Bannkreis skrupelloser Höflinge, die durch finstere Machenschaften versuchen, sich Vorteile zu verschaffen. Bald zieht Christian die Aufmerksamkeit des Kaisers selbst auf sich. Doch mit der kaiserlichen Gunst wächst die Furcht, dass es in diesem Ränkespiel auch um sein eigenes Leben gehen könnte. »Das große Lesevergnügen besteht im Heraufbeschwören von Prag als einer Stadt der Maskierung und des Scheins.« The Guardian
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 464
Ähnliche
Benjamin Black
John Banville alias Benjamin Black
Alchimie einer Mordnacht
Ein historischer Kriminalroman
Aus dem Englischen von Elke Link
Kurzübersicht
> Buch lesen
> Titelseite
> Inhaltsverzeichnis
> Über Benjamin Black
> Über dieses Buch
> Impressum
> Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
Inhaltsverzeichnis
I. Dezember 1599
1
Kaum einer entsinnt sich heute noch, dass ich es war, der in jener Nacht im Goldenen Gässchen die Leiche von Dr. Krolls unglückseliger Tochter im Schnee fand. Die wankelmütige Muse der Geschichtsschreibung hat den Namen Christian Stern aus ihren immerwährenden Rollen so gut wie ausradiert, doch ich habe oft Anlass zu denken, wie viel besser es doch für mich gewesen wäre, niemals erst darin enthalten gewesen zu sein. Ich sollte hoch aufsteigen, mit prachtvollem Gefieder, doch am Ende fiel ich mit flammenden Schwingen wieder auf die Erde hinab.
Es war mitten im Winter. Über dem Hradschin, der massig über dem schmalen Gässchen mit der Leiche aufragte, hing schief die Sichel des Mondes. Wie viele Sterne dort leuchteten! Eine Fülle von Edelsteinen, ausgestreut über eine Kuppel aus straffer schwarzer Seide. Seit meiner Kindheit faszinierten mich die Geheimnisse des Alls, und ich wollte die geheimnisvollen Harmonien am Himmel begreifen. In jener Nacht war ich allerdings betrunken, und die juwelenhaft funkelnden Lichter schwankten und wankten schwindelerregend über mir. Ich war reichlich benebelt, und es ist ein Wunder, dass ich die junge Frau überhaupt bemerkte, die tot im finsteren Schatten der Burgmauer lag.
Ich war erst am Tag in Prag angekommen. Bei Einbruch der Dunkelheit passierte ich nach einer beschwerlichen Reise aus Regensburg eines der südlichen Tore der Stadt. Die Wege waren zerfurcht, und die Moldau war von einem Ufer zum anderen zugefroren. Ich kam im Blauen Elefanten unter, einer schlichten Herberge auf der Kleinseite, wo ich gar nichts mehr erbat, sondern mich noch in Reisekleidern auf das Bett fallen ließ, sobald ich auf dem Zimmer war. An Schlaf war jedoch nicht zu denken, denn unter der Decke wimmelte es von Läusen, und im Zimmer nebenan lag ein Edelsteinhändler aus Antwerpen im Sterben, der unablässig hustete und heulte.
Obwohl ich hundemüde war, stand ich schließlich doch noch auf und ging hinunter in die Schenke. Ich setzte mich auf einen Hocker in der Kaminecke, trank Schnaps und aß Bratwurst mit Schwarzbrot. Ein alter Soldat, grau und struppig, leistete mir Gesellschaft und unterhielt mich mit alten blutrünstigen Geschichten aus seiner Zeit als Söldner in den Niederlanden unter dem Herzog von Alba.
Es war nach Mitternacht, und das Feuer im Kamin war längst heruntergebrannt. Wir beide, ordentlich betrunken, kamen auf eine, wie wir damals fanden, ganz famose Idee, nämlich hinauszugehen, um die verschneite Stadt im Sternenlicht zu bewundern. Die Straßen waren verlassen: Außer uns war niemand so dumm, sich in dieser Eiseskälte im Freien aufzuhalten. Ich blieb in einer geschützten Ecke stehen, um meine zum Platzen gefüllte Blase zu leeren, da zog der alte Bursche brabbelnd und singend davon. Ein Nachtvogel stieß über mir durch die Dunkelheit herab, eine lautlose Gestalt mit bleichen Flügeln, kaum war sie da, war sie auch schon wieder weg. Mir die Kniehose zuknöpfend – eine Sache, die nicht leicht zu bewerkstelligen ist, wenn man getrunken hat und einem die Finger abfrieren – machte ich mich auf den Rückweg zur Herberge. Zumindest glaubte ich das. Doch ich verirrte mich sofort in dem Labyrinth aus verwinkelten Straßen und Sackgassen unterhalb der Burg, wo, das schwöre ich, der Fäkaliengestank alle Osmanen vertrieben hätte.
Wie ich es schaffte, von dort aus im Goldenen Gässchen zu landen, kann ich nicht erklären. Auch Fortuna ist ein launisches weibliches Wesen.
Ich war noch ein junger Mann, gerade einmal fünfundzwanzig, klug, flink und ehrgeizig, und die Welt lag mir zu Füßen, bereit, von mir erobert zu werden, auf jeden Fall stellte ich mir das so vor. Mein Vater war kein Geringerer als der Fürstbischof von Regensburg, meine Mutter Dienstmagd im Bischofspalast: Ich war also ein Bastard, aber fest entschlossen, kein Nichtsnutz zu werden. Meine Mutter starb, als ich noch ein Säugling war, und der Bischof brachte mich bei einem kinderlosen Ehepaar unter, einem Willebrand Stern und seinem zänkischen Weib. Sie gaben mir ihren Namen und versuchten, mich gottesfürchtig großzuziehen. Will meinen, sie ließen mich halb verhungern und schlugen mich regelmäßig wegen meiner angeblich unverbesserlichen Sündhaftigkeit. Mehr als einmal lief ich aus dem freudlosen Haus der Sterns in der Pfauengasse davon, doch jedes Mal wurde ich aufgegriffen und zurückgebracht, um wieder, und zwar mit doppelter Härte, verdroschen zu werden.
Von Beginn an besaß ich einen großen und umfassenden Wissensdurst, und bald schon war ich trotz meiner jungen Jahre Experte in Naturphilosophie und studierte begierig, wenn auch skeptisch, den Okkultismus. Ich hatte das Glück, eine solide Ausbildung zu bekommen, dank meines Vaters, des Bischofs, der darauf bestand, dass ich das Regensburger Gymnasium besuchte, auch wenn es Ziehvater Stern lieber gewesen wäre, mich sogleich zu einem Hufschmied in die Lehre zu schicken. In der Schule tat ich mich im Quadrivium hervor und zeigte eine besondere Begabung für Arithmetik, Geometrie und Kosmologie. Als Student arbeitete ich hart, und dazu war ich auch noch klug – mehr als klug –, sodass ich im Alter von fünfzehn Jahren, bereits größer und stärker als mein Ziehvater, an der Universität von Würzburg eingeschrieben war.
Es war eine glückliche Zeit, vielleicht die glücklichste meines Lebens, dort oben im guten alten Frankenland, wo ich weise und achtsame Lehrer hatte und bald einen großen Wissensschatz ansammelte. Nach Abschluss meiner Studien blieb ich an der Universität und verdiente mir eine Art Lebensunterhalt, indem ich den tumben Söhnen der reichen Kaufleute der Stadt Nachhilfe gab. Aber ein Leben in der Akademie konnte einen Mann mit einer so eigenwilligen und zielstrebigen Persönlichkeit, wie ich sie besaß, nicht lange zufriedenstellen.
Die Sterns ließen mich nur ungern nach Würzburg ziehen, jedoch nicht wegen ihrer Zuneigung zu mir, sondern weil mit mir auch die monatliche Zuwendung des Bischofs aus ihrem Leben verschwand. Am Tag meiner Abreise schwor ich mir, meinen Zieheltern nie mehr zu begegnen, und diesen Schwur habe ich gehalten. Ich sollte nur noch einmal nach Regensburg zurückkehren, ein Jahrzehnt später. Die Sterns waren tot, und ich sollte ihr Erbe antreten. Es handelte sich lediglich um eine Handvoll Gulden, kaum die Reise aus Würzburg wert, aber es genügte, um meine Weiterfahrt nach Prag zu finanzieren, der Hauptstadt der Magie, nach der ich mich mein Leben lang gesehnt hatte.
Auch der Bischof war vor Kurzem gestorben. Als ich wohl oder übel meine Pflicht erfüllt und seine letzte Ruhestätte besucht hatte und mit noch größerem Widerstreben auch die der Sterns, verließ ich Regensburg, so schnell mein alter Gaul mich tragen wollte. An meiner Brust steckte ein kalbsledernes Futteral mit einem Empfehlungsschreiben, das ich mir mit wenig Hoffnung darauf, erhört zu werden, von Seiner Gnaden erbeten hatte, als er im Sterben lag. Aber auf dem Sterbebett ließ der bedeutende Mann einen Schreiber kommen, um das Dokument aufzusetzen, das er ordnungsgemäß unterzeichnete und postwendend seinem zudringlichen Sohn schickte.
Dieser Gefallen seitens meines Vaters wurde von einem Beutel mit einer nicht unerheblichen Menge an Gold und Silber begleitet. Der Brief und das Geld überraschten mich: Mir war durchaus bewusst, dass ich keineswegs der Liebling in der Schar seiner zahlreichen unehelichen Nachkommenschaft war. Vielleicht hatte er gehört, dass ich einen Gelehrten aus mir gemacht hatte, und hoffte, ich würde in seine Fußstapfen treten und Prälat werden. Doch sollte der alte Mann das wirklich geglaubt haben, dann kannte er seinen Sohn bei Gott nicht.
Außerdem – ich entdeckte ihn nur zufällig ganz unten in dem Beutel – schickte er mir einen Goldring mit, der wohl meiner Mutter gehört haben musste. Konnte es sein, dass er ihr diesen schlichten goldenen Ring als heimliches Zeichen der Zuneigung – gar Liebe – geschenkt hatte? Diese Möglichkeit verstörte mich. Ich hatte mich entschlossen, in meinem Vater ein Ungeheuer zu sehen, und wollte mir eigentlich keine neue Meinung bilden.
So kam ich gegen Ende des Jahres des Herrn 1599 nach Prag, während der Herrschaft Rudolfs II. aus dem Hause Habsburg, König von Ungarn und Böhmen, Erzherzog von Österreich und Kaiser des Heiligen Römischen Reichs. Es war eine glücklichere Zeit, eine Ära des Friedens, lange bevor dieser schreckliche Krieg der Religionen – der nun seit nahezu dreißig Jahren herrscht –, die Welt mit Gemetzel, Bränden und Ruinen überzog. Rudolf mag durchaus mehr als nur ein bisschen verrückt gewesen sein, aber er war allen gegenüber tolerant und hielt den Glauben jedes Menschen, ob Christ, Jude oder Muselmann, für die Sache des Einzelnen und nicht für eine Angelegenheit von Staat, Monarch oder Marschall.
Wie weithin bekannt ist, war Rudolf seiner Geburtsstadt Wien nicht gewogen, und er verlor keine Zeit, den kaiserlichen Hof nach Prag zu verlegen, und zwar im Jahr – ach, das Jahr vergesse ich immer wieder, dieser Tage habe ich ein Gedächtnis wie ein Sieb. Nicht jedoch vergesse ich, warum ich damals in die Hauptstadt des Kaiserreichs kam. Ich wollte nichts weniger als die Gunst des Kaisers erlangen und mir einen Platz unter den zahlreichen Gelehrten sichern, die zur Freude und unter Anleitung Seiner Majestät in der legendären Werkstatt in der Burg auf dem Hradschin arbeiteten. Die meisten waren Alchimisten, jedoch nicht alle: Bei Hof gab es auch weise Gelehrte, insbesondere den Astronomen Johannes Kepler und den adeligen Dänen Tycho Brahe, Rudolfs Hofmathematiker, beides bedeutende Männer, jedoch war Kepler der weitaus Gewichtigere.
Ich hatte mir kein leichtes Ziel gesetzt. Es war weithin bekannt, und auch ich wusste es, dass Rudolf kein großer Menschenfreund war. Jahrelang hatte sich Seine Majestät nur in seinen Privatgemächern in der Burg aufgehalten, alte Texte studiert und in seinen Wunderkammern gegrübelt. Wochenlang zeigte er sich nicht einmal den vertrautesten seiner Höflinge. Er ließ Abgesandte der erlauchtesten Fürsten ein halbes Jahr oder länger warten, bis er ihnen eine Audienz gewährte. Aber was ging mich das an? Ich wollte ohne Hemmnis und Verzug direkt ins Herz des Kaiserreichs vordringen, welche Mittel oder Listen auch dazu nötig sein mochten, so groß war mein Ehrgeiz und so stark mein Selbstvertrauen.
Gedanken an die königliche Gunst waren mir in jener Nacht im Goldenen Gässchen jedoch fern. Ich stand schwankend, stöhnend und benebelt da und starrte in meinem betrunkenen Elend mit trüben Augen auf die ausgestreckt im Schnee liegende Leiche der jungen Frau.
Zuerst dachte ich, sie wäre alt, ein verhutzeltes altes Weiblein. Wahrscheinlich war ich nicht in der Lage, mir vorzustellen, dass ein so junger Mensch so grausam, so unwiderruflich tot sein konnte. Sie lag auf dem Rücken, das Gesicht zum Himmel gerichtet, und hätte gut und gerne auch gleichmütig die ebenso gleichmütigen Sterne über sich am Himmel betrachten können. Arme und Beine waren verdreht und lagen schlaff da, als wäre die Frau mitten in einem grotesken Tanz erschöpft zusammengebrochen.
Dann sah ich genauer hin und stellte fest, dass sie überhaupt nicht alt war. Vielmehr handelte es sich um ein Mädchen von nicht mehr als siebzehn oder achtzehn Jahren.
Weshalb war sie in so einer Nacht unterwegs gewesen? Sie trug keinen Umhang, sondern nur ein Gewand aus dunklem besticktem Samt und Filzpantoffeln, kaum geeignet als Schutz gegen Kälte und Schnee. Hatte man sie aus einem Haus in der Nähe hergebracht und ihr an dieser Stelle das Leben genommen? Sie musste schon einige Zeit dort gelegen haben, denn neben ihr war auf einer Seite schon Schnee angeweht. Wahrscheinlich wäre sie gänzlich von Schnee bedeckt, wären nicht die Flocken, die auf sie niederfielen, durch ihre – obschon nachlassende – Körperwärme geschmolzen. Als ich ihr Gewand berührte, zog ich ruckartig die Hand zurück und fröstelte, denn der nasse Samt war spröde und scharfkantig vom Eis. Ich fühlte mich an das gefrorene Fell des toten Hundes erinnert, den ich als Junge in den Armen gehalten hatte. Es war ein Haushund, den mein Ziehvater, der alte Stern, die ganze Nacht über ausgesperrt hatte, sodass er in der winterlichen Kälte krepiert war.
Aber nun diese junge Frau hier, brutal ermordet! Ich stand einfach nur hilflos da und betrachtete sie voller Mitleid und Bestürzung. Ihre Augen waren ein klein wenig geöffnet, und das fahle Licht der Sterne schien auf die Augäpfel, deren glasige Oberfläche an trübes Perlmutt erinnerte. Auf mich wirkten diese Augen toter als der Körper der Frau.
Lange stand ich vornübergebeugt da, die Hände auf die Knie gestützt, trunken schwankend und schwer atmend. Ab und an entfuhr mir fröstelnd ein rauer Seufzer. Welch seltsame Macht übte diese Frau noch im Tode aus? Wie konnte sie mich hier festhalten, obwohl es mich drängte, von hier zu fliehen und so schnell als möglich wieder Zuflucht im Blauen Elefanten zu suchen? Vielleicht wirkte noch etwas von ihrem Geist nach, ein schwindendes Licht, vielleicht sollte ich, als das einzige lebende Wesen im Umkreis, bei ihr verweilen und Zeuge des allerletzten Aufflackerns der Flamme werden. Auch wenn sie stumm sind, die Toten klagen ihre Rechte ein.
Ihr Kopf war von einer Art Gloriole umgeben, die jedoch nicht strahlte, sondern sich im Gegenteil tiefschwarz glänzend von dem weißen Schnee abhob. Zunächst konnte ich mir keinen Reim darauf machen, aber als ich mich tiefer hinabbeugte, entdeckte ich gleich über der Spitzenkrause einen klaffenden Schnitt quer über der Kehle, wie ein zweiter, grotesk geöffneter Mund. Da begriff ich, dass ihr Kopf in einer Lache ihres eigenen Blutes lag, einem schwarzen Kreis, in dem sich schwach der funkelnde Himmel spiegelte.
Doch selbst dann verweilte ich noch, in elender Erregung, als wären meine Füße am Boden festgewachsen. Ich beschwor mich, mich abzuwenden, jetzt sofort, in diesem Augenblick, und die Beine in die Hand zu nehmen. Niemand hatte mich kommen und niemand würde mich gehen sehen. Sicher, es lag frisch gefallener Schnee, und meine Stiefel hinterließen Abdrücke darin, aber wer sollte behaupten, dies seien die Abdrücke meiner Stiefel, und wer sollte meiner Spur folgen?
Immer noch stand ich wie angewurzelt da und konnte mich dem leisen Griff der toten Hand, die mich dort festhielt, nicht entziehen. Gern hätte ich ihr das Gesicht zugedeckt, aber ich hatte keinen Umhang, nicht einmal ein Taschentuch, und ich war nicht bereit, in einer so bitterkalten Nacht meinen Biberfellmantel abzutreten, so stark das natürliche Gebot, sie in der Schande eines solchen Todes vor dem leeren, herzlosen Blick der Welt zu schützen, auch sein mochte.
Ich ging auf ein Knie und versuchte, sie an den Schultern zu heben, doch durch die Totenstarre und den Frost war sie schon ganz steif. Außerdem war ihr Gewand an dem Eis auf den Pflastersteinen festgefroren und ließ sich nicht davon lösen. Als ich mich mühte, sie hochzuheben – zu welchem Behufe genau hätte ich kaum sagen können –, nahm ich einen schweren, süßlichen Geruch wahr, den ich der Pfütze dunklen Blutes hinter ihrem Kopf zuschrieb, auch wenn es, genau wie alles andere, steifgefroren war.
Als ich sie losließ und einen Schritt zurückwich, entfuhr ihr ein lang gezogener, rasselnder Seufzer. In Würzburg hatte ich zwölf Monate Medizin studiert und wusste daher, dass Leichen manchmal solche Geräusche von sich geben, da sich die inneren Organe verschieben und senken, bevor sie sich auflösen. Nichtsdestotrotz standen mir alle Haare zu Berge.
Ich ging wieder in die Hocke und untersuchte die Wunde an ihrem Hals genauer. Es war kein glatter Schnitt wie von einer scharfen Klinge, sondern er war unregelmäßig und ausgefranst, als wäre ein beutehungriges Tier über sie hergefallen und hätte ihr die Reißzähne ins zarte Fleisch geschlagen und es aufgerissen.
Mir fiel außerdem auf, dass sie eine schwere Goldkette trug. An der Kette hing ein Medaillon, ebenfalls aus Gold. Es war rund und groß, mit gezahnten Rändern, ein Medusenkopf vielleicht oder ein Abbild der großen Sonnenscheibe selbst.
Schließlich befreite ich mich aus dem kalten Griff der Toten. Ich wandte mich ab und taumelte durch die Gasse davon, auf der Suche nach Hilfe, auch wenn das arme Geschöpf ganz sicherlich weit jenseits jeglichen menschlichen Beistands war. Der Tod ist der Tod, was auch immer die Priester oder die Nekromanten – wenn es überhaupt einen Unterschied zwischen den beiden gibt – uns glauben machen wollen, und dann ist es zu Ende, unsere Zeit als Erdenbürger ist vorüber.
Die kleinen Häuschen, an denen ich vorbeikam, waren verschlossen und still. In keinem der Fenster war auch nur ein Spalt Licht zu sehen. Doch trotz der späten Stunde und obwohl der Ort so einen verlassenen Eindruck machte, war es mir, als würde ich heimlich von zahllosen wachen, aufmerksamen Augen beobachtet.
Meine Füße wurden taub von der Kälte, während meine ebenso kalten Hände unter der Haut fieberheiß brannten. Ich fühlte mich seltsam losgelöst, von meiner Umgebung und auch von mir selbst, als hätte der Tod auch mich berührt, mich ganz leicht mit einer eisigen Fingerspitze gestreift. Ich dachte an den Schnaps – wie viele Gläser hatten der alte Soldat und ich gekippt, als wir im Blauen Elefanten am Ofen saßen? Jetzt dürstete mich nach einem Schluck, ja nur einem kleinen Schluck von diesem feurigen Zeug, um mir das Blut zu wärmen und meine wirren, rasenden Gedanken zu beruhigen.
Nachdem ich eine Weile unten an den Festungsmauern entlanggegangen war, während der Schnee unter meinen Stiefeln knirschte und mein Atem geisterhafte Gestalten in der Luft bildete, kam ich an ein Tor mit einem Fallgatter. Rechts vom Tor war ein Wachhäuschen, innen schwach von einer Laterne beleuchtet, die aber in der schwarzen Nacht sehr hell wirkte. Der Wächter war im Stehen eingeschlafen, auf seinen Spieß gestützt. Er war klein und dick, sein Bauch war rund und fest wie ein Bierfass. In einem Kohlenbecken neben ihm glühte ein Feuer aus Seekohle, und ein wenig von dieser einladenden Wärme gelangte sogar bis zu der Stelle, an der ich stand.
Ich rief laut und stampfte fest auf, bis sich schließlich die Augenlider des Wächters flatternd öffneten. Er glotzte mich verständnislos an, noch halb im Schlaf. Als er dann mehr oder weniger zur Besinnung kam und sich erinnerte, wen und was er darstellte, brachte er sich ächzend und mit klirrendem Kettenhemd in Habachtstellung. Er rückte sich den Helm gerade, balancierte theatralisch seine Lanze und richtete die Spitze drohend auf mich, während er mit belegter Stimme und nuschelnd zu wissen begehrte, wer ich denn sei und was ich da zu schaffen habe.
Ich nannte ihm meinen Namen, musste ihn aber wiederholen, und beim zweiten Mal schrie ich ihn dem Kerl geradezu ins Gesicht.
»Stern!«, brüllte ich. »Christian Stern!«
Ich sollte vielleicht zugeben, dass ich damals eine hohe Meinung von meinem Namen hatte, denn ich sah ihn schon auf den Rücken einer ganzen Reihe gelehrter Bände prangen, die ich zweifellos eines Tages verfassen würde.
Der Wächter stand da und blickte mit stumpfen Augen und blinzelnd zu mir auf. Ich erzählte ihm, wie ich zufällig auf die junge Frau gestoßen war, die im Schnee auf den Steinen unter der Burgmauer lag, den Hals von einem Ohrläppchen zum anderen aufgeschlitzt. Als er meine Geschichte gehört hatte, räusperte sich der Bursche und spuckte einen Schleimklumpen über die halbhohe Tür, der platschend direkt vor dem großen Zeh meines rechten Stiefels auftraf. Ich stellte mir vor, wie ich dem ungehobelten Kerl just mit diesem Zeh einen saftigen Tritt in die Weichteile unterhalb seines Hängebauchs versetzte.
»Was geht das mich an«, höhnte er, »wenn einer Metze die Luftröhre durchgeschnitten wird?«
»Das ist keine Metze.« Ich dachte an das Samtkleid und das goldene Medaillon an der Goldkette. »Im Gegenteil, ich nehme an, sie ist eine vornehme Dame.«
»Alle Huren von Prag bilden sich ein, sie wären hochwohlgeborene Damen«, sagte der Wächter voller Spott.
In jungen Jahren hatte ich ein hitziges Temperament, und ich zog es in Betracht, dem Burschen die Lanze zu entwinden und ihm mit selbiger für seine Frechheit einen Schlag auf den Helm zu verpassen. Doch ich hielt mich im Zaum und verlangte, man solle eine Obrigkeit darüber benachrichtigen, dass ein schweres Verbrechen begangen worden sei.
Darauf entgegnete der Wächter mit einem Lachen, es sei bereits eine Obrigkeit benachrichtigt worden, denn ich hätte es ihm ja gerade erzählt. Ganz offensichtlich hielt er das für eine selten geistreiche Bemerkung.
Ich seufzte. Mittlerweile waren meine Füße beinahe vollständig taub, und von den Knöcheln an abwärts spürte ich kaum mehr etwas. Was bedeutete mir denn diese Frau, fragte ich mich, und warum kümmerte ich mich so um etwas, das letztlich nichts anderes als eine Leiche war?
Nun kam noch ein weiterer Wächter. Das Knirschen seiner Stiefel auf dem Eis war zu hören, noch bevor er aus der nebligen, verschneiten Dunkelheit auftauchte wie ein gerade zum Geist gewordener Recke, der aus dem Rauch des Schlachtfelds aufsteigt. Sehr nach einem Recken sah er allerdings nicht aus mit seinen dünnen Armen und Beinen, so hager und schlaksig, wie er war. Über der Schulter trug er eine rostige Hakenbüchse. Er war gekommen, um seinen dicken Kollegen abzulösen. Meine Person blickte er gänzlich desinteressiert an und wischte sich mit einem Fingerknöchel die Nase ab. Nachdem die beiden ein paar Worte gewechselt hatten, nahm der Neuankömmling den Platz im Wachhäuschen ein, legte seine Waffe ab und wandte seinen dürren Rücken dankbar dem Becken mit den glühenden Kohlen zu.
Noch einmal drängte ich den dicken Wächter, mit mir zu kommen und sich die Leiche der jungen Frau anzusehen, um dann über die weiteren Schritte zu entscheiden.
»Lasst sie doch dem Nachtwächter«, antwortete er. »Der findet sie schon auf seiner Runde.«
Wenn er nicht sofort mit mir käme, drohte ich, würde ich umgehend einen wachhabenden Offizier rufen und Beschwerde gegen ihn einlegen. Natürlich war das nur ein Bluff, aber ich sprach mit solcher Autorität, dass der Bursche nach einem kurzen Zögern mit den Achseln zuckte und mich ärgerlich angrunzte, ich solle vorangehen.
Wir liefen wieder zurück durch die Gasse. Der Wächter watschelte mit krummen Beinen voran. Er war so verkümmert, dass er mit dem Schädel, rund wie ein Kohlkopf, kaum höher als bis zu meinem Ellbogen aufragte.
Die Leiche der jungen Frau lag noch so da, wie ich sie verlassen hatte. In der Zwischenzeit war niemand dort gewesen, denn die einzigen Fußabdrücke, die im Schnee sichtbar waren, waren meine.
Der dicke Kerl neben mir gab einen kehligen Laut von sich, kniff ein Auge zu und sog Luft durch die Zähne ein. Er trat vor und ging ächzend in die Hocke. Dann hob er das Medaillon an, legte es sich auf die Handfläche und begutachtete es im schwachen Licht der Sterne. Er stieß einen leisen Pfiff aus. »Das ist echtes Gold«, sagte er. »Fühlt mal, wie schwer.«
Was hat Gold nur an sich, dass alle Menschen sich der Kunst des Prüfens für mächtig halten? Das Gleiche gilt für Edelsteine, doch jedes alte geschliffene Glasstück kann für einen Edelstein erlesenster Qualität durchgehen, wie jeder Juwelier und jeder Taschendieb bestätigen werden.
Urplötzlich ließ der Bursche das Medaillon fallen, als hätte es ihm die Hand versengt. Er rappelte sich auf und taumelte entsetzt rückwärts. »Die kenne ich!«, brabbelte er. »Das Mädchen, das ist die Tochter von Kroll. Herr im Himmel!« Mit wildem Blick wandte er sich mir zu, dann blickte er in der Dunkelheit um sich, als fürchte er, eine Schar Meuchelmörder könnte dort irgendwo lauern, bereit zuzuschlagen.
»Kroll?«, fragte ich. »Und wer oder was ist Kroll, bitte?«
Der Wächter stieß ein verzweifeltes Lachen aus. »Ihr kennt Kroll nicht?«, fragte er. »Den Knochensäger des Kaisers und einer seiner wichtigsten Magier?« Wieder lachte er bitter. »Ich wage zu behaupten, den werdet Ihr bald kennenlernen, mein Freund.«
Und so kam es denn auch.
2
Als sie mich in meinem Quartier abholten, sollte es noch eine gute Weile dauern, bis der Tag anbrach. Ich erschrak sehr und ängstigte mich noch viel mehr, gleichwohl stellte ich fest, dass ich in meinem tiefsten Inneren nicht gänzlich überrascht war. Seit Adam den Apfel aß, schlummert wohl in jedem von uns die schuldbewusste Erwartung, mitten in der Nacht just so ein Hämmern an der Tür, barsche Stimmen in der Diele und schwere Stiefelschritte auf der Treppe zu vernehmen. Kein Mensch hält sich im Herzen für völlig unschuldig.
Als ich das laute Gepolter vernahm, sprang ich aus dem Bett auf und blickte panisch um mich, aber ich hatte nicht einmal ein Messer, um mich zu verteidigen. Verwirrt fragte ich mich, wie sie wohl in Erfahrung gebracht hatten, wo ich zu finden war. Nachdem der dicke Wächter in der Nacht die junge Frau für mich identifiziert hatte, hatte ich ihn zum Tor zurückbegleitet, wo er sich über die halbhohe Tür des Wachhäuschens hinweg dringlich mit seinem Waffenkameraden austauschte. In diesem Moment kam ich schließlich zur Besinnung – mittlerweile spürte ich den Schnaps kaum mehr. Ich zog mich bedächtig zurück und verschwand in der Nacht, um die beiden Wächter ihrem bangen Gespräch zu überlassen.
Im Blauen Elefanten musste ich lange draußen in der Kälte warten. Ich klopfte an der Haustür und blickte besorgt die Straße entlang, als endlich die Frau des Wirts herunterkam und mich einließ. Sie war aus dem Bett aufgestanden und trug ihr Nachtgewand, die Haare steckten unter einer zarten Nachthaube aus weißem Musselin. Sie war mir bereits bei meiner Ankunft aufgefallen, ein hübsches Ding mit rosigen Wangen und glänzenden schwarzen Locken, auch wenn sie, mit den Augen eines jungen Mannes betrachtet, für mich durchaus schon als reif gelten konnte.
Mit einem Kerzenhalter leuchtete sie mir den Weg in mein Zimmer. Dort angekommen, verweilte sie noch an der Tür, bedachte mich mit einem frechen Lächeln und einem Einblick in den Ausschnitt ihres locker sitzenden Hemdchens. Ich nahm ihren fraulichen Duft wahr, glaubte gar, das warme Glimmen ihrer Haut zu spüren. Der Kerzenschein machte ihre Züge weicher und strich die fein gefächerten Fältchen um Mundwinkel und Augen glatt. Ich hätte ihr unausgesprochenes Angebot sicherlich angenommen und sie mit aufs Zimmer und in mein Bett geholt, Läuse hin oder her, wäre mir nicht just in diesem Moment, wie eine furchtbare Warnung, klar und deutlich das diffuse Glitzern in den halb geöffneten, leblosen Augen der jungen Frau wieder in den Sinn gekommen, die unter der Burgmauer im Schnee lag, mit diesem schrecklichen zweiten Mund unter dem Kinn, der blutig aufklaffte.
Der Kaufmann nebenan gab mittlerweile Ruhe – vielleicht war es ihm endlich gelungen, zu sterben, was wusste ich schon. Trotzdem schlief ich kaum, und wenn doch, dann wurde ich geplagt von Träumen, die sich sogleich als Prophezeiung erweisen sollten – laute Schreie, Warnungen, hastige Schritte in der Dunkelheit von einem grell beleuchteten Fleck zum nächsten.
Als ich die Soldaten unten hörte, dachte ich zuerst daran, aus dem Fenster zu springen und zu fliehen, aber das Zimmer befand sich in einem oberen Stockwerk: Wäre ich gesprungen, ich wäre blutend und mit gebrochenen Knochen auf der Straße darunter gelandet. Schwerfällig vor Angst war ich noch nicht einmal halb aus dem Bett, als die Tür aufsprang und ein Trupp behelmter Gestalten samt Feldbinden und Stiefeln sich hereindrängte. Eine gepanzerte Faust packte mich unsanft an der Schulter und zerrte mich auf die Füße.
Dann wurde ich verprügelt und beschimpft, und man brüllte mir unverständliche Anweisungen entgegen. Die Soldaten warfen mir meine Kleidung hin und befahlen mir, mich sofort anzuziehen. Auf einem Bein hüpfend schlüpfte ich in die Hose und kassierte dabei einen Hieb auf den Schädel, sodass es mir in den Ohren klingelte. Angeblich war ich zu langsam. Dann wurde ich inmitten einer miefigen Mischung aus Schweiß und Stahl und dem rauen Atem grober Soldaten die Treppe hinuntergedrängt.
Als man mich durch den Hauseingang hinausführte, warf ich einen kurzen Blick über die Schulter und sah die Frau des Wirts mit ihrer Nachthaube. Sie lugte ängstlich hinter der Tür zur Schenke hervor. Ich sollte sie zum letzten Mal sehen, doch heute, viele Jahre später, rufe ich mir ihr Bild immer noch häufig ins Gedächtnis, so klar und deutlich, dass es schmerzt, und ich empfinde stets ein liebevolles und trauriges Bedauern über die verlorene Gelegenheit. Ist das Alter nicht unverbesserlich?
Glücklicherweise war es mir gelungen, noch schnell meine Jacke zu greifen, denn an dem immer noch dunklen Himmel waren schwere, dicke Wolken aufgezogen, und ein beißender Wind peitschte mir Schneeschauer ins Gesicht, wie halb gefrorene Spucke.
Als die Soldaten mein Zimmer gestürmt hatten, war es mir vorgekommen, als wären es mindestens ein Dutzend, aber jetzt stellte ich fest, dass es nicht mehr als vier waren. Wortlos und unerbittlich liefen sie scheppernd weiter und bildeten dabei ein Karree, eine Art wandernden Käfig, während ich mich keuchend und stolpernd mühte, mitzukommen. Sie gingen im Gleichschritt, sodass ich mir in der Mitte umso tollpatschiger und hilfloser vorkam.
Wir passierten ein Tor, breiter und vornehmer als das, wo ich Stunden zuvor auf den schlafenden Wächter getroffen war, dann gingen wir über einen gepflasterten Hof, rutschig von dem weichen Schnee, um anschließend drei breite Steintreppen hinaufzusteigen. Gefangen inmitten der bewaffneten Männer betrat ich eine kahle Halle mit einem unermesslich hohen Dach. Sie wurde von Binsenlichtern in Eisenhaltern erleuchtet, die auf halber Höhe der Wände angebracht waren. Es ist schon seltsam, auf welche Dinge sich die Angst verschiebt: Diese Lichter, die flackerten, rauchten und sich anhörten wie ein Flächenbrand, der in weiter Ferne wütete, kamen mir vor wie das Sinnbild aller düsteren Vorahnungen und Ängste.
Man führte mich zu einer breiten eichenen Tür mit eingelassenen metallenen Nieten so groß wie Männerfäuste. Die Tür öffnete sich zu einem weiteren Saal, etwas kleiner als der äußere, und die Decke dort war niedriger. Ein großer Tisch stand kantig und unerschütterlich in der Mitte, schwer wie ein Ochse auf seinen vier dicken Beinen, um ihn herum Stühle mit hohen Lehnen. Auch dieses Arrangement hatte etwas Unheimliches. Der Tisch war leer und glänzte auf eine seltsame Art unheilvoll, die großen Stühle standen reglos da, und doch schienen sie gespannt auf etwas zu warten, wie sprungbereite Jagdhunde auf den Pfiff ihres Herrn.
Gegenüber der Tür war ein Kamin mit offener Feuerstelle, in der man aufrecht hätte stehen können. Auf zwei hohen bronzenen Feuerböcken, die mit gegossenen Figuren von Tümmlern, Nereiden und sich windenden Wassermännern verziert waren, lag ein einziges brennendes Buchenholzscheit. Hier gab es keine Fackeln, und das einzige Licht kam vom Feuer.
Der Trupp Soldaten zog sich zurück, die Tür schloss sich hinter ihnen.
Ich stellte mich vor den Tisch, als wäre es der Richtstuhl Christi, und wartete auf ich weiß nicht was. Lediglich das Knistern der Flammen im Kamin und mein eigener schwerer Atem waren zu hören. Ich war froh über den Schein des Feuers und wollte gerade etwas näher herantreten, da erklang eine Stimme. Ich fuhr zusammen – ich hatte gedacht, außer mir sei niemand in dem Raum.
»Stern«, schnappte die Stimme. »So nennt Ihr Euch doch, wie?«
Ich blickte in die tanzenden Schatten, die das Feuer warf, und suchte nach der Herkunft dieser so schroff und rüde geäußerten Worte.
In der Düsternis links von dem Kamin machte ich einen großen, älteren Mann aus, den ich hinter der Lehne des dick gepolsterten thronähnlichen Sessels, in dem er gegenüber vom Feuer saß, vorher nicht gesehen hatte. Er schien zu schlafen, denn er lehnte kraftlos im Stuhl, das Kinn auf der Brust. Ein Arm hing schlaff herunter, doch die Augen waren geöffnet, in den Pupillen reflektierten sich die flackernden Flammen.
Aber das war nicht der Mann, der gesprochen hatte. Auf der rechten Seite des Kamins stand ein weiterer Mann, weit hinten, wo das Licht des Feuers kaum hingelangte. Er machte auf mich den Eindruck, recht schmal und schlank zu sein, ein kleiner Kopf, ein spitzer Bart über einer seidenen Halskrause, deren Weiß gespenstisch in der Düsternis leuchtete. Ich erinnerte mich an eine andere Halskrause, die ich vor Kurzem gesehen hatte, doch die war dunkel und steif von Blut gewesen.
»Ja«, gab ich zur Antwort. Ich musste mich räuspern, bevor ich weitersprechen konnte. »Ja, das ist mein Name.«
Der Mann im Schatten gab ein leises und ungläubiges Schnauben von sich und trat vor ins Licht.
Im Feuerschein wirkten seine Augen schwarz. Sie lagen nah beisammen, wie zwei winzige glänzend schwarze Perlen. Seine gräulichen Haare waren kurz geschnitten und wuchsen ihm in einer schmalen Spitze weit in die Stirn, ein Echo seines Spitzbarts. Er trug Wams und Hose. Seine Beine waren seltsam schlank und grazil, eher wie die einer Frau als eines Mannes. Er war mittleren Alters und wirkte scharfsinnig und wachsam. Mir gefiel sein Aussehen nicht im Mindesten, mit seinen stechenden Augen, dem spitzen Haaransatz und diesem satanischen Bart, der im modischen spanischen Stil geschnitten war.
»Und Ihr behauptet, von Regensburg aus hergekommen zu sein.« Er klang skeptisch und amüsiert.
»Ja«, antwortete ich. »Ich habe mich vor einer Woche in Regensburg aufgemacht und bin gestern Abend in Prag angekommen.«
»Regensburg«, wiederholte der Mann mit einem leisen, sarkastischen Lachen.
Ich war verwirrt: So wie er reagierte, hätte ich wohl genauso gut behaupten können, ich sei gerade aus Atlantis oder der sagenumwobenen Stadt Ur gekommen.
»Regensburg ist mein Geburtsort.« Ich sprach langsam und deutlich, wie zu einem Kind. »Allerdings war ich viele Jahre nicht mehr dort, denn ich studierte und lehrte dann an der Universität Würzburg.«
»Regensburg«, wiederholte der Mann noch einmal glucksend. »Würzburg!« Er wandte sich an den Mann in dem Sessel. »Wie glaubhaft diese im Westen liegenden Orte aus seinem Munde klingen, was, Doktor?«
Mittlerweile war ich völlig verunsichert. Ganz offenbar war der Mann mit der Halskrause davon überzeugt, dass ich log – aber weshalb sollte ich bei so simplen Dingen wie meinem Namen und meinem Geburtsort lügen? Und außerdem, warum verhörte er mich auf diese streitsüchtige Art und Weise? Ich hatte nichts angestellt. Es konnte doch sicherlich nicht gegen die Verordnungen der Stadt verstoßen, zufällig eine Leiche zu finden. Doch als hätte ich damit gerechnet, überkam mich wieder das leichte Schuldgefühl, das ich verspürt hatte, als ich die Absätze der Soldatenstiefel auf der Treppe im Blauen Elefanten gehört hatte.
Ich versuchte es noch einmal.
»Ich heiße Christian Stern.« Ich sprach jetzt noch langsamer und mit mehr Nachdruck. »Ich bin gestern Abend in Prag angekommen, aus Regensburg. In Regensburg wurde ich geboren, und dort lebte ich, bis ich, noch jung an Jahren, wegging, um an der Universität Würzburg zu studieren, und in Würzburg war ich einige Jahre als Student und danach als Lehrer.« Ich zögerte, dann fügte ich hinzu: »Ich werde mich nicht lange in Prag aufhalten, denn ich befinde mich eigentlich auf dem Weg nach Dresden.«
Das war nicht wahr, und ich bereute die Äußerung, sobald sie mir über die Lippen gekommen war. Ich hatte nicht die geringste Absicht, nach Dresden oder sonst irgendwohin weiterzureisen. Prag war mein lang ersehntes Ziel, und in Prag wollte ich die Reise beenden. Doch in Anbetracht des argwöhnischen und bedrohlichen Verhaltens des Mannes erschien es mir klüger, mich als Fremden auf der Durchreise zu präsentieren, der bald aus dieser Stadt verschwunden wäre. Jetzt schalt ich mich für diese falsche Behauptung, denn später, so dachte ich vorausahnend, würde mich das in noch größere Schwierigkeiten bringen. Doch was ging es diesen Wichtigtuer eigentlich an, ob ich noch länger in Prag blieb oder nicht? Und darüber hinaus, was hatte das mit dem toten Mädchen im Schnee zu tun?
»Tretet näher«, sagte der Mann schroff, »sodass wir Euch deutlich sehen können.«
Ich ging um den Tisch herum und blieb vor dem Kamin stehen. Der Mann betrachtete mich lange schweigend. Er legte seinen kleinen Kopf schief, wie eine Amsel, die das Fressen unterbricht, und hielt mir ein Ohr hin.
»Wisst Ihr, wer ich bin?«, fragte der Mann.
»Nein, mein Herr«, sagte ich, »das weiß ich nicht.«
Er hielt den Kopf wieder gerade und hob das Kinn. »Ich bin Felix Wenzel«, sagte er, »Hofmeister Seiner Majestät des Kaisers Rudolf.«
Ah!, dachte ich, und mein Herz setzte einen kleinen Schlag aus. Felix Wenzel war, wie die ganze Welt wusste, einer der klügsten, listigsten und gefürchtetsten Berater des Kaisers. Ich war gleichermaßen beeindruckt wie beunruhigt. Felix Wenzel!
»Es ist mir eine Ehre, Eure Bekanntschaft zu machen«, sagte ich mit einer steifen Verbeugung. Das Verbeugen, das schäme ich mich nicht zu sagen, lag mir nicht sonderlich.
Wenzel lächelte kalt und strich sich mit Daumen und Zeigefinger über die Mundwinkel, sodass die angegrauten Bartstoppeln dort ein kratzendes Geräusch machten. Immer noch betrachtete er mich mit seinen hellen, harten Augen. »Verratet uns, warum Ihr die junge Frau getötet habt«, sagte er.
Das Holzscheit im Kamin brutzelte und zischte, das Licht der Flammen funkelte auf den nackten Brüsten einer Meeresnymphe, die aus dem Sockel eines der bronzenen Feuerböcke hervorlugte. Einen Augenblick lang war ich so verblüfft, dass ich kein Wort herausbrachte. Es war mir nicht einmal im Ansatz eingefallen, dass man mich des Mordes an der jungen Frau beschuldigen könnte.
Ich räusperte mich noch einmal. »Ihr täuscht Euch, Herr«, sagte ich. »Sie war tot, als ich sie fand. Und sie war es seit geraumer Zeit, denn ihre Gliedmaßen waren schon starr.«
Wenzel nickte, allerdings war es nur ein kleines Zeichen der Ungeduld, als würde er ein unwichtiges und lästiges Detail abtun. »Das ist natürlich gelogen.«
Nun ergriff der Mann, der in dem Sessel vor dem Kamin saß und den Eindruck erweckt hatte, er wäre in Gedanken verloren und achte kein bisschen auf uns, plötzlich das Wort. »Würzburg«, brummte er leise und müde, hob den Kopf und drehte sich zu mir. »Ihr kommt aus Würzburg, sagt Ihr?«
»Jawohl«, antwortete ich. »In Würzburg wohne ich seit einem Jahrzehnt, und dort arbeite ich auch, an der Universität.« Ich wandte mich wieder Wenzel zu. »Wenn Ihr Zweifel hegt, dort gibt es Leute – Kollegen, Professoren, Gelehrte –, die für mich bürgen.«
»Aber gewiss!«, rief Wenzel verächtlich. »Die Weisen von Würzburg würden für die Ziege ihrer Großmutter bürgen.« Er ging wieder in seine dunkle Ecke.
Reumütig dachte ich an das Beglaubigungsschreiben von meinem Vater, dem Bischof – warum hatte ich bloß nicht daran gedacht, es mitzunehmen, als mich die Soldaten aus meinem Zimmer im Blauen Elefanten zerrten? Jetzt hätte ich es vorlegen und meine Identität nachweisen können. Ich war ein vergesslicher Idiot und hatte es unter der stinkenden Strohmatratze liegen gelassen, wo ich es bei meiner Ankunft in der Herberge sicherheitshalber versteckt hatte.
Der Mann in dem Sessel blickte immer noch zu mir auf. Er hatte einen großen Kopf mit einer hohen, gewölbten Stirn, eine vorstehende Nase und einen Vollbart. Seine Augen waren müde und entzündet. »Sie war meine Tochter.« Er sprach so leise, dass ich ihn kaum verstand. »Die Frau, die Ihr gefunden habt.« Er stieß einen langen Seufzer aus, der langsam verklang. »Magdalena, so heißt sie – hieß sie. Meine Tochter.«
Ich nickte. Ich hatte mir bereits gedacht, dass dies Dr. Kroll sein musste, der Vater der toten jungen Frau, dessen Namen der dicke Wächter erwähnt hatte.
Nun richtete sich Wenzel aus der Dunkelheit wieder an mich. »Und Madek, der Abtrünnige«, fragte er, »was wisst Ihr über ihn?«
Als Dr. Kroll diesen Namen hörte, zuckte er überrascht, vielleicht sogar auch erschreckt zusammen. Er starrte Wenzel an, dann wandte er sich wieder dem Feuer zu.
Auf Wenzels Frage hatte ich keine Antwort. Ich wusste von keinem Madek, ob Papist, Abtrünniger oder sonst etwas. Ja, ich wurde aus alldem nicht schlau – der ermordeten Frau, diesen hohen Amtsträgern, dieser rätselhaften, albtraumartigen Befragung. Ich fühlte mich wie ein Mann, der abends losgeritten und im Sattel eingeschlafen war und der sich beim Aufwachen auf einer unbekannten Straße wiederfand, in tiefster Nacht, verwirrt und orientierungslos.
Wenzel trat wieder ins Licht des Feuers und ging mit gesenktem Kopf hin und her, die Hände hinter dem Rücken verschränkt. Er setzte einen schmalen Fuß wohlüberlegt und mit Bedacht vor den anderen, als würde er auf einer geraden unsichtbaren Linie entlanggehen. Seine Schuhe bestanden aus weichem Kalbsleder, mit silbernen Fäden und einem Stückchen scharlachroten Bandes in den Löchern für die Schnürsenkel. Ein eitler Geselle demnach, und nicht wenig verliebt in sich selbst. Merke dir das gut, sagte ich mir: Es ist immer nützlich, die Schwächen eines Mannes zu kennen und sie im Kopf zu behalten.
Doch so eitel Wenzel auch war, so gefährlich war er auch. Dies war der Mann, der als Jüngling angeblich nach einem Streit über das Testament des Vaters die Ermordung seiner beiden Brüder in Auftrag gegeben hatte.
Am Kamin blieb Wenzel stehen, hob den Kopf und musterte mich mit dem prüfenden Blick eines Henkers. »Ich hätte Euch auf die Folterbank spannen können«, sagte er. »Ich hätte Euch blenden und in die Nacht hinausschicken können, damit Ihr Euch auf die Suche nach dem Loch macht, aus dem Ihr herausgekrochen seid. Ich könnte alles mit Euch anstellen, Christian Stern, wie Ihr angeblich heißt.« Trotz der Härte seiner Worte hatte er sie milde, beinahe neckisch ausgesprochen, charmant und amüsiert.
Hinter seiner Schulter sah ich durch die rautenförmigen Scheiben eines Fensters an der gegenüberliegenden Wand dunkles Schneegestöber vorbeiziehen. Irgendwo aus den fernen Straßen der Stadt kam schwach der schwermütig klingende Ruf des Nachtwächters.
Wenzel betrachtete mich immer noch mit zusammengekniffenem Auge. »Und?«, meinte er. »Habt Ihr nichts zu sagen?«
»Ich kann nur sagen, Ihr täuscht Euch, für wen Ihr mich auch haltet. Ich bin ein Wissenschaftler auf Reisen, zuletzt aus Würzburg. Ich kam gestern Abend in diese Stadt, wie ich Euch bereits gesagt habe, und ich habe im Blauen Elefanten Quartier genommen, auf der Kleinseite oder Malá Strana, wie dieser Stadtteil wohl in der tschechischen Sprache heißt. Ich konnte nicht schlafen und hatte zu viel getrunken, und so ging ich aus der Herberge hinaus in die Dunkelheit und den Schnee. Ich fand mich unter der Burgmauer wieder, wo ich unversehens auf die Leiche der Tochter dieses unglücklichen Mannes stieß …«
»Dieser Mann«, unterbrach Wenzel mich schroff, »ist Dr. Ulrich Kroll, Hofarzt Seiner Majestät des Kaisers.« Er hielt inne, zog den Kopf zurück und rümpfte voller Verachtung die Nase. »Hört, habt Ihr Bursche denn überhaupt eine Vorstellung von der Ungeheuerlichkeit des Verbrechens, das Ihr begangen habt?«
»Herr Hofmeister«, erwiderte ich geduldig, »ich habe kein Verbrechen begangen. Hätte ich die junge Frau ermordet, wäre ich dann zu dem Wächter ans Tor gegangen, um ihn zu alarmieren und zu der Stelle zu führen, wo die Leiche lag? Wäre ich dann nicht eher so schnell wie möglich wieder in die Herberge, um meine Sachen zu holen und aus der Stadt zu fliehen, statt in mein Zimmer und ins Bett zurückzukehren, wo mich die Soldaten, die Ihr ausgeschickt habt, so einfach finden konnten?« Ich machte eine Pause. »Wenn Ihr auch nur das Geringste über mich wüsstet, Herr«, fuhr ich fort, »dann wäre Euch klar, was ich auch sein mag, ein Narr bin ich jedenfalls nicht.«
Ich wandte mich Kroll zu, dem das Kinn wieder auf die Brust gesunken war. Er blickte teilnahmslos in den Kamin und in das pulsierende weiße Herz der Flammen. »Ich schwöre Euch, Doktor«, sagte ich, »ich habe Eure Tochter nie lebendig gesehen. Sie hatte längst ihren letzten Atemzug getan, als ich auf sie stieß. Ich hätte mich leicht davonmachen und ihre Leiche im Schnee liegen lassen können, allein und ohne dass sich jemand um sie kümmerte. Es zeugt doch gewiss von meiner Unschuld, dass ich das nicht tat.«
Das Scheit im Kamin brach in der Mitte auseinander, dort, wo die Flammen am stärksten waren, und die brennenden Enden der zwei Hälften plumpsten in einem knisternden Funkenregen verquer auf den Steinboden der Feuerstelle. Kroll, an dessen Kinn ein Muskel beständig pochte, betrachtete die wilden Flammen, die aus den aschigen Stümpfen hochzüngelten.
»Ja«, sagt er mit tiefer Stimme, langsam und matt. »Ja, ja.«
Wenzel wollte sich zu Wort melden, aber Kroll hob die Hand und bedeutete ihm zu schweigen. Ein Stück des zerbrochenen Holzscheits sank noch weiter nach unten und ließ noch einmal Funken sprühen.
»Das ist nicht der Mann, der mein Kind ermordet hat«, sagte Kroll. »Er lügt nicht.« Wieder blickte er von der Seite zu mir auf. »Sie war schon kalt, sagt Ihr?«
»Jawohl«, antwortete ich. »Ihr Todeskampf war längst vorbei, und sie lag friedlich da.«
Noch während ich das sagte, erinnerte ich mich, wie die junge Frau mich irgendwie in den Bann gezogen hatte, als wäre ihr Sterben noch nicht zu Ende und als wäre immer noch etwas vom ihrem Geist in ihr, obwohl sie längst gefroren und für immer erstarrt war.
Kroll hob wieder die Hand, diesmal um die Augen zu bedecken. »Ja«, sagte er, ebenso schwer und mit der gleichen Endgültigkeit wie zuvor. »Ja.«
Wenzel gab ein ungeduldiges Geräusch von sich und wandte sich ab, während er an der seidenen Krause um seinen Hals zupfte. Missmutig blickte er um sich, als wolle er unsichtbare Gestalten hinter dem Schein des Feuers herbeirufen, um diesen wahnwitzigen Augenblick zu bezeugen.
Dr. Kroll legte die Hände zitternd auf die gepolsterten Armlehnen des Sessels und erhob sich, indem er seine schwere, trauernde Gestalt mühsam nach oben stemmte. Wenzel streckte dem gramgebeugten Mann eine Hand entgegen, um ihm zu helfen. Aber er zog sie sofort wieder zurück, mit einem raschen Blick in meine Richtung, wandte sich wieder zur Seite und kaute auf seinem Daumen. Er hatte gesehen, dass mir dieser freundliche Impuls und der hastige Rückzug aufgefallen waren, gesehen, dass ich eine Schwachstelle bemerkt hatte, und das würde er nicht vergessen.
»Ich muss jetzt nach Hause und mich ausruhen«, sagte Dr. Kroll.
»Bleibt noch einen Moment«, sagte Wenzel. »Ich lasse die Kutsche vorfahren.«
Kroll ignorierte ihn und richtete stattdessen seinen rotäugigen Blick auf mich. »Brecht auf und reist weiter«, sagte er. »Fahrt nach Dresden – fahrt irgendwohin. Prag ist nicht der rechte Ort für Euch.« Er sah kurz in Wenzels Richtung. »Hier ist alles schmutzig und krank.«
Dann ging er mit schweren Schritten hinaus, und der Saum seiner dunklen Robe schleifte auf dem Boden hinter ihm her.
3
Danach wurde ich wieder in das Viereck von Männern in scheppernden Rüstungen gepfercht und über den gepflasterten Hof und durch das hohe Tor hinausgeleitet, durch das ich vor Kurzem erst hineingeführt worden war. Es schneite immer noch. Die wirbelnden Flocken hätten die restlichen Fetzen einer himmlischen Katastrophe sein können, eine Art feuchter weißer Asche, die auf die Welt herabregnete.
Nachdem Dr. Kroll gegangen war, war Wenzel noch eine Weile vor dem Kamin hin und her gegangen. Sichtlich in Gedanken hatte er sich über den Bart gestrichen, dann hatte er an der Tür die Wache gerufen und mich wieder in ihre Obhut übergeben, ohne mich eines weiteren Blickes zu würdigen.
Nachdem wir jetzt unter dem Tor hindurchgegangen waren, bog die Abordnung mit mir in der Mitte nach rechts ab und marschierte unter der Burgmauer entlang. Bald kamen wir zu einem gedrungenen runden Turm an einer Ecke der Mauer, der wie der Stummel eines abgetrennten Fingers in schmerzvollem Protest zum Himmel hinaufzeigte. Hier schob und zerrte man mich eine Steintreppe hinauf, bis ich benommen und schwindelig wieder vor einer mit eisernen Nieten beschlagenen Tür landete, die diesmal schmal und niedrig war.
Die Tür wurde aufgetreten, und man warf mich in eine winzige, kalte, übelriechende Zelle. Wenn ich nach einem wechselhaften Leben etwas bezeugen kann, dann die Tatsache, dass ein Kerker wie der andere riecht.
Als die Tür geschlossen wurde, befand ich mich in einer tiefen, beinahe greifbaren Finsternis, dicht und dennoch verwirrend durchdringlich. Ich stand da und lauschte meinem dumpfen, langsamen Herzschlag. Dann tat ich vorsichtig einen Schritt nach vorne, mit ausgestreckten Armen. Mir kribbelten die Fingerspitzen, in furchtsamer Erwartung dessen, was sie womöglich gleich berühren würden. Sie berührten jedoch lediglich eine gekrümmte, durchgehende und kalt schwitzende Wand, deren Steine über zahllose Jahrhunderte von Händen wie den meinen, die sich in blinder Hilflosigkeit daran entlanggetastet hatten, geglättet worden waren.
Der kleine Raum war unmöbliert, wie ich bald feststellte. Es gab lediglich eine Art Holzbank, auf die ich mich setzte. Ich stellte die Ellbogen auf die Knie und stützte den Kopf in die Hände. In der absoluten Dunkelheit war es egal, ob ich die Augen schloss oder öffnete; schwarz war es so oder so. Das versetzte mich in einen flauen Zustand, und ich fühlte mich leicht, als würde ich in einem weichen, dunklen, stillen Meer treiben und bewegungslos untergehen.
Da kroch ein grauer Schimmer von einem vergitterten Fenster herunter, das oben in der Wand hinter mir eingelassen war. Das Fenster war quadratisch und klein, und ich konnte es nur erreichen, indem ich mich auf die Bank stellte, mich an den Gitterstäben festhielt und mich hochzog, während ich gleichzeitig versuchte, mit den Zehen an der glitschigen Wand Halt zu finden. Draußen graute trist der Morgen über den Dächern und Kirchtürmen der Stadt. Keuchend vor Anstrengung und mit zitternden Armen hing ich da. Am liebsten hätte ich losgelassen, aber ich wollte nicht den einzigen Blick auf diese verlassene, winterliche Aussicht aufgeben.
In zahllosen Kirchen schlugen Glocken die Stunde; es kam mir vor, als hätte ich nie im Leben ein so ödes und trostloses Geräusch gehört. In dieser Wehrlosigkeit kam mir zu Bewusstsein, dass ich vielleicht niemals aus diesem üblen Verlies freigelassen würde, außer womöglich, um an einem eiskalten Wintermorgen, ganz ähnlich wie diesem, abgeholt und zu einer schmuddeligen Ecke der Burg geführt zu werden, wo ich mich dann hinknien und den Hals auf den Richtblock legen müsste. Das Letzte, was ich auf dieser Welt sehen sollte, war der Scharfrichter mit seiner Kapuze, der mit dickem Daumen die Klinge des Beils prüfte.
Ich hing noch mit zitternden Armen, tauben Fingern und knackenden Handgelenken am Fenster, als ich ein Geräusch an der Tür vernahm, ein metallisches Klappern. Ich ließ die Gitterstäbe los und landete auf der Bank, wo ich mich mit dem Rücken an die Wand kauerte. Ich rechnete damit, dass die Soldaten gleich wieder hereindrängten und mich zu einem neuen Zusammentreffen abholten, das ebenso beängstigend und verstörend war wie dasjenige, das ich gerade erst durchgemacht hatte.
Aber die Tür ging nicht auf. Stattdessen wurde ganz unten eine Platte mit einem abrupten Klack! zur Seite geschoben. Ich fühlte mich an einen Beichtstuhl erinnert: Dort und in einer Gefängniszelle denkt der Menschen an seine Sünden. Ein zerbeulter Zinnteller mit einem Stück Brot darauf wurde hereingeschoben, gefolgt von einem Tonkrug.
Fast freudig stürzte ich mich auf die Verpflegung. Das Brot war schimmelig und hart und trocken wie Kreide, aber ich nagte daran wie eine Ratte kurz vor dem Hungertod. Ich knabberte den Teig, bis ich klebrige Kügelchen im Mund hatte, die ich, so gut es ging, mit großen Schlucken des faulig schmeckenden Wassers aus dem Krug herunterspülte.
Als ich gegessen hatte, falls man diesen Vorgang überhaupt so nennen konnte, legte ich mich seitlich auf die Bank, zog die Knie an die Brust und den Mantel fest um mich. Bald darauf fing ich an zu zittern, das Zittern kam in Anfällen, die im Nacken begannen, wie Wellen, die über einen flachen Strand rollten. Nach und nach wurde das Tageslicht heller, doch es brachte mir, anders als es eigentlich sein sollte, keinen Trost. Irgendwie verstärkte es nur das Gefühl, zu ertrinken, als wäre es nicht das Licht, das eindrang, sondern als würde etwas anderes, eine dicke, durchsichtige Flüssigkeit um mich herum ansteigen.
Schließlich fiel ich in einen albtraumhaften Halbschlaf. Vermutlich hatte man mir einen Wahnvorstellungen hervorrufenden Zaubertrank in das Wasser im Krug gemischt, denn in meinem Dämmerzustand schien ich mich nicht in der Zelle zu befinden, sondern selbiges lediglich zu träumen, obwohl ich doch wusste, dass ich mich dort befand und nicht in einem Traum.
Auf dem Höhepunkt meines Deliriums erschien ein Gesicht und schwebte in dem schimmernden Licht der Morgendämmerung über mir, ein Gesicht, das ich von den zahllosen Bildnissen kannte, die im ganzen Kaiserreich zu sehen waren, auf Leinwand gemalt, in Stein gemeißelt und auf Münzen geprägt. Das Gesicht war grob und breit, Kinn und Unterlippe hingen herab, und die großen, dunklen Augen strahlten eine grenzenlose Melancholie aus. Eine Weile hing es reglos über mir, ein blankes, bleiches Antlitz, wie ein schwebender Mond, das mich mit kaltem, distanziertem und nicht zu erwiderndem Blick betrachtete.
Ich kann nicht sagen, wie viele Stunden vergingen, bis ich schließlich aus diesem starren, nebulösen Zustand erwachte. Es schien kaum heller geworden zu sein als zu dem Zeitpunkt, als ich einschlief. Doch die Kälte war jetzt durchdringender. Ich konnte mich kaum rühren, so steif waren meine Gliedmaßen, und mein Magen krampfte sich zusammen. Zweifellos lag die ungenießbare Brotkruste noch wie ein Stein dort. Unter dem Protest meiner steifen Glieder stand ich auf und zog bibbernd den Kragen meines Mantels fester zu.
Irgendwie kam ich zu der Überzeugung, dass noch jemand mit mir in der Zelle war, eine Gestalt, die neben mir auf der Pritsche hockte, ohne Substanz, jedoch unzweifelhaft vorhanden. Sie hatte kein mondähnliches Gesicht, keine traurigen Augen, keinen weichen braunen Bart. Vielmehr schien es eine zweite Version meiner selbst zu sein, ein heraufbeschworener, unsichtbarer Zwilling. Dieses andere Ich war jedoch keine willkommene Gesellschaft oder ein Trost, sondern mir gänzlich fremd, mein furchterregender, abscheulich allwissender, unwirklicher Doppelgänger.
Wie lange würde es wohl dauern, bis ich an diesem Ort den Verstand verlor?
Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich mir nie ernsthaft den eigenen Tod vorstellen können – er kam mir vor wie ein schlechter, derber Witz –, aber nun hielt ich es durchaus für möglich, dass ich sterben könnte, und selbst wenn mir der Kopf nicht mit dem Beil abgehackt werden sollte, dann würde mich schon die Eiseskälte umbringen, bevor es wieder Nacht wurde. Meine Not war so groß, dass mir der Tod wie eine willkommene Erlösung vorkam. Ich stellte mir vor, wie sich die Taubheit über den ganzen Körper ausbreiten und Muskeln und Knochen durchdringen würde, wie mein Herz in mir flatterte wie ein in der Luft stehender Falke, bevor er die Flügel ausbreitet und nach unten gleitet. Würde etwas von mir noch ein wenig weiterbestehen, ein kleines, vergehendes Licht, so wie ich es in Magdalena Krolls Leiche noch glühen gespürt hatte? In meinem Fall wäre jedenfalls niemand da, der mit ansah, wie es endgültig erlosch, außer diesem gestaltlosen Phantom neben mir, das allerdings sicherlich im selben Moment sterben würde wie ich.
So unwahrscheinlich es klingt, ich dachte unwillkürlich sehnsüchtig an meine Kindheit zurück, eine Zeit, die mir in der jetzigen Trübsal auf einmal ungeahnt glücklich und fröhlich schien. Selbst das trostlose Haus in der Pfauengasse wurde in meiner Erinnerung eine Oase der Ruhe und der liebenden Fürsorge. Und was war mit den Sterns? Ja, würde die Zellentüre in diesem Augenblick aufgehen und sie würden mit finsterer Miene eintreten, Kirchenlieder singen und mich lauthals schimpfen, wie sie es immer getan hatten, ich glaube, ich wäre vor ihnen auf die Knie gefallen und hätte ihnen vor Freude über den vertrauten Anblick die Hände geküsst.
Draußen schneite es immer noch: Die Schatten der Flocken bewegten sich hinter dem Fenster. Ich stellte mir vor, wie sich die Stadt in stiller Ergebung niederkniete, so wie ich mich der erbarmungslosen kriechenden Kälte hingab.
Beschämt durch solch selbstmitleidige Faselei zwang ich mich schließlich, aufzustehen und kräftig auf und ab zu gehen, mit den Füßen aufzustampfen und mit den Armen zu rudern, damit das Blut durch die Adern floss, während ich die ganze Zeit über langsam und tief Luft holte, um Kraft zu sammeln, obwohl die eisige Luft mir die Lunge versengte. Doch nach einer gewissen Zeit kam wieder eine mörderische Mattigkeit über mich, und ich musste mich unbedingt hinlegen. Wieder war ich leicht weggedämmert, als plötzlich ein Schlüssel im Schloss rasselte und die Tür aufgestoßen wurde. Ich setzte mich auf, rieb mir die Augen und blinzelte. Diesmal rechnete ich mit weiteren Soldaten, weiteren gebrüllten Befehlen, weiteren Tritten und Stößen. Ich hatte mit meiner Einsamkeit gehadert, aber jetzt war mein einziger Wunsch, sie möge nicht enden.
Es waren keine Soldaten, die eintraten, sondern nur der Kerkermeister, ein gebeugter Kerl mit traurigen Augen und einem Buckel über einer Schulter. Am Gürtel trug er eine Vielzahl Schlüssel, die an einem eisernen Ring befestigt waren. Er bedeutete mir, aufzustehen, und führte mich hinaus.