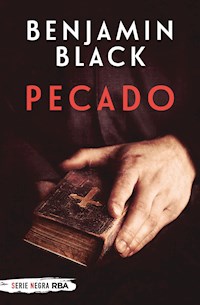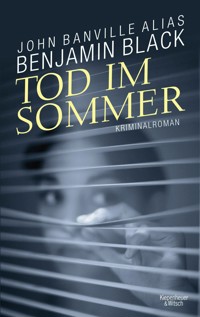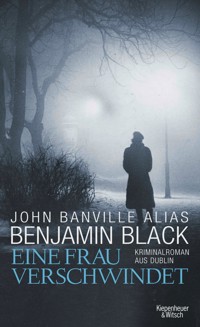
9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Quirke ermittelt
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2012
Ein fesselnder und spannender Whodunit« Publishers Weekly Die junge Ärztin April ist verschwunden. Ihre Freunde machen sich Sorgen, denn es sieht ihr so gar nicht ähnlich, sich tagelang nicht zu melden. Ist April etwas zugestoßen? Während der Pathologe Quirke, der bereits in den ersten beiden Kriminalromanen von Benjamin Black die Hauptrolle spielte, nach einer Alkohol-Entziehungskur versucht, wieder Fuß zu fassen, macht sich seine Tochter Phoebe große Sorgen: Ihre Freundin April ist plötzlich wie vom Erdboden verschluckt. April würde nie verreisen, ohne Phoebe Bescheid zu sagen, und so bittet sie ihren Vater, sich der Sache anzunehmen. Gemeinsam mit Inspector Hackett nimmt er die Ermittlungen auf.In Aprils Wohnung finden sie Blut, das von einer Abtreibung stammt. Phoebe war immer davon ausgegangen, dass ihre Freundin, wie sie, keinen Freund hatte. Im Verlauf der Ermittlungen muss sie feststellen, dass sie viele intime Details aus dem Leben ihrer Freundin nicht kannte. »Der Krimi ist genauso gut oder sogar besser als alle Romane, die der Autor unter seinem Namen John Banville geschrieben hat. Ein hervorragend konstruierter Roman, der noch lange nachwirkt.« Daily Telegraph »Quirke ist ein liebenswerter Held, und das Dublin der 50er-Jahre wird mit einem genauen und nostalgischen Blick heraufbeschworen.« The Times Blacks Beschreibung einer fragilen Vater-Tochter-Beziehung ist so überzeugend wie die beunruhigende Wahrheit hinter Aprils Verschwinden.« Publishers Weekly
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 400
Ähnliche
John Banville
alias Benjamin Black
Eine Frau verschwindet
Kriminalroman aus Dublin
Aus dem Englischen von Andrea O'Brien
Kurzübersicht
> Buch lesen
> Titelseite
> Inhaltsverzeichnis
> Über John Banville
> Über dieses Buch
> Impressum
> Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
Inhaltsverzeichnis
Die Arbeit der Übersetzerin am vorliegenden Text wurde vom Deutschen Übersetzerfonds gefördert.
I
1
Es herrschte widerliches Winterwetter, und April Latimer war verschwunden.
Seit Tagen wollte sich der typische Februarnebel einfach nicht auflösen. In der gedämpften Stille wirkte die Stadt verwirrt wie jemand, der plötzlich sein Augenlicht verloren hat. Wie Blinde tappten die Menschen durch die trübe Suppe, tasteten sich an Fassaden entlang und hielten sich an Geländern fest, zauderten an Straßenecken und suchten vorsichtig mit dem Fuß nach der Bordsteinkante. Autos mit hellen Scheinwerfern geisterten wie riesige Insekten durch den Nebel und stießen milchige Abgaswölkchen aus. In den Abendzeitungen konnte man die Unglücksfälle des Tages verfolgen: Auf der Rathgar Road ereignete sich in der Nähe des Kanals ein schwerer Auffahrunfall, drei Autos und ein Motorradfahrer der Army waren daran beteiligt. Bei den Five Lamps überrollte ein Kohlelaster einen kleinen Jungen, der allerdings überlebte. Seine Mutter versicherte dem eigens ausgesandten Reporter, dieses Wunder sei nur der Medaille mit der Jungfrau Maria zu verdanken, die das Kind immer tragen müsse. Ein alter Geldverleiher in der Clanbrassil Street wurde am helllichten Tag ausgeraubt, er behauptete steif und fest, einer Bande Hausfrauen zum Opfer gefallen zu sein. Die Polizei verfolgte bereits eine heiße Spur. Eine Marktfrau wurde von einem Lieferwagen in der Moore Street angefahren. Der Fahrer war flüchtig, und die Frau lag im St. James im Koma. Und in der Bucht tuteten den ganzen Tag die Nebelhörner.
Phoebe Griffin hielt sich für Aprils beste Freundin, und nachdem sie seit einer Woche nichts von ihr gehört hatte, war sie sicher, dass ihr etwas zugestoßen sein musste. Sie wusste sich keinen Rat. Sicher, April könnte auch einfach weggefahren sein, ohne Bescheid zu sagen – das hätte sogar zu ihr gepasst, denn sie war unkonventionell, manche nannten sie sogar hemmungslos –, doch Phoebe bezweifelte das.
Die Fenster von Aprils Wohnung im ersten Stock eines Mietshauses in der Herbert Place wirkten blind und unergründlich, was nicht nur am Nebel lag. Phoebe wusste nicht, warum, aber bei leer stehenden Wohnungen war das immer so. Sie überquerte die Straße, stellte sich vom Kanal abgewandt vor den Gitterzaun und betrachtete die hohen Reihenhäuser mit ihren finsteren Backsteinfassaden, die hinter dem diesigen Schleier feucht glänzten. Sie wusste nicht, was sie dort zu sehen hoffte. Eine Bewegung hinter der Gardine? Ein Gesicht am Fenster? Aber da war nichts, niemand. Die Feuchtigkeit kroch ihr in die Kleider, und sie zog die Schultern hoch, um sich vor der Kälte zu schützen. Hinter ihr auf dem Treidelpfad hallten Schritte, und sie drehte sich um, doch hinter dem undurchdringlichen Nebelvorhang war niemand zu sehen. Die kahlen Bäume wirkten fast menschlich mit ihren emporgereckten schwarzen Gliedmaßen. Der geisterhafte Spaziergänger hustete einmal wie ein bellender Fuchs.
Sie ging zurück und stieg wieder die Eingangstreppe hinauf, noch einmal drückte sie auf den Knopf über dem kleinen Schild mit Aprils Namen, obwohl sie wusste, dass ihr niemand öffnen würde. Im Granit der Stufen glitzerte der Glimmer – seltsam, dieses geheimnisvolle Aufblitzen im Nebel. Aus dem Sägewerk am anderen Ufer drang ein ohrenbetäubendes Kreischen, und schlagartig wurde ihr klar, was ihr die ganze Zeit in die Nase gestiegen war: der Geruch von gehacktem Holz.
Sie ging die Baggot Street entlang, bog rechts ab und ließ den Kanal hinter sich. Ihre flachen Absätze pochten dumpf auf dem Gehweg. Es war schon mittags, ein ganz normaler Arbeitstag, doch sie kam sich vor wie an einem Sonntagabend. Die Stadt war wie leer gefegt, und die wenigen Menschen, die Phoebe traf, huschten an ihr vorbei wie Phantomgestalten. Sie mahnte sich zur Vernunft. Obwohl sie April seit Mitte letzter Woche weder gesehen noch gesprochen hatte, war ihre Freundin vielleicht noch gar nicht so lange weg – möglicherweise war sie überhaupt nicht weg. Aber die ganze Zeit kein Wort von ihr? Nicht mal ein Anruf? Bei anderen wäre das nicht weiter bemerkenswert, aber um jemanden wie April machte man sich ständig Sorgen, nicht etwa, weil sie allein nicht klarkam, sondern, weil sie sich dessen viel zu sicher war.
Die Lampen am Eingang des Shelbourne Hotels strahlten unheimlich in den Nebel, wie übergroße Pusteblumen. Ein Portier in Gehrock und Umhang stand gelangweilt davor, zog aber den grauen Zylinder, als Phoebe vorbeiging. Sie hätte Jimmy Minor lieber hier im Hotel getroffen, doch der verabscheute feudale Etablissements und weigerte sich, sie zu betreten, es sei denn, er musste einen der dort beherbergten Honoratioren für eine Story interviewen. Sie ging weiter, überquerte die Kildare Street und stieg die Treppe zum Country Shop hinunter. Sogar durch ihre Handschuhe hindurch spürte sie das kalte, glitschige Geländer. Im kleinen Café aber war es warm und hell, und es duftete behaglich nach Tee, frisch gebackenem Brot und Kuchen. Sie wählte einen Tisch am Fenster. Es waren kaum andere Gäste da, allesamt Frauen mit Hüten, Einkaufstaschen und Kartons. Phoebe bestellte eine Kanne Tee und ein Eiersandwich. Sie hätte zwar auf Jimmy warten können, doch der kam bestimmt wie immer zu spät, weil er gern so tat, als hätte er viel mehr um die Ohren als jeder andere. Sie wurde von einem drallen rosigen Mädchen mit Doppelkinn und freundlichem Lächeln bedient. In der Falte neben ihrem linken Nasenloch wucherte ein Muttermal; Phoebe versuchte, es nicht zu aufdringlich zu beäugen. Der Tee, den sie ihr servierte, war schwarz und bitter. Das Sandwich, in zwei akkurate Dreiecke geschnitten, bog sich am Rand schon leicht nach oben.
Wo April jetzt wohl steckte? Und was trieb sie gerade? Irgendwas musste sie doch schließlich treiben. Eine andere Möglichkeit wollte Phoebe gar nicht in Betracht ziehen.
Nach einer halben Stunde trudelte Jimmy endlich ein. Sie sah ihn schon durchs Fenster die Stufen hinunterspringen und war wie immer erstaunt, wie schmächtig er doch war, ein winziger Kerl, der aussah wie ein vorzeitig gealterter Schuljunge. Er trug einen durchsichtigen Regenmantel in wässrigem Tintenblau. Sein Haar war schütter und rot, das Gesicht schmal und sommersprossig, und er wirkte stets zerzaust, als hätte er angezogen geschlafen und wäre gerade erst aus dem Bett gekrochen. Beim Eintreten hielt er ein brennendes Streichholz an seine Zigarette. Er entdeckte sie, kam schnurstracks an ihren Tisch und setzte sich hektisch, knüllte den Regenmantel zusammen und schob ihn unter seinen Stuhl. Alles, was Jimmy tat, geschah in Eile, als stünde er unter Druck. »Also, Pheeb«, sagte er, »was gibt's?« Wassertropfen setzten Lichtakzente auf sein ansonsten glanzloses Haar. Auf dem Kragen seiner braunen Cordjacke lag eine feine Schuppenschicht, und als er sich vorbeugte, roch sie seinen Tabakatem. Doch sein Lächeln war so bezaubernd, es war immer wieder verblüffend, wie es das spitze, verkniffene Gesicht überstrahlte. Gern tat er so, als wäre er in Phoebe verliebt, und beklagte sich dann auf hochdramatische Weise bei Fremden darüber, dass sie seinen Avancen mit grausamer Kaltherzigkeit begegnen würde. Er arbeitete als Kriminalreporter bei der Evening Mail, doch in dieser verschlafenen Stadt gab es sicherlich nicht genug Verbrechen, um ihn dermaßen auf Trab zu halten.
Sie erzählte ihm von April und davon, wie lange sie schon nichts mehr von ihr gehört hatte. »Nur eine Woche?«, fragte Jimmy. »Wahrscheinlich ist sie mit irgendeinem Kerl durchgebrannt. Sie hat da so einen Ruf, du weißt schon.« Jimmy sprach affektiert wie ein Filmstar. Als er damit angefangen hatte, wollte er sich über seine Arbeit lustig machen – »Jimmy Minor, Profireporter, ganz zu Ihren Diensten, Madam!« –, doch mittlerweile war es zur Gewohnheit geworden, und er merkte offenbar nicht, wie sehr es den anderen auf die Nerven ging.
»Wenn sie weggefahren wäre, hätte sie mir Bescheid gesagt, da bin ich sicher«, sagte Phoebe.
Die Bedienung kam, und Jimmy bestellte ein Glas Gingerale und ein Steak-Sandwich – »mit viel Meerrettich, Baby, lang nur zu, ich hab's gern scharf«. Das Mädchen kicherte. Als sie weg war, sagte er leise: »Mann, die Warze ist ja riesig!«
»Muttermal«, sagte Phoebe.
»Was?«
»Das ist ein Muttermal, keine Warze.«
Jimmy hatte aufgeraucht und zündete sich die nächste Zigarette an. Keiner rauchte so viel wie Jimmy. Er hatte Phoebe mal erzählt, er würde sich oft schon während er rauchte nach der nächsten sehnen, und manchmal zündete er sich eine neue Zigarette an, obwohl im Aschenbecher noch eine brannte. Er lehnte sich zurück, schlug die spindeldürren Beine übereinander und blies Rauchschwaden in die Luft. »Und, was hältst du von der Sache?«
Phoebe rührte wie besessen im kalten Tee herum. »Ich glaube, ihr ist was zugestoßen«, sagte sie leise.
Er warf ihr einen Seitenblick zu. »Machst du dir wirklich Sorgen?«
Sie zuckte mit den Schultern, wollte bloß kein Drama daraus machen, nicht, dass er sie auslachte. Er sah sie immer noch von der Seite an, die Stirn gerunzelt. Auf einer Party in ihrer Wohnung hatte er ihr mal gesagt, er finde ihre Freundschaft mit April Latimer komisch. »Komisch, wie in merkwürdig, und nicht wie in ha, ha, lustig«, hatte er damals hinzugefügt. Er war angetrunken gewesen, und hinterher hatten sie sich stillschweigend darauf geeinigt, diese Andeutung zu vergessen, doch sie stand immer noch zwischen ihnen. Sie hatte Phoebe ins Grübeln gebracht und der Gedanke daran löste bei ihr noch heute leichtes Unbehagen aus, egal wie sehr sie die Sache herunterspielte.
»Wahrscheinlich hast du recht«, sagte sie. »Vermutlich benimmt sich April so, wie sie es immer tut, macht sich einfach aus dem Staub und sagt keinem Bescheid.«
Nein, so war das nicht, sie glaubte selbst nicht, was sie da sagte. Egal, was April sonst so trieb, rücksichtslos war sie nicht, erst recht nicht ihren Freunden gegenüber.
Die Bedienung brachte Jimmys Bestellung. Er biss eine Sichel in sein Sandwich und nahm noch beim Kauen einen tiefen Zug von seiner Zigarette. »Was ist mit dem Prinzen aus Bongo-Bongo-Land?«, fragte er mit vollem Mund. Er schluckte geräuschvoll und kniff dabei angestrengt die Augen zusammen. »Hattest du schon eine Audienz bei Seiner Majestät?« Sein Lächeln war süß, aber hintersinnig, und entblößte einen scharfen Eckzahn. Er war eifersüchtig auf Patrick Ojukwu. Alle Männer in der Clique waren eifersüchtig auf Patrick, den sie den Prinzen nannten. Oft beunruhigte sie die Frage, was zwischen Patrick und April lief – hatten sie es nun getan oder nicht? Eine Affäre zwischen den beiden hätte das Zeug für einen handfesten Skandal: das wilde weiße Mädchen und der edle Schwarze.
»Viel wichtiger finde ich, was ihre Mutter dazu zu sagen hat.«
Jimmy wich mit gespieltem Entsetzen zurück und hob abwehrend die Hand. »O weh!«, rief er. »Mit dem pechschwarzen Mohr nehme ich's noch auf, aber die gute alte Eiskönigin ist ein ganz anderes Kaliber.« Mrs Latimer galt unter Aprils Freunden als besonders furchterregend.
»Ich weiß, aber ich sollte sie trotzdem anrufen. Sie weiß bestimmt, wo April ist.«
Jimmy hob skeptisch die Augenbraue. »Meinst du?«
Sie fand seine Zweifel nicht abwegig. April hatte schon vor langer Zeit das Vertrauen zu ihrer Mutter verloren, genauer gesagt wechselten die beiden kaum noch ein Wort miteinander.
»Und was ist mit ihrem Bruder?«
Bei dieser Frage musste Jimmy herzhaft lachen. »Meinst du den großen Gynäkologiker vom Fitzwilliam Square und professionellen Klempner: ›Und ist die Ritze noch so klein, wir schaun gern für Sie hinein‹?«
»Jimmy, das ist widerlich!« Sie trank einen Schluck Tee, doch der war schon eiskalt. »Obwohl ich weiß, dass April ihn nicht mag.«
»Nicht mag? Wie wär's mit ›verachtet‹?«
»Was soll ich jetzt machen?«, fragte Phoebe.
Jimmy nippte an seinem Gingerale und verfiel ins Jammern: »Warum kannst du dich eigentlich nicht wie alle anderen in einem Pub mit mir treffen?« Er hatte anscheinend bereits das Interesse an April verloren. Sie unterhielten sich eine Weile halbherzig über andere Themen, dann nahm er Zigaretten und Streichhölzer, kramte seinen Regenmantel unter dem Stuhl hervor und verkündete, er müsse jetzt gehen. Phoebe bedeutete der Bedienung, dass sie zahlen wolle – sie wusste schon, dass sie die Rechnung begleichen musste, denn Jimmy war immer pleite –, und kurz darauf gingen sie die feuchte, rutschige Treppe zur Straße hinauf. Jimmy legte ihr die Hand auf den Arm. »Keine Sorge«, sagte er, »wegen April, meine ich. Die taucht schon wieder auf.«
Der Geruch von dunstig-warmem Pferdemist wehte von der anderen Straßenseite herüber, wo ein paar Droschken in Reih und Glied vor dem Gitterzaun von St. Stephen's Green darauf warteten, Kundschaft durch die Stadt zu kutschieren. Im Nebel sahen sie aus wie Geister: die Pferde unnatürlich starr und mit traurig gesenkten Köpfen, und die Kutscher mit Umhang und Zylinder, erwartungsvoll und stocksteif auf ihren Kutschböcken, als warteten sie nur darauf, zur Burg Dracula oder zu Dr. Jekyll gerufen zu werden.
»Gehst du jetzt zur Arbeit zurück?«, fragte Jimmy. Er sah sich mit zusammengekniffenen Augen um und war offensichtlich nicht mehr ganz bei der Sache.
»Nein, ich habe einen halben Tag frei.« Beim Einatmen spürte Phoebe, wie ihr kalte feuchte Luft in die Lunge strömte. »Ich treffe mich mit jemandem. Mit – meinem Vater. Du willst bestimmt nicht mitkommen, oder?«
Er mied ihren Blick und richtete seine volle Aufmerksamkeit darauf, sich eine neue Zigarette anzuzünden, indem er sich vorbeugte, als wehte ein starker Wind. »Tut mir leid«, sagte er und richtete sich wieder auf. »Muss Verbrechen aufklären, Storys stricken und die Gerüchteküche anheizen – rasende Reporter rasten nicht.«
Jimmy war fast einen halben Kopf kleiner als Phoebe, und sein Regenmantel stank nach Chemie. »Wir sehen uns, Kleines.« Er war schon ein paar Schritte in Richtung Grafton Street gegangen, da wandte er sich noch einmal um. »Ach, was ich dich noch fragen wollte: Was ist der Unterschied zwischen einem Muttermal und einer Warze?«
Als er gegangen war, blieb Phoebe noch eine Weile unentschlossen stehen, dann streifte sie sich langsam die Kalbslederhandschuhe über. Das Herz wurde ihr schwer, wie jeden Donnerstag, wenn sie ihren Vater traf. Heute aber war sie besonders aufgewühlt. Warum hatte sie sich nur an Jimmy gewandt? Was hätte er schon sagen oder tun können, um ihre Befürchtungen zu entkräften? Außerdem war ihr irgendwas an seiner Art komisch vorgekommen, vor allem, als sie ihm erzählt hatte, sie habe lange nichts von April gehört. Da hatte er so verschlagen, ja fast hinterlistig gewirkt. Sie war sich der unterschwelligen Feindseligkeit zwischen den beiden ungleichen Freunden sehr wohl bewusst. Auf April war Jimmy ebenso eifersüchtig wie auf Patrick Ojukwu. Oder war es eher Missgunst? Aber was genau gönnte er April eigentlich nicht? Die Latimers aus Dun Laoghaire gehörten zur Oberschicht, klar, aber Jimmy zählte sie auch dazu, ohne es ihr anzukreiden. Sie betrachtete die Droschken und die geduldig wartenden Kutscher auf der anderen Straßenseite. Plötzlich war sie überzeugt, dass ihrer Freundin etwas ganz Schlimmes, wahrscheinlich das Allerschlimmste überhaupt, zugestoßen war.
Da kam ihr auf einmal ein neuer Gedanke, der sie noch viel stärker beunruhigte: Was, wenn Jimmy Aprils Verschwinden ausnutzte, um einen »echten Knüller zu landen«, wie er es immer nannte? Was, wenn er seine Gleichgültigkeit nur vorgetäuscht hatte und direkt zum Chefredakteur gerannt war, um ihm brühwarm zu erzählen, dass man seit einer Woche nichts mehr von April Latimer, Assistenzärztin am Holy Family Hospital, gehört hatte, der verruchten Tochter des verstorbenen und betrauerten Conor Latimer und Nichte des amtierenden Gesundheitsministers? O Gott, dachte Phoebe erschrocken, was habe ich nur getan?
2
Quirke war das Leben noch nie so fad vorgekommen. Die ersten Tage im St. John's war er zu verwirrt und verzweifelt gewesen, um zu bemerken, dass hier alle Farben und Strukturen wie verwaschen schienen. Nach und nach begann ihn die allumfassende Leblosigkeit hier zu faszinieren. Nichts im St. John's ließ sich fassen oder festhalten. Als hätte sich der Nebel, der seit dem Herbst so häufig in der Luft hing, für immer niedergelassen, draußen wie drinnen, ein allgegenwärtiges, aber substanzloses Etwas, das einem stets in gleicher Entfernung vor den Augen hing, egal, wie schnell man sich bewegte. Nicht, dass sich hier jemand schnell bewegt hätte, jedenfalls keiner der Insassen. Insassen war ein verpöntes Wort, aber gab es eine bessere Bezeichnung für ihn und seine labilen, mundtot gemachten Leidensgenossen, die stumpf über die Flure und durch die Anlagen schlichen wie traumatisierte Kriegsopfer? Er fragte sich, ob die Atmosphäre in der Anstalt künstlich erzeugt wurde, sozusagen als emotionales Pendant zum Bromsalz, das Gefängniswärter den Häftlingen angeblich ins Essen schmuggelten, um deren Leidenschaft zu zügeln. Als er Bruder Anselm mit dieser Frage konfrontierte, lachte der gute Mann und erwiderte: »Nein, nein, das ist allein euer Werk.« Dabei klang er so, als wäre er fast ein wenig stolz darauf.
Bruder Anselm war Direktor von St. John's House of the Cross, einem Refugium für Suchtkranke aller Art, für gebrochene Seelen und versteinerte Lebern. Quirke mochte ihn, mochte seine vorurteilsfreie Zurückhaltung, den trockenen, melancholischen Humor. Die beiden spazierten gemeinsam durch die Anlage, flanierten auf Kieswegen zwischen Buchsbaumhecken und sprachen über Bücher, Geschichte und die Politik im Altertum –, unverfängliche Themen, zu denen sie Meinungen austauschten, frostig und inhaltsleer wie die winterliche Luft, die sie umgab. Quirke hatte sich an Heiligabend ins St. John's begeben, auf Anraten seines Schwagers, der ihm nach einem sechsmonatigen und von Quirke nur noch bruchstückhaft rekonstruierbaren Alkoholexzess eine Entziehungskur empfohlen hatte. »Wenn schon nicht für dich, dann tu es wenigstens für Phoebe«, hatte Malachy Griffin zu ihm gesagt.
Mit dem Trinken aufzuhören, war leicht gewesen. Ungleich schwerer war es, täglich mit klarem Verstand sich selbst gegenüberzutreten, einer Person, der man doch partout aus dem Weg gehen wollte. Dr. Whitty, der Klinikpsychiater, hatte eine Erklärung dafür. »Manche Menschen, zu denen auch Sie gehören, sind nicht süchtig nach Alkohol, sondern nach der Fluchtmöglichkeit, die er ihnen bietet. Das leuchtet ein, oder? Sie sind auf der Flucht vor sich selbst.« Dr. Whitty war ein stattlicher, gutmütiger Mann mit himmelblauen Augen und Fäusten so groß wie Futterrüben. Er und Quirke waren sich draußen schon ein paar Mal begegnet, von Berufs wegen, doch es gehörte zu den Gepflogenheiten des Hauses, sich höflich wie Fremde zu verhalten. Quirke war das trotzdem unangenehm, hatte er doch erwartet, St. John's würde ihm Anonymität gewähren – das war ja wohl das Mindeste, was man erwarten durfte, wenn man sich in die Obhut einer solchen Einrichtung begab –, und er war dankbar für die betont distanzierte Heiterkeit und die gewissenhafte Diskretion in Dr. Whittys blassem Blick. Artig unterzog sich Quirke den täglichen Sitzungen auf der Couch – genau genommen war es keine Couch, sondern ein halb dem Fenster zugewandter Stuhl, und hinter dem stand der Psychiater, zumeist schweigend und geräuschvoll atmend – und versuchte, die Dinge zu formulieren, die man von ihm erwartete. Er wusste um seine Probleme, ihm waren die Dämonen, die ihn quälten, mehr oder weniger bekannt, doch im St. John's wurde erwartet, dass man reinen Tisch machte, Ordnung schaffte, neu anfing – Klischees waren eine feste Größe im Anstaltsleben –, und auch bei ihm machte man da keine Ausnahme. »Der Weg zurück ist lang«, sagte Bruder Anselm. »Je weniger Päckchen Sie zu tragen haben, desto besser.« Als könnte ich alles abladen und unbeschwert weitergehen, dachte Quirke.
Man nötigte die Insassen, sich paarweise zusammenzuschließen wie schüchterne Tänzer auf einem grotesken Ball. Der Theorie nach sollten der tägliche Umgang mit einem auserwählten Leidensgefährten, die damit einhergehenden Vertraulichkeiten und die aufrichtige Selbstentblößung das Gefühl von »Gemeinschaftlichkeit« wiederherstellen und so den Heilungsprozess beschleunigen. Deshalb verbrachte Quirke sehr viel mehr Zeit, als ihm lieb war, mit Harkness – im St. John's sprach man sich mit dem Nachnamen an. Harkness, ein grauhaariger Mann mit harten Gesichtszügen und indigniertem Adlerblick, hatte ein feines Gespür für die bittere Komik ihrer »Gefangenschaft«, wie er es hartnäckig nannte, und als er von Quirkes Beruf erfuhr, brachte er ein kurzes, lautes Lachen hervor, das klang, als würde etwas Dickes und Widerspenstiges entzweigerissen. »Pathologe!«, knurrte er voller Schadenfreude. »Willkommen im Leichenschauhaus.«
Harkness – der Name klang wie eine Krankheit – war dem Austausch intimer Vertraulichkeiten ebenso abgeneigt wie Quirke und erzählte zunächst nur wenig über sich und seine Vergangenheit. Doch Quirke, der seine Kindheit in kirchlichen Waisenhäusern verbracht hatte, erriet sofort, dass sein Gegenüber ein – wie hießen sie doch gleich? – ein Schwarzrock war. »Stimmt«, sagte Harkness, »Ordensmann, Christian Brothers. Sie haben anscheinend das Rascheln der Ordenstracht gehört.« Wohl eher das Peitschen des Lederriemens, dachte Quirke. Seite an Seite in stoischem Schweigen, die Köpfe gesenkt und die Fäuste hinter dem Rücken verschränkt, marschierten die beiden auf denselben Wegen, die Quirke auch mit Bruder Anselm beschritt, und wandelten unter froststarren Bäumen, als würden sie Buße tun, was ja auch irgendwie stimmte. In den nächsten Wochen spuckte Harkness nach und nach widerwillig harte Informationsbröckchen aus wie die Kerne einer sauren Frucht. Die Gier nach Alkohol hatte ihn offenbar von anderen Gelüsten abgelenkt. »Ich will es mal so ausdrücken«, sagte er, »wenn ich dem Orden nicht beigetreten wäre, hätte ich höchstwahrscheinlich trotzdem nie geheiratet.« Er lachte verdrießlich vor sich hin. Quirke war schockiert: Noch nie hatte er jemanden so unumwunden von seiner Homosexualität reden hören, und erst recht kein Mitglied der Christian Brothers. Auch Harkness war vom Glauben abgefallen – »wenn ich überhaupt je einen hatte« – und zu der Auffassung gelangt, dass es unterm Strich wohl keinen Gott gab.
Nach derart drastischen Enthüllungen fühlte sich Quirke genötigt, eine Gegenleistung zu erbringen, was ihm äußerst schwerfiel, nicht etwa, weil es ihm peinlich gewesen wäre oder weil er sich schämte – obgleich Verlegenheit oder Schamgefühl angesichts der Untaten, die er auf dem Gewissen hatte, durchaus angebracht gewesen wären –, sondern wegen der Last des Überdrusses, die ihn dabei unvermittelt niederdrückte. Mit Sünden und Leid gab es ein Problem, hatte er festgestellt – sie wurden nach einer Weile langweilig, sogar für den gramgebeugten Sünder selbst. Hatte er den Mut, von seinem verpfuschten Leben zu erzählen, diesem Scherbenhaufen? Von den verhängnisvollen Momenten, in denen er die Nerven verloren hatte, von seiner moralischen Trägheit, den Versäumnissen, den Vertrauensbrüchen? Er versuchte es. Er schilderte, wie er, nach dem Tod seiner Frau im Kindbett, seiner Schwägerin das neugeborene Kind überlassen und dies Phoebe, so hieß seine Tochter, mittlerweile eine junge Frau, fast zwanzig Jahre lang verschwiegen hatte. Er hörte sich reden und fand, dass er klang, als würde er die Geschichte eines anderen erzählen.
»Aber sie kommt Sie doch besuchen«, unterbrach ihn Harkness konsterniert. »Ihre Tochter – sie kommt Sie besuchen.«
»Ja, schon.« Quirke, den dieser Umstand schon lange nicht mehr überrascht hatte, wunderte sich nun aufs Neue darüber.
Harkness sagte nichts mehr, sondern nickte nur, gleichermaßen verbittert wie erstaunt, und wandte sich dann ab. Harkness bekam nie Besuch.
Am Donnerstag darauf, als Phoebe kam, dachte Quirke an den einsamen Ordensmann und versuchte, besonders aufmerksam zu sein und den Trost, den sie ihm mit ihren Besuchen wohl zu spenden glaubte, angemessen zu würdigen. Sie saßen im Besucherraum, einem kargen, mit Glaswänden abgetrennten Teil der Eingangshalle mit Resopaltischen und Metallstühlen. In viktorianischen Zeiten hatte das einschüchternd protzige Gebäude irgendeinem Zweig der britischen Verwaltung als städtisches Hauptquartier gedient. Auf einem Tresen am anderen Ende des Raums thronte eine mächtige Teemaschine, die den ganzen Tag vor sich hinrumpelte und -zischte. Quirke fand seine Tochter noch blasser als sonst. Sie hatte dunkle Schatten unter den Augen, die wie blaue Flecken aussahen. Und sie wirkte abwesend. Immer schon hatte sie etwas Schwermütiges, Bleichsüchtiges gehabt, und diese Neigung war noch stärker hervorgetreten, seit sie die zwanzig überschritten hatte. Dennoch reifte sie zu einer schönen Frau heran, wie er mit einiger Überraschung und unerklärlichem, aber spürbarem Unbehagen feststellte. Ihre Blässe wurde von der dunklen Kleidung, der schwarzen Bluse und dem ebenfalls schwarzen Pullover, dem etwas abgetragenen schwarzen Mantel noch betont. Sie war zwar aus beruflichen Gründen so angezogen – sie arbeitete in einem Hutgeschäft –, doch er fand, dass sie darin viel zu sehr wie eine Nonne wirkte.
Sie saßen sich gegenüber, die Hände flach auf dem Tisch, und ihre Fingerspitzen berührten sich fast.
»Geht‘s dir gut?«, fragte er.
»Ja«, erwiderte sie. »Alles bestens.«
»Du siehst – wie soll ich sagen? – mitgenommen aus.«
Er beobachtete, wie sie beschloss, sein Mitgefühl zu ignorieren. Sie blickte hinauf zum Oberlicht, wo der Nebel sich wie Dampf an die Scheibe drückte. Die grauen Becher mit Tee standen unberührt vor ihnen auf dem Tisch. Da lag auch Phoebes Hut, eine winzige Kreation aus Spitze und schwarzem Samt mit einer unverhältnismäßig theatralischen scharlachroten Feder. Quirke nickte in Richtung Hut. »Wie geht es Mrs Dingsbums?«
»Wem?«
»Der mit dem Hutgeschäft.«
»Mrs Cuffe-Wilkes.«
»Der Name ist doch wohl erfunden, oder?«
»Es gab einen Mr Wilkes. Der ist gestorben, und von da an nannte sie sich Cuffe-Wilkes.«
»Gibt es auch einen Mr Cuffe?«
»Nein, das ist ihr Mädchenname.«
»Aha.«
Er zog sein Zigarettenetui hervor, ließ es mit einem Klicken aufschnappen und hielt es ihr hin. Sie schüttelte den Kopf. »Ich habe aufgehört.«
Er nahm sich eine Zigarette und zündete sie an. »Du hattest doch immer diese – wie heißen sie noch, diese ovalen Dinger?«
»Passing Clouds.«
»Ja, genau. Warum hast du aufgehört?«
Sie lächelte gequält. »Und warum hast du aufgehört?«
»Du meinst, warum ich nicht mehr trinke? Hm, naja.«
Beide wandten den Blick ab, Phoebe sah wieder zum Oberlicht hinauf und Quirke seitlich zu Boden. Ein halbes Dutzend Paare saß an Tischen, die so weit auseinanderstanden wie möglich. Der Boden bestand aus großen schwarz-weißen Gummifliesen, und die Leute wirkten wie lebensgroße Figuren, die man zu einer stillen Partie Schach aufgestellt hatte. Es stank nach Rauch und zu lange gezogenem Tee, aber irgendwie auch nach Medizin und Maßregelung. »Es ist grässlich hier«, sagte Phoebe, sah ihren Vater aber gleich darauf schuldbewusst an. »Tschuldige.«
»Wieso? Du hast ja recht, es ist schrecklich.« Er hielt kurz inne. »Ich werde mich entlassen.«
Er war ebenso erstaunt wie sie. Die Entscheidung war erst beim Aussprechen gefallen. Aber jetzt, da es heraus war, ging ihm auf, dass er den Entschluss in jenem Moment gefasst hatte, als er mit Harkness unter den kahlen Bäumen von seiner Tochter gesprochen und dieser sich verbittert abgewandt hatte. Ja, damals, so viel verstand Quirke jetzt, hatte er sich innerlich auf den Weg gemacht, zurück zu dem, was man wohl Gefühle nannte, zurück in eine Art – wie hieß es doch gleich – Leben? Bruder Anselm lag richtig: Ihm stand noch eine lange Reise bevor.
Phoebe hatte irgendetwas gesagt. »Was?«, fragte er mit einem Anflug von Gereiztheit, versuchte aber, nicht finster dreinzublicken. »Entschuldigung, ich habe gerade nicht zugehört.«
Sie bedachte ihn mit einem missbilligenden Blick, den Kopf leicht zur Seite geneigt, Kinn nach unten und eine Augenbraue hochgezogen, so hatte sie ihn schon als kleines Mädchen immer angesehen, als sie ihn noch für eine Art Onkel hielt. Damals war seine Aufmerksamkeit auch schon wechselhaft gewesen. »April Latimer«, sagte sie. »Offenbar ist sie – weggefahren oder so was.«
»Latimer«, wiederholte er vorsichtig.
»Ach, Quirke!«, rief Phoebe – so nannte sie ihn, nicht Vater oder Papa –, »meine Freundin April Latimer. Sie arbeitet bei dir im Krankenhaus. Als Assistenzärztin.«
»Kann ich gerade nicht zuordnen.«
»Sie ist die Tochter von Conor Latimer und die Nichte des Gesundheitsministers.«
»Ach. Zu diesen Latimers gehört sie. Sie ist verschwunden, sagst du?«
Sie starrte ihn verwundert an: Das Wort »verschwunden« hatte sie nicht benutzt, warum tat er es dann? Was hatte er aus ihrer Stimme herausgehört, das auf ihre Befürchtung hindeutete? »Nein«, sagte sie nachdrücklich und schüttelte den Kopf, »nicht verschwunden, sondern – anscheinend ist sie – weggefahren, ohne jemandem Bescheid zu sagen. Ich habe seit einer Woche nichts mehr von ihr gehört.«
»Seit einer Woche?«, fragte er betont gleichgültig. »Das ist noch nicht lang.«
»Normalerweise meldet sie sich jeden oder zumindest jeden zweiten Tag bei mir.« Sie zog demonstrativ die Schultern hoch und lehnte sich zurück, denn sie befürchtete, dass sie ein Unglück für ihre Freundin umso wahrscheinlicher machen könnte, je deutlicher sie ihre Sorge zeigte. Das war zwar völlig abwegig, aber sie konnte sich einfach nicht davon befreien. Sie merkte, dass Quirke sie taxierte. Sein Blick fühlte sich an wie die Hand eines Arztes, der den wunden Punkt, den infizierten Punkt, den neuralgischen Punkt zu ertasten sucht.
»Was ist mit dem Krankenhaus?«, fragte er.
»Da habe ich angerufen. Sie hat sich angeblich krankgemeldet.«
»Für wie lange?«
»Was?« Sie sah ihn verdutzt an.
»Wie lange hat sie sich krankgemeldet?«
»Oh, danach habe ich gar nicht gefragt.«
»Hat sie einen Grund angegeben?« Phoebe schüttelte den Kopf, sie wusste es nicht. Sie biss sich auf die Unterlippe, bis die Haut weiß war. »Vielleicht hat sie eine Grippe«, bemerkte er. »Vielleicht hat sie einfach beschlossen, mal Urlaub zu machen – diese Assistenzärzte müssen schuften wie die Sklaven.«
»Das hätte sie mir gesagt«, murmelte sie. Wenn sie so sprach, mit diesem bockigen Zug um den Mund, war sie für einen Augenblick wieder das Kind seiner Erinnerung.
»Ich rufe da mal an«, sagte er, »in ihrer Abteilung. Ich kriege schon raus, was los ist, keine Sorge.«
Sie lächelte, doch so gezwungen und zögerlich – dabei biss sie sich sogar noch immer auf die Unterlippe –, dass ihre Verzagtheit unverkennbar war. Was sollte er tun, was konnte er ihr noch sagen?
Er begleitete sie zum Eingangstor. Der ohnehin kurze Tag neigte sich dem Ende zu, und die düstere Abenddämmerung durchzog den Nebel wie Ruß, verdichtete ihn. Er trug keinen Mantel und ihm war kalt, dennoch bestand er darauf, sie den ganzen Weg bis zum Tor zu begleiten. Ihre Abschiede waren immer verkrampft. Sie hatte ihn nur ein einziges Mal geküsst, vor Jahren, als sie noch nicht wusste, dass er ihr Vater war, und in Momenten wie diesen flammte dieser eine, erinnerte Kuss immer wieder zwischen ihnen auf wie entzündetes Magnesium. Er berührte sie leicht am Ellenbogen und trat einen Schritt zurück. »Mach dir keine Sorgen«, wiederholte er, und sie lächelte erneut, nickte und wandte sich dann ab. Er sah ihr nach, wie sie durch das Tor ging, sah, wie diese absurde, scharlachrote Feder auf ihrem Hut auf und ab wippte, dann rief er ihr etwas hinterher. »Was ich dir noch erzählen wollte – ich kaufe mir ein Auto.«
Sie drehte sich um und starrte ihn an. »Was? Du kannst doch nicht mal fahren.«
»Weiß ich. Du kannst es mir ja beibringen.«
»Ich kann's doch auch nicht!«
»Gut, dann lernst du es eben und bringst es mir dann bei.«
Sie schüttelte den Kopf. »Du bist doch verrückt«, sagte sie und lächelte.
3
Als sie das Telefon klingeln hörte, wusste Phoebe seltsamerweise sofort, dass der Anruf ihr galt. Obwohl das Haus in vier Wohnungen unterteilt war, gab es nur einen öffentlichen Apparat unten im Flur, und die Frage, wer ihn wann benutzen dürfe, löste unter den Mietern regelmäßig heftigen Streit aus. Sie wohnte schon seit sechs Monaten hier. Das Haus war schmucklos und ungepflegt, bei Weitem nicht so schön wie das in der Harcourt Street, in dem sie früher gewohnt hatte. Aber nach allem, was geschehen war, hatte sie dort nicht mehr bleiben können. Natürlich hatte sie alles mitgenommen, Fotos, Schmuck und den alten einäugigen Teddybären, und der neue Vermieter hatte ihr sogar erlaubt, ein paar eigene Möbel unterzubringen, doch sie sehnte sich immer noch nach ihrer alten Wohnung. Damals hatte sie den pulsierenden Herzschlag der Stadt gespürt, doch hier, in der Haddington Road, fing die Vorstadt an. Wenn sie an manchen Tagen hinter der Brücke an der Baggot Street abbog und auf einmal bis Ringsend sehen konnte, klaffte die Einsamkeit ihres Lebens vor ihr wie ein Abgrund. Sie wusste, sie war viel zu oft allein, deshalb wollte sie eine Freundin wie April Latimer auf keinen Fall verlieren.
Als sie in den Hausflur trat, lauerte der feiste junge Mann aus dem Erdgeschoss schon am Treppenabsatz und sah mit bösem Blick zu ihr hinauf. Er war zwar immer zuerst am Telefon, doch die Anrufe waren wohl nie für ihn. »Ich hab gerufen«, sagte er verärgert, »haben Sie mich nicht gehört?« Hatte sie nicht. Offensichtlich log er. Sie hastete die Treppe hinunter, während der junge Mann sich wieder verzog und die Tür hinter sich zuknallte.
Der Münzfernsprecher, ein schwarzer Metallkasten, war an der Wand über dem Flurtisch festgeschraubt. Sie hielt sich den schweren Hörer ans Ohr und bildete sich ein, den fauligen Atem des feisten jungen Mannes an der Sprechmuschel riechen zu können.
»Ja?«, sagte sie leise, freudig. »Ja?«
Sie hatte trotz allem gehofft, es möge April sein, doch sie war es nicht, und ihr erwartungsvoll schlagendes Herz fiel wieder in seinen gewohnten Takt zurück.
»Hallo Pheeb, hier ist Jimmy.«
»Oh, hallo.« Er hatte nichts über April geschrieben – sie hatte extra in der Mail nachgesehen –, und jetzt plagte sie ein schlechtes Gewissen und ihre Verdächtigungen kamen ihr albern vor.
»Ich habe gestern vergessen, dich zu fragen – hast du nachgesehen, ob Aprils Schlüssel noch da war, als du bei ihr geklingelt hast?«
»Was?«, fragte sie. »Welcher Schlüssel?«
»Der, der immer unter der losen Bodenfliese liegt, falls sie Besuch erwartet und nicht da ist.« Phoebe schwieg. Warum wusste Jimmy von dem Schlüssel und sie nicht? Wieso hatte April ihr nichts davon erzählt? »Ich gehe jetzt zur Wohnung und sehe nach, ob er da noch liegt«, sprach Jimmy weiter. »Kommst du auch?«
Den Schal um Kopf und Mund geschlungen eilte sie zur Brücke. Der Nebel hatte sich zwar etwas gelichtet, doch ein kalter Dunstschleier war zurückgeblieben. Herbert Place lag nur einen Straßenzug entfernt, auf der anderen Seite des Kanals. Beim Haus angekommen, konnte sie Jimmy nirgends sehen. Sie ging die Treppe hinauf und klingelte, für den Fall, dass er vor ihr da gewesen und schon in die Wohnung gegangen war, doch dem war nicht so. Sie betrachtete den Granitboden und suchte nach der kaputten Fliese. Einige Minuten verstrichen, sie fühlte sich befangen, stets in Sorge, jemand könnte sie fragen, warum sie immer noch hier herumlungere, es sei doch wohl klar, dass niemand zu Hause war. Umso erleichterter war sie, als sie Jimmy den Treidelpfad entlangeilen sah. Er kletterte durch eine Lücke im schwarzen Gitterzaun und sprintete über die Straße, ohne auf das Auto zu achten, das gerade noch ausweichen konnte und erbost hupte.
»Ist sie immer noch nicht da?«, fragte er auf den Stufen zum Eingang. Er trug wieder diesen Plastikregenmantel, der so beißend roch. Als er mit dem Absatz auf die Fliese neben dem Schuhabstreifer trat, hob sie sich an der abgebrochenen Ecke, und Phoebe konnte die beiden matt glänzenden Schlüssel am Ring darunter erkennen.
Der Dunst drang nun auch in den Flur, und dünne Schwaden waberten geisterhaft über der Treppe. Schweigend gingen sie in den zweiten Stock. Phoebe war diese Treppe schon oft hinaufgestiegen, doch plötzlich kam sie sich vor wie ein Eindringling. Vorher hatte sie nie bemerkt, wie abgetreten der Läufer auf der Treppe war, wie angelaufen die Teppichstangen, einige fehlten sogar ganz. Vor Aprils Wohnungstür blieben sie kurz stehen und sahen sich an. Jimmy klopfte vorsichtig. Sie warteten, aber drinnen rührte sich nichts. »Und jetzt?«, flüsterte er. »Sollen wir einfach reingehen?«
Das schroffe Knirschen des Schlüssels im Schloss ließ Phoebe zusammenzucken.
Sie wusste nicht, was sie erwartet hatte, aber natürlich war alles an seinem Platz, jedenfalls soweit sie es erkennen konnte. April war nicht gerade ordentlich, und das Durcheinander in der Wohnung wirkte vertraut und beruhigend zugleich: Konnte einer Frau, die Nylonstrümpfe gewaschen und sie über dem Feuerschirm vor dem Kamingitter zum Trocknen aufgehängt hatte, wirklich etwas Schlimmes zugestoßen sein? Und da, auf dem Couchtisch, stand eine Tasse, auf dem Rand sogar noch der halbkreisförmige Abdruck von scharlachrotem Lippenstift, daneben eine halb leere Packung Marietta-Kekse, alles ganz normal, ganz alltäglich. Trotzdem lag da etwas in der Luft, es ließ sich nicht ignorieren, etwas Wachsames, geradezu Feindseliges, das ihre Anwesenheit genau verfolgte und verurteilte.
»Und jetzt?«, fragte sie.
Jimmy suchte mit argwöhnisch zusammengekniffenen Augen das Zimmer ab, wie immer spielte er den abgebrühten Reporter, und es hätte nicht viel gefehlt, dann hätte er auch noch Notizblock und Stift gezückt. Phoebe konnte sich nicht mehr erinnern, wo und wann sie Jimmy kennengelernt hatte. Seltsam: Sie meinte, ihn schon seit ewigen Zeiten zu kennen, dabei wusste sie fast nichts über ihn, war sich nicht mal sicher, wo er wohnte. Er war eine Plaudertasche und redete wie ein Wasserfall über alles und jeden, nur nicht über sich. Es machte Phoebe stutzig, dass April ihm von dem Schlüssel unter der Fliese erzählt hatte. Wussten noch andere davon? Wenn April sie als Einzige nicht eingeweiht hatte, war es ja auch nicht weiter verwunderlich, dass sich ihre Freundin nicht bei ihr meldete. Vielleicht betrachtete April sie überhaupt nicht als Freundin, sondern nur als Bekannte, mit der man nach Lust und Laune Kontakt hielt oder eben nicht. In diesem Fall gäbe es keinen Grund mehr, sich Sorgen zu machen. Sie wollte sich schon genüsslich dem Gefühl der Kränkung hingeben, da fiel ihr ein, dass auch Jimmy, dem April sehr wohl von dem Schlüssel erzählt hatte und der deshalb ein intimer Vertrauter sein musste, nichts von ihr gehört hatte, weder er noch irgendein anderer aus ihrem Freundeskreis, soviel sie wusste.
Als könnte er Gedanken lesen – manchmal legte er eine unheimliche Hellsichtigkeit an den Tag –, fragte er: »Wie gut kennst du sie deiner Meinung nach? April, meine ich.«
Sie standen mitten im Zimmer. Es war kalt, Phoebe trug immer noch den Schal, und obgleich sie die Hände tief in den Manteltaschen vergraben hatte, spürte sie ein Prickeln in ihren kalten Fingerspitzen. »So gut wie jeder andere auch, glaube ich«, erwiderte sie. »Dachte ich zumindest. Wir haben fast jeden Tag miteinander gesprochen. Darum habe ich mir auch Sorgen gemacht, dass sie sich so lange nicht mehr bei mir gemeldet hat.« Er inspizierte immer noch das Zimmer, nickte und kaute seitlich an der Oberlippe. »Und du?«, fragte sie nun.
»Sie war immer ein guter Kontakt.«
»Kontakt?«
»Im Krankenhaus. Wenn es eine Story gab, wenn ein hohes Tier im Suff jemanden über den Haufen gefahren hatte oder ein Selbstmord vertuscht werden sollte, hat April mir immer die Details zugespielt.«
Phoebe sah ihn entgeistert an. »Solche Sachen hat April dir erzählt?« Das konnte nicht wahr sein. Die April, die sie kannte oder zu kennen glaubte, hätte einem Reporter niemals solche Informationen weitergegeben, auch wenn sie mit ihm befreundet war.
»Das waren keine vertraulichen Sachen, die sie mir da erzählt hat«, verteidigte Jimmy sich. »Ein Telefonat mit ihr hat eben Zeit gespart, mehr nicht. Du weißt doch, wie das ist, wenn man Termindruck hat.« Dieser jammernde, wehleidige Ton, den er manchmal anschlug, war alles andere als attraktiv. Er trat ans Fenster und sah hinaus. Sogar von hinten strahlte er noch Ärger und Missmut aus. Sie wusste aus Erfahrung, wie schnell er beleidigt war, hatte es oft genug erlebt.
»Ist dir klar, dass wir die ganze Zeit in der Vergangenheitsform von ihr sprechen?«, fragte sie.
Er drehte sich um, und ihre Blicke trafen sich.
»Das Schlafzimmer«, erwiderte Jimmy. »Da haben wir noch nicht nachgesehen.«
Schon auf der Schwelle fiel ihnen auf, dass es hier noch unordentlicher war. Der Kleiderschrank stand sperrangelweit offen, Aprils Kleidung lag auf einem Haufen und sah irgendwie durchwühlt aus. Auch intimere Wäschestücke lagen achtlos und zerknüllt am Boden, wo sie sie ausgezogen hatte. Auf einem Schreibtisch in der Ecke stapelten sich Fachbücher, Papiere und vollgestopfte Ordner, mittendrin thronte eine alte schwarze Remington und irgendwo dazwischen, fast verschüttet, stand ein altmodisches Telefon mit einer Kurbel für die Vermittlung, daneben eine Tasse mit einem Rest Kaffee, bereits eingetrocknet und rissig, der aber immer noch einen bitteren Geruch verströmte. April war süchtig nach Kaffee und trank ihn ständig, nicht nur tagsüber, wenn sie Dienst hatte, sondern bis tief in die Nacht. Phoebe sah sich um. Sie hatte das Gefühl, nichts anfassen zu dürfen, war überzeugt davon, dass jeder Gegenstand, den sie berührte, zwischen ihren Fingern zu Staub zerfallen würde: Plötzlich war in diesem Zimmer alles zerbrechlich. Ihr wurde schlecht von dem Geruch des abgestandenen Kaffees und all der anderen Dinge – Gesichtspuder, Staub, benutzte Bettwäsche – und von dieser besonderen Duftmischung, die Schlafzimmer immer verströmten.
Seltsamerweise war das Bett gemacht, und das auch noch so ordentlich wie sonst nur in Krankenhäusern, Decke und Laken straff untergeschlagen und das Kopfkissen glatt wie eine Schneewehe.
Jimmy, irgendwo hinter ihr, sagte etwas. »Sieh dir das mal an.« Eine schmale Lamellentür aus Sperrholz führte in ein winziges, fensterloses Bad. Dort stand er und beugte sich über das Waschbecken. Er sah sie über die Schulter hinweg an, und noch während sie einen Schritt nach vorn machte, verspürte sie den Drang, hier hinten stehen zu bleiben. Das Waschbecken war alt und vergilbt, unter beiden Wasserhähnen hatte sich Grünspan gebildet. Jimmy wies auf eine nur noch schwach erkennbare, bräunliche Schliere, die vom Überlauf bis fast zum Abfluss reichte. »Das«, sagte er, »ist eindeutig Blut.«
Beide starrten wie gebannt auf die Spur und wagten kaum zu atmen. Aber was war an einem bisschen Blut in einem Badezimmer so besonders? Trotzdem hatte Phoebe das Gefühl, als hätte sich jemand mit unschuldigem Lächeln zu ihr umgedreht und ihr etwas Schreckliches gezeigt. Jetzt war ihr wirklich speiübel. Bilder aus der Vergangenheit stürzten auf sie ein, flackerten in ihrem Kopf wie eine alte Wochenschau. Ein Auto auf einer verschneiten Landzunge, ein junger Mann mit einem Messer; ein alter Herr, stumm und grimmig, auf einem schmalen Bett zwischen zwei hohen Fenstern; eine Gestalt mit silbernem Haar, aufgespießt auf einem schwarzen Gitterzaun, aber immer noch zuckend. Sie musste sich setzen, aber wohin? Nirgendwo konnte sie sich anlehnen, denn alles könnte jäh auseinanderbrechen und Grauenhaftes freilegen. Ihr drehte sich der Magen um, sie verspürte plötzlich stechende Kopfschmerzen, und vor ihren Augen lag ein undurchdringlicher roter Nebel. Und dann fand sie sich unerklärlicherweise auf der Schwelle zum Badezimmer wieder, halb sitzend, halb liegend, die Lamellentür in ihrem Rücken. Sie hatte einen Schuh verloren, und Jimmy kniete neben ihr und hielt ihre Hand.
»Alles in Ordnung?«, fragte er besorgt.
War es das? Sie hatte immer noch diese stechenden Kopfschmerzen, als hätte man ihr einen glühend heißen Draht mitten durch die Stirn gebohrt. »Tut mir leid«, stammelte sie. »Ich bin wohl – bin wohl …«
»Du bist ohnmächtig geworden«, sagte Jimmy. Er betrachtete sie aufmerksam und mit leicht skeptischem Blick, wie es ihr schien, so als hege er den Verdacht, die Ohnmacht sei nur vorgetäuscht gewesen, eine theatralische, Aufmerksamkeit heischende Einlage.
»Tschuldige«, sagte sie. »Ich glaube, ich muss mich übergeben.«
Mühsam rappelte sie sich auf, rutschte auf Knien zur Toilette und beugte sich, die Hände auf die Brille gestützt, über die Schüssel. Ihr Magen krampfte sich zusammen, doch es kam nichts, nur trockenes Würgen. Wann hatte sie zuletzt gegessen? Sie konnte sich nicht erinnern. Sie wich zurück und ließ sich unsanft auf den Hosenboden fallen, die Beine unelegant gespreizt.
Jimmy ging ins Wohnzimmer und machte Tee in der kleinen Ecke, die als Kochnische diente. Sie hörte ihn den Wasserkessel füllen und Geschirr aus dem Schrank holen. Am liebsten hätte sie sich aufs Bett gelegt, doch irgendwas hinderte sie daran – das Bett gehörte schließlich April, und außerdem wirkte die strenge Sorgfalt, mit der es gemacht worden war, geradezu abschreckend –, also setzte sie sich, immer noch zitternd, auf den Schreibtischstuhl und legte eine Hand an die Wange. Der Schmerz hinter der Stirn war nach unten gewandert, und sie verspürte einen Druck hinter den Augen. »Die Milch ist sauer«, sagte Jimmy, während er ihr die Tasse auf den Schreibtisch stellte. »Aber es gibt genug Zucker, ich hab dir drei Löffel reingetan.«
Sie nahm ein Schlückchen von dem kochend heißen, bittersüßen Tee und rang sich ein Lächeln ab. »Ich komme mir so albern vor«, sagte sie. »Ich glaube, ich bin noch nie in Ohnmacht gefallen.« Sie sah Jimmy über den Rand ihrer dampfenden Teetasse hinweg an. Er stand vor ihr, die Hände in den Hosentaschen vergraben, den Kopf zur Seite geneigt, und beobachtete sie. Immer noch trug er den stinkenden Regenmantel. »Was sollen wir denn jetzt machen?«, fragte sie.
Er zuckte mit den Schultern. »Weiß ich auch nicht.«
»Zur Polizei gehen?«
»Und was sollen wir denen erzählen?«
»Na, dass – dass wir nichts von April gehört haben, dass wir in ihre Wohnung gegangen sind und die leer war und wir Blut im Waschbecken entdeckt haben.« Sie hielt inne, hörte ihre eigenen Worte. Wie dürftig doch ihre Argumente klangen, dürftig und überspannt.
Jimmy ging auf und ab, bahnte sich einen Weg durch Aprils Unterwäsche. »Sie könnte überall sein«, sagte er fast ungeduldig. »Sie könnte einfach Urlaub machen – du weißt ja, wie spontan sie ist.«
»Aber was, wenn sie nicht im Urlaub ist?«
»Vielleicht ist sie krank geworden und nach Hause zu ihrer Mutter gefahren.« Phoebe schnaubte verächtlich. »Könnte doch sein«, beharrte er. »Wenn Mädels krank werden, kehren sie sofort wieder zurück ins Nest.« Wo war wohl Jimmys Nest, fragte sie sich, in das er zurückkehrte, wenn er krank war oder Probleme hatte? Sie stellte sich ein beengtes weiß getünchtes Häuschen vor, am Fuße einer ungeteerten Straße, dahinter ein Berg, ein knurrender Hund am Tor und eine verhuschte Gestalt mit Schürze in einem düsteren Hauseingang. »Warum rufst du sie nicht an?«, fragte er.
»Wen?«
»Ihre Mutter. Mrs Latimer, die alte Megäre.«
Das war natürlich naheliegend, das hätte sie als Erstes tun sollen, doch die Vorstellung, mit dieser Frau zu sprechen, schüchterte sie ein. »Ich wüsste gar nicht, was ich sagen sollte«, erwiderte sie. »Außerdem hast du recht, April könnte Gott weiß wo sein und Gott weiß was machen. Nur weil sie sich nicht bei uns gemeldet hat, heißt das noch lange nicht … noch lange nicht, dass sie verschwunden ist.« Sie schüttelte den Kopf und zuckte sofort zusammen, als es hinter ihren Augen wieder zu pochen begann. »Ich glaube, wir sollten uns treffen, alle vier, du, ich, Patrick, Isabel.«
»Eine Versammlung einberufen, meinst du?«, fragte er. »Und eine Krisensitzung abhalten?« Er machte sich über sie lustig.
»Ja, wenn du es so nennen willst«, entgegnete sie unbeirrt. »Ich rufe sie an und schlage ihnen für heute Abend ein Treffen vor. Im Dolphin? Um halb acht, wie immer?«
»Na gut«, sagte er. »Vielleicht wissen die anderen ja mehr als wir, oder einer von ihnen hat schon was von ihr gehört.«
Sie stand auf und ging, die Tasse in der Hand, in die Küche. »Wer weiß?«, fragte sie mit einem Blick über die Schulter. »Vielleicht sind sie zu dritt irgendwo hingefahren.«
»Ohne uns Bescheid zu sagen?«
Warum nicht, dachte sie. Nichts ist unmöglich – rein gar nichts. April hatte ihr auch nichts von dem Schlüssel unter der Fliese erzählt. Was sie ihr wohl sonst noch so verheimlicht hatte?
4
Bei Quirkes Rückkehr herrschte in der Wohnung betretenes, muffiges Schweigen, wie in einer Schulklasse nach Eintreffen des Lehrers. Er stellte seinen Koffer ab und wanderte durch die Zimmer, spähte in die Ecken, inspizierte dieses und jenes, ohne recht zu wissen, was er zu entdecken hoffte, und fand die Wohnung haargenau so vor, wie er sie an Heiligabend in der Früh verlassen hatte, als er schwitzend und zitternd mit dem Taxi zum St. John's gefahren war. Aus unerfindlichen Gründen war er enttäuscht – hatte er etwa gehofft, seine Privatsphäre wäre zerstört, die Fensterscheiben zerbrochen, sein Besitz geplündert, das Bett umgekippt und die Laken vollgekackt? Dass hier alles noch ganz war, während er woanders solche Strapazen über sich hatte ergehen lassen müssen, erschien ihm einfach nicht angemessen. Er kehrte mit zugeknöpftem Mantel zurück ins Wohnzimmer. Seit über zwei Monaten hatte in der Wohnung niemand mehr Feuer gemacht, daher kam es ihm hier drinnen kälter vor als draußen. Als er sich bückte, um den elektrischen Heizstrahler einzustöpseln, hörte er sich ächzen. Gleich darauf schlug ihm brenzliger Geruch entgegen; auf der rot glühenden Spirale verbrannte der Staub der letzten Wochen. Dann ging er in die Küche, drehte alle vier Gasbrenner voll auf, zündete den Backofen an und stellte ihn hoch. Malachy Griffin, in seinem grauen Mackintosh-Mantel, einen dicken Wollschal um den Hals, hatte sich nicht hereingewagt, und stand nun mit dem Treppenhaus als Hintergrund wie in einem gerahmten Bild im Eingang und beobachtete, wie Quirke grimmig sein Revier zurückeroberte. Mal war lang und dürr mit schütterem Haar und trug eine randlose Brille, die seinen Augen einen tränenfeuchten Glanz verlieh.