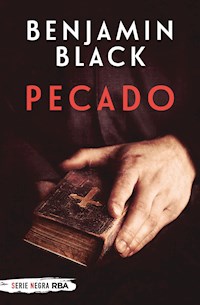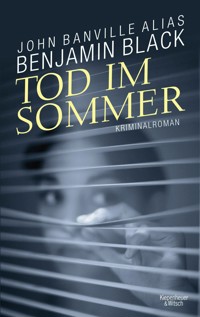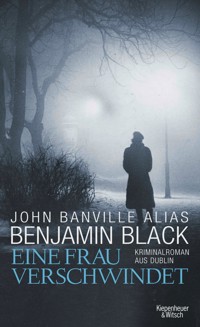9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2010
Nichts bleibt ungesühnt. Der Multimilliardär und Ex-CIA-Agent William Big Bill Mulholland will seine Memoiren schreiben lassen. John Glass, ehemaliger Journalist und Mulhollands Schwiegersohn, nimmt den Auftrag nur widerwillig an. Er engagiert einen Detektiv, der Nachforschungen anstellen soll. Wenige Tage später ist der Mann tot. Erschossen. Offenbar hatte jemand Interesse daran, gewisse Dinge geheim zu halten. Aber Schweigen kann man nicht kaufen – auch nicht, wenn man zu einer der reichsten Familien New Yorks zählt … «Gerechterweise müsste John Banville zu seinen zahlreichen Trophäen bald auch den höchsten Krimipreis Großbritanniens zählen dürfen.» (The Guardian) «Black schreibt wortgewaltig und stimmungsvoll – hinter diesem Pseudonym verbirgt sich schließlich John Banville – ein Meister der Beobachtung.» (Time) «Diese Erzählung vereint alles, wofür der Autor bekannt ist: trockenen Humor, eine spannungsgeladene Handlung und reizvolle Charaktere.» (Publishers Weekly) «Man versinkt, staunt und verneigt sich schließlich in schaudernder Ehrfurcht vor dieser raffinierten, intellektuell aufgeladenen Variante eines ‹Schwarze Serie›-Plots.» (Park Avenue)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 191
Ähnliche
John Banville alias Benjamin Black
Der Lemur
Kriminalroman
Deutsch von Gerlinde Schermer-Rauwolf und Thomas Wollermann, Kollektiv Druck-Reif
Kapitel 1
Im Glashaus
Der Rechercheur war ein hochgewachsener, sehr dünner junger Mann mit einem für seine Gestalt zu kleinen Kopf und einem Adamsapfel von der Größe eines Golfballs. Er trug eine randlose Brille mit nahezu unsichtbaren Gläsern, deren Spiegelung seinen großen, runden, leicht vorstehenden schwarzen Augen noch mehr Glanz verlieh. Ein blondes Ziegenbärtchen spross an seinem Kinn, und seine hohe, gewölbte Stirn war mit Aknenarben übersät. Seine Hände waren schlank und perlweiß, mit langen, spitz zulaufenden Fingern – die Hände eines Mädchens, oder zumindest Hände, wie man sie gern an Mädchen sieht. Selbst im Sitzen hing ihm der Schritt seiner schlabberigen Jeans halb zwischen den Knien. Sein nicht allzu sauberes T-Shirt trug die Aufschrift Life Sucks and Then You Die. Er sah aus wie siebzehn, war aber, so schätzte John Glass, Ende zwanzig, mindestens. Mit seinem langen Hals, dem kleinen Kopf und den großen, glänzenden Augen erinnerte er stark an irgendein exotisches Nagetier, bloß wollte Glass gerade nicht einfallen, welches.
Sein Name war Dylan Riley. Klar, dachte Glass, dass so einer Dylan heißt.
«Soso», sagte Riley, «Sie sind also mit Big Bills Tochter verheiratet.»
Er hatte es sich in einem der schwarzledernen Drehsessel des Büros bequem gemacht, das man Glass auf der Nordseite des Mulholland Tower zur Verfügung gestellt hatte. Hinter ihm, jenseits der Glaswand, lag Manhattan diesig grau und trüb unter durchziehenden Aprilregenwolken.
«Finden Sie das etwa komisch?», fragte Glass. Er hatte eine instinktive Abneigung gegen Leute, die T-Shirts mit schlauen Sprüchen trugen.
Dylan Riley kicherte. «Nicht komisch, nein. Überraschend. Ich wäre nie darauf gekommen, dass Sie zu Big Bills Clan gehören.»
Glass ließ das unkommentiert. Aber er atmete schwer durch die Nase, sch-sch, sch-sch, stets ein Warnzeichen.
«Mister Mulholland», sagte Glass mit Nachdruck, «legt Wert darauf, dass ich über alle ermittelbaren Fakten verfüge.»
Riley lächelte auf seine trottelige Art, drehte seinen Sessel erst in die eine, dann in die andere Richtung und nickte vergnügt. «Alle Fakten», sagte er. «Selbstverständlich.» Riley schien bester Laune zu sein.
«Ja», sagte Glass harsch, «alle Fakten. Dafür möchte ich Sie engagieren.»
In einer Ecke des Büros stand ein großer Metallschreibtisch, zu dem Glass nun hinüberging, um sich bedächtig dahinter niederzulassen. Gleich fühlte er sich weniger von Panikattacken bedroht. Das Büro lag im neununddreißigsten Stock. Absurd, von irgendjemand zu erwarten, in solcher Höhe Geschäfte zu machen – oder überhaupt etwas zu tun. An seinem ersten Tag hier war er vorsichtig an die Glasscheibe getreten und hatte nach unten gespäht. Etliche Stockwerke tiefer waren ganz gemächlich flauschige weiße Wolken wie watteweiche Eisberge über eine versunkene Stadt hinweggezogen. Nun legte er die Hände flach auf den Schreibtisch, als wäre das Möbel ein schwankendes Floß, das er ruhig zu halten versuche. Er brauchte sehr dringend eine Zigarette.
Dylan Riley hatte mit seinem Sessel eine Drehung vollführt, um sich dem Schreibtisch zuzuwenden. Glass war sich sicher, dass der junge Mann spürte, wie schwindlig und übel ihm war, hier oben in diesem Horst aus Glas und Stahl.
«Wie auch immer», sagte Glass und führte seine rechte Hand in weitem Bogen über die Tischoberfläche, als wolle er das Thema beiseitewischen; bei dieser Geste musste er daran denken, wie Richard Nixon vor vielen Jahren in den Abendnachrichten ins Schwitzen geraten war und betont hatte, er sei kein Gauner. In jenen Tagen der Paranoia und gegenseitigen Beschuldigungen waren die Studios so gnadenlos ausgeleuchtet, dass jedermann aussah wie ein Schurke in einem alten Eastmancolor-Film. «Ich sollte Sie darauf hinweisen», sagte Glass, «dass Sie von Mr.Mulholland keine Hilfe zu erwarten haben. Und ich möchte nicht, dass Sie ihn kontaktieren. Keine Anrufe, keine Briefe. Verstanden?»
Riley feixte und biss sich auf die Unterlippe, wodurch er noch mehr aussah wie ein – was denn nur? Ein Erdmännchen? Nein. So was in der Art, aber nicht ganz. «Sie haben ihm nichts gesagt, oder?», fragte Riley. «Von mir, meine ich.»
Glass überhörte das. «Ich verlange nicht von Ihnen, im Dreck zu wühlen», sagte er. «Ich nehme auch nicht an, dass Mr.Mulholland schmutzige Geheimnisse hat. Er war Geheimagent, aber er ist kein Gauner, nur falls Sie glauben sollten, dass ich ihn für einen halte.»
«Nein», sagte Riley, «er ist Ihr Schwiegervater.»
Wieder atmete Glass schwer ein. «Es wäre mir lieb, wenn Sie das bei Ihren Recherchearbeiten vergessen würden», sagte er. Er lehnte sich in seinem Sessel zurück und musterte den jungen Mann. «Wie wollen Sie eigentlich vorgehen – bei Ihren Recherchen, meine ich?»
Riley verschränkte die langen bleichen Finger über seinem Bauch und begann, in seinem Drehstuhl sanft vor und zurück zu schwingen, sodass der kugelgelagerte Mechanismus unter dem Sitz zu quietschen begann, ieek, ieek.
«Tja», sagte Riley grinsend, «wie soll ich sagen: Mit Wikipedia gebe ich mich jedenfalls nicht zufrieden.»
«Aber Sie benutzen doch… Computer und dergleichen?» Glass besaß noch nicht einmal ein Handy.
«Ja, ja, Computer», äffte Riley den Älteren nach und weitete seine ohnehin schon großen Augen noch mehr. «Und all solchen technischen Schnickschnack.»
Glass fragte sich, ob das ein britischer Akzent sein sollte. Hielt Riley ihn vielleicht für einen Engländer? Na, sollte er doch. Er stellte sich vor, wie er sich eine Zigarette anzündete: das Aufflammen des Streichholzes, der angenehme Schwefelgeruch und dann der herbe Rauch, der in seiner Kehle brannte.
«Ich möchte Sie etwas fragen», sagte Riley, und sein Spitzkopf auf dem langen Stängelhals schoss vor. «Warum haben Sie ja gesagt?»
«Ja zu was?»
«Die Biographie von Big Bill zu schreiben.»
«Ich glaube nicht, dass Sie das etwas angeht», erwiderte Glass scharf. Er sah in den Nieselregen hinaus. Vor sechs Monaten war er endgültig von Dublin nach New York übergesiedelt, er hatte eine großzügige Wohnung am Central Park West und ein Haus auf Long Island – oder zumindest seine Frau besaß beides–, doch er hatte sich noch immer nicht an das gewöhnt, was er für die typisch New Yorker Spitzzüngigkeit hielt. Jeder Hot-Dog-Verkäufer an der Straßenecke brachte es fertig, sein «Danke auch» wie fröhlichen Spott klingen zu lassen. Woher kam das nur, diese unstillbare Lust, sich andauernd gegenseitig zu verhöhnen?
«Nun lassen Sie mal hören», sagte er, «was Sie so über Mr.Mulholland wissen.»
«Umsonst?» Riley grinste wieder, lehnte sich zurück, schaute zur Decke und befingerte das Haarbüschel an seinem Kinn. «William ‹Big Bill› Mulholland. Ire aus South Boston, zweite Generation. Vater hat sich aus dem Staub gemacht, als der kleine Willie noch ein Kind war. Mutter hat sich als Wäscherin und Putzfrau durchgeschlagen. Musterschüler, Messdiener, Liebling der Priester, das Übliche. Dabei zäh – hätte ihn ein pädophiler Pfaffe angerührt, hätte der wohl seine Eier eingebüßt. Dann Ingenieurstudium am Boston College. Auf dem College von der CIA angeworben, erste Einsätze in den späten Vierzigern. Spezialgebiet elektronische Überwachung. Korea, Lateinamerika, Europa, Vietnam. Dann ist er mit James Jesus Angleton aneinandergeraten, Anlass war Angletons zwanghaftes Misstrauen gegenüber den Franzosen– Big Bill war damals in der Pariser Niederlassung der Firma postiert. In jenen Tagen erregte man nicht ungestraft das Missfallen» – wieder dieser hoffnungslose Versuch, britisch zu klingen – «von James Jesus, ohne dass man einen Kopf kürzer gemacht wurde, und Bill Mulholland wäre es nicht anders ergangen, hätte er nicht seinen Hut genommen, bevor Angleton ihm einen Arschtritt verpassen konnte, was noch das wenigste gewesen wäre. Das war in den späten Sechzigern.»
Er hievte sich aus dem Sessel hoch, entfaltete sich wie das Seil eines Fakirs und schlenderte zur Glasfront hinüber, wo er, die Hände in den Gesäßtaschen seiner Hose versenkt, stehen blieb und hinausschaute. «Nachdem er die Firma verlassen hatte, stieg Big Bill in die damals aufblühende Kommunikationsbranche ein», fuhr er fort. «Seine Spionage-Erfahrungen kamen ihm bei der Gründung von Mulholland Cable sehr zugute, er scheffelte vom Start weg Unmengen Geld. Erst zwanzig Jahre später musste er seinen Schützling Charlie Varriker beteiligen, um sein Unternehmen vor der Pleite zu retten.» Er machte eine Pause und sagte dann, ohne sich umzuwenden: «Über Big Bills eheliche Eskapaden wissen Sie vermutlich Bescheid? 1949 heiratete er die berühmteste Rothaarige der Welt, Vanessa Lane, gemeinhin als Hollywoodstar bezeichnet, und 1949 wurde die Ehe auch schon wieder aufgelöst.» Bei diesen Worten grinste er über die Schulter zu Glass. «Ist Liebe nicht einfach grotesk?»
Erneut sah er nachdenklich auf die verschwommenen Konturen der Stadt hinaus und schwieg. «Eigentlich», sagte er dann, «ist er ein solches CIA-Klischee, dass ich mich frage, ob ihn die CIA nicht erfunden hat. Nehmen Sie nur seine nächste Ehe, 1958, mit Claire Thorpington Eliot von den Bostoner Eliots – damit ist Billy the Kid aus der Brewster Street ein ordentliches Stück die Gesellschaftsleiter hinaufgestolpert. Er hat, wie Sie wissen, nur ein Kind, seine Tochter Louise, aus der Ehe mit der zweiten Ms.Mulholland. Miz Claire, wie man die Grande Dame nannte, starb im April 1961 bei einem Jagdunfall – scheuendes Pferd, Genickbruch–, wie es das blutrünstige Schicksal wollte, am Vorabend der Invasion in der Playa Girón, auch bekannt als Schweinebucht, ein Abenteuer, in dem Big Bill bis über beide Ohren steckte. Der trauernde Witwer kehrte von der Küste Floridas zurück und fand die Eliots bereits damit beschäftigt, seine Sachen einschließlich seiner zweijährigen Tochter vor die Tür des großen alten Familiensitzes in Back Bay zu verfrachten.»
Nun wandte er sich um, ging zurück, ließ sich wieder in den Sessel fallen und verdrehte die Augen zur Decke. «Danach heiratete Big Bill ein drittes Mal. Nancy Harrison, Schriftstellerin, Journalistin, Martha-Gellhorn-Verschnitt. Er lebte mit ihr irgendwo an der Westküste von Irland, kaum einen Oscar-Wurf von seinem alten Freund und Saufkumpan John Huston entfernt. Großartige Zeit, nach allem, was man so hört, die jedoch, wie alle großartigen Zeiten, rasch ihr Ende fand. Die blonde Nancy konnte den ewigen Regen und die tumben Einheimischen nicht ertragen, schnappte sich ihre Remington und verschwand in südlichere Gefilde– Ibiza, Clifford Irving, Orson Welles und so weiter.» Er hielt inne, löste die glänzenden Augen von der Decke und richtete sie auf Glass. «Wenn Sie mehr wollen, kein Problem. Und dabei habe ich noch nicht einmal in die Kristallkugel meines Laptops geschaut.»
«Wie haben Sie das gemacht?», fragte Glass. «Haben Sie das etwa auswendig gelernt?»
Im Blick des jungen Mannes zeigte sich eine gewisse Schärfe, auch Verdruss. «Ich habe ein fotografisches Gedächtnis.»
«Praktisch, bei Ihrem Job», sagte Glass.
«Ja.»
Jetzt war er sauer, Glass entging es nicht. Seine Berufsehre war angekratzt. Gut zu wissen, wo sein wunder Punkt lag.
Glass erhob sich, einen Finger auf der Tischplatte, um sein Gleichgewicht zu sichern, und wanderte dann vorsichtig in den Raum hinein. Bei jedem Schritt war ihm, als müsse er gleich vornüberkippen, auch hatte er das Gefühl, dass es ihn unwiderstehlich seitwärts zu jener gläsernen Wand und dem in die Magengrube fahrenden Nichts dahinter zog. Ob er sich je an diesen wolkenkratzenden Turm gewöhnen würde?
«Ich sehe schon», sagte er, «ich habe die richtige Wahl getroffen. Denn was ich will, sind die Details – die Sachen, die zu suchen ich keine Zeit oder, ehrlich gesagt, keine Lust habe.»
«Nein», sagte Riley aus den ledernen Tiefen seines Sessels, dem Klang seiner Stimme nach immer noch beleidigt, «Details waren nie Ihre Stärke, stimmt’s?»
Was Glass besonders traf, war nicht das Kränkende dieser Worte, sondern die Zeitform des Verbs. Ob es alle so sehen würden, dass er mit der Annahme des Auftrags, die Biographie seines Schwiegervaters zu schreiben, seine journalistische Berufung verraten hatte? Sollte das der Fall sein, so irrten sie sich – allerdings wiederum nur bei der Zeitfrage. Denn er hatte den Journalismus bereits an den Nagel gehängt, bevor Big Bill ihm dieses Angebot unterbreitet hatte, das abzulehnen schlicht verrückt gewesen wäre. Seine Berichte von den Unruhen aus Nordirland, vom Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens, dem Völkermord in Ruanda, der Intifada, von jenem blutigen Samstagnachmittag in Srebrenica, sie waren stets weniger Reportagen als vielmehr ausgiebige, leidenschaftlich vorgetragene Klagegesänge gewesen – damit war es aus und vorbei. Etwas in ihm war verstummt, ein Licht war erloschen, er wusste nicht, warum. Dabei war es ganz einfach: Er fühlte sich ausgebrannt. Eine alte Geschichte. Auch er war ein wandelndes Klischee. «Ich möchte, dass du diese Sache schreibst, mein Sohn», hatte Big Bill zu ihm gesagt und ihm dabei eine Hand auf die Schulter gelegt, «nicht nur, weil ich dir vertraue, sondern weil es auch andere tun. Ich will keine Hagiographie – die steht mir auch gar nicht zu, ich bin kein Heiliger. Was ich will, ist die Wahrheit.» Und Glass hatte gedacht: Oh, die Wahrheit.
«Es wird nicht leicht werden für Sie», sagte er nun zu dem jungen Mann, der sich in dem muschelförmigen Sessel fläzte.
«Und wieso?»
«Ich möchte nicht, dass Mr.Mulholland von Ihnen und dem, was Sie tun, Wind bekommt. Sie verstehen?»
Er drehte sich um – zu schnell, sodass ihm schwindlig wurde – und bedachte Dylan Riley mit einem Blick, der gnadenlos sein sollte. Doch Riley blickte schon wieder zur Decke hinauf und kaute am Nagel des kleinen Fingers seiner linken Hand, es war unklar, ob er überhaupt zugehört hatte.
«Diskretion», sagte Riley, «ist mein Beruf. Außerdem wären Sie vermutlich überrascht, wie viele Informationen– Details, wie Sie es auszudrücken belieben – sich in irgendwelchen Akten finden, wenn man weiß, wo man blättern muss.»
Glass wollte den Burschen plötzlich nur noch loswerden. «Haben Sie einen Standardvertrag?», fragte er schroff.
«Einen Vertrag? Ich arbeite nicht auf Vertragsbasis.» Riley lächelte verschlagen. «Ich vertraue Ihnen.»
«Ach, tatsächlich? Hätte nicht gedacht, dass Sie irgendwem trauen, angesichts der Natur Ihrer Arbeit.»
Riley erhob sich von seinem Stuhl und strich den Schritt seiner schlabbrigen Hose mit schaufelnden Bewegungen beider Hände glatt. Wirklich eine unappetitliche Person. «Die Natur meiner Arbeit?», sagte er. «Ich bin Rechercheur, Mr.Glass. Mehr nicht.»
«Ja, aber Sie schnüffeln herum. Und sicherlich sind die Dinge, die Sie herausfinden, manchmal nicht nach dem Geschmack Ihrer Auftraggeber. Ganz zu schweigen von den Leuten, die Sie unter die Lupe genommen haben.»
Riley bedachte ihn mit einem langen, durchdringenden Blick und legte den Kopf schief, seine Augen wurden zu Schlitzen. «Sagten Sie nicht, Big Bill hätte keine schmutzigen Geheimnisse?»
«Ich sagte, dass ich das nicht erwarte.»
«Und ich sage Ihnen, jeder hat Geheimnisse, und in der Regel sind sie schmutzig.»
Glass wandte sich zur Tür und zog den jungen Mann mit sich. «Sie machen sich unverzüglich an die Arbeit», sagte er. Es war eine Feststellung, keine Frage. «Wann höre ich von Ihnen?»
«Ich muss mir erst ein paar Gedanken über die Sache machen, einen Arbeitsplan erstellen, Prioritäten setzen. Dann melde ich mich.» Schon hatte Glass die Tür geöffnet. Die ziemlich abgestandene Luft im Korridor roch schwach nach verbranntem Gummi. «Und ich muss mir noch ein paar Gedanken über Sie machen», sagte Riley und lachte unvermittelt bitter auf. «Wissen Sie, ich habe früher Ihre Artikel gelesen, im Guardian, im Rolling Stone, in der New York Review. Und jetzt schreiben Sie Big Bill Mulhollands Lebensgeschichte.» Er blies die Backen auf und entließ die Luft mit einem leisen Plopp. «Wow», sagte er und wandte sich zum Gehen.
Glass schloss die Tür hinter ihm und ging zu seinem Schreibtisch zurück. Kaum hatte er ihn erreicht, klingelte das Telefon, als sei es ein verabredetes Zeichen. «Der Sicherheitsdienst, Mr.Glass. Ihre Frau ist hier.»
Einen Augenblick lang sagte Glass nichts. Er berührte den Sessel, in dem Dylan Riley gesessen hatte, sodass der wieder leise protestierte: iek, iek. Der junge Mann hatte einen markanten Geruch hinterlassen, eine gräuliche, widerwärtige Ausdünstung.
Ein Lemur! Das war das Tier, dem Dylan Riley ähnelte. Ja, natürlich. Ein Lemur.
«Sie soll raufkommen», sagte John Glass.
Kapitel 2
Louise
Louise Glass war achtundvierzig und sah aus wie dreißig – eine hochgewachsene, schlanke Rothaarige, auch wenn das Rot inzwischen größtenteils aus der Tube stammte. Ihr Teint war so blass, dass er fast durchsichtig schien, ihre markanten Gesichtszüge wirkten aus manchen Blickwinkeln lieblich, aus anderen faszinierend streng. Wie Glass sich zum x-ten Mal eingestand, war sie eine hinreißende Frau – die er nicht mehr liebte. Es war merkwürdig. Eines Tages – etwa zu dem Zeitpunkt, als er aufgehört hatte, Journalist zu sein – war alles, was er für sie gefühlt hatte, all die hilflose, halb gequälte Leidenschaft, auf den Nullpunkt gefallen. Als wäre diese Frau aus Fleisch und Blut in seinen Armen zu Stein geworden, wie eine verwunschene Märchenprinzessin. Dabei war sie, wie sie immer gewesen war, eine geschmeidige, grazile, auf Hochglanz polierte Schönheit, bei deren bloßem Anblick in früheren Tagen etwas in ihm in einer Art lustvoller Qual herzzerreißend aufgeschrien hatte; doch jetzt löste ihre Gegenwart nur noch eine leise, verhallende Melancholie in ihm aus. Heute trug sie ein dunkelgrünes Kostüm und einen Hut von Philip Tracey, ein winziges schwarzes Samtquadrat, dekoriert mit ein paar Büscheln, die an Zuckerwatte erinnerten.
«Was ist los?», fragte sie. «Du siehst grauenhaft aus.»
«Das macht dieses Büro.»
Stirnrunzelnd sah sie sich um. Sie hatte ihm vorgeschlagen, sich dieses Büro zu nehmen – der Wolkenkratzer gehörte ihrem Vater. «Was stimmt nicht damit?»
Er wollte nicht zugeben, dass es ihm Angst einjagte, fast vierzig Stockwerke über Straßenniveau zu sein. «Es ist zu unpersönlich. Ich weiß nicht, ob ich hier schreiben kann.»
«Du könntest auch in der Wohnung arbeiten.»
«Du weißt doch, dass ich zu Hause nicht schreiben kann.»
Ihre graugrünen Augen ruhten auf ihm. «Ist es denn ein Zuhause?» Ein Abgrund an Stille tat sich auf, in den beide einen kurzen Blick warfen und rasch zurücktraten.
«Du solltest nach Silver Barn fahren.» Silver Barn war das Haus – Louises Haus – auf Long Island. «Das Arbeitszimmer ist komplett eingerichtet. Es ist ruhig dort, du bist völlig ungestört.» Er verzog das Gesicht. «Nun», ihre Lippen wurden schmal, «wenn du nicht arbeiten kannst, kannst du mich ja zum Mittagessen ausführen.»
Sie gingen die 44th Street entlang Richtung Osten, und endlich konnte Glass eine Zigarette rauchen. Der feine Sprühregen war wie ein Gazeschleier. Das Problem mit dem Rauchen bestand darin, dass das Bedürfnis danach so viel größer war als die Befriedigung, die sich dann dabei tatsächlich einstellte. Manchmal vergaß er, dass er bereits eine Zigarette in der Hand hatte, und griff nach dem Päckchen, um sich die nächste anzuzünden. Vielleicht sollte man es genau so machen und sechs auf einmal rauchen, drei zwischen die Finger jeder Hand geklemmt, wie eine Gatling Gun.
Wie immer in diesen Tagen war Mario’s gerammelt voll. Die rotkarierten Tischdecken und wackeligen Holzstühle gaukelten eine ländliche Schlichtheit vor, die in krassem Widerspruch zu den atemberaubenden Preisen auf der Speisekarte stand. Das Ehepaar Glass zählte seit der Eröffnung des Lokals zu den Gästen, schon lange bevor sie nach New York umgesiedelt waren. Damals kümmerte sich Mario noch selbst um alles, und es war wirklich schlicht. Aus Gründen, die sie selbst nicht mehr wussten, hatten sie dem Lokal den Spitznamen Bleeding Horse gegeben. Jetzt drückte Louise einem Ober ihren tropfenden Schirm in die Hand, und sie wurden zu ihrem üblichen Tisch am Fenster geführt, der, wie Glass auffiel, für drei gedeckt war. Unverzüglich wurden Proseccoflöten gebracht. «Wenn ich bloß den Mumm hätte, ihnen einmal zu sagen, was für ein triviales Gesöff das meiner Meinung nach ist», murmelte Louise.
Glass schwieg. Er mochte Prosecco. Auch gefiel ihm die Geste, dass die Getränke ohne Bestellung gebracht und übertrieben beflissen vor sie hingestellt wurden. Das gab ihm das Gefühl, ein alteingesessener New Yorker zu sein, er sah die Bildunterschrift beinahe vor sich: «Auf ein Glas im Bleeding Horse, eins seiner Lieblingslokale in Manhattan». Eine alte Gewohnheit, er dachte oft im Zeitungsstil an sein Leben. Ob Louise ihn wohl auch für trivial hielt, so wie den Aperitif?
«Wie geht’s mit der Arbeit?», fragte sie, den Blick auf die Speisekarte gesenkt. «Hast du schon angefangen?» Mit dem länglich kantigen, blassen Gesicht, den Kopf geneigt und die Speisekarte wie einen Psalter in der Hand, sah sie in dem diesigen Licht, das durchs Fenster fiel, wie eine frühe florentinische Madonna aus.
«Nein», erwiderte er. «Ich habe noch nicht angefangen. Mit dem Schreiben, meine ich. Da sind noch ein paar Vorarbeiten nötig.»
«Du meinst Recherchen?»
Ein scharfer Blick. Doch sie konnte nichts von Dylan Riley wissen, keinesfalls, er hatte niemandem von dem Lemur erzählt. Sie studierte immer noch die Speisekarte, mit dieser gespannten, strahlenden Aufmerksamkeit, die sie allem entgegenbrachte, sogar, wie er sich reuevoll erinnerte, dem Liebesakt.
«Ja, Recherchen», brummelte er, «und solches Zeug.»
Der Ober kam, und Glass bestellte Linguine mit Muscheln. Louise entschied sich für grünen Salat. Mehr aß sie mittags nie. Aber warum hatte sie sich dann so lange in die Speisekarte vertieft, wunderte sich Glass. Nachdem der Ober die Bestellung aufgenommen hatte, zeigte er mit dem Stift fragend auf den unbesetzten dritten Platz, doch Louise schüttelte den Kopf. «Vielleicht schaut David vorbei», erklärte sie Glass. «Ich hab ihm gesagt, dass wir hier essen und er mit uns zusammen den Kaffee nehmen könnte.»
Glass enthielt sich jeden Kommentars. David Sinclair war Louises Sohn aus ihrer ersten Ehe mit einem Wall-Street-Anwalt, der aus ihrem Leben verschwunden war, ohne größere Spuren zu hinterlassen, mit Ausnahme des jungen Mannes natürlich, der jetzt den Dreh- und Angelpunkt ihrer Welt bildete. Glass sah sich nach dem Ober um, weil er die Weinkarte sehen wollte. Wenn sein Stiefsohn hier aufkreuzte, würde er mehr brauchen als ein Glas Prosecco.
Das Essen kam, und eine Zeit lang aßen sie schweigend. Der leichte Regen benetzte die Scheiben, die vorbeifahrenden Autos und Taxis schwammen silbrig schimmernd vorbei wie eine wässrige Fata Morgana. Warum er wohl so ein Geheimnis aus Dylan Riley machte, überlegte Glass. Bill Mulhollands Leben war ein Sinnbild für die letzten zwei Drittel des chaotischen, gewalttätigen und schwindelerregend innovativen Jahrhunderts, das vor kurzem zu Ende gegangen war. Niemand würde von einem Biographen erwarten, sich ohne Hilfe an die umfangreiche Recherche zu machen, die nötig war, wenn man die Lebensgeschichte eines solchen Mannes aufschreiben wollte – niemand außer diesem Mann selbst. Bill Mulholland war der Prototyp des kantigen Individualisten und erwartete, dass alle in seiner Umgebung aus demselben harten Holz geschnitzt waren. Was für ein Weichei von Schreiberling würde denn jemanden anheuern, um die Kärrnerarbeit für ihn zu erledigen? Er hatte seinem Schwiegersohn den Auftrag und ein Honorar von einer Million Dollar geboten, weil er ihm – so hatte er sich ausgedrückt – vertraute; das hieß, er vertraute darauf, dass Glass einige allzu gewichtige Steine nicht umdrehen würde, das hatte er wohl verstanden. Glass selbst war es, der alle Fakten wollte, nicht sein Schwiegervater, wie er es Dylan Riley erzählt hatte, auch und gerade die unbequemen. Glass hielt es mit Aristoteles: Die Kenntnis von Geheimnissen verschafft Macht.
Er trank einen Schluck Wein und musterte seine Frau, die mit langgestrecktem Hals wie ein Reiher am Flussufer in ihrem Grünzeug pickte. Sie hatte ihn vehement dazu gedrängt, das Angebot ihres Vaters anzunehmen. «Du hast doch immer die Herausforderung gesucht», hatte sie gesagt, «und die Biographie meines Vaters zu schreiben ist ganz fraglos eine.» Auch hier war ihm die Vergangenheitsform aufgefallen. «Und eine Million Dollar», hatte sie mit schiefem Lächeln hinzugesetzt, «ist eine Million Dollar.»