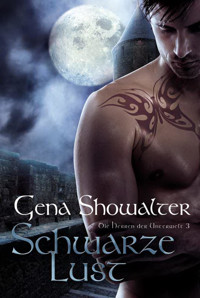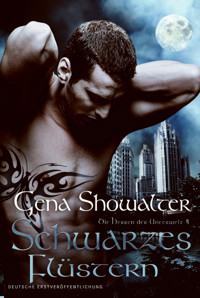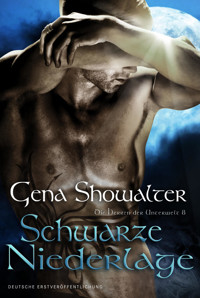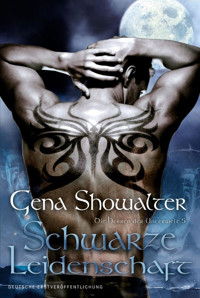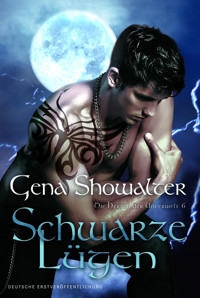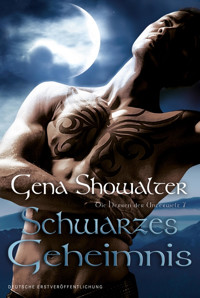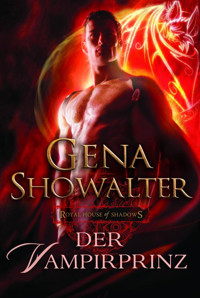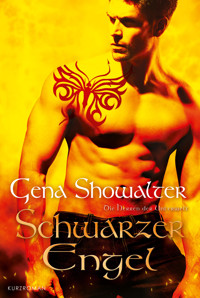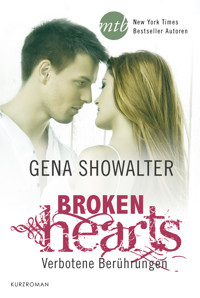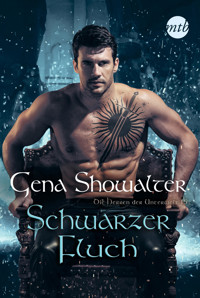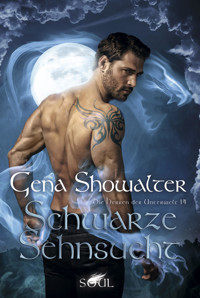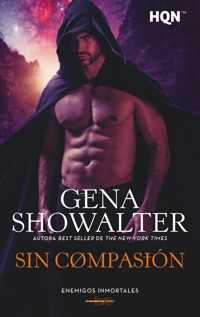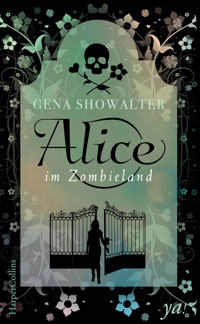
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Dragonfly
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: The White Rabbit-Chronicles
- Sprache: Deutsch
Alice hat unter mysteriösen Umständen ihre Familie verloren - und wenn sie nicht bald erfährt, wer oder was hinter dem Unfall steckt, dreht sie noch durch. Auf ihrer neuen Highschool in Birmingham kommt sie der Wahrheit näher, als ihr gut tut. Sind es womöglich Zombies, die sie zur Waisen gemacht haben? Nie hat sie an deren Existenz geglaubt. Jetzt zeigt der draufgängerische Cole ihr, wie sie sich gegen die fleischfressenden Untoten zur Wehr setzen kann. Und er weckt eine Sehnsucht in ihr, die sie jede Vorsicht vergessen lässt.
"Ein verheißungsvoller Auftakt der Serie." Kirkus Reviews
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 592
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Zum Buch:
An ihrem 16. Geburtstag sieht Alice „Ali“ Bell eine Wolke, welche die Form eines weißen Kaninchens hat. Kurz darauf passiert, was Alice nie für möglich gehalten hätte: Ihre Eltern, ihre Schwester und sie werden von Zombies angegriffen. Nur Ali überlebt. Sie zieht zu ihren Großeltern nach Birmingham und fängt an einer neuen Schule an. Um zu überleben, muss sie dem undurchsichtigsten Typen an der Asher Highschool vertrauen: Cole Holland weiß, wie man Zombies jagt. Aber er hat selbst Geheimnisse; und es scheint, dass die größten Gefahren dort lauern, wo Ali sie am wenigsten vermutet …
„Leser werden sich in die kämpferische Heldin verlieben.“
Romantic Times Book Review
Zur Autorin:
New York Times- und USA Today-Bestsellerautorin Gena Showalter gilt als Star am romantischen Bücherhimmel des Übersinnlichen. Ihre Romane erobern nach Erscheinen die Herzen von Kritikern und Lesern gleichermaßen.
Lieferbare Titel:
Rückkehr ins Zombieland (White Rabbit Chronicles #2)Showdown im Zombieland (White Rabbit Chronicles #3)Verrat im Zombieland (White Rabbit Chronicles #4)
Gena Showalter
Alice im Zombieland
Roman
Aus dem Amerikanischen von Constanze Suhr
HarperCollins YA! ®
HarperCollins YA!® Bücher erscheinen in der HarperCollins Germany GmbH, Valentinskamp 24, 20354 Hamburg Geschäftsführer: Thomas Beckmann
Deutsche Erstausgabe Copyright © 2014 by MIRA Taschenbuch in der Harlequin Enterprises GmbH
Copyright © 2016 by HarperCollins YA! in der HarperCollins Germany GmbH
Titel der amerikanischen Originalausgabe: Alice in Zombieland Copyright © 2012 by Gena Showalter Erschienen bei: Harlequin Teen, Toronto
Published by arrangement with Harlequin Enterprises II B.V./S.àr.l.
Konzeption/Reihengestaltung: fredebold&partner GmbH, Köln Cover-/Umschlaggestaltung: formlabor, Hamburg
Redaktion: Tania Krätschmar Titelabbildung: Angelinna, Gocili, majivecka, Aji Pebriana / Shutterstock
ISBN eBook 978-3-95967-618-2
www.harpercollins.de
eBook-Herstellung und Auslieferung:readbox publishing, Dortmundwww.readbox.net
Alle Rechte, einschließlich das des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten.
Der Preis dieses Bandes versteht sich einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Alle handelnden Personen in dieser Ausgabe sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig.
EINE VORBEMERKUNG VON ALICE
Hätte mir jemand gesagt, dass sich mein gesamtes Leben von einem Herzschlag zum nächsten völlig umkehren würde, ich hätte denjenigen ausgelacht. Von wunschlos glücklich zu am Boden zerstört? Von reiner Unschuld zu knallhart? Also bitte!
Aber so war es. Von einem Augenblick zum nächsten. Ein Wimpernschlag, ein Atemzug, eine Sekunde und alles, was mir vertraut war, was ich liebte, war weg.
Mein Name ist Alice Bell, und am Abend meines sechzehnten Geburtstags verlor ich meine geliebte Mutter, die von mir angebetete Schwester und den Vater, den ich erst verstand, als es zu spät war, nämlich in dem Moment, als meine Welt zusammenbrach und sich eine vollkommen neue vor mir auftat.
Mein Vater hatte recht. Mitten unter uns bewegen sich Ungeheuer.
Nachts erheben sich diese lebenden Toten, diese … Kreaturen aus ihren Gräbern und verzehren sich nach dem, was sie verloren haben. Leben. Sie werden sich von euch ernähren. Sie werden euch infizieren. Und dann werden sie euch töten. Wenn das passiert, werdet ihr euch ebenfalls aus euren Gräbern erheben. Es ist ein endloser Kreislauf, wie bei einem Hamster in einem mit Stacheldraht gespickten Laufrad, blutend und sterbend, während die spitzen Stacheln sich tiefer ins Fleisch bohren, ohne einen Ausweg aus dieser tödlichen Dynamik.
Diese Kreaturen kennen keine Angst, keinen Schmerz, aber sie sind hungrig. Oh ja, so hungrig. Es gibt nur eine Möglichkeit, sie aufzuhalten – wie, das kann ich euch nicht erklären. Das muss ich euch zeigen. Was ich euch sagen kann, ist, wir müssen die Monster bekämpfen, um sie unschädlich zu machen. Um das tun zu können, müssen wir uns ihnen nähern. Wer sich diesen Zombies nähert, muss schon etwas Mut haben – und ziemlich bescheuert sein.
Aber wisst ihr was? Es ist mir lieber, die anderen halten mich für verrückt, falls ich bei einem Kampf umkomme, als dass ich mich den Rest meines Lebens vor der Wahrheit verstecke. Zombies existieren. Sie sind da draußen.
Wenn ihr nicht aufpasst, werden sie sich auch euch schnappen. So ist es. Jawohl. Ich hätte auf meinen Vater hören sollen. Er hatte mich wieder und wieder davor gewarnt, nachts rauszugehen, davor, mich auf einen Friedhof zu wagen, und mir eingeschärft, nie, unter gar keinen Umständen, jemandem zu vertrauen, der mich dazu überreden will. Er hätte sich an seinen eigenen Rat halten sollen, denn er vertraute mir – und ich überzeugte ihn davon, genau das zu tun.
Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen und tausend Dinge anders machen. Ich würde Nein zu meiner Schwester sagen, würde niemals meine Mutter anflehen, meinen Dad zu überreden. Ich würde keine Tränen vergießen, meine Lippen versiegeln und diese hasserfüllten Worte hinunterschlucken. Außerdem würde ich meine Schwester, meine Mutter und meinen Vater noch ein letztes Mal umarmen. Würde ihnen sagen, dass ich sie liebe.
Das wünschte ich mir … ja, das wäre mein Wunsch.
1. KAPITEL
Hinunter in den Zombiebau
Vor sechs Monaten …
„Bitte, Alice. Bitte.“
Ich lag hinten im Garten auf einer Decke ausgestreckt und flocht eine Kette aus Gänseblümchen für meine kleine Schwester. Die Sonne strahlte am endlos babyblauen Himmel, helle bauschige Wölkchen zogen vorüber. Während mir der typische schwere Duft von Geißblatt und Lavendel, der zum Sommer in Alabama gehörte, in die Nase stieg, machte ich in den Wolken bekannte Umrisse aus. Eine lange Raupe mit Beinen. Ein Schmetterling mit einem zerrissenen Flügel. Ein fettes weißes Kaninchen, das auf einen Baum zuhoppelte.
Die achtjährige Emma tänzelte um mich herum. Sie trug ein glitzerndes pinkfarbenes Ballerinakostüm. Ihre Rattenschwänze hüpften bei jeder ihrer Bewegungen. Sie war eine Miniaturausgabe unserer Mutter und das genaue Gegenteil von mir.
Die beiden hatten dunkles glänzendes Haar und wunderschöne, leicht schräg gestellte, golden wirkende Augen. Mom war klein, kaum über eins sechzig, und ich war mir nicht sicher, ob Em überhaupt jemals diese Größe erreichen würde. Ich dagegen? Mein Haar war lockig und weißblond, meine Augen blau und meine Beine ziemlich lang. Mit meinen eins achtundsiebzig war ich größer als die meisten Jungen meiner Schule und fiel deshalb immer auf – ich konnte nirgends hingehen, ohne dass mir ein paar Bist-du-eine-Giraffe-Blicke zugeworfen wurden.
Die Jungen hatten nie Interesse an mir gezeigt, aber ich konnte nicht zählen, wie viele schmachtende Blicke meiner Mutter auf ihren Wegen folgten oder – würg! – wie oft ich anerkennende Pfiffe hörte, wenn sie sich hinunterbeugte, um etwas aufzuheben.
„Al-liss.“
Em stand neben mir und stampfte mit einem ihrer Füße, die in Ballerinaschühchen steckten, auf den Boden, um meine Aufmerksamkeit zu erregen.
„Hörst du mir zu?“
„Süße, das haben wir doch schon hunderttausend Mal besprochen. Deine Vorführung fängt zwar an, wenn es draußen noch hell ist, aber wenn sie vorbei ist, ist es bereits so gut wie dunkel. Du weißt, dass Dad uns niemals erlauben wird, dann das Haus zu verlassen. Und Mom hat dich nur unter der Bedingung für den Kurs angemeldet, dass du keinen Aufstand machst, wenn du mal eine Übungsstunde oder eine – was war es gleich? – Aufführung verpasst.“
Sie kam ganz dicht an mich heran und stellte einen ihrer Füße in pinkfarbenen Schlappen auf meine Schulter. Ihr kleiner Körper warf einen Schatten über mich, der groß genug war, um das Sonnenlicht auszublenden. Sie füllte mein gesamtes Blickfeld aus und schimmerte golden. Flehend sah sie mich an.
„Heute ist dein Geburtstag. Ich weiß, ja, okay, am Morgen hab ich nicht daran gedacht … am Nachmittag auch nicht … Aber letzte Woche wusste ich es noch genau – du erinnerst dich doch, dass ich es Mom gesagt habe, oder? Und jetzt ist es mir wieder eingefallen, zählt das etwa nicht? Na, klar zählt das“, sagte sie schnell, bevor ich darauf reagieren konnte. „Daddy muss einfach machen, was du dir wünschst. Wenn du ihn also darum bittest, dass wir gehen dürfen, und … und …“ Da war so viel Sehnsucht in ihrem Tonfall. „Und wenn du ihn bittest, dass er mitkommt und mir zusieht, dann macht er das bestimmt.“
Mein Geburtstag. Ja, ja. Meine Eltern hatten nicht daran gedacht. Wieder mal. Anders als Em erinnerten sie sich nie an so etwas. Vergangenes Jahr war mein Vater zu sehr damit beschäftigt gewesen, Single Malt in sich reinzukippen und von Monstern zu faseln, die außer ihm niemand sehen konnte. Und meine Mutter hatte viel zu viel damit zu tun, alles hinter ihm sauber zu machen. So wie immer.
Dieses Jahr hatte Mom einen Zettel mit einer Notiz in ihre Schublade gelegt, als Erinnerung. (Ich habe ihn gefunden.) Und wie Em schon gesagt hatte – meine kleine Schwester hatte nach zahlreichen Andeutungen rundheraus gemeint: „Hey, Alice hat Geburtstag, und ich finde, sie hat eine Party verdient!“
Als ich heute Morgen aufgewacht war, fand ich alles beim Alten. Nichts hatte sich geändert.
Was soll’s! Ich war ein Jahr älter, endlich süße sechzehn, doch mein Leben blieb dasselbe. Ehrlich, das war keine aufregende Sache. Ich machte mir schon lange keine großen Hoffnungen mehr.
Em war da anders. Sie wollte das, was ich nie gehabt hatte, die ungeteilte Aufmerksamkeit unserer Eltern.
„Wenn heute mein Geburtstag ist, solltest du dann nicht was für mich machen?“, fragte ich und hoffte, sie damit von ihrer ersten Ballettaufführung, in der sie als Prinzessin auftreten sollte, abzulenken, eine Rolle, von der sie behauptete, „dafür geboren zu sein“.
Sie stemmte die Fäuste in die Hüften, ein Ausbund an Unschuld und gleichzeitiger Empörung und, auf jeden Fall, mein Allerliebstes auf der Welt.
„Na hallo! Das ist mein Geschenk für dich, wenn ich dich das machen lasse.“
Ich musste mir das Grinsen verkneifen. „Ach, so ist das?“
„Jawohl! Ich weiß nämlich, wie gern du meine Aufführung sehen willst, du hast ja vor lauter Geifer schon Schaum vorm Mund.“
So ein Satansbraten. Ich konnte ihrer Logik aber nicht wirklich widersprechen. Ich wollte sie tatsächlich tanzen sehen.
Ich weiß noch, wie es in der Nacht war, als Em geboren wurde. Die wilde Mischung aus Angst und Hochstimmung hatte diese Erinnerung in mein Gedächtnis gebrannt. Wie bei meiner Geburt, hatten sich meine Eltern entschlossen, eine Hebamme zu engagieren, die Hausbesuche machte. Dann müsste meine Mutter nicht ins Krankenhaus, wenn der große Moment kam.
Dieser Plan hatte nicht funktioniert.
Die Sonne war bereits untergegangen, als bei meiner Mutter die Wehen einsetzten, und mein Vater hatte sich geweigert, der Hebamme die Tür zu öffnen, aus lauter Furcht, dass ihr ein Monster hereinfolgen könnte.
Also hatte Dad bei Emma Geburtshilfe geleistet, während Mom das ganze Haus zusammenschrie. Ich hatte mich unter meiner Bettdecke verkrochen und vor Angst geheult und gezittert.
Als der Lärm endlich aufgehört hatte, war ich ins Elternschlafzimmer geschlichen, um nachzusehen, ob alle überlebt hatten. Dad war herumgewuselt, und meine Mutter hatte erschöpft auf dem Bett gelegen. Vorsichtig war ich auf sie zugegangen und hatte, um bei der Wahrheit zu bleiben, erschrocken nach Luft geschnappt. Baby Emma war keinesfalls ein schöner Anblick gewesen. Rot und schrumpelig mit gruseligen dunklen Härchen an den Ohren. (Glücklicherweise fielen diese Härchen dann aber später aus.) Mom hatte über das ganze Gesicht gestrahlt und mich zu sich gewinkt, weil ich meine „neue beste Freundin“ kennenlernen sollte.
Ich hatte mich neben sie aufs Bett gesetzt, die Kissen in meinem Rücken zurechtgeklopft, und sie hatte mir dieses sich windende kleine Bündel in die Arme gelegt. Augen, die so wunderschön waren, dass sie nur von Gott erschaffen worden sein konnten, blickten zu mir auf. Rosige gekräuselte Lippen, wedelnde winzige Fäuste.
„Wie sollen wir sie nennen?“, hatte meine Mutter gefragt.
Als die kleine knubbelige Hand einen meiner Finger umklammert hatte, weiche, warme Haut, hatte ich beschlossen, dass Haare auf den Ohren eigentlich gar nicht so schlimm waren. „Lily“, hatte ich vorgeschlagen. „Wir sollten sie Lily nennen.“ Ich hatte ein Buch über Blumen, und Lilien mochte ich am liebsten.
Das leise Lachen meiner Mutter hatte mich umfangen. „Das gefällt mir. Was hältst du von Emmaline Lily Bell, da Nanas richtiger Name Emmaline ist. Es wäre nett, meine Mutter auf diese Weise zu ehren. Bei deinem Namen haben wir ja den der Mutter deines Vaters einbezogen. Wir können dieses kleine Wunder dann kurz Emma nennen und der Rest bleibt unter uns dreien ein schönes Geheimnis. Du bist meine Alice Rose und sie ist meine Emma Lily und ihr beide zusammen seid für mich ein wundervoller Strauß.“
Darüber hatte ich nicht lange nachdenken müssen. „Okay. Abgemacht.“
Baby Emma hatte etwas gegurgelt, und ich hatte das als Zustimmung genommen.
„Alice Rose“, sagte Emma jetzt. „Du bist mit deinen Gedanken wieder ganz woanders, gerade wenn ich dich so dringend brauche wie nie.“
„Okay, okay.“ Ich seufzte. Ich konnte ihr einfach nichts abschlagen. Das hatte ich noch nie gekonnt, würde ich auch niemals können. „Ich gehe aber nicht zu Dad. Ich werde mit Mom sprechen und sie überreden, dass sie mit ihm spricht.“
Der erste Hoffnungsfunke blitzte auf. „Wirklich?“
„Wirklich.“
Ihr Gesicht begann zu strahlen, dann hüpfte sie wieder auf und ab. „Bitte, Alice. Du musst sofort mit ihr reden. Ich will nicht zu spät kommen, und wenn Dad Ja sagt, müssen wir bald aufbrechen, damit ich mich auf der Bühne noch zusammen mit den anderen Mädchen aufwärmen kann. Bitte. Jeeetzt.“
Ich setzte mich auf und legte ihr die Blumenkette um den Hals. „Du weißt aber, dass die Chancen nicht besonders gut stehen, ja?“
Eine Grundsatzregel im Bell-Haushalt lautete: Du verlässt das Haus nicht, wenn du nicht vor Einbruch der Dunkelheit wieder zurück sein kannst. Drinnen hatte Dad spezielle „Abwehrmaßnahmen“ gegen Monster getroffen, um sicherzustellen, dass keins von ihnen zu uns hereinkommen konnte. Wenn es Nacht wurde, nun, dann blieben wir an Ort und Stelle. Jeder in der großen bösen Welt draußen vor unserer Tür war ohne jeglichen Schutz und ein angreifbares Ziel.
Dieser Wahn und die Paranoia meines Vaters sorgten dafür, dass ich diverse Schulaktivitäten versäumte und an zahllosen Sportveranstaltungen nicht teilnahm. Ich hatte noch nie eine Verabredung mit einem Jungen gehabt. Ja, ich hätte zu einem Wochenendmittagessen oder anderen genauso ätzend lahmen Events gehen können, aber soll ich mal ehrlich sein? Ich hatte überhaupt keinen Drang nach einem Freund, denn ich wollte niemandem erklären müssen, dass mein Vater verrückt war. Oder dass er uns manchmal in einem „Spezialkeller“ unterbrachte, den er als zusätzlichen Schutz vor Monstern gebaut hatte, die nicht existierten. Ja, ja, echt abgedreht.
Em schlang die Arme um mich. „Du schaffst es, ich weiß, dass du es schaffst. Du kannst alles!“
Ihr Vertrauen in mich war … demütigend. „Ich werde mein Bestes geben.“
„Und das ist … oh, igitt!“ Mit angewidert verzogenem Gesicht ließ sie von mir ab und ging auf größtmöglichen Abstand. „Du bist ja ganz nass geschwitzt! Und jetzt bin ich auch ganz nass von dir.“
Lachend versuchte ich sie zu schnappen. Sie kreischte und rannte davon. Ich hatte mich vor etwa einer halben Stunde mit dem Gartenschlauch abgespritzt, um mich ein bisschen abzukühlen. Nicht dass ich ihr das erklärte. Ihr wisst schon, Freude an Geschwisterfolter und all das.
„Bleib hier draußen, hörst du?“ Mom könnte irgendwas sagen, das ihr nicht gefiel, und ich könnte was von mir geben, das bei ihr ein schlechtes Gewissen verursachte, weil sie mich darum gebeten hatte. Dann würde sie womöglich anfangen zu heulen. Ich ertrug es nicht, wenn sie weinte.
„Ja, ja, sicher“, versprach sie und hob die Hände in einer Unschuldsgeste.
Als wäre ich so naiv, ihr diese viel zu schnell ausgesprochene Zustimmung abzunehmen. Sie plante natürlich, hinterherzuschleichen und zu lauschen. Verschlagen genug war sie. „Versprich es mir.“
„Ich kann einfach nicht glauben, dass du mir nicht traust!“ Eins ihrer feingliedrigen Händchen legte sich auf ihr Herz. „Das tut weh, Alice. Das tut richtig weh.“
„Also erst mal herzlichen Glückwunsch. Deine Schauspielkunst ist inzwischen umwerfend“, sagte ich applaudierend. „Und außerdem, sprich die Worte, sonst geh ich gleich wieder auf meine Decke zurück und arbeite an meiner so gut wie aussichtslosen Bräunung.“
Grinsend stellte sie sich auf die Zehenspitzen, streckte die Arme aus und drehte sich langsam auf einem Bein. Genau diesen Moment suchte sich die Sonne aus, um mit sanftem Licht die perfekte Scheinwerferbeleuchtung für diese gelungene Pirouette zu bieten.
„Okay, okay, ich verspreche es. Zufrieden?“ „Aufs Hehrste.“ Sie war vielleicht verschlagen, aber sie hielt sich an ihre Versprechen.
„Nun beobachte mich dabei, wie ich so tue, als hätte ich das verstanden.“
„Es heißt … ach, egal.“ Ich versuchte Zeit zu schinden, das war mir klar. „Ich gehe jetzt.“
So enthusiastisch wie jemand, der vor ein Erschießungskommando tritt, machte ich mich auf den Weg ins Haus, ein zwei Stockwerke umfassendes Gebäude, das mein Vater in der Blütezeit seiner Tätigkeit als Hausbauer errichtet hatte. Unten bestand die Fassade aus rotbraunen Ziegelsteinen, oben aus braunem und hellem Holz. Irgendwie kistenartig, erstaunlich durchschnittlich und ganz bestimmt nicht der Rede wert. Aber na ja, so wollte er’s haben, wie er behauptete.
Meine Flip-Flops klatschten auf den Boden, und der Rhythmus formte sich in meinem Kopf zu einem Mantra. Nicht versagen. Nicht versagen. Nicht versagen. Schließlich stand ich vor der Glastür, die in unsere Küche führte. Ich sah meine Mutter drinnen geschäftig vom Waschbecken zum Herd laufen und wieder zurück. Während ich sie beobachtete, wurde mir leicht mulmig im Magen.
Sei kein Waschlappen. Du schaffst das.
Ich schob die Tür auf. Der Duft von Knoblauch, Butter und Tomatenmark lag in der Luft. „Hallo“, sagte ich und hoffte, dass ich nicht zu demütig wirkte.
Mom blickte vom dampfenden Nudeltopf hoch und lächelte mir zu. „Hallo Schatz. Hast du genug von der Sonne, oder machst du nur eine Pause?“
„Pause.“ Wegen der nächtlichen Einkerkerung verspürte ich tagsüber immer den Drang, jede mögliche Minute draußen im Tageslicht zu verbringen, ob ich mich dabei in einen roten Krebs verwandelte oder nicht.
„Dein Timing ist super. Die Spaghetti sind fast fertig.“
„Ja, ach so, cool.“ In den Sommermonaten gab es immer um Punkt fünf Uhr Dinner. Im Winter verschob es sich auf vier Uhr. Auf diese Weise konnten wir bei jeder Jahreszeit vor Sonnenuntergang sicher in unserem Heim sein.
Die Hauswände waren mit einer Art Stahl verstärkt und die Türschlösser unüberwindbar. Und, ja, das machte unser futuristisches Burgverlies, auch bekannt als „der Keller“, mehr oder weniger überflüssig, aber versucht mal, mit einem Verrückten zu argumentieren.
Tu’s einfach. Sag es. „Also, äh … na ja.“ Ich trat unruhig von einem Bein aufs andere. „Ich habe heute Geburtstag.“
Meiner Mutter klappte der Unterkiefer herunter, sie wurde kreidebleich. „Oh … mein Schatz. Das tut mir so leid. Ich wollte doch … Ich hätte es nicht vergessen dürfen … Ich hatte es mir sogar aufgeschrieben … herzlichen Glückwunsch …“, sagte sie schließlich lahm. Sie blickte sich um, als hoffte sie, dass plötzlich irgendwo ein Geschenk auftauchte. „Ach, ich fühle mich so schrecklich.“
„Mach dir keine Sorgen deshalb.“
„Ich werde es irgendwie wiedergutmachen, das schwöre ich dir.“
Und somit begannen die Verhandlungen. Ich straffte die Schultern. „Meinst du das ernst?“
„Natürlich.“
„Na gut. Weil … Em hat nämlich heute Abend eine Vorstellung, und da möchte ich gern hingehen.“
Obwohl sich ein trauriger Ausdruck auf ihrem Gesicht breitmachte, schüttelte meine Mutter den Kopf, bevor ich noch zu Ende geredet hatte.
„Du weißt, dass dein Vater das nie erlauben würde.“
„Dann rede mit ihm. Überzeuge ihn.“
„Das kann ich nicht.“
„Warum nicht?“
„Deshalb nicht.“
Ich liebte meine Mutter, wirklich. Trotzdem, Mann, sie frustrierte mich wie kein anderer Mensch. „Aber wieso?“, drängelte ich. Selbst wenn sie jetzt zu weinen anfinge, würde ich dranbleiben. Lieber ihre Tränen als Emmas.
Mom drehte sich genauso graziös wie Emma einmal um die eigene Achse und trug den dampfenden Kochtopf zum Abwaschbecken, um den Inhalt in ein Sieb zu gießen. Für einen Moment war sie von Wassernebel eingehüllt und wirkte wie ein Traumbild.
„Emma kennt die Regeln. Sie wird das verstehen.“
So, wie ich das jedes Mal hatte verstehen müssen, immer und immer wieder, bis ich schließlich aufgegeben hatte? Ärger stieg in mir hoch. „Warum machst du das? Warum gibst du ihm ständig nach, obwohl du genau weißt, dass er megamäßig verrückt ist?“
„Er ist nicht …“
„Doch, das ist er!“ Ich stampfte mit dem Fuß auf wie Em.
„Leise“, ermahnte sie mich. „Er ist oben.“
Ja, wahrscheinlich schon wieder vollkommen betrunken.
„Wir haben bereits mehrmals darüber gesprochen, Liebes. Ich glaube, dein Vater kann etwas sehen, das wir nicht sehen. Und bevor du ihn oder mich verdammst, wirf bitte einen Blick in die Bibel. Es gab einmal eine Zeit, als unser Herr und Erlöser verfolgt wurde. So viele Menschen zweifelten an Jesus.“
„Dad ist aber nicht Jesus!“ Er ging ja nicht mal regelmäßig mit uns in die Kirche.
„Ich weiß, so meinte ich das auch nicht. Ich glaube, dass es um uns herum bestimmte Mächte gibt, böse wie gute.“
Ich konnte mich mit ihr nicht auf eine Gut-und-Böse-Diskussion einlassen. Das ging einfach nicht. Ich glaubte an Gott, und ich glaubte, dass es Engel und Teufel gab, aber wir hatten doch mit dem Bösen nie was zu tun, oder? „Ich wünschte, du würdest dich von ihm scheiden lassen“, schimpfte ich und hätte mir gleich darauf vor Reue am liebsten auf die Zunge gebissen – dennoch sah ich nicht ein, wieso ich mich deshalb entschuldigen sollte.
Meine Mutter arbeitete zu Hause, sieben Tage die Woche, und gab medizinische Berichte in den Computer ein. Täglich tippte und tippte und tippte sie auf ihrer Tastatur. An den Wochenenden, so wie an diesem wunderbaren Samstagabend, machte sie noch die Krankenschwester für meinen Vater, pflegte ihn, tat für ihn dies und das. Sie hatte wirklich mehr verdient. Sie war jung – für eine Mom – und so wahnsinnig hübsch. Sie hatte ein weiches Herz, war lustig und sollte eigentlich jemanden haben, der sich ein bisschen um sie kümmerte.
„Die meisten Kinder wollen, dass ihre Eltern zusammenbleiben“, sagte sie, in ihrer Stimme einen scharfen Unterton.
„Ich bin nicht wie die meisten Kinder. Dafür habt ihr beide schon gesorgt“, erwiderte ich mit einem noch schärferen Unterton.
Ich wollte einfach … ich wollte das, was andere Kids hatten. Ein normales Leben.
Mit einem Mal schien der Ärger von ihr abzufallen und sie seufzte.
„Alice, mein Schatz, ich weiß, es ist schwer für dich. Du willst mehr in deinem Leben, das ist mir klar, und eines Tages wirst du das bekommen. Du machst deinen Abschluss, nimmst einen Job an, ziehst aus und gehst aufs College, verliebst dich, machst Reisen, was auch immer dein Herz begehrt. Jetzt lebst du aber im Haus deines Vaters, in dem er seine Regeln aufstellt. Und du richtest dich danach und respektierst seine Autorität.“
Das war direkt aus dem Handbuch für Eltern, gleich unter der Überschrift „Was sage ich meinem Kind, wenn ich keine richtige Antwort habe?“.
„Und vielleicht“, fügte sie hinzu, „wenn du mal die Verantwortung für eine eigene Familie trägst, wird dir irgendwann klar, dass dein Vater alles nur tut, um uns zu beschützen. Er liebt uns, und für ihn ist unsere Sicherheit das Wichtigste. Du darfst ihn dafür nicht hassen.“ Ich hätte es wissen müssen. Diese Rede von Gut und Böse führte immer auch zum Thema Liebe und Hass. „Hast du jemals eins von diesen Monstern gesehen?“, fragte ich.
Schweigen. Ein nervöses Lachen. „Ich habe mich bisher Hunderte Male geweigert, auf diese Frage zu antworten. Wie kommst du darauf, dass ich jetzt was dazu sage?“
„Vielleicht als verspätetes Geburtstagsgeschenk, da du mir ja das, was ich mir wirklich wünsche, sowieso nicht geben kannst.“ Das war ein Schuss unter die Gürtellinie, es war mir klar, aber auch diesmal sah ich nicht ein, wieso ich mich entschuldigen sollte.
Sie zuckte bei meinen Worten zusammen. „Ich möchte dieses Thema nicht mit euch Mädchen besprechen, um euch nicht noch mehr zu verängstigen.“
„Wir sind nicht verängstigt“, erwiderte ich. „Du bist diejenige, die Angst hat!“ Beruhige dich. Tief einatmen … ausatmen … Ich musste rational an diese Sache herangehen. Wenn ich ausrastete, würde sie mich nur in mein Zimmer schicken. Das wär’s dann gewesen. „Du hättest doch über all die Jahre zumindest eins von den Monstern gesehen haben müssen. Ich meine, du verbringst die meiste Zeit mit Dad. Du bist dabei, wenn er mit seinem Schießeisen im Haus auf Patrouille geht.“
Das war es, was ich gesehen hatte, als ich mich mal eines Nachts aus meinem Zimmer gewagt hatte, um mir ein Glas Wasser zu holen, weil ich vergessen hatte, mir eins mit nach oben zu nehmen. Mein Dad mit einer Pistole im Anschlag auf dem Weg durch alle Räume, wo er an jedem Fenster haltmachte, um rauszusehen und die Lage zu peilen.
Ich war damals dreizehn gewesen und hätte fast einen Herzschlag bei dem Anblick erlitten. Vielleicht rührte der Schock auch von der peinlichen Situation her, da ich mir beinah in die Hose gemacht hätte.
„Okay. Du willst es wissen, dann sage ich es dir. Nein, ich habe sie nicht gesehen“, gestand meine Mutter schließlich, was mich überhaupt nicht überraschte. „Aber ich habe die Zerstörung gesehen, die sie anrichten. Und bevor du mich fragst, woher ich weiß, dass sie die Ursache für diese Zerstörung sind, muss ich hinzufügen, dass ich Dinge beobachtet habe, die sich einfach nicht anders erklären lassen.“
„Zum Beispiel?“ Ich warf einen Blick über meine Schulter. Em hatte sich auf die Schaukel gesetzt und schwang hin und her, trotzdem hatte sie mich nach wie vor mit ihren Adleraugen im Fadenkreuz.
„Auch das werde ich dir nicht erzählen“, sagte Mom. „Es gibt ein paar Dinge, von denen du besser nichts weißt, egal was du sagst. Dafür bist du noch nicht bereit. Babys vertragen Milch, aber kein Fleisch.“
Ich war kein Baby mehr, nicht mal annähernd. Emma sah ziemlich beunruhigt aus. Ich zwang mich zu lächeln, und sofort erhellte sich ihr Gesicht, als hätte ich die Mission erfolgreich abgeschlossen und sie in dieser Beziehung nicht bereits Tausende Male enttäuscht.
Wie zum Beispiel, als sie die Kunstausstellung in ihrer Schule hatte besuchen wollen. Ihr Globus aus Pappmaschee war dort ausgestellt worden. Oder als sie mit ihrer Pfadfinderinnengruppe zum Camping hatte fahren wollen. Hunderte von Male, als ihre Freundin Jenny angerufen hatte, um zu fragen, ob sie über Nacht bei ihr bleiben könnte. Irgendwann hatte sich Jenny dann nicht mehr gemeldet.
Diesmal darfst du nicht versagen … Gib dir Mühe …
Ich sah meine Mutter an. Sie hatte mir den Rücken zugewandt und stand vor dem Herd. Mit der Gabel spießte sie eine Nudel nach der anderen auf, um sie zu testen, als wäre es die wichtigste Aufgabe der Welt. Diesen Tanz hatten wir früher schon aufgeführt. Sie verfolgte eine Vermeidungstaktik, das war ihr gerade wieder bestens gelungen.
„Vergiss die Monster und was du gesehen hast oder auch nicht. Heute ist mein Geburtstag, und ich wünsche mir nichts weiter, als die Ballettaufführung meiner kleinen Schwester zu sehen, wie in einer ganz normalen Familie. Das ist alles. Ich will ja nicht die Welt. Aber wenn du nicht genug Mumm hast, okay. Wenn Dad das nicht hinkriegt, was soll’s! Ich rufe jemanden aus meiner Schule an, dann fahren wir ohne euch.“ Von uns in die Stadt dauerte die Autofahrt mindestens eine halbe Stunde, das war zu weit zum Laufen. „Und weißt du was? Solltest du mich zu dieser Maßnahme zwingen, wirst du Emma das Herz brechen, und ich werde dir niemals verzeihen.“
Sie atmete scharf ein und versteifte sich. Ich hatte sie wahrscheinlich zutiefst geschockt. Normalerweise war ich die Ruhige in der Familie. Ich flippte nie aus und blieb meist zurückhaltend. Ich akzeptierte größtenteils und fügte mich.
„Alice“, sagte sie.
Ich biss die Zähne zusammen. Jetzt kommt’s. Die Zurückweisung. Tränen brannten mir in den Augen, tropften mir auf die Wange. Schnell wischte ich sie mit dem Handrücken weg. „Tut mir leid, dass ich da kein Einsehen habe. Ich werde dich dafür hassen.“
Sie sah mich an und seufzte. Geschlagen ließ sie die Schultern sinken. „Okay. Ich rede mit ihm.“
Die ganze Vorführung durch glühte Em förmlich. Außerdem dominierte sie die Bühne und stahl allen die Show, egal wie tragend deren Rolle war. Ehrlich, sie blamierte die anderen Mädchen regelrecht. Und das war nicht mein Geschwisterstolz, es war einfach eine Tatsache.
Sie wirbelte lächelnd herum und war absolut verblüffend. Alle, die ihr zusahen, waren genauso hingerissen wie ich. Garantiert. Als nach zwei Stunden der Vorhang fiel, war ich so stolz auf sie und so glücklich, dass ich hätte platzen können. Vielleicht platzten aber auch die Trommelfelle der Leute vor mir. Ich glaube, ich klatschte viel lauter als alle anderen, und meine Pfiffe waren so schrill, dass ihnen beinah die Ohren abgefallen wären.
Damit mussten sie klarkommen. Das war der beste Geburtstag aller Zeiten. Endlich einmal waren die Bells wie eine ganz normale Familie bei einem Event.
Natürlich hätte mein Vater fast alles ruiniert, weil er ständig einen Blick auf seine Armbanduhr warf und nervös zur Hintertür sah, als würde von dort jeden Moment jemand eine Atombombe in den Saal schleudern. Als das Publikum sich schließlich zu einer stehenden Ovation erhob, hatte er mich in seiner Verkrampftheit trotz meines Glückstaumels dermaßen mit seiner Paranoia angesteckt, dass mir praktisch alle Muskeln wehtaten.
Trotzdem war ich weit davon entfernt, mich auch nur mit einem einzigen Wörtchen zu beschweren. Wunder über Wunder, er war mitgekommen. Na gut, diesem Wunder war mit einer Flasche seines Lieblingswhiskeys ein bisschen nachgeholfen worden, und er hatte auf den Beifahrersitz gestopft werden müssen wie die Cremefüllung in einen Twinkie, aber was soll’s! Er war mitgekommen.
„Wir müssen gehen“, sagte er und bahnte sich bereits einen Weg zum Hinterausgang. Mein Vater war ein großer Mann, mit seinen über eins neunzig überragte er die meisten um ihn herum. „Schnappt euch Em und lasst uns losfahren.“
Trotz seiner Unzulänglichkeiten und egal, wie satt ich seine Alkoholprobleme hatte, liebte ich ihn. Ich wusste, dass er nichts für seine Paranoia konnte. Er hatte eine betreute Therapie mit Medikamenten versucht, aber ohne Erfolg. Er hatte eine Psychotherapie gemacht, und es war nur schlimmer geworden. Er sah Monster, die sonst niemand sehen konnte, und er weigerte sich zu glauben, dass sie nicht existierten – und nicht darauf aus waren, ihn zu verschlingen und alle zu töten, die er liebte und die ihm wichtig waren.
Irgendwie verstand ich ihn sogar. Eines Abends, etwa vor einem Jahr, hatte Em wegen der Ungerechtigkeit, dass sie schon wieder eine Pyjamaparty versäumte, geheult. Ich wiederum war wütend über unsere Mutter hergefallen. Sie hatte wegen meines untypischen aggressiven Verhaltens einen solchen Schock bekommen, dass sie mir zu erklären versucht hatte, was sie als „den Verlauf des Kampfes eures Vaters gegen das Böse“ bezeichnete.
Als Kind hatte mein Vater miterleben müssen, wie sein eigener Vater brutal ermordet wurde. Das Verbrechen war nachts auf einem Friedhof passiert, als unser Großvater das Grab unserer Großmutter Alice besucht hatte. Von diesem Ereignis war Dad traumatisiert. Also ja, ich kapierte es.
Fühlte ich mich danach deshalb besser? Nein. Er war inzwischen erwachsen. Sollte er seinen Problemen nicht mit Weisheit und Reife begegnen? Ich meine, wie oft hatte ich denn gehört: „Jetzt benimm dich doch mal deinem Alter entsprechend, Alice. Du bist schließlich kein kleines Kind mehr, Alice!“?
Was ich davon halte? – Praktiziert, was ihr selbst predigt, Leute. Aber was wusste ich denn schon? Ich war ja keine allwissende Erwachsene. Ich sollte mich nur erwachsen verhalten. Und ja. Einen richtig netten Stammbaum hatte ich. Mord und Totschlag in allen krummen Ästen. Das erschien mir nicht gerecht.
„Nun kommt endlich“, zischte er uns zu.
Mom eilte an seine Seite und tätschelte ihm beschwichtigend den Arm. „Beruhige dich, Darling. Es wird schon alles in Ordnung sein.“
„Wir können nicht länger hierbleiben. Wir müssen nach Hause, wo wir sicher sind.“
„Ich hole Em“, lenkte ich ein. Leichte Schuldgefühle flackerten bei mir auf und schnürten mir den Brustkorb zu. Vielleicht hatte ich doch zu viel von ihm verlangt. Und von meiner Mutter, die ihn später aus dem Wagen würde schälen müssen, nachdem wir in unsere monstersichere Garage eingefahren waren. „Mach dir keine Sorgen.“
Mein Rock schlackerte um meine Beine, als ich mich eilig durch die Menge drängelte und zur Bühne hinter dem Vorhang rannte. Überall wimmelte es von kleinen Mädchen, alle stärker geschminkt und mit mehr Rüschen und Glitter ausstaffiert als irgendwelche Stripperinnen, die ich im Fernsehen gesehen hatte, als ich ahnungslos durch die Kanäle zappte und aus Versehen bei einem Sender gelandet war, den ich nicht hätte einschalten dürfen.
Mütter und Väter umarmten ihre Töchter, lobten sie, überreichten ihnen Blumensträuße. Alles, was Leute eben taten, wenn sie jemandem zu einer super Leistung gratulierten. Ich dagegen musste meine Schwester an die Hand nehmen und sie eiligst hinter mir her von der Bühne zerren.
„Dad?“, fragte sie, offensichtlich wenig überrascht.
Ich warf ihr einen Blick über die Schulter zu. Sie war blass, und ihre goldenen Augen blickten viel zu wissend und abgeklärt für dieses Engelsgesicht. „Ja.“
„Was ist denn passiert?“
„Nichts weiter. Du kannst dich immer noch in der Öffentlichkeit zeigen, ohne dich zu schämen.“
„Dann nenne ich das einen Erfolg.“
Das tat ich auch.
Im Foyer wimmelte es von Leuten wie in einem Bienenschwarm. Die eine Hälfte lungerte dort herum, die andere war auf dem Weg zu den Ausgängen, da fand ich unseren Vater. Er stand vor einer Glastür, den Blick starr nach draußen gerichtet. Halogenlampen beleuchteten den Weg zu unserem Wagen, den Mom unerlaubterweise auf dem Parkplatz für Behinderte abgestellt hatte, weil der dem Eingang am nächsten lag. Schnell raus, schnell wieder rein. Der Teint meines Vaters hatte eine leicht graue Farbe angenommen, und seine Haare standen zu allen Seiten ab, als wäre er sich ständig mit den Fingern hindurchgefahren.
Mom versuchte ihn immer noch zu beruhigen. Glücklicherweise hatte sie es geschafft, ihm seine Waffen abzunehmen, bevor wir das Haus verlassen hatten. Normalerweise nahm er seine Pistolen, Messer und Wurfsterne mit, wenn er sich hinauswagte. Als ich neben ihm stand, umfasste er meine Arme und schüttelte mich.
„Wenn du irgendetwas in den Schatten lauern siehst, egal was, dann schnapp dir deine Schwester und renne. Hast du gehört? Nimm sie mit, und laufe hierher zurück. Schließ die Türen, versteckt euch, und ruft um Hilfe.“
Seine Augen hatten eine stahlblaue Farbe, sein Blick war wild, die Pupillen riesig groß. Mein Schuldgefühl, tja, es hatte sich zu einem flammenden Inferno entwickelt. „Das werde ich“, versprach ich und tätschelte seine Hände. „Mach dir um uns keine Sorgen. Du hast mir ja beigebracht, wie ich mich verteidigen kann, schon vergessen? Ich werde Em beschützen. Egal was passiert.“
„Okay“, sagte er, sah jedoch keinesfalls zufrieden aus. „Okay dann.“
Was ich gesagt hatte, stimmte. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich mit ihm hinten im Garten verbracht hatte, um zu lernen, wie man einen Angreifer abwehrte. Sicher, diese Trainingsstunden waren alle darauf angelegt, mich davor zu bewahren, dass sich irgendein hirnloses Wesen meine lebenswichtigen Organe zum Dinner vornimmt, aber Selbstverteidigung war Selbstverteidigung, oder etwa nicht?
Irgendwie schaffte Mom es, seine verkrampften Finger von meinen Armen zu pflücken und ihn zu bewegen, sich in die schreckliche Außenwelt zu wagen. Die Leute warfen uns schon merkwürdige Blicke zu, die ich zu ignorieren versuchte. Wir liefen zusammen im Familienverband los, mit fliegenden Schritten dicht zusammengedrängt. Mom und Dad vorn, gleich dahinter folgten Em und ich, wir hielten uns bei den Händen. Die Grillen zirpten und untermalten unseren Gang zum Auto mit ihrem gespenstischen Soundtrack.
Ich blickte mich um und bemühte mich alles so zu sehen, wie es sich für meinen Dad darstellen musste. Zuerst mal war da eine endlose Fläche schwarzer Asphalt – eine Tarnung? Ein Meer von Autos – Versteckmöglichkeiten? Ich sah den Wald, der sich vor uns auf den Hügeln erhob – eine Brutstätte für Albträume?
Über uns stand der volle Mond hoch und auf wunderbare Weise transparent am Himmel. Noch immer zogen Wolken darüber, die jetzt orange eingefärbt waren und irgendwie unheimlich wirkten. Was war das … doch sicher nicht …? Ich blinzelte und lief langsamer. Tatsächlich. Da war diese Wolke in Form eines Kaninchens. Sie musste mir gefolgt sein. Unglaublich!
„Sieh dir mal die Wolken an“, sagte ich zu Em, „entdeckst du irgendwas Cooles?“
Einen Moment herrschte Schweigen, dann: „Ein … Kaninchen?“
„Genau. Ich hab’s heute Morgen schon gesehen. Der Hoppler muss uns ja ziemlich umwerfend finden, wenn er immer noch da ist.“
„Sind wir doch auch.“
Dad bemerkte, dass wir zurückfielen, kam zu uns gelaufen, schnappte mich an einem Handgelenk und zerrte mich mit sich … während ich wiederum Emma nicht losließ und sie mit mir zog. Lieber würde ich ihr die Schulter ausrenken, als sie zurückzulassen, selbst wenn es nur für eine Sekunde wäre. Dad liebte uns, aber ich wollte nicht das Risiko eingehen, dass er plötzlich ohne uns wegfuhr, weil er meinte, es sei notwendig.
Er öffnete die Wagentür und schob zuerst mich hinten auf den Sitz, dann Emma. Als wir saßen, tauschten wir einen Augenblick stumm unsere Gedanken aus.
War echt super, formte ich mit den Lippen.
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, gab sie genauso zurück.
Sobald Mom auf dem Fahrersitz saß, verschloss Dad alle Türen. Er zitterte so stark, dass er mit seinem Sicherheitsgurt gar nicht klarkam.
„Fahr nicht am Friedhof vorbei“, sagte er zu Mom, „aber sieh zu, dass wir so schnell wie möglich nach Hause kommen.“
Auf unserem Weg hierher hatten wir den Friedhof ebenfalls gemieden, obwohl es noch taghell gewesen war, sodass die Fahrt viel länger als üblich gedauert hatte.
„Mach ich. Keine Sorge.“
Der Motor des Tahoe begann zu brummen, und Mom stellte den Rückwärtsgang ein.
„Dad“, sagte ich in so vernünftigem Ton wie möglich. „Wenn wir den längeren Weg nehmen, kommen wir nur im Schneckentempo vorwärts.“ Wir wohnten am Stadtrand des wunderschönen Birmingham, und der Verkehr konnte da ebenfalls zu einem fürchterlichen Monster werden. „Dann würde die Fahrt mindestens eine halbe Stunde länger dauern. Du willst doch nicht, dass wir so lange im Dunkeln auf der Straße festsitzen, oder?“ Er würde sich in seine Panik steigern, bis wir uns alle an den Türgriffen festklammerten, bereit zur Flucht.
„Liebling?“, fragte meine Mutter.
Sie hatte den Wagen jetzt zum Ausgang des Parkplatzes gelenkt, wo wir entweder links oder rechts abbiegen mussten. Wenn sie links abbog, würden wir nie nach Hause kommen. Ehrlich. Wenn ich meinem Vater länger als eine halbe Stunde zuhören müsste, würde ich aus dem Fenster springen und Emma als Akt der Gnade mitnehmen. Wenn Mom rechts abbog, war die Fahrt kürzer. Eine kurze Angstattacke am Friedhof, mit der wir fertigwerden mussten, aber danach konnten wir uns ja gleich wieder erholen.
„Ich werde so schnell fahren, dass du den Friedhof nicht einmal sehen kannst“, versprach sie.
„Nein, zu riskant.“
„Bitte, Daddy“, sagte ich, über Manipulationsversuche nicht erhaben. Wie ich ja schon bewiesen hatte. „Für mich. Zu meinem Geburtstag. Das ist alles, was ich möchte, wirklich, weiter wünsche ich mir gar nichts. Obwohl ihr’s letztes Jahr vergessen und mir nichts geschenkt habt.“
„Ich … ich …“ Sein Blick war ständig auf die Umgebung gerichtet und suchte zwischen den Bäumen nach einer Bewegung.
„Bitte. Em muss bald ins Bett, sonst wird sie noch rasend wie Lily aus dem Dornental.“ So hatten wir sie scherzhaft früher oft genannt. Wenn meine Schwester müde war, wurde sie unerträglich.
Em zog einen Flunsch und boxte gegen meinen Arm. Ich zuckte mit den Schultern, das allgemeine Zeichen für: Na, stimmt doch!
Dad seufzte laut. „Okay, okay. Aber … fahr wie der Blitz, Liebling“, sagte er und küsste Moms Hand.
„Das werde ich, du hast mein Wort.“
Meine Eltern tauschten einen sanften Blick miteinander. Ich fühlte mich wie ein Voyeur, als ich das sah. Das war in solchen Augenblicken immer so gewesen. Die beiden hatten öfter zärtliche Momente wie diesen, auch wenn ihr Lächeln inzwischen über die Jahre seltener geworden war.
„Dann geht es los.“
Mom lenkte den Wagen nach rechts, und zu meinem echten Erstaunen fuhr sie tatsächlich wie der Blitz, fädelte sich in die Fahrspuren ein, hupte langsamer fahrende Autos an und rammte fast deren Stoßstange.
Ich war beeindruckt. Bei den wenigen Fahrstunden, die sie mir bisher gegeben hatte, war sie ein nervöses Wrack gewesen, was wiederum mich ziemlich nervös gemacht hatte. Wir waren nie weit gekommen und keinmal schneller als fünfzig gefahren, nicht mal innerhalb unseres Viertels.
Mom redete pausenlos auf Dad ein, und ich beobachtete die Zeitanzeige auf meinem Handy. Die Minuten vergingen, bis wir zehn ohne einen einzigen Zwischenfall hinter uns hatten. Nur noch gut eine Viertelstunde mehr.
Dad hatte die Nase an die Fensterscheibe gedrückt, seine nervösen Atemzüge hinterließen Nebelwölkchen auf der Glasscheibe. Vielleicht genoss er ja auch die Aussicht auf die Berge, die Täler und die üppigen grünen von den Straßenlampen beleuchteten Bäume und suchte gar nicht nach Monstern.
Ja, ja. Träum weiter.
„Wie war ich denn?“, flüsterte Em mir zu.
Ich griff nach ihrer Hand. „Einfach umwerfend.“
Sie verzog ihre dunklen Augenbrauen, und ich wusste, was als Nächstes kommen würde. Misstrauen.
„Schwörst du es?“
„Ich schwöre es. Du hast alle vom Sockel gehauen, ehrlich. Im Vergleich zu dir waren die anderen Mädchen lahme Enten.“
Sie schlug sich eine Hand vor den Mund und versuchte, nicht zu kichern.
Ich kam richtig in Fahrt und konnte mich nicht zurückhalten, noch hinzuzufügen: „Und der Junge, der dich herumgewirbelt hat? Ich glaube, der hätte dich am liebsten von der Bühne geschleudert, damit die Leute ihn endlich mal registrieren. Ehrlich, alle hatten nur Augen für dich.“ Ihr Kichern wurde lauter. „Du willst also sagen, als ich über meine eigenen Füße gestolpert bin, hat es jeder gesehen.“
„Gestolpert? Wann bist du denn gestolpert? Du meinst, das gehörte nicht zum Tanz?“
„Gute Antwort.“
Sie streckte ihre rechte Hand aus, um mir „fünf“ zu geben, und wir klatschten ab.
„Liebling“, sagte Mom, und ihre Stimme klang plötzlich angespannt. „Willst du nicht etwas Musik für uns raussuchen?“
Oh, oh, sie wollte ihn ablenken.
Ich lehnte mich nach vorn und warf einen Blick durch die Windschutzscheibe. Eins war klar, wir näherten uns dem Friedhof. Wenigstens waren jetzt keine anderen Autos mehr zu sehen, sodass niemand den zu erwartenden Zusammenbruch meines Vaters beobachten konnte, und den würde er bekommen. Ich spürte die Anspannung förmlich in der Luft.
„Keine Musik“, sagte er. „Ich muss mich konzentrieren, aufmerksam bleiben. Ich muss …“ Er versteifte sich und umklammerte die Sitzlehnen so fest, dass seine Knöchel weiß hervortraten.
Einen Moment herrschte Schweigen, dicke, schwere Stille.
Sein Atem ging immer schneller und schneller – bis er plötzlich einen so durchdringenden Schrei ausstieß, dass ich zusammenzuckte.
„Sie sind da draußen! Sie wollen uns angreifen!“ Er griff hektisch nach dem Steuerrad und riss es herum. „Siehst du sie nicht? Wir fahren direkt auf sie zu. Kehr um! Du musst umdrehen!“
Der Tahoe rutschte so scharf zur Seite, dass Mom Mühe hatte, ihn wieder in die Spur zu lenken. Emma schrie auf. Ich fasste nach ihrer Hand, drückte sie und ließ sie nicht los. Mein Herz hämmerte gegen meine Rippen, und mir brach der kalte Schweiß aus. Ich hatte versprochen, sie zu beschützen, und das würde ich tun.
„Alles wird gut“, sagte ich.
Sie zitterte so stark, dass ich es am ganzen Körper spürte.
„Liebling, hör zu“, versuchte Mom ihn zu beruhigen. „Wir sind hier im Wagen sicher. Niemand kann uns was antun. Wir müssen …“
„Nein! Wenn wir nicht umkehren, verfolgen sie uns bis nach Hause!“ Mein Vater war vollkommen fertig; nichts, was Mom sagte, drang zu ihm durch. „Wir müssen umdrehen!“
Er griff erneut nach dem Lenkrad und riss noch stärker daran als vorher. Diesmal geriet der Wagen richtig ins Schleudern, und wir machten eine volle Drehung.
Und noch eine und noch eine. Ich hielt Emma so fest ich konnte.
„Alice …“, sagte sie schluchzend.
„Ist schon gut, ist schon gut“, versuchte ich sie zu trösten. Die Welt um uns herum verschwamm, wir drehten uns wie in einem Strudel … mein Vater fluchte laut … meine Mutter schnappte erschrocken nach Luft …
Einfrieren.
Ich erinnerte mich an das Spiel, das Em und ich oft spielten. Wir stellten unser iPod-Dock auf volle Lautstärke – harten, wummernden Rock – und tanzten wie wild. Eine von uns rief dann: „Einfrieren!“, und wir hörten auf der Stelle auf, uns zu bewegen, standen total still, ohne zu lachen, bis eine das magische Wort sagte, das uns wieder in Bewegung brachte. „Tanzen!“
Ich wünschte in diesem Moment, ich könnte jetzt einfach „einfrieren!“ rufen und dann die Szenerie und die Mitspieler neu arrangieren, aber das Leben ist kein Spiel.
Tanzen.
Wir überschlugen uns, krachten mit dem Wagendach auf die Straße und rollten wieder herum. Ich hörte Glas splittern und Metall knirschen, begleitet von Schreien. Mein Kopf fühlte sich wie Mus an, und vom Geschleuder blieb mir die Luft weg.
Als der Wagen schließlich stand, war ich so benommen und benebelt, dass ich das Gefühl hatte, wir würden uns immer noch bewegen. Niemand schrie mehr. Ich hörte nur ein Klingeln in meinen Ohren.
„Mom? Dad?“ Keine Antwort. „Em?“ Wieder nichts.
Ich richtete mich auf und sah mich um. Irgendwas Warmes und Feuchtes in meinen Wimpern ließ mich alles verschwommen sehen, aber ich konnte noch genug erkennen.
Und was ich sah, gab mir den Rest.
Ich schrie entsetzt auf. Meine Mutter war blutüberströmt. Emma lag auf ihrem Sitz eingesunken, ihr Kopf in einem merkwürdigen Winkel, die eine Wange voller Blut.
Nein! Nein, nein, nein, nein.
„Dad, hilf mir! Wir müssen sie hier rausholen!“
Schweigen.
„Dad?“ Ich beugte mich vor … und stellte fest, dass er nicht mehr im Wagen saß. Die Windschutzscheibe war zerborsten, und er lag ein paar Meter entfernt in den Scherben. Drei Männer hatten sich über ihn gebeugt, die Scheinwerfer des Wagens beleuchteten die Szene.
Nein, es waren keine Männer, wurde mir klar. Das war unmöglich. Ihre pockennarbige, fleckige Haut hing ihnen schlaff von den Wangen, die Kleidung war völlig zerfetzt, die Haare hingen nur noch in einzelnen Büscheln von ihren sonst kahlen Schädeln − und die Zähne … Sie hatten den Mund weit aufgerissen und ihre Zähne sahen so scharf und spitz aus wie die von Raubtieren. Alle drei fielen über meinen Vater her … und schlugen ihm die Kiefer in die Eingeweide … und … und … fraßen ihn!
Monster.
Ich versuchte verzweifelt, aus meinem Sitz zu kommen, wollte Em in Sicherheit bringen. Em, die nicht mehr weinte und sich nicht mehr rührte. Ich wollte raus und meinem Vater helfen. Einer meiner Füße war eingeklemmt, und als ich mich loszureißen versuchte, schlug ich mit dem Hinterkopf gegen etwas Hartes, Spitzes. Fürchterlicher Schmerz durchfuhr mich, mir wurde schwindlig. Ich versuchte trotzdem, mich zu befreien, bis meine Kräfte mich verließen und alles vor meinen Augen verschwamm …
Es wurde dunkle Nacht um mich. Mehr bekam ich nicht mit.
Zumindest für eine Weile …
2. KAPITEL
Der Pfuhl von Blut und Tränen
Sie waren alle gestorben. Meine Familie lebte nicht mehr. Weg. Verschwunden. Ich wusste es, sobald ich in einem Krankenhausbett aufwachte und die Krankenschwester, die sich über mich beugte, mir nicht in die Augen sah und mir nicht sagen wollte, wo die anderen waren.
Als der Arzt kam, um mir die Nachricht zu übermitteln, drehte ich mich einfach zur Seite und schloss die Augen. Das war ein Traum. Nur ein schrecklicher Traum, aus dem ich wieder aufwachen würde. Wenn ich das nächste Mal erwachte, würde alles in Ordnung sein.
Ich bin aber nicht mehr aus diesem Traum aufgewacht.
Es stellte sich heraus, dass meine Mutter bei dem Autounfall umgekommen war, genau wie mein Vater und meine … meine … Ich konnte diesen Gedanken nicht ertragen. Es ging einfach nicht. Also. Noch mal von vorn. Bei dem Autounfall war meine Familie getötet worden, und ich hatte nur unerhebliche Verletzungen erlitten. Eine Gehirnerschütterung, ein paar gebrochene Rippen, das war’s. Das kam mir alles so fürchterlich unfair vor, versteht ihr? Ich hätte so schlimm aussehen müssen wie meine Mutter. Zumindest den ganzen Körper eingegipst. Irgendwas in der Art.
Stattdessen ging es mir, abgesehen von erträglichen Schmerzen und kleineren Beschwerden, gut.
Sehr gut. Na klar.
Meine Großeltern mütterlicherseits kamen mich öfter besuchen und weinten um die Familie, die sie verloren hatten. Ich hatte sie zwei Wochen vorher noch gesehen. Zwei Wochen, bevor meine Mutter mich und meine … Mein Kinn zitterte, aber ich biss die Zähne zusammen. Als Mom uns zu einem Besuch bei ihnen mitgenommen hatte. Wir waren nur ein paar Stunden dageblieben, hatten gemeinsam Mittag gegessen und uns angeregt und gut gelaunt unterhalten.
Obwohl Nana und Pops mich mochten und mir gegenüber immer freundlich waren, gehörte ich wohl nicht zu ihren Favoriten. Ich glaube, ich erinnerte sie zu sehr an meinen Vater, der für ihr einziges Kind nie gut genug gewesen war.
Trotzdem würden sie mich in der Zeit der Hilflosigkeit und Trauer nicht allein lassen, versprachen sie. Ich sollte zu ihnen ziehen, sie würden sich um alles kümmern.
Also würde ich nun in einem zwei Etagen umfassenden Haus wohnen, das genauso langweilig aussah wie mein altes Zuhause und mir fremd war. Ein Gebäude, das nicht mein Vater gebaut hatte – und das nicht mit den entsprechenden Schutzvorrichtungen ausgerüstet worden war, doch das war keine große Sache. Ich hatte niemals bei einer Freundin übernachtet, immer nur in meinem eigenen Bett geschlafen. Dennoch, keine große Sache.
Ich hätte traurig sein müssen, wollte traurig sein, aber ich war völlig vor den Kopf geschlagen … leer … wie eine bloße Hülle.
Die Ärzte und Schwestern versicherten mir hundertmal, wie leid es ihnen täte und dass es mir bald wieder besser ginge. Die üblichen Floskeln. Es tat ihnen leid? Und? Das brachte mir meine Familie nicht zurück. Mir würde es bald wieder besser gehen? Bitte! Mir würde es nie wieder gut gehen.
Was hatten die schon für eine Ahnung davon, wie es war, wenn man die Menschen verlor, die man am meisten liebte? Was wussten die schon von dem Gefühl, das man hatte, wenn man plötzlich allein war? Wenn ihre Schicht endete, fuhren sie nach Hause. Sie würden ihre Kinder in die Arme nehmen, zusammen mit ihren Lieben essen und über ihren Tag reden. Und ich? Ich konnte solche einfachen Freuden nie wieder erleben.
Ich hatte keine Mutter mehr.
Ich hatte keinen Vater mehr.
Ich hatte keine Schw… − Familie mehr.
Himmel noch mal, ich hatte wahrscheinlich auch meinen Verstand verloren. Diese Monster …
Polizisten besuchten mich, ebenso Sozialarbeiter und Therapeuten. Alle fragten, was genau passiert war. Vor allem die Cops wollten wissen, ob eine Meute wilder Hunde meine Eltern angefallen hätte.
Wilde Hunde. Ich hatte keine Hunde gesehen, aber das ergab im Zusammenhang mit dem, was ich gesehen hatte, mehr Sinn.
Trotzdem sagte ich nichts davon. Unser Wagen war ins Schleudern geraten, und wir hatten uns überschlagen. So viel wusste die Polizei, und mehr brauchte sie auch nicht zu wissen. Ich würde kein Wort über die Monster verlieren. Dazu bestand kein Anlass. Sicher hatte dieser kleine Anfall von Halluzination etwas mit meiner Gehirnerschütterung zu tun.
Niemals würde ich erzählen, dass meine Mom noch im Auto gewesen war, als ich die Augen das erste Mal geöffnet hatte. Und als ich das zweite Mal zu mir gekommen war? Da hatte sie draußen gelegen, beleuchtet von den Scheinwerfern, genauso wie mein Dad, und diese Dinger hatten in ihren Innereien gewütet, waren praktisch darin eingetaucht und wieder herausgekommen, wie um Luft zu holen.
Obwohl ich es mit aller Kraft versucht hatte, war ich nicht in der Lage gewesen, mich zu befreien und ihr zu Hilfe zu kommen. Mein Sicherheitsgurt hatte sich verhakt, und ich hatte mir irgendwo einen Fuß eingeklemmt, sodass ich förmlich an den Sitz gefesselt gewesen war. Als die Monster in meine Richtung geblickt hatten, die stechenden Augen auf mich gerichtet, und einen Schritt auf den Wagen zu gemacht hatten, war ich in Panik geraten, hatte verzweifelt meine … das andere Familienmitglied beschützen wollen.
Bevor eine von uns angegriffen worden war – von den wilden Hunden, wie ich mir inzwischen selbst einredete –, war ein Auto angefahren gekommen, die Insassen hatten uns entdeckt und die Biester vertrieben, sie waren weggerannt. Obwohl „rennen“ nicht das richtige Wort war. Einige schienen zu gleiten. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was danach gewesen war, nur an einzeln aufflackernde Bilder. Gleißendes Licht in meinen Augen. Geräusche, als würde Metall gegen Metall schaben. Männer, die sich etwas zuriefen. Dann starke Arme, die mich befreiten und aus dem Wagen zogen, ein schmerzender Stich in meinen rechten Arm, etwas, das mir auf das Gesicht gedrückt wurde. Danach nichts mehr.
„Hallo, du bist doch Alice, richtig?“
Ich blinzelte, bis sich der schreckliche Nebel der Erinnerung langsam lichtete, und wandte den Kopf in die Richtung der einzigen Tür im Raum. Ein hübsches Mädchen, wahrscheinlich in meinem Alter, kam herein. Die Unbekannte hatte glattes dunkles Haar, große haselnussbraune Augen mit schwarz getuschten Wimpern und einen perfekten, von der Sonne sanft geküssten Teint. Sie hatte sich in ein langärmliges pinkfarbenes T-Shirt geworfen, auf dem ein Pfeil gedruckt war, der nach oben wies und die Aufschrift „I’m With Genius“ zeigte. Dazu trug sie einen Mikrominirock, der gerade mal ihre Hüften bedeckte. Eigentlich hätte man das Ding korrekter als Badeanzugunterteil bezeichnen müssen.
Es erübrigt sich wohl zu sagen, dass mein hässliches, papierdünnes Nachthemd mit den schiefen Schnürbändern daneben ziemlich lächerlich wirkte.
„Ich heiße Ali“, erwiderte ich. Das waren die ersten Worte, die ich nach einer scheinbaren Ewigkeit mal wieder von mir gab. Meine Kehle fühlte sich rau an, ich klang heiser, konnte es jedoch nicht zulassen, dass sie mich noch mal Alice nannte. Die letzte Person, die das getan hatte, war … na, egal. Ich wollte es jedenfalls nicht.
„Cool. Ich heiße Kathryn, doch alle nennen mich Kat. Mach bitte keine Katzenwitze, sonst muss ich dir wehtun. Mit meinen Krallen.“ Sie wedelte mit ihren Händen und zeigte mir ihre langen Fingernägel. „Tatsache ist, dass ich seit Ewigkeiten kein Miau mehr sage.“
Kein Miau mehr sage? „Ich nehme an, es wäre uncool, wenn ich dich Pretty Kitty nennen würde.“ Keine Ahnung, warum ich plötzlich so zum Scherzen aufgelegt war, ich kämpfte nicht dagegen an. Ich brauchte all meine Kraft, um gegen alles andere anzukämpfen. „Wie wär’s mit Mad Dog?“ Sie verzog die Lippen zu einem ironischen Grinsen. „Har, har, har. Jetzt würdest du mich aber enttäuschen, falls du mich nicht Mad Dog nennst.“ Sie kam mit einer eleganten Bewegung ein Stück näher. „Also, nun ja. Was den Grund meines Besuchs angeht … bringen wir erst mal den Austausch von notwendigen Hintergrundinfos hinter uns. Meine Mutter arbeitet hier und hat mich heute mitgenommen. Sie meinte, du könntest sicher eine Freundin gebrauchen oder irgendwas vergleichbar Tragisches.“
„Mir geht’s bestens“, sagte ich sofort. Wieder dieses blöde Wort. Bestens.
„Das weiß ich doch. Habe ich ihr auch gesagt.“ Kat schnappte sich den einzigen Besucherstuhl im Raum, schob ihn neben mein Bett und setzte sich. „Außerdem erzählt man nicht gleich jedem Unbekannten seine Geheimnisse. Das wäre schon ein bisschen merkwürdig. Sie ist aber nun mal meine Mutter, und du brauchst ganz eindeutig eine Schulter zum Ausweinen, was sollte ich also sagen? Nein? Nicht mal ich bin so herzlos.“
Ich hatte keine Lust, mich von ihr bemitleiden zu lassen. „Du kannst deiner Mutter sagen, ich war sehr unhöflich und habe dich rausgeschmissen.“
„Okay“, fuhr sie fort, als hätte ich gar nichts gesagt. „Das Leben ist zu kurz, um sich in seinem Elend zu wälzen, das weiß ich. Egal, wie du sicher schon mitbekommen hast, bin ich für dich eine absolute Spitzengesellschaft. Oh, oh. Und weißt du was? Ich habe noch einen Platz in meinem Fave Five Account frei – nicht diese lahme Telefonwerbung, sondern mein derzeitiger engster Kreis –, und ich suche nach jemandem, der einen Platz in der ersten Reihe bekommt. Du kannst das also sozusagen als Bewerbungsgespräch betrachten.“
Irgendwie erwachte bei ihrer kleinen Rede meine gute Laune wieder ein bisschen. „Bei einem Platz in der ersten Reihe deiner fünf Lieblingsanschlüsse handelt es sich also um einen Job, oder was?“, konnte ich mir nicht verkneifen zu sagen.
„Natürlich.“ Sie strich sich mit den Fingern durchs Haar. „Ich will ja nicht prahlen, aber ich bin äußerst unterhaltsam.“
„Soso. Ich glaube, etwas ruhiger wäre erstrebenswerter.“ „Etwas ruhiger kannst du vergessen. Das solltest du dir aufschreiben, unterstreichen, gelb markieren und mit Sternchen kennzeichnen, mit goldenen.“ Ohne Luft zu holen, redete sie weiter: „Lass uns doch mal überprüfen, ob wir kompatibel sind, okay?“
O-kay. Dann würden wir das eben durchziehen. Die ganze Zeremonie. Alice würde jetzt so tun, als wäre alles in bester Ordnung. „Klar, machen wir.“
„Also … du hast deine Familie verloren, ja?“, sagte sie.
Das nannte man wohl direkt auf sein Ziel zugehen, aber wenigstens schlich sie nicht mit irgendwelchen Plattitüden um den heißen Brei herum. Das war vielleicht der Grund, wieso ich mit einem gekrächzten „Ja“ antwortete. Das war mehr, als ich jedem anderen bisher zugestanden hatte.
„Ein echter Schlag.“
„Allerdings.“
„Isst du das hier noch auf?“ Sie deutete auf den Vanillepudding, den mir jemand gebracht hatte.
„Nein.“
„Wahnsinn. Ich bin am Verhungern.“
Sie grinste breit und katzenhaft, schnappte ihn sich und den Löffel und lehnte sich in ihrem Stuhl zurück. Nach dem ersten Bissen seufzte sie genießerisch.
„Dann hör mal zu und sag mir, ob du meiner Meinung bist.“ „Hm, okay.“ Ich hatte so das Gefühl, als würde ich während dieser Unterhaltung wohl noch öfter ein „Hm“ von mir geben. Selbst wenn sie einfach nur dasaß, kam sie mir wie ein energetischer Wirbelwind vor, dem ich nicht gewachsen war.
Nach einem weiteren Löffel Pudding sagte sie: „Also. Mein Freund und ich hatten uns vorgenommen, den Sommer zusammen zu verbringen, trotzdem musste er irgendwelche Angehörigen in Nowhereland besuchen. Zumindest hat er das behauptet. Egal. Jedenfalls war erst mal alles wunderbar, weil wir jeden Abend telefonierten, dann, peng – auf einmal rief er nicht mehr an. Natürlich versuchte ich ihn zu erreichen, schickte ihm SMS, wie das eben eine brave Freundin so macht. Das war nicht aufdringlich, ich schwör’s, ich hab’s nämlich nach dem … sagen wir mal, nach dem dreißigsten Mal aufgegeben. Eine Woche verging, bis er endlich reagierte. Er war völlig besoffen und alles, so nach dem Motto: Hallo Baby, ich vermisse dich und was hast du gerade an? Als wäre gar nichts gewesen. Ich hab ihm gleich klargemacht, dass er kein Anrecht mehr darauf hat, das zu erfahren.“
Schweigen.
Sie beobachtete mich erwartungsvoll und nahm noch einen Löffel Pudding. Ich war versucht, mich im Zimmer nach einer anderen Person umzusehen, für die ihre belastenden Infos gedacht waren. Die wenigen Freundinnen, die ich im Lauf der Jahre gehabt hatte, hatten mir natürlich auch Storys aus ihrem Leben und von ihren Typen erzählt, aber keine war gleich in der ersten Minute so offen gewesen.
„Und? Was sagst du?“, drängelte Kat.
Ach ja. Das war der Augenblick, in dem ich mein Urteil abgeben sollte. Zustimmung oder Kritik. „Es war … richtig?“
„Genau! Und jetzt hör dir mal das an: Er hat mich mit einem falschen Namen angesprochen. Nicht beim Sex oder so was. Wenn das der Fall gewesen wäre, hätte ich ihn wohl gekillt, dann hätte er gar nicht mehr die Gelegenheit gehabt, seine kläglichen Erklärungen abzugeben. Nein, es war, als wir das letzte Mal telefoniert haben.“
Ich brauchte einen Moment, um mir noch mal die ganze Geschichte durch den Kopf gehen zu lassen und zu kapieren, was sie jetzt von mir erwartete. „Das ist echt ätzend?“ Eigentlich wollte ich es nicht als Frage rüberbringen, aber ich war mir nicht so sicher.
„Ich wusste, dass du mich verstehst! Wir beide haben einen Draht, als wären wir kurz nach der Geburt getrennt worden. Na ja, jedenfalls haben wir einfach aufgelegt. Das heißt vielmehr, ich habe einfach aufgelegt, mit einem richtig schönen Knall. Dafür klopfe ich mir immer noch auf die Schulter. So, es klingelt also wieder, und er ist dran mit einem ‚Hey, Rina‘. – ‚Wie bitte? Rina? Wieso willst du Rina anrufen?‘, frag ich. Er druckst rum, sucht nach einer Ausrede, aber mir war alles klar. Er ist ein hinterhältiges Dreckstück, das mich betrügt. Der hat bei mir ausgedient.“
„Gut so.“ Immerhin. Was hält man davon? Ich war doch tatsächlich fähig, meine Meinung zu äußern. „Betrug ist das Letzte.“
„Schlimmer. Wenn die Schule wieder anfängt, werde ich diesem Typ das noch mal klarmachen, aber nicht zu knapp. Er hat mir geschworen, dass er mich liebt, für immer und ewig, nur mich allein, und er muss dafür bezahlen, dass er mich belogen hat. Rina wird auch einiges zu hören bekommen. Hoffentlich stirbt sie an irgendeiner fürchterlichen Krankheit. Die verdient es gar nicht, dass ich meine wertvolle Zeit mit ihr verschwende.“
Schule. Oje. Da war noch was in meinem Leben, das sich drastisch ändern würde. „In welche Schule gehst du?“
„Asher High. Die beste Schule überhaupt, musst du wissen.“
„Meine Eltern sind da ebenfalls gewesen.“ Noch mal oje! Warum musste ich das Thema auch ansprechen? Ich krallte die Finger in die Decke und wünschte, ich könnte meine Worte zurücknehmen. Vielleicht könnte ich so tun, als wäre ich völlig normal, aber das ginge nur, wenn die Unterhaltung sich nicht um persönliche Angelegenheiten drehte.
„Und du?“, erkundigte sie sich, ohne auf meine unbedachte Bemerkung einzugehen.