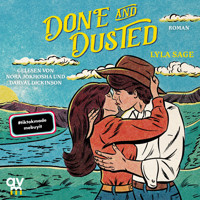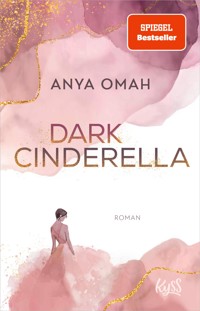3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Forever
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zusammen kämpft es sich leichter als allein – für die Liebe und das Leben Als Clarissa in der psychiatrischen Klinik auf Bela trifft, ist sie fasziniert von dem gutaussehenden Einzelgänger, der lieber in sein Notizbuch schreibt, als mit anderen zu reden. Niemand weiß, warum er dort ist, und genau das versucht Clarissa auch für sich herauszufinden. Vor einer Woche ist etwas passiert, das ihre Welt zum Einsturz gebracht hat – doch sie erinnert sich an nichts! Eine Amnesie hat die Ereignisse in einen Schleier gehüllt, den sie nun versucht zu heben. Bei der tiergestützten Therapie und den Alpakas kommen Bela und Clarissa sich immer näher und schenken sich nicht nur gegenseitig Hoffnung, sondern auch ihr Herz. Schaffen es die beiden, die Dunkelheit zu vertreiben und gemeinsam nach vorn zu blicken? Diese Romance bietet, was das Herz begehrt: Tiefe Gefühle und kuschelige Alpakas!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 414
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
All die Sterne zwischen uns
Die Autorin
Katharina Olbert lebt in einer Kleinstadt in der Mecklenburgischen Seenplatte und liebt Tee, Schokolade und Spaziergänge mit ihrer Border-Collie-Hündin. Geschichten hatte die Autorin schon immer im Kopf, aber erst 2016 fing sie an, diese auch aufs Papier zu bringen. Seit dem ist das Schreiben für sie eine nicht mehr wegzudenkende Leidenschaft geworden. Ihr Herz schlägt vor allem für Romane, bei denen die Liebe im Mittelpunkt steht, genau wie in ihren Geschichten.
Das Buch
Zusammen kämpft es sich leichter als allein – für die Liebe und das Leben
Als Clarissa in der psychiatrischen Klinik auf Bela trifft, ist sie fasziniert von dem gutaussehenden Einzelgänger, der lieber in sein Notizbuch schreibt, als mit anderen zu reden. Niemand weiß, warum er dort ist, und genau das versucht Clarissa auch für sich herauszufinden. Vor einer Woche ist etwas passiert, das ihre Welt zum Einsturz gebracht hat – doch sie erinnert sich an nichts! Eine Amnesie hat die Ereignisse in einen Schleier gehüllt, den sie nun versucht zu heben. Bei der tiergestützten Therapie und den Alpakas kommen Bela und Clarissa sich immer näher und schenken sich nicht nur gegenseitig Hoffnung, sondern auch ihr Herz. Schaffen es die beiden, die Dunkelheit zu vertreiben und gemeinsam nach vorn zu blicken?
Katharina Olbert
All die Sterne zwischen uns
Forever by Ullsteinforever.ullstein.de
Originalausgabe bei ForeverForever ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH,Berlin Dezember 2021 (1)© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2021Umschlaggestaltung:zero-media.net, MünchenTitelabbildung: © FinePic®Autorenfoto: © privatE-Book powered by pepyrus.com
978-3-95818-658-3
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
Epilog – 10 Jahre später
Nachwort
Danksagung
Leseprobe: Counting Stars
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
1. Kapitel
Widmung
Es ist okay, sich gut zu fühlen.Es ist okay, es nicht zu tun.Und es ist okay, um Hilfe zu bitten.
TriggerwarnungLiebe Leser*innen,wir möchten euch darauf aufmerksam machen, dass All die Sterne zwischen uns Elemente enthält, die triggern können.Diese sind: Suizid, selbstverletzendes Verhalten und Verlust.
1. Kapitel
Clary
Das Erste, was ich sah, als ich die Lider aufschlug, waren weiße Wände und dann das Gesicht meiner Mutter. Ihre Augen waren rotunterlaufen und sie wirkte, als hätte sie ein halbes Jahrhundert nicht geschlafen. Ein Piepen drang an meine Ohren und als ich zur Seite blickte, entdeckte ich den Monitor, der meine Vitalwerte anzeigte. Erst in dem Moment realisierte ich, dass ich im Krankenhaus war. Wie war ich hierhergekommen? Was war passiert?
»Clarissa.« Es war mehr ein Schluchzen, das aus meiner Mutter drang, aber meinen Namen konnte ich dennoch heraushören.
Sie griff nach meiner Hand, umklammerte sie regelrecht und mehrere Tränen lösten sich aus ihren Augen. Ich runzelte die Stirn. Warum war sie so aufgelöst? Ich verstand nicht, was hier vor sich ging.
Papa tauchte neben mir auf, seine Augen waren nicht ganz so rot wie die von Mama, aber ich hatte ihn trotzdem noch nie so niedergeschlagen, geradezu zerstört gesehen. Langsam bekam ich es mit der Angst zu tun.
»Was ist los?«, brachte ich mühsam hervor und meine Stimme klang, als gehörte sie nicht zu mir. Sie war so dünn. Haltlos.
Ein weiteres Schluchzen meiner Mutter erfüllte den Raum. Sie war eigentlich eine starke Person. Selbstbewusst und ein wenig herrisch. So wie jetzt hatte ich sie nur selten erlebt.
Papa nahm meine rechte Hand in seine und erst da bemerkte ich den Verband um mein Handgelenk. Ich schaute zum anderen und auch um dieses war eine Binde gewickelt. Ich riss die Augen auf. »Was ist mit meinen Händen passiert?«
»Kannst du dich nicht erinnern?«, fragte Papa verwirrt.
Ich schüttelte den Kopf. Mir war absolut schleierhaft, was das hier sollte.
Mama schaute weg und Papa fuhr sich unruhig durch seine schwarzen Haare, aber beide schwiegen. Wieso sagten sie mir nicht, was los war? War es so schlimm? Panik stieg in mir auf und ich wollte endlich wissen, was geschehen war.
»Redet mit mir! Warum bin ich hier?«
Papa schluckte schwer und atmete mehrmals tief durch, bevor er mir antwortete. »Du hast versucht, dir das Leben zu nehmen.«
Erschrocken schnappte ich nach Luft und starrte Papa schockiert an, doch der hatte den Kopf gesenkt. Mein Blick flog zu Mama, aber ihre blonden Haare fielen wie ein Schleier vor ihr Gesicht, sodass ich ihren Gesichtsausdruck nicht sehen konnte.
»Was sagst du da? Das ist nicht wahr!« Unabsichtlich hatte ich die Stimme gehoben. Aber das Ganze klang so absurd. »Warum seht ihr mich nicht an? Ich habe nichts dergleichen getan. Das würde ich niemals machen!«
Endlich hob Mama den Kopf und schaute mich an. Nur war dieses Mal neben der Traurigkeit auch Wut in ihren Augen zu erkennen. »Das hast du aber und wir hatten gewaltige Angst, dich zu verlieren. Weißt du, was du uns …«
»Monika«, unterbrach mein Vater sie mahnend, aber seine Stimme klang mehr flehend als böse.
Mama presste die Lippen aufeinander. »Tut mir leid, aber sie soll ruhig wissen, was sie uns damit angetan hat.«
»Schätzchen«, sagte mein Vater sanft und schaute mich an. »Was meinst du, warum deine Handgelenke verbunden sind?«
Ich zuckte mit den Schultern. Ich hatte so was zwar schon mal in Filmen oder Serien gesehen, aber ich konnte einfach nicht glauben, dass ich so etwas getan haben sollte. Vielleicht war ich durch eine Scheibe geflogen oder so. Und dabei hatte ich mir den Kopf verletzt und konnte mich deshalb nicht erinnern. Das war zumindest eine nachvollziehbare Erklärung. Aber ein Selbstmordversuch? Das klang wie ein Albtraum, aber nicht nach meinem Leben.
»Willst du es sehen?«
Wollte ich? Nein, eigentlich nicht. Ich hatte Angst, was mich erwarten würde und wollte einfach nur nach Hause. Aber ich wusste, dass ich es mir ansehen musste, um endlich Klarheit zu haben. Deshalb biss ich die Zähne zusammen und nickte.
Papa drückte auf den Knopf der Fernbedienung, die durch ein Kabel an der Wand hinter mir befestigt war.
Mama stand auf. »Ich will das nicht noch mal sehen.«
Irgendwie konnte ich sie verstehen. Wenn das wirklich wahr war und ihre neunzehnjährige Tochter versucht hatte, sich umzubringen, dann würde es mir an ihrer Stelle auch nicht anders gehen. Aber ich, die diese Person sein sollte, wünschte, sie würde weiterhin meine Hand halten und in dem schlimmsten Moment meines Lebens zu mir stehen. Ich sah, wie sie sich durch ihre langen Haare strich und aus dem Fenster starrte. Es war klar zu erkennen, wie schlimm das Ganze für sie war, aber was sollte ich denn sagen?
Kurz darauf kam eine Schwester ins Zimmer und sah mich freundlich an. »Ah, Frau Graf, Sie sind wach. Wie fühlen Sie sich?« Die kleine rundliche Frau trat an mein Bett und warf einen Blick auf den Monitor.
»Ich will es sehen«, sagte ich.
Sie schaute mich verwirrt an. »Was?«
Ich streckte ihr meine Handgelenke entgegen. »Was darunter ist.«
Schwester Gabriele, wie ich auf ihrem Schild lesen konnte, runzelte die Stirn. »Wieso? Das muss verbunden bleiben, die Wunden sind gerade erst genäht worden, da darf erst mal nichts rankommen.«
Ich schluckte schwer. Das klang alles so real. Wunden, Nähte, Verband. Ich wollte das alles nicht und doch hatte ich keine Wahl. »Ich kann mich nicht erinnern. Ich will es sehen.«
Meine Stimme war quasi nicht mehr vorhanden und es drückte so schwer hinter meinen Lidern, dass ich mich extrem zusammenreißen musste, um nicht zu weinen.
»Sie können sich nicht erinnern, dass Sie versucht haben, sich das Leben zu nehmen?«, fragte sie ungläubig.
Mir wich bei ihren Worten jegliches Blut aus dem Gesicht und ich war nicht in der Lage, auf ihre Frage zu antworten. Ich bekam meine Lippen einfach nicht auseinander. Deswegen war ich froh, als mein Vater das für mich übernahm.
»Nein und sie braucht einen Beweis. Sie glaubt uns nicht.«
Die Schwester sah von meinem Vater zu mir und wieder zurück. Sie wirkte, als könnte sie es nicht fassen und ich konnte sie verstehen. Ich wollte es ja selbst nicht glauben. Doch statt weiter nachzufragen und darauf herumzureiten, begann sie endlich die erste Binde abzuwickeln.
Mein Herzschlag beschleunigte sich und meine Kehle wurde immer enger. Ich wollte es sehen und dann auch wieder nicht. Was, wenn sie recht hatten? Was, wenn ich wirklich … Nein! Das konnte einfach nicht sein. Es war unmöglich.
Ohne etwas zu sagen, machte Schwester Gabriele am anderen Handgelenk weiter. Das gab mir zusätzlich Zeit. Sekunden, um zu hoffen, Sekunden, die meine Befürchtung nur verstärkten.
»So«, sagte sie. »Sie können es sich jetzt anschauen. Ich lasse Sie kurz allein. Dann kommen die Verbände aber wieder dran.«
Ich hörte, wie die Tür ins Schloss fiel, aber alles war schwarz. Was natürlich daran lag, dass ich die Augen geschlossen hatte. Aber ich hatte einfach verdammte Angst hinzuschauen. Meine Handgelenke fühlten sich so nackt und gleichzeitig fremd an. Meine Hoffnung wurde immer kleiner.
»Clary?« Die Stimme meines Vaters drang zu mir durch. »Du kannst jetzt hinsehen.«
»Ich habe Angst«, gab ich zu.
»Wir sind hier. Du bist nicht allein.«
Ich nickte und öffnete wieder die Augen. Papa lächelte mir leicht zu und auch Mama war wieder ans Bett getreten. Das gab mir Kraft. Und dann tat ich es. Ich schaute auf meine Handgelenke. Sofort schnappte ich laut nach Luft und hielt sie dann an. Da waren zwei Risse in meinen Armen. Die Haut war rot und ich konnte die Nähte deutlich erkennen. Es sah so klar nach Selbstmordversuch aus, dass mir Tränen in die Augen stiegen. Ich hatte es wirklich getan. Aber warum? Ich konnte mir das absolut nicht erklären. Das hier war ein Albtraum. Es musste ein Albtraum sein. Ich fing an zu weinen, nein vielmehr heulte ich wie ein kleines Kind. Doch meine Eltern hielten mich fest, während ich wimmerte und schluchzte und es waren nicht nur meine Laute, die durchs Zimmer hallten.
Die Verbände waren wieder dran, doch das änderte nichts an den Tatsachen. Wie eine Leuchtreklame erinnerten sie mich immer wieder daran, was ich getan haben sollte. Es ging einfach nicht in meinen Kopf. Auch zwei Tage später nicht. Ich hatte mein Gehirn schon unzählige Male durchforstet, konnte mich aber weder an die Ereignisse am Dienstagvormittag noch an die Gründe meines Verhaltens erinnern. Der Psychologe hatte von retrograder und kongrader Amnesie gesprochen. Das waren Formen des Gedächtnisverlustes. Ich hatte also nicht nur den Vorfall vergessen, sondern auch, was davor passiert war. Beziehungsweise, was dazu geführt haben könnte. Somit konnten wohl auch die im Gedächtnis gespeicherten Bilder oder Zusammenhänge nicht in das Bewusstsein geholt werden. Oder so ähnlich. Für mich waren das alles einfach nur irgendwelche Worte, die nichts mit mir zu tun hatten. Es fühlte sich so fremd und weit weg an. Aber das schien jetzt wohl mein Leben zu sein. Genauso wie von unzähligen Ärzten und Psychologen untersucht zu werden. Das war die letzten zwei Tage nämlich passiert. Sie wollten natürlich herausfinden, ob ich noch suizidgefährdet war und sie mich auf eine geschlossene Station bringen mussten. Aber ich wollte nicht sterben! Niemals. Ich hatte noch so viel in meinem Leben vor. Träume, Ziele. Aber auch, wenn mich das Ganze nervte, war das nun mal ein Prozedere, das sie durchführen mussten. Jedoch erkannten die Ärzte zum Glück, dass ich nicht mehr Gefahr lief, mir etwas anzutun. Somit war ich nicht gezwungen, in eine geschlossene Anstalt zu gehen. Mir fiel ein Stein vom Herzen, als sie mir diese Entscheidung mitteilten. Allerdings legten sie mir nahe, eine Therapie zu machen, um den Ursachen auf den Grund zu gehen und meine Erinnerungen wiederzuerlangen, bevor das eventuell erneut passieren würde. Ich wollte die Therapie, nur machte mir der Gedanke daran jetzt schon Angst.
Ein Türklopfen riss mich aus meinen Gedanken und kurz darauf steckte Tobi seinen Kopf durch die Tür. Mittlerweile lag ich auf einer normalen und nicht mehr auf der Intensivstation. Deswegen konnte er mich endlich besuchen.
»Hey«, sagte er und kam auf mich zu. Er drückte mir einen Kuss auf den Mund und holte dann einen Blumenstrauß hinter seinem Rücken hervor. »Hier, die habe ich dir mitgebracht.«
Es waren rote Rosen. Obwohl wir seit drei Jahren zusammen waren, wusste er wohl immer noch nicht, dass ich die nicht leiden konnte.
»Danke«, sagte ich trotzdem mit einem Lächeln. Die Geste zählte schließlich.
Er stellte sie in eine Vase und setzte sich dann zu mir auf die Bettkante. »Wie fühlst du dich? Wann kommst du wieder raus? Ich hab dich vermisst«, raunte er und fuhr mit den Fingern meinen Arm auf und ab.
»Ich weiß es nicht«, sagte ich wahrheitsgemäß.
Weder wie ich mich fühlte, noch wann ich nach Hause durfte. Denn der Psychologe konnte mir schon für kommende Woche einen Platz in einer Klinik besorgen. Er meinte, dass eine stationäre Therapie sinnvoller wäre. Aber allein die Vorstellung, in so eine Klinik zu gehen, löste Panik in mir aus. Ich war nicht psychisch krank, mir ging es gut. Doch ein Blick auf meine Handgelenke zeigte mir, dass das nicht stimmte.
»Soll ich mal fragen gehen? Vielleicht kann ich dich ja gleich mitnehmen.«
Ich schüttelte den Kopf. »Ich werde nächste Woche wahrscheinlich sowieso in eine psychiatrische Klinik gehen.«
»Was?« Er hob erstaunt die Augenbrauen. »Aber wieso?«
»Du weißt schon, was passiert ist, oder?«
»Klar, aber eine Klinik? Ist das wirklich notwendig? Ich kann mich doch um dich kümmern.«
»Ich habe keine Grippe, Tobi. Ich habe versucht, mich umzubringen.«
Sofort schlug ich mir die Hand auf den Mund. Es das erste Mal so auszusprechen war merkwürdig. Es fühlte sich zu real an.
»Und du kannst dich nicht erinnern. Ich weiß. Das haben mir deine Eltern schon gesagt.« Er fuhr sich durch seine schwarzen Haare. Wann waren sie so lang geworden? »Das war bestimmt ein Versehen. Wir kriegen das wieder hin.«
Mir klappte der Mund auf. Ein Versehen? Ich war nicht gestolpert und in ein Messer gefallen. In welcher Welt lebte er? Er tat, als wäre das alles eine Kleinigkeit. Hauptsache ich würde wieder funktionieren. Aber so einfach war das nicht. Das wurde mir bei diesem Gespräch umso deutlicher bewusst. Doch bevor ich ansetzen und ihm meine Meinung sagen konnte, klopfte es erneut. Eine Sekunde später platzten Anna und Michelle ins Zimmer. Sie liefen sofort auf mich zu und schlossen mich in ihre Arme. Nur entfernt nahm ich wahr, wie Tobi aufstand, doch in mir machte sich Erleichterung breit. Ich war gerade nicht in der Stimmung, weiter mit ihm zu diskutieren.
»Clary«, sagte Michelle mit gepresster Stimme, ließ mich allerdings nicht los. Ihre Rastazöpfe hingen mir dabei im Gesicht, aber ich genoss diese Umarmung, brauchte sie geradezu.
»Michelle«, mahnte Anna. »Du erdrückst sie.«
Schnell richtete sich Michelle auf und sah mich an. Ihre schwarzumrandeten Augen waren glasig. Es war ein merkwürdiger Kontrast zu ihrem Gothiclook, zeigte aber, welche Sorgen sie sich machte.
»Wie geht es dir?«, fragte Anna und ich drehte mich zu ihr. Ihre Hand lag auf meiner, aber ihr Blick wanderte immer wieder zu dem Verband.
Ich schluckte. »Gut soweit, denke ich.«
»Ich gehe mal einen Kaffee trinken und komme später wieder«, meinte Tobi plötzlich und alle sahen ihn an. Ich hatte schon ganz vergessen, dass er da war, nickte aber.
»Sorry, Tobi«, sagte Michelle. »Wir wollten euch nicht stören.«
»Schon gut. Wir haben ja noch später Zeit füreinander«, gab er lächelnd zurück und verließ das Zimmer.
Als die Tür ins Schloss fiel, setzte Michelle sich aufs Bett. »Alles okay bei euch?«
»Klar, die Situation ist nur für uns alle nicht einfach.«
Sie nickte traurig. »Hast du noch irgendwelche Schmerzen?«
»Nein«, erwiderte ich, obwohl das nicht ganz der Wahrheit entsprach. Die Risse an meinen Handgelenken brannten und erinnerten mich jede Sekunde an eine Realität, zu der ich nicht gehören wollte. »Aber jetzt erzählt mir doch mal etwas von euch. Ich brauche Ablenkung.«
Anna schüttelte den Kopf und ein paar Haarsträhnen lösten sich aus ihrem lockeren Dutt. »Vergiss es. Wir hätten dich fast verloren, wir reden jetzt nicht über Partys oder Jungs. Wir wollen wissen, was los ist, dich unterstützen, dir helfen.«
Das war unglaublich lieb von ihnen, aber das konnten sie nicht. »Ich weiß nicht, wieso das passiert ist und es gibt nichts, was ihr tun könnt.«
Anna ließ sich seufzend auf mein Bett fallen. »Irgendwas muss es doch geben. Einfach nach Hause gehen und so weitermachen wie bisher, wird nicht die Lösung sein.«
So gern ich auch alles hinter mir lassen und nie wieder meine Handgelenke ansehen wollte, wusste ich, dass sie recht hatte. Ich traute mir im Moment selbst nicht. Was war, wenn ich es wieder versuchte?
»Das seh ich auch so. Es muss herausgefunden werden, warum das geschehen ist und du brauchst deine Erinnerungen zurück«, sagte Michelle.
Ich sah zwischen meinen Freundinnen hin und her. Sie waren wie Nord- und Südpol. Während Michelle stark geschminkt war und düstere Klamotten trug, war auf Annas Haut kein Fünkchen Farbe, dafür waren ihre Sachen umso bunter. Ich war die Mitte. Neutral. Langweilig. Obwohl meine langen blonden Locken durchaus auffielen. Wir gaben echt ein interessantes Bild ab, wenn wir zusammen unterwegs waren. Doch trotz der ganzen Unterschiede waren wir drei ein wunderbares Trio und schon seit der Grundschule befreundet.
»Ihr habt recht«, sagte ich, obwohl ich wünschte, es wäre anders. »Es gäbe da auch eine Möglichkeit. Der Psychologe des Krankenhauses hat mir einen Platz in einer psychiatrischen Klinik angeboten.« Oh Gott, wie das klang. Niemals hätte ich gedacht, jemals in eine Anstalt zu müssen.
»Und was hast du geantwortet?«
»Ich denke …«
»Was gibt es da nachzudenken?«, unterbrach mich Michelle. »Das ist die Chance, dem Ganzen auf den Grund zu gehen und die Sicherheit, dass …« Sie hielt inne, aber ich wusste genau, was sie sagen wollte. Dass so etwas nicht wieder passiert. Und ich konnte es ihr nicht mal verübeln. Sie hatte ja recht. Wer wusste schon, ob ich es nicht erneut versuchen würde? Ich hatte keine Ahnung mehr, wer ich war. Und meine Familie und Freunde hatten Angst um mich. Vielleicht gehörte ich da nun hin. Egal wie unvorstellbar es für mich war.
»Was Michelle sagen will«, fing Anna an. »Wir machen uns Sorgen um dich und wünschen uns, dass es dir besser geht, damit wir zusammen bald wieder einen drauf machen können.« Sie zwinkerte mir zu. »Es sind nur ein paar Wochen. Was ist das im Gegensatz zum Rest deines Lebens?«
Nur ein paar Wochen. Aber es war viel mehr als das. Es war eine Klinik und eine Therapie, die wahrscheinlich die Gründe für meine Tat hervorbringen würde. Ich hatte Angst vor dem, was da auf mich zukam und wie groß und gewaltig dieser Teil in mir war, an den ich mich nicht erinnern konnte. Aber das behielt ich für mich, lächelte und nickte. Ich wollte ihnen einfach nicht noch mehr aufbürden.
2. Kapitel
Clary
Wieder nach Hause zu kommen war merkwürdig. Anders. Und es fiel mir schwer überhaupt einen Fuß über die Schwelle zu setzen. Ich hatte Angst mich zu erinnern und gleichzeitig mich nicht zu erinnern. Das war verrückt. Doch was sollte ich tun? Ich musste mich dem stellen. Mehrfach atmete ich ein und aus und irgendwie schaffte ich es nach ein paar Minuten die Treppe nach oben und auf mein Zimmer zuzugehen. Bevor ich es jedoch betreten konnte, kam jemand um die Ecke geflitzt.
»Clary«, schrie Louis und ich ging in die Hocke, damit ich ihn auffangen konnte. »Ich habe dich vermisst! Ich wollte dich ja im Krankenhaus besuchen, aber Mama hat es verboten.«
Ich drückte meinen kleinen Bruder an mich und sog seinen Duft ein. Er roch nach zu Hause und ich fühlte mich sofort ein großes Stück leichter. Seine Nähe beruhigte mich und ich hatte gleich weniger Angst als vorher.
»Sei froh, dass du nicht da warst. Im Krankenhaus ist es wirklich nicht so schön. Außerdem war ich ja gar nicht lange weg.«
Er ließ mich los und sah mich mit seinen braunen Kulleraugen an. »Mama hat gesagt, dass du dich an Scherben geschnitten hast. Tut es noch weh?«
Ich wusste, dass wir Louis nicht die Wahrheit sagen konnten. Er war fünf, das Ganze würde ihn nur verängstigen, wenn er es überhaupt verstand.
Ich fuhr ihm durch seine braunen Haare. Das tat ich zu gern, sie waren so furchtbar weich, doch Louis mochte das eigentlich nicht. »Etwas, aber wir können trotzdem Federball spielen.«
Sein Gesicht hellte sich auf. »Au ja!« Dann runzelte er die Stirn. »Aber Mama hat auch gesagt, dass du noch mal in ein Krankenhaus musst. In ein anderes, wo du Therapien hast, damit deine Arme richtig heilen können.«
»Das stimmt.«
Es gefiel mir nicht, Louis anzulügen, aber ich wusste, es musste sein.
»Ich will aber nicht, dass du gehst«, sagte er und wirkte dabei so traurig, dass ich ihn noch mal in meine Arme zog.
»Das will ich auch nicht. Doch es muss leider sein. Wir können aber hin und wieder telefonieren und du darfst mich diesmal auch besuchen. Du wirst sehen, die Zeit vergeht wie im Flug und dann bin ich schon wieder hier.«
»Versprichst du mir das?«
»Ich verspreche es«, sagte ich und hauchte ihm einen Kuss aufs Haar.
»Aber bis dahin musst du noch ganz oft mit mir spielen.«
Ich lachte und schob ihn ein Stück von mir, damit ich ihn betrachten konnte. »Natürlich, lass uns loslegen.«
Wir hatten noch ein gemeinsames Wochenende, am Montag würde die Therapie beginnen und ich wollte die Zeit eigentlich nur mit Louis verbringen. Er schaffte es einfach immer, mich in eine Welt zu entführen, die unbeschwert und leicht war. Manchmal wünschte ich, ebenfalls noch einmal fünf sein zu können.
»Vorher fahr ich dich zu Finns Geburtstag«, sagte Mama, die uns zugehört haben musste.
Louis schob die Unterlippe vor. »Aber ich will da gar nicht mehr hin. Ich will viel lieber mit Clary spielen.«
»Louis, er hat dich eingeladen, du hast zugesagt und wir haben ein Geschenk gekauft. Du kannst jetzt nicht absagen, wie sieht das denn aus? Wir fahren, keine Diskussion!«
Louis schwieg, doch sein Gesicht sprach Bände. Ich tippte mit dem Finger auf seine Brust. »Los jetzt. Das wird bestimmt lustig und wir können danach noch spielen, okay?«
Er nickte, wirkte aber trotzdem nicht gerade begeistert. Doch gleichzeitig wusste er genau, dass er sowieso keine Chance hatte. Mama ließ sich so gut wie nie umstimmen. Deswegen gab er auf und ging mit hängendem Kopf nach unten.
Mama warf mir einen unsicheren Blick zu. »Kommst du zurecht oder willst du mitkommen?«
Zwanzig Minuten sinnlos im Auto sitzen? Darauf konnte ich getrost verzichten.
»Ich komm klar. Außerdem ist Papa ja noch da.«
Sie nickte, aber überzeugt sah sie nicht aus. Eher so, als hätte sie Angst, ich würde jeden Moment die Sache von Dienstag beenden wollen. Dennoch folgte sie Louis und ließ mich allein.
Ich atmete tief durch. Jetzt wo mein Bruder weg war, fühlte ich mich wieder so verloren wie vorher. Und es kostete mich reichlich Überwindung, einen Fuß in mein Zimmer zu setzen. Obwohl es aussah wie immer, lag eine Schwere in der Luft. Ich wusste, es war hier passiert. In diesem Raum hatte ich mir die Pulsadern aufgeschnitten. Ich erwartete Blutreste, Rasierklingen oder Ähnliches, aber nichts war zu sehen. Es wies rein gar nichts darauf hin, dass sich hier jemand versucht hatte, das Leben zu nehmen. Na ja, bis auf, dass der große Flauschteppich fehlte. Mein Blick fiel auf den leeren Holzboden und wieder rauschten tausend Fragen durch meinen Kopf. Wieso hatte ich das getan? Warum hier? Wo meine Eltern oder gar Louis mich hätten finden können? Wieso hatte ich es nicht abgelegen irgendwo im Wald gemacht? Wollte ich unterbrochen werden? Ich presste mir den Handballen gegen die Stirn. Es pochte dahinter. Meine Gedanken schmerzten. Ich wünschte, ich könnte mich einfach erinnern.
»Ich habe dich gefunden«, sagte plötzlich eine Stimme und ich drehte mich zu meinem Vater, der in der Tür stand.
Ich sah den Schmerz in seinen Augen, obwohl er versuchte, seine Gefühle zu verbergen. Wir hatten bisher nicht über den Vorfall im Einzelnen gesprochen. Es war einfach alles zu viel gewesen. Doch jetzt wollte ich mehr wissen.
»Wie? Wann?«, fragte ich.
Papa blickte auf den leeren Boden und atmete tief durch, bevor er zu sprechen begann. »Ich hatte mein Portemonnaie vergessen und bin noch mal nach Hause gefahren. Und weil dein Auto noch in der Einfahrt stand, wollte ich nachsehen, warum du nicht zur Arbeit gefahren bist. Und dann …« Er schluckte schwer. »Du lagst dort auf dem Teppich und alles war voller Blut. Ich …« Wieder brach er ab und in mir begann es zu brennen.
Wie hatte ich ihm das nur antun können? Es muss das Schlimmste für einen Vater sein, seine eigene Tochter so vorzufinden. Ich wollte mir das nicht einmal vorstellen.
»Ich habe sofort einen Krankenwagen gerufen. Und dann ging alles so schnell. Dein Puls war schwach und du hattest so viel Blut verloren …«
Seine Hände begannen zu zittern, und das war der Moment, wo ich auf ihn zuging und ihn in meine Arme schloss. Er erwiderte die Umarmung, drückte mich sogar etwas fester an sich, als wollte er sichergehen, dass er mich nicht auf diesem Teppich verloren hatte.
»Es tut mir leid«, flüsterte ich in sein Hemd. »Ich weiß zwar nicht, warum ich das getan habe und wie ich euch das überhaupt antun konnte, aber es tut mir so unendlich leid.«
»Schon gut, du wirst es hoffentlich in der Klinik herausfinden. Alles kommt wieder in Ordnung.«
Die Muskeln in meinem Rücken verhärteten sich. Auch, wenn es das Richtige war, zog sich beim Gedanken an die Klinik jedes Mal alles in mir zusammen. »Ja, hoffentlich«, sagte ich dennoch.
Er ließ mich los, schaute mir in die Augen und legte den Kopf schräg. »Wollen wir etwas Musik machen gehen?«
Papa hatte im Keller noch etliche Instrumente und ein paar Dinge, die aus seinem alten Leben, wie er immer sagte, übrig geblieben waren. Hin und wieder gingen wir runter und gaben uns der Musik hin. In letzter Zeit war es extrem selten geworden. Ich hatte keine Zeit mehr dafür gehabt. Und gerade tat mir das leid.
»Gerne. Kannst du mich nur noch einen Augenblick festhalten?«
Sein Lächeln zerbrach. »Natürlich.«
Er legte seine Arme um mich und ich schmiegte mich an seine Brust. Zwei, drei Momente standen wir so da und obwohl ich mir wünschte, diese Umarmung würde alles ungeschehen machen, so wie früher, als ich noch klein war, tat sie das nicht.
Kurz darauf verließ er das Zimmer und ich versprach gleich nachzukommen, obwohl ich ihm am liebsten sofort folgen wollte. Raus aus diesem Raum. Für immer. Denn selbst wenn ich mich nicht erinnern konnte, spürte ich hier etwas Dunkles und Schweres. Es war wie ein schwarzes Monster, das mich zu verschlingen drohte. Und ich wollte rennen. Weg von hier. Von diesem Leben, von meiner Vergangenheit. Aber stattdessen trat ich vor den Spiegel, der in der rechten Ecke des Zimmers stand. Ich konnte nicht davonlaufen. Denn ich war das Problem und mir blieb nichts anderes übrig, als mich dem Ganzen zu stellen. Eigentlich sah ich aus wie immer. Meine langen Locken wirkten gesund, ebenso wie der Rest von mir. Vielleicht hatte ich etwas abgenommen, aber nicht viel. Ich war noch immer vollkommen durchschnittlich, normalgewichtig, normalgroß, was um die hundertsiebzig Zentimeter hieß, und meine Haut war frisch und gebräunt. Ich sah fit aus. Nur eine Sache stand im Kontrast dazu und machte das Bild kaputt. Die Verbände an meinen Handgelenken. Sie fühlten sich an wie Fremdkörper und zeigten deutlich, dass ich nicht gerade in der besten Verfassung war. Daran würde weder die Musik noch Louis etwas ändern können. Niemand eigentlich. Na ja, außer eine Therapie vielleicht. Beziehungsweise ein achtwöchiger Aufenthalt in der Klinik einen Ort weiter. Zumindest war die Zeit vorerst darauf beschränkt worden. Natürlich konnte sie noch verlängert werden, was ich nicht hoffte. Stattdessen wünschte ich mir, dass ich weniger als acht Wochen brauchen würde. Ich wollte mein altes Leben zurück, obwohl ich wusste, dass dieses dazu geführt hatte, dass ich jetzt hier stand. Mit Narben auf meinen Armen. Für einen kurzen Moment erlaubte ich mir, die Tränen, die in meinen Augen brannten, loszulassen. Nur einen Augenblick. Ein paar Sekunden der Schwäche. Aber dann wandte ich mich ab und ging zu Papa in den Keller. Ich wollte nicht mehr daran denken, zumindest für ein Wochenende lang.
Nachdem ich mich mit meinem Vater auf den Instrumenten ausgetobt hatte, verbrachte ich das restliche Wochenende mit Louis. Wir spielten Federball, bauten Höhlen im Garten oder malten zusammen die verschiedensten Tiere. Es war die perfekte Ablenkung. Seine fröhliche und gleichzeitig entspannte Art ließ mich alles vergessen und ich fühlte mich für eine gewisse Zeit geradezu unbeschwert. Ich wünschte, ich könnte ihn in meine Tasche stecken und mitnehmen, dann würde ich den Klinikaufenthalt sicher besser überstehen.
»Schläfst du heute wieder bei mir?«, fragte Louis nach dem Abendbrot.
Ich wollte nicht in meinem Zimmer sein und erst recht nicht dort schlafen. Jedes Mal, wenn ich es betrat, schnürte sich meine Kehle zu. Außerdem schossen mir dabei immer wieder Bilder durch den Kopf, die ich nicht ertragen konnte. Deswegen war ich gestern einfach bei Louis liegen geblieben, nachdem ich ihm etwas vorgelesen hatte.
»Wenn du das willst.«
»Ja, ja, ja«, schrie er.
»Louis«, mahnte Mama ihn.
Doch mein kleiner Bruder ignorierte sie. »Wir können ja auch bei dir schlafen, dann können wir noch fernsehen.«
Ich versteifte mich. Genau das wollte ich nicht. Doch wie sollte ich Louis das erklären?
»Der ist kaputt«, log ich. »Aber wir können die Sterne an deiner Decke zählen und uns zu jedem Stern eine Geschichte ausdenken.«
»Ja, das ist cool.« Seine Augen strahlten. »Ich geh schon mal hoch, alles vorbereiten.« Und mit diesen Worten sprang er vom Stuhl und verschwand nach oben.
Erleichtert atmete ich aus. Gerade noch mal gut gegangen. Mein Blick glitt zu meinen Eltern, die mich beide merkwürdig betrachteten. Das taten sie schon das ganze Wochenende. Wahrscheinlich dachten sie, ich würde es nicht bemerken, aber sie beobachteten mich ständig und das auf eine Weise, die schmerzte. Als erwarteten sie, dass jeden Moment etwas Schlimmes passierte. Ich konnte ihre Sorge verstehen, es würde mir vermutlich nicht anders gehen, wenn es meine Tochter beträfe oder Louis. Aber so angesehen zu werden war schrecklich.
»Hast du schon alles gepackt?«, fragte meine Mutter. »Ich möchte morgen Früh nicht warten müssen, weil du dann erst damit anfängst.«
Innerlich verdrehte ich die Augen. Sie hatte extra einen Termin verschieben müssen, um mich morgen in die Klinik fahren zu können. Ich hatte sie nicht darum gebeten, ich hätte auch den Bus genommen.
»Ja, alles erledigt.«
Die Taschen standen bereits im Flur. Es fehlte nur noch meine Kosmetiktasche. Die morgen Früh reinzuwerfen, würde ihren Plan schon nicht durcheinanderbringen.
»Gut. Herr Pesch lässt dir auch noch mal gute Besserung ausrichten. Ich habe ihn vorhin beim Bäcker getroffen.«
Ich unterdrückte ein Würgen. Wie nett von meinem Chef. Ich glaubte ihm jedoch kein Wort. Nach außen hin wirkte er immer freundlich, aber ich wusste, wie er wirklich war. Und er war ganz sicher ziemlich angepisst, dass ich für mehrere Wochen nicht zur Arbeit kommen würde. Es waren zwar Sommerferien und somit musste ich nicht in die Berufsschule, aber ich hätte in der Zeit arbeiten müssen. Ich hoffte nur, dass ich rechtzeitig zu Beginn des dritten Lehrjahres wieder da sein würde und es nicht wiederholen musste.
»Danke, sehr aufmerksam von ihm«, gab ich zurück, weil meine Eltern von alldem, was auf Arbeit abging, nichts wussten.
»Finde ich auch. Es gibt genug Arbeitgeber, die nicht so verständnisvoll sind. Sei froh, wenn du das Jahr nicht wiederholen musst. So steht einem Studium danach nichts im Wege.«
Ich presste die Lippen aufeinander, um mich davon abzuhalten, etwas zu erwidern. Wir hatten die Sache mit dem Studium schon so oft durchgekaut. Mama akzeptierte mein Nein einfach nicht. Nur, weil sie als Steuerberaterin viel verdiente, wollte sie auch für mich einen gut bezahlten Job. Ihrer Meinung nach war das nur mit einem Studium möglich. Aber ich wollte das alles nicht.
»Meinst du, es ist eine gute Idee, wenn du heute wieder bei Louis schläfst?«, fragte meine Mutter plötzlich und ich runzelte die Stirn. Nicht nur wegen des krassen Themenwechsels, sondern auch wegen der Sache an sich. Was war schlimm daran?
»Wieso sollte ich nicht?«
»Das macht es nur schwerer für ihn, wenn du ab morgen weg bist.«
Ich sah auf die Tischplatte. Wie sollte ich ihr nur erklären, dass ich nicht in meinem Zimmer schlafen konnte? Sie würde es wahrscheinlich eh nicht verstehen. »Ich kann nicht …« Ich schluckte, in der Hoffnung, der Kloß in meinem Hals würde verschwinden, doch das tat er nicht. »Ich kann einfach nicht …«
»Schon gut«, mischte sich Papa ein. »Wenn es dir und Louis guttut, warum nicht? Oder, Monika? Lass die beiden noch ein wenig Geschwisterzeit miteinander verbringen, bevor sie für eine Weile getrennt sind.«
»Na schön«, sagte sie, sah mich dabei jedoch nicht an und erhob sich. »Aber setz ihm keinen Floh ins Ohr. Erzähl ihm nichts von dem Vorfall oder vom Sterben.«
Ich starrte sie mit geweiteten Augen an. »Ich kann mich nicht erinnern! Und selbst wenn, würde ich Louis niemals da reinziehen.«
»Ich wollte es nur mal gesagt haben.«
Was dachte sie nur von mir? Glaubte sie nicht, dass ich mich nicht erinnern konnte? Und dachte sie, ich würde Louis beim nächsten Mal mitnehmen?
Ein Klingeln unterbrach meine Gedanken und hinderte mich daran, etwas zu erwidern. Ich rannte zur Tür, weil ich die Energie loswerden wollte, die sich gerade in meinem Körper angesammelt hatte. Als ich sie öffnete, stand Tobi vor mir.
»Hey«, sagte er, machte einen Schritt auf mich zu und gab mir einen Kuss.
»Hey, was machst du denn hier?«, antwortete ich und er trat ein.
»Meine Freundin besuchen.« Wieder trafen seine Lippen auf meine. Diesmal strich er dabei mit seinen Händen meinen Rücken hinab und umfasste meinen Po. »Und sie fragen, ob sie mit zu mir kommen und die Nacht mit mir verbringen will«, hauchte er und vertiefte den Kuss.
Ich versteifte mich. Das Ganze war mir gerade zu viel und ich fühlte mich unwohl hier mitten im Flur und mit meinen Eltern nebenan. Ich freute mich zwar, dass Tobi da war, aber ich hatte gar nicht mit ihm gerechnet. Er war das ganze Wochenende auf Arbeit gewesen. Wir hatten ein paar Mal geschrieben und uns gestern kurz gesehen, aber er war viel zu erschöpft gewesen und sofort auf der Couch eingeschlafen. Heute sollte er noch länger arbeiten und wollte dann direkt nach Hause ins Bett. Was vollkommen okay für mich war. Sein Chef und Vater war ein verdammter Ausbeuter. Auch, wenn er die Metallbaufirma irgendwann übernehmen sollte, mutete sein Vater ihm meiner Meinung nach viel zu viel zu. Aber das hatte ich ihm schon oft genug gesagt. Letztendlich war es seine Entscheidung, ob er das mit sich machen ließ.
Dass er jetzt doch hier war, war schön, aber ich hatte gerade keine Lust auf das, was er vorhatte. Ich hatte im Moment echt andere Probleme.
Ich machte mich von ihm los. »Ich kann nicht. Ich habe Louis versprochen, bei ihm zu schlafen.«
Tobi schaute mich verwirrt an. »Ach komm, Louis wird das verstehen. Wir haben nur noch diese eine Nacht.«
Ich sah an ihm vorbei. »Ich denke, es ist besser, wenn ich zu Hause bleibe. Du weißt schon, weil …«
»Wieso? Du kannst dich doch eh nicht erinnern, also kannst du genauso gut alles tun, was du willst.«
Ich trat von einem Bein aufs andere und wusste nicht, was ich darauf erwidern sollte. Ich wollte ihn nicht vor den Kopf stoßen, aber genauso wenig konnte ich jetzt mit ihm gehen. Nicht nur, weil ich keine Lust auf Sex hatte, sondern auch, weil er die Sache nicht ernst genug nahm.
»Clary?« Louis tauchte auf der Treppe auf. »Es ist alles fertig, kommst du?«
Er ignorierte Tobi vollkommen. Das tat er eigentlich immer. Er sagte es zwar nicht, aber ich wusste, dass er ihn nicht leiden konnte.
»Ja, ich bin gleich bei dir, geh schon mal vor, Louis.«
»Was? Du willst wirklich nicht mit zu mir kommen?«, fragte Tobi völlig perplex. Hatte er mir gerade nicht zugehört?
Diesmal sprach ich es direkt aus, weil er es anscheinend nicht anders verstand und ich nicht den Nerv hatte, weiter darüber zu diskutieren. »Nein, das will ich nicht.«
Er machte noch einen Schritt auf mich zu und fuhr mit seinen Fingern über meinen Bauch. »Bist du dir sicher? Ich könnte dir eine Nacht bescheren, die du die nächsten Wochen nicht vergessen wirst.«
Ein Schauer lief mir über den Rücken, aber nicht, weil es mir gefiel. Ganz im Gegenteil. »Hör auf, Tobi, ich habe nein gesagt«, stieß ich aus und drückte seine Hand weg.
»Denk noch mal darüber nach«, hauchte er und wollte mich erneut küssen.
»Hau ab«, rief Louis plötzlich und Tobi hielt inne.
Verdammt, er sollte doch hochgehen. Hatte er etwas gesehen?
Tobi beugte sich zu Louis, der auf einmal neben mir stand. »Hör mal, Kleiner. Du bist doch auch dafür, dass Clary mit zu mir kommt, oder? Sie ist meine Freundin und da gehört sich das.«
Louis schüttelte den Kopf und ich stellte mich vor ihn. »Lass das, Tobi. Zieh ihn da nicht mit rein. Ich komme nicht mit. Ich werde morgen für mehrere Wochen in eine Klinik gehen und vielleicht solltest du irgendetwas Nettes sagen, mir eine gute Genesung wünschen und dann einfach nach Hause fahren.«
»Aber …«
»Gute Nacht, Tobi«, sagte ich müde. Es machte einfach keinen Sinn, weiter zu diskutieren.
Ich nahm Louis’ Hand und ging mit ihm nach oben. Tobi rief uns noch etwas hinterher, doch ich konnte kein Wort verstehen, und ignorierte ihn einfach. In Louis’ Zimmer angekommen, ließ ich mich seufzend auf sein Bett fallen. Er tat es mir gleich, nur noch etwas theatralischer und ich musste sofort lachen.
»Ich mag Tobi nicht«, sagte er nach mehreren Sekunden.
Innerlich grinste ich, weil ich es die ganze Zeit gewusst hatte. »Ich weiß.«
»Aber ich habe mir schon eine Geschichte für diesen Stern ausgedacht.« Er zeigte auf den Stern ganz links.
»Schieß los«, sagte ich und kuschelte mich an ihn.
»Und zwar handelt sie von meiner Schwester, die morgen in eine Klinik gehen wird und die ich schon jetzt furchtbar vermisse. Aber dort wird ihr geholfen und sie kommt ganz gesund wieder nach Hause.«
Meine Augen wurden feucht und ich schluckte schwer.
»Das wird sie doch, oder?«, fragte Louis, nachdem ein paar Sekunden Stille herrschte, weil ich versuchte, nicht zu weinen.
Ich hauchte ihm einen Kuss aufs Haar. »Ja, das wird sie.«
Für Louis wollte ich daran glauben und ein bisschen auch für mich selbst.
3. Kapitel
Clary
»Und das hier ist dein Zimmer«, sagte Schwester Rita, nachdem sie mir gezeigt hatte, wo ich das Schwesternzimmer, die Küche und den Aufenthaltsraum – in dem gleichzeitig gegessen wurde – fand.
Ich war tierisch aufgeregt, als sie die Tür öffnete. Ich wusste, dass ich mir mit jemandem das Zimmer teilen musste und hatte Angst, wie dieses Mädchen sein würde. Doch zu meiner Verwunderung war niemand da.
»Elli ist gerade bei einer Untersuchung. Sie ist wirklich liebenswürdig, ein wenig überdreht, aber du wirst sie sicher mögen. Sie müsste bald zurück sein.« Rita sah sich um. »Richte dich in Ruhe ein. Wenn du fertig bist, komm einfach zum Schwesternzimmer, dann besprechen wir deinen Therapieplan.«
Ich nickte, weil ich nicht wusste, was ich sagen sollte. Seit ich die Klinik betreten hatte, war mir meine Stimme irgendwie abhandengekommen. Vielleicht hatte ich aber auch nur Angst, etwas Falsches zu sagen. Wer wusste schon, was sie über mich dachten, nachdem sie erfahren hatten, was ich getan hatte.
»Hast du noch Fragen?« Ich schüttelte den Kopf. »Okay, aber wenn doch, weißt du ja, wo du mich findest.« Sie schenkte mir ein letztes Lächeln und ließ mich dann allein.
Ich atmete tief durch und nahm das Zimmer in mich auf. Zwei Betten, zwei Nachttische, ein Tisch mit zwei Stühlen und zwei Schränke. Alles doppelt. Es war nicht so schlimm wie im Krankenhaus, aber das machte es auch nicht besser. Es war trotzdem eine Klinik und nicht mein Zuhause. Ich wollte hier weg und mit niemandem, den ich nicht kannte, zusammen in einem Raum schlafen. Aber ich hatte wohl keine Wahl.
Seufzend ließ ich mich auf mein zukünftiges Bett fallen und blickte auf die gegenüberliegende Seite, die nicht so kahl aussah wie meine. Elli hatte Bilder und ein Poster von Shawn Mendes aufgehängt. Wir hatten also schon mal eine Gemeinsamkeit, was den Musikgeschmack betraf. Auf ihrem Bett saß ein kleiner Bär und daneben lag ein Buch, das mir nach einem Liebesroman aussah. Ich schielte herüber, um den Titel zu entziffern, doch bevor ich auch nur ein Wort lesen konnte, schwang die Tür auf. Ein zierliches Mädchen kam herein und schritt direkt auf mich zu. Sie hatte kurze blonde Haare, grüngraue Augen und einen blauen Pulli an. Dabei hatten wir über fünfundzwanzig Grad. War ihr nicht warm? Merkwürdig. Andererseits hatte auch ich ein Langarmshirt an. Natürlich damit man meine Verbände nicht sehen konnte. Hatte sie auch irgendetwas zu verstecken?
»Hey, du musst Clarissa sein. Ich bin Elli.« Sie hielt mir ihre Hand hin und ich ergriff sie vorsichtig. »Endlich bist du da. Es war furchtbar langweilig hier allein.« Sie strahlte. »Hast du dich schon eingerichtet?« Ihr Blick flog über meine kahle Seite. »Scheinbar nicht. Soll ich dir helfen?«
Ich war ein wenig überfordert. Woher kannte sie meinen Namen? Außerdem wurde mir jetzt bewusst, was Rita mit überdreht gemeint hatte.
Ich winkte ab. »Geht schon. Ich hab nicht viel Kram.«
Sie ging rüber zu ihrem Bett und ließ sich darauf fallen. »Okay, dafür zeig ich dir nachher die Klinik.«
»Rita hat mich schon rumgeführt.«
Sie hob die Brauen. »Aufenthaltsraum, Küche und Schwesternzimmer?«
Ich nickte.
»Es gibt hier viel mehr zu sehen als diese drei Räume und auch noch genug Dinge, die du wissen musst.« Sie zwinkerte mir zu. »Aber pack erst mal aus. Danach müssen wir sowieso zur Gruppentherapie. Die Spezialführung bekommst du dann in der Mittagspause.«
Musste ich da auch hin? Zur Gruppentherapie? Heute schon? Gab es keine Schonung für die Neuen? Einen Gewöhn-dich-erst-mal-ein-Tag? Wurde man sofort ins kalte Wasser geschmissen? Scheinbar schon.
Ich begann meine Tasche auszupacken, die etwas durchwühlt war, weil Rita sie vorhin begutachtet hatte. Mir wurde der Rasierer weggenommen, eine Schere und meine Nagelfeile. Es waren nur Vorsichtsmaßnahmen, das wusste ich. Trotzdem war es merkwürdig und zeigte mir mal wieder, wie ernst die Lage wirklich war.
»Ist das dein Bruder?«, fragte Elli plötzlich, als ich ein Bild von Louis und mir auf den Nachttisch stellte.
Ich nickte und dachte sofort daran, wie er sich heute Morgen an mich geklammert hatte und mich nicht gehen lassen wollte. Es war schrecklich gewesen und es hatte mich viel Selbstbeherrschung gekostet, ihn zurückzulassen.
»Er ist süß. Wie alt ist er?«
»Fünf, aber manchmal habe ich das Gefühl, er wäre schon älter.« Er war anderen Kindern in seinem Alter definitiv voraus.
»Ich weiß, was du meinst«, gab Elli mit einem Grinsen zurück.
»Hast du auch Geschwister?«
Mittlerweile hatte ich alles ausgepackt. Ich legte nur noch die Zeitschriften in die Schublade, die meine Mutter mir heute Morgen gegeben hatte. Sie meinte, dass Kreuzworträtsel die beste Möglichkeit seien, sich die Zeit zu vertreiben. Nur doof, dass ich Kreuzworträtsel hasste.
»Ja, eine Schwester. Aber sie ist gerade mitten in der Pubertät und verdammt anstrengend«, gab Elli mit einem Augenrollen zurück.
Ich verzog das Gesicht. »Das kann ich mir vorstellen.«
Ich wünschte, Louis könnte diese Zeit überspringen, denn wahrscheinlich war es dann total uncool mit seiner Schwester abzuhängen. Vielleicht wäre er auch aufmüpfig und würde rebellieren. Ich wollte lieber nicht darüber nachdenken und meinen kleinen Bruder behalten, wie er war.
»Wie alt bist du?«, fragte ich Elli, weil sie so jung aussah.
»Achtzehn. Und lass mich raten, du bist neunzehn.«
Langsam wurde ich stutzig. Erst meinen Namen und jetzt mein Alter? Woher wusste sie das?
Ich hob die Brauen. »Bist du Spionin?«
Elli lachte. »Irgendeine Beschäftigung muss man sich hier ja suchen, sonst wird man verrückt. Doch mehr als deinen Namen und dein Alter weiß ich nicht. Keine Angst.«
Da war ich beruhigt. Aber wurde man hier wirklich verrückt? War man nicht deswegen hier?
»So.« Elli klatschte in die Hände. »In zehn Minuten geht die Gruppentherapie los, du solltest noch schnell deinen Plan holen. Dann können wir gemeinsam hingehen.«
Elli war wirklich sympathisch und ich war froh, gerade sie als vorübergehende Mitbewohnerin zu haben. Aber ich war noch nicht bereit für diese ganze Therapiesache. Ich hatte Angst und würde meine Sachen am liebsten sofort wieder einpacken und von hier verschwinden. Aber was dann? Es gab keinen anderen Weg. Ich musste mich zusammenreißen und die Sache durchziehen. Es kostete mich nur mehr Kraft, als ich in mir finden konnte.
Rita hatte mir meinen Therapieplan sehr ausführlich erklärt, sodass ich zu spät zur Gruppentherapie gekommen wäre. Sie hatte gesagt, dass ich die Zeit einfach noch zum Ankommen nutzen und dafür aber heute Nachmittag alle Therapien wahrnehmen sollte. Ich war erleichtert, denn später standen Therapien auf dem Programm, die sich weniger angsteinflößend anhörten. Ich musste zur Ergotherapie, zum autogenen Training und zur Musiktherapie. Ich machte zwar alles zum ersten Mal, aber sie klangen nicht so schlimm wie die Gruppentherapie, wo man vor Fremden über seine Probleme reden musste.
»Da bist du ja.« Elli tauchte neben mir auf. »Ich habe dich in der Therapie vermisst.«
»Ja, das mit dem Plan hat etwas länger gedauert als gedacht.«
»Sei froh, Laura hat sich schon wieder in den Mittelpunkt gedrängt und nicht mehr aufgehört zu weinen.«
Solange jemand anderes im Mittelpunkt stand, war mir alles recht.
»Lass uns zum Mittag gehen. Heute gibt es Hühnerfrikassee und das ist sogar essbar«, Elli zwinkerte mir zu und ich folgte ihr in den Essensraum.
Was bedeutete das denn? Waren die anderen Mahlzeiten so grauenhaft? Würde ich hier verhungern? Vielleicht sollte ich mir schon mal einen Schokoladenvorrat anlegen.
Als wir ankamen, saßen die meisten Patienten bereits, aber es war noch genug Platz. Elli setzte sich zu einem Mädchen und begann sofort, mit ihr über die Therapie von eben zu sprechen. Ich ließ mich neben den beiden nieder und sah mich um. Es waren mehr Frauen als Männer hier und sie wirkten alle ziemlich normal. Warum auch nicht? Irgendwie erwartete man immer, dass sie anders waren und sich merkwürdig verhielten, aber eigentlich waren es ganz normale Menschen.
»Paula, das ist Clary, meine neue Mitbewohnerin.« Bei meinem Namen horchte ich auf und wandte mich wieder den beiden zu. »Clary, das ist Paula. Sie ist ein paar Tage nach mir gekommen und wir haben uns sofort angefreundet. Ohne sie hätte ich die letzten Wochen nicht durchgehalten.«
Wir gaben uns die Hand. »Freut mich, Paula.«
»Mich auch.« Sie lächelte und strich sich ihre braunen Haare zurück.
Paula wirkte wirklich sympathisch und es tat gut, hier ein paar Leute kennenzulernen. So fühlte ich mich irgendwie weniger allein.
Elli hatte recht gehabt, das Hühnerfrikassee war echt in Ordnung. Aber wenn sie damit richtig lag, hatte ich schon Angst vor der nächsten Mahlzeit.
Als ich nach dem Essen meinen Blick durch den Raum schweifen ließ, fiel mir ein Junge auf, der abseits von allen saß. Neben seinem Tablett lag ein Notizbuch und er war mehr damit beschäftigt, etwas hineinzuschreiben, als zu essen. Er hatte dunkelblonde Haare und soweit ich sehen konnte, blaue Augen. Man konnte nicht abstreiten, dass er unglaublich gut aussah.
»Das ist Bela«, sagte Elli plötzlich. Anscheinend hatte sie meinen Blick bemerkt.
»Warum sitzt er ganz allein?«
Sie zuckte mit den Schultern. »Er ist ein Einzelgänger. Er sondert sich immer ab. Ich habe ihn noch nie länger als nötig mit jemandem sprechen sehen. Keine Ahnung, warum. Aber er redet kaum und hängt nur über seinem Notizbuch.«
»Was schreibt er da?«
»Ich weiß es nicht.«
»Du bist also doch keine so gute Spionin.«
Sie streckte mir die Zunge raus. »Doch, nur über Bela habe ich noch nichts herausgefunden. Er ist ein Mysterium. Aber zeig mir irgendeinen anderen hier und ich kann dir alles erzählen.«
Ich wollte gar nichts über die anderen wissen. Sie hatten wahrscheinlich keine leichten Schicksale und ich hatte nicht das Recht, etwas über sie zu erfahren, was sie mir nicht freiwillig sagen wollten. Nur Bela machte mich neugierig.
»Nein danke, zeig mir lieber die Klinik.«
Elli sprang auf, als hätte sie nur darauf gewartet. »Auf geht’s!«