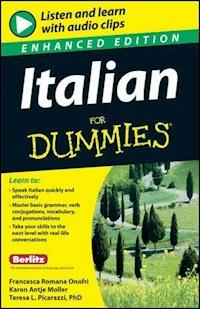9,99 €
Mehr erfahren.
Was wären Eltern ohne Erziehungsweisheiten! Doch was nützen Sätze wie "Kinder brauchen Grenzen" oder "Ein Kind gehört zu seiner Mutter" wirklich? Nicht viel. Julia Heilmann und Thomas Lindemann erzählen wieder amüsant und ehrlich aus ihrem Leben als fünfköpfige Familie und hinterfragen den Gehalt solcher Sprüche. Ihre Ansicht: Das meiste davon ist überflüssig. Stattdessen vertreten sie ein paar unkonventionelle Lösungen, die das Leben wirklich etwas leichter machen. Ein Plädoyer für das nicht perfekte Familienleben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 259
Ähnliche
Julia Heilmann | Thomas Lindemann
Alle Eltern können schlafen lernen
Erziehungsweisheiten auf den Kopf gestellt
Atlantik
Vorwort Julia und Thomas
Zwei Gruppen von Menschen werden sehr früh und sehr laut geweckt, um sich in den täglichen Kampf zu begeben: Soldaten – und Eltern. In unserer Familie herrscht am Morgen am Frühstückstisch Kampfgetümmel.
Heute haben wir einen Rekord aufgestellt. Es ist gerade mal 6:15 Uhr, und Quinn und Leo, fünf und sieben Jahre alt, streiten sich schon um den roten Kinderstuhl. Leider haben wir in unbedarfteren Zeiten mal einen roten und einen in Birke gekauft und es später bereut. Denn manchmal finden die Jungs den roten attraktiver, manchmal den naturfarbenen. Heute ist also wieder Krieg um den roten angesagt. »Wenn du mich nicht rauflässt, mach ich deine Sachen kaputt«, ruft der Kleine. Der Große hält sich die Ohren zu und skandiert: »La Lala La La La Lalalala Lalala Laaa Dideldideldidel Lalala.« Das ist eine gut funktionierende kindliche Kulturtechnik, um unangenehme Botschaften durch schlichtes Übertönen zunichtezumachen. Unsere Jungs wenden sie gefühlte zehn Mal am Tag an. Manchmal endet das Ganze in einem großartigen Crescendo, in dem beide gemeinsam plärren. Uns Eltern bleibt dann nur noch die undankbare Rolle des »Ich-kann-aber-noch-lauter«-Brüllers. An diesem Morgen übernimmt sie Thomas: Er schreit etwas Unverständliches, das irgendwie das Wort »Schluss« zu enthalten scheint, und schlägt mit der Faust auf den Tisch. Ich schließe das Küchenfenster.
Plötzlich fällt den Kindern etwas anderes ein: »Hunger! Ich hab Hunger!«, ruft Quinn. »Ich auch! Aber ich will als Erster!«, ruft Leo.
Unsere Söhne wollen sich ihr Müsli selbst auftun. Sollen sie. Die Selbständigkeit der Kinder ist zu fördern. Das denke ich vor allem, seit mir eine gute Freundin erzählt hat, ihr sechzehnjähriger Sohn rufe sie noch heute auf der Arbeit an, um zu fragen, was er essen solle (er steht dabei mit dem Handy vor dem offenen Kühlschrank!).
Es raschelt und rieselt. Wie immer schütten sich Leo und Quinn zu viel in die Schalen. Sie gießen Unmengen von Milch nach, essen dann genau drei Löffel und lassen den Rest stehen. Ungezählte Male habe ich sie schon dazu angehalten, den Teller nicht so voll zu machen, lieber noch einmal nachzunehmen, wenn sie hungrig sind. Sogar kleinere Schüsseln habe ich ihnen hingestellt und dachte, das sei ein super Trick. Dass es dennoch nicht klappt, dass die Dinkelflocken, Cornflakes und Rosinen sich wieder über den Rand ergießen und auf den Boden zu den Sushi-Reisresten vom Vortag fallen, kränkt mich. In meiner Wut sage ich: »Esst eure Teller leer. Woanders auf der Welt hungern die Kinder. Die würden sich über euer Müsli freuen.«
Sofort wünsche ich mir, ich hätte meinen Mund gehalten. Dass mein Mann im Vorbeigehen, auf einer Marmeladensemmel kauend, knurrt: »Ach, jetzt kommt die Afrika-Keule!«, macht die Sache nicht besser. Ich habe den ältesten und dümmsten Hut der Erziehungsgeschichte gezogen und jetzt ein schlechtes Gewissen. Keiner muss aus irgendeinem Schuldkomplex heraus den Teller leer essen. Die Jungs gucken mich fragend an. Es sieht nicht so aus, als ob die Botschaft angekommen ist. Sie laufen ins Kinderzimmer und hinterlassen dabei eine Spur klebriger Flocken, die aus ihren Schlafanzügen fallen.
Für uns ist dieses denkwürdige Ereignis Grund, einmal innezuhalten. Woher kommen eigentlich diese seltsamen Erziehungssprüche und Glaubenssätze, in die wir Eltern uns flüchten, wenn es schwierig wird? Und schwierig wird es doch immer? Sätze wie: »So spricht man nicht mit seinem Vater«, »Was auf den Tisch kommt, wird gegessen«, »So was macht man nicht«, »Dann geh halt in eine andere Familie, wenn es dir nicht passt«, »Gleich setzt es was …«
All diese verbalen Ziegelsteine, mit denen wir teilweise erzogen wurden und die in uns noch weiterwirken. Dabei sind sie oft sinnlos. Das Argument »In Afrika hungern die Kinder!« an unserem Frühstückstisch ist schließlich nur ein arg hilfloser Versuch, meine eigene Wut in ein allgemeines Moralisieren umzumünzen und meinem Wort dadurch mehr Gewicht zu verschaffen. Was selbstverständlich nicht funktioniert und mich stinksauer macht. Nicht wegen der Kinder, sondern meinetwegen. Ich muss mir eingestehen, dass ich es gerade nicht im Griff habe. Ich bin mal wieder an einen Punkt gekommen, an dem es argumentativ dünn für mich wird. Und das noch vor sieben Uhr.
Eigentlich sollen uns Regeln und Grundsätze Klarheit in Handlungsbereichen geben, in denen wir unsicher sind. Und es gibt kaum einen, in dem wir so unsicher sind, wie im Umgang mit unseren Kindern. Doch die Erziehungsweisheiten, von denen wir hier sprechen, sind fragwürdige Formeln, die das Nachdenken ersetzen. Wir haben guten Grund, sie zu bezweifeln. Zu Zeiten unserer Großeltern war noch klar, dass Kinder den strengen Anweisungen ihrer Eltern Folge zu leisten haben. Auch in vielen Familien, in denen das nicht mit Gewalt durchgesetzt wurde, war der Vater ein Patriarch und die Mutter eine Eiskönigin. Vor ungefähr dreißig Jahren galt dann plötzlich das Gegenteil. Der Satz »Wir sind wie Freunde« bestimmte in zahlreichen Familien das Verhältnis von Eltern und Kindern. Heute weiß keiner mehr, was gilt.
Ein Freund, dessen Frau schwanger ist, sagte neulich den bemerkenswerten Satz: »Also, ich will schon, dass mein Kind mir später gehorcht.« Das entspricht in etwa dem, was uns als Dreifacheltern das gesellschaftliche Umfeld signalisiert: »Ihr Eltern von heute diskutiert einfach zu viel mit euren Kindern!« Oder: »Das hätte es bei uns früher nicht gegeben!«
Oft ernten wir genervte, entsetzte oder amüsierte Blicke, wenn wir auf offener Straße unsere Kinder mit einer Mischung aus Wut und Angst anschreien, weil sie beim Überqueren der Straße nicht geguckt haben, oder wenn sie sich mit hochrotem Kopf auf den Boden des Supermarktes werfen, weil wir nicht bereit sind, die Pops mit der Actionfigur zu kaufen.
Beim Elternabend in der Kita erklärt uns eine Polizistin, wie sich die Kinder gegenüber Fremden verhalten sollen, wenn sie belästigt werden. Sie sollen laut rufen, dass man sie in Ruhe lassen möge. Eine Mutter gibt zu bedenken, dass sie diese Situation tagtäglich mit ihrem Jüngsten auf der Straße erlebe. Wie soll sie sich als Mutter denn da in der Öffentlichkeit vor Missverständnissen schützen?
Thomas und ich halten uns für moderne Eltern und verfallen dennoch gelegentlich in ein pädagogisches Denken, das wir eigentlich rückständig finden. Eltern müssen sich permanent neu erfinden. Ohrfeigen und der berüchtigte »Klaps« auf den Po sind out. Wir sind heute bereit, uns in unsere Kinder hineinzuversetzen, Widerspruch zuzulassen. Das hat zur Folge, dass die Kleinen keine Angst vor körperlicher Züchtigung haben müssen, dass sie sich ernst genommen fühlen dürfen. Aber auch, dass sie uns manchmal nicht zuhören oder gar argumentativ überlegen sind. Leo mit seinen sieben Jahren kann inzwischen hervorragend unseren Tonfall nachahmen. Wenn wir ihn ermahnen, sein Zimmer aufzuräumen, dann kann es sein, dass er die Arme vor der Brust verschränkt und sagt: »Ja, sooo schon gar nicht.«
Über all dem Suchen nach einer klaren Erziehungslinie jenseits von Strenge oder Strafen scheinen wir Eltern manchmal, siehe oben, uneindeutig zu kommunizieren. Wie oft lavieren wir uns mit haltlosen Ermahnungen durch den Alltag mit unseren Kindern. Eine Freundin formulierte es so: »Wir wollen nicht mehr autoritär sein, aber trotzdem sollen die Kinder machen, was wir sagen.«
Ein eindeutiges Ja oder Nein erfordert eben auch eine klare Haltung zu den Dingen. Wenn wir nicht wissen, ob wir etwas erlauben wollen oder nicht und warum, dann flüchten wir uns in leere Phrasen. Dann antworten wir auf die Frage »Kann ich Gummibärchen?« nicht mit ja oder nein, sondern: »Aber du hattest doch heute schon so viele.« Für Leo ist das Anlass, in ein nervtötendes Aber-ich-hab-doch-erst-und-überhaupt-Genörgel zu verfallen. Und schon sind wir mitten in einer Diskussion, die wir gar nicht führen wollten. »Zucker ist nicht gesund für dich« interessiert niemanden. Einfach nur »Nein« ist wohl doch besser.
Wir müssen damit klarkommen: Es gibt keine einfachen Rezepte, die die Erziehung regeln. Als Eltern müssen wir uns die Frage nach unseren Grundsätzen immer wieder neu stellen. Auf den folgenden Seiten wollen wir das tun. Wir haben uns die gängigen Erziehungsweisheiten vorgenommen und uns gefragt, ob wir eigentlich richtig handeln.
Wie alle Eltern haben wir mit der Kindererziehung bei null begonnen, wir haben das nirgends gelernt und sind weit davon entfernt, Profis zu sein. Aber wir haben über die Jahre hinweg aus der tagtäglichen Auseinandersetzung mit den Kleinen gelernt. Wir haben uns Elternratgeber vorgenommen, Expertengespräche mit Therapeuten, Erziehungsberatern und anderen Eltern geführt. Manches davon war nutzlos, so auch die meisten Ratgeber. »Erziehungsweisheiten auf den Kopf stellen« heißt hier nun auch, Erziehung noch einmal neu zu denken. Ohne staubige Klischees und mit der Bereitschaft, sich in eine Aufgabe zu stürzen, an der man auch immer wieder scheitert. Das macht aber nichts. Der Wille, seine Erziehungsmaximen stets neu zu überprüfen, zählt. Und jetzt noch eine gute Nachricht: Das kann sogar Spaß machen.
Kapitel 1 »Lass das mal schreien, das stärkt die Lungen.« Julia
Sprüche von vorgestern und wie wir kreativ damit umgehen.
Erziehungsweisheiten begleiten uns von der ersten Minute unseres Elternseins an. Und es werden, so lehrt uns die Erfahrung, über die Jahre nicht weniger. Sie haben immer etwas Übergriffiges und verursachen schlechte Gefühle. Sind es zunächst mehr die Klassiker zur Säuglingspflege (»Du stillst immer noch? Wird dein Baby denn davon satt?«), kommen später die zur Fremdbetreuung (»Ein Kind gehört zu seiner Mutter«) hinzu. Spätestens ab Beginn der Trotzphase wird der Ton Außenstehender schärfer. Denn da, sagen wir etwa ab vier Jahren, fangen Kinder ziemlich gezielt an, sich zu verweigern und zu provozieren, kurz: sich »unmöglich« zu benehmen. Viele Erwachsene können damit gar nicht gut umgehen und packen ihre Ansichten dann in Formulierungen, die gern das Wörtchen »muss« in sich tragen: »Das muss er jetzt aber mal lernen«, »das muss jetzt aber mal funktionieren«. »Das würde ich mir von meinem Kind nicht bieten lassen!« ist so eine verbale Tretmine, die Thomas und mich schon öfter eiskalt erwischt hat.
Viele Sprüche gehen uns Eltern direkt unter die Haut und verunsichern uns zutiefst. Vor allem, wenn wir noch keine alten Hasen sind, sondern vielleicht das erste Kind haben. Ihre zerstörerische Wirkung entfaltet sich oft erst Jahre nachdem sie das erste Mal gefallen sind. Dazu gehören nicht nur Sätze wie »In dem Alter müsste er/sie das aber schon können«, sondern vor allem auch das, was man landläufig in Erziehungsratgebern liest. Da steht dann in schöner Regelmäßigkeit: »Vertrauen Sie Ihrem Bauchgefühl« oder »Kinder brauchen Grenzen«. Man liest diese Sätze so oft, bis man wirklich denkt, sie seien wahr. Und wundert sich, dass man mit ihnen im wirklichen Leben nichts anfangen kann, weil Grenzen und Bauchgefühl so schwammige Begriffe sind. Bis ich gemerkt habe, dass viele pädagogische Handreichungen nur gut klingen, aber eigentlich nichts bedeuten, hat es lange gedauert.
Manche Sprüche wirken so hoffnungslos veraltet, dass man sich erst einmal nur wundert, wenn sie auch noch im 21. Jahrhundert fallen. Zum Beispiel der von meiner Großtante Käthe. Als Leo gerade ein paar Tage auf der Welt ist, telefonieren wir miteinander. Statt einer Gratulation hat Käthe folgenden guten Rat parat: »Wenn er schreit, dann nicht gleich hinrennen! Ruhig mal ein bisschen schreien lassen. Das stärkt die Lungen.«
Als Thomas und ich die Idee zu diesem Buch entwickelten, kam gleich Kritik von Jeanne, einer Kollegin: Diese Sprüche, die noch aus der schwarzen Pädagogik stammten, würde doch heutzutage eh keiner mehr ernst nehmen. Es ist aber nicht nur eine bizarre Spielerei, sondern durchaus lohnend, für ein paar Minuten über Sätze wie diesen von Käthe nachzudenken. Wörter wie »stählen« lassen mich persönlich innerlich aufheulen. »Abhärten« oder »kräftigen« geht auch nicht, das erinnert mich an Ernst Jünger, den Weltkriegs-Schriftsteller, der im tiefsten Winter seine Eisbäder nahm. So etwas kommt mir nun wirklich nicht zeitgemäß vor. Dann schon eher »zu einem Leistungsträger von morgen heranziehen«. Schon sehe ich mich in einer Doku über ehrgeizige Mütter sitzen und sagen: »Ich möchte nur das Beste für mein Kind. Und ich will es fit machen, damit es später mal auf dem Arbeitsmarkt besteht. Daher lasse ich mein Baby schreien.« Da soll noch jemand sagen, dass der uralte Spruch nichts mit dem Zeitgeist zu tun hat!
Aber mal im Ernst: Man könnte die Lungen einfach sinnbildlich verstehen. Das Kind soll gleich mal merken, dass Mutti nicht immer springt, sobald es quakt. Und nach sieben Jahren Kindererziehung würde ich frisch heraus sagen: Da ist durchaus was Wahres dran.
Wissen es die Franzosen besser?
In ihrem Buch Warum französische Kinder keine Nervensägen sind schildert die in Paris lebende New Yorkerin Pamela Druckerman, dass man in unserem Nachbarland bereits Babys ein kleines bisschen warten lässt, wenn sie weinen. Französische Kinder würden so von klein auf lernen, dass es sich lohnt, Geduld zu haben. Sie schliefen nach drei Monaten durch, könnten sich später bei Tisch besser benehmen und ließen ihre Eltern stets ausreden. Sie hätten gelernt zu warten, bis sie dran sind. Offenbar traut man dort schon den Babys zu, das zu verstehen. Im Gegensatz zu uns. Als wir neulich unseren Jungs zu erklären versuchten, dass wir wenigstens einmal am Tag einen Satz zu Ende reden wollen, ohne dass uns einer von ihnen ins Wort fällt, guckten sie uns an wie die Schimpansen im Zoo.
Zumindest in meinem Umfeld ist die Ansicht, man solle die Kleinen »ruhig mal ein bisschen schreien lassen«, äußerst unpopulär. In der Wissenschaft heute übrigens auch. Die von der Autorin beschriebenen Folgen übertriebener elterlicher Fürsorge sind fürchterlich und erinnern uns schmerzhaft an eigene Erfahrungen. Als Expat in Paris merkt Druckerman sehr schnell, dass ihr Kind anders ist als die französischen. Etwa im Restaurant: »Bean (ihre kleine Tochter) interessiert sich nur am Rande für Essbares. Es dauert nur wenige Minuten, und sie beginnt, Salzstreuer umzuwerfen oder Zuckertütchen aufzureißen … Unsere Strategie besteht darin, möglichst schnell zu essen. Wir bestellen schon, bevor man uns einen Platz zugewiesen hat, und flehen den Kellner an, uns rasch etwas Brot und unser Essen zu bringen – Vorspeise und Hauptgericht bitte gleichzeitig.«
Da kann ich nur lachen. Immerhin geht Druckerman noch ins Restaurant. Wir laden noch nicht mal mehr Leute zu uns nach Hause ein.
Maja, meine Jüngste, ist wesentlich ausgeglichener als ihre beiden großen Brüder. Ob es vielleicht daran liegt, dass ich im Alltag mit drei Kindern nicht immer sofort auf sie eingehen kann? Und dass ich insgesamt wesentlich gelassener auf ihr Quengeln reagiere als damals bei meinem Erstgeborenen Leo (der übrigens nach wie vor der Oberschreihals der Familie ist)? Mag sein. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich sie bewusst und lange weinen lasse, so wie es Käthes Spruch nahelegt. Das wäre für mich einfach nur grobe Vernachlässigung.
Leider gelingt es mir selten, gelassen zu bleiben, wenn selbsternannte Tugendwächter mit allen zehn Fingern in Richtung meiner Sippe zeigen und sich über das Verhalten meiner Kinder erregen. Auch wenn bisweilen ein wahrer Kern in diesen Erziehungsmantras steckt: Es schwingt doch immer das unangenehme Gefühl mit, der andere wisse es besser und bloßes Befolgen seiner Ratschläge bringe Ordnung, Frieden und wohlerzogene Kinder hervor. Kommt dann noch der Vorwurf: »Ihr Eltern diskutiert heute viel zu viel mit euren Kindern! Die tanzen euch ja auf der Nase herum«, dann bin ich vollends bedient.
Interessanterweise steckt in diesen Sprüchen ja überwiegend die Forderung nach mehr Strenge und mehr Disziplin. Der Appell, wir sollten weniger mit unseren Kindern reden, sondern mehr regeln, greift meiner Meinung nach aber zu kurz und ist mit einem friedvollen Familienalltag nicht zu vereinbaren. Diskussion, gleichbedeutend mit Umgang auf Augenhöhe, bedeutet ja nicht, dass man die Kinder machen lässt, was sie wollen. Dass man nicht Verantwortung für das Wohlergehen seiner Kinder übernimmt. Im Gegenteil: Wir als Eltern verstehen darunter einen achtsamen, respektvollen Umgang miteinander. Wir versuchen, in Kontakt mit unseren Kindern zu bleiben, ihnen Orientierung zu geben.
»Ich bin der König hier«, ruft Thomas neuerdings immer, wenn die Kinder sauer über eine seiner gefürchteten Ansagen sind. So etwa: »Ab ins Bett. Aber vorher räumt ihr noch euer Zimmer auf!« Dann kniet er sich mitten rein ins Chaos aus Legoteilen, Spielzeugautos und Malbüchern und hilft mit. Er sagt: »Aber ihr habt Glück, denn ich bin ein guter König.«
Kapitel 2 »So spricht man nicht mit seinem Vater!« Thomas
Oder doch. Schimpfwörter benutzen – das dürfen Kinder nicht? Unsinn. Dürfen sie sehr wohl, müssen sie sogar.
Wir stellen zusammen Familienregeln auf. Ein Fünfjähriger sieht das so: »Papa nicht anschreien, wenn er mit am Tisch sitzt.«
»Und keine Sachen im Zimmer rumschmeißen!«
Ich sitze im Kindercafé. Diese Orte, die es inzwischen überall in Deutschland gibt, sind gefährliche Orte. Dabei ist ihre Idee auf den ersten Blick schön: große Cafés mit Spielecken, manchmal Klettergerüsten oder kleinen Rutschen, und die Eltern können dennoch an ganz normalen Kaffeetischen ihren Milchschaum schlürfen, Ciabatta Caprese futtern und an ihren Handys rumspielen, als seien sie normale Teilnehmer am Sozialleben.
Aber in Wirklichkeit sind diese Orte eben doch gefährlich. Man darf sich von den Blümchentapeten, den auf antik gemachten Stühlen und den gesund wirkenden Säften nicht täuschen lassen. Das Kindercafé ist Kriegsgebiet. Der kritische Blick dräut überall. Hier sitzen im Wesentlichen Frauen, die eigentlich gern woanders wären, und die wegen ihrer Jobsituation (keiner mehr) und wegen ihres Bauchs (immer noch einer, wieso bleibt der so lange?) und manchmal auch wegen des Partners (oft genug leider: keiner mehr) total gereizt sind. Um diese Kundschaft weiter zu zermürben, stellen die Betreiberinnen von Kindercafés immer sehr gut aussehende, schlanke und garantiert kinderlose Bedienungen ein. Da steht dann eine hochgewachsene Frau mit schwarzer Haut, perfektem Afro und Designerklamotten Größe 36 und lächelt die verschwitzten Mütter mitleidig an, wenn sie ihnen den koffeinfreien Latte serviert.
Eine falsche Bewegung im Kindercafé, und du bist tot. Bloß kein Kind anrempeln, egal wie heftig und rücksichtslos es dich geschubst hat, bloß nicht zu lange auf den Bauch einer Mutter starren und keinesfalls laut ein Gespräch führen, das eine junge Mutter beleidigen könnte. Etwa, indem es sie an das erinnert, was sie gerade verpasst und vermisst. Das alles nicht. Falsch wäre: »In den Bars hat ja der Hugo, diese Mischung aus Sekt, Holundersirup und Minzblatt, plötzlich den Spritz, den Weißwein-Mineralwasser-Aperol, als Szenegetränk abgelöst. Seltsam, weil der neue Trenddrink ja eigentlich gar nicht schmeckt.« Lieber so: »Ich mische nachts immer die Fläschchenmilch an, weil meine Frau ja auch mal durchschlafen will. Bin aber ehrlich gesagt total müde und zu nichts mehr zu gebrauchen deswegen.«
Kampfzone Kindercafé
Ich sitze also im Kindercafé, weil ich zwei Freundinnen mal wiedersehen will, die inzwischen auch Kinder haben. Katja hat ihre kleine Tochter auf dem Arm, sechs Monate ist die alt und steckt in einem süßen weißen Kleid. Ich kenne Katja von Partys, diese Lebensphase ist bei ihr lange vorbei. Sie hat jetzt ein Haus auf dem Land mit ihrem Mann, der fürs Finanzministerium arbeitet. Dann ist noch Anja dabei, die früher Schauspielerin war und wegen der Kinder die Karriere aufgegeben hat. Ihre Zehnjährige gibt mir brav die Hand, sagt Guten Tag und verschwindet mit einem Comic in eine Ecke. Anja sagt etwas von »katholischer Erziehung«, was ich nicht genau verstehe – wegen des Schocks darüber, dass Kinder sich höflich benehmen können, habe ich kurz etwas Ohrensausen bekommen. Ihr zweijähriger Sohn löffelt einen Joghurt und ist nicht – ich wiederhole: nicht! – bekleckert. Das kann ja heiter werden. Ich habe nur die älteren zwei Drittel meiner Kinderschar dabei. Die Jungs verschwinden sofort ins Klettergerüst, grußlos natürlich.
Nachdem wir zweieinhalb Minuten über alte Zeiten geplaudert haben, ziehen meine beiden Söhne auf Dreirädern langsam an uns vorbei. Das läuft so ab:
Leo: »Papa, können wir Kuchen? Oder Eis? Oder beides?«
Ich: »Mal sehen, kümmere mich in drei Minuten drum, erst mal wollen die Erwachsenen ein bisschen reden.«
Leo, wütend: »Kacke! Du Furzkanone!«
Quinn, der hinter ihm rollt, beiläufig: »Ja, du pupst eben immer so viel.«
Leo, schon weit weg, richtig erbost: »Ich finde das beschissen.«
Damit bin ich dann bei meinen beiden Freundinnen schon als Versager abgestempelt, eigentlich meine ich in ihren Gesichtern sogar ehrliche Bestürzung und Geringschätzung zu lesen. Ich hätte im Prinzip auch gleich sagen können: »Leute, wir haben mal zusammen studiert und große Pläne gehabt, aber heute wohne ich in einer ganz besonders hässlichen Plattenbausiedlung, trage den ganzen Tag lang einen Jogginganzug, trinke Dosenbier und schlage meine Frau. Macht doch nix, oder?«
Das größte Problem am Schimpfwort ist der fremde Papa oder die fremde Mama, die es hört. Als Mutter oder Vater gibt man schon viel von seinen Vorstellungen auf, wie alles zu wirken und auszusehen habe. Aber ein ganz klein wenig Fassade möchte ich doch noch behalten. Ich hab mir eigentlich erhofft, mein Sohn würde auf mich zukommen und sagen: »Papi, dürfen wir bitte eine kleine Kugel Eis? Nein, jetzt noch nicht? Na, das macht nichts, dann spiele ich still weiter und frage später noch einmal.« Stattdessen verzieht er das Gesicht, feuert das Spielzeug, das er gerade in der Hand hält, mit Schmackes in eine entlegene Ecke und ruft: »Du hinterlistiger SACK!«
Nun sind wir heute – dank des allgemeinen Konservativismus und des Elite-Internat-Leiters Bernhard Bueb mit seinem Bestseller über Disziplin – wieder ein bisschen auf dem Trip, dass Kinder gehorchen sollten und der antiautoritäre Weg vielleicht doch in die Irre geführt habe. Kein Mensch hat sich ernsthaft mit den Grundsätzen der antiautoritären Erziehung befasst, die selbstverständlich auch nicht ganz so dumm sind – es geht einfach die vage Vorstellung um, ein bisschen Zucht und Ordnung sei eventuell doch ganz gut.
Für eine gewisse Entspannung in der Erziehung dürfte es sorgen, die Dinge leichter zu nehmen. Selbst die Beleidigungen durch den lieben Nachwuchs. Man denke an die schöne Kolumne von Max Goldt, in der er beschreibt, wie ein mauliger Teenager ins Wohnzimmer zu seinen sozialdemokratisch eingestellten, sensiblen Eltern kommt und sagt: »Ihr sollt alle sterben!« Darauf: betretene Gesichter, Ratlosigkeit, bittere Tränen! Dabei wäre, so Goldt, die einzig richtige Antwort gewesen: »Stirb doch selbst!« Und dann weiter fernsehen.
Als Knigge wegen schlechten Benehmens rausflog
Wenn man aber näher hinsieht, ist die strenge, militärisch effektive Erziehung oft nicht das, was sie zu sein scheint. Selbst Adolph Freiherr Knigge, der heute als Urvater aller Benimmbücher gilt, verlor 1772 seinen Job als Hofjunker und Assessor zu Kassel, nachdem er sich durch »gesellige Misshelligkeiten unmöglich« gemacht hatte. Er hatte sich nicht angemessen benommen. Seine Bücher, von denen man heute eine ganz falsche Vorstellung hat, sind eher eine etwas hemdsärmelige praktische Sozialpsychologie. Zum Thema Züchtigung bei Regelübertretungen – wie etwa Schimpfwörtern – durch das Kind sagt er: »Erniedrige dich aber nie so weit, dass du dich durch Hitze zu gewaltsamen Behandlungen verleiten ließest; sonst hast du schon zur Hälfte Unrecht.« Schon vor 250 Jahren war es eigentlich nicht cool, auszuflippen und wütend zu werden, wenn das eigene Kind nicht tat, wie wir wollten.
Es gibt natürlich einen guten Grund, sich gegen die Invektiven und Beleidigungen zu wehren: wenn man davon verletzt ist. Wer sich mies damit fühlt, sollte sich wehren – ist das nicht allgemein ein Grundsatz im Leben? Ich habe meinen Kindern mehrfach geduldig erklärt, dass manche Worte mich dann doch ärgern und letztlich traurig machen und ich sie einfach nicht hören will. Ob sie es kapiert haben, steht in den Sternen. Aber wir haben dann angefangen, verbotene und erlaubte Schimpfwörter zu unterscheiden. Akribisch zu unterscheiden, in langen Listen. In zähen Verhandlungen. Ich musste auch ein paar erlauben, die ich lieber verboten hätte. Er darf mich »Blödmann« nennen. Das finde ich okay. Durchgekommen ist er mit »Knallkopf«, obwohl es mir nicht recht schmeckt. Oft schreiben wir auf einen Zettel, was man alles nicht sagen darf, dann wird gelacht und gekichert. Mein großer Sohn hat so das Schreiben gelernt – mit einer Begeisterung, die anhand der Fibel und ihrem »Das ist Bert. Bert ist ein Boxer. Bert hat rosa Handschuhe« nicht ganz so gegeben gewesen wäre.
Ich habe für die Kinder auch ein Pipi-Kacka-Verbotene-Wörter-Lied mit Gitarrenbegleitung geschrieben. Singen wir es, bekomme ich immer die volle Aufmerksamkeit. Und wenn die Jungs jetzt meckern wollen, denken sie sich exotische Flüche aus wie:
Du Regenrinne mit lauter Löchern drin!
Du gerade Banane!
Leere Tüte!
Eine der schönsten Familienerfindungen ist der Schimpfwort-Eimer geworden, dessen Etablierung von den Kindern mit strahlenden Gesichtern angenommen wurde. Ein Papierkorb, der in einer Ecke der Wohnung steht. Wer muss, darf hingehen und alle bösen, auch verbotenen Wörter hineinschreien. Und dann ist gut. Und ist es auch wirklich.
Mir hat das möglich gemacht, auch die Schönheit des wohlüberlegten Maledictums zu würdigen. Als Leo einmal total sauer ist, weil ich weder Tim und Struppi vorlesen noch Lego spielen mag und stattdessen auf die Zubettgehzeit halb neun bestehe, obwohl er noch voller Energie steckt, ruft er: »Du bist der Matrose, der bestimmt, dass du immer in die Hose kackst und einpullerst.« Nichts davon hat einen Bezug zu unserem bisherigen Gespräch, kein Mensch weiß, wie er auf den Matrosen kommt, der kindliche Dadaismus brach mal wieder hervor. Kurzes Nachdenken lässt mich denken: Hut ab! Ich bin also ein Matrose und gleichzeitig derjenige, der dafür sorgt, dass ich selbst der Peinlichkeit ausgesetzt werde. Das ist ausgeklügelte soziale Dialektik. Auch Sprüche wie »Bei dir knallts wohl hinten in der Hose drin!« kann ich akzeptieren, allein schon, weil ebenfalls nicht ganz abwegig. Und ein bisschen lustig.
Außerdem grinst Leo dann schief dabei, und oft ist die Wut über das, was voranging, damit verflogen.
Das Schimpfwort ist wohl eine große Leistung der Zivilisation. Irgendwann haben die Neandertaler aufgehört, sich wegen jeder Kleinigkeit die Köpfe einzuschlagen. Das war der Moment, als einer von ihnen sagte: »Ach, leck mich doch am Arsch«, und einfach wegging.
Das Schimpfwort, der Fluch, die Schmähung, sie alle können auch hübsche Instrumente im Dienste der Wahrheit sein. Abends gehe ich mit Quinn, den ich im Winter vom Fußball aus der Halle abgeholt habe, über einen Platz, und wir kommen an einem Glühweinzelt vorbei. Plötzlich springt der Kleine kurz in die Tür und brüllt »Ihr besofft euch doch alle!« hinein. Ich bin dann vorsichtshalber etwas schneller gegangen, auch wenn der Glühwein die Bürohengste sicher schon etwas träge gemacht haben dürfte. Lachen musste ich aber schon.
An all das denke ich jetzt auch im Kindercafé und fühle mich gleich nicht mehr ganz so idiotisch. Wie oft, wenn ich es schaffe, cool zu bleiben, belohnt der Weltgeist mich hinterher. Denn beim Verlassen des Cafés werde ich noch Zeuge eines interessanten Naturschauspiels. Eine große rothaarige Frau hat mit ihrer Tochter, klein, drall, etwa fünf, offenbar etwas draußen an der Eistheke bestellt. Aber irgendetwas passte nicht. Vielleicht wollte die Kleine drei Kugeln, und Mama spendierte nur eine? Was das Problem war, kann ich nicht in Erfahrung bringen, denn das Mädchen setzt gerade zu dem klassischen Tobsuchtsanfall an. Der großen Katastrophe, die alle Eltern hin und wieder ereilt, vorzugsweise an der Supermarktkasse oder mitten auf einer großen Kreuzung. Oder eben am Eisladen, inmitten der Wartenden. Das Mädchen zerrt an Mamas Ärmel, wirft sich auf den Boden und läuft knallrot an.
Der Exorzist am Eisstand
Die Mutter stammelt etwas von: »Friedi, es reicht jetzt, komm hier weg, da sind noch andere Leute dran.« Aber Friedi windet sich am Boden, grunzt wie das Mädchen aus Der Exorzist und tritt dabei mit den Füßen um sich. Einzelne Schreie stechen aus den Tierlauten hervor: »Du Scheiß-Mama! Ich will dich nicht mehr!« Zum Glück gehen die Kraftausdrücke unter im Schreien und in der Unfähigkeit, sich zu artikulieren. Friedi hat sich in eine Hysterie erster Klasse hineingesteigert und hyperventiliert jetzt praktisch nur noch. Wie eine Irre, man möchte nach der Zwangsjacke rufen.
Mutter packt zu, um das quirlige Bündel wegzutragen. Das klappt so gut, als würde man den berühmten Wackelpudding an die Wand nageln. Die jetzt auch schon keuchende Mutter versucht es zwischendurch mit Sätzen wie: »Dir kauf ich nie wieder ein Eis!« … »Es gibt kein Fernsehen heute Abend!« … »Am Wochenende auch nicht!«
Aber das verhallt natürlich alles ungehört. Beziehungsweise wird es nur von den Umstehenden gehört, den anderen Eltern, die Eis kaufen wollen oder einfach nur in der Sonne vor dem Café sitzen. Doch kein Mensch wagt es, sich über die grandios scheiternde Mutter in Not lustig zu machen. Denn allen ist klar: »Tat twam asi«, wie es in der indischen Philosophie heißt, das bist auch du, nächstes Mal kann es schon dir so gehen. Alle blicken konsterniert und mitleidig drein. Ich bin fasziniert, aber ich glaube, nur kurz, vielleicht muss ich gleich weinen. Inzwischen ist die Mutter dabei, das zappelnde Gör in den Kindersitz am Fahrrad zu quetschen, in den es auch in friedlichem Zustand kaum noch reingepasst hätte. Ein Mann stürzt hinzu, um zu helfen, und kassiert von der Kleinen als erstes eine schallende Watschn. Erst als eine zweite Frau dazukommt und das Fahrrad festhält, gelingt die Löwenbändigung. Der Mutter ist längst alles zu viel, sie kann sich nicht einmal bedanken, murmelt nur noch Dinge wie »nicht nötig!« und »geht schon!« und verschwindet.
Was denkt ein Kinderloser, wenn er so etwas sieht?, frage ich mich. All das Elend, das doch gleichzeitig total normal ist. Ach, egal. Wen interessiert’s. Kinderlose leben auf einem anderen Planeten als wir. Heute Abend gibt es in der Familie des kleinen, wilden Pummelchens jedenfalls kein Fernsehen. Wahrscheinlich gibt es Tränen, wenn Mama sich noch einmal vor Augen führt, wie erniedrigend alles war, und es ihrem Mann erzählt. Und dann werden sie ganz langsam und mühsam vorwärtskommen im Umgang. Das nennt man Erziehung, und so machen wir es alle. Und dass dabei öfter mal »Scheiße, verdammt!« gerufen wird, egal von wem, ist wirklich keine große Überraschung.
Ich habe eben sogar noch etwas gelernt, und zwar noch vor dem katastrophalen Ereignis mit der unwilligen kleinen Eisesserin. Das war so: Nach den Beschimpfungen zerrte ich meinen Sohn am Arm durchs Café, auf der Suche nach einer stillen Ecke, um ihn in Ruhe anmeckern zu können. Er zeterte, klopfte auf meinem Arm herum und kniff mich schmerzhaft in die Brust. »Sag mal, hast du einen schlechten Tag oder was«, rief ich eigentlich eher aufs Geratewohl.
Aber es stimmte: Er berichtete mir dann, dass die Kinder auf dem Schulhof immer »Leo, Löwenzahn, kommt an meine Suppe dran« singen. Außerdem war es ihm alles viel zu laut. Auch hier im Kindercafé war es ihm zu laut. Und er vermisste seine Freunde aus dem Urlaub und wollte wieder dorthin, wo es das schöne Schwimmbad gab. Na gut, dachte ich, da wäre ich auch sauer. Es erinnerte mich an meinen letzten Chef. Ich hab auch manchmal abends meine Frau angemault, weil ich seinetwegen unglücklich war.
Als es ausgesprochen war, lächelte Leo mich an. Kinder sind gar nicht so blöd. Teilweise schlauer als wir selbst.
Kapitel 3 »Ich zähl bis drei …« Julia
Das berüchtigte Runterzählen kennt jeder. Aber eigentlich könnte man auch gleich zur Sache kommen.
Maja sitzt in der Babywippe und schreit. Sie hat Hunger, und ich stehe mit dem dampfenden Brei vor ihr. Leo kniet zwischen uns und macht Faxen. Er streckt Maja die Zunge heraus, singt »Bäh, bäh, bäh«, verdreht die Augen. »Leo«, sage ich genervt, »Maja hat Hunger, lass mich durch, ich möchte sie füttern.« »Ja, ja,«, trällert mein Sohn und macht weiter. »Leo, jetzt!«, ermahne ich ihn. »Gleich!«, ertönt es vom Fußboden. »Leo«, brülle ich jetzt voller Ungeduld. »Ich zähl bis drei, und dann bist du da weg. Eins, zwe-hei, …« Leo steht zögerlich auf. »Drrr …« In letzter Sekunde springt Leo hoch und trollt sich kichernd aufs Sofa.