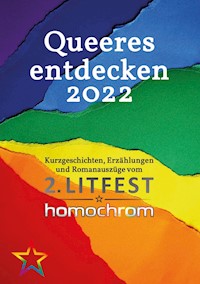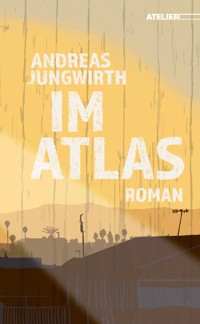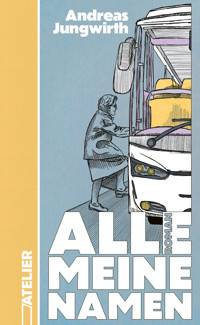
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Atelier
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Schaffst du das?«, fragt Peter. »Natürlich«, sagt Johanna, »ich kann alles, was ein Mann auch kann.« Und das beweist sie schon ihr ganzes Leben lang. Nach diesem Dialog wird Johanna, die gerade ein Kind bekommen hat und ihren an Polio erkrankten Mann Peter pflegt, ein Haus für die Familie bauen. Da ist sie gerade Anfang zwanzig und hat bereits viel erlebt: den Tod des geliebten Vaters und den Umzug aufs Land, den Krieg, Heimweh und Liebeskummer als Dienstmädchen in der Schweiz und die Ausbildung zur Kinderkrankenschwester. Nie hat Johanna den Mut und die Kraft verloren, sich den gesellschaftlichen Konventionen entgegenzusetzen und ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Das tut sie auch noch als alte Frau, deren mitreißende Geschichte noch lange nicht vorbei ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 281
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
ANA
HANNA
JOHNNY
JEANNE
N. N.
JO
JOHANNA
HANS
PETRA
Meine Eltern haben mich Johanna genannt, damit ich ein Leben lang so heiße. Aber im Laufe der vergangenen achtzig Jahre war ich Ana, Hanna, Johnny, Jeanne, Jo und Hans. Diese Namen haben mir andere verpasst, ohne mich zu fragen. Und plötzlich habe ich für alle Welt so geheißen. Peter war der Einzige, der wissen wollte, ob ich einverstanden bin, wenn er Johanna zu mir sagt, so, wie meine Eltern es gewollt haben. Mit Peter bin ich fast fünfzig Jahre verheiratet gewesen. Vor einem halben Jahr ist er gestorben. Seitdem habe ich die Orientierung verloren. Um sie wiederzufinden, erzähle ich meine Geschichte. Auch wenn diese Geschichte ab und zu einen anderen Verlauf nehmen sollte als den, den sie in Wirklichkeit genommen hat, bleibt es meine Geschichte. Und es bleibt die Geschichte von Peter. Und es bleibt eine Liebesgeschichte.
ANA
Der Himmel ist ein blaues Viereck. Gerahmt von den grauen Hausmauern der Anstalt. Oben schwebt eine weiße Wolke. Unten im Hof ist es windstill. Über den Dächern muss ein Sturm brausen. Warum sonst sollte sich die Form der Wolke so rasch verändern? Gerade noch war da ein Schiff. Das Schiff wird zu einem Wal. Der Wal zu einem Vogel mit riesigen Schwingen. Aber noch bevor er einen ersten Flügelschlag tut, zerzaust sein Gefieder schon wieder.
»Wo schaust du denn hin?«, will Marie wissen.
Ana senkt den Kopf und schaut wieder zu dem Mann, der mit einem Hammer in der Rechten auf dem festgestampften Erdboden kniet und mit Geduld einen rostigen Nagel geradeklopft. Schweiß tropft ihm von der Stirn. Erstaunlich dünne Arme hat der und spitze Ellenbogen, eine Glatze und buschige Augenbrauen. Das muss einer von denen sein, die nicht an ein Bett gefesselt liegen, nicht in einem der Zimmer hinter den vergitterten Fenstern bleiben müssen, die nach unten in die Höfe dürfen, die zwar einen Dachschaden haben, aber trotzdem einer nützlichen Beschäftigung nachgehen. Seine kleinen, tief im Schädel liegenden Augen fixieren den Nagel, der auf einem Hackstock liegt. Zeigefinger und Daumen halten ihn fest. Mit jedem Schlag scheint der Nagel sich ein wenig mehr zu strecken, ein wenig länger zu werden.
Kinn und Nase des Mannes sind blutverkrustet.
»Als wäre er gegen eine Mauer gerannt«, überlegt Ana.
»Als hätte ihm jemand eine Faust ins Gesicht geschlagen«, sagt Marie.
Beide wissen, dass sie im letzten der drei Höfe nichts verloren haben. Die Erwachsenen haben es ihnen oft genug gesagt: Dorthin nicht! Dorthin geht ihr nicht! Nicht dorthin! Die beiden scheren sich aber nicht darum. Warum auch? Niemand hat ihnen einen Grund genannt.
»Ist das alles?«, fragt Ana nach einer Weile enttäuscht. »Ein Mann, der Nägel geradeklopft?«
»Siehst du das nicht?« Marie übertreibt ihre Empörung. »Der Nagel ist schon längst gerade und der Mann klopft immer noch.«
Tatsächlich. Warum tut er das?
»Genau, warum tut er das?« Marie klingt, als wüsste sie die Antwort, sagt aber stattdessen: »Jetzt pass auf!« Sie streckt ihren Nacken, bläht ihre Lungen auf und ruft: »Du kannst aufhören, du Depp!«
Augenblicklich lässt der Mann den Hammer sinken, wirft den Nagel in einen Eimer, nimmt den nächsten verbogenen Nagel vom Boden und fängt wieder mit dem Geradeklopfen an.
»Und jetzt du!«
Ana zögert.
»Probier es!«, verlangt Marie »Oder traust du dich etwa nicht?«
Also gut. Anas Herz klopft schneller, schließlich holt sie tief Luft, dann schreit auch sie: »Aufhören!«
»Du Depp«, flüstert Marie ihr zu. »Mach schon!«
Und Ana echot mit Inbrunst: »Du Depp!«
Und der Mann hält tatsächlich inne, lässt den Hammer sinken und der rostige Nagel fällt mit einem leisen Pling zu den anderen in den Eimer.
Aber was tut der Mann, wenn er alleine ist? Drischt er dann den ganzen Tag und die ganze Nacht mit dem Hammer auf immer denselben Nagel ein?
»Wäre dem Deppen zuzutrauen«, ist Marie überzeugt.
Vielleicht. Ana zuckt mit den Schultern. Sie kann es sich bloß nicht vorstellen, warum jemand etwas so Nutzloses tun sollte.
Vor dem Trakt mit den Dienstwohnungen lehnen große, schlanke Soldaten mit kantigen Gesichtern, in grauen Uniformen, eine Hand in der Hüfte, wie verbogene Nägel. In ihren Mundwinkeln hängen Zigaretten, die stinken und fressen sich selbst auf. Seit ein paar Wochen sind die Männer nun schon in der Anstalt einquartiert. Am Anfang haben die Bewohner wissen wollen, was das soll, warum hier bei ihnen, warum nicht woanders? Aber immer mehr Patienten waren über Nacht sang- und klanglos verschwunden, immer mehr Angestellte in den Krieg gezogen. Zimmer, ganze Wohnungen standen leer. Aber werden wir so nicht zum Ziel des Feindes? Wird der Feind nicht wegen der Soldaten Bomben auf uns werfen? Als dann aber wochenlang nichts dergleichen geschehen ist, haben sich die Leute an die Anwesenheit der jungen Männer gewöhnt. Und die meiste Zeit lungern die Soldaten ohnehin nur schweigend herum, als würden sie nichts anderes zu tun haben, als drauf zu warten, dass die Zeit vergeht, dass der Krieg vergeht.
»Die Soldaten werden uns den Kopf abreißen, weil wir im verbotenen Hof gewesen sind.«
»Pff!«, faucht Marie. »Mir reißt niemand den Kopf ab.« Sie verschränkt die Arme vor der Brust.
»Wartet doch mal!« Sie haben den Dünnsten zu ihnen herübergeschickt, dessen Uniform um seinen knochigen Körper flattert. »Ich will mit euch …!« Der Soldat schiebt die Lippen hin und her, als wöge er die Worte ab, als gäbe es da noch andere, bessere als die, die ihm als Erstes eingefallen sind. »Wie heißt ihr …?«
Und während Ana noch überlegt, ob sie die Frage eines Soldaten nach ihrem Namen mit Johanna beantworten muss, ihrem Taufnamen, oder mit Ana, wie sie von allen genannt wird, weil ihr Bruder Otto, als er ein Jahr gewesen ist, Johanna nicht hat aussprechen können, platzt Marie heraus: »Ich bin ich!«
Die Blicke des Soldaten hüpfen ein paarmal zwischen Marie und Ana hin und her.
»Und deine Mutter …?« Der Soldat unterbricht sich abermals, setzt kurz darauf erneut an: »Wo ist er, dein Vater?«
Wessen Mutter? Wessen Vater? Ana schließt die Augen und überlässt ihm die Entscheidung.
»Du bist gemeint!«
Natürlich! Maries Mutter! Maries Vater. Wie hat sie nur einen Augenblick lang glauben können, dass der Soldat sich für ihre Eltern interessieren würde. Dabei sind es doch nur die Kleider, die Frisur, die Hüte mit den Fasanenfedern, die Maries Mutter zu dem machen, was sie darstellt. Wenn man ihr das alles wegnehmen würde, bliebe von der Frau Primar nicht viel mehr übrig als mit Stroh gefüllte Gliedmaßen, ist der Vater überzeugt.
»Deine Mutter«, unterbricht der Soldat Anas Überlegungen. »Wie heißt sie?«
Ana öffnet die Augen. Er zeigt auf sie. Ihr bleibt der Mund offen stehen. Marie verdreht die Augen, als wäre es Anas Schuld, dass der Soldat sich nach ihrer und nicht nach Maries Mutter erkundigt hat.
»Marianne«, sagt Ana leise.
»Bist du wahnsinnig?«, flüstert Marie, »ich würde ihm niemals einen Namen verraten, weder meinen eigenen noch den meiner Mutter!«
Aber warum denn nicht? Was soll falsch daran sein?
An diesem Tag im April findet Ana den Vater ausgestreckt auf dem Sofa. Obwohl ihm die Mutter schon oftmals gesagt hat, dass er sich nicht so aufreiben, nicht so aufopfern soll für seine Patienten, kommt der Vater mittags sonst nie von der Station herüber, um sich für eine Stunde aufs Ohr zu legen. Auf Zehenspitzen geht Ana zu ihm, hockt sich auf den Holzboden, dorthin, wo sein Kopf auf einem Kissen ruht. Sie spreizt die Finger zu einem Kamm und frisiert seine schönen, schwarzen, festen Haare. Wie alles am Vater riechen auch seine Haare nach der guten Seife, sie riechen nach Minze und Sandelholz. Der Vater öffnet und schließt die Augen gleich wieder, als hätte er nur sichergehen wollen, welches der beiden Kinder ihn kämmt – Ana oder Otto.
Als die Mutter zum Essen ruft, zerrt Ana am Vater, bis er sich endlich aufsetzt.
Über dem Esstisch hängt das Bild des Führers, im Winkel der Eckbank ein Kreuz. Die Mutter faltet ihre Hände, Ana tut es ihr gleich. Otto muss zweimal und auch noch ein drittes Mal von der Mutter zum Händefalten aufgefordert werden. Schließlich verknotet er die Finger zu einem wilden Durcheinander. Komm, Herr Jesu, sei unser Gast, und segne, was du uns bescheret hast. Zwei Kinderstimmen und die Stimme der Mutter sprechen das Gebet. Der Vater spricht nicht mit. Kaum haben die Mutter und die Kinder zu Ende gesprochen, gibt er zum Besten: »Ich glaube weder an den einen noch an den anderen. Weder an Gott noch an den Führer.«
Otto lacht.
»Seid still«, ermahnt die Mutter die beiden.
»Ich lasse mir den Mund nicht verbieten«, widerspricht der Vater, »nicht in meinen eigenen vier Wänden.«
»Ich auch nicht!«, krakeelt Otto.
»Jetzt ist aber wirklich Schluss!«, befiehlt die Mutter und fixiert Ana: »Und dass du bloß nicht mit der Marie darüber redest! Über nichts, was innerhalb dieser vier Wände gesprochen wird.«
»Mit der rede ich sowieso nie wieder!«, sagt Ana.
»Wieso das denn?« Die Mutter wundert sich.
»Weil sie eine blöde Kuh ist.«
»Umso besser. Und jetzt wird gegessen!«
Es ist ein Donnerstag. An Donnerstagen gibt es Spinat und Spiegeleier. Heute hat die Mutter nur ein Ei bekommen. Das kriegt der Vater. Aber ehe er es essen kann, heulen die Sirenen auf.
Ist der Vater bei Fliegeralarm zu Hause, muss er in den Dienst. Ist er auf der Station, bleibt er dort. In der Wohnung liegt ein Tischtuch bereit, in das die Mutter rasch das Wichtigste verpackt, ein Stück Brot, eine Flasche mit Wasser, Anas Puppe, Ottos Spielzeugauto. Anschließend hebt sie den schreienden Otto in den Wagen, legt ein Brett quer, setzt Ana drauf. Und los geht es. Die anderen Bewohner der Stiege überholen sie, drängen an ihnen vorbei. Alle wissen, die Schnellsten überleben am ehesten. Aber die Mutter kann mit den Kindern und dem Wagen nicht schneller. Jedes Mal kommen sie als Letzte im Keller an. Dort hocken sie dann alle zusammen auf dem Boden, zittern, schwitzen, riechen nach Angst. Früher oder später fangen immer welche zu beten an. Da wird die Angst nicht weniger, sondern noch mehr. Am schlimmsten aber ist es, wenn welche zu singen anfangen, wenn die hohen Stimmen der Frauen durch die Räume wabern.
Im Hof unten hupt es. Einmal, zweimal, dreimal.
»Die Soldaten spinnen wieder einmal«, stöhnt die Mutter, die gerade Kartoffeln schält.
Ana läuft zum Fenster. Den Lärm machen aber gar nicht die Soldaten.
»Es ist der Papa!« Er steht neben dem Mercedes-Benz vom Primar, die rechte Hand an der Hupe, mit der Linken winkt er zu ihr herauf.
»Wir sollen hinunterkommen!«
»Sag ihm, ich bin gerade beim Kochen.«
Der Vater lässt das nicht gelten. »Sag deiner Mutter, sie soll den Herd abstellen, wir essen auswärts. Und zieht euch an, als wär heut ein Feiertag!«, ruft er hinauf.
Eine halbe Stunde später fahren sie am Fluss entlang.
Ana und die Mutter tragen Kleider mit Spitzenkragen, Otto einen dunkelblauen Blazer mit einem aufgestickten Wappen. Er plappert die ganze Zeit. »Ich weiß mehr über Autos als ihr anderen zusammen!«
»Ist dir der Primar etwas schuldig?« Die Mutter wundert sich, dass er ihm den funkelnagelneuen Mercedes-Benz überlassen hat.
Der Vater gibt keine Antwort. Die Mutter hakt nicht nach.
Ana legt die Stirn gegen die kühle Scheibe. Sie fahren auf schmalen, schnurgeraden Straßen zwischen frühlingshaften Mais- und Getreidefeldern hindurch. Und es gibt noch so vieles anderes zu sehen, das Ana sich merken will – die Linien der Landschaft, wie sie sanft auf- und abschwingen, der Wechsel zwischen Wäldern, Wiesen und Feldern.
Als sie nach zwei Stunden Fahrt auf einem Dorfplatz halten, ist der Wagen binnen Kurzem von so vielen Männern, Frauen und Kindern umringt, dass die Türen blockieren und sie nicht aussteigen können. An den Scheiben erscheinen Gesichter, nah und groß. Otto beginnt zu heulen. Keines der Gesichter hat Ana schon einmal gesehen, nur eines kommt ihr bekannt vor. Der Mann hat zwar einen zauseligen Bart, aber die Lippen, die Augen, die Nase: alles genauso wie beim Vater.
»Sagt Guten Tag!«, verlangt der Vater, nachdem sie es doch aus dem Auto geschafft haben.
Das Guten-Tag-Sagen geht ja noch, aber wenn die fremden Menschen am Tisch, um den sie sitzen und Suppe essen, den Mund aufmachen, klingen die Worte so seltsam, als wären sie verdreckt. Manches ist überhaupt gänzlich unverständlich, als hätte der Dreck die Münder der Leute hier vollständig verstopft. Aber die meiste Zeit redet ohnehin der Vater. Er erzählt von der Wohnung, in der sie leben, und von der Arbeit, die er macht. Er erzählt von etwas, das so anders ist als das, was Ana kennt, obwohl sie ja auch in dieser Wohnung lebt und ihren Vater schon öfter auf die Station begleitet hat. Aber so wie der Vater das beschreibt, so ist das alles doch gar nicht. Die Wohnung hat nicht fünf Zimmer, sondern nur zweieinhalb. Den Patienten kann es nicht rundum gut gehen. Würde man sie sonst wie Tiere in vergitterten Betten halten und bis auf den Hof schreien hören? Als Ana ihren Vater auch noch sagen hört, dass er das Auto erst seit einer Woche besitzt, dass es deshalb wie nagelneu aussieht, schießt Lava durch ihre Adern. Die Mutter sitzt mit versteinerter Miene zwischen Ana und Otto und nickt, wenn der Vater sie ansieht. Sagen tut sie zu all dem nichts. Zu Ana hätte sie gesagt: Du sollst nicht lügen! Als Otto meint, er könne diese Suppe unmöglich essen, ohne kotzen zu müssen, streicht sie ihm über die Haare. Er muss sie nicht essen. Zu Hause hätte sie gesagt: Du isst, was auf den Tisch kommt. Ana kennt sich vorne und hinten nicht mehr aus. Als sie am späten Nachmittag das Dorf wieder verlassen, verlautbart Otto, dass er dort nie wieder hinwill. Ana will wissen, wer die Leute gewesen sind.
»Der mit dem Bart, das ist der Josef, mein jüngerer Bruder«, erklärt der Vater.
»Warum hast du nie von ihm erzählt?«, fragt Ana.
Der Vater tut, als hätte er die Frage nicht gehört.
Nach einer Weile fängt der Motor zu stottern und zu husten an. Dann bleibt der Wagen mitten auf der Straße liegen. Drei Stunden lang hocken die Mutter, Ana und Otto im Straßengraben und schauen dem Vater beim Reparieren zu. Als der Motor wieder anspringt, hat er schwarze Hände, ein schwarzes Gesicht, sein weißes Hemd ist hinüber. Dem Primar sagt er als Entschuldigung fürs Zuspätkommen, es war Sand im Getriebe.
Während der nächsten Wochen kommt der Vater jeden Tag zur Mittagszeit nach Hause, um sich auszuruhen. Die Kinder haben still zu sein oder in den Hof hinunterzugehen. Nach einer Stunde kehrt der Vater zur Arbeit zurück. Jeden Tag das Gleiche. Bis es an einem Donnerstag im Mai an der Tür klopft. Ana wird von der Mutter zum Aufmachen geschickt. Drei Männer in Uniform stoßen sie zur Seite. Keinen von denen hat sie bisher unter den Soldaten im Hof gesehen. Außerdem tragen sie andere Uniformen, schwarze.
»Kommt her, kommt her!«, ruft die Mutter und zieht Otto und Ana aufs Sofa, umklammert mit der Rechten Anas Hände, mit der Linken Ottos. Sie presst die Knie so fest zusammen, dass dort, wo sie sich berühren, die Haut ganz weiß wird.
Drei Paar Stiefel treten hart auf den Holzdielen auf. Die Männer reißen alle Schränke auf, Schubladen, alles heraus, egal, wo es landet, drehen alles um, sogar die Matratzen. Die Mutter redet auf die Kinder ein, sagt ihnen, dass die Soldaten nur etwas suchen, dass das Ganze ein Spiel sei.
»Ein Versteckspiel?«, fragt Otto.
»Genau«, bestätigt die Mutter und scheint froh, dass Otto ein Wort dafür hat.
Ana hat die ganze Zeit die schwarzen Stiefel im Visier, hohe, anliegende, glänzende Stiefel.
Die Mutter redet immer weiter, ohne Punkt und Komma, irgendwann reiht sie nur noch sinnlos Worte aneinander. Als einer der Männer das Kreuz von der Wand reißt und über dem Knie in Stücke zerbricht, schreit die Mutter auf. Als die Männer wieder abmarschiert sind, will Otto wissen, ob das Spiel jetzt vorbei sei, ob die Soldaten etwas gefunden hätten – wer hat gewonnen und wer verloren? Die Mutter zuckt lediglich mit den Schultern. Sie sieht fertig aus, fertig mit den Nerven, fertig mit der Welt.
»Die waren wegen dem Papa da«, die Worte fallen Ana aus dem Mund, als könnte es gar nicht anders sein, »weil er seinen Bruder angelogen hat, was die Wohnung und die Patienten und das Auto angeht.«
Die Mutter widerspricht auch jetzt nicht.
»Haben die Soldaten Papas Lügen gesucht?«, will Otto wissen.
Die Mutter nickt. »Sie haben aber keine gefunden.«
»Weil er sie so gut versteckt hat?«
»Weil es hier keine Lügen gibt. Weil euer Vater weder den Onkel noch euch noch eure Mutter jemals belogen hat«, sagt sie.
Jetzt hat auch die Mutter gelogen.
Dann schickt sie die Kinder in den Hof hinunter und putzt die Wohnung, wie sie es sonst samstags tut, nur heute putzt sie noch gründlicher, sie schrubbt und bohnert und schleppt immer wieder die Kübel mit dem schmutzigen Wasser in den Hof, schüttet dort das blasenschlagende Wasser aus.
Mitten in der Nacht wacht Ana von Schluchzern in der Küche auf. Sie schaut, ob Otto auch wach ist. Nein, ist er nicht. Ana klettert aus dem Bett, schleicht aus dem Zimmer. Die Mutter sitzt am Tisch und heult Bäche. Sie bemerkt Ana erst, als sie bei ihr steht, schickt sie nicht zurück ins Bett. Ana fasst sich ein Herz, sagt, was sie die ganze Zeit im Hinterkopf gehabt hat: »Die Männer waren nicht hier, weil der Papa den Onkel Josef angelogen hat, oder?«
Die Mutter nickt abwesend. »Sie wissen, dass er weder an den einen noch an den anderen glaubt, weder an Gott noch an den Führer.«
Entgegen ihrem Versprechen hat Ana Marie davon erzählt, und die hat sie daraufhin angesehen, als wäre das unmöglich.
»Und wo ist der Papa jetzt?«
»Sie haben ihn abgeholt«, erklärt die Mutter leise.
»Diese schwarzen Soldaten?«, fragt Ana.
»Die oder andere.«
»Wo haben sie ihn hingebracht?«
»In ein Zimmer ohne Fenster.«
»Warum weißt du das?«
Die Mutter zuckt mit den Schultern. »So stelle ich es mir vor.«
»Dann weißt du es gar nicht?«
Darauf antwortet die Mutter nicht mehr.
»Und was macht der Papa in dem Zimmer, das du dir ohne Fenster vorstellst?«, will Ana wissen.
»Dort reden sie mit ihm.«
»Worüber?«
»Das weiß ich nicht.«
»Aber kannst du dir das nicht vorstellen?«, fragt Ana.
»Ich will es mir nicht vorstellen.«
Das Gespräch läuft noch eine Weile so hin und her, bis die Mutter ihm schließlich ein Ende setzt.
»Du bist noch ein Kind, du solltest das alles überhaupt noch nicht wissen. Geh ins Bett, schließ die Augen und denk über das alles nicht weiter nach!«
Als Ana das nächste Mal aufwacht, scheint die Sonne bereits bis in den hinteren Teil des Zimmers. Aus der Küche sind Stimmen zu hören, vertraute Stimmen, die auch Otto aufgeweckt haben.
»Was ist los?«
»Der Papa ist wieder da«, flüstert Ana und beißt sich im selben Augenblick auf die Lippen.
»War er weg?«
Ana spitzt ihre Ohren. Die Eltern streiten.
»Was reden sie?«
»Wenn du ruhig bist, kann ich’s dir sagen.«
Ana hört, wie die Mutter sagt: »Vielleicht hast du ja laut gedacht.«
»Ich habe auch nicht laut gedacht!«, sagt der Vater.
»Aber sie wissen es. Sie wissen es, dass du weder an den einen noch an den anderen glaubst. Der eine ist ihnen egal. Es kommt ihnen auf den anderen an.«
»Darf ich nicht einmal mehr in meinen eigenen vier Wänden sagen, was ich denke?«, fragt der Vater. »Ist es das, was du von mir verlangst?«
»Bei dir ist immer alles Entweder-oder. Du musst ja nur nach außen hin so tun als ob. Das kann doch nicht so schwer sein!«
»Es ist schwer, nicht zu sagen, dass mir das nicht passt, wenn sie meine Patienten abholen wie Tiere. Dass sie sie zum Schlachten führen!«
»Hör auf!« Die Mutter stockt, dann sagt sie leise: »Tu es für deine Kinder!«
»Nein«, erwidert der Vater energisch. »Für die paar letzten Wochen werde ich mich nicht mehr ändern.«
»Die letzten paar Wochen?«, fragt die Mutter. »Wieso sagst du das?«
»Warum, glaubst du, hat mir der Primar den Wagen geliehen?«
Ana hält die Luft an, als hätte das jetzt mit ihr zu tun.
»Der Primar hat gesagt, es geht noch ein paar Wochen, und wenn du einen Wunsch hast, den ich dir erfüllen kann, dann sag ihn mir.«
»Ach, red keinen Blödsinn«, entgegnet die Mutter. »Red jetzt keinen Blödsinn!«
Daraufhin wird es still in der Küche, so still, dass Ana fürchtet, Vater und Mutter hätten sich in nichts aufgelöst.
»Was ist in ein paar Wochen?«, fragt Otto leise.
»Dann ist der Krieg aus«, antwortet Ana rasch.
Dass der Krieg bald vorbei sein wird, davon ist jetzt überall die Rede. Aber in ihrem Innersten, dort, wo man sich nichts vormachen kann, weiß Ana, dass der Vater nicht vom Krieg gesprochen hat. Aber sie hört nicht auf diese innere Stimme, sie hört die Stimme der Mutter im anderen Zimmer fragen: »Wenn die Kinder etwas gesagt haben?« Dieser Satz fährt wie ein Stachel in Anas Herz. Sie ist es nämlich gewesen, die mit Marie darüber gesprochen hat, und Marie hat es bestimmt aller Welt weitererzählt. Also ist es ihre Schuld, dass die schwarzen Soldaten gekommen sind, die Wohnung auf den Kopf gestellt, den Vater geholt, mit ihm in einem fensterlosen Zimmer geredet haben. Ich, ich, ich, würde Ana am liebsten laut schreien. Ich bin schuld! Und plötzlich ist ihr, als würde ihr Körper verströmen, wie die Luft, die die Wörter in die Welt hinausträgt und sie schließlich verklingen lässt, nicht viel mehr als ein Nachklang bliebe übrig von ihr, eine Erinnerung an etwas, das niemand gehört hat, eine Erinnerung an jemanden, der niemals geboren wurde.
Gegen Mittag bekommt der Vater so hohes Fieber, dass er nicht mehr in die Arbeit gehen kann, weder heute noch an den folgenden Tagen. Manchmal schleicht Ana sich zu ihm, hockt sich neben das Bett, spreizt die Finger zu einem Kamm, greift in seine Haare und versucht, sich in den Geruch der Seife zu verwickeln, in den Geruch nach Minze und Sandelholz. Das aber wird von Tag zu Tag schwieriger. Irgendwann ist da nur noch der scharfe Krankengeruch.
Meist schläft der Vater. Wenn er wach ist, verlangt er nach Wasser. Ana bringt ihm ein Glas, gefüllt bis zum Rand. Er bittet sie, – vorsichtig – einen Schluck zu trinken, sonst würde er es verschütten. Erst trinkt sie, dann trinkt er an derselben Stelle, an der ihre Lippen das Glas berührt haben.
Einmal, als sie das Zimmer betritt, steht der Vater am offenen Fenster, stützt sich mit beiden Händen am Fensterbrett auf, die Finger gespreizt wie Krallen. Er blickt die grauen Mauern der Anstalt hoch, bis in den Himmel. Ana stellt sich neben ihn. Ein Vogelschwarm zieht über ihnen hinweg.
»Das ist alles, was ich noch zu sehen bekomme«, sagt der Vater. »Mauern, Himmel und manchmal Vögel, die in den Süden ziehen, und wenn sie wiederkommen, werde ich nicht mehr sein.«
Der Vater senkt den Kopf und tapst zurück zum Bett, die Arme nach vorne gestreckt, um sich bei nächstbester Gelegenheit festhalten zu können.
Daraufhin liegt der Vater neun Tage lang im Delirium, fiebert, redet, jetzt mit einer hohen Stimme wie der eines Kindes. Was er redet, das kann man nicht mehr ernst nehmen. Der Primar kommt am Vormittag und am Nachmittag und manchmal sogar nachts. Die Mutter sitzt am Bett des Vaters, starr und wortlos, sie vergisst darauf, Essen für die Kinder zu machen, und die Nachbarn stellen etwas Warmes vor die Tür. Dann redet der Vater gar nichts mehr, das Fieber lässt nach, schließlich ist es vorbei. Das Fieber. Seine Kraft. Vaters Leben. Die Mutter öffnet die Fenster. Es kommen fremde Leute in die Wohnung, die Kinder werden in den Hof geschickt.
Er ist gegangen, sagen die Leute.
»Und wo ist er jetzt?«, fragt Otto.
»Es stimmt nicht, was die Leute sagen«, behauptet Ana. »Er ist noch da. Willst du ihn sehen?«
Otto wirft sich auf den Boden, strampelt mit den Füßen und schreit.
»Er sieht aus, als würde er schlafen«, versucht die Mutter ihn zu beruhigen, redet sanft auf ihn ein, setzt sich zu ihm auf den Boden.
Nichts hilft. Otto weigert sich.
Ana geht mit der Mutter in die Kapelle der Anstalt, wo der Vater in einem offenen Sarg aufgebahrt ist. Sein Kopf ruht auf einem weißen Kissen, seine Augen sind geschlossen, die Haare akkurat gescheitelt, und er trägt den Anzug, den er bei der Ausfahrt mit dem Auto des Primars getragen hat. Er sieht ganz und gar nicht aus, als würde er schlafen, schon alleine, weil niemand in einem Anzug schläft. Ana geht ganz nah zum Vater hin, zieht vorsichtig Luft durch die Nase hoch. Der Vater riecht jetzt nicht mehr, weder nach der guten Seife noch nach Krankheit.
Die Mutter seufzt und sagt: »Er ist nicht nur an dieser Krankheit gestorben.«
»Sondern?«, fragt Ana vorsichtig.
»Der Leopold hat das alles nicht ausgehalten. Den Krieg. Die Soldaten. Die verschwundenen Patienten. Er wollte nicht mehr leben«, sagt die Mutter.
»Auch, weil ich der Marie erzählt habe, dass er weder an den einen noch an den anderen glaubt?«
Die Mutter sieht zu Ana herunter. Dann schüttelt sie den Kopf. »Das ist saudumm von dir gewesen, aber deshalb stirbt man nicht.«
»Bist du sicher?«
»Ja, ich bin sicher.«
Am Tag des Begräbnisses sieht Ana die Mutter zum ersten Mal einen Hut tragen. Er ist schwarz, hat eine breite Krempe, eine blau-grün schillernde Feder steckt im Hutband. Die Mutter hat ihn von der Frau Primar geliehen und sie sieht sehr schön damit aus. Ana hat ein Kleid von Marie an. Sie hasst dieses Kleid, aber in dem ganzen Durcheinander nimmt sie es hin. Die Trauergäste versammeln sich in der Kapelle. Der Sarg ist immer noch offen. Otto hält sich die Ohren zu.
»Du musst dir die Augen zuhalten, wenn du ihn nicht sehen willst«, sagt Ana.
Aber Otto hört nicht auf sie.
Sogar ein paar Soldaten sind da, auch der Dünne mit der schlackernden Uniform. Als Ana ihn entdeckt, hat er gerade seinen Blick auf die Mutter geheftet. Er sieht sie an, als würde er nie wieder wegschauen wollen.
Und natürlich sind auch der Onkel Josef und seine Frau, die Tante Johanna, aus dem Dorf in die Stadt gekommen.
»Der Leopold wurde als Sohn eines Bauern geboren«, sagt der Pfarrer. »Als sein jüngerer Bruder vor ihm geheiratet hat, war auf dem Hof kein Platz mehr für ihn. Er ging in die Stadt, lernte viel und wurde klug.« Als er hinzufügt, dass der Vater verstanden hat, dass man mehr Geld verdient, wenn man Krankenpfleger bei Geisteskranken ist und nicht in einem gewöhnlichen Spital, lachen ein paar. Dann kommen vier Männer, legen den Deckel auf den Sarg, setzen Nägel auf das Holz und schlagen mit Hämmern darauf.
Die Nägel sind rostig, aber gerade.
Die Trauergäste versammeln sich im Wirtshaus gegenüber dem Friedhofstor. Bevor das Essen serviert wird, redet der Onkel, mit einem Krug Bier in der Hand, so laut, dass alle ihn hören können. Und es hören ihm auch alle zu, freiwillig oder unfreiwillig, der Onkel hat eine Stimme, die alle zum Zuhören zwingt.
»Marianne«, sagt Josef mit Blick auf die Mutter, »ihr kommt zu uns, Platz genug haben wir. Zumindest für ein paar Wochen kommt ihr. Länger dauert der Krieg ohnehin nicht mehr. Vor dem Winter noch wird der Krieg aus und vorbei sein, noch bevor der erste Schnee fällt, glaubt mir!«, doziert er. »Ihr werdet sehen! Und dann sehen wir weiter.« Er wendet sich an die Trauergesellschaft: »Bis dahin leben sie bei uns. Mit uns. In unserem Haus. In meinem Haus.« Daraufhin schaut er in Ottos und Anas Richtung: »In dem Haus, in dem euer Vater aufgewachsen ist.« Und in Richtung seiner Frau, Johanna, und der Mutter sagt er: »Und ich verbitte mir jede Widerrede!« Er weiß, dass beide nach Gründen suchen, wie sie die Sache abbiegen können. Johanna, weil sie nicht will, dass sich Verwandte im Haus breitmachen. Die Mutter aus Angst, umgetopft zu werden. Aber in der Stadt wird es immer gefährlicher. Auf die Industrieanlagen am Stadtrand fallen jetzt manchmal Bomben. Nachts muss alles abgedunkelt bleiben. Und die Soldaten sammeln sich.
Um die Mutter und die Kinder abzuholen, kommt der Onkel zwei Wochen später ein zweites Mal innerhalb kurzer Zeit in die Stadt. »Packt nur das Nötigste! Die anderen Sachen, die Möbel und den Rest, holt ihr, wenn der Krieg vorbei ist!«
In Anas Ohren klingen die Worte des Onkels, als hätte er gesagt: Wenn der Sommer vorbei ist, wenn der Winter kommt, wenn es schneit.
»Wenn der Krieg vorbei ist, kehren wir wieder in die Stadt zurück«, entgegnet die Mutter. »Wir können euch ja nicht ewig belagern!«
Der Josef lacht, als wüsste er bereits, dass es anders kommen wird. Aber einen Koffer muss die Mutter gleich jetzt mit Anzügen und Schuhen und weißen Hemden füllen.
»Das sind Papas Sachen«, protestiert Ana mit trockenem Mund.
»Das nehme ich mit. Das brauchst du jetzt nicht mehr«, sagt der Onkel zur Mutter, ohne Ana auch nur anzusehen.
Josef setzt sich zum Fahrer in die Kabine. Ana, Otto und die Mutter hocken sich zu den Koffern auf die offene Ladefläche des Lasters. Marie steht am Tor der Anstalt und sieht ihnen mit einem überlegenen Grinsen nach. Aber der Laster hat bereits Fahrt aufgenommen, und bald verliert Ana Marie aus den Augen.
Aus den Augen, aus dem Sinn.
Sie erreichen die Straße am Flussufer. Eine Weile geht es stromaufwärts, immer weniger Häuser stehen links und rechts des Flusses, ein paar Fabriken noch, die Stadt verläuft sich, Felder und Wälder wechseln einander ab, sie kommen in eine übersichtliche Ortschaft, biegen am Marktplatz ab, Richtung Süden, dann fahren sie weiter auf schmalen, geraden Straßen. Die Gepäckstücke und die Mutter, Otto und Ana werden, wenn der Fahrer Schlaglöchern ausweicht, hin und her geworfen. Ana schaut da hin und dort hin. Sie weiß, dass sie diesen Weg damals auch mit dem Mercedes des Primars gefahren sind. Aber sie kann sich beim besten Willen an nichts in der flachen Landschaft erinnern. Otto kann nicht still sitzen. Er ist aufgeregt und verwirrt und vollkommen durcheinander. Ana versucht, nichts von all dem zu sein, nicht aufgeregt, nicht verwirrt, nicht durcheinander, einfach ohne Gefühle. Ohne Gefühle schaut sie zur Mutter. Ohne Gefühle begreift Ana zum ersten Mal, dass sie die Mutter nie wieder gemeinsam mit dem Vater sehen wird. Ohne Gefühle denkt sie an ihre eigene Zukunft –
An diesem Abend hat nichts gepasst. Zweimal hab ich ihn umbetten müssen. Erst dann hat er gut gelegen. Schließlich habe ich mich neben ihm ausgestreckt und meinen Arm über ihn gelegt, wie ich es fast fünfzig Jahre lang immer vorm Einschlafen gemacht habe. Er hat mich noch gebeten, ihm eine Fliege aus dem Gesicht wegzutun. Und ich habe sie verjagt. In der Nacht hat er mich aufgeweckt, weil ein Bein von der Bettkante hing. Am nächsten Morgen bin ich um sechs Uhr aufgewacht und hab mir einen Kaffee gemacht. Damit er mich rufen kann, habe ich die Schlafzimmertür offen stehen lassen. Hat er aber nicht. Also habe ich erst einmal Holz aus dem Keller geholt. Auf der Treppe sind mir ein paar Scheite hinuntergefallen und ich hab gelauscht, ob er wegen dem Lärm schimpft. Nein. Kein Mucks. Dann bin ich ins Schlafzimmer gegangen, hab mich neben dem Bett auf den Boden gekniet. Guten Morgen, hab ich zu ihm gesagt. Heute hast du aber verschlafen. Im Grunde habe ich es da schon gewusst. Aber ich habe es noch nicht denken können. Also hab ich ihn an den Schultern gepackt und hab ihn geschüttelt. Normalerweise habe ich die Kraft gehabt, ihn hochzuziehen, seinen Oberkörper aufzurichten – heute nicht. Und dann bin ich zum Telefon gerannt. Die Nummer vom Doktor wusste ich auswendig. Herr Doktor, der Peter rührt sich nicht, hab ich in den Hörer geschrien. Als Nächstes die Haustür aufgesperrt, dann zurück ins Schlafzimmer. Bin dagestanden und hab den Peter angestarrt wie einen, der nicht hierhergehört. Als ich den Doktor im Flur gehört habe, hab ich gerufen: Hier! Schon war er bei uns, hat dem Peter den Pyjama aufgeknöpft, ihn abgehorcht. Ich hab den Kopf in ein Kissen gesteckt. Damit ich nicht schreie. Der Doktor hätte sich die Mühe nicht mehr machen müssen, ist aber seiner Sorgfaltspflicht nachgekommen. Und das hat gedauert. Bis er gesagt hat, er kann nicht mehr helfen. Ich hab den Kopf immer noch im Kissen stecken gehabt. Ich hab ihn gar nicht mehr he