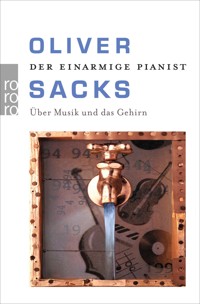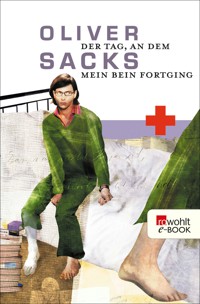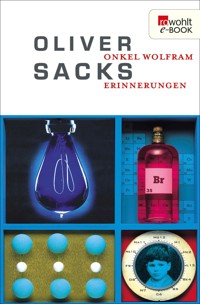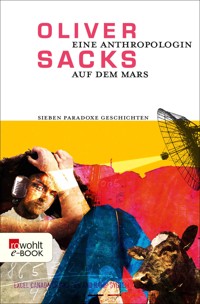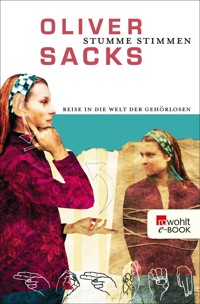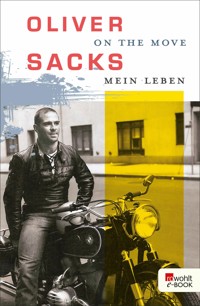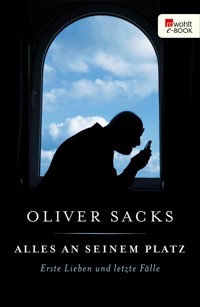
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Der Neurologe Oliver Sacks ist durch seine Fallgeschichten weltberühmt geworden. Er hat eine neue Form des Verständnisses für seine Patienten entwickelt, indem er deren Eigenheiten nicht als Defekte oder Behinderung abtat, sondern sie in ihrer Besonderheit wahrnahm und beschrieb. Als Sacks 2015 starb, hinterließ er eine Fülle von Aufzeichnungen: Sacks schreibt über Depressionen und Psychosen, über das Tourette-Syndrom und Demenzerkrankungen, Träume und Halluzinationen. Und er gibt Einblicke in seine persönliche Welt, indem er sein Faible für Farngewächse und Gingkobäume beschreibt und von seinem meistgeliebten Sport erzählt: dem ausgiebigen Schwimmen in Seen und Flüssen. Das höchst lesenswerte Vermächtnis eines Autors von Weltrang.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 353
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Oliver Sacks
Alles an seinem Platz
Erste Lieben und letzte Fälle
Über dieses Buch
Der Neurologe Oliver Sacks ist durch seine Fallgeschichten weltberühmt geworden. Er hat eine neue Form des Verständnisses für seine Patienten entwickelt, indem er deren Eigenheiten nicht als Defekte oder Behinderung abtat, sondern sie in ihrer Besonderheit wahrnahm und beschrieb. Seine Botschaft: Wer von der Norm abweicht, ist anders, aber nicht weniger wert als die sogenannten Normalen. Im Gegenteil: Viele Krankheiten ermöglichen ganz besondere Fähigkeiten der Wahrnehmung.
Als Sacks 2015 starb, hinterließ er eine Fülle von Aufzeichnungen: über sein eigenes Leben, über Patienten, über Lektüren und Reisen. Seine engsten Mitarbeiter haben daraus ein Buch zusammengestellt, das den Autor Oliver Sacks noch einmal in der ganzen Fülle seines Beobachtens und Denkens zeigt. Der Band enthält faszinierende autobiographische Miniaturen ebenso wie Studien über wichtige Fälle aus der Praxis des Arztes.
Das Spektrum der Texte ist denkbar breit: Der Autor schreibt über Depressionen und Psychosen, über das Tourette-Syndrom, Krebs- und Demenzerkrankungen, Träume und Halluzinationen. Und er gibt Einblicke in seine persönliche Welt, indem er sein Faible für Farngewächse und Ginkgobäume beschreibt und von seinem meistgeliebten Sport erzählt: dem ausgiebigen Schwimmen in Seen und Flüssen. Das höchst lesenswerte Vermächtnis eines Autors von Weltrang.
Vita
Oliver Sacks, geboren 1943 in London, war Professor für Neurologie und Psychiatrie an der Columbia University. Er wurde durch die Publikation seiner Fallgeschichten weltberühmt. Nach seinen Büchern wurden mehrere Filme gedreht, darunter «Zeit des Erwachens» (1990) mit Robert de Niro und Robin Williams. Oliver Sacks starb am 30. August 2015 in New York City.
Bei Rowohlt erschienen unter anderem seine Bücher «Awakenings – Zeit des Erwachens», «Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte», «Der Tag, an dem mein Bein fortging», «Der einarmige Pianist» und «Drachen, Doppelgänger und Dämonen». 2015 veröffentlichte er seine Autobiographie «On the Move».
Hainer Kober, geboren 1942, lebt in Soltau. Er hat u.a. Werke von Stephen Hawking, Steven Pinker, Jonathan Littell, Georges Simenon und Oliver Sacks übersetzt.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel «Everything in Its Place. First Loves and Last Tales» bei Alfred A. Knopf, New York.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Dezember 2019
Copyright © 2019 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
«Everything in Its Place» Copyright © 2019 by the Oliver Sacks Foundation
All rights reserved
Redaktion Uwe Naumann
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München, nach dem Original von Penguin Random House
Coverabbildung Umschlagfoto: Bill Hayes
ISBN 978-3-644-05771-5
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Erste Lieben
Wasserbabys
Erinnerungen an South Kensington
Erste Liebe
Humphry Davy: Poet der Chemie
Bibliotheken
Eine Reise ins Innere des Gehirns
Klinische Erzählungen
Kühllagerung
Neurologische Träume
Nichts
Gotteserscheinungen im dritten Jahrtausend
Schluckauf und andere merkwürdige Verhaltensweisen
Reisen mit Lowell
Zwänge
Die Katastrophe
Gefährlich gesund
Tee und Toast
Mitteilen
Das alternde Gehirn
Kuru
Sommer des Wahnsinns
Die verlorenen Tugenden der Heilanstalten
Das Leben geht weiter
Irgendjemand dort draussen?
Clupeophilie
Rückkehr nach Colorado Springs
Botaniker im Park
Grüsse von der Insel der Stabilität
Kleingedrucktes lesen
Der Gang des Elefanten
Orang-Utan
Warum wir Gärten brauchen
Die Nacht des Ginkgos
Filter-Fisch
Life Continues
Anhang
Literatur
Quellen
Register
Über den Autor
Erste Lieben
Wasserbabys
Wir waren alle Wasserbabys, meine drei Brüder und ich. Mein Vater, der ein Schwimm-Champ war (er hat die drei Meilen vor der Isle of Wight drei Jahre hintereinander gewonnen) und für sein Leben gern schwamm, machte uns schon mit dem Wasser vertraut, als wir kaum eine Woche alt waren. In diesem Alter schwimmt man instinktiv, daher habe ich, ob es mir recht war oder nicht, niemals schwimmen «gelernt».
Daran musste ich denken, als ich die Karolinen in Mikronesien besuchte, wo ich sah, wie Kleinkinder furchtlos in den Lagunen tauchten und schwammen, wobei sie meist wie Hunde paddelten. «Nicht schwimmen können» gibt es dort nicht; die Insulaner sind hervorragende Schwimmer. Magellan und andere Seefahrer, die im 16. Jahrhundert Mikronesien anliefen, waren begeistert, als sie die Insulaner schwimmen und tauchen sahen, und konnten nicht umhin, sie mit Delfinen zu vergleichen, als sie beobachteten, wie sie von Welle zu Welle sprangen. Vor allem die Kinder fühlten sich so heimisch im Wasser, dass sie einem Entdeckungsreisenden «eher wie Fische als wie Menschen» erschienen. (Anfang des 20. Jahrhunderts lernten Westler von den Pazifikinsulanern den Kraulstil, diesen eleganten, kraftvollen Armzug, den sie perfekt beherrschten und der dem menschlichen Körperbau so viel besser entspricht als das froschartige Brustschwimmen, das damals im Westen vorherrschte.)
Ich kann mich nicht erinnern, dass man mir das Schwimmen beigebracht hätte; ich glaube, ich lernte meine Schwimmzüge, indem ich mit meinem Vater schwamm – obwohl sich seine langsamen, gemessenen, raumgreifenden Armzüge (er war ein gewaltiger Mann, der fast 115 Kilogramm wog) nicht unbedingt für einen kleinen Jungen eigneten. Aber ich konnte sehen, wie sich mein alter Herr, der an Land riesig und schwerfällig wirkte, im Wasser verwandelte und die Eleganz eines Delfins entwickelte. Und ich selbst, der eher gehemmt, nervös und unbeholfen war, erfuhr dieselbe wundersame Metamorphose im Wasser, ein neues Sein, eine neue Seinsweise. Ich erinnere mich lebhaft an einen Sommerurlaub in einem englischen Seebad, einen Monat nach meinem fünften Geburtstag. Ich rannte in das Zimmer meiner Eltern und zerrte an dem riesigen walartigen Leib meines Vaters. «Komm, Dad!», sagte ich. «Lass uns schwimmen gehen.» Langsam wälzte er sich herum und öffnete ein Auge. «Was denkst du dir dabei, einen alten dreiundvierzigjährigen Mann um sechs Uhr morgens auf so rüde Weise zu wecken?» Heute, da mein Vater nicht mehr lebt und ich fast doppelt so alt bin, wie er damals war, macht mir die Erinnerung an diesen längst vergangenen Moment zu schaffen, und ich weiß nicht recht, ob ich lachen oder weinen soll.
Die Pubertät war eine schlimme Zeit. Ich bekam eine eigenartige Hauterkrankung: «Erythema annulare centrifugum», meinte ein Facharzt, «Erythema gyratum perstans», ein anderer – prächtige, volltönende, pompöse Wörter, aber keiner der Experten vermochte etwas dagegen auszurichten, und ich war mit nässenden Ekzemen bedeckt. Da ich aussah wie ein Leprakranker, oder es zumindest glaubte, wagte ich nicht, mich im Schwimmbad oder am Strand auszuziehen, und hatte nur gelegentlich das Glück, einen einsamen See oder Tümpel zu finden.
In Oxford wurde meine Haut plötzlich wieder rein, woraufhin meine Erleichterung so groß war, dass ich nackt schwimmen wollte, um zu fühlen, wie das Wasser ungehindert über jeden Teil meines Körpers floss. Manchmal ging ich am Parson’s Pleasure schwimmen, einer Biegung des Cherwell, die seit den 1680er Jahren für Nacktbadende reserviert war und, wie man zu spüren meinte, von den Geistern Swinburns und Cloughs behütet wurde. An Sommernachmittagen fuhr ich mit einem Stocherkahn auf dem Cherwell, suchte ein abgeschiedenes Plätzchen, vertäute den Kahn und schwamm dort bis zum Abend. Manchmal unternahm ich nachts lange Läufe, die mich an der Schleuse Iffley Lock vorbei weit aus der Stadt hinausführten. Dort tauchte ich ein in den Fluss und schwamm in ihm, bis es schien, dass wir zusammenflossen und eins wurden.
In Oxford wurde das Schwimmen für mich zu einer unwiderstehlichen Leidenschaft, und danach gab es keinen Weg zurück. Als ich Mitte der 1960er Jahre nach New York kam, begann ich, am Orchard Beach in der Bronx zu schwimmen; manchmal umrundete ich City Island – eine Schwimmstrecke, für die ich mehrere Stunden brauchte. So fand ich übrigens auch das Haus, in dem ich zwanzig Jahre lang lebte: Auf halbem Wege hatte ich haltgemacht, um mir einen entzückenden Pavillon am Ufer anzuschauen, war an Land gestiegen und die Straße entlanggeschlendert, als ich ein kleines rotes Haus erblickte, das zum Verkauf stand, hatte mich (immer noch tropfnass) von den verdutzten Eigentümern herumführen lassen, war zur Immobilienmaklerin gegangen, hatte sie davon überzeugt, dass ich es ernst meinte (sie war nicht an Kunden in Badehose gewöhnt), war auf der anderen Seite der Insel wieder ins Wasser gestiegen und zum Orchard Beach zurückgeschwommen. So hatte ich mir während des Schwimmens ein Haus gekauft.
Wenn es ging, schwamm ich von April bis November draußen – damals war ich abgehärteter –, im Winter ging ich in die örtliche YMCA-Schwimmhalle. 1976/77 errang ich den Titel des besten Langstreckenschwimmers des Mount Vernon YMCA in Westchester: Ich schwamm fünfhundert Bahnen – zehn Kilometer – in dem Wettbewerb und hätte weitergemacht, hätten die Kampfrichter nicht gesagt: «Es reicht! Bitte gehen Sie nach Hause.»
Man sollte meinen, fünfhundert Bahnen seien eintönig, langweilig, aber ich habe Schwimmen nie als eintönig oder langweilig empfunden. Schwimmen erzeugt in mir eine solche Freude, ein so extremes Wohlgefühl, dass ich gelegentlich in eine Art Ekstase verfalle. Ich gehe vollkommen im Schwimmen auf, in jedem Armzug, und gleichzeitig kann ich meine Gedanken frei wandern lassen, bin wie verzaubert, in einem tranceartigen Zustand. Ich kenne nichts, was einen so mächtigen, gesund euphorisierenden Einfluss auf mich ausübt – ich bin süchtig danach und ungenießbar, wenn ich nicht schwimmen kann.
Im 13. Jahrhundert nannte es Duns Scotus condelectari sibi – den Wunsch, sich an der eigenen Tätigkeit zu erfreuen, und in unseren Tagen spricht Mihály Csikszentmihályi vom Flow. Schwimmen hat etwas inhärent Stimmiges, so wie alle fließenden und gewissermaßen musikalischen Tätigkeiten. Und dann ist da noch das Wunder des Auftriebs, des Schwebens in diesem dichten, transparenten Medium, das uns trägt und umfängt. Wir können uns in einer Weise im Wasser bewegen und mit ihm spielen, für die es in der Luft nichts Vergleichbares gibt. Wir sind in der Lage, in jeder beliebigen Richtung seine Dynamik und seinem Fluss zu erkunden; wir können unsere Hände wie Propeller bewegen oder wie kleine Ruder einsetzen, uns in kleine Wasserflugzeuge oder U-Boote verwandeln, die Strömungsphysik mit dem eigenen Körper erforschen.
Und zu alldem kommt noch die ganze Symbolik des Schwimmens – seine imaginativen Resonanzen, seine mythenbildenden Kräfte.
Mein Vater nannte Schwimmen das «Lebenselixier», und auf ihn traf das wohl wirklich zu: Er schwamm jeden Tag und wurde mit der Zeit nur ein wenig langsamer. Ich hoffe, ich kann es ihm nachtun und schwimmen, bis ich sterbe.
Erinnerungen an South Kensington
Solange ich zurückdenken kann, habe ich Museen geliebt. Immer haben sie eine zentrale Rolle in meinem Leben gespielt, indem sie meine Phantasie anregten und mir die Ordnung der Welt in lebhafter, konkreter Weise vor Augen führten, wenn auch in verkleinertem Maßstab, en miniature. Aus dem gleichen Grund schätze ich Botanische Gärten und Zoos: Sie zeigen einem die Natur, aber eine klassifizierte Natur, die Taxonomie des Lebens. Bücher sind nicht real in diesem Sinn, sie sind nur Wörter. Museen präsentieren reale Exemplare der Natur in sinnreicher Anordnung.
Die vier großen South-Kensington-Museen – alle auf demselben Stück Land gelegen und im gleichen hochviktorianischen Barock erbaut – wurden als eine Einheit mit vielen Aspekten konzipiert, als Versuch, Naturgeschichte, Naturwissenschaft und Kulturgeschichte öffentlich und für jedermann zugänglich zu machen.
Die South-Ken-Museen waren (zusammen mit der Royal Institution und ihren beliebten Weihnachtsvorträgen) eine einzigartige viktorianische Bildungseinrichtung, die für mich heute noch, wie in meiner Kindheit, der Inbegriff des Museums sind.
Es gab das Natural History Museum, das Geology Museum, das Science Museum und das Victoria and Albert Museum, das der Kulturgeschichte gewidmet war. Da ich der naturwissenschaftliche Typ war, ging ich nie ins V&A, aber die anderen drei waren für mich ein einziges Museum, das ich ständig aufsuchte, an freien Nachmittagen, an Wochenenden, in den Ferien, wann immer ich konnte. Ich litt darunter, dass ich ausgesperrt war, wenn sie geschlossen wurden, und eines Nachts gelang es mir, im Natural History Museum zu bleiben, indem ich mich in dem Saal der fossilen Wirbellosen versteckte (der nicht ganz so gut bewacht war wie der Dinosauriersaal oder die Wale). Ich verbrachte eine verzauberte Nacht ganz allein in dem Museum und wanderte mit einer Taschenlampe von Saal zu Saal. Während ich so in der Nacht herumstreifte, wurden vertraute Tiere plötzlich schrecklich und unheimlich, wenn ihre Gesichter plötzlich aus der Dunkelheit auftauchten oder wie Geister an der Peripherie des Lichtkegels schwebten. So ganz ohne Licht hatte das Museum etwas von einem Fiebertraum, und ich war nicht wirklich traurig, als der Morgen dämmerte.
Ich hatte viele Freunde im Natural History Museum – Cacops und Eryops, riesige fossile Amphibien, in deren Schädel sich ein Loch für ein drittes Auge befand, das Scheitelauge; die Würfelqualle Charybdea, die niederste Tierart mit Nervenganglien und Augen; die herrlichen Braunglasmodelle von Strahlentierchen und Sonnentierchen – aber meine tiefste Liebe, meine besondere Leidenschaft gehörte den Kopffüßern, von denen es dort eine prachtvolle Sammlung gab.
Stundenlang konnte ich mich in den Anblick der Tintenfische vertiefen: von Sthenoteuthis caroli, 1925 an der Küste Yorkshires gestrandet, oder des exotischen pechschwarzen Vampirtintenfischs (leider nur als Wachsmodell vertreten), eine seltene Tiefseeart mit schirmartigen Häuten zwischen den Armen, in deren Falten glänzende Sterne leuchteten. Und natürlich: Architeuthis, der Riesenkalamar, der Herrscher aller Tintenfische, in tödlicher Umarmung mit einem Wal.
Doch meine Aufmerksamkeit galt nicht in erster Linie den riesigen oder exotischen Exemplaren. Meine besondere Vorliebe gehörte den Ausstellungen der Insekten und Mollusken, der Möglichkeit, die Schubladen unter den Vitrinen zu öffnen und all die verschiedenen Spielarten zu betrachten, die Merkmale einer einzigen Art oder Muschel, und zu erfahren, wo jede Varietät ihren eigenen geographischen Standort hatte. Ich konnte nicht wie Darwin zu den Galápagos reisen und die Finken auf den einzelnen Inseln miteinander vergleichen, aber mir stand im Museum die zweitbeste Möglichkeit offen. Ich konnte ein virtueller Naturforscher, ein imaginärer Reisender sein, mit einer Fahrkarte für die ganze Welt, ohne South Kensington zu verlassen.
Als die Museumsangestellten mich kannten, wurde ich durch eine verschlossene, massive Tür in die der Öffentlichkeit nicht zugänglichen Räume des neuen Spirit Building gelassen, wo man Exemplare aus der ganzen Welt in Empfang nahm, sie untersuchte, sezierte, neue Arten identifizierte – und sie gelegentlich für Sonderausstellungen präparierte. (Eines war ein Quastenflosser, der gerade entdeckte «letzte noch lebende fossile Fisch» Latimeria, ein Geschöpf, von dem man geglaubt hatte, es sei seit der Kreidezeit ausgestorben.) Bevor ich nach Oxford ging, verbrachte ich endlose Tage im Spirit Building; mein Freund Eric Korn hielt sich dort ein ganzes Jahr lang auf. Damals waren wir alle vernarrt in die Taxonomie – waschechte viktorianische Naturforscher.
Ich liebte das altmodische Glas-und-Mahagoni-Ambiente des Museums und war empört, als man dem Haus während meines Studiums in den 1950er Jahren ein modernes, aufdringliches Outfit verpasste und dort trendige Ausstellungen veranstaltete. (Am Ende wurden sie sogar interaktiv.) Jonathan Miller, ein anderer Freund, teilte meinen Widerwillen und meine Nostalgie. «Ich sehne mich nach dieser sepiafarbenen Epoche zurück», schrieb er mir einmal. «Was gäbe ich drum, wenn dieser Ort plötzlich wieder in die körnige Einfarbigkeit von 1876 getaucht würde.»
Das Natural History Museum lag in einem wunderhübschen Garten, der beherrscht wurde von Sigillaria-Stämmen, einer lange ausgestorbenen fossilen Baumart, und einer Sammlung von Kalamiten. Mein Herz hing mit fast schmerzlicher Intensität an der fossilen Botanik; wenn sich Jonathan nach der körnigen Monochromie von 1876 zurücksehnte, so war ich der grünen Einfarbigkeit der Farn- und Palmwedelwälder des Jura verfallen. Als Jugendlicher träumte ich sogar nachts von riesigen Bärlapp- und Schachtelhalmbäumen, von Urwäldern aus riesigen Nacktsamern, die den Globus umspannten – um dann zornig mit dem Gedanken aufzuwachen, dass sie seit langem verschwunden waren und den bunten, gefälligen Blütenpflanzen unserer Zeit Platz gemacht hatten.
Von dem jurassischen Fossiliengarten des Natural History Museum waren es knapp hundert Meter zum Geology Museum, in das sich, soweit ich sehen konnte, praktisch nie Besucher verirrten. (Leider gibt es das Museum nicht mehr; seine Sammlung ist dem Natural History Museum einverleibt worden.) Für das kundige, geduldige Auge war es voller außergewöhnlicher Schätze und stiller Freuden. Da gab es einen riesigen Kristall, einen Stibnit (Antimonsulfid) aus Japan. Er war einen Meter achtzig hoch, ein kristalliner Phallus, ein Totem, das mich auf eine besondere, fast ehrfurchteinflößende Weise faszinierte. Ein Phonolith, ein Klangstein, stammte vom Devils Tower in Wyoming; als die Museumswärter mich kannten, durfte ich ihn mit der Handfläche anschlagen, er gab einen dumpfen, aber gongartigen, widerhallenden Ton von sich, als hätte man gegen den Resonanzboden eines Klaviers geschlagen.
Mir gefiel die Atmosphäre dieser unbelebten Welt – die Schönheit der Kristalle, die Vorstellung ihrer Vollkommenheit, ihres Aufbaus aus identischen Atomgittern. Aber auch wenn sie vollkommen waren, gestaltgewordene Mathematik, so erregten sie mich doch mit ihrer sinnlichen Schönheit. Stundenlang starrte ich versunken auf die blassgelben Schwefelkristalle und lilafarbenen Fluoritkristalle – verschachtelt, kostbar, wie eine Meskalin-Vision – und, das andere Extrem, die seltsamen «organischen» Formen des Blutsteins, die so sehr wie die Nieren von Riesentieren aussahen, dass ich mich einen Augenblick lang fragte, ich welchem Museum ich sei.
Aber am Ende ging ich stets zurück ins Science Museum, denn das hatte ich als Erstes kennengelernt. Manchmal war meine Mutter vor dem Krieg mit meinen Brüdern und mir hierhergekommen, als ich noch ein Kind war. Sie führte uns durch die verzauberten Ausstellungsräume – die frühen Flugzeuge, die Maschinen der industriellen Revolution, die riesig wie Dinosaurier waren, die alten optischen Geräte – zu einem kleinen Raum ganz oben, wo sich der Nachbau eines Kohlestollens mit Originalausrüstung befand. «Schaut mal!», sagte sie dann und lenkte unseren Blick auf eine alte Grubenlampe. «Die hat mein Vater, euer Großvater erfunden!», sagte sie, und wir beugten uns vor und lasen: «Die Landau-Lampe. 1869 von Marcus Landau erfunden. Sie hat ihre Vorgängerin, die Humphry-Davy-Lampe, ersetzt.» Immer wenn ich das las, verspürte ich eine eigenartige Erregung und so etwas wie eine Verbindung mit dem Museum und meinem Großvater (1837 geboren und schon lange tot), das Gefühl, dass er und seine Erfindung noch irgendwie real und lebendig seien.
Aber die eigentliche Offenbarung im Science Museum wurde mir zuteil, als ich zehn war: Oben im fünften Stock entdeckte ich das Periodensystem – keine dieser modernen Spiralen, dieser hässlichen, kleinen Dinger, sondern ein stabiles Rechteck, das eine ganze Wand einnahm, mit einem eigenen Kästchen für jedes Element und, wenn möglich, einer Probe des Elements: Chlor, grün-gelb; waberndes braunes Brom; pechschwarze (aber violett verdampfende) Jodkristalle; schwere, sehr schwere Urankugeln und in Öl schwimmende Lithium-Pillen. Sie hatten sogar Proben von den Inertgasen (oder «Edelgasen», zu edel, um sich mit anderen zu verbinden): Helium, Neon, Argon, Krypton, Xenon (aber kein Radon – ich vermute, weil es zu gefährlich war). In ihren versiegelten Glasröhrchen waren sie natürlich unsichtbar, aber man wusste, dass sie da waren.
Die tatsächliche Anwesenheit der Elemente verstärkte den Eindruck, dass es sich tatsächlich um die Bausteine des Universums handelte, das das ganze Universum da sei, im Mikrokosmos, in South Kensington. Beim Anblick des Periodensystems überkam mich ein überwältigendes Gefühl von Wahrheit und Schönheit, das Gefühl, dass es sich nicht bloß um ein menschliches, willkürliches Konstrukt handelte, sondern um eine wahrhaftige Vision der ewigen kosmischen Ordnung, und dass alle künftigen Entdeckungen und Fortschritte, gleich welcher Art, nur die Wahrheit dieser Ordnung bekräftigen und bestätigen würden.
Dieses Empfinden für die Größe, die Unwandelbarkeit der Naturgesetze und die Gewissheit, dass wir sie entdecken können, wenn wir lange und hartnäckig genug nach ihnen suchen, offenbarte sich mir mit überwältigender Klarheit, als ich ein Junge von zehn Jahren war und vor dem Periodensystem des Science Museums in South Kensington stand. Dieses Gefühl hat mich nie verlassen; heute, fünfzig Jahre später, ist es noch genauso stark und lebendig wie damals. Dieser Augenblick entschied über meinen Glauben und mein Leben; ein Museum wurde mein Pisga und mein Sinai.
Erste Liebe
Im Januar 1946, als ich zwölfeinhalb war, wechselte ich von meiner Prep School The Hall in Hampstead zu der sehr viel größeren Schule St. Paul’s in Hammersmith. Dort, in der Walker Library, begegnete ich Jonathan Miller zum ersten Mal. Ich saß versteckt in einer Ecke und las ein Buch aus den 19. Jahrhundert über eine Gasentladungsröhre, die ihrer Form wegen Electric Egg hieß – als ein Schatten auf die Seite fiel. Ich blickte auf und sah einen erstaunlich großen, schlaksigen Jungen mit sehr beweglichen Gesichtszügen, glänzenden, verschmitzten Augen und einem ungebärdigen rötlichen Haarschopf. Wir kamen ins Gespräch und sind seither enge Freunde. Bis dahin hatte ich nur einen wirklichen Freund gehabt, Eric Korn, den ich fast seit meiner Geburt kannte. Ein Jahr später folgte mir Eric von The Hall nach St. Paul’s, und jetzt bildeten er, Jonathan und ich ein unzertrennliches Dreigespann, das nicht nur durch persönliche, sondern auch durch familiäre Bande zusammengehalten wurde (unsere Väter hatten vor dreißig Jahren zusammen Medizin studiert, und unsere Familien waren eng befreundet). Eigentlich teilten Jonathan und Eric meine Leidenschaft für die Chemie nicht – obwohl sie sich ein oder zwei Jahre zuvor an einem spektakulären chemischen Experiment von mir beteiligt hatten: Wir hatten in einen Highgate-Teich der Hampstead Heath einen riesigen Klumpen metallisches Natrium geworfen und aufgeregt beobachtet, wie er Feuer fing und, auf einer gelben Flamme reitend, wie ein durchgeknallter Meteor über die Wasserfläche schoss – aber sie hatten großes Interesse an der Biologie, daher war es unvermeidlich, dass wir uns zu gegebener Zeit in demselben Biologiekurs zusammenfanden und dass wir alle unseren Biologielehrer Sid Pask anbeteten.
Pask war ein phantastischer Lehrer. Er war auch engstirnig, bigott, mit grässlichem Stottern geschlagen (das wir endlos nachahmten) und keineswegs ungewöhnlich intelligent. Doch durch Überredung, Ironie, Spott oder Gewalt machte er uns alle anderen Tätigkeiten abspenstig – Sport und Sex, Religion und Familie sowie alle anderen Schulfächer. Er verlangte von uns, dass wir ebenso ausschließlich waren wie er.
Die Mehrheit seiner Schüler fand, dass er ein unglaublich anspruchsvoller und strenger Zuchtmeister war. Sie taten alles, um sich seiner, wie sie fanden, kleinlichen Tyrannei zu entziehen. Dieser Kampf zog sich eine Zeitlang hin, dann war der Widerstand plötzlich gebrochen – sie waren frei. Pask nörgelte nicht mehr an ihnen herum, stellte keine lächerlich übertriebenen Anforderungen mehr an ihre Zeit und Energie.
Doch ein paar von uns nahmen jedes Jahr Pasks Herausforderung an. Dafür gab er uns alles, was er zu geben hatte – seine Zeit und seine Leidenschaft für die Biologie. Bis spätabends blieben wir mit ihm im Natural History Museum. Jedes Wochenende gingen wir mit ihm auf Pflanzensuche. An bitterkalten Wintertagen standen wir in der Morgendämmerung für seinen Süßwasserkurs im Januar auf. Und einmal im Jahr – noch heute überkommt mich eine süße, fast unerträgliche Wehmut bei der Erinnerung – fuhren wir für drei Wochen nach Millport, um meeresbiologische Studien zu betreiben.
Millport, vor der Westküste Schottlands gelegen, hatte eine wunderbar ausgestattete Station für Meeresbiologie, wo wir immer freundlich aufgenommen wurden und bei allen unseren Experimenten Unterstützung fanden. (Damals wurden dort bahnbrechende Beobachtungen an Seeigeln gemacht; Lord Rothschild, der gerade mitten in seinen heute berühmten Experimenten über die Befruchtung von Seeigeln steckte, bewies unendliche Geduld mit den begeisterten Schuljungen, die ihn umringten und in seine Petrischalen mit den durchsichtigen Pluteus-Larven starrten.) Jonathan, Eric und ich legten gemeinsam mehrere Transsekte auf dem steinigen Strand an und zählten alle Tiere und Pflanzen, die wir auf den sukzessiven Quadratfußabschnitten entdeckten, von der flechtenbedeckten Spitze des Felsens (Xanthoria parietina lautete der wohlklingende Name dieser Flechte) bis zur Strandlinie und den Gezeitentümpeln unten. Eric erwies sich dabei als besonders ideenreich: Als wir einmal ein Bleilot brauchten, um eine Senkrechte zu haben, aber nicht wussten, wo wir es befestigen sollten, löste er eine Napfschnecke vom Fuß eines Felsens, legte das Ende der Lotschnur unter die Schnecke und befestigte diese wieder am Felsen, sodass sie die Schnur gewissermaßen als natürliche Reißzwecke am Felsen festhielt.
Jeder fand Gefallen an bestimmten zoologischen Gruppen: Eric entwickelte eine besondere Vorliebe für Seegurken, Holothurien; Jonathan für schimmernde Vielborster, Polychaeta; und ich für Tintenfische, Sepien und Oktopoden, alle Kopffüßer – die intelligentesten und, für mein Empfinden, schönsten wirbellosen Tiere.
Einmal fuhren wir alle drei an die See nach Hythe in Kent, wo Jonathans Eltern ein Sommerhaus gemietet hatten. Eines Tages fuhren wir mit einem Fischtrawler hinaus. Normalerweise warfen die Fischer die Tintenfische, die in ihrem Netz landeten, wieder ins Meer zurück (damals mochte man in England keinen Tintenfisch). Doch ich bat sie flehentlich, sie für mich aufzubewahren, sodass wohl Dutzende an Deck lagen, als wir wieder in den Hafen liefen. In Eimern und Kübeln brachten wir alle Tintenfische nach Hause, füllten sie im Keller in Gläser und gaben ein wenig Alkohol hinzu, um sie zu konservieren. Jonathans Eltern waren nicht da, daher konnten wir ungehindert zu Werke gehen. Den ganzen Fang Tintenfische wollten wir mit in die Schule nehmen und Pask übergeben – wir stellten uns sein erstauntes Lächeln vor, wenn wir damit ankamen. Für jeden Schüler in der Klasse würde es ein Exemplar zum Sezieren geben, und zwei oder drei für die Kopffüßer-Fans. Ich würde im Hockeyclub einen kleinen Vortrag halten und mich ausführlich über ihre Intelligenz verbreiten, ihre großen Gehirne, ihre Augen mit den schräg nach oben ragenden Netzhäuten, ihre rasch wechselnden Farben.
Etwas später, an dem Tag, an dem Jonathans Eltern zurückkommen wollten, hörten wir ein dumpfes Knallen aus dem Keller. Als wir nachsehen gingen, bot sich uns ein grotesker Anblick: Die unzureichend konservierten Tintenfische waren verfault und hatten gegoren, durch die Gase, die sich gebildet hatten, waren die Gläser explodiert, sodass große Klumpen Tintenfisch an die Wände und den Fußboden gespritzt waren; einige Fetzen klebten sogar an der Decke. Der durchdringende Fäulnisgeruch war unvorstellbar ekelhaft. Wir gaben uns größte Mühe, die Wände abzukratzen und die explodierten, festsitzenden Tintenfischreste zu entfernen. Mit unserem Brechreiz kämpfend, spritzten wir den Keller mit einem Schlauch ab, aber der Gestank ließ sich nicht vertreiben, und als wir Fenster und Türen aufrissen, um den Keller zu lüften, breitete sich der unerträgliche Geruch auch draußen wie ein Pesthauch aus – 50 Meter nach allen Seiten.
Eric, einfallsreich wie immer, schlug vor, den Gestank durch einen noch stärkeren, aber angenehmen Geruch zu überlagern oder zu ersetzen – wir gelangten zu dem Schluss, dass eine Kokosnuss-Essenz den Zweck erfüllen müsste. Wir legten zusammen und kauften eine große Flasche von dem Zeug, tränkten damit den Keller und verteilten den Rest großzügig in den anderen Räumen und auf dem Grundstück.
Eine Stunde später kamen Jonathans Eltern und trafen, als sie sich dem Haus näherten, auf einen überwältigenden Kokosnussduft. Doch ein paar Schritte weiter gerieten sie in eine Zone, in der der Gestank des verfaulten Tintenfischs vorherrschte – die beiden Gerüche, die beiden Schwaden hatten sich in einander abwechselnden Zonen von knapp zwei Metern Breite angeordnet. Als sie schließlich den Schauplatz unseres Unfalls oder Verbrechens erreichten – den Keller –, konnte man den Gestank nicht länger als ein paar Sekunden ertragen. Wir waren alle drei in tiefe Ungnade gefallen. Ich vor allem, weil in erster Linie meine Gier an allem schuld war (hätte es nicht auch ein Tintenfisch getan?) und in zweiter Linie meine Dummheit, weil ich keine Ahnung hatte, wie viel Alkohol so viele Exemplare brauchten. Jonathans Eltern mussten ihren Urlaub abbrechen und das Haus verlassen (wie wir hörten, blieb es auf Monate hin unbewohnbar). Aber meiner Liebe zu Tintenfischen tat das Ganze keinen Abbruch.
Vielleicht hatte diese Katastrophe auch eine chemische und biologische Ursache, denn Tintenfische haben (wie viele andere Weich- und Krustentiere) blaues Blut, kein rotes, weil die Evolution sie mit einem völlig anderen System zum Sauerstofftransport ausgestattet hat, als wir es haben. Während unser rotes Atmungspigment, das Hämoglobin, Eisen enthält, befindet sich in ihrem blaugrünen Pigment, dem Hämocyanin, Kupfer. Eisen und Kupfer haben beide zwei unterschiedliche «Oxidationszustände», das heißt, sie können in der Lunge leicht Sauerstoff aufnehmen, ihn in einen höheren Oxidationszustand versetzen und dann in den Geweben abliefern, wo er gebraucht wird. Aber warum Eisen und Kupfer verwenden, wenn es doch ein anderes Metall gibt – das Vanadium, das ihnen im Periodensystem benachbart ist –, das nicht weniger als vier Oxidationszustände hat? Ich fragte mich, ob Vanadiumverbindungen irgendwo als Atmungspigment verwendet wurden, und geriet in helle Aufregung, als ich hörte, dass einige Seescheiden, die dem Unterstamm der Manteltiere angehörten, außerordentlich reich an Element Vanadium waren und spezialisierte Zellen hatten, sogenannte Vanadozyten, die das Element speichern. Warum sich das so verhielt, war ein Rätsel; sie schienen nicht zum Sauerstoff-Transportsystem zu gehören.
Ich kam auf den absurden und reichlich vermessenen Gedanken, ich könnte dieses Rätsel während einer unserer jährlichen Exkursionen nach Millport lösen. Aber ich brachte nicht mehr zustande, als ein Scheffel Seescheiden zu sammeln (mit der gleichen Gier, der gleichen Maßlosigkeit, die mich veranlasst hatte, zu viele Tintenfische zu sammeln). Ich dachte, ich könnte sie verbrennen und den Vanadiumanteil in ihrer Asche messen (nach dem, was ich gelesen hatte, konnte der bei einigen Arten 40 Prozent übersteigen). Und dieser Überlegung verdankte ich die einzige kommerzielle Überlegung, die ich jemals hatte: Ich wollte eine Vanadium-Farm anlegen – viele Hektar Meereswiesen, bepflanzt mit Seescheiden, die das kostbare Vanadium für mich aus dem Seewasser aufnehmen würden, wie sie es seit mindestens dreihundert Millionen Jahren mit großem Erfolg taten, und ich würde es für 500 Pfund pro Tonne verkaufen. Das einzige Problem bestand darin – wie mir, voller Entsetzen über meine genozidalen Pläne, klarwurde –, dass dazu ein veritabler Holocaust an Seescheiden erforderlich war.
Humphry Davy: Poet der Chemie
Humphry Davy war für mich – wie für die meisten Jungen meiner Generation mit einem Chemiebaukasten oder einem Labor – ein strahlender Held; ein Junge im Jugendalter der Chemie; eine außerordentlich faszinierende Gestalt, so gegenwärtig und lebendig für uns wie jemand aus unserem Freundeskreis. Wir wussten alles über die Experimente, die er im Jugendalter durchgeführt hatte – vom Lachgas (das er entdeckte, beschrieb und in der Pubertät eine Zeitlang als Suchtmittel verwendete) bis zu seinen oft tollkühnen Experimenten mit Alkalimetallen, elektrischen Batterien, elektrischen Fischen, Sprengstoffen. Wir stellten ihn uns als einen jungen Byron vor, mit weit auseinanderstehenden, träumenden Augen.
Zufällig dachte ich gerade an Humphry Davy, als ich auf eine Anzeige für David Knights Biographie aus dem Jahr 1992 stieß – Humphry Davy: Science and Power. Sofort bestellte ich mir ein Exemplar. Ich war in wehmütiger Stimmung, dachte an meine Jugendzeit: an den romantischen Zwölfjährigen, der in tiefer Liebe – womöglich tiefer als jemals danach – zu Natrium und Kalium und Chlor und Brom entbrannt war; zu einem magischen Laden, in dessen dunklen Eingeweiden man chemische Stoffe für sein Labor kaufen konnte; zu dem schweren, enzyklopädischen Werk von Mellor (und, soweit ich sie entziffern konnte, zu den Handbüchern von Gmelin); zu Londons Science Museum in South Kensington, wo eine Ausstellung der Geschichte der Chemie, vor allem ihren Anfängen Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts, gewidmet war; wobei meine größte Liebe wohl der Royal Institution galt, die in großen Teilen sicherlich noch genauso aussah und roch wie zu der Zeit, als der junge Humphry Davy dort arbeitete, und wo man, umgeben von seinen Notizheften, Manuskripten und Laboraufzeichnungen stöbern und träumen konnte.
Wie Knight völlig zu Recht feststellt, ist Davy ein wunderbarer Gegenstand für Biographen, und es hat in den letzten anderthalb Jahrhunderten reichlich Biographien über ihn gegeben. Doch Knight als gelernter Chemiker, als Professor für die Geschichte und Philosophie der Naturwissenschaften an der Durham University und als ehemaliger Herausgeber des British Journal for the History of Science hat hier ein Werk vorgelegt, das sich nicht nur durch seine wissenschaftliche Qualität auszeichnet, sondern auch durch sein menschliches Einsichts- und Einfühlungsvermögen.
1778 wurde Davy in Penzance als ältestes von fünf Kindern eines Kupferstechers und seiner Frau geboren. Er besuchte die örtliche Gelehrtenschule und genoss seine Freiheit. («Ich erachte es für mein Glück, dass ich mir als Kind selbst überlassen blieb und nicht auf einen bestimmten Lehrplan festgelegt wurde», notiert er.) Als er die Schule mit sechzehn verließ, wurde er bei einem Apotheker und Bader in die Lehrer gegeben, doch diese Tätigkeit langweilte ihn, und er strebte nach Höherem. Vor allem die Chemie hatte es ihm angetan: Er las und verstand Lavoisiers Elemente der Chemie – eine bemerkenswerte Leistung für einen Achtzehnjährigen mit geringer Schulbildung. Große Visionen trieben ihn um: Würde er vielleicht der neue Lavoisier, der neue Newton sein? Eines seiner Notizbücher aus dieser Zeit trug den Titel «Newton und Davy».
Dabei wies Davy eigentlich weniger eine geistige Verwandtschaft mit Newton als mit dessen Freund und Zeitgenossen Robert Boyle auf. Denn während Newton eine neue Physik begründete, hob Boyle die ebenso neue Wissenschaft der Chemie aus der Taufe und befreite sie aus den Klauen ihrer alchimistischen Vorgänger. Boyle war es, der 1661 in seinem Werk Der skeptische Chemiker die vier metaphysischen Elemente der antiken Heilkunde verwarf und dem Begriff «Elemente» eine neue Bedeutung verlieh als einfachen, reinen, nicht weiter zerlegbaren Körpern, die aus «Korpuskeln» bestimmter Art bestanden. Boyle sah auch die Analyse als die wichtigste Aufgabe der Chemie an, wobei er das Wort «Analyse» in den chemischen Kontext einführte: Man zerlegte komplexe Stoffe in ihre konstituierenden Elemente und untersuchte, wie sie sich verbinden ließen. Boyles Projekt gewann Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts erheblich an Bedeutung, als man in rascher Folge mehr als ein Dutzend neuer Elemente isolierte.
Doch beim Isolieren dieser Elemente herrschte erhebliche Verwirrung. 1774 gewann der schwedische Chemiker Carl Wilhelm Scheele einen dichten grünlichen Dampf aus Chlorwasserstoffsäure, erkannte aber nicht, dass es sich um ein Element handelte. Stattdessen hielt er den Dampf für «dephlogistierte Salzsäure». Im selben Jahr isolierte Joseph Priestley Sauerstoff und bezeichnete das Gas als «dephlogistierte Luft». Diese Fehldeutungen entsprangen einer etwas mystischen Theorie, die die Chemie während des 18. Jahrhunderts beherrscht und in gewisser Weise ihre Fortschritte verhindert hat. Man glaubte, «Phlogiston» sei eine immaterielle Substanz, die von brennenden Körpern abgegeben werde; sie sei Wärmestoff.
Lavoisier, dessen Elemente erschienen, als Davy elf war, widerlegte die Phlogistontheorie und wies nach, dass Verbrennung nicht auf dem Verlust eines geheimnisvollen «Phlogistons» beruhte, sondern aus der Verbindung der Stoffe, die verbrannt wurden, mit dem Sauerstoff in der Atmosphäre resultierte (Oxidation).
Durch Lavoisiers Werk wurde Davy mit achtzehn Jahren zu seinem ersten bahnbrechenden Werk angeregt, als er Eis durch Reibung zum Schmelzen brachte und damit zeigte, dass Wärme reine Energie war und kein materieller Stoff wie die kalorische Substanz. «Die Widerlegung der kalorischen Substanz oder Wärmeflüssigkeit ist bewiesen», jubelte er. Die Ergebnisse seiner Experimente veröffentlichte Davy in einer langen Abhandlung mit dem Titel «Ein Versuch über Wärme, Licht und die Verbindungen des Lichts»; sie enthielt eine Kritik an Lavoisier und aller Chemie seit Boyle sowie den Entwurf einer neuen Chemie, die er zu begründen hoffte – einer Chemie, die von allem metaphysischen und gespenstischem Beiwerk der alten Chemie bereinigt sein sollte.
Die Nachricht von dem jungen Mann und seinen revolutionär neuen Vorstellungen über Materie und Energie kam Thomas Beddoes zu Ohren, der damals Chemieprofessor in Oxford war. Beddoes lud Davy in sein Labor in Bristol ein, und hier vollendete Davy sein erstes bedeutendes Werk: einen Bericht über die Isolierung von Stickoxiden und ihre physiologischen Auswirkungen.[*]
In Bristol begann Davys Freundschaft mit Coleridge und den romantischen Dichtern. In dieser Zeit schrieb er selbst viele Gedichte. Seine Notizhefte sind eine bunte Mischung aus Einzelheiten chemischer Experimente, Gedichten und philosophischen Reflexionen. Joseph Cottle, der Coleridge und Southey veröffentlicht hatte, war der Meinung, Davy sei in demselben Maße Dichter wie Naturforscher gewesen und habe in beiderlei Hinsicht die Besonderheit seines Wahrnehmungsvermögens bewiesen: «Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass er, hätte er nicht als Philosoph geglänzt, Großes als Dichter geleistet hätte.» Tatsächlich wurde Davy 1800 von Wordsworth gebeten, die Veröffentlichung der zweiten Ausgabe seiner Lyrical Ballads zu beaufsichtigen.
Zu dieser Zeit herrschte noch die Einheit von literarischer und wissenschaftlicher Kultur; die Empfindsamkeit war noch nicht ausgegrenzt worden. Coleridge und Davy waren einander in enger Freundschaft und einem Gefühl fast mystischer Verwandtschaft und Entsprechung verbunden. Der Vergleich mit der chemischen Verwandlung, die zur Entstehung vollkommen neuer Verbindungen führte, war von zentraler Bedeutung für Coleridges Denken. Eine Zeitlang plante er sogar, sich mit Davy zusammen ein chemisches Labor einzurichten. Als Krieger, Analytiker und Forscher hatten sich der Dichter und der Chemiker dem Prinzip des tiefen Zusammenhangs von Geist und Natur verschrieben.[*]
Coleridge und Davy schienen sich als Zwillinge zu begreifen: Coleridge als Chemiker der Sprache, Davy als Dichter der Chemie.
In die Zuständigkeit der Chemie fielen zu Davys Zeit nicht nur chemische Reaktionen im eigentlichen Sinn, sondern auch das Studium von Wärme, Licht, Magnetismus und Elektrizität – also vieles von dem, was später als Physik abgetrennt werden sollte. (Noch Ende des 19. Jahrhunderts hielten die Curies die Radioaktivität zunächst für eine «chemische» Eigenschaft bestimmter Elemente.) Obwohl man schon im 18. Jahrhundert statische Elektrizität kannte, konnte man keinen dauerhaften elektrischen Strom erzeugen, bis Alessandro Volta ein Sandwich aus zwei verschiedenen Metallen erfand, zwischen denen er in Salzlake getauchte Pappe gelegt hatte. Diese Vorrichtung, die Volta’sche Säule, erzeugte einen stetigen elektrischen Strom: Sie war die erste Batterie. Später schrieb Davy, Voltas 1800 veröffentlichter Artikel sei für die europäischen Experimentalforscher wie ein Weckruf gewesen, und für Davy selbst nahm plötzlich Gestalt an, was er von nun an als seine Lebensaufgabe betrachten sollte.
Er überredete Beddoes, eine große elektrische Batterie nach dem Vorbild der Volta’schen Säule zu bauen, und begann 1800 mit seinen ersten Experimenten. Fast von Anfang an vermutete er, dass der elektrische Strom durch chemische Veränderungen in den Metallplatten erzeugt werde, und fragte sich, ob auch das Umgekehrte zutreffe: Konnte man chemische Veränderungen erzeugen, indem man elektrischen Strom durch das Metall schickte? Dazu nahm er einfallsreiche und radikale Veränderungen an der Batterie vor und nutzte die neue Energie als Erster, um eine neue Form der Beleuchtung zu entwickeln, die Kohlebogenlampe.
Mit diesen glänzenden Erfolgen machte er die Hauptstadt auf sich aufmerksam und wurde noch im selben Jahr in die gerade gegründete Royal Institution eingeladen. Er war schon immer sehr beredt und ein begnadeter Geschichtenerzähler gewesen, jetzt sollte er der berühmteste und einflussreichste Vortragsredner Englands werden. Wenn er sprach, drängten sich die Massen vor dem Eingang und blockierten die Straßen. Seine Vorträge bewegten sich von den winzigsten Einzelheiten seiner Experimente – wenn man sie liest, bekommt man einen lebhaften Eindruck von der Vorgehensweise eines ganz außergewöhnlichen Verstandes – bis hin zu kühnen Spekulationen über das Universum und das Leben, dargeboten in einer mitreißenden, unvergleichlichen Sprache.
Davys Antrittsvortrag verzauberte viele Zuhörer, unter ihnen auch Mary Shelley. Jahre später legte sie in Frankenstein ihrem Professor Waldman bei dessen Vortrag einige Ausführungen von Davy fast wörtlich in den Mund. (Insbesondere hatte Davy, als er über galvanische Elektrizität sprach, gesagt: «Ein neuer Einfluss wurde entdeckt, der dem Menschen ermöglichte, aus Kombinationen toter Materie Wirkungen hervorzurufen, die bisher nur durch tierische Organe hervorgebracht wurden.») Und Coleridge, der größte Redner seiner Zeit, erschien stets zu Davys Vorträgen, nicht nur um seine chemischen Notizhefte zu füllen, sondern auch, um «meinen Metaphernvorrat zu erneuern».[*]
In den frühen, unbeschwerten Tagen der industriellen Revolution herrschte ein außergewöhnliches Interesse an den Naturwissenschaften, besonders der Chemie; sie schien eine neue, vielversprechende (und keineswegs pietätlose) Möglichkeit zu sein, die Welt nicht nur zu verstehen, sondern auch, sie in einen besseren Zustand zu versetzen. Diese doppelte Auffassung von den Naturwissenschaften fand ihren idealen Vertreter in Davy.
In diesen ersten Jahren der Royal Institution ließ Davy seine allgemeineren Spekulationen beiseite und konzentrierte sich auf bestimmte praktische Probleme: etwa auf die Probleme des Gerbens und die Isolierung des Gerbstoffs (er hatte ihn als Erster im Tee entdeckt) und auf eine Reihe landwirtschaftlicher Probleme – als Erster erkannte er die Bedeutung von Stickstoff und Ammoniak für Dünger (seine Elements of Agricultural Chemistry erschienen 1813).
Doch 1806, nachdem sich sein Ruf als glänzendster Redner und praktischer Chemiker Englands gefestigt hatte – und das im jugendlichen Alter von 27 Jahren –, empfand er das Bedürfnis, seine Forschungsaufgaben an der Royal Institution aufzugeben, um zu den grundlegenden Fragen seiner Zeit in Bristol zurückzukehren. Schon längere Zeit fragte er sich, ob sich mit Hilfe des elektrischen Stroms nicht ein neues Verfahren zur Isolierung chemischer Elemente entwickeln lasse. Er begann mit der Elektrolyse von Wasser zu experimentieren, indem er es mit elektrischem Strom in seine Bestandteile, die Elemente Wasserstoff und Sauerstoff, zerlegte und zeigte, dass sie sich in einem exakten Verhältnis verbinden.
Im folgenden Jahr führte er die berühmten Experimente durch, in denen er mittels elektrischen Stroms metallisches Kalium und Natrium isolierte. Als der Strom floss, so schrieb Davy, «zeigte sich am negativen Draht ein intensives Licht, und eine Flammensäule … stieg vom Kontaktpunkt auf». Schließlich bildeten sich glänzende Metallkügelchen – äußerlich nicht von Quecksilberkügelchen zu unterscheiden – zweier neuer Elemente, Kalium und Natrium. «Oft entzündeten sich die Kügelchen im Augenblick ihrer Entstehung», merkte er an, «manchmal explodierten sie auch und teilten sich in kleinere Kügelchen auf, die im Zustand heftiger Verbrennung mit großer Geschwindigkeit durch die Luft flogen und dabei prächtige Feuerschweife hervorriefen». Bei diesem Anblick sei Davy, wie sein Vetter Edmund berichtet, vor Freude durchs Labor getanzt.[*]
Mein größtes Vergnügen als Junge war es, Davys elektrolytische Herstellung von Natrium und Kalium zu wiederholen und zu beobachten, wie diese glänzenden Kügelchen sich an der Luft entzündeten und mit einer hellgelben oder blasslila Flamme brannten. Später gewann ich Rubidium (das mit einer wunderhübschen rubinroten Flamme brennt) – ein Element, das Davy zwar noch nicht kannte, das er aber sicherlich sehr geschätzt hätte. Dabei identifizierte ich mich so stark mit Davys Originalexperimenten, dass ich fast das Gefühl hatte, ich sei es, der diese Elemente gerade entdeckte.
Als Nächstes wandte sich Davy den alkalischen Erden zu und isolierte binnen weniger Wochen ihre metallischen Elemente – Calcium, Magnesium, Strontium und Barium. Es handelte sich um außerordentlich reaktionsfreudige Metalle, besonders Strontium und Barium brannten, wie die Alkalimetalle, mit strahlend bunten Flammen. Und als sei die Isolation von sechs neuen Elementen in einem einzigen Jahr nicht genug, entdeckte Davy im folgenden Jahr noch ein weiteres Element, das Bor.
In der Natur kommen Natrium und Kalium nicht in elementarer Form vor; sie sind zu reaktionsfreudig und verbinden sich augenblicklich mit anderen Elementen. Stattdessen finden wir ihre Salze – Natriumchlorid zum Beispiel (Speisesalz) –, Verbindungen, die chemisch inaktiv und elektrisch neutral sind. Doch wenn man sie, wie Davy, mittels zweier Elektroden einem starken elektrischen Strom aussetzt, kann das Salz zerfallen, da seine elektrisch geladenen Teilchen (in diesem Fall elektropositives Natrium und elektronegatives Chlor) von den entsprechenden Elektroden angezogen werden. (Faraday bezeichnete diese Teilchen später als «Ionen».)