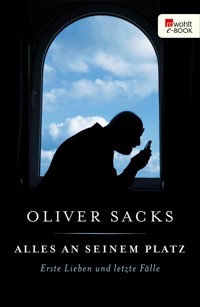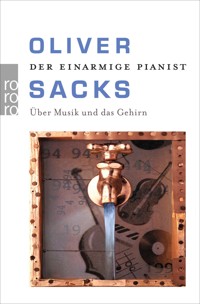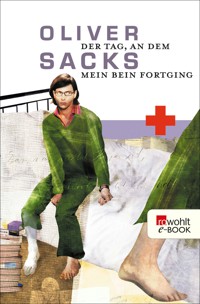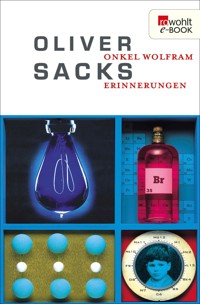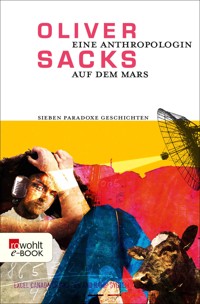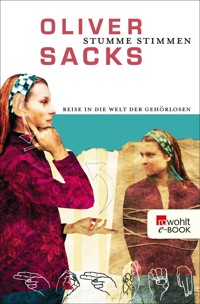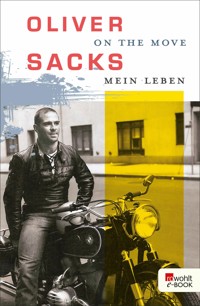9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Zwischen 1916 und 1927 grassierte weltweit eine Epidemie der sogenannten Europäischen Schlafkrankheit, eine Gehirnkrankheit, die neben fast fünf Millionen Toten unzählige schwergeschädigte Menschen hinterließ. Der Neuropsychologe Oliver Sacks stieß Ende der sechziger Jahre in einem Krankenhaus bei New York auf Überlebende dieser Epidemie, und er begann, sie mit einem neu entdeckten Medikament, L-Dopa, zu behandeln. Die Wirkung des Medikaments war überwältigend - jahrzehntelang "erstarrte" Menschen erwachten plötzlich wieder zum Leben. Oliver Sacks beschreibt in seinem Buch die Geschichte dieser Menschen und die schier unfassbaren Folgen der Dopamin-Behandlung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 774
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Oliver Sacks
Awakenings – Zeit des Erwachens
Über dieses Buch
Zwischen 1916 und 1927 grassierte weltweit eine Epidemie der sogenannten Europäischen Schlafkrankheit, eine Gehirnkrankheit, die neben fast fünf Millionen Toten unzählige schwergeschädigte Menschen hinterließ. Der Neuropsychologe Oliver Sacks stieß Ende der sechziger Jahre in einem Krankenhaus bei New York auf Überlebende dieser Epidemie, und er begann, sie mit einem neu entdeckten Medikament, L-Dopa, zu behandeln. Die Wirkung des Medikaments war überwältigend – jahrzehntelang «erstarrte» Menschen erwachten plötzlich wieder zum Leben.
Oliver Sacks beschreibt in seinem Buch die Geschichte dieser Menschen und die schier unfassbaren Folgen der Dopamin-Behandlung.
Vita
Oliver Sacks, geboren 1933 in London, war Professor für Neurologie und Psychiatrie an der Columbia University. Er wurde durch die Publikation seiner Fallgeschichten weltberühmt. Nach seinen Büchern wurden mehrere Filme gedreht, darunter «Zeit des Erwachens» (1990) mit Robert de Niro und Robin Williams. Oliver Sacks starb am 30. August 2015 in New York City.
Bei Rowohlt erschienen unter anderem seine Bücher «Awakenings – Zeit des Erwachens», «Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte», «Der Tag, an dem mein Bein fortging», «Der einarmige Pianist» und «Drachen, Doppelgänger und Dämonen». 2015 veröffentlichte er seine Autobiographie «On the Move».
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, April 2019
«Awakenings» Copyright © 1973, 1976, 1982, 1983, 1987, 1990 by Oliver Sacks
«Bewußtseinsdämmerungen» Copyright © 1989 by VCH Verlagsgesellschaft mbH, Weinheim
Covergestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt
Coverabbildung Heidi Sorg, München
ISBN 978-3-644-00088-9
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Alexandre Métraux
Biographie und Biologie.
Einige Bemerkungen zur Neuroanthropologie von Oliver Sacks
Vor einigen Jahren erschienen in der New York Review of Books und der nicht weniger angesehenen London Review of Books in unregelmäßiger Folge Beiträge, die man üblicherweise nicht dort, sondern in neurologischen oder neuropsychologischen Fachzeitschriften erwarten könnte. Diese Texte trugen Titel wie Musical Ears (Musikalische Ohren), The Man who Mistook his Wife for a Hat (Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte), Hands (Hände) oder The Presidents Speech (Die Ansprache des Präsidenten). Bei allen handelte es sich um neurologische Fallgeschichten. Und doch fanden sie in den literarischen Journalen nicht deshalb Eingang, weil ihrem Urheber, Oliver Sacks, der Zutritt zu medizinischen Zeitschriften verwehrt worden wäre (er veröffentlicht ja regelmäßig u.a. im Lancet), sondern deshalb, weil in ihnen an die Beschreibung pathologischer Verirrungen der Natur die Frage nach den Bedingungen der psychischen Tätigkeiten des Menschen geknüpft wurde.
Ein Beispiel. Am 15. August 1985 erscheint in der New York Review of Books die knapp vier Spalten umfassende Fallgeschichte ‹Die Ansprache des Präsidenten›:
Im Aufenthaltsraum einer Station, auf der Menschen mit Sprachstörungen behandelt werden, läuft der Fernseher. Es wird eine Ansprache des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika übertragen. Dem Redner, einst Schauspieler in drittklassigen Streifen und in Werbefilmen, werden von seinen Anhängern rednerisches Können, Überzeugungskraft sowie die Beherrschung der Massenkommunikationsregeln zugeschrieben – doch die Patienten krümmen sich während der Ansprache vor Lachen oder kichern höhnisch. Was geht da vor? Den Lachern, die an sensorischer Aphasie als Folge einer wie auch immer entstandenen linksseitigen Hirnrindenschädigung leiden, muß an der Redeweise des Präsidenten etwas auffallen, das anderen Menschen üblicherweise verborgen bleibt.
Die Feststellung eines traumatisch bedingten Wortverständnisverlusts ist häufig nur dadurch zu erzielen, daß eine unnatürliche Sprechsituation hergestellt wird, in der die Begleiterscheinungen sprachlicher Äußerungen (Tonfall, Mimik, Gestik, Haltung usw.) keine Rolle mehr spielen. Oder anders : erst wenn das Reden, das sich an den auf Aphasie untersuchten Patienten richtet, zu einer neutralen Wortkette gemacht wird, läßt sich ermessen, wie stark der Wortverständnisausfall ausgeprägt ist. Der künstlich herbeigeführte Wegfall dessen, was der Logiker Gottlob Frege zur Charakterisierung der Begleiterscheinungen sprachlicher Äußerungen als ‹Beleuchtung› oder ‹Färbung› bezeichnet hat[*], ist für die Erfassung der Wortverständnisstörung unerläßlich.
Patienten mit einem derartigen Funktionsausfall vermögen allerdings durch die Verschiebung ihrer Aufmerksamkeit auf die Färbung oder Beleuchtung verbaler Äußerungen in natürlichen Sprechsituationen die Beeinträchtigung teilweise wettzumachen. Dadurch wird letztere beinahe unauffällig. Zugleich reagieren solche Patienten überaus empfindlich auf die Färbungen der von ihnen wahrgenommenen Sprechhandlungen. So heißt es, daß man an sensorischer Aphasie leidende Patienten nicht belügen und ihnen nichts vormachen könne – sie hören die Lüge aus dem Tonfall, die leere Versprechung aus dem Gehabe eines Sprechenden heraus. Deshalb also das Gelächter, das der sprechende Präsident auslöst.
Im Aufenthaltsraum verfolgt auch Edith D. das Geschehen. Wegen einer Geschwulst im rechtsseitigen Schläfenlappen leidet diese Patientin an tonaler Agnosie : sie ist nicht mehr imstande, die Färbung oder Beleuchtung sprachlicher Äußerungen wahrzunehmen. Für sie sind Sprechhandlungen nur verstehbar, wenn diese aus grammatikalisch und syntaktisch richtig zusammengesetzten Wortketten bestehen – wenn sie gleichsam eine dürre, spröde Prosa bilden. Umgangssprachliche Wendungen, emotionale Färbung, Tonfall und andere Begleiterscheinungen von Sprechakten sind Edith D. so fremd, wie ihren aphasischen Mitpatienten umgekehrt die puren Wörter ohne Bezug zur Verständigungssituation es sind.
Edith D. kann der Ansprache des Präsidenten auch nichts abgewinnen. Sie ist über die wirre Prosa des Redners so entsetzt, daß Zweifel an dessen Verstand sie beschleichen …
Nun ersetzt eine derartige Fallstudie weder eine Kommunikationstheorie, noch tritt sie zu dieser in Konkurrenz. Sie kann aber auf gewisse empirische Randbedingungen der Verständigung aufmerksam machen, die die Sprachtheoretiker in der ständigen Beschäftigung mit ‹normalen› Sprechakten übersehen könnten. Zudem erlaubt eine Fallstudie wie die kurz vorgestellte, eine Brücke zwischen der Sprachpathologie und der Kommunikationstheorie zu schlagen, wie Aleksandr R. Lurija dies in seinem neurolinguistischen Forschungsprogramm vorgesehen hat.[*]
Aus diesen wenigen Angaben läßt sich bereits ersehen, daß das Schaffen Oliver Sacks’ einer bestimmten Gattung nicht eindeutig zugeordnet werden kann. Es ist bestimmt das eines Neurologen, wenn man an die Menge der mitgeteilten klinischen Beobachtungen und an die Auseinandersetzungen mit Auffassungen der Neurophysiologie, der Neuropharmakologie und anderen Zweigen der Medizin denkt. Zugleich bricht Sacks – besonders in seinen Fallgeschichten – die durch die Neurologie gesetzten Grenzen auf. Was also ist den Fallgeschichten gemeinsam – gleichgültig, ob sie die Beeinträchtigung einzelner psychischer Funktionen (Sprache, begriffliches und anschauliches Denken, visuelle Wahrnehmung, Gedächtnis usw.) zum Gegenstand haben[*] oder, wie im vorliegenden Band, den Zusammenbruch von Denken, Wollen und Handeln als Folge eines massiven Traumas? Sie berichten über mitunter gravierende Zerfallserscheinungen des menschlichen Verhaltens, die mit den Hilfsmitteln der Neurologie analysierbar sind, und thematisieren dennoch unentwegt die Problematik der Bedingung der Möglichkeit menschlichen Daseins. Das wird dadurch erreicht, daß die aus der klinischen Beobachtung gewonnenen Befunde zu lebensgeschichtlichen Lehrstücken umgeschrieben werden. Die so entstehenden Texte erzählen allerdings nicht von großen und kleinen Taten, von Verlegenheiten, Selbstüberwindungen, anerkennungswürdigen Leistungen oder der gelegentlich mühsam errungenen Identität von Personen, sondern von Ereignissen, die, obzwar sie Personen angehören, keinen Eigennamen zu tragen vermögen. Sacks bringt also Ereignisse und Zustände, die unter der Haut oder unterm Schädel lokalisiert sind, in die Form einer Erzählung, die veranschaulicht, wie jemandes Geschichte durch subjektiv manchmal nicht wahrnehmbare Veränderungen des organischen Substrats aus den Angeln gehoben, oder anders: wie jemandes Geschichte durch die Verstrickungen einer untergründig sich abspielenden Gegengeschichte des Körpers gebrochen wird. Und wenn eine Lebensgeschichte derart erschüttert wird, bleibt für glückendes Selbstbewußtsein kein Platz mehr. In manchen Fällen wird es durch die Vorherrschaft des Organischen übrigens so überwuchert, daß im kleinen leiblichen Rest einer Lebensgeschichte (wie Sacks andeutet) archaische Verhaltensformen aus der früheren Gattungsgeschichte des Menschen sichtbar werden.
Die den Fallgeschichten Oliver Sacks’ eignende Irritationskraft ergibt sich also aus der Symbiose zweier Textgattungen: der diskursiven, analytischen, in Medizin und Naturwissenschaft beheimateten einerseits, und der narrativen oder erzählend aufklärenden andererseits, auf die sich die Geschichtswissenschaften und die Dichtung gründen – nur daß bei Sacks nicht selbstbewußt handelnde Personen, sondern die dem neurologischen Blick sich darbietenden organischen Ereignisse und Zustände als ‹Helden› der Geschichte auftreten.
Aber im Ausbildungsweg und in der frühen beruflichen Laufbahn Sacks’ ist nichts zu entdecken, was sich als Vorzeichen seiner heutigen Arbeits- und Denkweisen auslegen ließe. Der am 9. Juli 1933 in London geborene Oliver wurde, wie seine drei älteren Brüder auch, durch die Eltern – beide übten den Arztberuf aus – auf die medizinische Laufbahn eingestimmt und vorbereitet. Vielleicht ist die Tatsache, daß der Vater unter dem berühmten Neurologen Sir Henry Head gearbeitet hatte, für die Entscheidung des jüngsten Sohnes zugunsten einer Laufbahn im Bereich der Neurologie mitbestimmend gewesen. Nach Abschluß der St. Paul’s School in London erhielt Sacks 1951 ein Stipendium des Queen’s College zu Oxford, wo er bis 1954 das medizinische Grundwissen erwarb. Sein Medizinstudium schloß er 1958 am Middlesex Hospital in London ab, an dem er sich dann bis 1960 in Chirurgie und Neurologie spezialisierte. Noch im selben Jahr siedelte er in die USA über. Zuerst arbeitete er in San Francisco am Mount Zion Hospital (Abteilung für Parkinson-Kranke), von 1962 bis 1965 an der Neurologischen Klinik der University of California in Los Angeles. 1966 wurde er an das Albert Einstein College of Medicine im New Yorker Stadtteil Bronx berufen, an dem er seither Neurologie unterrichtet. Inzwischen ist Sacks auch als Berater für verschiedene Hospitäler und Altenheime in New York tätig. Sein erstes Buch Migraine: The Evolution of a Common Disorder[*], das er während seines Aufenthalts in Kalifornien in Angriff genommen hatte, erschien 1970.
Kurz nach der Übernahme der Professur für Neurologie stieß Sacks in einem Hospital für chronisch Kranke auf jene Gruppe von Postenzephalitikern, deren langjährige Beobachtung und Behandlung nicht nur Anlaß des vorliegenden Buches waren, sondern auch zu einer Veränderung der theoretischen Fragestellungen und der medizinischen Denkweise unseres Autors geführt haben. Über Ausmaß und Konsequenzen dieser Veränderung äußert sich Sacks an verschiedenen Stellen seiner Monographie, so daß sich ein Eingehen darauf hier schadlos erübrigt. Hervorzuheben sind aber die Einzigartigkeit des Themas dieser Monographie sowie die Art, wie das Thema behandelt wird.
Die Patientengruppe, der Sacks während gut fünf Jahren unermüdlich seine Aufmerksamkeit geschenkt hat, umfaßt achtzig Personen, die an der 1916/1996 ausgebrochenen epidemischen Encephalitis lethargica erkrankt waren und wegen der mitunter schlimmen Folgen dieser Gehirnerkrankung versorgt werden mußten. Sie waren im Laufe der Zeit in das Hospital verlegt worden, dem Sacks den Decknamen ‹Mount Carmel› gegeben hat, und bildeten Mitte der sechziger Jahre die größte Postenzephalitiker-Gruppe der USA (vermutlich auch der Welt).
Die Encephalitis lethargica – sie wird auch Encephalitis epidemica, europäische Schlafkrankheit oder Economo-Krankheit genannt, letzteres nach dem Wiener Neurologen Constantin von Economo (1876–1931), der sie ausführlich beschrieben hat[*] – ist Ursache von ‹Nachkrankheiten›[*], deren Bild dem des Parkinsonismus ähnlich ist. Dieser Ähnlichkeit liegt ohne Zweifel jener Analogieschluß zugrunde, durch den die in ihrem Kranksein gefangenen, in sozialer Isolation lebenden und ihrer Lebensgeschichte beraubten Patienten zu individuell unterschiedlichen ‹Trägern› anthropologisch aufsehenerregender und aufschlußreicher Episoden wurden :
1960 gelang der Nachweis, daß bei Parkinsonismus ein Mangel der als Neurotransmitter wirkenden Substanz Dopamin vorliegt. Dieser Mangel kann durch Zufuhr der natürlichen Vorstufe von Dopamin, nämlich Laevodihydroxyphenylalanin (auch L-DOPA genannt), mindestens soweit ausgeglichen werden, daß sich ein Einsatz dieser Substanz zu therapeutischen Zwecken lohnt. Ende der sechziger Jahre war klar, daß L-DOPA, wenn es schon bei Parkinson-Kranken zu einem gewissen, wenngleich nicht immer eindeutigen Erfolg führt, postenzephalitischen Patienten wohl nicht abträglich wäre. Die ersten Versuche zeitigten jedoch die erwartete Wirkung nicht. Erst die mit Risiken behaftete Vervielfachung der Dosis bewirkte eine überraschende Erwekkung auch der am schwersten betroffenen Postenzephalitiker aus dem Zustand der Erstarrung, der Sprachunfähigkeit, der Bewußtseinsgerinnung und der Geschichtslosigkeit, in den sie Jahrzehnte zuvor geraten waren.
Mit anderen Worten : erst die gezielte Verabreichung einer Substanz, die die Störung wichtiger Mechanismen des Zentralnervensystems teilweise behebt, erlaubte es Sacks, mit den Opfern der Encephalitis lethargica-üpidemie eine effektive Verständigung aufzubauen. Die in dieser neuen Situation entstandenen Krankengeschichten nehmen sich denn auch nicht wie Berichte unbeteiligter Beobachter aus, sondern lassen sich wie Erzählungen eines Leidenswegs nachvollziehen, die von den Augenzeugen desselben beglaubigt sind.
Daß ein Medikament einen leidenden Organismus aus der ‹epidemischen Schlummersucht›[*] holen und ihn – wenn auch nur vorübergehend – zu einer Person machen kann, die ihre verschüttete Lebensgeschichte rekonstruiert, ist gewiß eine aufsehenerregende Tatsache. Beließe man es aber allein beim ‹biochemischen› Aspekt oder reduzierte man die zwanzig von Sacks vorgestellten Fallgeschichten auf eine Reportage über das Geschick einer ‹Wunderdroge›, würde der Gehalt des vorliegenden Buches um den wesentlichen Bestandteil amputiert werden.
Wie die Encephalitis lethargica sich schlagartig ausbreitete, so verschwand sie Mitte der zwanziger Jahre ebenso plötzlich. Eine Wiederholung der Epidemie ist zwar nicht ausgeschlossen. Aber es deutet alles darauf hin, daß die heutige Medizin aufgrund der früheren Erfahrungen und dank der Fortschritte der therapeutischen Verfahren der Encephalitis lethargica anders als damals entgegentreten würde. Vermutlich würde eine erneute Epidemie die Ausmaße derjenigen von 1916 bis 1927 nicht erreichen. Zudem würden die Erkrankten nicht wie die Patienten von ‹Mount Carmel› jahrzehntelang mit einer nachträglich kaum faßbaren Vergessenheit (Abschiebung und Versorgung in Institutionen, Ausblendung aus dem Bewußtsein der Ärztegemeinschaft) bedacht werden[*]. Doch gerade diese Vergessenheit der Postenzephalitiker, die Verfügbarkeit von L-DOPA zu einem günstigen Zeitpunkt, und die Beobachtungs- und Experimentierfreudigkeit von Oliver Sacks, die sich mit einer leidenschaftlichen Geduld in ausweglos erscheinenden Lagen und mit einem ausgeprägten Sinn für die Erweiterung der medizinischen Problematik der neurologischen Störung durch die anthropologische Problematik der krankheitsbedingten Lebensbehinderung verbindet, bildeten die Konstellation, dank der die Geschichten über die Bewußtseinsdämmerung einiger Menschen nicht prinzipiell einmalig, sondern, weil wahrscheinlich unwiederholbar, in der Tat einzigartig sind[*]
Jede der im vorliegenden Band enthaltenen Fallgeschichten ist – für sich genommen – menschlich bewegend. Sei es, weil die Leserin oder der Leser in Verfolgung eines detaillierten Berichts und unter Nachhilfe des eigenen Vorstellungsvermögens zu begreifen vermag, was es für einen Menschen heißt, lebensgeschichtlich endlich wieder zu sich zu kommen; sei es, weil anschaulich vorgeführt wird, daß etwas, das bei manchem Patienten zur Linderung des Leids beiträgt, bei anderen Kranken allen Bemühungen zum Trotz nicht mehr hilft. Und wie das ursprünglich von Economo gezeichnete Bild der Encephalitis lethargica uneinheitlich war, weil es voller Paradoxe steckte, so sind die individuellen Fallgeschichten uneinheitlich – als ob die Individualität des einzelnen Kranken sich nur mehr in unterschiedlichen organischen Geschehen bemerkbar machte. Deshalb sind induktive Verallgemeinerungen lediglich geringer Reichweite möglich. Dennoch lassen sich aus der widersprüchlichen postenzephalitischen Symptomatik – insonderheit dann, wenn man den Kontrast zwischen den Zuständen vor und denen während der Behandlung durch L-DOPA im Auge behält – einige Merkmale hervorheben, die für die anthropologische Problematik belangvoll sind.
Alle von Sacks untersuchten und behandelten Patienten litten unter Bewußtseinsverzerrungen und Aufmerksamkeitsverlagerungen. Es ging jedoch nicht um wahnähnliche Phänomene oder um Depersonalisationserscheinungen, sondern um eine zwangsartige Innengewandtheit der Aufmerksamkeit auf das Verhalten, das sich jeder Steuerung entzog. Es spielt dabei keine Rolle, ob das Verhalten, das sich dem Patienten regelrecht aufdrängte, zum Bereich des Mentalen gehörte, wie im Falle einer Rechenoperation, oder zu dem der Motorik, wie im Falle des Gehens oder des Hantierens mit einem Gegenstand. Was verhaltensmäßig auch immer geschah, überwältigte unwiderstehlich den Willen und das Gefühl der Postenzephalitiker, deren Selbst in die qualvolle Nebenrolle eines passiv Erduldenden verdrängt wurde. Das ist mit ein Grund, warum Sacks mehrfach Querverbindungen zwischen dem Zustand der Postenzephalitiker und dem Phänomen des Tics bzw. dem Tourette-Syndrom herstellt. Und wenn in der deutschsprachigen Terminologie schon in den zwanziger Jahren im Zusammenhang der Encephalitis lethargica von Schlafkrankheit und Schlummersucht die Rede war, dann betraf dies nicht nur den Krankheitsverlauf, der bei Hunderttausenden zum Tod nach langem Koma führte, sondern auch die Unansprechbarkeit der Überlebenden auf die Umwelt bei grundsätzlich intakt gebliebenen geistigen Fähigkeiten: denn ihr Selbst schlummerte ohnmächtig hinter ihrem unbeherrscht mal so, mal anders sich aufdrängenden, ein merkwürdig anonymes Eigenleben führenden Verhalten.
Es fällt ferner auf, daß sich die Verhaltensweisen der Postenzephalitiker durch extreme Verlangsamung oder extreme Beschleunigung auszeichnen. Der Gang vom Bett zum Fenster oder das innere Sprechen eines Satzes kann so in übermäßiger Hast erfolgen oder Stunden in Anspruch nehmen. Was Philosophen und Psychologen im gelegentlich verzweifelten Versuch, die Zeitlichkeit des Erlebens zu erfassen, mit Hilfe von Metaphern als ‹Strom›, als ‹Fließen›, als ‹Gestalt› mit fließendem Übergang von einem Gegenstand im Brennpunkt der Aufmerksamkeit zu einem anderen Gegenstand im Brennpunkt der Aufmerksamkeit oder auch als ‹gelebte Zeit› beschrieben haben, scheint sich bei den postenzephalitischen Patienten verselbständigt und jede mit der Musikalität eines Geschehens vergleichbare Ebenmäßigkeit eingebüßt zu haben. Die Postenzephalitiker verhalten sich so, als ob ihnen der inwendige Zeitsinn für den Duktus des Sprechens, des Überlegens, der Lokomotion, des Wahrnehmens und Fühlens abhanden gekommen sei – oder so, als ob das Zeitmaß durch die aus den Fugen geratene Gehirntätigkeit diktiert würde (was übrigens auch die vermittels des Elektroenzephalogramms erhaltenen Meßwerte nahezulegen scheinen). Die krankheitsbedingte Abwendung der Aufmerksamkeit von der Welt – der materiell-gegenständlichen und der gesellschaftlichen in einem – bricht folglich den Bezug zur kosmischen wie auch zur konventionellen Zeit auf. Übrig bleibt die erlittene Zeit der sich wiederholenden, beliebig einsetzenden und ebenso beliebig die Richtung ändernden, bloß auf sich selbst gerichteten Regungen des leiblichen Substrats, das mit seiner Regellosigkeit und Aleatorik den Aufbau einer lebensgeschichtlichen Kontinujtät verhindert.
Wenn nun durch Verabreichung von L-DOPA die Bedingungen für eine erneute Außenwendung der Aufmerksamkeit gegeben sind, wenn also die Patienten nicht mehr von ihren Verhaltensweisen vereinnahmt werden, sondern wieder in der Lage sind, ihr Erleben und Handeln auf die Umwelt abzustimmen, machen sie die Erfahrung eines aus der lähmenden Abgeschiedenheit zu sich kommenden geschichtlichen Selbst. Die einen lassen ihre Biographie an den Zeitpunkt der Erkrankung anknüpfen und leben in ihrer Jugend weiter, leben also mit einer jahrzehntelangen Verzögerung ihr Leben dort weiter, wo es nichts mehr zu erleben gab; andere bringen Ereignisse, die sie im Schlummer entfernt noch mitbekommen haben, in eine zeitlich-kontinuierliche Ordnung. Was allerdings nicht heißt, daß die Wiedergewinnung der chronologischen Rahmenbedingung für die Konstruktion einer Lebensgeschichte jeweils als Erlösung empfunden wird. Denn einige Patienten können sich ja zum Zeitpunkt des Zu-sich-Kommens nicht vor der Erkenntnis verschließen, daß sie alterslos alt geworden sind. Man sollte also gerade die Problematik des Erwachens des Selbst nach der geschichtslosen Zeit nicht unterschätzen, da die Linderung der Aufmerksamkeitsstörung einerseits, der nicht beherrschbaren Abfolge chaotischer Verhaltensweisen andererseits in einzelnen Fällen dramatisch und konflikthaft verläuft, will sagen : die Erkenntnis eines kaputten Lebens unausweichlich macht.
Diese und andere Überlegungen zum Thema ‹Biographie und Biologie› lassen vermuten, daß das Bild, das man sich vom Menschen macht, denn doch etwas zu kurz geraten ist. Es scheint ja nicht zu genügen, den Menschen als ein bewußt sich selbst bestimmendes, seine Lebensgeschichte aufbauendes und seine Identität suchendes Individuum zu bestimmen. Die von Descartes propagierte Definition des Menschen aus dem bloßen Bewußtsein und aus der reinen Inwendigkeit heraus hat zwar längst ausgedient. Fragt sich nur, ob die Überwindung der Position Descartes’ konsequent genug betrieben worden ist. Denn die Fallgeschichten, über die in diesem Buch berichtet wird, lassen die trägen, widersetzlichen, ein merkwürdig anonymes Eigenleben führenden organischen Determinanten menschlichen Daseins sichtbar werden, die die Macht anderer Determinanten der Lebensgeschichte – die individuellen wie auch die gesellschaftlichen – außer Kraft setzen oder mit ihnen wie mit Spielbällchen umgehen. So gewinnt man den Eindruck, daß bei geglückten Lebensgeschichten das individuelle Bewußtsein den Taktstock führt, daß aber auch dann die Partitur vom organischen Leben unter der Haut und von den gesellschaftlichen Konstellationen geschrieben wird.
Danksagung
Zuerst (und unendlich) zu Dank verpflichtet bin ich den außergewöhnlichen Patienten des Mount Carmel-Hospitals in New York, über deren Geschichten ich im vorliegenden Buch berichte und denen Awakenings ursprünglich gewidmet war.
Im Rückblick auf ein Vierteljahrhundert ist es nicht leicht, sich an alle zu erinnern, die in Mount Carmel mit unseren Kranken beschäftigt waren und direkt oder indirekt an der Entstehung von Awakenings teilhatten. Gern denke ich aber an das Pflegepersonal zurück – Ellen Costello, Eleanor Gaynor, Janice Grey und Melanie Epps; vom Arztpersonal an Walter Schwartz, Charles Messeloff, Jack Sobel und Flora Tabbador; ferner an unsere Sprachtherapeutin, meine engste Helferin in den entscheidenden drei Jahren der Erweckung unserer Patienten, Margie Kohl Inglis; an unseren EEG-Fachmann, Chris Carolan, der an den ‹Bioelektrischen Grundlagen des Erwachens› mitgearbeitet hat; an unseren Pharmakologen, Bob Malta, der stundenlang L-DOPA verkapselte, von Schwaden dopaminergischen Staubs eingehüllt; sowie an engagierte Beschäftigungs- und Physiotherapeuten. Besondere Erwähnung verdienen unsere Musiktherapeuten – Kitty Stiles für die ersten Jahre des Erwachens unserer Patienten und Connie Tomaino, ihre Nachfolgerin bis heute –, mit denen ich am engsten zusammenarbeitete, da sich Musik als die für unsere Patienten wirksamste nicht-chemische Behandlung erwies.
Besonderen Dank schulde ich meinen englischen Kollegen vom Highlands-Hospital, die mir den Kontakt zu einer außergewöhnlichen Gruppe von Kranken ermöglichten, welche auffällige Ähnlichkeiten mit unseren Patienten in Mount Carmel aufwiesen und sich dennoch radikal von ihnen unterschieden. Besonders erwähnen möchte ich den freundschaftlichen Beistand von Gerald Stern und Donald Calne, die 1969 diesen Patienten zum ‹Erwachen› verhalfen; James Sharkey und Rodwin Jackson, die seit 1945 gemeinschaftlich die Patienten betreuten; Bernard Thompson, einen Krankenpfleger, der viele Jahre mit den Patienten verbrachte; und vor allem James Purdon Martin, der mit diesen (und anderen) postenzephalitischen Patienten seit mehr als sechzig Jahren vertraut war. 1969 stattete er Mount Carmel einen Besuch ab, um unsere Patienten im ersten Rausch des ‹Erwachens› zu sehen, und blieb danach eine Art Vaterfigur und Bahnbrecher.
Unzählige andere Kollegen und Freunde haben mir, oder diesem Buch, auf dem Weg geholfen: D.P. dePaola, Roger Duvoisin, Stanley Fahn (und der Basal Ganglia Club), Ilan Golani, Elkhonon Goldberg, Mark Homonoff, William Langston, Andrew Lees, Margery Mark, Jonathan Mueller, H. Narabayashi, Isabelle Rapin, Robert Rodman, Israel Rosenfield, Sheldon Ross, Richard Shaw, Bob Wasserman. Besonders hervorheben möchte ich hier Jonathan Miller, der eine Kopie des Manuskripts von 1969 aufbewahrte, als ich das Original vernichtet hatte, und es Colin Haycraft, meinem ersten Herausgeber und Verleger, zukommen ließ (und der, viel später, das beeindruckende Filmporträt von Ivan Vaughan, Ivan, für die BBC produzierte); Eric Korn, Helfer bei der Herausgabe der Edition von 1976; Lawrence Weschler, der viele der postenzephalitischen Patienten in Mount Carmel kannte und über zehn Jahre hinweg intensiv mit mir alle Aspekte von Zeit des Erwachens diskutierte; und Ralph Siegel, der jetzt mit mir am Thema ‹Chaostherapie und Bewußtseinsdämmerungen› arbeitet.
Ein besonderer Platz gebührt denjenigen Kollegen, die selbst Patienten sind und die Welt des Parkinson-Kranken mit einzigartiger Autorität, der des ‹Insiders›, kennen und beschreiben können. Zu ihnen gehören Ivan Vaughan, Sidney Dorros und Cecil Todes (die alle ihre eigenen Berichte über das Leben mit der Parkinsonschen Krankheit geschrieben haben); und Ed Weinberger, dem ich unendlich vielfältige und bedeutsame Einblicke und Anschauungen verdanke. Viele am Tourette-Syndrom leidende Kranke haben mir geholfen, ihren Zustand, der viele Ähnlichkeiten mit hyperkinetischer Enzephalitis aufweist, besser zu verstehen. Schließlich ist meine eigene postenzephalitische Patientin zu erwähnen, Lillian Tighe, die ich nun seit mehr als zwanzig Jahren kenne : sie war die Zentralfigur des Dokumentarfilms über das Buch und beflügelte auch die Arbeiten an dem Spielfilm zu diesem Thema.
Viele kreative Talente haben sich an Bearbeitungen des Buches für Film, Bühne und Literatur versucht: zuallererst ist hier Duncan Dallas (Yorkshire Television) zu nennen, der 1973 einen prächtigen Dokumentarfilm über Awakenings drehte – er enthält unvergeßliche Bilder der Patienten und Ereignisse, über die ich im Buch berichte, und sollte, wenn immer möglich, von jedem Leser gesehen werden; des weiteren Harold Pinter, der mir 1982 ein außergewöhnliches, von den Awakenings inspiriertes Theaterstück übersandte (A Kind of Alaska), welches im Oktober jenes Jahres vom National Theatre in England uraufgeführt wurde; John Reeves, der 1987 eine bewegende Hörfunkversion von Awakenings für den kanadischen Rundfunk produzierte; Arnold Aprill von City Lit, der 1987 eine ausgezeichnete Bühnenversion in Chicago inszenierte; Carmel Ross, der eine Hörspielversion erarbeitete; und nun Mitarbeiter und Besetzung des Spielfilms über das Buch – vor allem Walter Parkes und Larry Lasker als Produzenten; Steve Zaillian als Drehbuchautor; Penny Marshall als Regisseurin; und natürlich die überragenden Schauspieler Robert De Niro und Robin Williams.
Schließlich möchte ich meiner Agentin Suzanne Gluck und den vielen Lektorinnen und Lektoren von Awakenings meinen Dank aussprechen, die in den letzten siebzehn Jahren die zahlreichen Ausgaben betreut haben : Colin Haycraft, Ken McCormick, Julia Vellacott, Anne Freedgood, Mike Petty, Bill Whitehead, Jim Silberman, Rick Kot und Kate Edgar. Auch auf die Gefahr hin, ungehörig zu erscheinen, muß ich dennoch den ersten und letzten dieser Namen besonders erwähnen; Colin Haycraft von Duckworth, dessen Vertrauensvorschuß und dessen ‹maieutikê technê› der Erstausgabe 1973 zugute kamen; und Kate Edgar für ihre Hilfe bei der Erstellung dieser vorliegenden, wesentlich erweiterten Ausgabe.
In der zweiten Ausgabe finden sich zwei spezielle Danksagungen – an W.H. Auden und Aleksandr R. Lurija, die für mich Mentoren, Freunde und ‹Erwecker› waren. Ich lasse diese Passagen hier aus, möchte jedoch Awakenings, in Dankbarkeit und Liebe, dem Andenken dieser beiden Menschen widmen.
Geleitwort zur Erstausgabe
Thema dieses Buches ist das Leben und Reagieren bestimmter Patienten unter einzigartigen Umständen – und die Folgerungen, die daraus für Medizin und Wissenschaft gezogen werden können. Diese Patienten gehören zu den wenigen Überlebenden der fünfzig Jahre zurückliegenden großen epidemischen Schlafkrankheit (Encepbalitis lethargica) : ihre Reaktionen wurden durch eine aufsehenerregende neue ‹Weckdroge› (Laevodihydroxyphenylalanin, oder kurz: L-DOPA) hervorgerufen. Die Lebensgeschichten und Reaktionen dieser Patienten, die in der gesamten Geschichte der Medizin bisher einzig dastehen, werden in Form ausführlicher Fallgeschichten oder Biographien wiedergegeben; diese nehmen den Hauptteil des Buches ein. Den Fallgeschichten gehen einführende Bemerkungen über die Natur der Krankheit, über die Lebensart nach Ausbruch der Krankheit und über die Droge, die das Leben dieser Kranken verwandelte, voraus. Ein solches Thema scheint vielleicht nur von sehr speziellem oder eingeschränktem Interesse zu sein, doch ist dies meiner Meinung nach nicht der Fall. In den letzten Kapiteln habe ich versucht, einige der weitreichenden Folgen aufzuzeigen, die sich aus der Behandlung des Gegenstands ergeben und die bis zu den allgemeinsten Fragen zu Gesundheit, Krankheit, Leiden, Pflege und zur menschlichen Natur reichen.
Bei einem solchen Buch, das sich mit lebenden Personen beschäftigt, ergibt sich ein schwieriges, möglicherweise unüberwindliches Problem: genaue Angaben zu vermitteln, ohne beruflich und privat entgegengebrachtes Vertrauen zu zerstören. Ich mußte daher die Namen meiner Patienten, Name und Ort des Hospitals, in dem sie leben, sowie einige andere kleinere Umstände ändern. Dennoch habe ich mich bemüht, das, was von grundlegender Bedeutung ist, zu bewahren – die echte, leibhaftige Gegenwärtigkeit der Patienten selbst, das ‹Gefühl› für ihr Leben, ihre Charaktere, ihre Krankheiten, ihre Reaktionen – also für die wesentlichen Bestandteile ihrer seltsamen Situation.
Der allgemeine Stil dieses Buches – abwechselnd zwischen Erzählung und Reflexion, stark durchsetzt mit Bildern und Metaphern, Erläuterungen, Wiederholungen, Abschweifungen und Anmerkungen – hat sich mir einfach durch die Natur der Sache aufgedrängt. Ich habe nicht vor, ein System aufzubauen oder Kranke als Systeme aufzufassen, sondern eine Welt, eine Vielfalt von Welten auszumalen – die Landschaften des Daseins, in denen die Patienten wohnen. Und das Ausmalen von Welten verlangt keine feste und systematische Formulierung, sondern ein aktives Suchen nach Bildern und Ansichten, ein ständiges Gedankenspringen und eine bewegliche Phantasie. Die daraus sich ergebenden stilistischen (und erkenntnistheoretischen) Probleme sind genau dieselben, von denen Wittgenstein im Vorwort zu den Philosophischen Untersuchungen schreibt. Über die Notwendigkeit, Denklandschaften durch Bilder und ‹Bemerkungen› zu beleuchten, sagt er dort:
… dies hing mit der Natur der Untersuchung selbst zusammen. Sie nämlich zwingt uns, ein weites Gedankengebiet, kreuz und quer, nach allen Richtungen hin zu durchreisen. – Die … Bemerkungen dieses Buches sind gleichsam eine Menge von Landschaftsskizzen, die auf diesen langen und verwickelten Fahrten entstanden sind. Die gleichen Punkte, oder beinahe die gleichen, wurden stets von neuem von verschiedenen Richtungen her berührt und immer neue Bilder entworfen … So ist also dieses Buch eigentlich nur ein Album (Wittgenstein 1963, S. 285–286).
Durch das Buch zieht sich eine metaphysische Leitidee – die Ansicht nämlich, daß es nicht ausreicht, Krankheit unter bloß mechanistischen oder chemischen Gesichtspunkten zu betrachten, und daß auch biologische oder metaphysische Aspekte, d.h. Fragen von Krankheitsaufbau und -zweck zu berücksichtigen sind. In meinem ersten Buch Migräne (vgl. Sacks 1970) habe ich von der Notwendigkeit einer solchen zweifachen Herangehensweise gesprochen, und in dem vorliegenden Werk entwickle ich dieses Thema viel weiter. Dabei ist diese Ansicht keineswegs neu – der klassischen Medizin war sie bestens bekannt. In der heutigen Medizin hingegen liegt die Betonung fast ausschließlich auf dem technischen oder mechanistischen Bereich, was zu ansehnlichen Fortschritten, aber auch zu intellektueller Regression und zu einem Mangel an echter Aufmerksamkeit für sämtliche Bedürfnisse und Gefühle der Kranken geführt hat. Dieses Buch stellt einen Versuch dar, diese metaphysische Aufmerksamkeit zurückzugewinnen und neu zu beleben.
Beim Schreiben empfand ich unerwartet große Schwierigkeiten, obwohl die Ideen und Absichten des Buches unkompliziert sind. Doch man kann nicht geradlinig vorgehen, bevor der Weg nicht klar und akzeptiert ist. Man müht sich um die richtige Perspektive, die angemessene Betonung und angebrachte Tonart, nur um sie, völlig unverhofft, wieder zu verlieren. Es ist ein ständiges Ringen um das Wiedererlangen und Bewahren einer präzisen Aufmerksamkeit. Ich kann die Probleme, die mich herausforderten und die meine Leser herausfordern werden, nicht besser als mit dem glänzenden Ausspruch von John Maynard Keynes im Vorwort zu seiner General Theory in Worte fassen:
Für den Autor gestaltete sich die Arbeit an diesem Buch als ein langer Fluchtversuch, und so muß es auch den meisten Lesern beim Lesen ergehen, wenn der vom Autor gegen sie geführte Angriff Erfolg haben soll, der eben darin besteht, den Denk- und Ausdrucksgewohnheiten zu entfliehen. Die Gedanken, welche hier mit soviel Mühe zu Papier gebracht wurden, sind einfach und sollten jedermann einleuchten. Die Schwierigkeit liegt nicht in den neuen Ideen, sondern darin, die alten zu überwinden, die sich – so wie die meisten von uns erzogen wurden – bis in die letzte Hirnwindung hinein eingenistet haben.
Macht der Gewohnheit und Widerstand gegen Veränderung – beherrschend in allen Bereichen des Denkens – erreichen ihren Höhepunkt in der Medizin, im Studium der komplexesten Leiden und Störungen unseres Daseins. Denn hier sind wir gezwungen, die tiefsten, dunkelsten und furchterregendsten Seiten unseres Selbst zu erforschen – die Seiten, die wir allzugerne verleugnen oder übersehen möchten. Die am schwersten in Gedanken oder Worte zu fassenden Gedanken sind die, welche diesen verbotenen Bereich streifen und in uns die stärksten Verleugnungen und die tiefsten Einsichten wieder-erwecken.
O.W.S.
New York, Februar 1973
Vorwort zur aktuellen Ausgabe
Vor vierundzwanzig Jahren kam ich nach Mount Carmel und begegnete den faszinierenden postenzephalitischen Patienten, die dort seit Ende des Ersten Weltkriegs als Opfer der großen Encephalitis lethargzoz-Epidemie eingeschlossen lebten. Economo, der vor einem halben Jahrhundert als erster die Encephalitis lethargica beschrieben hatte, bezeichnete die schwer betroffenen Patienten als ‹erloschene Vulkane›. Im Frühjahr 1969 brachen diese Vulkane wieder auf – in einer weder für ihn noch für irgend jemand anderen unvorhersehbaren Weise. Die stille Atmosphäre in Mount Carmel veränderte sich gänzlich. Vor unseren Augen ereignete sich im Ausmaß einer geologischen Umwälzung das explosionsartige ‹Erwachen›, die ‹Wiederbelebung› von etwa achtzig Patienten, die lange von anderen und sich selbst im Grunde als tot angesehen worden waren. Ich kann nicht ohne große innere Bewegung an diese Zeit zurückdenken – sie war die bedeutsamste und aufwühlendste in meinem und im Leben der Patienten. Wir alle in Mount Carmel waren überwältigt von Emotion, Erregung, Verzückung, ja fast von Ehrfurcht.
Es war keine rein ‹medizinische› Erregung, wie auch diese Bewußtseinsdämmerungen keine rein medizinischen Vorfälle waren. Vielmehr entstand eine sehr menschliche (ja allegorische) Erregung, die ‹Toten› erwachen zu sehen – in diesem Augenblick kam mir der Titel Awakenings in den Sinn, inspiriert von einem Titel von Ibsens Dramen in Übersetzung ‹When We Dead Awaken› (Wenn wir Toten erwachen) – denn Leben, die man für unrettbar verloren hielt, blühten wundervoll wieder auf. Lebendige, vielfältige Persönlichkeiten kamen aus dem Zustand des Totseins, in dem sie jahrzehntelang erstarrt und versteckt gewesen waren, zurück. Wir hatten vielleicht eine dunkle Ahnung von den so lange eingemauerten, lebenssprühenden Persönlichkeiten gehabt – doch in ihrer ganzen Leibhaftigkeit kristallisierten sie sich erst heraus – sprangen uns förmlich an –, als die Patienten ‹erwachtem.
Ich hatte außerordentliches Glück, diesen Patienten gerade zu der Zeit und unter solchen Arbeitsbedingungen zu begegnen. Doch sie waren nicht die einzigen postenzephalitischen Patienten auf der Welt – es gab in den späten sechziger Jahren deren noch viele Tausende, von denen manche in großen Gemeinden in Pflegeanstalten lebten. Jedes größere Land hatte seinen Anteil an Postenzephalitikern. Dennoch ist Awakenings bisher der einzige Bericht über solche Patienten, über ihren jahrzehntelangen ‹Schlaf› und über ihr dramatisches ‹Erwachen› im Jahre 1969.
Ich fand dies damals äußerst seltsam: Warum, fragte ich mich, gab es keine anderen Berichte über dieses Phänomen, das doch überall aufgetreten sein mußte? Warum gab es z.B. keinen entsprechenden Bericht aus Philadelphia, wo ich von der Existenz einer Gruppe ähnlich gearteter Patienten wußte? Warum nicht aus London, wo das Highlands-Hospital die größte Gemeinde postenzephalitischer Patienten in England beherbergte?[*] Oder aus Paris und Wien, wo die Krankheit ausgebrochen war?
Darauf gibt es mehr als nur eine Antwort. Viele Dinge wirkten zusammen gegen die in diesem Buch bevorzugte biographische Vorgehensweise.
Ein Faktor, der diese Studie möglich machte, hatte mit der Situation zu tun. Mount Carmel ist ein Krankenhaus für chronisch Kranke, ein Asyl. Im allgemeinen meiden Ärzte derartige Krankenhäuser oder arbeiten dort eine kurze Zeit, um sie dann so schnell wie möglich zu verlassen. Das war nicht immer so: Im vergangenen Jahrhundert wohnte Charcot praktisch in der Salpêtrière und Hughlings-Jackson im West Riding Asylum – die Begründer der Neurologie hatten wohl erkannt, daß man nur in solchen Krankenhäusern die Abgründe und Einzelheiten der verborgenen Funktionsstörungen erforschen und herausarbeiten konnte. Als Anstaltsarzt war ich nie in einem solchen Krankenhaus, und obgleich ich mehrere Patienten mit postenzephalitischem Parkinsonismus und anderen Störungen in Polikliniken behandelt hatte, hatte ich keine Ahnung, wie umfassend und fremdartig die Auswirkungen der postenzephalitischen Krankheit sind. Für mich war die Ankunft in Mount Carmel 1966 eine Offenbarung. Es war meine erste Bekanntschaft mit einer Krankheit, von deren Tiefen ich zuvor nichts gesehen, gelesen oder gehört hatte – denn allgemein dringen Ärzte nicht in die ‹tiefen Bereiche› vor, noch gibt es nicht viele Berichte über diese Bereiche, aus jenen Abgründen der Not oder Bedrängnis, die jetzt sozusagen unter der medizinischen Wahrnehmungsschwelle liegen. Wenige Doktoren haben jemals die Räume solcher Krankenhäuser und Asyle betreten, und noch weniger hatten die Geduld, zu hören, zu schauen und in die Physiologie sowie in die Zwangslagen dieser immer weniger ansprechbaren Patienten einzudringen. Ferner versiegt die medizinische Literatur über die Encephalitis lethargica eigentlich schon 1935, so daß die damals noch unsichtbaren gravierenden Krankheitsbilder, die erst später auftraten, nie beschrieben wurden. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, daß derartige Patienten überhaupt existierten oder, falls sie existierten, nie beschrieben worden sind.
Die ‹andere›, die gute Seite der Krankenhäuser für chronisch Kranke ist die, daß das Personal oft jahrzehntelang dort arbeitet und lebt. Und so kann es den Patienten außerordentlich nahekommen, sie als Menschen kennen und lieben lernen, anerkennen und respektieren. Deshalb begegnete ich, als ich nach Mount Carmel kam, nicht einfach bloß ‹80 Postenzephalitikern›, sondern 80 Menschen, deren inneres Leben und Dasein dem Personal in einem bemerkenswerten Ausmaß bekannt war – bekannt im konkreten Sinne einer lebensnahen Zusammengehörigkeit, nicht im fahlen, abstrakten Sinne des medizinisichen Wissens. Als ich in diese Gemeinschaft kam – eine Gemeinschaft von Patienten und eine solche von Patienten und Personal –, stellte ich fest, daß ich den Patienten als Individuen begegnete, die sich kaum mehr auf Statistiken oder Listen von Symptomen reduzieren ließen.
Natürlich war dies auch eine einzigartige Zeit für die Patienten und für uns alle. Man hatte in den späten fünfziger Jahren herausgefunden, daß dem Gehirn des Parkinson-Kranken der Neurotransmitter Dopamin fehlt und es durch Anhebung des Dopamin-Spiegels ‹normalisiert werden könne. Doch alle Versuche in dieser Richtung, bei denen das L-DOPA milligrammweise verabreicht wurde, schlugen fehl, bis Dr. George Cotzias mit großem Wagemut einer Gruppe von Patienten die Substanz erstmals in tausendfach größeren Dosen verschrieb. Mit der Veröffentlichung von Cotzias’ Ergebnissen im Februar 1967 veränderte sich plötzlich der Ausblick für die Parkinson-Patienten : Die unglaubliche Hoffnung entstand schlagartig, daß Patienten, die bis dahin nur eine schreckliche und sich immer weiter verschärfende Behinderung zu gewärtigen hatten, durch das neue Medikament wenn nicht geheilt, so doch verändert werden könnten. Das Leben wurde für die Patienten wieder vorstellbar. Zum ersten Mal in vierzig Jahren konnten sie an eine Zukunft glauben. Von diesem Zeitpunkt an war die Atmosphäre wie elektrisch geladen. Einer der Patienten, Leonard L., rief, als er von L-DOPA hörte, in einer Mischung von Enthusiasmus und Ironie aus: «Dopamin ist Auferstehungsamin. Cotzias ist der Messias der Chemie.»
Aber es war nicht das L-DOPA, oder was es versprach, das mich so anregte, als ich als junger Doktor, ein Jahr nach Abschluß der Assistenzzeit, nach Mount Carmel kam. Fasziniert wurde ich durch das Phänomen einer Krankheit, die bei jedem Patienten eine andere Gestalt annahm und die von jenen, die sie zuerst studierten, mit Recht als ‹Phantasmagorie› bezeichnet wurde. («Es gibt nichts in der medizinischen Literatur», schrieb McKenzie [1927], «das vergleichbar wäre mit der Phantasmagorie der Behinderung, die sich im Verlauf dieses seltsamen Leidens manifestiert.») Auf der Ebene des Phantastischen, des Phantasmagorischen, war die Enzephalitis geradezu fesselnd. Es ging um eine Behinderung, die im Vergleich zu anderen Störungen des Nervensystems besser zeigen konnte, wie das Nervensystem organisiert ist und wie Gehirn und Verhalten in tieferen Schichten funktionieren. Der Biologe, der Naturforscher in mir wurde von alldem gepackt – und das brachte mich damals dazu, mit dem Sammeln von Daten für ein Buch über primitive, subkortikale Verhaltens- und Kontrollmechanismen zu beginnen.
Doch ungeachtet der Behinderung und der Auswirkungen dieser Krankheit hatte man es auch mit den Reaktionen der Patienten auf ihre Krankheit zu tun. Womit man konfrontiert wurde, woran man arbeitete, war nicht einfach eine Krankheit oder etwas Physiologisches, sondern das Menschliche im Kampf um Anpassung und ums Überleben. Auch das wurde von den frühen Beobachtern der Krankheit, vor allem von Ivy McKenzie (1927), klar erkannt: «Der Arzt ist, anders als der Naturwissenschaftler … mit einem einzelnen Organismus, dem menschlichen Subjekt, befaßt, das danach strebt, seine Identität unter widrigen Umständen zu bewahren.» Als ich dies erkannte, wandelte ich mich zu mehr als zu einem Naturwissenschaftler (ohne jedoch aufzuhören, ein solcher zu sein). Es entstand ein neuer Bezug, eine neue Bindung: die der Hinwendung zu den Patienten, den Individuen, für die ich zu sorgen hatte. Durch sie sollte ich erfahren, was es bedeutet, ein Mensch zu sein und angesichts unvorstellbarer Härten und Bedrohungen menschlich zu bleiben. Während ich kontinuierlich die organische Natur, die vielschichtige, sich ständig verändernde Pathophysiologie und Biologie der Patienten beobachtete, wurde Identität zu meinem vordringlichen Anliegen. Das Ringen um den Erhalt der Identität der Patienten galt es zu beobachten, zu unterstützen und nicht zuletzt zu beschreiben. All dies stand am Übergang von der Biologie zur Biographie.
Der Sinn für die Dynamik von Krankheit und Leben, für das Ringen des Organismus oder des Subjekts ums Überleben (manchmal unter den seltsamsten und dunkelsten Umständen), spielte in meiner Studenten- und Assistentenzeit keine besondere Rolle. Auch in der üblichen Fachliteratur fand ich darüber kaum etwas. Als ich den postenzephalitischen Patienten begegnete, wurde für mich evident, daß der biologisch-biographische Zugang der einzig mögliche ist. Was von den meisten meiner Kollegen geringschätzig abgetan wurde («Anstalten für chronisch Kranke? In ihnen wirst du nie etwas Interessantes sehen»), stellte sich als das genaue Gegenteil heraus : als eine ideale Situation, in der man beobachten, pflegen und explorieren kann. Dieses Buch wäre vermutlich auch geschrieben worden, wenn es kein ‹Erwachen› gegeben hätte. Es wäre dann zu People of the Abyss (Menschen am Abgrund) geworden, einer Darstellung der Bewegungslosigkeit und Finsternis dieser erstarrten und gefrorenen Leben und einer Beschreibung des Mutes und des Humors, mit denen Patienten zu leben versuchen.
Die Intensität meiner Gefühle für diese Patienten ebenso wie mein Interesse und meine Wißbegierde verbanden uns in Mount Carmel zu einer Gemeinschaft. Die Intensität erreichte im Jahre 1969 ihren Höhepunkt, als die Patienten tatsächlich ‹erwachten›. Im Frühling jenes Jahres zog ich in ein kaum einhundert Meter vom Krankenhaus entferntes Appartement um und verbrachte manchmal zwölf oder fünfzehn Stunden am Tag mit den Patienten. Ich war ständig bei ihnen, gönnte mir kaum ein paar Stunden Schlaf, beobachtete sie, sprach mit ihnen, brachte sie dazu, Tagebücher zu führen, und fertigte meinerseits umfangreiche Notizen an – einige tausend Wörter am Tag. Wenn ich in der einen Hand die Feder hielt, führte ich mit der anderen die Kamera : Ich erblickte Dinge, die vielleicht niemals zuvor gesehen worden waren und die, aller Wahrscheinlichkeit nach, nie wieder gesehen werden würden. Es war meine Pflicht (und auch meine Freude), alles zu registrieren und Zeuge zu sein. Auch viele andere Personen widmeten sich dieser Aufgabe, verbrachten unzählige Stunden im Krankenhaus. Wir alle, die mit den Patienten zu tun hatten – Krankenschwestern, Sozialarbeiter, Therapeuten aller Art –, waren in ständiger Verbindung: Wir teilten uns das Neueste aufgeregt im Flur mit, riefen einander nachts und an Wochenenden an, tauschten ständig neue Erfahrungen und Ideen aus. Die Erregung, der Enthusiasmus dieses Jahres waren bemerkenswert. Gerade dies, so scheint mir, war der wesentliche Bestandteil der Erfahrung des ‹Erwachens›.
Und dennoch hatte ich zu Anfang kaum eine Ahnung, was mich erwartete. Ich hatte das Halbdutzend Berichte über L-DOPA von 1967 und 1968 gelesen, betrachtete meine Patienten jedoch als anders geartet. Sie litten nicht an normalem Parkinsonismus wie die im Bericht erwähnten Kranken, sondern an postenzephalitischen Störungen wesentlich komplexerer, gravierenderer und rätselhafterer Natur. Wie würden diese so andersartigen Patienen reagieren? Ich hatte das Gefühl, fast übervorsichtig vorgehen zu müssen. Als ich mich Anfang 1969 an die Arbeit zu dem machte, woraus später Awakenings hervorgehen sollte, betrachtete ich sie unter einem ziemlich begrenzten und enggefaßten ‹wissenschaftlichen› Gesichtspunkt, nämlich dem eines neunzigtägigen ‹Double Blind›-Versuchs mit L-DOPA an einer großen Patientengruppe, die nach der Erkrankung in die Anstalt eingewiesen worden war. L-DOPA galt zu dieser Zeit noch als experimentelles Medikament. Für die Verabreichung benötigte ich eine zum Zwecke der Forschung ausgestellte Sondergenehmigung vom Gesundheitsministerium der USA. Eine Bedingung solcher Genehmigungen war die Anwendung ‹orthodoxer› Methoden (einschließlich des ‹Double Blind›-Verfahrens, bei dem weder die Versuchsleiter noch die Patienten wissen, wer Test- und wer Kontrollperson ist) wie auch die quantitative Auswertung der Versuchsdaten.
Doch binnen eines Monats wurde klar, daß die ursprünglich vorgegebene Verfahrensweise nicht einzuhalten war. Die Wirkung von L-DOPA war durchschlagend, ja spektakulär. Aus dem Anteil negativer Ergebnisse von genau 50 Prozent konnte ich ablesen, daß keinerlei Placebo-Effekt zu beobachten war. Ich konnte guten Gewissens nicht länger mit dem Placebo fortfahren, sondern mußte jedem Patienten L-DOPA verabreichen. Auch konnte ich nicht länger daran denken, es nur 90 Tage zu verabreichen und dann damit aufzuhören – genausogut hätte man den Patienten die Luft zum Atmen nehmen können. So wurde der ursprünglich auf 90 Tage angelegte Versuch zu einem historischen Ereignis: Eine Geschichte vom Leben dieser Patienten vor der Behandlung mit L-DOPA und von der Wandlung nach Beginn der Behandlung.
So sah ich mich nolens volens zur Vorstellung von Fallgeschichten oder Biographien genötigt, denn keine ‹orthodoxe› Darstellungsform mit Zahlenkolonnen, Versuchsreihen, Ausprägungsgraden usw. hätte etwas von der historischen Dimension dieser Erfahrung vermitteln können. Im August 1969 schrieb ich daher die ersten neun Fallgeschichten, ‹Stories›, von Awakenings.
Der gleiche Impuls, der gleiche Mitteilungsdrang bezüglich der Geschichten und Phänomene – der dramatischen Geschichten und der wundersamen Phänomene – ließ mich Anfang des darauffolgenden Jahres einige Leserbriefe an den Lancet und an das British Medical Journal richten. Ich schrieb sie gern; so weit ich es beurteilen konnte, wurden sie dort auch gern gelesen. Eine gewisse Freiheit, was Umfang und Stil betrifft, erlaubte es mir, diese wunderbare klinische Erfahrung so zu vermitteln, wie es mir in einem medizinischen Artikel nicht möglich gewesen wäre.
Ich entschloß mich nun, meine gesamten Beobachtungen und die allgemeinen Schlußfolgerungen daraus, immer noch in Briefform, zu Papier zu bringen. Meine ersten Briefe an den Lancet hatten anekdotischen Charakter (und Anekdoten liest jeder gern). Noch hatte ich mich nicht an allgemeine Formulierungen herangewagt. Meine ersten Erfahrungen, die ersten Reaktionen der Patienten im Sommer 1969, waren beglückend gewesen. Doch nach dem wunderbaren, rauschhaften ‹Erwachen› begannen für alle meine Patienten neue Schwierigkeiten und Probleme. Ich beobachtete hierbei nicht nur spezifische ‹Nebenwirkungen› von L-DOPA, sondern auch bestimmte allgemeine Komplikationen – plötzliche, unvermutet auftretende Reaktionsschwankungen und übersteigerte Reaktionen, die Entwicklung einer pathologischen Sensibilität gegenüber L-DOPA. So mußte ich schließlich die völlige Unmöglichkeit erkennen, Dosis und Wirkung aufeinander abzustimmen, was mich natürlich höchst irritierte. Ich versuchte es mit anderen Dosierungen von L-DOPA, aber das bewirkte nichts – das ‹System› schien zunehmend eine Eigendynamik entwickelt zu haben.
Im Sommer 1970 berichtete ich endlich in einem Brief an das Journal of the American Medical Association (JAMA) über diese Entdeckungen und beschrieb alle Wirkungen von L-DOPA nach einjähriger Anwendung bei sechzig Patienten. Zunächst hatte es bei allen gute Wirkungen gezeitigt; doch früher oder später waren alle außer Kontrolle und in komplexe, mitunter bizarre und unberechenbare Zustände geraten. Ich zeigte auf, daß diese Zustände nicht als ‹Nebenwirkungen›, sondern als integrale Bestandteile eines sich entwickelnden Ganzen anzusehen waren. Normale Betrachtens- und Vorgehensweisen, so betonte ich, konnten früher oder später einfach nicht mehr greifen. Ein tieferes, radikaleres Verständnis war unumgänglich.
Mein JAMA-Brief rief bei einigen Kollegen wütende Reaktionen hervor (vgl. Sacks u.a. 1970 e und die Briefe in der JAMA-Ausgabe vom Dezember 1970). Ich war erstaunt und erschreckt über den Sturm, der sich da erhob, insbesondere aber über den Tonfall einiger Briefe. Manche Kollegen behaupteten schlicht, solche Wirkungen kämen ‹nie› vor; andere meinten, selbst wenn diese Wirkungen aufträten, sollte besser darüber geschwiegen werden, um die ‹für die optimale Wirksamkeit von L-DOPA notwendige zuversichtliche Haltung der Therapeuten› nicht zu zerstören. Absurderweise wurde sogar angenommen, ich sei ‹gegen› L-DOPA. Doch es war der Reduktionismus und nicht das L-DOPA, wogegen ich mich wandte. Ich lud meine Kollegen nach Mount Carmel ein, um sich mit eigenen Augen von der Wahrheit meines Berichts zu überzeugen; keiner folgte der Einladung. Bis dahin war mir die Allmacht des Wunsches, Tatsachen zu verdrehen und abzuleugnen, noch nicht richtig zu Bewußtsein gekommen – ebensowenig wie seine Dominanz in dieser komplexen Situation, wo enthusiastische Ärzte und leidende Patienten in unwissentlicher Übereinstimmung gleichermaßen von dem Willen beseelt waren, eine unangenehme Wahrheit zu verdrängen. Eine ähnliche Situation hatte sich zwanzig Jahre zuvor mit dem ‹neuen Wundermittel› Cortison ergeben. Man konnte also nur hoffen, daß im Lauf der Zeit und durch die Ansammlung unwiderlegbarer Erfahrungen der Sinn für die Realität über das Wunschdenken triumphieren würde.
War mein Brief zu komprimiert? Oder ganz einfach zu verwirrend? Sollte ich zu ausführlichen Artikeln übergehen? Mit viel Mühe (weil es mir gegen den Strich ging) zwängte ich alles, was nur ging, in die orthodoxe und konventionelle Form – Beiträge voller Statistiken und Diagramme, Tabellen und Zeichnungen – und sandte diese an verschiedene medizinische und neurologische Fachzeitschriften. Erstaunt und bekümmert mußte ich feststellen, daß kein Artikel angenommen wurde – von einigen Zeitschriften kamen sogar äußerst kritische, ja verletzende Ablehnungen, als hätte ich etwas ganz Unerhörtes geschrieben. Dies bestärkte meinen Eindruck, eine empfindliche Schwachstelle getroffen zu haben und nicht nur auf eine medizinische, sondern auch eine gleichsam erkenntnistheoretische Angst – und Wut – gestoßen zu sein[*].
Ich hatte nicht nur Zweifel gesät, ob es tatsächlich so einfach war, ein Medikament zu verabreichen und seine Wirkungen zu kontrollieren; ich hatte auch die Möglichkeit der Vorhersagen selbst in Zweifel gezogen. Vielleicht ohne es selbst ganz zu erfassen, hatte ich auf etwas Bizarres gedeutet: auf einen Widerspruch zu normalen Denkgewohnheiten und zur üblichen, akzeptierten Betrachtungsweise der Welt. Ein Spektrum extremer Andersartigkeit, radikaler Ungewißheit tat sich auf – und dies war natürlich höchst beunruhigend und verwirrend. (Poincaré sagte einmal: «Diese Dinge sind so rätselhaft, daß ich darüber nicht nachdenken kann.»)
So trat ich ab Mitte 1970 auf der Stelle, zumindest was weitere Veröffentlichungen betraf. Die Arbeit ging mit unverminderter Spannung weiter, und ich sammelte, so durfte ich wohl behaupten, einen wahren Schatz an Beobachtungen und damit verbundenen Hypothesen und Reflexionen. Aber ich hatte keine Ahnung, was ich daraus machen sollte. Ich wußte, daß mir eine einmalige Chance gegeben war; ich wußte auch, daß ich etwas Wichtiges zu sagen hatte. Doch ich sah keine Möglichkeit, dies zu tun, ohne entweder meine Erfahrungen zu verfälschen oder an medizinischer ‹Publizierbarkeit› und an Glaubwürdigkeit bei meinen Kollegen einzubüßen. Diese Zeit war von großer Verwirrung und Frustration, erheblichem Zorn und manchmal auch von Verzweiflung geprägt.
Ein Ausweg aus der Sackgasse eröffnete sich erst im September 1972, als der Herausgeber des Listener mich aufforderte, einen Artikel über meine Erfahrungen zu verfassen. Das war meine Chance. Statt, wie gewöhnlich, kritischer Ablehnung zu begegnen, wurde ich tatsächlich aufgefordert, zu schreiben, bekam die Gelegenheit, frei und ausführlich das zu veröffentlichen, was sich so lange angesammelt und aufgestaut hatte. Ich schrieb The Great Awakening in einem Zug – weder ich noch der Herausgeber änderten auch nur ein Wort daran –, und schon im folgenden Monat wurde es veröffentlicht (vgl. Sacks 1972).
Endlich befreit von den Beschränkungen medizinischer Fachterminologie, beschrieb ich das wunderbare Panorama von Phänomenen, die ich an meinen Patienten beobachtet hatte. Ich berichtete über den Rausch ihres ‹Erwachens› ebenso wie die Qualen, die oftmals darauf folgten. Doch es waren vor allem die Phänomene, deren Beschreibung mir am Herzen lag, und zwar unter neutralem und phänomenologischem (statt unter therapeutischem oder ‹medizinischem›) Gesichtspunkt.
Das Gesamtbild und die Theorie, die sich aus den Phänomenen ergaben: sie erschienen mir revolutionär – «eine neue Neurophysiologie quanten-relativistischer Art», schrieb ich. Kühne Worte, fürwahr. Sie erregten mich und andere – obwohl ich bald erkannte, damit zu viel und zu wenig gesagt zu haben. Daß hier mit Gewißheit etwas sehr Seltsames vor sich ging – nicht Quantalität, nicht Relativität, sondern etwas viel Gewöhnlicheres und dennoch Seltsameres. 1972 hatte ich noch keine Ahnung, was das war, obwohl es mich bei der Fertigstellung von Awakenings ständig verfolgte und sich überall, kaum faßbar, in höhnisch lockenden Metaphern niederschlug.
Dem Artikel im Listener folgte (im Gegensatz zu der haßerfüllten JAMA-Episode zwei Jahre zuvor) eine Fülle von Briefen, die großes Interesse bezeugten und aus denen sich eine mehrwöchige fesselnde Korrespondenz entwickelte. Diese Reaktionen beendeten die lange Phase von Frustration und Lähmung und machte mir entscheidend Mut. Ich nahm meine lange vernachlässigten Fallgeschichten von 1969 wieder auf, fügte elf hinzu und vollendete Awakenings binnen zwei Wochen. Die Fallgeschichten waren das einfachste; sie schrieben sich von selbst, waren unmittelbar der Erfahrung entsprungen, und ich habe sie immer mit besonderer Zuneigung als das wahre und unanfechtbare Zentrum des Buches betrachtet. Über den Rest läßt sich streiten – die Geschichten sind so, wie sie sind.
Doch deren Veröffentlichung traf 1973 trotz allgemein großer Aufmerksamkeit auf die gleiche kühle Reaktion seitens des Arztestandes wie meine früheren Artikel. Es gab keine einzige Notiz oder Besprechung in medizinischen Zeitschriften, nur ablehnendes oder verständnisloses Schweigen. Ein einziger mutiger Herausgeber (vom British Clinical Journal) sprach dies an, erklärte Awakenings zu seinem ‹Buch des Jahres 1973›, erwähnte jedoch zugleich die ‹seltsame Sprachlosigkeit› der Fachöffentlichkeit dem Buch gegenüber.
Diese medizinische ‹Sprachlosigkeit› machte mir schwer zu schaffen. Zugleich jedoch erfuhr ich Bestätigung und Ermutigung durch die Reaktion von Lurija, der selbst, nach endlosen und minutiösen neuropsychologischen Beobachtungen, zwei außergewöhnliche, fast romanhafte Fallgeschichten veröffentlicht hatte: Ein kleines Buch über ein großes Gedächtnis (1968) und Eine verlorene und wiedergewonnene Welt (1972). Zu meiner größten Freude erhielt ich in der Zeit des seltsamen ‹medizinischen› Schweigens nach Veröffentlichung des Buches zwei Briefe von ihm; im ersten sprach er von seinen eigenen ‹biographischen› Büchern und Versuchen:
«Offen gestanden, ich selbst schätze die Gattung der ‹biographischem Studie sehr, wie Šeraševskij [den Gedächtniskünstler aus dem Bericht von 1968] und Zazeckij [den Hirnverletzten aus dem Bericht von 1972] … zuerst deshalb, weil ich damit eine Art ‹romantischer Wissenschaft› zu begründen dachte, und zum Teil auch, weil ich sehr gegen eine formale statistische Betrachtung und für eine qualitative Persönlichkeitsstudie eintrete, für jeden Versuch, Faktoren zu finden, die der Persönlichkeitsstruktur zugrunde liegen.» (Brief vom 19. Juli 1973, Hervorhebungen im Original)
Im zweiten Brief schrieb er über mein Buch:
«Ich habe die Awakenings erhalten und sogleich mit großem Vergnügen gelesen. Es war mir immer bewußt, daß eine gute klinische Fallbeschreibung in der Medizin, und besonders in der Neurologie und Psychiatrie, eine entscheidende Rolle spielt. Unseligerweise scheint diese Fähigkeit zur Beschreibung, die den großen Neurologen und Psychiatern des 19. Jahrhunderts so geläufig war, abhanden gekommen zu sein, vielleicht aufgrund der grundfalschen Annahme, mechanische und elektrische Apparate könnten die Erforschung der Persönlichkeit ersetzen … Ihr ausgezeichnetes Buch zeigt, daß die wichtige Tradition klinischer Fallstudien mit viel Erfolg wiederbelebt zu werden vermag.» (Brief vom 25. Juli 1973)
Im weiteren stellte er mir spezielle Fragen und brachte insbesondere sein Staunen über die vielfältigen und unsteten Wirkungen von L-DOPA zum Ausdruck[*].
Ich war schon vor dem Medizinstudium ein großer Bewunderer Lurijas gewesen. 1959, bei einem Vortrag in London, beeindruckte mich die Kombination von intellektueller Stärke und menschlicher Wärme in ihm – diese waren mir oft getrennt begegnet, doch kaum je vereint in einer Person. Genau diese Kombination gefiel mir so an seiner Arbeit und machte sie zu einem Gegenpol zu bestimmten Richtungen in der medizinischen Literatur, die sowohl Subjektivität wie Reflexion am liebsten gänzlich getilgt hätten. Lurijas frühe Werke wirkten mitunter noch etwas geschraubt, doch mit zunehmendem Alter gewannen auch sie an intellektueller Wärme und Ganzheitlichkeit und gipfelten schließlich in seinen beiden Schriften von 1968 und 1972. Ich kann nicht ermessen, wie stark mich diese beiden Werke beeinflußt haben, aber auf jeden Fall machten sie mir Mut und erleichterten mir das Schreiben und Veröffentlichen von Awakenings.
Lurija sagte oft, er müsse eigentlich zwei Arten von Büchern schreiben, die voneinander verschieden seien und sich doch einander ergänzten: ‹klassische›, analytische Texte wie die Monographie über höhere kortikale Funktionen (vgl. Lurija 1966) und ‹romantische›, biographische Bücher wie die Fallstudien von 1968 und 1972 (vgl. auch Lurija 1987a und 1987b). Auch ich verspürte dieses zweifache Bedürfnis, das von jeder klinischen Erfahrung potentiell zwei Bücher forderte: ein rein ‹medizinisches› oder ‹klassisches› mit einer objektiven Beschreibung der Störungen, Mechanismen und Syndrome; und ein anderes, existentielleres und persönlicheres, beruhend auf einem einfühlsamen Einblick in die Erfahrungen und Welten der Patienten. Die Idee zu zwei solchen Büchern reifte in mir nach der ersten Begegnung mit den postenzephalitischen Patienten: Compulsion and Constraint (Zwang und Nötigung), eine Studie über subkortikale Störungen und Mechanismen, und People of the Abyss, ein romanhaftes Buch im Stil von Jack London. Erst 1969 fanden sie zueinander – in einem Buch, das zugleich klassisch und romantisch zu sein versuchte, angesiedelt an der Schnittstelle zwischen Biologie und Biographie, verfaßt in dem Versuch, Paradigma und Kunst auf einen Nenner zu bringen.
Doch letztlich schien kein Modell meinen Anforderungen zu genügen, denn was ich sah und vermitteln wollte, war weder rein klassisch noch rein romantisch, sondern schien in die tieferen Bereiche von Allegorie und Mythos vorzudringen. Selbst der Titel, Awakenings, war doppeldeutig: teils wörtlich und teils als Metapher oder Mythos zu verstehen.
Die ausführliche Fallgeschichte, der ‹romantische› Stil mit seinem Bemühen, ein Leben in seiner Ganzheit, eine Krankheit mit ihren Reaktionen in ihrer ganzen Fülle zu beschreiben, waren seit Mitte dieses Jahrhunderts gänzlich aus der Mode gekommen – und dies war vielleicht ein Grund für die ‹seltsame Sprachlosigkeit› des Ärztestandes nach der Erstveröffentlichung des Buches im Jahre 1973 gewesen. Doch im Laufe der siebziger Jahre schwand diese Antipathie gegen Fallgeschichten. Es wurde sogar möglich (wenn auch schwierig), Fallgeschichten in medizinischen Organen zu veröffentlichen. In dieser Tauwetteratmosphäre entstand wieder ein Gefühl dafür, daß detaillierte und nicht-reduktionistische Berichte zwingend erforderlich sind, um komplexe neuronale und psychische Funktionen (und ihre Störungen) umfassend zu erläutern und zu verstehen[*].
Zugleich machten jetzt zunehmend alle die gleichen Beobachtungen der unberechenbaren Reaktionen auf L-DOPA, die ich 1969 an meinen Patienten gesehen hatte – die plötzlichen Reaktionsschwankungen, die pathologische Ansprechbarkeit auf L-DOPA und auf alles. Es wurde klar, daß postenzephalitische Patienten diese bizarren Reaktionen binnen Wochen, manchmal binnen Tagen zeigten – wohingegen ‹normale› Parkinson-Kranke mit ihrem stabileren Nervensystem sie vielleicht erst viele Jahre später zeigen. Dennoch begannen früher oder später alle Patienten, denen L-DOPA verabreicht wurde, in diese seltsamen Kipp-Zustände zu verfallen. Seit der Zulassung von L-DOPA durch das US-Gesundheitsministerium im Jahre 1970 überstieg ihre Zahl schließlich die Millionengrenze. Nun entdeckte jeder das gleiche: Die eigentliche Verheißung von L-DOPA ging in Erfüllung – millionenfach; doch früher oder später trat eben auch die wahre Bedrohung, die ‹Nebenwirkungen› und ‹Komplikationen›, auf.
Was bei der Erstveröffentlichung des Buches noch als überraschend oder unerhört erschienen war, hatte sich – zum Zeitpunkt der dritten Ausgabe von 1982 – für alle meine Kollegen durch eigene, unwiderlegliche Erfahrungen bestätigt. Die optimistische und irrationale Stimmung der ersten Zeit mit L-DOPA war etwas nüchterner und realistischer geworden. Diese 1982 schon gefestigte Atmosphäre ließ die neue Ausgabe von Awakenings für meine Kollegen nicht nur akzeptabel, sondern sogar zum Klassiker werden – wohingegen die Erstausgabe neun Jahre zuvor noch unannehmbar gewesen war.
Die Vorstellung von Welten anderer Menschen – fast unbegreiflich fremd und dennoch von ‹Menschen wie du und ich› bewohnt, Menschen, die leicht du und ich sein könnten – steht im Mittelpunkt des Buches. Andere Welten, andere Leben, auch wenn sie sich noch so sehr von unseren eigenen unterscheiden, haben in sich die Kraft, durch Einfühlung getragene Anschauung und ein intensives, oft kreatives Echo bei anderen hervorzurufen. Ohne Rose R. je begegnet zu sein, sehen wir dennoch die Welt anders, seit wir von ihr gelesen haben – wir können uns mit einer Art ehrfürchtiger Scheu ihre Welt vorstellen und damit unser eigenes Bild von der Welt erweitern. Harold Pinter lieferte mit seinem Stück A Kind of Alaska ein wunderbares Beispiel für eine solche kreative Antwort: Es ist Pinters Welt, seine einzigartige, sensible Landschaft, doch auch die Welt der Rose R. und anderer Patienten. Auf Pinters Stück folgten mehrere Versionen von Awakeningsfür Bühne und Film; jede stellte einen anderen Aspekt des Buches in den Vordergrund. Jeder Leser bringt seine eigenen Vorstellungen und Empfindungen in die Lektüre ein und wird, wenn er sich ihnen überläßt, von einer neuen tiefen Zärtlichkeit und vielleicht auch von Schrekken erfaßt. Denn diese Patienten, so außergewöhnlich, so ‹speziell› sie auch sein mögen, haben etwas Universelles an sich und können jeden erreichen und erwecken, so wie sie es bei mir getan haben.
Bei der Erstveröffentlichung der ‹Stories› unserer Patienten und ihres Lebens habe ich stark gezögert. Doch sie haben mich selbst dazu ermutigt und mir von Anfang an gesagt: «Erzählen Sie unsere Geschichte –sonst wird sie nie bekannt.»
Einige der Patienten leben noch – wir kennen einander nun seit vierundzwanzig Jahren. Doch auch die Toten sind in gewissem Sinne nicht tot – ich sehe ihre noch unabgeschlossenen Tabellen und Briefe vor mir, wenn ich schreibe. Auf sehr persönliche Weise sind sie für mich noch immer lebendig. Sie waren nicht nur Patienten, sondern Lehrer und Freunde, und die Jahre, die ich mit ihnen verbracht habe, waren die bedeutsamsten meines Lebens. Ich möchte etwas von ihrem Leben und ihrer Gegenwärtigkeit für andere lebendig erhalten: als Beispiel für menschliches Elend und Überleben. Dies ist das einzige Zeugnis eines einzigartigen Ereignisses – doch kann es zu einer Allegorie für uns alle werden.
O.W.S.
New York, März 1990
Einleitung
Die Parkinsonsche Krankheit und der Parkinsonismus
1817 veröffentlichte der Londoner Arzt Dr. James Parkinson seinen berühmten Essay on the Shaking Palsy (Essay über die Schüttellähmung), in dem er in einer bis heute in bezug auf Lebendigkeit und Verständnistiefe unübertroffenen Art den verbreiteten, Aufmerksamkeit erregenden und einzigartigen Zustand schilderte, den wir Parkinsonsche Krankheit nennen.
Bereits zur Zeit Galens hatten Ärzte einzelne Symptome und Merkmale der Parkinsonschen Krankheit beschrieben, beispielsweise das charakteristische Schütteln oder den Tremor und die charakteristische Hast oder die Festination beim Gehen und Sprechen. Auch in der nichtmedizinischen Literatur waren detaillierte Darstellungen zu finden, etwa in Aubreys Beschreibungen von Hobbes’ Schüttellähmung. Aber es war Parkinson, der als erster einzelne Merkmale und Aspekte der Krankheit im Gesamtzusammenhang betrachtet und sie als einen besonderen Zustand des Menschen bzw. als Verhaltensweise verstanden hat[*].
Als erster erkannte er das Moment der Häufung als solches, das wir heute ‹Parkinson-Syndrom› oder ‹Parkinsonismus› nennen.
Der Parkinsonismus war eines der ersten neurologischen Syndrome, das erkannt und definiert wurde – eine überragende klinische Leistung. Parkinson war jedoch nicht nur begabt: er war ein Genie. Er erfaßte, daß die von ihm bemerkte, sonderbare Häufung mehr war als ein diagnostisches Syndrom – es schien eine kohärente innere Logik und eine eigenständige Ordnung aufzuweisen: die Konstellation war eine Art geordnetes Ganzes, ein Kosmos.