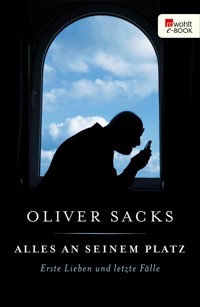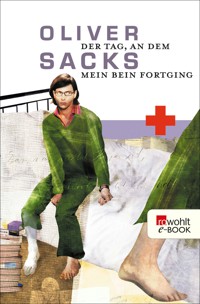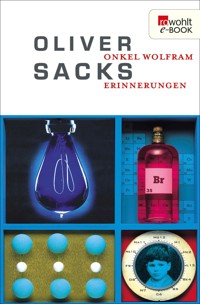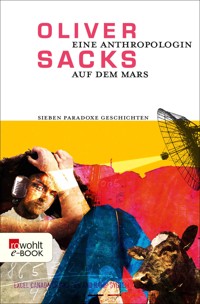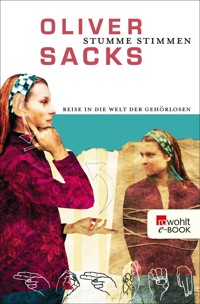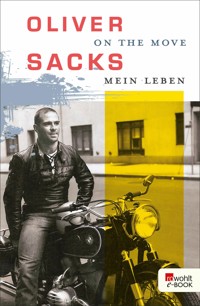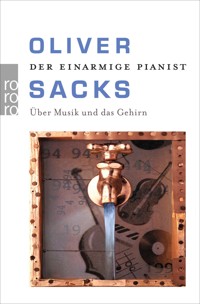
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
«Dies ist Literatur, wie sie nur wenige, Freud vielleicht und C.G. Jung, schreiben konnten, und es ist zugleich sachliche Information.»«DIE ZEIT» über Oliver Sacks
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 608
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Oliver Sacks
Der einarmige Pianist
Über Musik und das Gehirn
Über dieses Buch
«Dies ist Literatur, wie sie nur wenige, Freud vielleicht und C.G. Jung, schreiben konnten, und es ist zugleich sachliche Information.»
«DIE ZEIT» über Oliver Sacks
Vita
Oliver Sacks, geboren 1933 in London, war Professor für Neurologie und Psychiatrie an der Columbia University. Er wurde durch die Publikation seiner Fallgeschichten weltberühmt. Nach seinen Büchern wurden mehrere Filme gedreht, darunter «Zeit des Erwachens» (1990) mit Robert De Niro und Robin Williams. Oliver Sacks starb am 30. August 2015 in New York City.
Bei Rowohlt erschienen unter anderem seine Bücher «Awakenings – Zeit des Erwachens», «Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte», «Der Tag, an dem mein Bein fortging», und «Drachen, Doppelgänger und Dämonen». 2015 veröffentlichte er seine Autobiographie «On the Move».
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, September 2021
Copyright © 2008 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«Musicophilia» Copyright © 2007 by Oliver Sacks
Covergestaltung Umschlag-Konzept: any.way, Hamburg
Barbara Hanke/Heidi Sorg/Cordula Schmidt
Coverabbildung Hans Neleman/Getty Images; neuebildanstalt/Jordan; Heide Benser/Zefa/Corbis
ISBN 978-3-644-00090-2
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Orrin Devinsky, Ralph Siegel und Connie Tomaino
Vorwort
Wie merkwürdig doch der Anblick einer ganzen Spezies ist – Milliarden von Menschen, die mit bedeutungslosen Tonmustern spielen und ihnen lauschen, die einen großen Teil ihrer Zeit mit etwas beschäftigt sind, was sie Musik nennen und darin völlig versinken. Das war zumindest eine der menschlichen Eigenschaften, die die hochintelligenten Außerirdischen, die Overlords, in Arthur C. Clarkes Roman Childhood’s End (deutsch: Die letzte Generation, Berlin-Schöneberg 1960) verwirrte. Die Neugier, ein Konzert zu besuchen, führt sie auf die Erde, sie hören höflich zu und gratulieren dem Komponisten am Ende zu seinem «großen Einfallsreichtum» – finden die ganze Sache aber völlig unverständlich. Sie können sich einfach nicht vorstellen, was in Menschen vorgeht, wenn sie Musik spielen oder hören, weil in ihnen nichts vorgeht. Sie selbst sind eine Spezies, der Musik völlig fehlt.
Wir können uns vorstellen, wie sich die Overlords, zurück in ihren Raumschiffen, weiter den Kopf zerbrechen. Diese Sache, die sogenannte Musik, das müssten sie zugeben, übt irgendeine Wirkung auf die Menschen aus, ist von zentraler Bedeutung für das menschliche Leben. Trotzdem hat sie keine Begriffe, macht keine Aussagen; es fehlt ihr an Bildern, Symbolen, dem Stoff, aus dem die Sprache ist. Sie hat kein Darstellungsvermögen. Sie hat keine zwingende Beziehung zur Welt.
Es gibt vielleicht einige wenige Menschen, denen, wie den Overlords, der neuronale Apparat für die Wertschätzung von Klängen oder Melodien fehlt. Aber auf praktisch alle von uns übt Musik eine große Macht aus, egal ob wir uns nun für besonders «musikalisch» halten oder nicht. Die Neigung zur Musik, die «Musikophilie», zeigt sich schon im Säuglingsalter, ist in jeder Kultur greifbar und von zentraler Bedeutung und reicht wahrscheinlich in die frühesten Anfänge unserer Art zurück. Sie mag von den Kulturen, in denen wir leben, durch die Lebensverhältnisse oder durch individuelle Begabungen oder Schwächen, die uns als Individuen eigen sind, gefördert oder geprägt werden – doch sie ist so tief in der menschlichen Natur verwurzelt, dass wir versucht sind, sie als angeboren zu betrachten, ganz so, wie es E.O. Wilson von der «Biophilie» meint, unserem Verbundenheitsgefühl gegenüber anderen Lebewesen. (Vielleicht ist die Musikophilie ja eine Form der Biophilie, empfinden wir doch die Musik selbst fast wie ein Lebewesen.)
Während der Gesang der Vögel offenbar adaptiven Zwecken (Balz, Aggressivität, Abstecken der Reviergrenzen etc.) dient, ist er doch in seiner Struktur relativ im Nervensystem der Vögel weitgehend festgelegt (obwohl es einige wenige Singvögel gibt, die scheinbar improvisieren oder im Duett singen). Der Ursprung menschlicher Musik ist weniger leicht zu begreifen. Darwin selbst war offenbar verwundert, schreibt er doch in der Abstammung des Menschen: «Da dem Menschen weder das Vergnügen an der Erzeugung musikalischer Töne noch die Fähigkeit zu ihrer Erzeugung von geringstem Nutzen sind … müssen sie den geheimnisvollsten Eigenschaften zugerechnet werden, mit denen er begabt ist.» Und heute nennt Steven Pinker die Musik einen «auditiven Käsekuchen» und fragt: «Was für einen Nutzen könnte es haben, Zeit und Energie mit der Herstellung klimpernder Geräusche zu verschwenden? … Was die biologischen Wirkungszusammenhänge angeht, so ist Musik bedeutungslos … sie könnte der Menschheit verloren gehen, und der Rest ihrer Lebensweise bliebe praktisch unverändert.»
Obwohl Pinker selbst hochmusikalisch ist und sein Leben ohne Musik sicherlich als viel ärmer empfände, glaubt er dennoch nicht, dass es sich bei der Musik oder anderen Künsten um direkte evolutionäre Anpassungsfunktionen handelt. In einem Aufsatz gibt er 2007 zu bedenken, dass
viele der Künste womöglich gar keine adaptive Funktion haben. Es könnte sich um Nebenprodukte zweier anderer Eigenschaften handeln: der Motivationssysteme, die Lust auslösen, sobald wir Signale wahrnehmen, die mit adaptiven Folgen korrelieren (etwa Sicherheit, Sex, Wertschätzung, informative Umgebungen) sowie dem technischen Know-how, um bereinigte und konzentrierte Dosen dieser Signale zu erzeugen.
Pinker (und andere) glauben, dass zumindest einige unserer musikalischen Fähigkeiten zustande kamen, indem Systeme des Gehirns, die bereits zu anderen Zwecken entwickelt worden waren, benutzt, herangezogen oder hinzugezogen wurden. Dies hätte möglicherweise damit zu tun, dass es kein eigentliches «Musikzentrum» im menschlichen Gehirn gibt, stattdessen aber die Beteiligung eines Dutzends über das ganze Gehirn verteilter Netzwerke. Stephen Jay Gould, der als Erster die vieldiskutierte Frage nonadaptiver Veränderungen direkt anging, spricht in dieser Hinsicht nicht von Adaptationen, sondern von «Exaptationen» – und er bezeichnet die Musik als eindeutiges Beispiel für eine solche Exaptation. (William James schwebte offenbar etwas Ähnliches vor, als er schrieb, unsere Empfänglichkeit für Musik und andere Aspekte «unserer höheren ästhetischen, moralischen und intellektuellen Lebensäußerungen» hätten sich «durch die Hintertür» Eingang zu unserem Geist verschafft.)
Doch unabhängig von all diesen Erwägungen – von der Frage, inwieweit die musikalischen Fähigkeiten und die musikalische Sensibilität des Menschen im Gehirn verdrahtet oder das Nebenprodukt anderer Fähigkeiten und Neigungen sein mögen –, die Musik ist und bleibt in jeder Kultur von fundamentaler und zentraler Bedeutung.
Wir Menschen sind nicht weniger eine musikalische Spezies als eine sprachliche. Das zeigt sich auf vielfältige Weise. Jeder von uns kann (mit sehr wenigen Ausnahmen) Musik wahrnehmen: Töne, Klangfarben, Tonintervalle, melodische Figuren, Harmonien und (was vielleicht am elementarsten ist) Rhythmus. Alle diese Elemente fügen wir in unserem Geist zusammen und «konstruieren» Musik, indem wir verschiedene Teile des Gehirns verwenden. Zu diesem weitgehend unbewussten strukturellen Musikverständnis gesellt sich häufig noch eine intensive und tiefe emotionale Reaktion auf Musik. «Die unaussprechliche Tiefe der Musik», schrieb Schopenhauer, «so leicht zu verstehen und doch so unerklärlich, ist dem Umstand zu verdanken, dass sie alle Gefühle unseres innersten Wesens nachbildet, jedoch vollkommen ohne Wirklichkeit und fern allen Schmerzes … Musik drückt nur die Quintessenz des Lebens und seiner Ereignisse aus, nie diese selbst.»
Musik hören ist nicht nur ein akustischer und emotionaler Vorgang, sondern auch ein motorischer: «Wir hören Musik mit unseren Muskeln», schrieb Nietzsche. Wir schlagen den Takt zur Musik, unwillkürlich, selbst wenn wir nicht bewusst auf sie achten, und unser Gesicht und unsere Körperhaltung spiegeln die «Erzählung» der Melodie sowie die Gedanken und Gefühle wider, die sie hervorruft.
Vieles von dem, was geschieht, während man Musik wahrnimmt, kann auch geschehen, wenn Musik «im Geiste gespielt wird». Selbst bei relativ unmusikalischen Menschen ist die Vorstellung von Musik in der Regel bemerkenswert naturgetreu, nicht nur im Hinblick auf die Melodie und Stimmung des Originals, sondern auch auf Tonhöhe und Tempo. Das liegt an der außerordentlichen Beharrlichkeit des musikalischen Gedächtnisses, die bewirkt, dass vieles von dem, was wir in frühen Jahren gehört haben, für den Rest unseres Lebens ins Gehirn «eingemeißelt» bleibt. Unser Gehör, unsere Nervensysteme, sind nämlich ausgezeichnet auf Musik eingestellt. Allerdings wissen wir noch nicht, inwieweit das an den besonderen Merkmalen der Musik selbst liegt – ihrem komplexen Klangteppich, in die Zeit eingebetteten Klangmustern, ihrer Logik, ihrem Schwung, ihren unauflöslichen Sequenzen, ihren eindringlichen Rhythmen und Wiederholungen, der geheimnisvollen Weise, in der sie Gefühl und «Willen» verkörpert – und inwieweit an bestimmten Resonanzen, Synchronisationen, Schwingungen, wechselseitigen Erregungen oder Rückkoppelungen in dem ungeheuer komplexen, vielschichtigen neuronalen Schaltkreis, der der musikalischen Wahrnehmung und Wiedergabe zugrunde liegt.
Doch dieser wundervolle Apparat ist – vielleicht gerade weil so komplex und hoch entwickelt – für verschiedene Verzerrungen, Auswüchse und Pannen anfällig. Die Fähigkeit, Musik wahrzunehmen (oder sich vorzustellen), kann durch bestimmte Hirnschädigungen beeinträchtigt werden; es gibt viele Formen der Amusie. Auf der anderen Seite kann die musikalische Einbildungskraft exzessiv und unkontrollierbar werden, sodass es zur pausenlosen Wiederholung von Ohrwürmern oder sogar zu musikalischen Halluzinationen kommt. Bei einigen Menschen kann Musik Krampfanfälle auslösen. Es gibt spezielle neurologische Risiken, «Fertigkeitsstörungen», denen Berufsmusiker ausgesetzt sind. Unter gewissen Umständen kann sich die normale Verbindung von Intellekt und Emotion auflösen, sodass der Betroffene Musik einwandfrei wahrzunehmen vermag, doch gleichgültig und ungerührt bleibt oder, umgekehrt, leidenschaftlich bewegt ist, obwohl er sich nicht in der Lage sieht, irgendeinen «Sinn» in dem Gehörten zu erkennen. Manche Menschen – sogar eine überraschend große Zahl – «sehen» Farben oder haben verschiedene «Geschmacks-», «Geruchs-» oder «Tasterlebnisse», während sie Musik hören – obschon eine solche Synästhesie wohl eher als Begabung und nicht als Symptom anzusehen ist.
William James sprach von unserer «Empfänglichkeit für Musik»: Während Musik in der Lage ist, uns alle zu beeinflussen – zu beruhigen, zu beleben, zu trösten, zu erregen, bei Arbeit und Spiel zu organisieren und zu synchronisieren –, kann sie besonders wirksam und von großem therapeutischem Wert bei Patienten mit den verschiedensten neurologischen Befunden sein. Unter Umständen reagieren solche Menschen besonders auf Musik (und manchmal auf kaum etwas anderes). Einige dieser Patienten haben allgemeine kortikale Störungen, entweder infolge von Schlaganfällen, Alzheimer oder anderen Demenzursachen; andere haben spezifische kortikale Syndrome – Verlust von Sprach-oder Bewegungsfunktionen, Amnesien oder Frontallappensyndrome. Einige sind retardiert, andere autistisch; wieder andere haben subkortikale Syndrome wie die Parkinson-Krankheit oder andere Bewegungsstörungen. Alle diese Erkrankungen und viele andere können unter Umständen auf Musik und Musiktherapie ansprechen.
Für mich ergab sich der erste Anlass, über Musik nachzudenken und zu schreiben, im Jahre 1966, als ich sah, welche nachhaltige Wirkung Musik auf jene schwer erkrankten Parkinson-Patienten hatte, über die ich später in Awakenings schrieb. Seither stelle ich fest, dass sich die Musik fortwährend und auf weit vielfältigere Art, als ich mir hätte vorstellen können, in mein Bewusstsein drängt und mir ihre Wirkungen auf fast jeden Aspekt der Hirnfunktionen – und des Lebens – vor Augen führt. «Musik» ist immer eines der ersten Stichworte, die ich im Register eines neuen neurologischen oder physiologischen Fachbuches nachschaue. Doch ich fand nur selten eine Erwähnung des Themas, bis Macdonald Critchley und R.A. Henson ihr Buch Music and the Brain mit seiner Fülle an historischen und klinischen Beispielen veröffentlichten. Ein Grund für den Mangel an musikalischen Fallgeschichten ist vielleicht der Umstand, dass Ärzte ihre Patienten selten nach Beeinträchtigungen der musikalischen Wahrnehmung fragen (während ein Sprachproblem in der Regel sofort ans Licht kommt). Ein weiterer Grund für diese Vernachlässigung liegt darin, dass Neurologen gerne erklären, vermeintliche Mechanismen entdecken und beschreiben – und es vor 1980 praktisch keine neurowissenschaftlichen Untersuchungen der Musik gab. Das alles hat sich im Laufe der letzten zwanzig Jahre dank neuer Techniken verändert, die es uns ermöglichen, das lebende Gehirn zu beobachten, während Menschen Musik hören, sich vorstellen und sogar komponieren. Es gibt mittlerweile einen eindrucksvollen und rasch wachsenden Bestand an Arbeiten über die neuronalen Grundlagen der musikalischen Wahrnehmung und Vorstellung sowie die komplexen und häufig bizarren Störungen, zu denen diese neigen. Die neuen neurowissenschaftlichen Einsichten sind überaus aufregend, aber es besteht immer eine gewisse Gefahr, dass die einfache Kunst der Beobachtung verloren geht, dass die klinische Beschreibung oberflächlich bleibt oder dass die Vielfalt menschlicher Zusammenhänge nicht hinreichend beachtet wird.
Natürlich sind beide Ansätze erforderlich, das heißt, die «altmodische» Beobachtung und Beschreibung muss mit den neuesten Errungenschaften der Technik verknüpft werden, daher habe ich hier versucht, beides einfließen zu lassen. Vor allem aber habe ich mich bemüht, meinen Patienten und Versuchspersonen zuzuhören, mir ihre Erlebnisse vorzustellen und mich in sie hineinzufinden – das ist der eigentliche Kern des vorliegenden Buches.
Teil IVon Musik verfolgt
Kapitel 1Wie Ein Blitz aus Heiterem Himmel: Plötzliche Musikophilie
Tony Cicoria war zweiundvierzig, durchtrainiert und kräftig, ein ehemaliger College-Footballspieler, der es zum angesehenen Orthopäden in einer Kleinstadt im Norden des Staates New York gebracht hatte. Eines Nachmittags im Herbst befand er sich in einem Pavillon an einem Seeufer, in dem ein Familientreffen stattfinden sollte. Das Wetter war angenehm und etwas windig, doch in der Ferne bemerkte er einige Gewitterwolken; es sah nach Regen aus.
Er ging zu einem Münzfernsprecher außerhalb des Zeltes, um rasch seine Mutter anzurufen (es war im Jahr 1994, vor Anbruch des Handyzeitalters). Noch heute erinnert er sich an jede Sekunde des folgenden Geschehens: «Ich telefonierte mit meiner Mutter. Es regnete ein bisschen, in der Ferne Donner. Meine Mutter legte auf. Das Telefon war dreißig Zentimeter von mir entfernt, als ich getroffen wurde. Ich erinnere mich, wie ein Blitz aus dem Telefon kam. Er traf mich ins Gesicht. Danach weiß ich nur noch, dass ich nach hinten flog.»
Dann – er schien zu zögern, bevor er fortfuhr – «flog ich nach vorn. Verblüfft sah ich mich um. Ich erblickte meinen eigenen Körper am Boden. Ich sagte mir: ‹Oh, Scheiße, ich bin tot.› Ich sah, wie Menschen sich dem Körper näherten. Wie eine Frau – sie hatte hinter mir auf das Telefon gewartet – sich über meinen Körper beugte und mich reanimierte … ich schwebte die Treppe hinauf – mein Bewusstsein mit mir. Ich sah meine Kinder, und mir war klar, dass sie ohne mich zurechtkommen würden. Dann umgab mich ein bläulich weißes Licht … ein ungeheures Gefühl von Wohlergehen und Frieden. Die Höhe- und Tiefpunkte meines Lebens rauschten an mir vorüber. Das löste überhaupt keine Gefühle in mir aus … reines Denken, reine Ekstase. Ich hatte das Empfinden, zu beschleunigen, nach oben gezogen zu werden … Ich registrierte Geschwindigkeit und Richtung. Dann, als ich mir sagte: ‹Das ist das großartigste Gefühl, das ich jemals hatte› – ZACK! war ich zurück.»
Dr. Cicoria wusste, dass er in seinem Körper zurück war, weil er Schmerzen hatte – Schmerzen von den Verbrennungen im Gesicht und am linken Fuß, den Stellen, wo die elektrische Ladung in seinen Körper ein- und wieder ausgetreten war –, und ihm wurde klar: «Nur Körper können so empfinden.» Er wollte zurück, er wollte der Frau sagen, sie solle mit der Reanimation aufhören und ihn gehen lassen; aber es war zu spät – er war unwiderruflich unter die Lebenden zurückgekehrt. Nach ein oder zwei Minuten, als er wieder sprechen konnte, sagte er: «Schon gut – ich bin Arzt!» Die Frau (wie sich herausstellte, eine Intensivschwester) erwiderte: «Vor ein paar Minuten waren Sie es nicht mehr.»
Die Polizei kam und wollte einen Krankenwagen rufen, doch Cicoria wehrte sich. Da fuhren sie ihn nach Hause («es schien Stunden zu dauern»), von wo aus er seinen eigenen Arzt, einen Kardiologen, anrief. Als der Kardiologe ihn untersuchte, meinte er, Cicoria müsse einen kurzen Herzstillstand gehabt haben, konnte aber bei seiner Untersuchung und im EKG nichts Ungewöhnliches feststellen. «Bei solchen Geschichten sind Sie entweder lebendig oder tot», meinte der Kardiologe. Er glaubte nicht, dass Dr. Cicoria von diesem merkwürdigen Unfall irgendwelche Folgen zurückbehalten würde.
Cicoria suchte auch einen Neurologen auf – er fühlte sich träge (höchst ungewöhnlich für ihn) und hatte gewisse Gedächtnisprobleme. Er vergaß die Namen guter Bekannter. Doch auch die neurologischen Untersuchungen, EEG und Kernspin, ergaben nichts Ungewöhnliches.
Zwei Wochen später, als seine Energie zurückkehrte, nahm Dr. Cicoria seine Arbeit wieder auf. Er hatte noch immer ein paar nachklingende Gedächtnisprobleme – gelegentlich vergaß er die Namen seltener Krankheiten oder chirurgischer Verfahren –, aber alle seine chirurgischen Fertigkeiten waren davon unbeeinträchtigt. Nach weiteren zwei Wochen hatten sich seine Gedächtnisprobleme gelegt, und er glaubte, damit sei die Sache ausgestanden.
Was dann geschah, lässt Cicoria selbst heute noch staunen, zwölf Jahre danach. Das Leben war scheinbar zur Normalität zurückgekehrt, als «plötzlich, innerhalb von zwei oder drei Tagen, dieses unersättliche Verlangen auftrat, Klaviermusik zu hören». Dafür gab es überhaupt keinen Anknüpfungspunkt in seiner Vergangenheit. Als Kind habe er ein paar Klavierstunden gehabt, sagte er, «aber kein wirkliches Interesse». In seinem Haus gab es kein Klavier. Wenn er Musik hörte, dann eher Rockmusik.
Als diese plötzliche Lust auf Klaviermusik einsetzte, begann er, entsprechende Aufnahmen zu kaufen, und begeisterte sich besonders für Vladimir Ashkenazys Einspielungen seiner Lieblingsstücke von Chopin – Militär-Polonaise, Winterwind-Etüde, Schwarze-Tasten-Etüde, As-Dur-Polonaise, b-Moll-Scherzo. «Ich war von allen hingerissen», sagte Cicoria. «Ich hatte das Bedürfnis, sie zu spielen. Ich bestellte alle Noten. Zu diesem Zeitpunkt fragte eine unserer Babysitterinnen, ob sie ihr Klavier bei uns unterstellen dürfe – so trudelte uns genau in dem Augenblick, wo ich mich danach sehnte, ein hübsches kleines Klavier ins Haus. Das kam mir gerade recht. Ich konnte nur mit Mühe Noten lesen, kaum spielen, aber ich begann, es mir selbst beizubringen.» Die wenigen Klavierstunden seiner Kindheit waren mehr als dreißig Jahre her, und seine Finger fühlten sich steif und ungeschickt an.
Und dann, im Kielwasser dieses plötzlichen Verlangens nach Klaviermusik, begann Cicoria, Musik in seinem Kopf zu hören. «Beim ersten Mal», sagte er, «war es ein Traum. Ich hatte einen Smoking an, stand auf der Bühne; ich spielte etwas, das ich selbst geschrieben hatte. Verwirrt wachte ich auf, und die Musik war immer noch in meinem Kopf. Ich sprang aus dem Bett und versuchte, sie aufzuschreiben, soweit ich mich an sie erinnern konnte. Aber ich wusste kaum, wie ich in Notenschrift festhalten sollte, was ich hörte.» Das war nicht überraschend – er hatte noch nie versucht, Musik zu schreiben oder in Noten niederzulegen. Doch jedes Mal, wenn er sich ans Klavier setzte, um Chopin zu üben, «kam mir meine eigene Musik in den Sinn und nahm mich gefangen. Sie war ungeheuer präsent.»
Ich war mir nicht ganz sicher, was ich von dieser gebieterischen Musik halten sollte, die von seinem Bewusstsein Besitz ergriff und ihn überwältigte. Hatte er musikalische Halluzinationen? Nein, Dr. Cicoria bestritt, dass es sich um Halluzinationen handelte – «Inspiration» sei das richtigere Wort. Die Musik sei da, tief in seinem Inneren – oder irgendwo sonst –, er müsse ihr lediglich Einlass gewähren. «Es ist wie eine Frequenz, ein Radioband. Wenn ich mich öffne, kommt sie. Fast möchte ich sagen: ‹Sie fällt vom Himmel herab›, wie Mozart es ausgedrückt hat.»
Seine Musik ist unaufhörlich. «Sie versiegt nie», fuhr er fort. «Wenn überhaupt, muss ich sie abstellen.»
Jetzt musste er nicht nur damit ringen, Chopin spielen zu lernen, sondern auch, der Musik, die ständig in seinem Kopf ablief, eine Form zu geben, sie auf dem Klavier zu probieren und auf Notenpapier festzuhalten. «Es war ein schrecklicher Kampf», sagte er. «Um vier Uhr morgens stand ich auf und spielte, bis ich zur Arbeit ging, und wenn ich nach Hause kam, saß ich den ganzen Abend am Klavier. Meine Frau war nicht besonders erfreut. Ich war besessen.»
Im dritten Monat nach dem Blitzschlag war Cicoria – der einst so unbeschwerte, freundliche Familienmensch, dem Musik fast gleichgültig gewesen war – von Musik beseelt, ja, besessen, und hatte kaum noch Zeit für irgendetwas anderes. Er begann zu glauben, er sei zu einem besonderen Zweck «gerettet» worden. «Ich bildete mir ein», sagte er, «dass der einzige Grund dafür, weiterleben zu dürfen, die Musik sei.» Ich fragte ihn, ob er vor dem Blitzschlag religiös gewesen sei. Er sei katholisch erzogen worden, sagte er, habe das aber nie besonders ernst genommen; er hänge auch einigen «unorthodoxen» Vorstellungen an, etwa der Wiedergeburt.
Er gelangte sogar zu der Überzeugung, selbst eine Art Wiedergeburt erlebt zu haben, die ihn verwandelt und ihm das besondere Talent geschenkt habe, sich auf die Musik «einzustimmen», die er, halb metaphorisch, «Musik vom Himmel» nannte. Die ergoss sich häufig in einem «absoluten Sturzbach» von Tönen, ununterbrochen, pausenlos, und er musste ihr Form und Gestalt verleihen. (Als er das sagte, musste ich an Cædmon denken, den angelsächsischen Dichter aus dem 7. Jahrhundert, einen Ziegenhirten, der weder lesen noch schreiben konnte, aber, so erzählte man sich, die «Kunst des Singens» eines Nachts im Traum empfangen habe und den Rest seines Lebens damit verbrachte, Gott und die Schöpfung in Hymnen und Gedichten zu preisen.)
Cicoria setzte die Arbeit am Klavierspielen und Komponieren fort. Er besorgte sich Bücher über Notenschrift und erkannte bald, dass er einen Musiklehrer brauchte. Er reiste zu den Konzerten seiner Lieblingsinterpreten, hatte aber nichts mit Musikfreunden und den Musikveranstaltungen in der eigenen Stadt im Sinn. Es war eine einsame Beschäftigung, die nur ihn und seine Muse anging. Ich fragte ihn, ob er seit dem Blitzschlag andere Veränderungen an sich festgestellt habe – ein neues Kunstverständnis vielleicht, andere Lektürevorlieben, neue Überzeugungen? Cicoria sagte, er sei seit der Nahtod-Erfahrung «sehr spirituell» geworden. Er habe angefangen, alle Bücher über Nahtod-Erfahrungen und Blitzeinschläge zu lesen, die er habe finden können. Er habe sich «eine ganze Bibliothek über Tesla» zugelegt und jedes Buch beschafft, das von der schrecklich-schönen Macht der Hochspannung handle. Er glaubte, manchmal «Licht- oder Energieauren» um die Körper der Menschen wahrzunehmen – etwas, was er vor dem Blitzschlag nie gesehen hatte.
Einige Jahre vergingen, und nie wurde Cicoria von seiner Inspiration verlassen. Er arbeitete weiterhin hauptberuflich als Chirurg, doch mit Herz und Verstand gehörte er fortan der Musik. 2004 ließ er sich scheiden und erlitt im selben Jahr einen fürchterlichen Motorradunfall. Er konnte sich nicht daran erinnern, aber seine Harley war von einem anderen Fahrzeug erfasst worden, und er landete im Graben. Bewusstlos und schwer verletzt, mit Knochenbrüchen, einem Milzriss, Lungenperforation, Herzprellungen und Kopfverletzungen, trotz Helm. Dennoch wurde er vollkommen gesund und konnte nach zwei Monaten wieder arbeiten. Weder sein Unfall noch seine Kopfverletzung, noch seine Scheidung schienen irgendetwas an seiner Leidenschaft fürs Klavierspielen und Komponieren geändert zu haben.
Ich habe nie wieder einen ähnlichen Fall wie den von Tony Cicoria erlebt, wohl aber Patienten, bei denen musikalische oder künstlerische Interessen ebenso plötzlich auftraten – darunter auch Salimah M., die in der chemischen Forschung tätig war. Mit Anfang vierzig stellten sich bei Salimah kurze Phasen von einer Minute oder weniger ein, in denen sie «ein seltsames Gefühl» überkam – manchmal das Empfinden, sie sei an einem Strand, den sie von früher kannte, während sie sich gleichzeitig ihrer gegenwärtigen Umgebung vollkommen bewusst blieb und in der Lage war, ein Gespräch fortzusetzen, Auto zu fahren oder zu tun, womit immer sie gerade beschäftigt war. Gelegentlich waren diese Episoden von einem «sauren Geschmack» im Mund begleitet. Sie bemerkte diese seltsamen Erscheinungen, dachte aber nicht, dass sie irgendeine neurologische Bedeutung haben könnten. Erst als sie im Sommer 2003 einen großen Epilepsieanfall erlitt, suchte sie einen Neurologen auf, der ihr Gehirn scannte und einen großen Tumor im rechten Temporallappen entdeckte. Der Grund für die seltsamen Episoden, die jetzt als Temporallappenanfälle diagnostiziert wurden. Der Tumor war nach Meinung ihrer Ärzte bösartig (wenn auch wahrscheinlich ein Oligodendrogliom von relativ geringer Bösartigkeit) und musste entfernt werden. Salimah fragte sich, ob das ihr Todesurteil sei, und hatte Angst vor der Operation und ihren möglichen Folgen; man hatte ihr und ihrem Mann mitgeteilt, es könnten einige «Persönlichkeitsveränderungen» auftreten. Am Ende aber verlief die Operation gut, der größte Teil des Tumors wurde entfernt, und nach einer gewissen Zeit der Rekonvaleszenz konnte Salimah ihre Arbeit als Chemikerin wieder aufnehmen.
Vor dem Eingriff war sie eine ziemlich zurückhaltende Frau gewesen, die sich gelegentlich über Kleinigkeiten wie Staub oder Unordnung aufregen konnte; ihr Mann sagte, bei Haushaltspflichten sei sie manchmal «zwanghaft» gewesen. Doch nach der Operation schienen solche häuslichen Angelegenheiten ihre Bedeutung für Salimah verloren zu haben. Sie war, in der eigenwilligen Ausdrucksweise ihres Mannes (Englisch war nicht die Muttersprache der beiden), «eine glückliche Katze» geworden. Sie sei, so erklärte er, eine «Fachfrau für Lebensfreude».
Salimahs neue Fröhlichkeit zeigte sich auch am Arbeitsplatz. Seit fünfzehn Jahren arbeitete sie in diesem Labor und war immer wegen ihrer Intelligenz und ihres Fleißes bewundert worden. Doch jetzt schien sie, obwohl unverändert tüchtig im Beruf, ein sehr viel warmherzigerer Mensch geworden zu sein, sehr sympathisch und am Leben und den Gefühlen ihrer Kollegen interessiert. Während sie sich vorher, wie ein Kollege sagte, mehr «in sich zurückgezogen» hatte, wurde sie nun die Vertraute und der soziale Mittelpunkt des gesamten Labors.
Auch zu Hause legte sie die Marie-Curie-Haltung, diese ganz auf den Beruf ausgerichtete Persönlichkeit, ein bisschen ab. Sie konnte jetzt ihre beruflichen Probleme, ihre Gleichungen, auch mal vergessen, ging ins Kino, auf Partys, amüsierte sich. Außerdem war eine neue Liebe, eine neue Leidenschaft in ihr Leben getreten. Als Mädchen war sie «irgendwie musikalisch» gewesen, wie sie selbst sagte, hatte ein bisschen Klavier gespielt, ohne dass die Musik jemals eine größere Rolle für sie gespielt hatte. Das war jetzt anders. Sie verspürte das Verlangen nach Musik, den Wunsch, in Konzerte zu gehen, klassische Musik im Radio oder auf CD zu hören. Sie konnte nun bei einer Musik, die früher «keine besonderen Gefühle» in ihr geweckt hatte, in Verzückung geraten oder in Tränen ausbrechen. Sie wurde «süchtig» nach dem Autoradio, dem sie lauschte, während sie zur Arbeit fuhr. Ein Kollege, der auf der Straße zum Labor an ihr vorbeikam, berichtete, die Musik in ihrem Radio sei «unglaublich laut» gewesen – er habe sie noch einen halben Kilometer weit hören können. Salimah habe in ihrem Kabrio «die ganze Schnellstraße unterhalten».
Mit Salimah gingen – wie mit Tony Cicoria – tiefgreifende Veränderungen vor: Aus einem anfangs nur vagen Interesse an Musik wurden eine leidenschaftliche Hingabe und ein ständiges Verlangen danach. Und bei beiden gab es auch andere, allgemeinere Veränderungen – eine Woge von Emotionalität, als würden Gefühle jeder Art angeregt oder freigesetzt. Dazu Salimah: «Nach der Operation geschah etwas – ich fühlte mich wie wiedergeboren. Das veränderte meine Einstellung zum Leben und ließ mich jede Minute genießen.»
Könnte jemand eine «reine» Musikophilie entwickeln, ohne begleitende Veränderungen in Persönlichkeit oder Verhalten? Diese Situation beschrieben Rohrer, Smith und Warren 2006 in der erstaunlichen Fallgeschichte einer Frau Mitte sechzig, die unter refraktären Temporallappenanfällen mit einem Herd im rechten Temporallappen litt. Nach sieben Jahren ließ sich ihre Epilepsie schließlich durch das Antikonvulsivum Lamotrigin (LTG) unter Kontrolle bringen. Bevor die Patientin das Medikament bekam, war ihr, wie Rohrer und seine Kollegen schrieben,
Musik immer gleichgültig gewesen, hatte sie sich nie einfach zum Vergnügen Musik angehört oder Konzerte besucht, ganz anders als ihr Mann und ihre Tochter, die Klavier und Geige spielten … Sie fühlte sich auch von der traditionellen Thai-Musik nicht angesprochen, die sie in der Familie und bei öffentlichen Veranstaltungen in Bangkok gehört hatte, genauso wenig wie von den klassischen und populären Musikrichtungen des Westens, nachdem sie nach Großbritannien gezogen war. Tatsächlich ging sie der Musik aus dem Weg, wo es möglich war, und hatte eine ausgesprochene Abneigung gegen bestimmte musikalische Klänge (beispielsweise schloss sie die Tür, um ihren Mann nicht Klavier spielen zu hören, und fand Chormusik «lästig»).
Diese Gleichgültigkeit gegenüber der Musik veränderte sich schlagartig, als die Patientin auf Lamotrigin umgestellt wurde:
Binnen weniger Wochen nach Beginn der Verabreichung von LTG war ein grundlegender Wandel ihres Musikverständnisses zu beobachten. Sie suchte sich Musiksendungen im Radio und Fernsehen, lauschte jeden Tag stundenlang Klassik-Sendern und wollte in Konzerte gehen. Ihr Mann berichtete, sie hätte während einer ganzen Traviata-Aufführung wie «versteinert» dagesessen und verärgert reagiert, wenn sich andere Zuschauer zwischendurch unterhielten. Jetzt beschrieb sie das Hören klassischer Musik als ein außerordentlich angenehmes und gefühlvolles Erlebnis. Allerdings sang und pfiff sie nicht, und auch sonst wurden bei ihr keine Veränderungen in Verhalten oder Persönlichkeit beobachtet. Es gab keine Anzeichen für Störungen, Halluzinationen oder Verstimmungen.
Zwar konnten Rohrer et al. sich nicht auf die exakte Ursache der Musikophilie ihrer Patientin festlegen, äußerten aber die Vermutung, es habe sich möglicherweise in den Jahren der refraktären Anfallsaktivität eine verstärkte funktionale Verbindung zwischen den Wahrnehmungssystemen in den Temporallappen und Teilen des für emotionale Reaktionen zuständigen limbischen Systems entwickelt – eine Verbindung, die erst zutage getreten sei, als ihre Anfälle mit Hilfe der Medikation unter Kontrolle gebracht worden sei. In den siebziger Jahren hat David Bear die Hypothese aufgestellt, dass eine solche sensorisch-limbische Hyperkonnektivität der Grund für die Entstehung unverhoffter künstlerischer, sexueller, mystischer oder religiöser Gefühle sein könnte, die gelegentlich bei Menschen mit Temporallappenepilepsie auftreten. Ist möglicherweise auch Tony Cicoria so etwas zugestoßen?
Im letzten Frühjahr nahm Cicoria an einer zehntägigen musikalischen Freizeit für Musikstudenten, begabte Laien und Berufsmusiker teil. Die Veranstaltung dient Erica vanderLinde Feidner, einer Konzertpianistin, zugleich als Verkaufsausstellung, denn sie hat sich darauf spezialisiert, das ideale Klavier für jeden ihrer Kunden zu finden. Tony hatte gerade ein Instrument von ihr gekauft, einen Bösendorfer Flügel, ein in Wien gefertigtes Unikat – und sie fand, er habe einen bemerkenswerten Instinkt bei der Auswahl eines Instrumentes bewiesen, das genau den von ihm gewünschten Ton hatte. Cicoria glaubte, es sei der richtige Zeitpunkt und der richtige Ort, um sein Debüt als Musiker zu geben. Zwei Stücke studierte er für sein Konzert ein: seine erste Liebe, das b-Moll-Scherzo, und seine erste eigene Komposition, die er Rhapsodie, opus 1, nannte. Sein Spiel und seine Geschichte faszinierte alle Teilnehmer der Freizeit (viele äußerten den nicht ganz ernst gemeinten Wunsch, ebenfalls von einem Blitz getroffen zu werden). Er spielte, sagte Erica, «mit großer Leidenschaft, großem Schwung» – und wenn nicht mit übermenschlicher Genialität, so doch zumindest mit beachtlicher Fertigkeit, eine erstaunliche Leistung für jemanden, der praktisch keine musikalische Ausbildung hatte und sich das Spielen mit zweiundvierzig Jahren selbst beigebracht hatte.
Was ich denn nach allem von seiner Geschichte halte, fragte mich Cicoria. Ob mir jemals etwas Ähnliches untergekommen sei? Ich fragte ihn, was er denn meine und wie er interpretiere, was ihm zugestoßen sei. Er sagte, dass er als Mediziner außerstande sei, diese Ereignisse zu erklären, und dass er ihnen deshalb aus «spiritueller» Sicht begegne. Ich erwiderte, dass ich bei allem Respekt vor Spiritualität doch der Meinung sei, dass selbst die intensivsten Gemütsverfassungen, die erstaunlichsten Verwandlungen irgendeine physische Basis oder zumindest ein physiologisches Korrelat in der neuronalen Aktivität haben müssten.
Als Dr. Cicoria von einem Blitz getroffen wurde, hatte er sowohl eine Nahtod- als auch eine Außerkörperliche Erfahrung. Viele übernatürliche oder mystische Erklärungen sind für die Außerkörperlichen Erfahrungen vorgeschlagen worden, aber sie sind auch seit mindestens 100 Jahren Gegenstand neurologischer Untersuchung. Der Ablauf dieser Erlebnisse erscheint relativ stereotyp zu sein: Man scheint nicht mehr im eigenen Körper zu sein, sondern außerhalb seiner und schaut in den meisten Fällen aus einer Höhe von zweieinhalb oder zweidreiviertel Metern auf sich hinab (Neurologen sprechen in diesem Fall von «Autoskopie»). Man scheint das Zimmer sowie die Menschen und Gegenstände in der Nähe deutlich zu sehen, aber eben von oben. Menschen, die solche Erlebnisse hatten, berichten häufig von vestibulären Empfindungen wie dem «Schweben» oder «Fliegen». Außerkörperliche Erfahrungen können Furcht, Freude oder ein Gefühl der Distanzierung hervorrufen, aber sie werden gewöhnlich als außerordentlich «real» beschrieben – keineswegs wie Träume oder Halluzinationen. Sie sind bei vielen Arten von Nahtod-Erfahrungen und Temporallappenanfällen geschildert worden. Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass sowohl visuell-räumliche wie vestibuläre Aspekte von Außerkörperlichen Erfahrungen mit Funktionsstörungen in der Großhirnrinde zusammenhängen, vor allem im Übergang vom Temporal- zum Parietallappen.[*]
Doch es war nicht nur eine Außerkörperliche Erfahrung, von der Dr. Cicoria berichtete. Er sah auch bläulich weißes Licht, er sah seine Kinder, sein Leben raste an ihm vorbei, er hatte ekstatische Empfindungen und vor allem das Gefühl, etwas Transzendentes und außerordentlich Bedeutsames zu erleben. Was käme als neuronale Basis dafür in Frage? Ähnliche Nahtod-Erfahrungen sind häufig von Menschen beschrieben worden, die in großer Gefahr waren oder zu sein glaubten, etwa bei plötzlichen Unfällen, Blitzeinschlägen oder, in den meisten Fällen, bei Wiederbelebung nach Herzstillstand. All diese Situationen lösen nicht nur Schrecken aus, sondern bewirken wahrscheinlich auch einen plötzlichen Abfall des Blutdrucks und des zerebralen Blutflusses (bei Herzstillstand auch einen Sauerstoffmangel im Gehirn). Es kommt in solchen Zuständen wahrscheinlich zu intensiverer emotionaler Erregung und einer verstärkten Ausschüttung von Noradrenalin und anderen Neurotransmittern, egal, ob es sich bei dem Affekt um Schrecken oder Verzückung handelt. Bislang haben wir kaum eine Vorstellung von den wirklichen neuronalen Korrelaten solcher Erfahrungen, doch die auftretenden Veränderungen von Bewusstsein und Emotionen müssen sehr tief reichen und die emotionalen Teile des Gehirns – die Amygdala und die Hirnstammkerne – sowie den Kortex einbeziehen.[*]
Während Außerkörperliche Erfahrungen den Charakter einer (wenn auch komplexen und singulären) Wahrnehmungstäuschung haben, besitzen Nahtod-Erfahrungen alle Kennzeichen einer mystischen Erfahrung, wie sie William James definiert – Passivität, Unbeschreiblichkeit, Flüchtigkeit und eine noetische Qualität. Von einer Nahtod-Erfahrung wird man vollkommen vereinnahmt, fast buchstäblich in einer Flamme (manchmal auch einem Tunnel oder Trichter) verschluckt und in ein Jenseits gezogen – jenseits des Lebens und jenseits von Zeit und Raum. Man hat das Empfinden eines letzten Blickes, eines (erheblich beschleunigten) Abschieds von irdischen Dingen, den Orten und Menschen und Ereignissen des Lebens und ein Gefühl der Ekstase oder der Freude, während man seiner Bestimmung entgegenschwebt – eine archetypische Symbolik von Tod und Verwandlung. Derartige Erfahrungen sind von den Betroffenen nicht leicht abzuschütteln und führen manchmal zu einer Metamorphose oder Metanoia, einer Bewusstseinsveränderung, die dem Leben eine neue Richtung oder Orientierung gibt. Wir können bei diesen Erlebnissen, so wenig wie bei Außerkörperlichen Erfahrungen, nicht davon ausgehen, dass es sich um reine Einbildung handelt; in jedem Bericht tauchen ganz ähnliche Grundzüge auf. Nahtod-Erlebnisse müssen auch eine eigene neuronale Basis haben, eine, die das Bewusstsein selbst tiefgreifend verändert.
Wie verhält es sich mit Dr. Cicorias bemerkenswertem Musikalitätsschub, seiner plötzlichen Musikophilie? Patienten mit einer Degeneration der vorderen Gehirnregionen, einer sogenannten frontotemporalen Demenz, zeigen gelegentlich ein verblüffendes Auftreten von musikalischer Befähigung und Begeisterung, während sie Abstraktions- und Sprachvermögen einbüßen – was bei Dr. Cicoria mit Sicherheit nicht der Fall war, dessen sprachliche und geistige Fähigkeiten in jeder Hinsicht unbeeinträchtigt blieben. 1984 beschrieb Daniel Jacome einen Patienten, dessen linke Gehirnhälfte durch einen Schlaganfall geschädigt wurde und der in der Folge neben Aphasie und anderen Problemen auch «Hypermusie» und «Musikophilie» entwickelte. Doch nichts deutete darauf hin, dass Tony Cicoria nennenswerte Hirnschädigungen aufwies, abgesehen von einer sehr flüchtigen Störung seiner Gedächtnissysteme während der ersten ein oder zwei Wochen nach dem Blitzschlag.
Seine Situation erinnerte mich ein bisschen an Franco Magnani, den «Gedächtniskünstler», den ich einmal beschrieben habe.[*] Franco hatte sich nie für einen Maler gehalten, bis er mit einunddreißig Jahren eine merkwürdige Krankheitskrise erlebte – vielleicht eine Form von Temporallappenepilepsie. Nachts träumte er von Pontito, dem kleinen toskanischen Dorf, in dem er geboren wurde. Nach dem Erwachen blieben diese Bilder außerordentlich lebendig, voller Tiefe und Natürlichkeit («wie Hologramme»). Franco wurde von dem Wunsch verzehrt, diese Bilder festzuhalten, sie zu malen, daher brachte er sich selbst das Malen bei und opferte fortan jede freie Minute, um Hunderte von Ansichten Pontitos auf die Leinwand zu bannen.
Könnten Tony Cicorias musikalische Träume, seine musikalischen Eingebungen, epileptischer Natur gewesen sein? Diese Frage lässt sich aufgrund eines schlichten EEG, wie es nach dem Unfall an Cicoria vorgenommen wurde, nicht beantworten. Zur Beurteilung wäre ein spezielles Langzeit-EEG über mehrere Tage hinweg erforderlich.
Und warum entwickelte sich Cicorias Musikophilie mit solcher Verzögerung? Was war in den sechs oder sieben Wochen geschehen, die zwischen seinem Herzstillstand und dem eher plötzlichen Ausbruch seiner Musikalität verstrichen waren? Wir wissen, dass es unmittelbare Nachwirkungen des Blitzschlags gab: die Außerkörperliche und die Nahtod-Erfahrung, den Verwirrungszustand, der einige Stunden, und die Gedächtnisstörung, die einige Wochen anhielt. Die könnten allein auf die zerebrale Anoxie zurückzuführen sein – sein Gehirn muss mindestens eine Minute lang ohne hinreichende Sauerstoffzufuhr gewesen sein –, allerding kann es zu direkten zerebralen Auswirkungen durch den Blitzschlag selbst gekommen sein. Wir müssen jedoch davon ausgehen, dass Dr. Cicorias scheinbare Genesung einige Wochen nach diesem Ereignis nicht so vollständig war, wie sie erschien, dass es andere, unbemerkte Formen der Hirnschädigung gab und dass sein Gehirn auf die ursprüngliche Läsion reagierte und sich während dieses Zeitraums reorganisierte.
Dr. Cicoria hat das Empfinden, jetzt «ein anderer Mensch» zu sein – musikalisch, emotional, psychologisch und spirituell. Das war auch mein Eindruck, als ich mir seine Geschichte anhörte und Kostproben der neuen Leidenschaften sah, die ihn verwandelt hatten. Aus neurologischer Sicht betrachtet, hatte ich den Eindruck, dass sein Gehirn jetzt ganz anders sein musste als vor dem Blitzschlag oder in den Tagen unmittelbar danach, als neurologische Tests keine schwerwiegenden Befunde brachten. Veränderungen gab es vermutlich in den Wochen danach, als sich sein Gehirn neu organisierte – gewissermaßen auf die Musikophilie vorbereitete. Könnten wir jetzt, zwölf Jahre später, diese Veränderung bestimmen, die neurologische Grundlage seiner Musikophilie? Viele neue und weitaus empfindlichere Tests der Gehirnfunktionen sind entwickelt worden, seit Cicoria 1994 seine Verletzung erlitt, und er stimmte mir zunächst zu, dass es interessant sein müsse, der Sache tiefer auf den Grund zu gehen. Doch kurz darauf überdachte er es noch einmal und meinte, es sei vielleicht das Beste, alles auf sich beruhen zu lassen. Er habe Glück gehabt, und die Musik, egal, wie er zu ihr gekommen sei, sei ein Segen, eine Gnade, die er nicht in Frage stellen wolle.
Postskriptum
Seit ich Tony Cicorias Geschichte erstmals veröffentlichte, erreichten mich viele Zuschriften von Leuten, die zwar nicht vom Blitzschlag getroffen waren und offenbar keine besonderen physischen oder psychischen Beeinträchtigungen aufwiesen, aber zu ihrer großen Überraschung – in ihrem fünften, sechsten oder gar neunten Lebensjahrzehnt – unvermutete kreative Begabungen oder Neigungen an sich feststellten, musikalischer oder anderer künstlerischer Art.
Meine Korrespondentin Grace M. schilderte den recht unvermittelten Beginn ihrer Musikalität im Alter von 55 Jahren. Kurze Zeit nach Rückkehr von einer Urlaubsreise nach Israel und Jordanien begann sie im Kopf bruchstückhaft Lieder zu hören. Sie versuchte, diese festzuhalten, indem sie «Linien auf ein Blatt Papier zeichnete» – Notenschrift war ihr nicht geläufig. Als dies zu nichts führte, kaufte sie sich einen Recorder und besang das Band. Heute, drei Jahre später, hat sie mehr als 3300 Bruchstücke aufgezeichnet und dazu, auf ihnen aufbauend, monatlich etwa vier vollständige Lieder. Grace gab an, dass sie zwar schon Popsongs im Geiste vernehme, seit sie zurückdenken kann, doch erst nach dem erwähnten Urlaub höre sie fast ausschließlich ihre eigenen Lieder.
«Ich zeichnete mich nie durch großes musikalisches Können aus», schrieb sie, «und habe auch kein besonderes Ohr für Musik.» Allerdings fragte sie sich, wie denn jemand wie sie, der offenkundig nicht allzu musikalisch sei, plötzlich den Kopf voller Lieder und Liedfragmente haben könne. Zögernd zeigte sie ihre Lieder anderen, auch Berufsmusikern, und erhielt ermutigende Kritik. «Ich habe es weder erwartet noch erhofft», sagte sie, «nie habe ich davon geträumt, ein Songwriter zu werden … Ich hatte so wenig musikalisches Talent. Genauso gut hätte ich mich danach sehnen können, ein Supermodel zu werden.»
Für ihren plötzlichen Drang, Lieder zu schreiben, konnte sie sich keine physische Ursache vorstellen: «Im Gegensatz zu Dr. Cicoria», schrieb sie, «hat mich kein Blitz getroffen. Ich hatte nie eine Kopfverletzung und habe auch nie einen schwereren Unfall erlitten. Ich war nie so krank, dass ich stationär hätte behandelt werden müssen. Ich glaube nicht, dass ich eine Schläfenlappenepilepsie habe oder an frontotemporaler Demenz leide.» Sie fragte sich allerdings, ob es auf ihrer Reise nach Israel und Jordanien einen psychischen Impuls gegeben habe, irgendeinen «Auslöser». Als gläubigem Menschen sei die Reise ihr ein wichtiges Anliegen gewesen, doch habe sie dabei weder besondere Erscheinungen noch Visionen erlebt. (Sie glaubt nicht an einen missionarischen Auftrag, ihre Musik zu verbreiten oder Dritte teilhaben zu lassen; wenn überhaupt, dann ist sie in dieser Beziehung eher zurückhaltend. «Ich bin von meinem Wesen her kein Vortragskünstler oder Selbstdarsteller und finde das alles eher peinlich», schrieb sie.)
Eliza Bussey, eine andere Korrespondentin, ebenfalls Mittfünfzigerin, schrieb:
Vor vier Jahren, ich war fünfzig, kam ich an einer Musikalienhandlung vorbei und bemerkte im Schaufenster eine Keltische Harfe. Als ich das Geschäft zwei Stunden später verließ, gehörte mir eine Keltische 2000-Dollar-Harfe. Dieser Augenblick veränderte mein Leben. Jetzt dreht sich alles nur noch um Musik und Musikschreiben. Vor vier Jahren konnte ich nicht eine Note lesen, jetzt studiere ich klassische Harfe am Peabody-Konservatorium in Baltimore. Ich habe drei Zwölfstunden-Nachtschichten in der Nachrichtenredaktion übernommen – medizinische Informationen zur Berichterstattung über den Irak –, sodass ich donnerstags und freitags zum Unterricht gehen konnte. Ich übe täglich zwei bis drei Stunden (würde gern mehr tun, wenn ich könnte) und kann gar nicht beschreiben, welche Freude und Verwunderung ich empfinde, wenn ich bedenke, dass mir dies im vorgerückten Alter noch vergönnt ist. Beispielsweise habe ich gespürt, wie mein Gehirn und meine Finger sich zu verbinden suchten, um neue Synapsen zu bilden, als [mein Lehrer] mich Händels Passacaille spielen ließ.
«Ich würde mich gern einer Kernspintomographie unterziehen», fügte sie hinzu, «ich weiß, dass mein Gehirn sich enorm verändert hat.»
Kapitel 2Ein Seltsam Vertrautes Gefühl: Musikalische Krampfanfälle
Jon S., ein robuster Mann von fünfundvierzig, war bis Januar 2006 bei bester Gesundheit. Die Arbeitswoche hatte gerade begonnen; Montagmorgen, er befand sich in seinem Büro und ging etwas aus dem Abstellraum holen. Sobald er ihn betreten hatte, hörte er plötzlich Musik – «klassisch, melodisch, sehr hübsch, tröstlich … dunkel vertraut … Es war ein Streichinstrument, eine Sologeige.»
Augenblicklich dachte er: «Wo zum Teufel kommt diese Musik her?» Es gab in dieser Abstellkammer eine alte Stereoanlage, die zwar noch Knöpfe, aber keine Lautsprecher mehr hatte. Verwirrt, in einem Zustand, den er später als «scheintot» bezeichnete, griff er nach den Knöpfen, um die Musik abzustellen.
«Dann», sagt er, «ging ich hinaus.» Ein Kollege im Büro, der alles beobachtete, berichtete, S. sei in der Abstellkammer «zusammengesackt gewesen, ohne Reaktion», habe aber keinen Krampfanfall gehabt.
Als Nächstes erinnert sich S. an einen Rettungssanitäter, der sich über ihn beugte und ihm Fragen stellte. S. konnte sich zwar nicht an das Datum, aber an seinen Namen erinnern. Er wurde in die Notaufnahme eines städtischen Krankenhauses gebracht, wo er einen weiteren Anfall hatte. «Ich lag da, der Arzt untersuchte mich, meine Frau war anwesend … dann begann ich wieder Musik zu hören, und ich sagte: ‹Es geht schon wieder los›, und dann war ich weg.»
Er wachte in einem anderen Zimmer auf, wo er merkte, dass er sich auf die Zunge und in die Wangen gebissen und heftige Schmerzen in den Beinen hatte. «Sie sagten, ich hätte einen Anfall gehabt, einen richtigen, mit Krämpfen … Es ging alles viel schneller als beim ersten Mal.» S. wurde einigen Tests unterzogen und bekam ein Antileptikum, um ihn vor weiteren Anfällen zu bewahren. Seither hat man weitere Tests an ihm vorgenommen (von denen keiner etwas Ungewöhnliches erbrachte – was bei Temporallappenepilepsie durchaus nicht ungewöhnlich ist). Zwar zeigte das Neuroimaging keine nachweisbaren Schädigungen, doch S. erwähnte, er habe mit fünfzehn eine ernsthafte Kopfverletzung erlitten – zumindest eine Gehirnerschütterung –, und die mochte leichte Narben in den Temporallappen hinterlassen haben.
Als ich ihn bat, die Musik zu beschreiben, die er unmittelbar vor seinen Anfällen gehört hatte, versuchte er, die Melodie zu singen, aber es gelang ihm nicht – er sagte, er könne überhaupt keine Melodie singen, auch nicht, wenn sie ihm geläufig sei. Er sei überhaupt nicht sehr musikalisch, und die Art klassischer Violinmusik, die er vor seinem Anfall «gehört» habe, sei ganz und gar nicht nach seinem Geschmack; sie habe sich «wimmernd, nach Katzen» angehört. Gewöhnlich höre er sich Popmusik an. Und doch sei sie ihm irgendwie vertraut erschienen – vielleicht habe er sie vor langer Zeit, als Kind, gehört?
Ich sagte ihm, wenn er diese Musik jemals hören würde – im Radio vielleicht –, solle er sich aufschreiben, was es sei, und es mich wissen lassen. S. versprach, die Ohren offen zu halten, doch als wir darüber sprachen, fragte er sich immer wieder, ob die der Musik innewohnende Vertrautheit nicht einfach ein Gefühl, vielleicht eine Einbildung sei, und nicht die tatsächliche Erinnerung an etwas, was er einst gehört habe. Sie habe zwar etwas Erinnerungsträchtiges an sich, das aber sei so schwer fassbar wie die Musik, die man im Traum höre.
Damit ließen wir es bewenden. Ich bin gespannt, ob ich eines Tages einen Anruf von S. bekommen und von ihm erfahren werde: «Ich habe es gerade im Radio gehört! Es war eine Bach-Suite für Sologeige», oder ob das, was er vernommen hatte, ein Traumgebilde war, ein Konglomerat, das er, ungeachtet aller «Vertrautheit», niemals wird identifi zieren können.
Hughlings Jackson schrieb in den 1870er Jahren über das Gefühl der Vertrautheit, das so häufig ein Merkmal der dem Temporallappenanfall vorangehenden Aura ist. Auch er sprach von «Traumzuständen», «Déjà-vu-Erlebnisssen» und «Reminiszenzen». Solche Erinnerungsempfindungen hätten, so Jackson, unter Umständen überhaupt keinen näher bestimmbaren Inhalt. Während einige Menschen während eines Anfalls das Bewusstsein verlieren, bleiben sich andere ihrer Umgebung vollkommen bewusst und treten in einen anderen, die Wirklichkeitsebene überlagernden Zustand ein, in dem sie seltsame Stimmungen, Gefühle, Visionen, Gerüche – oder eben Musik erleben. Hughlings Jackson spricht in diesem Zusammenhang von einer «Verdoppelung des Bewusstseins».
Eric Markowitz, ein junger Musiker und Lehrer, bekam in seinem linken Temporallappen ein Astrozytom, einen Tumor von relativ geringer Bösartigkeit, der 1993 operiert wurde. Er kam zehn Jahre später wieder, wurde dann aber, weil in Nähe der Sprachareale des Temporallappens gelegen, als inoperabel eingestuft. Mit dem Nachwachsen seines Tumors bekam er wiederholte Anfälle, bei denen er zwar nicht das Bewusstsein verlor, aber in deren Verlauf, wie er mir schrieb, «rund zwei Minuten lang Musik in meinem Kopf explodierte. Ich liebe Musik; ich habe sie zu meinem Beruf gemacht, daher scheint mir eine gewisse Ironie darin zu liegen, dass die Musik auch zu meinem Quälgeist geworden ist.» Dabei werden Erics Anfälle nicht durch Musik ausgelöst, wie er betont, vielmehr ist die Musik immer nur ein Teil von ihnen. Wie Jon S. kommt auch Eric seine halluzinatorische Musik sehr real und beklemmend vertraut vor:
Zwar kann ich nicht genau angeben, welcher Song oder welche Songs ich während dieser Aura-Anfälle höre, aber ich weiß, dass sie mir sehr vertraut erscheinen – tatsächlich so vertraut, dass ich manchmal nicht weiß, ob diese Songs aus einer Stereoanlage in der Nähe oder in meinem Gehirn erklingen. Sobald mir diese seltsame und doch vertraute Verwirrung bewusst wird und ich merke, dass es sich tatsächlich um einen Anfall handelt, versuche ich anscheinend, nicht herauszufinden, was für eine Musik es sein könnte – denn würde ich es eingehender untersuchen wie ein Gedicht oder ein Musikstück, würde es mir gelingen … doch vielleicht befürchte ich unbewusst, dass ich dem Song, würde ich ihm zu viel Aufmerksamkeit schenken, nicht mehr entkommen könnte – als wäre er Treibsand oder eine Hypnose.
Obwohl Eric (anders als Jon S.) ziemlich musikalisch ist – er verfügt über ein ausgezeichnetes musikalisches Gedächtnis und ein sehr geschultes Ohr – und obwohl er mehr als ein Dutzend solcher Anfälle hatte, ist er (wie S.) völlig außerstande, die aurale Musik zu erkennen.[*] Bei der «seltsamen und doch vertrauten Verwirrung», die ein fester Bestandteil seiner Anfallserfahrung ist, fällt es Eric schwer, einen klaren Gedanken zu fassen. Seine Frau oder Freunde bemerken, wenn sie zugegen sind, vielleicht «einen merkwürdigen Ausdruck» auf seinem Gesicht. Wenn er bei der Arbeit einen Anfall hat, kann er ihn gewöhnlich irgendwie «überspielen», sodass seine Studenten gar nichts merken.
Es gibt laut Eric allerdings einen grundlegenden Unterschied zwischen seinem normalen musikalischen Vorstellungsvermögen und dem seiner Anfälle: «Als Songwriter bin ich vertraut damit, dass Melodien und Wörter einem aus dem Nirgendwo zufliegen können … das ist trotzdem intentional – ich sitze mit meiner Gitarre in der Dachkammer und arbeite an der Vollendung meines Songs. Meine Anfälle aber haben mit alldem nichts zu tun.»
Weiter berichtete er, dass seine epileptische Musik – obwohl scheinbar zusammenhanglos und bedeutungslos, aber doch beklemmend vertraut – einen erschreckenden und fast gefährlichen Zauber auf ihn auszuüben schien, sodass er immer tiefer in sie hineingezogen wurde. Andererseits fühlte er sich von diesen musikalischen Auren aber auch in seiner schöpferischen Arbeit inspiriert, sodass er Stücke komponierte, in denen er ihren geheimnisvollen und unbeschreiblich seltsamen und doch vertrauten Charakter auszudrücken oder zumindest anzudeuten suchte.
Kapitel 3Furcht vor Musik: Musikogene Epilepsie
1937 beschrieb Macdonald Critchley, ein hervorragender Beobachter ungewöhnlicher neurologischer Syndrome, elf seiner eigenen Patienten, die musikalisch induzierte epileptische Anfälle hatten, und bezog in seine Erhebung auch Fälle ein, die von anderen Forschern berichtet worden waren. Seinen wegweisenden Artikel nannte er «musikogene Epilepsie» (obwohl er erwähnte, ihm wäre die Bezeichnung «Musikolepsie» lieber gewesen).
Einige von Critchleys Patienten waren musikalisch, andere nicht. Welche Art Musik ihre Anfälle auslösen konnte, wechselte erheblich von Patient zu Patient. Einer nannte klassische Musik, ein anderer «Oldies» oder «erinnerungsträchtige» Melodien, während eine Dritte feststellte, dass «ein klar akzentuierter Rhythmus für sie das gefährlichste Element in der Musik sei». Einer meiner Korrespondenten hatte nur bei «moderner, dissonanter Musik» Anfälle, nie bei klassischer oder romantischer Musik (unglücklicherweise war ihr Mann ein Anhänger moderner, dissonanter Musik). Ferner wies Critchley darauf hin, dass einige seiner Patienten nur auf bestimmte Instrumente oder Geräusche reagierten. (Einer dieser Patienten sprach nur auf die «tiefen Noten eines Blechblasinstrumentes» an; dieser Mann war Funker auf einem großen Kreuzfahrer, bekam aber von den Tönen der Bordkapelle ständig Krampfanfälle und musste deshalb auf ein kleineres Schiff ohne Kapelle wechseln. Einer meiner eigenen Patienten mit musikogenen Anfällen erzählt, dass bestimmte Töne oder Klänge seine Anfälle auslösen. Wichtig sei deren Höhe. Ein provozierendes Gis in einer Stimmlage sei in einer höheren oder niedrigeren Lage weniger gefährlich. Er reagiert auch auf Klangfarbe sehr empfindlich – eine Gitarrensaite könnte pizzicato eher einen Anfall auslösen als mit den Fingern oder dem Plektrum gespielt.) Einige Patienten reagierten nur auf bestimmte Melodien oder Lieder.
Der spektakulärste Fall war der des bekannten Musikkritikers Nikonow aus dem 19. Jahrhundert, der seinen ersten Anfall bei einer Aufführung von Meyerbeers Oper Der Prophet hatte. Danach reagierte er immer empfindlicher auf Musik, bis er schließlich bei fast jeder Musik, und mochte sie noch so zurückhaltend sein, Anfälle bekam. («Am schlimmsten überhaupt», schrieb Critchley, «war Wagners sogenannter musikalischer Hintergrund, der aus einer ununterbrochenen und unentrinnbaren Tonfolge bestand.»)
Schließlich musste Nikonow, trotz seiner profunden Kenntnisse und seiner leidenschaftlichen Liebe zur Musik, seinen Beruf aufgeben und jegliche Berührung mit Musik vermeiden. Wenn er auf der Straße eine Blaskapelle hörte, musste er sich die Ohren zuhalten und in einen Torweg oder die nächste Seitenstraße laufen. Er bekam eine regelrechte Phobie, einen Horror vor Musik, den er einer kritischen Abhandlung mit dem Titel Furcht vor Musik beschrieb.[*]
Einige Jahre zuvor hatte Critchley auch Aufsätze über epileptische Anfälle veröffentlicht, die durch Geräusche ohne musikalischen Charakter verursacht wurden – gewöhnlich eher monotone Geräusche wie das eines kochenden Wasserkessels, eines Flugzeugs in der Luft oder einer Maschine in der Werkstatt. In einigen Fällen von musikogener Epilepsie sei, so Critchley, die besondere Beschaffenheit des Geräusches von ausschlaggebender Bedeutung (wie bei dem Funker, der keine tiefen Töne von Blechbläsern ertragen konnte); in anderen schienen die emotionale Wirkung der Musik und vielleicht die von ihr ausgelösten Assoziationen wichtiger zu sein.[*]
Auch die durch Musik ausgelösten Arten von Anfällen waren höchst verschieden. Einige Patienten haben große Epilepsieanfälle, fallen bewusstlos zu Boden, beißen sich auf die Zunge, sind inkontinent; andere haben kleine Anfälle, kurze «Absenzen», die ihre Freunde kaum bemerken. Aber auch komplexe Temporallappenanfälle kommen vielfach vor, so bei einem von Critchleys Patienten, der sagte: «Ich habe das Gefühl, das alles schon einmal erlebt zu haben; als ginge ich durch eine Theaterszene. Es ist jedes Mal die gleiche Szene. Menschen sind da und tanzen; ich glaube, ich bin auf einem Schiff. Die Szene besitzt keinen Zusammenhang mit irgendeinem realen Ort oder Ereignis, an das ich mich erinnere.»
Musikogene Epilepsie gilt im Allgemeinen als sehr selten, aber Critchley fragte sich, ob sie nicht doch erheblich häufiger ist als angenommen.[*] Er glaubte, viele Menschen haben zunächst ein seltsames Gefühl – beunruhigend, vielleicht auch erschreckend –, wenn sie eine bestimmte Musik hören, doch dann schotten sie sich sofort gegen sie ab, stellen sie aus oder halten sich die Ohren zu, sodass sie einem richtigen Anfall entgehen. Critchley überlegte sich daher, ob abortive Formen – Formes frustes (atypische Krankheitsbilder) – musikalischer Epilepsie nicht relativ häufig sein könnten. (Das entspricht definitiv meinem eigenen Eindruck, und ich denke, es könnte auch ähnliche Formes frustes photogener Epilepsie geben, wenn blinkende oder fluoreszierende Lichter ein eigenartiges Unbehagen hervorrufen, ohne einen richtigen Anfall auszulösen.)
Bei meiner Arbeit in einer Epilepsie-Ambulanz behandelte ich zahlreiche Patienten mit Anfällen, die durch Musik provoziert worden waren, und andere, die bei Anfällen musikalische Auren hatten – in einigen Fällen trat auch beides gleichzeitig auf.[*] Beide Patiententypen sind anfällig für Temporallappenanfälle, und die meisten haben Anomalien der Temporallappen, die im EEG oder beim Neuroimaging zu erkennen sind.
Zu den Patienten, die ich kürzlich untersucht habe, gehört auch G.G., ein junger Mann, der bis Juni 2005 bei guter Gesundheit war, als er an einer schweren Herpes-Enzephalitis erkrankte, die mit hohem Fieber und generalisierten Anfällen begann; es folgten Koma und schwere Amnesie. Bemerkenswerterweise hatten sich ein Jahr später seine Amnesieprobleme praktisch gelegt, er zeigte aber noch eine relativ hohe Anfallsneigung mit gelegentlichen großen Epilepsieanfällen und, häufiger, komplex-partiellen Anfällen. Anfänglich waren sie alle «spontan», doch innerhalb weniger Wochen begannen sie, fast ausschließlich in Reaktion auf Geräusche – «plötzliche, laute Geräusche wie Sirenen von Krankenwagen» – und vor allem auf Musik aufzutreten. Gleichzeitig entwickelte G.G. eine bemerkenswerte Geräuschempfindlichkeit, sodass er Laute wahrzunehmen vermochte, die zu schwach oder entfernt waren, um von anderen vernommen zu werden. Ihm gefiel das, und er fand, dass seine akustische Welt jetzt «lebendiger und eindringlicher» war, fragte sich aber, ob das nicht auch eine Rolle bei seiner neuen epileptischen Anfälligkeit für Musik und Geräusch spielte.
G.G.s Anfälle können durch ganz verschiedene Musikarten herbeigeführt werden, von Rock bis klassischer Musik (das erste Mal, als ich ihn sah, spielte er eine Verdi-Arie auf seinem Handy, was nach rund einer Minute einen komplex-partiellen Anfall auslöste). Er berichtet, dass die auslösende Wirkung bei «romantischer» Musik am größten sei, besonders Frank Sinatras Songs («Er bringt in mir eine Saite zum Klingen»). Die Musik müsse «voller Emotionen, Assoziationen, Nostalgie» sein. Fast immer handelt es sich um Musik, die er aus der Kindheit oder Jugend kennt. Sie muss nicht laut sein, um einen Anfall auszulösen – leise Musik kann genauso wirksam sein –, doch besonders gefährdet ist er in einer geräuschvollen, von Musik erfüllten Umgebung, daher trägt er meistens Wattepfropfen in den Ohren.
Bevor oder während seine Anfälle beginnen, erlebt er einen besonderen Zustand intensiver, unwillkürlicher Aufmerksamkeit, fast zwanghaften Lauschens. In diesem bereits veränderten Bewusstseinszustand scheint die Musik an Intensität zu gewinnen, anzuschwellen, von ihm Besitz zu ergreifen – und von da an kann er den Vorgang nicht mehr aufhalten, die Musik nicht mehr abstellen oder sich ihr entziehen. Von dem, was jenseits dieses Punktes geschieht, bleibt ihm nichts bewusst oder erinnerlich, obwohl verschiedene epileptische Automatismen wie Keuchen und Schmatzen einsetzen.
G.G. hat den Eindruck, dass Musik nicht nur einen Anfall hervorruft, sondern auch ein wesentlicher Teil des Anfalls ist, der sich – bei generalisierten Anfällen – von der ursprünglichen Region der Wahrnehmung (so scheint es) zu anderen Temporallappensystemen ausbreitet, gelegentlich auch zum motorischen Kortex (Esther) – wenn er generalisierte Anfälle hat. Es ist, als würde dann die auslösende Musik selbst verwandelt, als würde sie zunächst eine überwältigende psychische Erfahrung und dann erst ein Anfall.
Silvia N., eine andere Patientin, kam Ende 2005 zu mir in die Praxis. Frau N. hatte mit Anfang dreißig eine epileptische Störung entwickelt. Teils handelte es sich um große Anfälle mit Krämpfen und vollkommener Bewusstlosigkeit, teils um Anfälle von komplexerem Typ mit einer gewissen Bewusstseinstrübung. Manchmal schienen ihre Anfälle spontan oder eine Reaktion auf Stress zu sein, meistens aber traten sie in Verbindung mit Musik auf. Eines Tages fand man sie nach Krämpfen bewusstlos am Boden liegen. Ihre letzte Erinnerung war, dass sie vor dem Anfall eine CD mit ihren neapolitanischen Lieblingsliedern gehört hatte. Zunächst maß man dem keine Bedeutung bei, doch als sie bald darauf einen ähnlichen Anfall hatte, ebenfalls beim Abspielen neapolitanischer Lieder, begann sie sich zu fragen, ob da nicht ein Zusammenhang bestehen könne. Durch vorsichtiges Erproben stellte sie fest, dass sie, wenn sie solche Lieder entweder live oder als Aufzeichnungen hörte, unweigerlich ein «eigenartiges» Gefühl bekam, auf das dann rasch ein Anfall folgte. Keine andere Musik hatte diese Wirkung.
Sie liebte die neapolitanischen Lieder, weil sie sie an ihre Kindheit erinnerten. («Die alten Lieder», sagte sie, «hörte man ständig in der Familie; immer wurden sie aufgelegt.») Sie fand sie «sehr romantisch, gefühlvoll … sie hatten einen Sinn». Doch jetzt, da sie ihre Anfälle auslösten, begann sie sie zu fürchten. Besondere Angst hatte sie vor Hochzeiten, da diese Lieder – sie kam aus einer großen sizilianischen Familie – bei Festlichkeiten und Familientreffen immer gespielt wurden. «Sobald die Kapelle zu spielen begann», sagte Mrs. N., «lief ich hinaus … Mir blieb höchstens eine halbe Minute, um zu entkommen.»
Zwar hatte Mrs. N. in Reaktion auf die Lieder gelegentlich einen großen Epilepsieanfall, doch meist erlebte sie nur eine merkwürdige Veränderung von Zeit und Bewusstsein, bei der sie ein Gefühl des Erinnerns hatte, speziell das Gefühl, wieder ein Teenager zu sein oder bestimmte Episoden nachzuerleben (einige offenbar Erinnerungen, andere eindeutig Phantasien), in denen sie als Halbwüchsige auftrat. Sie verglich diese Anwandlungen mit Träumen und erklärte, sie würde aus ihnen wie aus einem Traum «aufwachen», aber einem Traum, in dem sie einen Rest von Bewusstsein, wenn auch kaum Kontrolle, bewahre. Beispielsweise konnte sie hören, was die Menschen um sie herum sagten, war aber nicht fähig, darauf zu reagieren – eine Verdoppelung des Bewusstseins, die Hughlings Jackson «mentale Diplopie» nannte. Während die meisten ihrer komplexen Anfälle in die Vergangenheit verwiesen, sagte sie mir einmal: «Ich habe die Zukunft gesehen … ich war dort oben, ging in den Himmel … Meine Großmutter öffnete mir die Himmelstore. ‹Deine Zeit ist noch nicht gekommen›, sagte sie zu mir – und dann kam ich wieder zu mir.»
Obwohl Mrs. N. neapolitanischer Musik meistens aus dem Weg gehen konnte, begann sie, Anfälle auch ohne Musik zu bekommen, und die wurden immer schwerer und schwerer, bis sie schließlich refraktär waren. Medikamente waren nutzlos, und manchmal hatte sie viele Anfälle an einem Tag, sodass ein alltägliches Leben praktisch unmöglich wurde. Kernspintomogramme hatten sowohl anatomische wie elektrische Anomalien in ihrem linken Schläfenlappen nachgewiesen (wahrscheinlich infolge einer Kopfverletzung, die sie als Jugendliche erlitten hatte) und damit einhergehend eine praktisch ununterbrochene Aktivität in einem Anfallsherd entdeckt, daher unterzog sich die Patientin 2003 einer Gehirnoperation, einer partiellen Temporallobektomie.
Der Eingriff beseitigte nicht nur die Mehrzahl ihrer spontanen Anfälle, sondern auch ihre spezielle Anfälligkeit für neapolitanische Lieder, wie sie fast zufällig entdeckte. «Nach der Operation hatte ich noch immer Angst, solche Lieder zu hören, bei denen ich Anfälle hatte», sagte sie, «aber eines Tages war ich auf einer Party, und sie begannen die Lieder zu spielen. Ich lief in ein anderes Zimmer und schloss die Tür. Dann öffnete jemand die Tür … ich hörte sie wie von weitem. Es störte mich nicht sonderlich, daher versuchte ich, sie mir anzuhören.» Mrs. N. fragte sich, ob sie endlich von ihrer Anfälligkeit für Musik geheilt sei, ging nach Hause («man fühlt sich dort sicherer als in Gegenwart von fünfhundert Menschen») und legte einige neapolitanische Lieder auf. «Ich drehte die Stereoanlage nach und nach auf, bis es richtig laut war, und es machte mir nichts aus.»
So hat Mrs. N. jetzt ihre Furcht vor Musik verloren und kann ihre neapolitanischen Lieblingslieder ohne Probleme abspielen. Auch ihre seltsamen komplexen, erinnerungsträchtigen Anfälle haben aufgehört; offenbar hat der chirurgische Eingriff beide Anfallsarten beendet – wie Macdonald Critchley es vielleicht vorhergesagt hätte. Mrs. N. ist über ihre Heilung natürlich begeistert. Doch gelegentlich trauert sie noch einigen ihrer epileptischen Erlebnissen nach – etwa den «Himmelstoren», die sie an einen nie zuvor gesehenen Ort geführt zu haben scheinen.
Kapitel 4Musik im Kopf: Vorstellung und Vorstellungsvermögen
Gehört sind Melodien süß,
doch ungehört noch süßer.
John Keats, «Ode an eine griechische Urne»
Musik ist für die meisten von uns ein wichtiger und meist angenehmer Teil des Lebens – und zwar nicht nur die äußerliche Musik, die Musik, die wir mit den Ohren hören, sondern auch die innerliche Musik, die Musik, die in unserem Kopf erklingt. Als Galton in den 1880er Jahren über «Vorstellungsbilder» schrieb, beschäftigte er sich nur mit visuellen Vorstellungen und nicht mit musikalischen. Doch man braucht nur den eigenen Freundeskreis zu befragen, um festzustellen, dass die Spannweite des musikalischen Vorstellungsvermögens nicht geringer ist als die des visuellen Vorstellungsvermögens. Es gibt Menschen, die kaum eine Melodie behalten können, und andere, die ganze Symphonien in ihrem Kopf hören, und zwar fast so detailliert und lebendig, als wohnten sie einer tatsächlichen Aufführung bei.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: