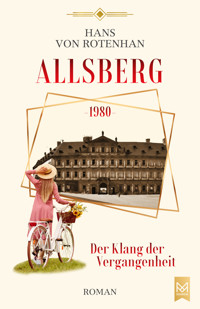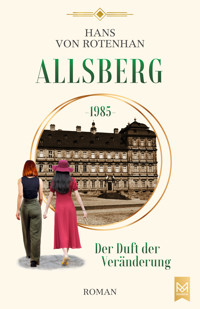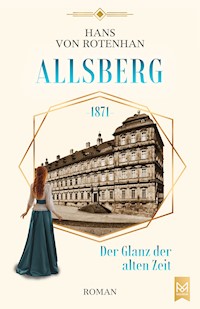
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Maximum Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Schloss Allberg-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Wir haben alle unsere Wurzeln "Mir ist das Hier und Jetzt wichtig. Ich habe in meinem Leben lernen müssen, dass man die Liebe nicht ewig festhalten kann. Aber man kann sie in dem Moment, in dem sie stark ist, genießen." 1871: Schloss Allsberg, das ehemals glanzvolle Anwesen der Familie Tröger in Unterfranken, ist in die Jahre gekommen und die Schönheit früherer Tage kaum mehr zu erkennen. Thea, die 26-jährige Tochter von Baron Tröger, erhält den Auftrag, auf einen Schlag alles Vieh zu verkaufen, um künftig Pferde für das Militär zu züchten und den Trögers damit wieder zu Wohlstand zu verhelfen. Als Baron Tröger bei einem Reitunfall stirbt, erfüllt Thea den letzten Wunsch ihres Vaters. Um die Nachkommenschaft der Trögers zu sichern, sucht sie ihren eigenwilligen Bruder Cord und bringt ihn dazu, ihre Freundin Vicky zu heiraten. Doch die Ehe scheitert und Thea kümmert sich zusammen mit Vicky um die zwei aus der Verbindung stammenden Söhne. Trotz etlicher Widerstände gelingt es Thea, sich mit dem Gestüt durchzusetzen und auch die anderen Geschäfte des Familiensitzes Schloss Allsberg erfolgreich zu führen. Und in dem Förster Hubert findet sie sogar ihre große Liebe, die sie jedoch geheim halten muss, um der gesellschaftlichen Ächtung zu entgehen, während Vicky sich in die Tochter des Dorfpfarrers verliebt ... Zwei starke Frauen, der Kampf um das Vermächtnis für die nachfolgenden Generationen und um das, was Schloss Allsberg über die Zeit hinaus bedeutet. Ein bewegender Roman über die Kraft der Liebe und die immer neue Hoffnung auf ein erfülltes Leben in Glück und Frieden. "Starke Frauen, die ihren eigenen Weg gehen. Ein wunderbar geschriebener historischer Roman und toller Auftakt, der Lust auf mehr macht!" Ellin Carsta
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 457
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Hans von Rotenhan
Allsberg 1871
Roman
Über das Buch
Wir haben alle unsere Wurzeln
„Mir ist das Hier und Jetzt wichtig. Ich habe in meinem Leben lernen müssen, dass man die Liebe nicht ewig festhalten kann. Aber man kann sie in dem Moment, in dem sie stark ist, genießen.“
1871: Schloss Allsberg, das ehemals glanzvolle Anwesen der Familie Tröger in Unterfranken, ist in die Jahre gekommen und die Schönheit früherer Tage kaum mehr zu erkennen. Thea, die 26-jährige Tochter von Baron Tröger, erhält den Auftrag, auf einen Schlag alles Vieh zu verkaufen, um künftig Pferde für das Militär zu züchten und den Trögers damit wieder zu Wohlstand zu verhelfen.
Als Baron Tröger bei einem Reitunfall stirbt, erfüllt Thea den letzten Wunsch ihres Vaters. Um die Nachkommenschaft der Trögers zu sichern, sucht sie ihren eigenwilligen Bruder Cord und bringt ihn dazu, ihre Freundin Vicky zu heiraten. Doch die Ehe scheitert und Thea kümmert sich zusammen mit Vicky um die zwei aus der Verbindung stammenden Söhne.
Trotz etlicher Widerstände gelingt es Thea, sich mit dem Gestüt durchzusetzen und auch die anderen Geschäfte des Familiensitzes Schloss Allsberg erfolgreich zu führen.
Und in dem Förster Hubert findet sie sogar ihre große Liebe, die sie jedoch geheim halten muss, um der gesellschaftlichen Ächtung zu entgehen, während Vicky sich in die Tochter des Dorfpfarrers verliebt …
Zwei starke Frauen, der Kampf um das Vermächtnis für die nachfolgenden Generationen und um das, was Schloss Allsberg über die Zeit hinaus bedeutet. Ein bewegender Roman über die Kraft der Liebe und die immer neue Hoffnung auf ein erfülltes Leben in Glück und Frieden.
Impressum
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der mechanischen, elektronischen oder fotografischen Vervielfältigung, der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, des Nachdrucks in Zeitschriften oder Zeitungen, des öffentlichen Vortrags, der Verfilmung oder Dramatisierung, der Übertragung durch Rundfunk, Fernsehen oder Video, auch einzelner Text- oder Bildteile.
Alle Akteure des Romans sind fiktiv, Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen wären rein zufällig und sind vom Autor nicht beabsichtigt.
Außer den Menschen, die wir aus dem Geschichtsunterricht kennen, habe ich alle handelnden Personen erfunden. Ähnlichkeiten sind natürlich nicht auszuschließen, aber unbeabsichtigt.
Auch Ort und Schloss Allsberg sind Fiktion.
Allein Epaminondas gab es, so hieß der Zuchthengst meines Urgroßvaters.
Copyright © 2023 by Maximum Verlags GmbH
Hauptstraße 33
27299 Langwedel
www.maximum-verlag.de
1. Auflage 2023
Lektorat: Silvia Kuttny-Walser
Korrektorat: Angelika Wiedmaier
Satz/Layout: Alin Mattfeldt
Umschlaggestaltung: Alin Mattfeldt
Umschlagmotiv: © Ironika / Shutterstock, Khirman Vladimir / Shutterstock, kamellys / Shutterstock
E-Book: Mirjam Hecht
Druck: Booksfactory
Made in Germany
ISBN: 978-3-98679-000-4
Widmung
Für Brigitte, meine Frau, die ich liebe.
Inhalt
Über das Buch
Impressum
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
Danksagung
Der Autor Hans von Rotenhan
ALLSBERG: Und so geht es weiter
ALLSBERG: Der dritte Teil
1. Kapitel
Wien, 1863
Die Reise nach Österreich war endlos lang. Sie genoss alles, die vorbeiziehenden Landschaften, die Bahnhöfe mit den umhereilenden Gepäckträgern und den schreienden Würstlverkäufern. Unter dem Schutz ihres Bruders in Leutnantsuniform schien ihr diese Reise wie ihr Eintritt in die große weite Welt. Im Speisewagen sahen sie Damen und Herren aus aller Herren Länder. Ein italienischer Maler stellte die ihn begleitende Dame, als seine Mätresse vor. Thea war schockiert und war es noch mehr als ihr Bruder bemerkte:
„Denkst du denn, dass all die anderen Paare verheiratet sind?“
„Meinst du wirklich …?“
„Thea, die Welt ist nicht Allsberg. In der Welt geht es noch viel aufregender zu als in all den Romanen, die du andauernd liest. Weißt du was? In Wien nehme ich dich mit auf einen Ball. Tante Fee wird schon was wissen.“
Thea schaute ihren Bruder dankbar an.
„Ach, es ist schön, erwachsen zu werden.“
„Und woran merkst du das, liebe Thea?“
„Daran, dass mich mein großer Bruder mitspielen lässt. Früher bist du immer allein auf die Bäume im Park geklettert, weil Buben mit Mädchen nichts zu schaffen haben wollen.“
„Oh, hab ich das gesagt? Da hab ich meine Meinung aber gründlich geändert.“
Es war nicht einfach gewesen, ihren Vater dazu zu bringen, Theas Plan zuzustimmen.
Sie langweilte sich auf Schloss Allsberg. Ihr ältester Bruder Karl Werner diente in einem Ulanen-Regiment in Magdeburg und der andere, Cord, war vor einigen Monaten zu einer Weltreise aufgebrochen.
„Was hat der Cord für noble Passionen?“ Der Vater schimpfte entrüstet, die Zeit der Kavaliersreisen sei vorbei.
„Mach dir keine Sorgen, ich verdiene mein Reisegeld schon selbst.“
Und tatsächlich, während Karl Werner immer wieder Geld brauchte, schickte Cord ab und zu eine Postkarte und teilte mit, dass es ihm gut gehe. Die letzte war aus Boston gekommen.
Wenn es wieder einmal darum ging, Geld nach Magdeburg zu schicken, brummte der alte Baron:
„Was nützt mir Preußens Gloria, wenn der Bub mit seinem Sold nicht auskommt? Der Cord ist zwar nie da, aber dafür liegt er mir nicht auf der Tasche.“
Theas ganzes Leben hatte sich bisher auf Schloss Allsberg abgespielt. Nicht einmal zur Schule durfte sie ins Dorf hinunter gehen. Ihr Vater hatte eine Erzieherin für die drei Kinder eingestellt, später kam ein Hauslehrer hinzu. Theas Mutter war nach ihrer Geburt am Kindbettfieber gestorben. Niemals wurde darüber gesprochen, und dennoch war es Thea, als verfolge sie ein stiller Vorwurf. War sie schuld am Tod ihrer Mutter?
Aber es war nicht nur das. Thea graute es bei der Vorstellung, in diesem riesigen Schloss darauf zu warten, bis irgendein junger fränkischer Baron, von der Jagd nach Hause kommend, sich daran erinnerte, dass er zu seinem Glück auch noch eine Frau brauchte. Vom Leben erwartete sie sich mehr als das.
Es war Zufall, dass Karl Werner an ihrem achtzehnten Geburtstag zu Hause war. Beim Mittagessen nahm sie ihren ganzen Mut zusammen. Mit Karl Werners Unterstützung hatte sie gar nicht gerechnet, nur darauf spekuliert, dass Vater ihr an ihrem Geburtstag keinen Wunsch würde abschlagen können.
„Ich will malen lernen in Wien. Dort wohnt Tante Fee, Mutters Schwester. Sie wird schon auf mich aufpassen. Vielleicht erzählt sie mir sogar etwas von meiner Mutter.“
Es war Karl Werner, der, ohne es beabsichtigt zu haben, bewirkte, dass der Vater einwilligte:
„Da hat Thea schon recht. Von unserer Mutter haben wir die roten Haare, aber mehr wissen wir von ihr nicht. Schämst du dich ihrer etwa, oder weshalb sprichst du nie von ihr?“
„Sie war mein Ein und Alles. Ich spreche nicht über sie, weil ich sonst in tiefer Trauer versinke. Ja, es ist etwas dran, ich kann meiner Tochter nicht wirklich etwas bieten hier in diesem Riesenkasten oberhalb des Mains. Womöglich ist es das Beste, wenn sie einmal ihre Tante Friederike besucht.“
„Was? Tante Fee heißt Friederike?“
Karl Werner lachte:
„Da kannst du noch froh sein, dass nur Fee daraus geworden ist. Meistens heißen österreichische Gräfinnen Bubsi, Mumsi oder Lalli, und wenn sich irgendwo eine ungarische Großmutter finden lässt, dann werden sie Erzsi genannt, auch wenn sie Agnes getauft wurden.“
„Aber allein reist mir die Thea nicht nach Wien. Du kannst von dort aus zurück zu deinen Ulanen nach Magdeburg fahren.“
„O Gott, wenn ich nur an Magdeburg denke. Die langweiligste Stadt unter dem Zepter des preußischen Königs.“
„Mag sein, mein Sohn, aber ein Tröger dient nicht unter der Fahne des bayerischen Usurpators.“
In Wien brachte sie der Fiaker zum Palais der Grafen Engl von Wagrain. Thea hatte noch nie eine so große Stadt gesehen. Fußgänger, Pferdekutschen und stolze Reiter in Uniform verwandelten in Theas Augen das ihr bisher bekannte Leben in ein verwirrendes und dabei beglückendes Chaos.
Unvermittelt hielt der Fiaker auf einem kleinen Platz hinter dem Stephansdom und bedeutete ihnen, das Haus mit vier Obergeschossen, vor dem er gehalten hatte, sei das Palais Engl von Wagrain. Während Karl Werner und der Fiaker das Gepäck abluden, betrachtete Thea die Fassade. Das Haus war nicht sehr breit, nur fünf langgestreckte Fenster. Im Erdgeschoss beherrschte die breite, aber nicht sehr hohe Einfahrt das Bild. Darüber eine ebenso breite schmiedeeiserne Balustrade, die wohl nur dekorativen Zwecken diente. Immerhin, man konnte hinaustreten, die Tür krönte ein kleiner Tympanon, unter dem Thea das Wappen der Grafen Engl von Wagrain erkannte. Ihr klangen die Worte des Vaters im Ohr:
„Ein unmögliches Wappen, da tänzelt ein Hund auf einem Hügel, und ein Gaul bäumt sich auf. Was soll der Unfug?“
Thea fand, dass ein lächerliches Wappen an einem schönen Palais mitten in Wien durchaus seine Berechtigung hatte. Die barocken Fassungen der hohen Fenster der Beletage machten neugierig auf die Salons und womöglich Säle dahinter.
Tante Fee und ihre Schwester Maria Theresia, Theas Mutter, waren Erbinnen des Vermögens ihres Onkels Alexander Engl von Wagrain. Er war Bischof von Leoben gewesen. Thea wusste, dass ihr Vater immer betont hatte, es sei das Geld seiner Frau gewesen, das die Familie Tröger durch die schwierigen Jahre gebracht habe, die die Angliederung an Bayern mit sich geführt hatten.
Thea war gespannt auf die Pracht des Hauses der Familie ihrer Mutter. Sie wurde bitter enttäuscht. Kein livrierter Diener erwartete sie, nur ein mürrischer Hauswart.
„Würden Sie uns bitte zur Gräfin bringen?“
Statt einer Antwort deutete der Mann nur nach oben und sagte:
„Dritter Stock rechts.“
Im Treppenhaus sollten eigentlich Jagdszenen an den Wänden die Blicke der Besucher fesseln. Die Geschwister achteten nicht darauf, Thea mühte sich mit ihrer Reisetasche ab, und Karl Werner schimpfte auf den faulen Bediensteten, der es ihm nicht einmal abgenommen hatte, Theas schweren Koffer zu schleppen. Vorbei an hohen zweiflügeligen Türen, hinter denen sich Thea wundervolle Suiten, einen Spiegelsaal und den Blick in französische Gärten vorstellte, quälten sie sich ins Obergeschoss. Sie klopften an die erste Tür rechts. Sie war erheblich niedriger und schmuckloser als das, was sie unten gesehen hatten.
Thea kam nicht dazu, noch weiter nachzudenken, denn eine alte Dame öffnete ihnen und nahm beide nacheinander in die Arme.
„Wie schön, euch endlich wieder zu sehen! Jetzt merk ich’s: Ich hab euch vernachlässigt nach dem Tod von der Marie Theres. Aber ihr seid’s ja auch ohne mich groß geworden. Jetzt kommt’s erst einmal herein und erzählt.“
Dazu kamen sie jedoch nicht, denn es war Tante Fee, die erzählte. Thea beobachtete sie dabei und versuchte sich vorzustellen, wie ihre Mutter wohl jetzt aussehen würde. Hätte sie auch graue Strähnen in der roten Haarpracht? Würde sie wie Tante Fee eine geschnürte Taille über einem ausladenden Rock tragen? Waren diese blitzenden, lebenslustigen Augen auch wie die ihrer Mutter gewesen?
„Thea, was starrst du mich so an?“
„Verzeih, Tante Fee, ich habe mir nur gerade überlegt, ob meine Mutter ebenso ausgesehen hat wie du.“
„Nein, man sagte ihr nach, ihr Charakter sei wie ihr wildes Haar. Keiner hat sich zugetraut, es mit ihr aufzunehmen. Ich glaub, sie war ganz froh, dass sie niemand hat heiraten woll’n.
„Tante Fee, ich hoffe, du erzählst mir viel von meiner Mutter. Vater sagt ja nie was.“
„Naja, losgangen ist es mit den zweien in der Oper. Euer Vater war auf Grand Tour, so hat man damals noch g’sagt. In Wien ist er in die Oper ’gangen, und in der Pause ist er der armen Marie Theres auf den Fuß g’stiegen. Ich glaub, bei ihm war’s Liebe auf den ersten Blick. Bei der Marie Theres hat’s noch ein bisserl gedauert. Sie war zwei Jahre älter als euer Vater und blitzgescheit. Aber mit über dreißig war der gute Gotthilf auch nicht mehr der Jüngste. Ich muss sagen, es wurde eine sehr glückliche Ehe, zumindest hat sie mir das in ihren Briefen immer versichert. Als Schlagobers gab’s dann noch das Geld vom Bischof-Onkel. Wenn das hier in Wien bekannt gewesen wär, hätt sie schon früher einen Verehrer g’funden.
Das Glück war nur kurz. Das Kindbettfieber ist ein grausames Damoklesschwert, das über uns Frauen hängt. Ich hab darum nie heiraten wollen. Gelebt hab ich, fröhlich sogar, und jetzt ist halt seit ein paar Jahren das Geld vom Bischof-Onkel verbraucht.“
„Mich hat der Vater einmal gewarnt. Ich soll keine heiraten wie die Tante Fee.“
„Ach ja, euer Vater hat mich für vergnügungssüchtig gehalten. Es stimmt aber auch in gewisser Hinsicht. Auf dem Wiener Kongress hab ich mit dem Zar und dem König von Preußen getanzt. Den Metternich hab ich mir vom Leib gehalten, der hat immer gedacht, dass ein Tanz ihm einen Freibrief geben würde. Ich hab mich mit eurem Vater nie gut verstanden. Er ist mir zu ernst. Drum bin ich nach dem Tod von der Marie Theres nur noch selten nach Allsberg gekommen. Am End macht er mir noch Avancen, hab ich gedacht.“
Etwas später zeigte sie Thea ihr Zimmer.
„Schau nicht so kritisch. Das hier ist nicht Allsberg. Hier musst du mit einem Bett, einer Waschmuschel und einem Stuhl auskommen. Bei mir im Salon, da hab ich alle Möbel reingestopft, die mir keiner hat abkaufen wollen, als ich von der Beletage nach oben ziehen musste. Da sieht es noch heute herrschaftlich aus. Aber denk nicht, dass mein Schlafzimmer viel üppiger ist als das, was ich dir hier anbieten kann. Ich hab aufs Bischofs-Geld nie so richtig achtgegeben. Als es weg war, musste ich das Palais in Wohnungen aufteilen, und nun lebe ich von der Miete.“
Karl Werner nahm am nächsten Morgen den Zug nach Berlin. Die Nacht auf Tante Fees Sofa musste schrecklich ungemütlich gewesen sein. Nachdem sie seiner Droschke nachgewinkt hatten, nahm die alte Dame Theas Hand und sagte:
„Es wird Zeit, dass wir uns ums Vergnügen kümmern. Ein so hübsches Madl muss sofort in die Gesellschaft eingeführt werden.“
Tante Fee hatte in Wien genügend Beziehungen, um Karten für den nächsten Ball, den des k.k. Thierarznei Instituts, zu bekommen. Zuvor aber ging sie mit Thea zu ihrer Modistin und gab ein Ballkleid aus smaragdgrüner Seide mit weißen Rüschen in Auftrag.
„Darin wirst du mit deinen roten Haaren wie eine Königin ausschauen. Ah, eh ich’s vergess: Dein Vater hat dir, so hoff ich, ein Geld mitgegeben?“
„Ja, mach dir keine Sorgen. Er hat mir sogar gesagt, ich soll dir was für Kost und Logis zahlen.“
„Ah, geh! Des agassiert mich jetzt aber! Was denkt der alte Gotthilf von mir? Ich bin doch kein Hungerleider!“
„Tante Fee, was ist agassieren?“
„Wenn ihr euch ärgert’s, dann agassieren wir uns hier in Wien.“
So schlimm war es mit dem Ärger dann doch nicht, denn sie einigten sich sehr schnell auf einen Obolus, den Thea allmonatlich diskret auf den Schreibtisch ihrer Tante legte.
Am Tag des Ballvergnügens erklärte Tante Fee ihrer Nichte, dass sie am Eingang des Saals eine Tanzkarte bekommen würde.
„Da schreibst alle die Namen von denen rein, die dich um einen Tanz bitten. Die kommen dann der Reihe nach dran. Wenn einer zudringlich wird, kommst du zu mir. Ich werde im Salon sitzen und Karten spielen. Hab keine Angst, allzu streng werde ich nicht über dich wachen.“
Sie hielt sich nicht an die Regeln mit der Tanzkarte, sondern tanzte den ganzen Abend nur mit dem Offizier, der sie als Erster aufgefordert hatte. Anselm hieß er.
Er sah blendend aus in seiner Uniform. Bald lernte sie, dass man das in Wien „fesch“ nannte.
„Ich verstehe nichts von Sternen, Litzen und Farben, aber diese Uniform steht ihm wirklich gut“, sagte sie nach einem der vielen Walzer.
„Wir duzen uns hier in Wien alle. Wir sind ja eh irgendwie verwandt. Du wirst dich fragen, was ich auf dem Veterinärball mache? Nicht, dass du meinst, ich bin ein Viechdoktor. Ich bin Oberleutnant bei den Dragonern. Man hat mich hierher abkommandiert, weil man in der Armee auch ein paar Offiziere braucht, die wissen, was man macht, wenn ein Pferd einen Schnupfen hat.“
„Und was ist er, ich meine, was bist du sonst noch?“
„Ich glaub, ich bin in dich verliebt!“
„So schnell geht das nicht, so was kommt nur im Roman vor.“
„Aber es kommt vor, ich will es dir zeigen. Lass uns auf die Terrasse gehen.“
Während drinnen eine Polka gespielt wurde, die zu tanzen sie einem Offizier mit ungarischem Namen versprochen hatte, nahm Anselm sie am Arm und führte sie auf die Terrasse hinaus. Dort nahm er ihr Gesicht in beide Hände und musterte es einen langen Moment. Sein Kuss erschreckte Thea.
Thea erinnerte sich an diesen Kuss, den sie sicherlich ersehnt, aber nicht so rasch erwartet hatte. Aus ihren Büchern wusste sie, dass es den zarten Kuss auf die Lippen gab. Das hier war etwas anderes. Zunächst dachte sie, es müsse sie ekeln. Dann aber, erst zögerlich, dann immer enthusiastischer, erwiderte sie den Tanz, den Anselms Zunge vollführte.
„Das ist es also, wovon ich so viel gelesen habe“, schoss es ihr durch den Kopf, und sie fühlte, dass dies ein weiterer Schritt hin zum Erwachsenwerden sein musste.
Anselm ließ es sich nicht nehmen, die beiden Damen, wie er sich ausdrückte, nach Hause zu bringen. Am nächsten Morgen übergab ein Dienstmann einen Veilchenstrauß mit einer Karte. Auf der stand:
„Wann darf ich dich wiedersehen?“
„Wer ist denn dein Galan? Als er sich mir gestern vorgestellt hat, hab ich seinen Namen nicht verstanden.“
Tante Fee war neugierig, und sie freute sich, dass ihre Nichte gleich beim ersten Ball solchen Erfolg gehabt hatte.
„Er ist Oberleutnant und heißt Anselm.“
Tante Fee lachte. Dann nahm sie Theas Hand und setzte sich mit ihr auf ein Sofa.
„Schatzerl, das hätt ich auch so gesagt in deinem Alter. Aber weißt, uns alte Menschen, uns interessieren Nachnamen.“
„Grosser, Anselm Graf von Grosser heißt er.“
Tante Fee sog scharf die Luft ein.
„Na servus, hoffentlich ist er der Gute von den beiden.“
„Er ist bei den Dragonern und zurzeit ans k.k. Thierarznei Institut abkommandiert.“
„Na, da hast aber Glück ghabt! Der jüngere Bruder sagt von sich, er ist a Dichter. Was er dichtet, weiß keiner, nur dass er überall Schulden hat, das weiß ein jeder.“
Bei den ersten Spaziergängen begleitete die Tante das Paar, das wurde ihr aber bald zu langweilig.
Die Kurse in der privaten Malschule Hladik gefielen Thea sehr. Sie machte gute Fortschritte, die sie selbst erstaunten. Ursprünglich war das mit dem Wunsch, malen zu wollen, nur eine Ausrede gewesen, um von Allsberg wegzukommen. Dort hatte sie nur ihren Vater, den Frieder, die Stubenmädchen und die Babett, die Schlossköchin. Tante Fee hatte schon recht: Nicht nur ihre Haarpracht war rebellisch. Sie spürte immer mehr, wie sie in Wien das Neue aufsog und daraus eigenständige Gedanken entwickelte. Das war es wahrscheinlich, was die Alten rebellisch nannten.
Herr Hladik, ihr Lehrer, kleidete sich wie ein exzentrischer Maler, er legte sogar Wert darauf, dass kleine Farbflecken seinen Anzug schmückten.
„Der arme Papa! Er wäre so gern ein berühmter Maler geworden. Aber dann hat er sich in unsere Mutter verliebt. Bald waren wir vier Kinder, da musste er nach einem geregelten Einkommen suchen.“ Renate Hladik, die Tochter des Meisters, war bald zu Theas Vertrauter und Freundin geworden. Die übrigen Schüler kamen aus allen Ländern der Donaumonarchie. Ungarisch, Kroatisch, Rumänisch, Ruthenisch – bald konnte sie die Sprachen voneinander unterscheiden, verstehen aber nicht. Einige waren durchs Aufnahmeexamen der Kunstakademie gefallen und hofften nun, beim Meister Hladik den letzten noch notwendigen Schliff zu bekommen. Man erkannte diese Schüler an ihrem Eifer. Andere, meist weibliche Teilnehmerinnen, sahen den Malkurs als Teil ihrer Erziehung zur künftigen perfekten Ehefrau an. Konnte Thea die einen nicht verstehen, so wollte sie die anderen gar nicht verstehen. Ihr war es wichtig, etwas zu lernen – wenn sie auch nicht wirklich wusste, was sie später damit anfangen sollte. Meister Hladik nannte sie „mein eifriges Baronesschen“.
„Papa hat dich in sein Herz geschlossen. Er lebt zwar vom Geld, das die Väter der höheren Töchter zahlen, aber er verabscheut sie, weil sie von Kunst nichts wissen wollen. Du gibst dir Mühe. Beim Abendessen hat er neulich gesagt, dass ihn diese deutsche Thea überrascht hat. Merkst du, wie er dich den anderen vorzieht?“
Renates Worte bewirkten, dass Thea sich eingestand, zum ersten Mal in ihrem Leben stolz auf sich zu sein.
Mit Anselm traf sie sich meistens in Kaffeehäusern. Er musste jetzt viel lernen und saß über seinen Büchern. Sie schaute ihm dabei über die Schulter, und manchmal hielt sie seine Hand. Wenn er sie dann abends nach Hause brachte, zog es sie immer wieder in dunkle Ecken, wo sie sich leidenschaftlich küssten. Dabei bemerkte Thea, dass es da wohl noch etwas anderes gab. In ihren Büchern würde es „Wonne“ heißen, was sie spürte, wenn er sich an sie presste.
Nachdem die Ballsaison vorüber war, lud Tante Fee Anselm zum Tee. Es war ein Sonntag im März, Fastenzeit. Davon war aber bei Tante Fee nichts erkennbar, es gab Tee mit Kandiszucker und feinstes Hefegebäck.
Tante Fee, die Anselms Familie offenbar sehr gut kannte, fragte ihn nach Eltern, Tanten und der Cousinage aus. Rudolf, den Bruder, erwähnte sie nur insoweit, als sie in einem Nebensatz fallen ließ, ganz Wien freue sich schon auf sein erstes Theaterstück.
Beim Abschied fragte Anselm, ob er Thea am kommenden Wochenende entführen dürfe, er wolle sie in Budapest seiner Tante Erzsi vorstellen.
Als Thea lachte, schauten Tante Fee und Anselm sie verständnislos an.
„Es ist nur so, dass Karl Werner behauptet hat, jeder Österreicher habe eine Tante Erzsi, auch wenn diese gar nicht Elisabeth heißt.“
„Meine heißt Erzsébet und ist eine Gräfin Székely.“
Tante Fee stieß einen leisen Pfiff aus.
Thea war erstaunt, dass ihre Tante diesen Ausflug sofort erlaubte. Nachdem Anselm gegangen war, erzählte sie Thea, dass Tante Erzsi die Schwester von Anselms Mutter sei. Durch die Ehe mit ihrem leider verstorbenen Ehemann, einem Grafen Székely, war sie zu einer der reichsten Frauen Europas geworden. „Nur der Herzog von Westminster soll noch reicher sein.“
Der Besuch wurde zu einem Fiasko. Thea und Anselm wurden am Bahnhof von einem Vierspänner abgeholt, der nach einer längeren Fahrt durch die prachtvollen Straßen der ungarischen Hauptstadt vorbei am Nationalmuseum in den Hof eines riesigen Palastes einbog. Dort wartete ein livrierter Diener, öffnete den Schlag und half den beiden aus der Kutsche. Durch ein prächtiges Treppenhaus ging es nach oben. Leise klirrten die Sporen an Anselms Stiefeln. Er war in seiner Dragoner-Uniform erschienen. Ein weiterer livrierter Diener öffnete vor ihnen beide Flügel einer hohen Tür. Als sie den saalartigen Salon betraten, erhob sich eine alte Dame, auf einen Gehstock gestützt, und reichte Anselm die Hand zum Kuss. Thea begrüßte sie mit einem Kopfnicken. Als sie saßen und der Tee serviert war, kam Tante Erzsi gleich zur Sache:
„Anselm, ich nehme an, dass du mir diese junge Dame vorstellst, weil du dich mit ihr verloben willst.“
Thea lief rot an, denn davon hatte sie mit Anselm noch kein Sterbenswörtchen gesprochen. Der aber antwortete ganz unbefangen:
„Ja, liebe Tante Erzsi, ich möchte dir die Baroness Dorothee von Tröger vorstellen. Sie hat mein Herz erobert.“
Ohne darauf einzugehen, griff die Tante zu einem silbernen Glöckchen. Sofort erschien ein weiterer livrierter Diener. Sie sagte zu ihm etwas auf Ungarisch. Der Diener verbeugte sich, sagte „igen hölgyem“ und kam wenig später mit einer Ausgabe des Gotha zurück.
„Dann wollen wir doch einmal sehen, was das für eine Familie ist“, sagte Tante Erzsi und blätterte im Adelsregister. „Da haben wir’s ja schon“, murmelte sie nach einigem Blättern. Sie las laut vor:
„Die Freiherren von Tröger sind ein fränkisches uradeliges Geschlecht, das seit dem Jahre 1220 nachweisbar ist. Die Besitzungen befinden sich hauptsächlich auf dem Gebiet des ehemaligen Ritterkantons Rhön-Werra. Bis zur Mediatisierung 1806 war die Familie reichsunmittelbar. Im Zuge der Reformation traten die Trögers und mit ihnen die von ihnen regierten Gemeinden dem lutherischen Glauben bei.“
Tante Erzsi klappte das Buch zu und schaute Thea schweigend an. Nach einer endlos wirkenden Minute wandte sie sich Anselm zu, ohne Thea eines weiteren Blickes zu würdigen.
„Wie du weißt, habe ich dich als Erben meines gesamten Besitzes vorgesehen. Damit würdest du zu einem der reichsten Männer unserer Monarchie. Mit mir wird die Familie der Grafen von Székely aussterben, aber der Geist dieser Familie wird in dir und deinen Nachkommen weiterleben. Das Festhalten an unserem Glauben, der Gehorsam Rom gegenüber und die unabdingbare Treue zum Träger der Stephanskrone sind die drei Säulen, die über Jahrhunderte das Glück und den Wohlstand unserer Familie garantiert haben.“
Sie machte eine Pause, um dann mit lauter Stimme fortzufahren: „Ich habe nichts gegen diese junge Dame, aber du kannst nicht eine lutherische Frau heiraten, und erst recht nicht kannst du dich an eine Baroness – wie sagt man in Deutschland? Ja, das ist das Wort: Du darfst dich nicht an eine Baroness verplempern. Wenn du es dennoch tust, werde ich dich enterben. Mehr habe ich nicht zu sagen. Adieu!“
Thea musste sich auf Anselms Arm stützen. Ihre Knie zitterten, und in ihrem Kopf drehte sich alles, als habe man mit einem großen Hammer dagegen geschlagen.
Unten wartete der Vierspänner noch immer.
„Die Kutsche wird die Herrschaften wieder zum Bahnhof bringen“, sagte der livrierte Diener und drückte Anselm einen Umschlag in die Hand. Dann weinte Thea.
Irgendwann hörte sie, wie Anselm den Kutscher bat, anzuhalten und ihr Gepäck abzuladen.
Vor dem Hotel half ihr Anselm, die Tränen abzuwischen. Dann fanden sie sich in einer riesigen Hotelhalle wieder. An der Rezeption fragte Anselm, ob er zwei Zimmer haben könne, und bat, die Koffer schon einmal hochzubringen.
„Glaube ja nicht, dass ich mir normalerweise so ein Hotel leisten kann. Im Umschlag, den mir der Diener gab, ist das drin, was Tante Erzsi ein Douceur nennt, eine Süßigkeit in Geldform. So was bekomme ich immer, wenn ich sie besuche, meist ist es mehr als mein Jahressold. Du weißt ja, unser Kaiser zahlt schlecht. Wir gehen jetzt erst mal in die Konditorei. Eine Esterházy-Schnitte hat bis jetzt noch jeden Kummer erstickt.“
Dass Anselm zwei Zimmer reserviert hatte, war normal. Man musste den Portier eines Hotels schon kennen, um zu wissen, ob man dort als unverheiratetes Paar ein gemeinsames Zimmer bekommen würde – nach einem üppigen Trinkgeld natürlich. Zu ihrer Verblüffung hatten sie später festgestellt, dass sie ganz ohne Trinkgeld zwei Zimmer bekommen hatten, die durch eine Tapetentür verbunden waren. Sicherlich war vergessen worden, die Riegel vorzuschieben. Thea war dies noch vor Anselm aufgefallen, und als sie sein Zimmer betrat, überraschte sie ihn dabei, wie er sich gerade seiner prächtigen Uniform entledigte. In Unterwäsche sah er weniger fesch aus, aber ungewöhnlich anziehend. Es schien ihm auch nichts auszumachen, in dieser Aufmachung gesehen zu werden. Er nahm Thea in die Arme und küsste sie zunächst zärtlich auf die Lippen. Dabei begann er, die Knöpfe ihres Kleides an ihrem Rücken zu öffnen. Sie ließ es geschehen und bemerkte, dass sie es war, deren Küsse leidenschaftlicher wurden, und wie ein unbekannter Schauer ihren Körper freudig erregte. Als Thea nackt war, zog auch Anselm sich aus. Es war das erste Mal, dass sie einen Mann so sah, wie Gott ihn geschaffen hatte. Sie war verblüfft, denn sie hatte keine Ahnung gehabt, wie das bei einem Mann unter der Kleidung aussieht. Es machte ihr Angst. Anselm schob es zwischen ihre Beine und das fühlte sich gut an, warm und pulsierend. Dann küsste er ihre Brüste und legte sie behutsam auf das Bett. Der kurze Schmerz war bald überwunden, und Thea stellte fest, dass sich ihr Körper ohne ihr Zutun bewegte. Ihr Unterleib wölbte sich ihrem Liebhaber entgegen, als wolle er keinen Millimeter von dem draußen lassen, was sie immer wieder in ekstatisches Zittern, Stöhnen und Lust versetzte. Sie krallte sich in Anselms Rücken fest und beantwortete jede seiner Bewegungen. Bald schien es, als geriete er außer Rand und Band. Als er aufschrie, kam auch aus ihrer Kehle ein Schrei. Die Welt schien zu versinken. Thea dachte an nichts mehr, sie fühlte nur noch. Als Anselm schwer atmend auf ihr liegen blieb, musste sie lachen.
„Was ist daran so komisch, meine Allerliebste?“
„Ach, ich habe nur gerade gedacht, wie froh ich doch bin, dass ich nicht den Verstand verloren habe. Ich habe nicht gewusst, dass es so etwas Herrliches auf dieser Erde gibt. Kann man das wiederholen?“
„Ja, aber ein bisschen Zeit brauch’ ich dazu schon. Lass uns die Zeit vertreiben, indem wir uns gegenseitig anschauen. Dein Nabel ist süß, und deine beiden Brüste sind das Schönste und Aufregendste, was ich je gesehen habe.“
Thea fand, dass es auch bei Anselm einiges zu entdecken gab …
Als sie am Morgen in seinen Armen erwachte, fragte sie:
„Sind wir jetzt verlobt?“
„Ja, mein Herz, wir werden heiraten.“
2. Kapitel
Allsberg, 19. Januar 1871
Es war bitterkalt. Am Abend zuvor hatte der Baron ausrichten lassen, er werde am Morgen nicht selbst nach Seligenstadt reiten, um am Bahnhof die Zeitung abzuholen.
Seine Finger waren trotz der Fäustlinge starr vor Kälte, als der Erlers Friedrich, für alle „der Frieder“, die Franken-Post vom Bahnwärter ausgehändigt bekam. Der Frieder war Kutscher, Pferdeknecht, Bote und auch ein wenig Beichtvater von Gotthilf Freiherr von Tröger, dem Herrn auf Schloss Allsberg.
Eigentlich waren dem Frieder die Zeitläufte egal, aber jetzt befand man sich wieder einmal im Krieg. Wer sollte sich da noch auskennen? Erst vor sechs Jahren war Bayern, wenn auch zögerlich, gegen die Preußen in den Krieg gezogen, und jetzt ging es gemeinsam mit den Preußen gegen Frankreich. So ein Hin und Her konnte nicht gutgehen. Da war er sich mit dem Baron einig, zumal dessen ältester Sohn bei Mars-la-Tour vor einem knappen halben Jahr gefallen war.
Frieders Gewohnheit war es, in diesen bewegten Zeiten zumindest die Schlagzeile der Franken-Post zu lesen. Was heute dort stand, alarmierte ihn, es ließ nichts Gutes vermuten.
„Wilhelm der I. Deutscher Kaiser! Proklamation im Spiegelsaal von Versailles.“
Er gab dem Pferd die Sporen und sah zu, dass er so schnell wie möglich wieder hinauf nach Allsberg kam. Er beschloss, die Zeitung nicht in der Schlossküche abzugeben, auch wenn er damit auf den wärmenden Malzkaffee verzichtete.
Ohne anzuklopfen, stürmte er ins Esszimmer, wo er den Baron und dessen Tochter Thea beim Frühstück antraf. Wortlos legte er das Blatt auf den Tisch und wartete.
Dann hörte er das ihm wohlbekannte Grunzen. Es war immer das erste Anzeichen dafür, dass dem Baron etwas missfiel.
Thea zog die Zeitung zu sich herüber und schaute dann ihr Gegenüber fragend an.
„Hast du denn etwas anderes erwartet, Vater?“
Der starrte nur ins Leere, und dann brach es aus ihm heraus:
„Das verzeihen uns die Franzosen nie! Wie kann man nur so instinktlos sein? Diese Preußen! Frieder, was würdest du denn sagen, wenn dieser andere Napoleon, der mit seinem albernen Zwirbelbart, sein Kaiserreich in der Würzburger Residenz ausgerufen hätte?“
„Am Arsch hätt er mich könn geleck!“
Thea grinste.
„Ja, lach nur! Der Frieder hat sich vielleicht etwas drastisch ausgedrückt, aber genau das ist es, was die Franzosen jetzt von uns denken. Das ist kein gedeihlicher Nährboden.“
„Vater, ich bitt dich, seit ich denken kann, hast du uns immer wieder gesagt, dass die Trögers eher nach Berlin fahren als nach München.“
In gespielter Verzweiflung wandte sich der Baron Tröger an seinen Kutscher:
„Frieder, wir sind beide vor einundsechzig Jahren auf diese Welt gekommen. Wie war das damals?“
„Erinnern du ich mich ned, aber der Herr Baron hats mer oft und oft verzähld: Reichsunmiddlbar war mer do. Über uns bloß der Kaiser in Wien und nuch a wenig höcher unner Herrgodd.“
„Genauso war’s! Und dann kamen wir zu Bayern, und wir schauten nach Berlin, weil wir dachten, die helfen uns, wenn die katholischen Wittelsbacher übermütig werden. Aber Thea, eine Sache ist es, als Lutheraner bayerischer Untertan sein zu müssen! Etwas ganz anderes aber kommt auf uns zu, wenn wir mit so vielen anderen unter Führung dieser preußischen Kommissköpfe in einen Topf geworfen werden. Ich befürchte, dass bald ganz Deutschland im Gleichschritt marschiert.“
Abrupt stand der Baron auf.
„Komm, Frieder, wir gehen in den Pferdestall.“
Thea blieb allein zurück. Sie war das jüngste von drei Kindern. Karl Werner war mit siebenundzwanzig Jahren gefallen, und Cord, der zweite Sohn, war schon seit Jahren auf Reisen und verdiente sein Geld damit, dass er Berichte aus unbekannten Welten an große europäische Zeitungen verkaufte. Er war darin sehr erfolgreich. Jedenfalls verfasste er die kurzen Briefe nach Hause stets auf dem Papier weltberühmter, teurer Hotels.
Thea, eigentlich hieß sie Dorothee, führte ihrem Vater den Haushalt. Wenn sie es sich recht überlegte, war sie hier im Schloss mit ihren bald sechsundzwanzig Jahren fehl am Platz. Ach, wie sehr hatte sie die Jahre in Wien genossen!
3. Kapitel
Allsberg, 24. Januar 1871
Der Baron Tröger war einsilbig gewesen in den vergangenen Tagen. Zunächst schien er über die politische Entwicklung verärgert, dann gingen ihm die andauernden Dankgottesdienste auf die Nerven, an denen er als Kirchenpatron selbstverständlich teilnehmen musste. Thea beobachtete ihn, wenn er im Baronsstall saß, der Tröger-Empore in der Kirche. Er verzog keine Miene, aber seine Fäuste ballten sich vor Unmut, wenn der Pfarrer wieder einmal zum Kruzifix emporschaute und betete:
„Wir danken dir Herr, dass wir diese wunderbar erhebenden Jahre 1870 und 1871 erleben durften, als die Fahnen immer wieder gehisst wurden und wir uns immer wieder unvorbereitet in dieser Kirche mit der ganzen Gemeinde versammeln durften, um dich, Gott, zu loben für all die Siege, die du dem deutschen Heere geschenkt hast. Unsere Glocken waren es, die der Gemeinde die großen Ereignisse kundtaten und die in jedem Herzen widerklangen als Lob- und Danklied.“
Thea kannte die Gedanken ihres Vaters. Dieser Krieg hatte seinen ältesten Sohn das Leben gekostet, und der Politik, die nun in Berlin gemacht werden würde, misstraute er zutiefst. Wie und wofür sollte er da danken?
Der Baron Tröger war so erzogen worden, dass ihm gar nicht in den Sinn kommen konnte, an der Wahrheit und der Notwendigkeit dessen zu zweifeln, was in der Bibel stand, und was die Kirche verkündete. Er musste sich deshalb nie fragen, ob er fromm sei. Er war es, zumal er Kirchenpatron war. Er war als solcher Vorbild. Es wäre für ihn schlicht ungehörig gewesen, nicht jeden Sonntag in die Kirche zu gehen. Dies gehörte zu seinem Leben ebenso wie es dazu gehörte, dass er im Schloss wohnte, im Herbst zur Hirschbrunft in die Rhön fuhr und in den Wintermonaten bei sich und seinen adeligen Freunden und Verwandten zur Jagd ging.
Thea schien es, als hadere ihr Vater mit den Zeitläuften, als kapsle er sich ein wie eine Larve in ihren Kokon. Entweder lag es daran, dass ihn wieder einmal eine Depression gepackt hatte, die ihn zu nichts anderem befähigte, als um seine verstorbene Frau zu trauern, oder aber er brütete eine neue Idee aus. Letzteres traf gerade zu.
Vor einigen Monaten war in der Zeitung gestanden, dass der Bau der Eisenbahnlinie nach Bagdad dazu geführt hatte, dass Rumänien, der traditionelle Lieferant von Eisenbahnbohlen, nun in die Türkei liefere. Nun suchten die Eisenbahngesellschaften händeringend nach Ersatz. Tagelang sah Thea daraufhin ihren Vater fast nicht mehr. Er hatte sich in sein Arbeitszimmer vergraben, um ein Sägewerk zu planen, mit dem er in der Rhön sein Buchen- und Eichenholz zu Bohlen machen könnte. Thea war froh, als ihr Vater wieder in den normalen Lebensrhythmus zurückkehrte. Das war das untrügliche Zeichen, dass er den Plan aufgegeben hatte. Thea war erleichtert, denn sie wusste, dass ihr Vater kein kaufmännisches Gespür besaß. Er war noch so erzogen worden, als würde er weiter als Feudalherr über die Trögerschen Ländereien herrschen.
Jetzt schien es wieder so, als brüte er eine neue Idee aus. Vater ritt umher, schaute sich die Stallungen und den Gutshof unten im Dorf genauer an und manchmal lächelte er stillvergnügt vor sich hin.
Wenige Tage vor Theas Geburtstag, als Vater und Tochter nach dem Mittagessen beim Mokka in der kleinen, der unteren Bibliothek saßen, fragte er Thea:
„Verstehst du etwas von Pferden?“
„Ich habe Einiges mitbekommen. Du weißt ja, Anselm, mein Verlobter, hat am k.k. Thierarznei Institut studiert. Ich habe ihn oft abgefragt und mit ihm zusammen gelernt. Dabei ist einiges hängen geblieben.“
„Das ist gut so, meine Thea. Wenn ich dieses neue deutsche Kaiserreich schon nicht mag, so soll es mich dennoch nicht daran hindern, damit Geld zu verdienen. Wir werden in die Rüstung gehen.“
„In die Rüstung? Das ist doch wieder eine von deinen Schnapsideen! Siehst du hier Erzvorkommen, Eisengießereien, Arbeitermassen? Oder willst du Kanonenrohre aus Eichenholz herstellen?“
„Mach dich bloß nicht lustig über deinen alten Vater! Du wirst nicht abstreiten können, dass die eisernen Kanonen auf ihren Lafetten gezogen werden müssen. Preußen denkt und handelt ausschließlich nach militärischen Gesichtspunkten. Wenn man es genau betrachtet, haben die damit in Berlin sogar recht. Kein Land hat so viele Nachbarn wie dieses neue deutsche Kaiserreich. Sie alle, und nimm noch Großbritannien hinzu, sie fühlen sich alle von diesem Koloss, der mitten in Europa entstanden ist, bedroht. Die werden rüsten und so wird auch Berlin rüsten.“
Der Baron machte eine Pause und nippte an seiner Mokkatasse.
„Hast du schon einmal von Remonten gehört?“
„Ja, schon, aber so ganz genau weiß ich nicht, um was es sich dabei handelt.“
„Das Wort kommt aus dem Französischen. Eine Remonte ist ein Ersatzpferd. Im deutschsprachigen Raum bezeichnet man damit die Zucht von Pferden für das Militär. Das geht vom edlen Rappen für die Offiziere bis zum klobigen Pferd, das Kanonen durch den Schlamm ziehen muss. Ich habe mir die Ländereien hier rund um Allsberg genauer angeschaut. Es sind leichte Böden mit Muschelkalk. Das wäre ideal für den Anbau von Hafer, hätten wir etwas mehr Regen. Aber es wird schon gehen. Wiesen haben wir nicht, aber ich denke, Heu wird man zukaufen können. Wir haben den riesigen Gutshof mit seinen Scheunen und Stallungen. Wo jetzt Kühe und Schweine untergebracht sind, werden wir Pferdeboxen hinstellen. Das Einzige, was wirklich fehlt, ist eine Reithalle.“
„Wann soll es denn losgehen? Du krempelst den ganzen Betrieb um, ist dir das klar? Du wirst dich darum bemühen müssen, die Pferde zu verkaufen. Ich seh dich schon, wie du stöhnst, du kämst dir vor wie ein Pfeffersack. Wie willst du denn das alles anfangen?“
„Ich fange nicht an. Wir fangen an! Allein schaffe ich das tatsächlich nicht mehr. Schau, ich habe mir das so gedacht: Ich fahre mit der Bahn nach Trakehnen und sehe mir an, was die dort machen. Ostpreußen ist weltweit der wichtigste Ort der Pferdezucht. Dort kaufe ich zunächst einen Hengst und einige Mutterstuten. Wenn ich denke, dass alles klappen wird, schicke ich ein kurzes Telegramm. Es wird drinstehen Los geht’s! Das ist für dich das Zeichen, alle Kühe und Schweine zu verkaufen, und wenn im Märzen der Bauer die Rösslein einspannt, dann säst du Hafer, nur Hafer. Die Ställe musst du natürlich umbauen. Ach ja, noch etwas: Such dir einen Zimmermann, der uns eine leichte Reithalle hinstellt.“
„Aber Vater, wie soll ich das machen? Wer wird mir die Tiere abkaufen?“
„Das habe ich schon geklärt. Heute Morgen habe ich den Aaron Seligmann getroffen. Er hat jetzt das Geschäft von seinem Vater, dem alten Herschel Seligmann, übernommen. Der schuldet mir noch einen Gefallen, und sein Sohn weiß das. Er wird dir einen guten Preis zahlen. Ich habe alles heute Morgen mit ihm besprochen.“
„Vater, wie kommt es, dass der Viehjude aus Kitzingen dir einen Gefallen schuldet?“
„Das ist eine lange Geschichte, die schon viele Jahre zurückliegt.“
„Ich glaube, ich sollte diese Geschichte kennen, bitte erzähl sie mir.“
„Nun gut, sie beginnt mit Napoleon, dem anderen, dem ohne Zwirbelbart. Der hat uns Reichsritter in die Wirklichkeit gestoßen, indem er diese winzigen Herrschaftsgebiete größeren Staaten zugewiesen hat. Damit hat er uns aber auch unserer wirtschaftlichen Grundlage beraubt. Die Einnahmen, die wir als Feudalherren genießen konnten, blieben weg und wir mussten selbst zusehen, wie wir überleben. Das war neu und darauf war keiner von uns vorbereitet, geschweige denn ausgebildet. Die ehemals reichen Herren auf ihren Schlössern kamen plötzlich in Not. Viele verkauften an reiche Bankiers aus Frankfurt. Uns hat das Geld deiner Mutter gerettet. Viele aber mussten Kredite aufnehmen, die ihnen nur wenige Banken geben wollten. Nur die Juden haben damals Geld verliehen. Der alte Herschel Seligmann hatte mit seinem Viehhandel gut verdient, und es sprach sich herum, dass er Kredite vergab. Niemand hat damals herumposaunt, Geld vom Viehjuden bekommen zu haben. Es war kurz vor deiner Geburt, als ich per Zufall Zeuge eines Streites wurde. Auf dem Würzburger Viehmarkt beschimpfte unser entfernt verwandter Vetter Friedrich Hüben den Herschel Seligmann. Als der Graf von Hüben wutschnaubend davongeeilt war, kam der Seligmann zu mir und fragte, ob ich ihm helfen könne. Es stellte sich heraus, dass zwanzig Jahre zuvor unser Vetter beim Viehjuden von Kitzingen einen Kredit von fünfzigtausend Gulden aufgenommen hatte, verzinst mit fünf Prozent. Der Graf von Hüben habe immer zum Jahresende pünktlich den Zins bezahlt, zweitausendfünfhundert Gulden. Nun lief der Kredit aus und Hüben behauptete, er hätte ihn bereits zurückgezahlt, denn zwanzig mal zweitausendfünfhundert ergibt nach Adam Riese fünfzigtausend. Du weißt, der Friedrich ist unterdessen ein wichtiger Mann geworden. Er saß lange Jahre in München im Landtag, er war es, der die Zuckerproduktion in Franken begründete. Er war damals in den 1840er Jahren schon so etwas wie der ungekrönte König von Mainfranken. Er dachte wohl, ein Jude werde es nicht wagen, gegen ihn vor Gericht zu ziehen. Ich fand das unerhört und bin hinüber in den Ochsenfurter Gau geritten, wo die Hübens seit Generationen sitzen. Ich versuchte dem Friedrich klarzumachen, dass es egal sei, von wem er einen Kredit bekommen habe, auf jeden Fall müsse das geliehene Geld samt Zinsen zurückgezahlt werden. Der Friedrich begann dann auf den Seligmann zu schimpfen, der sei eben auch nichts anderes als ein raffgieriger Jude, wie alle anderen auch. Ich fand das widerlich, denn der Raffke war ja der zahlungsunwillige Herr Graf. Ich habe ihm gesagt, dass er zahlen müsse, sonst würde ich von Schloss zu Schloss in den ehemaligen Fürstbistümern Würzburg und Bamberg reiten und dort erzählen, dass das Vermögen des Grafen von Hüben, des ungekrönten Königs von Mainfranken, darauf beruhe, dass er einem Viehjuden sein Geld nicht zurückgezahlt hat. Dem guten Friedrich war klar, dass er das weder wirtschaftlich noch politisch und erst recht nicht gesellschaftlich überleben würde. Er hat bezahlt, aber seither ist er mir spinnefeind, und der alte Seligmann ist mein Freund. Hüte dich vor dem lieben Vetter Friedrich!“
„Woher kommt das eigentlich, dass man die Juden nicht mag? Wenn ich man sage, dann meine ich uns, die Aristokraten. An Jesus kann es ja wohl nicht mehr liegen.“
„Es sind nicht nur wir, es sind wohl alle Deutschen, die die Juden nicht mögen. Ich glaube, man hat sich einfach daran gewöhnt, die Juden zu meiden. Sie werden nicht als gleichwertig angesehen, es sei denn, man braucht sie für das Geschäft. Manchmal denke ich, dass man die Juden verabscheut, damit der Rest besser zusammenhält. Ein Bach kann nur fließen, wenn er Gefälle hat, und ein Volk kann nur zusammenhalten, wenn es weiß, gegen wen.“
„Komisch, ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht, habe es einfach für normal gehalten, wenn man Juden ausgrenzt und blöde Witze über sie macht. Mal sehen, ob es mir gelingen wird, umzudenken.“
Sie wechselten das Thema und berieten bis in den Abend hinein über die baulichen Maßnahmen und über die Umstellung auf die Monokultur Hafer.
Später an diesem Abend saß Thea an ihrem Schreibtisch im Schloss Allsberg und dachte an die wunderbare Zeit mit Anselm zurück. War es die glücklichste Episode ihres Lebens gewesen? Wie dem auch sei, dachte sie, jedenfalls hat es nicht lange gewährt. Sieben Jahre waren seither vergangen.
Beim Frühstück am nächsten Morgen überraschte sie ihr Vater damit, dass er ankündigte, er werde sich schon am darauffolgenden Morgen auf die Reise nach Trakehnen machen.
„Ich gebe nun für die kommenden Wochen den Besitz der Familie in deine Hände. Ich bin sicher, dass er dort gut aufgehoben ist. Schade, dass aus dir kein Bub geworden ist.“
„Was soll das denn jetzt heißen? Hättest du einem Sohn mehr zugetraut?“
„Nein, das sicher nicht, aber er hätte mir einen Stammhalter schenken können. Die Familie Tröger darf nicht aussterben. Ich werde in Berlin einige Tage Station machen. Ich will versuchen, bei der Vossischen Zeitung herauszufinden, wo sich mein Sohn Cord gerade herumtreibt. Außerdem kann man in der Hauptstadt des neuen Kaiserreiches mal etwas Kultur tanken. Mit dem Dirigenten Hans von Bülow sind wir irgendwie verwandt, das muss man doch ausnutzen.“
Thea lächelte in sich hinein. Sie kannte ihren Vater nicht als Musikliebhaber, wusste aber, dass er anderweitige Vergnügungen durchaus zu schätzen wusste. Sie gönnte ihm das von Herzen.
4. Kapitel
Allsberg, am 25. Januar 1871
Es war Theas sechsundzwanzigster Geburtstag. Wie gewöhnlich würde ihr Vater dies vergessen haben. Umso mehr wunderte sie sich, als sie ihren Vater, bereits in Reisekleidung, im Esszimmer auf sie wartend vorfand. Er schloss sie in die Arme, gratulierte und sagte:
„Mein Geschenk ist durchaus zweischneidig. Die Verwaltung unseres Besitzes ist manchmal eine schwere Last und immer eine hohe Verantwortung. Du wirst daran wachsen, davon bin ich überzeugt.“
Dann kutschierte ihn der Frieder nach Seligenstadt an die Bahn.
Es begann nun eine fast tägliche Welle von langen Briefen, in denen der Vater zunächst aus Berlin berichtete, er habe den Aufenthaltsort seines Sohnes leider nicht herausfinden können. Die darauffolgenden Briefe waren eigentlich Tagebucheintragungen, in denen Theas Vater all das Erlebte aufschrieb, aber auch all das, was er sich daraus für die Umsetzung seiner Pläne überlegt hatte. Das war für Thea sehr wertvoll, denn die Briefe enthielten nicht nur die genauen Maße für die Erstellung der Pferdeboxen für Hengst, Mutterstuten, tragende Stuten, Stuten mit Fohlen, sie waren auch voller Beschreibungen der verschiedenen Gestüte, die er besuchte. Bald schon warf ihr Vater mit Fachausdrücken um sich, deren Bedeutung sich erst langsam aus dem Zusammenhang ergab. Was zum Teufel waren Paddocks? Pferde liefen darauf im Freien. Wenn es regnete, verwandelten sich diese Paddocks gern in Matsch, wenn sie nicht richtig aufgebaut waren. Kurz gesagt: unten grob, oben fein, damit das Wasser durch die Drainage schnell wegsickern konnte. Wieder hatte sie etwas gelernt.
Eines Tages traf das angekündigte Telegramm ein:
„Los geht’s!“
Thea ließ sich vom Frieder nach Kitzingen kutschieren und fragte sich dort nach dem Viehhandel der Familie Seligmann durch. Sie fand unter dem Firmenschild einen alten bärtigen Mann auf einem Schemel sitzend. Auf dem Kopf trug er einen breitkrempigen schwarzen Hut. Die Hände hatte er auf einen Stock gestützt.
„Guten Tag. Sind Sie Herschel Seligmann?“
Der alte Mann nickte nur müde, und Thea hörte ein leises „Nu!“.
„Ich bin die Tochter vom Baron Tröger aus Allsberg“, stellte sich Thea vor.
Ein Lächeln ging über das Gesicht des alten Mannes. Mühsam erhob er sich mit Hilfe seines Gehstocks.
„Der Herr Baron ist ein Freund dieses Hauses, so ist auch seine Tochter willkommen. Unser Prophet Micha warnt davor, einem Freund zu vertrauen. Verzeih, Gott du Gerechter, da hat dein Prophet Seichel erzählt, weil dem Allsberger, dem kann man vertrauen.“
Er lächelte Thea verschmitzt an:
„Nu, mer sagt, er is allwissend, aber alles kann er einfach nicht wissen.“
Thea lächelte ebenfalls und bat dann, dem Sohn Aaron ausrichten zu wollen, er möge am kommenden Morgen in den Gutshof von Allsberg kommen. Es sei jetzt so weit, er wisse schon, um was es gehe.
Tatsächlich erschien am nächsten Tag Aaron Seligmann mit zehn Männern und einigen von Pferden gezogenen Kastenwägen. Er hatte eine neue Ausgabe der Franken-Post dabei und zeigte Thea die erst kürzlich auf dem Würzburger Viehmarkt erzielten Preise. Dann zahlte er, ohne ein weiteres Wort zu verlieren, eben diese Preise aus. Er wies seine Leute an, die Schweine in die Kastenwägen zu verladen, und die Kühe nach Würzburg zu treiben. Den beträchtlichen Geldbetrag verschloss Thea im Tresor des Arbeitszimmers ihres Vaters. Er würde eine große Hilfe beim Umbau sein.
Einen der später eintreffenden Briefe des Vaters las sie der Babett in der Küche vor:
„Heute habe ich ein kleineres Gestüt bei Gumbinnen besucht und hörte im Stall ein Gespräch mit, das mich nicht nur amüsiert hat, sondern auch zum Handeln ermunterte. Ein Stallbursche redete mit einem Pferdeknecht darüber, dass es am Samstag ein Karnevals-Tanzvergnügen im Dorfkrug geben sollte. Der Junge fragte den Älteren, als was er sich denn verkleiden solle, worauf dieser antwortete:
„Wasch dir eenmal und dir erkennt keener!“ Ich habe später erfahren, dass dieser Junge ein Waisenkind ist und auf dem Gestüt einfach so mitläuft. Im Sommer schläft er im Heuboden und jetzt im Winter in der Haferkiste. Deren Deckel schützt gegen die Kälte. Er ist für sein Alter groß gewachsen, aber dürr wie eine Bohnenstange. Ich habe ihn beobachtet, er geht sehr geschickt mit Pferden um. Der Besitzer des Gestüts hält nicht viel von ihm, er sei ein Schmarotzer, sagte er zu mir. Ich habe Martin, so heißt der junge Mann, gefragt, ob er mit mir nach Franken kommen wolle. „Wo is’n det?“, fragte er. Auch Bayern sagte ihm nichts. Ich bot ihm eine Anstellung an und kam mir dabei vor wie der Esel aus den Bremer Stadtmusikanten, der seinen Kumpanen zuruft:
„Ei was, zieh mit uns, etwas Besseres als den Tod findst du überall.“ Er will also mit mir ziehen. Ich habe ihm ein Zimmer über den Stallungen mit Bett, Schrank und Waschtisch versprochen. (Thea, denke bitte daran beim Umbau.) Und ich habe ihm gesagt, die Babett werde ihn aufpäppeln. Er glaubt, er sei sechzehn Jahre alt, und heißt Martin Dietrichkeit.“
Es blieb nicht bei der Einrichtung des Zimmers für den Stallburschen. Es stellte sich heraus, dass die Decke des bisherigen Schweinestalls zu niedrig hing. Der Maurermeister schaute Thea besorgt an, kratzte sich am Kopf und entschied dann:
„Noch denn, was der Herr Baron da an Maßn gschickd hat, wird aus den Säustall fei ka Gäulsstall ned.“
„Und wenn wir die Decke einfach anheben?“
„Baness, ich bin a Mäurer, vo Sdadig versteh ich nix. Aber mei Auchnmaß, des sechd mer, äss die Wänd waggln, wemmer da einfach an halbn Meder Backstaa draufschwarddn.“
„Also weg mit dem Schweinestall.“
„Fei langsam, Baness. Ich reiß des Ding ei und Sie gehn nunder ins Dorf und freechn die Weiber, wo edserd ka Ärbed ned ham, ob sa die Backstaa abglopfn wölln. So du mer an Haufn Geld spar!“
Wenige Tage später erreichte Thea der letzte Brief ihres Vaters. Er habe einen Beschäler gekauft, der auf den schönen Namen Epaminondas höre.
„Wie du weißt, war das ein Feldherr aus dem griechischen Theben, der die schiefe Schlachtordnung erfunden hat.“
Thea hatte weder von diesem Herrn noch von seiner Erfindung gehört, fragte sich aber, was ein Beschäler sei. Sie wusste, dass in der alten Bibliothek, meist unbenutzt, Meyers Konversationslexikon stand. Dort erfuhr sie, dass es sogar einen Hauptbeschäler gibt, gemeint ist damit ein Deckhengst. Thea fand das etwas albern. Wozu brauchen Jäger, Pferdezüchter, Pfarrer und Rechtsverdreher je eine gesonderte Sprache? Beschäler? Nach ihrer Erinnerung hatte das mit dem Schälen eines Apfels herzlich wenig zu tun. Ihr Amüsement hielt nicht lange an, denn sie musste ehrlicherweise zugeben, dass ihr bei der Hirschbrunft in der Rhön das Jägerlatein flüssig von den Lippen ging.
„Nur wer ohne Spezialsprache ist, werfe den ersten Stein“, murmelte sie und stellte den Band 1 von Meyers Konversationslexikon wieder ins Regal.
5. Kapitel
Juli 1871
Als im Sommer die letzten Soldaten aus dem Frankreichfeldzug nach Hause kamen, wurde das Ausmaß der Kriegsfolgen erst richtig deutlich. Es waren nicht nur neunundzwanzig junge Männer aus dem Dorf gefallen, auf dem Feld der Ehre geblieben, für das Vaterland gestorben, oder wie auch immer man es nannte. Es kamen auch viele Kriegsversehrte zurück, und denen sah man an, dass nichts Heldenhaftes hinter ihnen lag, dass das Feld der Ehre meistens ein Drecksloch war. Darin zu sitzen und zu hoffen, dass die Schrapnelle anderswo einschlugen, war wirklich kein Vergnügen gewesen. Thea besuchte die Heimkehrer. Zum Teil waren sie mit ihr zusammen konfirmiert worden. Einige waren selbstständige Bauern, aber andere, die meisten, waren darauf angewiesen, auf dem Gutshof Arbeit zu finden. Sie erzählte ihnen, dass nun beim Tröger Pferde gezüchtet würden, man brauche Stall- und Fuhrknechte, es würden auch Zureiter und Pferdeausbilder gebraucht. Die Männer und ihre Familien schöpften etwas Hoffnung, aber bisher waren das lediglich Versprechungen. Die Bauarbeiten auf dem Gutshof waren noch nicht abgeschlossen, und Epaminondas hatte auch noch nicht wirklich viel zu tun.
In all dieser Zeit der Vorbereitungen war der Baron Tröger unermüdlich aktiv, er überwachte das Aufstellen der Pferdeboxen, kümmerte sich um erkrankte Mutterstuten, kaufte bei den Wiesenbauern Heu und ließ es auf den Dachböden über den Stallungen einlagern. Er erfand Heurutschen, damit das Futter schneller und mit wenig Arbeitsaufwand an die Futterraufen gebracht werden konnte. Begleitet wurde er stets von Martin Dietrichkeit, der den Baron dadurch verblüffte, wie viele praktische Vorschläge er beisteuerte. Von ihm stammte die Idee einer Krachmaschine, mit der die Pferde an Gefechtslärm und Ähnliches gewöhnt werden sollten. Er und der Hufschmied, der Grieders Adolf, bauten ein Monstrum zusammen. Der Baron lachte, als er bemerkte, dass es nicht technische Probleme waren, die das Vorhaben erschwerten, sondern die Tatsache, dass die beiden sich einander einfach nicht verständlich machen konnten. Am Ende klappte es aber dennoch. Das Ergebnis war ein in die Horizontale verlegtes Wagenrad, an dessen Rand in unregelmäßigen Abständen Pflugschare hingen. Über eine Kurbel und ein einfaches Winkelgetriebe konnte das Rad in Drehung versetzt werden und dann schlugen die Pflugschare gegen einen Vorschlaghammer, ein dickes Rohr, einen Eichenklotz oder eine Glocke. Der Krach erfüllte die beiden Erfinder mit großer Befriedigung und führte tatsächlich dazu, dass die Einjährigen in Panik davonstoben. Mit viel Geduld mussten sie an den Lärm gewöhnt werden.
Unterdessen war der Martin unter der strengen Aufsicht der Babett, die ihn täglich in der Schlossküche verköstigte, zu einem stattlichen jungen Mann herangewachsen, der im Sattel eine hervorragende Figur abgab.
Abends saßen Thea und ihr Vater unter den Blutbuchen im Park oder bei schlechtem Wetter in der unteren Bibliothek zusammen. Gesprächsstoff war zunächst immer das Tagewerk. Zunehmend aber trieb den Baron die Sorge um, dass sein Haus aussterben werde, wenn sein jüngerer Sohn Cord nicht bald heiraten würde. Die Zukunft war überhaupt äußerst unklar. Man wusste nur, dass sich alles ändern würde, nicht aber wie und wann.
„Heute las ich in der Zeitung, dass man in Berlin an einem Gesetz arbeitet, wonach es im Kaiserreich bald eine einheitliche Währung geben soll, die Mark. Dass damit der Münzverwirrung im Reich ein Ende gesetzt wird, ist ja gut und schön, aber wie kommen die auf die Bezeichnung Mark? Und, Thea, du wirst sehen, dabei bleibt es nicht, Landmaße und Hohlmaße, an die sich die Bauern seit Jahrhunderten gewöhnt haben, werden bald alle über einen metrischen Kamm geschert werden. Statt zur Vereinheitlichung wird es zur Verwirrung kommen. Man wird immer Papier und Bleistift bei sich tragen müssen, um das Gewohnte in das neue Maß umzurechnen. Was mir aber wirklich Sorgen macht, ist das Recht. Schau, zumindest in Bayern ist es uns großen Familien gelungen, unser eigenes Recht zu setzen. Unsere Familienstatute sind anerkannt und regeln bisher klaglos die Rechtsnachfolge auf unseren Besitzungen.“
„Klaglos würde ich da nicht gerade sagen, denn unser Familienstatut legt fest, dass nur volljährige, männliche Namensträger Teilhaber am Gesamtvermögen, dem Fideikommiss, werden können. Nur wenn ich als letzte Tröger übrigbleibe, weil Cord kinderlos verstirbt, werde ich Erbin. Ich halte das für eine schreiende Ungerechtigkeit.“