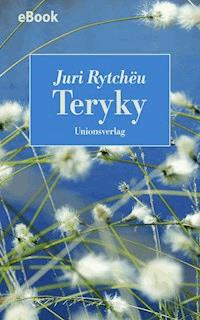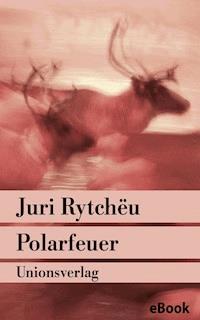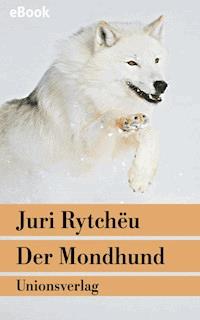12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Geboren in einer traditionellen Fellhütte am Polarkreis, geht er seinen Weg und bewahrt sich immer den wachen, heiteren, ironischen Blick auf die seltsamen Gebräuche der »zivilisierten« Welt. Noch nie hat Juri Rytchëu so persönlich, verschmitzt und anrührend von dem erzählt, was ihm, dem Tschuktschen aus dem äußersten Winkel Asiens, auf seiner Lebensreise widerfuhr. Hunderttausende von Leserinnen und Lesern kennen die Romane von Juri Rytchëu und haben den Autor auf seinen zahlreichen Lesungen erlebt. Kurz vor seinem Tod im Jahr 2008 hat er diesen Rückblick auf sein Leben abgeschlossen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 516
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
Geboren in einer Fellhütte am Polarkreis, geht er seinen Weg und bewahrt sich immer den wachen, heiteren, ironischen Blick auf die seltsamen Gebräuche der »zivilisierten« Welt. Noch nie hat Juri Rytchëu so persönlich, verschmitzt und anrührend von dem erzählt, was ihm, dem Tschuktschen aus dem äußersten Winkel Asiens, auf seiner Lebensreise widerfuhr.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Juri Rytchëu (1930–2008) wuchs als Sohn eines Jägers in der Siedlung Uëlen auf der Tschuktschenhalbinsel im Nordosten Sibiriens auf und war der erste Schriftsteller dieses nur zwölftausend Menschen zählenden Volkes. Mit seinen Romanen und Erzählungen wurde er zum Zeugen einer bedrohten Kultur.
Zur Webseite von Juri Rytchëu.
Antje Leetz (*1947) war Lektorin für neue russische Literatur im Verlag Volk und Welt Berlin und Redakteurin in einem Verlag in Moskau. Sie als Herausgeberin, Übersetzerin und als Autorin von Radiofeatures zum Thema Russland tätig.
Zur Webseite von Antje Leetz.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Juri Rytchëu
Alphabet meines Lebens
Mit Bildern aus Juri Rytchëus Familienalbum
Autobiografische Erzählung
Aus dem Russischen von Antje Leetz
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 3 Dokumente
Diese Übersetzung folgt dem Manuskript mit dem Titel »Doroshny lexikon«.
Die Fotos auf Umschlag und Vorsatz sind Juri Rytchëus Familienalbum entnommen.
Originaltitel: Doroshny lexikon
© by Juri Rytchëu 2008
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: shaday365
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30449-9
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 25.06.2024, 23:45h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
ALPHABET MEINES LEBENS
Einige Worte vorabAbiturientAutomobilWitzMeloneArchäologieDampfbadDiebRabeWahlenZeitungHausmeisterDetumeszenzJudeSterne und SternbilderImperatorNameUnterhosenBildKinoWalKlimaBuchKolchosSchiffeKorruptionKulturbasisKuchljankaMondEisMathematikEisbärMilizMeerWalrossMuseumMusikRingelrobbeBestrafungDeutscheBrauchÜbersetzungStempelSchriftstellerSchwimmenFlugPorträtBeerdigungKussFeiertagPräsidentPreisFunkHemdRussenRussische SpracheSexErzählerSonneTelefonEssenUniversitätFotoBrotKälteBlumenZigeunerMenschTschuktschische SpracheSchamaneSchuleExpeditionElektrizitätJubiläumNachbemerkungMehr über dieses Buch
Über Juri Rytchëu
Juri Rytchëu: Der stille Genozid
Eveline Passet: Juri Rytchëu – Literatur aus dem hohen Norden
Leonhard Kossuth: Wo der Globus zur Realität wird
Über Antje Leetz
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Juri Rytchëu
Zum Thema Russland
Zum Thema Arktis
Zum Thema Ethnologie
Einige Worte vorab
Dieses Buch, lieber Leser, kannst Du auf der Arbeit in die Hand nehmen, am Strand, in der Badewanne, im Flugzeug, im Zug, im Bus, im Auto, auf einer Segeljacht. Selbst wenn Du nur eine Minute Zeit hast. Du kannst die Lektüre jederzeit abbrechen, und Du kannst zu diesem Buch zurückkehren, wann Du willst, nach einer Stunde, nach einem Tag, ja sogar nach einer längeren Pause. Denn ich habe die einzelnen Kapitel nach Stichwörtern gegliedert, die jeweils in russischer, tschuktschischer und deutscher Sprache angegeben und nach der russischen Fassung geordnet sind.
So ist eine Art Reiselexikon daraus geworden, eine Reise, auf der ich Dir von meinem Volk erzählen möchte, von seiner Sicht auf die große, vielgestaltige Welt. Jede Zeile dieses Werks habe ich selbst erlebt, es gibt keine einzige Seite, wo Dichtung und Wahrheit auseinandergehen.
Mein großer Wunsch ist: Wo auch immer Du Dich gerade befindest, im tropischen Dschungel, auf dem Meer, in Feldern und Wäldern – egal, Du sollst noch eine zweite Reise machen, nämlich zusammen mit mir, durch mein Tschukotka. Du sollst meine Sicht der Dinge, der ungewöhnlichen Erscheinungen in unserem Leben kennenlernen. Ich will Dich mit Menschen bekannt machen, mit denen mich das Schicksal zusammengeführt hat.
Wohlan! Glückliche Reise!
Juri Rytchëu
St. Petersburg 2006–2008
Abiturient
Абитуриент
Das Wort »Abiturient« gibt es im Tschuktschischen nicht. Ich kann mit schlafwandlerischer Sicherheit sagen, wann ich es zum ersten Mal gehört habe – am 4. November 1948, spät am Abend, in Leningrad.
Mein Kamerad Wassili Kaio und ich erreichten nach einer langen Reise durch das ganze Land endlich unser Ziel – Leningrad, die große Stadt, in der sich die Universität befand, in die wir aufgenommen werden wollten.
Wir traten auf den Bahnhofsplatz hinaus, den Platz des Aufstands, und blieben unentschlossen stehen. Autos rasten vorbei, Straßenbahnen und merkwürdige Fahrgestelle mit Hörnern, die an Oberleitungen befestigt waren. Außer den elektrischen Laternen leuchteten elektrische Funken, die von den Stromabnehmern der Straßenbahnen fielen. Dazu kamen die Funken von den Hörnern. Diese ganze Illumination spiegelte sich im nassen Asphalt des Platzes wider. Es roch nach Feuchtigkeit, Ozon und allen möglichen unbekannten Dingen.
Bei unseren Nachfragen stellte sich heraus, dass sich die Universität auf der Wassilewski-Insel befand. Das Wort »Insel« verwirrte uns ein wenig: Müssten wir etwa noch einmal ein Schiff besteigen, um zu dieser Insel zu kommen? Ein guter Mensch zerstreute unsere Befürchtungen und erklärte uns, dass eine Brücke zur Insel führe, über die man zu Fuß gehen könne. Aber dann riet er uns, doch lieber die Straßenbahn Nummer 5 zu nehmen und in aller Seelenruhe bis zur Universität zu fahren.
Wir hatten aber die Erfahrung gemacht, dass man auf tangitanischem Gebiet für alles bezahlen musste. Unser Geld war bereits ausgegeben, und wir waren im Ungewissen, wie sich unsere unerwartete Reise auf die Insel gestalten würde. Da erfuhren wir von einem anderen Passanten, dass man zur Wassilewski-Insel gelangt, wenn man den Newski-Prospekt, der direkt vor uns mit seinen Lichtern schillerte, einfach geradeaus geht, alles in allem wären das nur drei Kilometer. Ein lächerlicher Weg, fanden wir. Wir überquerten mit aller gebotenen Vorsicht den Platz des Aufstands und machten uns auf zur Wassilewski-Insel.
Ungeachtet des düsteren regnerischen Wetters waren wir frohen Mutes. Auch der Regen war in dieser Stadt irgendwie seltsam: Er bestand nicht aus einzelnen Tropfen wie normaler Regen, sondern hing wie feiner Tüll über der Stadt, wie ein nasser Schleier, allerdings durchsichtig genug, um alles gut sehen zu können: die finsteren Paläste mit den Säulen, die dunklen Toreingänge zu den Höfen, in denen sich ein geheimnisvolles, uns bislang noch unverständliches Leben verbarg.
Wir betraten eine kurze Brücke über einen verhältnismäßig schmalen Fluss. Am Beginn der Brücke standen nackte Jünglinge aus Stein, die sich aufbäumende Pferde zügelten. Für alle Fälle erkundigten wir uns bei einem Passanten, ob das die Newa sei, er aber sagte, nein, das sei die Fontanka.
»Fontanka«, wiederholte Kaio versonnen. Er wälzte das neue Wort im Mund hin und her.
Aber wir mussten noch einen weiteren Fluss überqueren, den wir fast übersehen hätten. Das war die Moika, wie uns ein anderer freundlicher Passant mitteilte.
Und dann kam endlich die Newa! Ja, das war ein richtiger Fluss mit viel Wasser, in dem sich, wie uns schien, die halbe Stadt mit all ihren Gebäuden und Lichtern spiegelte. In aller Ruhe überquerten wir die Palastbrücke, entdeckten die Peter-und-Paul-Festung am anderen Ufer, die wir schon von Bildern her kannten. Wir vernahmen deutlich das Plätschern des tiefen Wassers und spürten die Kraft der Strömung.
Als wir über die Brücke gegangen waren, bogen wir nach links ein. Wie viele Male hatte ich im Geist vor den geheiligten Toren der Universität gestanden, wie viele Male hatte ich im fernen Uëlen davon geträumt! Und nun lag sie vor uns, gläsern und dunkel. Hinter der Tür konnten wir eine beeindruckende Figur erkennen. Der Mann trug eine Uniform, ähnlich der, die die Kapitäne der Eisbrecher in der Arktis trugen.
Schüchtern klopften wir an.
Langsam öffnete der Mann die Tür einen Spalt und fragte trocken: »Wer seid ihr? Abiturienten?«
Das unbekannte Wort traf mich wie ein Schlag, ich kramte in meinem Kopf nach, was es wohl bedeuten könne. Ob der Mann unsere Nationalität meinte? Hüstelnd stellte ich mich vor: »Nein, wir sind keine Abiturienten … Wir sind Tschuktschen!«
»Ach, Tschuktschen!«, sagte der wichtige Mann vieldeutig und schlug die Tür vor unserer Nase wieder zu. Mein Freund und ich sahen uns an: Solch eine Reaktion auf unsere Abstammung hatten wir nicht erwartet.
»Du hättest nicht sagen sollen, dass wir Tschuktschen sind«, warf mir mein Freund vor.
»Aber wir sind doch keine Abiturienten!«, wandte ich ein.
Der wichtige Mann in der Admiralsuniform löste sich in der undurchsichtigen Dunkelheit hinter der gläsernen Tür zur Leningrader Universität auf.
Den zweiten Versuch, in die Universität vorzustoßen, verschoben wir auf den nächsten Morgen. Die Frage des Nachtlagers kümmerte uns wenig, es war zwar nasskalt, aber für unser Gefühl doch recht warm.
Bei unserem Weg am Newa-Ufer entlang stießen wir auf zwei steinerne Sphinxe. Und unter diesen Sphinxen standen steinerne Bänke, auf denen wir ausgezeichnet schliefen.
Am nächsten Tag erfuhren wir schließlich, was das Wort Abiturient bedeutet.
Automobil
Автомобиль
kowlorgoor
Kowlorgoor heißt wörtlich Räderschlitten. Zum ersten Mal habe ich ein Automobil in der Sankt-Lorenz-Bucht gesehen, als ich im Sommer 1944 zum Bau des Militärflughafens dorthin abkommandiert war. Der Bau war ein Eilprojekt und streng geheim. Die angeworbenen Bauarbeiter, die fast mit Gewalt aus den Siedlungen am Meer zusammengeholt worden waren, wurden auf amerikanische Landungsboote verfrachtet und auf dem niedrigen Kieselufer von Kytrytkyn, am Eingang zur Lorenz-Bucht, abgesetzt. Hier waren bereits geräumige amerikanische Zelte aufgeschlagen worden, in denen nackte Pritschen standen. Das Gelände war mit Stacheldraht umzäunt, an den vier Ecken standen hölzerne Wachtürme mit bewaffneten Maschinengewehrschützen.
Wir wurden am Ufer aufgestellt und ins Lager geführt.
Das Automobil sah ich schon aus der Ferne. Es kam aus der hügligen Tundra angefahren und schwankte von einer Seite zur anderen, wie ein Lederkanu auf den Meereswellen. Es heulte und brummte, und unter ihm quoll Rauch hervor. Ich blieb verdutzt stehen. Dieser geheimnisvolle Räderschlitten, der ganz von allein, ohne Zugtiere, durch die hüglige Tundra fuhr, wirkte auf mich wie ein lebendiges Zauberwesen.
Das Auto sah wirklich wie ein lebendiges Wesen aus. Die Scheinwerfer waren die Augen, den Rumpf bildete die Pritsche, die Beine waren die Räder, der Kopf war das Fahrerhaus, das den bemerkenswertesten Teil, den brummenden heißen Motor, beherbergte. Später habe ich das lebendige Herz des Motors gefühlt, als ich die Hand auf die warme Motorhaube legte. Alle Automobile auf Tschukotka waren amerikanischer Herkunft, Studebakers, die die Sowjetunion als Kriegshilfe über das Lend-Lease-Abkommen erhalten hatte.
Jeden Morgen, wenn wir in aller Eile unser bescheidenes Frühstück hinunterschlangen, das aus Graupenbrei und einem Becher mit süßem Tee bestand, kamen die gerade erst erwachten Automobile zu den Zelten gefahren. Sie heulten unzufrieden, als ob sie darüber zornig wären, dass man sie in dieser kalten, nassen Morgenstunde geweckt hatte. Selbst ihre Scheinwerfer brannten trübe und irgendwie verärgert.
Die Spaten klapperten, als wir hastig auf die Pritschen kletterten. Ich spürte, wie unter mir der Wagen ächzte und stöhnte und wie er kreischend und mit knirschenden Eisengelenken langsam anfuhr, immer schneller wurde und durch die hüglige Tundra zur fernen Landzunge holperte, wo wir für die Landebahn des Flughafens Kieselsteine aufluden. Die Arbeit war selbst für einen so kräftigen jungen Mann wie mich sehr schwer.
Nach einiger Zeit wurde ich befördert: Ich kam als Gehilfe des Kochs in die Küche für die Lastträger, die fast alle Landsleute von mir waren. Zu meinen Pflichten gehörte es, das Feuer unter der Kochplatte zu unterhalten, in die ein riesiger Kessel eingelassen war. Mit demselben Spaten, mit dem ich Kohle ins Feuerloch schaufelte, rührte ich das Essen im Kessel um, damit es nicht anbrannte. Auch diese Arbeit war nicht leicht, machte aber satt.
Schade war, dass ich nun nicht mehr mit dem Wagen fuhr und ihn nur noch aus der Ferne sah. Ich hatte immer Angst, von vorn an ein Auto heranzutreten, ich fürchtete unter die schwarzen Räder zu kommen, falls es dem eisernen Monster plötzlich einfallen sollte loszufahren.
Ein richtiger Autofanatiker wurde mein Uëlener Landsmann Wassili Kornejewitsch Ryppel. Er war schon früher mit seiner Vorliebe für die Technik aufgefallen, konnte Uhren reparieren, Nähmaschinen und sogar die »Archimedes«-Bootsmotoren, die damals in die Fischfangschaluppen eingebaut wurden.
Auf dem Bau bemühte sich Ryppel, möglichst immer in der Nähe eines Autos zu sein. Er war der Erste, der dem Fahrer half, wenn etwas kaputtging. Es gab für ihn kein größeres Glück, als neben dem Fahrer in der Kabine eines Studebakers zu sitzen. Manchmal sahen wir, wie Ryppel sogar das Lenkrad hielt und scheinbar eigenhändig das Auto lenkte.
Doch plötzlich flog eine schreckliche Nachricht von Zelt zu Zelt: Ryppel hatte ein Auto in die Tundra entführt! Die Wachsoldaten jagten ihm hinterher. Auch ich rannte los.
Der abgesoffene Laster stand mit der Nase zu einem kleinen Tundrasee. Die Räder waren im sumpfigen Tundraboden stecken geblieben. Der Bösewicht saß in der Kabine, sein Kopf war auf die Arme gesunken.
Die Soldaten umzingelten den Wagen und fluchten entsetzlich. Sergeant Sotow, der Kommandant der motorisierten Truppe, kam angerannt. Er riss die Wagentür auf. Da hob Ryppel den Kopf, und alle sahen seinem Gesicht an, wie glücklich er war. Mein Landsmann lächelte so selig, als ob er gerade einen Grönlandwal erlegt hätte.
»Was freust du dich, du Dussel!«, schrie ihn der Sergeant an. »Weißt du, was dir für den Diebstahl von Militäreigentum droht! Das Tribunal! Und nach dem Kriegsgesetz die Erschießung!«
Ryppel, der immer noch glücklich lächelte, kletterte aus der Kabine und sprang federnd auf den Erdhügel. »Ich hab es geschafft, ihn zu bändigen!«, sagte er auf Tschuktschisch. Allerdings war ich der Einzige, der seine Worte verstand.
»Festnehmen!«, brüllte Sergeant Sotow, und zwei bewaffnete Soldaten rannten zu Ryppel, drehten ihm die Arme auf den Rücken und führten ihn zur Wache ab.
Das Auto wurde mithilfe eines Raupenschleppers aus dem Sumpfboden gezogen. Es war völlig unbeschädigt und fuhr bereits am nächsten Tag wieder fröhlich die aufgeschüttete Straße entlang und transportierte Kieselsteine vom Ufer des Meerbusens.
In unserem Zelt wurde lange darüber diskutiert, auf welche Weise wohl unser Landsmann Wassili Kornejewitsch Ryppel hingerichtet werden würde. Sie würden den Uëlener Jäger wohl am Meeresufer erschießen, auf dem Kap Kytrytkyn. Wir rätselten: Würden mehrere Menschen auf ihn schießen? Oder würde nur ein Soldat hervortreten, vielleicht sogar der Kommandeur der motorisierten Truppe, Sergeant Sotow, persönlich? Ich brachte dem Häftling Brei, dünnen Tee und Brot und wunderte mich über seine gute Laune. Offensichtlich kümmerte ihn der nahe Tod überhaupt nicht.
Etwas hielt mich zurück, mit Ryppel ein längeres Gespräch anzufangen, irgendeine unsichtbare Grenze, die das Schicksal meines Landsmanns von meinem und dem der anderen Uëlener trennte, die nach Beendigung des Flughafenbaus wieder nach Hause zurückkehren würden, in ihren Heimatort, zu ihren Verwandten und Freunden. Nur Ryppel würde nicht zurückkommen … Vielleicht werden sie uns erlauben, wenigstens seinen Leichnam in die Heimat zu bringen? Ryppels Tochter, deren Namen die russischen Lehrer kaum aussprechen konnten – Ryppelyttyne –, ging in dieselbe Klasse wie ich und war sehr begabt für die mathematische Wissenschaft.
Doch Ryppel verhielt sich seelenruhig, als ob nichts Besonderes passiert wäre.
Als ich die Wache verließ und an dem bewaffneten Soldaten vorbeiging, hörte ich hinter mir die Stimme des Häftlings. Er sang Kriegslieder, die er bei den Soldaten gelernt hatte:
Furchtlos im Kampf wird sich zeigen,
wer Stalin studiert – für und für!
Wen Sturm und Gefahren nicht beugen,
sein Weg – Komsomol – führt zu dir.
Schließlich war der Bau abgeschlossen. Ein Flugzeug aus der Prowidenije-Bucht machte eine Testlandung, und aus diesem Anlass organisierte die Leitung ein großes Fest. Alle erhielten ein Geschenk – eine doppelte Portion Graupengrütze und hundert Gramm reinen Spiritus. Die Feier aber begann erst richtig, als die Hohe Militärführung angeflogen kam – ein General. Er kam aus Chabarowsk und hatte an einem Tag die Reise von mehreren Tausend Kilometern bis zur Sankt-Lorenz-Bucht geschafft.
Zu Ehren des Generals stellte sich am Rand der Landebahn, die mit Transparenten, Fahnen und einem riesigen Stalin-Porträt geschmückt war, das motorisierte Regiment mit blitzblank gewaschenen Automobilen auf. Die Soldaten hatten sich ebenfalls herausgeputzt. Etwas abseits hatte mit glänzenden Messingposaunen das Militärorchester Platz genommen, das von Zeit zu Zeit Melodien intonierte und damit das uralte Meeresufer mit völlig neuen Tönen betäubte und die Vögel in Angst und Schrecken versetzte. Alle waren in gehobener Festtagsstimmung. Auch ich freute mich auf die baldige Rückkehr in mein heimatliches Uëlen, in die Schule.
Ich brachte dem Häftling das festliche Mittagessen, er bekam sogar die hundert Gramm Spiritus in einem Aluminiumbecher. Ryppel trank den reinen Alkohol aus, ohne mit der Wimper zu zucken, und erstmals bekam sein ewig fröhliches Gesicht einen traurigen Ausdruck. »So ist das nun«, sagte er zu mir. »Meine letzten Tage sind gekommen. Bald werde ich hingerichtet …«
»Wirst du wirklich erschossen?«, fragte ich ihn mit ersterbender Stimme. Ryppel nickte schweigend und begann die Grütze zu essen. Aber als ich ging, sang er wieder seine Kriegslieder.
Über dem Meer tauchte das Flugzeug des Generals auf. Bevor es auf der neuen, mit kleinen Wimpeln abgesteckten Bahn landete, zog es ein paar Kreise über dem Flughafen, der wartenden Menge, den Häuschen der Bezirksregierung und dem laut spielenden Orchester, wobei es mit seinem Motorengebrumm die Marschklänge übertönte.
Die Erbauer des Flughafens, zu denen trotz des privilegierten Postens als Kochgehilfe auch ich gehörte, standen abseits, hinter den Soldaten, aber dennoch konnte ich gut sehen, wie als Erster der General aus dem Flugzeug stieg, in voller Uniform mit Ordenreihen über der ganzen Brust und mit breiten goldenen Schulterstücken.
Der wichtigste Bauarbeiter, den wir allerdings auf dem Bau fast nie zu Gesicht bekommen hatten, trat nach vorn, legte seine Hand an die Mütze und sagte etwas Militärisches, Abgehacktes, das wie Hundegebell klang. Dann spielte das Orchester die neue Hymne der Sowjetunion, alle standen stramm, waren geradezu erstarrt, als ob ein plötzlicher Frost über sie gekommen wäre. Nach der Hymne erklang ein lautes »Hurra«, und der General begann die Reihen abzuschreiten.
Zur Verwunderung aller lenkte er seine Schritte zu unserer Gruppe. Er blieb vor uns stehen und sagte laut: »Ich grüße euch, Genossen Tschuktschen!«
»Amyn etti!«, grüßten meine Landsleute jeder einzeln den General.
Und da begann meine Sternstunde. Ein Dolmetscher wurde gebraucht. Ich wurde nach vorn gestoßen und dem General vorgestellt. Ich hatte natürlich schreckliche Angst, aber der General erwies sich als guter und verständnisvoller Mensch. »Zier dich nicht, Junge!«, ermunterte er mich. »Lass uns reden.«
Er wollte wissen, woher wir kommen und womit wir uns in unseren Heimatsiedlungen beschäftigen. Er lobte uns. Doch da sagte plötzlich jemand in der Menge: »Nicht alle haben gut gearbeitet. Einer hat was ausgefressen, er ist mit einem Studebaker in die Tundra geflohen! Jetzt sitzt er und wartet auf das Kriegsgericht …«
Der General verlangte, dass man ihn zu dem Häftling führte.
Ryppel trat aus seiner engen Zelle und kniff im hellen Sonnenlicht für eine Sekunde die Augen zusammen. »Ich wünsche Gesundheit, Genosse General!«, sagte er deutlich auf Russisch und salutierte.
»Mit unbedecktem Kopf salutiert man nicht«, bemerkte der General streng. »Verstehst du wenigstens, wofür man dich eingesperrt hat und was dir droht?«
Ryppel antwortete auf Tschuktschisch, und ich gab mir die größte Mühe, seine Worte so genau wie möglich zu übersetzen. »Als ich zum ersten Mal ein Automobil gesehen habe, bekam ich Herzklopfen. So ein schönes, prächtiges, stolzes Tier. Und so gehorsam! Von da an war es mein Traum, dieses Pferd in meine Gewalt zu bringen, es zu zwingen, meinen Händen zu gehorchen. Ich lernte beim Fahrer, setzte mich neben ihn. Und das heiße eiserne Tier fühlte meine Gewalt, wollte mir dienen. Da habe ich mich entschlossen … Natürlich bin ich nicht ganz mit ihm zurechtgekommen. Aus irgendeinem Grund bog das Automobil plötzlich in die Tundra ab. Vielleicht wollte es in die Freiheit? Mein Herz aber hüpfte vor Freude und sang in der Brust: Seht her, das eiserne Tier hat sich einem Luorawetlan unterworfen! Ich habe solche Freude empfunden und solchen Stolz, nicht nur meinetwegen, sondern auch für unser Volk. Und diese Freude reicht mein ganzes Leben lang! Soll man mich ruhig erschießen, dafür habe ich ein Auto gelenkt! Ein amerikanisches Auto! Ich habe keine Angst vor dem Tod, weil meine Seele zum Sternbild der Trauer aufsteigt, in die Gegend des Polarsterns, wohin nur wahre Helden kommen!« Stolz sah Ryppel den General an.
Als der sich meine Übersetzung angehört hatte, sagte er: »Verdammt noch mal! Sofort freilassen!«
Witz
Анекдот
Dafür haben die Tschuktschen kein Wort. Aber sie würden es ungefähr mit tennewpynyl übersetzen.
Den ersten Witz hörte ich von einem russischen Jungen, einem Mitschüler in der Uëlener Schule, vom Sohn des Bäckers Petka Pawlow. Dieser Witz war so anstößig und obszön, dass ich ihn selbst nach so langer Zeit beim besten Willen nicht niederschreiben kann. Doch seit dieser Zeit habe ich ein besonders lebhaftes Interesse für dieses Genre der Volkskunst entwickelt.
In der tschuktschischen Folklore gibt es humoristische Erzählungen, die einem Witz oder einer Anekdote ähnlich sind, doch in ihnen sind meist Tiere die Akteure. In russischen Witzen dagegen Menschen. Am beliebtesten sind die anonymen Witze, die sich vor allem über ethnische Besonderheiten lustig machen. Sie treten wellenartig auf. So gab es beispielsweise eine Zeit der armenischen Witze, und mit wundersamer Beständigkeit werden jüdische Witze erzählt. Unser Land hat einen Ansturm humoristischer Volkserzählungen erlebt, die Lenin gewidmet waren. Der Höhepunkt war, als der hundertste Geburtstag des großen Führers des Proletariats gefeiert wurde. Doch nie hätte ich mir träumen lassen, dass mein kleines tschuktschisches Volk Held zahlloser Witze werden würde, in denen mein Landsmann als naiver Idiot dargestellt wird, der in die unterschiedlichsten komischen Situationen gerät.
Eine Zeit lang hielt man mich für den Autor der Tschuktschenwitze, obwohl ich mir keinen einzigen ausgedacht habe und sie mir wegen ihrer Dummheit auch gar nicht gefallen. Ein Witz ist meist ein Selbstporträt seines Erfinders und wirft ein Licht auf seine negative Seite, aber das würde er niemals zugeben, mehr noch, er versucht uns davon zu überzeugen, dass er viel »höher« als das Witzobjekt steht.
Die Tschuktschenwitze sind so weit verbreitet, dass sogar Kinder sie erzählten, sie sind nicht so obszön wie die sogenannten Witze für Erwachsene.
Einmal, in einem kleinen Kurort, wo wir im Sommer einen Bungalow des Literaturfonds gemietet hatten, hörte ich durchs Fenster folgenden Dialog meiner Frau mit dem Nachbarjungen:
»Stimmt es, dass es in eurer Familie Tschuktschen gibt?«, fragte der Junge.
»Ja, das stimmt«, antwortete meine Frau. »Guck mal durchs Fenster! Da sitzt einer am Computer.«
Der Junge blickte mich lange Zeit mit unverhohlener Verwunderung an und sagte dann wie zu sich selbst: »Und ich dachte, Tschuktschen gibt es nur in Witzen …«
Dann vernahm ich, wie der Junge zu seinen Altersgenossen sagte: »Onkel Juri arbeitet als Tschuktsche am Computer.«
Natürlich waren die einen oder anderen bösen und dummen Witze beleidigend für meine Landsleute und verärgerten sie. Einmal wandten sich sogar die Studenten der Nordischen Fakultät des Instituts der Nordvölker in Petersburg mit einer offiziellen Bitte an mich, ich solle mich des Problems annehmen und Maßnahmen ergreifen, um die Verbreitung der beleidigenden und erniedrigenden Witze zu unterbinden. Ehrlich gesagt, ich hatte nicht die geringste Ahnung, wie ich das anstellen sollte. Ich versuchte meine beleidigten Landsleute zu beruhigen, indem ich ihnen erklärte, dass es eher eine Ehre sei, Gegenstand eines Witzes zu sein. Nur herausragenden und begabten Völkern würde diese Auszeichnung zuteil: Juden, Armeniern, und wie viel Witze gab es über die Russen!
Aber an und für sich ist der Witz etwas Wunderbares, vor allem in unserem russischen Leben. In den Jahren der totalen Zensur drückten die Menschen in Witzen ihre Unzufriedenheit aus, kritisierten die Macht der Besitzenden und widerwärtige Erscheinungen des kulturellen und politischen Lebens.
Von Zeit zu Zeit sagen die Futurologen das Verschwinden des einen oder anderen Literaturgenres voraus. Meiner Erinnerung nach wurde der Roman schon mehrmals zu Grabe getragen, und mit dem Erscheinen des Computers verkündeten sie das Ende der künstlerischen Literatur überhaupt.
Aber selbst die mutigsten Propheten riskieren nicht, das Ende des Witzes zu prophezeien. Der Witz ist ein wahrhaft unsterbliches Genre!
Melone
Арбуз
In der tschuktschischen Sprache gibt und gab es nie ein entsprechendes Wort. Diese wunderbare Frucht der warmen Länder kannte ich nur von Abbildungen im Botanikbuch der Schule – ein gestreiftes und unwahrscheinliches rundes Ding. Die Begegnung mit der echten Frucht war unerwartet und hat sich mir fürs ganze Leben eingeprägt.
Es geschah im Spätherbst des Jahres 1948 auf dem Weg von Tschukotka nach Leningrad. Gemeinsam mit meinem Freund Kaio stieg ich in Wladiwostok vom Schiff. Mit viel Mühe ergatterten wir die billigsten Sitzplätze im Zug nach Moskau. Uns blieben noch ein paar Tage bis zur Abfahrt, und wir spazierten untätig durch die Stadt, bewunderten die Straßenbahnen, die Verkäufer von Selterswasser, die hohen Steinhäuser, an denen wir mit besonderer Vorsicht vorbeigingen: Es könnte uns ja plötzlich etwas auf den Kopf fallen. Die Sonne schien, und wir schwitzten entsetzlich in unseren warmen Kleidern. Ich trug eine recht ordentliche Wattejacke, die allerdings einen großen Fettfleck auf dem Rücken hatte, und Kaio glänzte im Militärmantel eines japanischen Kriegsgefangenen. Diese Kriegsgefangenen marschierten übrigens häufig in Reih und Glied durch die Straßen von Wladiwostok und sangen laut ihre Lieder. Im Marschschritt liefen sie über die Brücke, und ihr Gesichtsausdruck war so seelenruhig, als seien sie keine Gefangenen, sondern im Gegenteil die wahren Sieger.
Bei unseren Streifzügen durch die Stadt gerieten wir eines Tages auch auf den Basar. Das war ein umwerfendes Schauspiel. Auf den Tischen türmten sich Berge von Gemüse und Obst, auf riesigen Fischleibern glänzten die Schuppen, und die Scheren der prächtigen Königskrabben hingen fast bis zur Erde.
Uns aber interessierten die Früchte der Erde! Vor unseren Augen erstanden plötzlich die Bilder aus dem Schulbuch und von den Etiketten der Konservendosen! Aber hier war alles echt, verströmte noch den Geruch und die Wärme der Erde, auf der die Früchte gereift waren. Mehrere Male gingen wir durch die Reihen, betrachteten jede einzelne Frucht – die Gurken, die Tomaten, die Äpfel, die Birnen, die Mohrrüben. Einiges erkannten wir, aber die Mehrheit der Früchte dieser Erde war uns völlig neu. Wir tauschten unsere Eindrücke aus, manchmal wahrscheinlich viel zu laut. Allerdings nahmen wir an, dass uns niemand verstand, denn wir redeten ja tschuktschisch. Wenn wir durch die Reihen mit den Früchten und dem Gemüse gingen, blieben wir ab und zu unwillkürlich stehen und diskutierten, was wir von unserem kleinen Budget wohl kaufen sollten. Die Händler sahen uns schon misstrauisch an. Wenn wir genug Geld gehabt hätten, hätten wir natürlich alles probiert!
Und da erblickten wir sie! Sie lag mitten unter ihren Schwestern, und das Verblüffendste war, dass wir schon mehrmals an ihr vorbeigegangen waren, ohne sie zu bemerken. Wahrscheinlich wegen ihres ungewöhnlichen Aussehens. Unsere Augen übersahen unwillkürlich das Neue und waren auf Dinge konzentriert, die wir wiedererkannten. Unbekanntes aber gab es auf dem Wladiwostoker Basar in solch großer Menge, dass unser Blick von diesem ungeahnten Überfluss schon abgestumpft war.
Ich dachte mir gleich, dass das eine Melone sein musste. Im russischen Schulbuch war sie unter »A« im Alphabet abgebildet gewesen. Als erster Gedanke schoss mir durch den Kopf: Dieses Wunder ist für uns unerreichbar, wir können es lediglich aus der Ferne genießen.
Hinter dem Verkaufstisch stand ein Koreaner. Er bemerkte unser Interesse. »Wollt ihr eine Melone? Ich geb sie euch billig ab. Die hier, die wiegt drei Kilo.« Er nannte einen durchaus annehmbaren Preis. Wenn wir auf alles andere verzichteten, könnten wir uns erlauben, diese Wunderfrucht zu kaufen.
Kaio und ich schauten uns an. Im Blick des Freundes konnte ich das unausgesprochene, leidenschaftliche Verlangen lesen. »Wir nehmen sie!«, sagte mein Begleiter energisch und kniff aus unerfindlichen Gründen für einen Augenblick die Augen zusammen.
Als wir bezahlt hatten, schnappten wir uns die Melone und machten uns davon, als fürchteten wir, uns könne jemand die Beute wegnehmen.
»Hör mal«, sagte ich zu Kaio, »wir haben vergessen zu fragen, wie man sie isst …«
»Das hätte noch gefehlt!«, lachte mein Freund. »Wer fragt denn so was? Wir kriegen das schon irgendwie raus.«
»Vielleicht muss sie gekocht oder irgendwie verarbeitet werden?«, ließ ich nicht locker.
»Wenn wir fragen, wie man eine Melone isst«, sagte Kaio entschlossen, »hält man uns für Idioten!«
Wir gingen auf der Straße, die zum Meer hinunterführte. Erst nach einer Weile fanden wir eine freie Stelle, ohne Gebäude, Hafenanlagen und Boote, und setzten uns auf die Steine. Die Melone legten wir zu unseren Füßen hin. Da ruhte sie vor uns, rund, schön, gestreift wie ein Tiger.
»Vielleicht waschen wir sie wenigstens?«, schlug ich zaghaft vor.
»Das können wir machen«, stimmte Kaio mir zu. »Irgendwo habe ich gelesen, dass empfohlen wird, rohes Obst vor dem Essen zu waschen.«
Ich wusch die Melone im warmen Wasser der Bucht. Die Melone wollte mir ständig aus der Hand rutschen, so als wäre sie lebendig, und ich hatte große Angst, dass sie mir ins Wasser entkommt.
Die sauber gewaschene Melone legte ich Kaio zu Füßen, der bereits sein Jagdmesser herausgezogen hatte, von dem er sich nie trennte. Nachdem er mit dem Daumen die Klinge geprüft hatte, richtete er das Messer auf die Melone. Aber ich hielt ihn zurück: »Warte! Nicht so schnell … Lass uns erst mal ein kleines Stück probieren.«
Kaio war einverstanden und hobelte von der Oberfläche der wundervollen Frucht zwei dünne Scheiben ab.
Ich hatte etwas ganz Ungewöhnliches erwartet, einen zauberhaften, ungeahnten Geschmack, eine besondere Zartheit, Süße, kurz ein wundervolles Aroma … Aber ich empfand gar nichts, außer dass das Melonenstück kühl war. Ich zerdrückte das Scheibchen mit der Zunge und den Zähnen und biss sogar hinein. Keine Wirkung. Die Melone schmeckte wie das gewöhnlichste Tundragras, das an einem See oder am Ufer eines Bachs bei uns zu Hause wuchs.
Ich schaute meinen Freund fragend an. Er konnte seine Enttäuschung kaum verbergen.
»Da hast dus«, sagte ich. »Es war falsch, dass wir uns so geniert haben. Wir hätten fragen sollen, wie man sie isst. Vielleicht muss man sie kochen oder dörren …«
Kaio spuckte das grüne Stück auf die Kieselsteine und umklammerte sein Messer.
»Vorsicht!«, warnte ich ihn.
Das Messer fuhr gegen einigen Widerstand in das Fruchtfleisch, und plötzlich ging ein Riss quer durch die Melone … Die Frucht spaltete sich. In dem Spalt war es feucht und rot. Kaio drehte das Messer im Fleisch herum.
»Wollen wir weiterschneiden?«
»Warte«, beschwichtigte ich den Freund. »Lass uns erst überlegen … Also, wir haben keine Ahnung, wie man das isst. Wir sind sozusagen blutige Anfänger. Vielleicht machen wir was nicht richtig? Und werden krank? Eine Melone ist immerhin kein Kopalchen.«
Kaio hielt inne und überlegte.
»Was ist uns wichtiger, die Melone oder die Universität?«, fuhr ich fort.
»Schade nur ums Geld!«, seufzte Kaio und steckte das Messer weg. Ärgerlich trat er gegen die Melone. Die Frucht rollte zum Wasser und zersprang in zwei Teile. Wir traten zu ihr und berührten die Teile mit dem Fuß.
»Sieh mal, rot und feucht«, brummte Kaio. »Und hier, die komischen schwarzen Dinger, die so aussehen wie Maden. Oder wie gigantische Mikroben!«
»So große Mikroben gibt es gar nicht«, sagte ich zweifelnd. »Aber die Sache scheint trotzdem gefährlich zu sein.«
Wir stießen die Melone mit dem Fuß ins Wasser und verließen, ohne uns auch nur ein einziges Mal umzublicken, das Ufer, um unseren langen Weg zur Leningrader Universität fortzusetzen.
Archäologie
Археология
In der tschuktschischen Sprache gibt es keine Entsprechung für dieses Wort. Ich habe es vor langer Zeit zum ersten Mal gehört, noch bevor ich des Russischen mächtig war.
Aber schön der Reihe nach.
Während des Zweiten Weltkriegs, als die Vereinigten Staaten Verbündete der Sowjetunion wurden, erinnerte man sich plötzlich daran, dass es ein Abkommen unserer Länder über den visafreien Reiseverkehr der Anwohner der Beringstraße gab, das bereits Mitte der Dreißigerjahre vereinbart worden war.
Die ersten Gäste kamen in riesigen Kanus mit mächtigen Außenbordmotoren. Einige Boote hatten sogar zwei Motoren, was den Neid unserer Mechaniker hervorrief, die ständig unsere alten »Archimedes«-Motoren reparieren mussten, die schwächelten und jeden Augenblick kaputtgingen.
Die Gäste waren festlich gekleidet. Unter ihren Gürteln steckten leuchtend bunte gestrickte Wollhandschuhe. Vor allem beeindruckten uns die Mützenschirme aus Zelluloid und die Gummistiefel mit warmen Sohlen. Die Gäste rochen nach aromatischem Pfeifentabak, Zigarettenrauch und kauten unablässig Pfefferminzkaugummi, was den Neid von uns Kindern hervorrief.
Auf der Stelle entwickelten sich Tauschgeschäfte. Es stellte sich heraus, dass unsere Gäste sich vor allem für Walrosselfenbein und Knochenschnitzereien interessierten. Wenn die Knochen viele Jahre in der Erde gelegen hatten, gewannen sie eine honiggelbe Färbung und wurden sehr geschätzt. Jemand erinnerte sich, dass sich Lagerstätten solcher Knochen am Fuß des Berges Linlinnej befanden, auf dem die Toten begraben wurden. Die Uëlener zogen nun massenweise dorthin, bewaffnet mit Schippen, Spaten und Hacken.
Die Ergebnisse der ersten Ausgrabung übertrafen alle Erwartungen. Allein ich konnte vier prachtvolle, unbeschadete Walrosshauer ans Tageslicht befördern, unzählige Spitzen von Harpunenpfeilen, beinerne Knöpfe, Figürchen von Meeres- und Tundragetier, rituelle Gegenstände unterschiedlichster Art, von denen ich nicht einmal wusste, welche Bestimmung sie hatten.
Da wir noch kleine Kinder waren, konnten wir nicht selbst mit unseren Gästen aus Übersee Geschäfte machen, doch die Älteren tauschten Tabak in großen Mengen, dreifach geschliffene Stahlnadeln, Mützenschirme aus Plastik und sogar ganze Kaugummipackungen.
Einige Tangitan hießen unsere archäologischen Ausgrabungen nicht gut, vor allem die Mitarbeiter der Polarstation. Aber unser Bäcker, Onkel Kolja, war immer bei den Ausgrabungen dabei und füllte einen ganzen Sack mit reicher Beute, die er bei den Amerikanern gegen Schrot und Pulver tauschte. Er war leidenschaftlicher Jäger, und der Mangel an Munition war seine ewige Sorge.
Solange der Krieg andauerte, hielt auch die Freundschaft mit den Amerikanern. Wir gruben gewissenhaft die Tundra um, und bis zur nächsten Ankunft der Eskimos aus Alaska lag in jeder Jaranga ein reicher Vorrat an antiken Fundstücken zum Tausch bereit. Doch mit Beginn des Kalten Krieges endete diese einträgliche archäologische Tätigkeit. Zur Erinnerung daran blieben auf dem Berg Linlinnej offene Gruben zurück, die Höhlen unterirdischer Tiere ähnelten.
Nach dem Krieg wurden verschiedene wissenschaftliche Expeditionen nach Uëlen entsandt. Am häufigsten kamen Archäologen und gruben genau an jenen Orten, an denen auch wir selbst einige Jahre zuvor gewühlt hatten. Die Wissenschaftler schimpften und beschuldigten die Uëlener, sie wären unachtsam mit ihrer eigenen historischen Vergangenheit umgegangen. Sie zogen von Jaranga zu Jaranga und kauften den Tschuktschen für einen Spottpreis, oft sogar nur für eine Flasche Schnaps, die vergilbten beinernen Gegenstände ab, die die Reise ans gegenüberliegende Ufer der Beringstraße nicht mehr geschafft hatten.
Der wissenschaftlichen Archäologie begegnete ich erst an der Leningrader Universität, der bekannte Wissenschaftler Alexej Pawlowitsch Okladnikow hielt Vorlesungen in diesem Fach. Und später hatte ich unter den Archäologen, die eine Menge über die Urzeit unseres Volkes wussten, gute Freunde.
Mein Kommilitone Dorian Sergejew, Sohn einer Lehrerin, die einige Jahre an einer Eskimoschule unterrichtet hatte, fuhr fast jedes Jahr mit einer archäologischen Expedition nach Tschukotka. Er galt nicht nur als großer Kenner der alten und neuen Geschichte des Eskimovolkes, er hielt sich darüber hinaus für einen großen Freund der arktischen Ureinwohner.
Im Sommer 1958, als ich nach dem Studium an der Zeitung Magadaner Wahrheit arbeitete, kreuzten sich unsere Wege. Ich reiste zusammen mit dem Moskauer Dichter Sergej Narowtschatow, einem wissbegierigen und gebildeten Mann, durch Tschukotka. In meinem Heimatort Uëlen wohnten wir im Haus des Lehrers, das während der Sommerferien leer stand.
Jeden Abend hatten wir Gäste, denen wir Cognac anboten, mit dem wir uns vorher im Gebietszentrum eingedeckt hatten. Wir erzählten uns alte Märchen und Legenden und sangen Lieder. Am häufigsten kamen mein Verwandter, der berühmte Sänger Atyk, und Ryppel, der Bademeister von Uëlen.
Eines Abends klopfte Dorian Sergejew bei uns an, der zu dieser Zeit zum Leiter einer wissenschaftlichen Expedition aufgestiegen war. Wir unterhielten uns angeregt, aber unser Gespräch wurde von Ryppel unterbrochen, der uns mitteilte, dass das Dampfbad angeheizt sei und er sogar ein paar Ruten aus Polarbirke geflochten habe. »Hier!«, Ryppel wedelte vor unserer Nase mit den Ruten.
Als er weg war, fragte plötzlich der beste Freund der arktischen Ureinwohner, Dorian Andrejewitsch Sergejew: »Wollt ihr wirklich im Tschuktschendampfbad schwitzen?«
»Ja«, entgegnete ich. »Was ist daran so verwunderlich!«
»Es ist so«, sagte der Archäologe mit seltsam gesenkter Stimme, »dass wir für gewöhnlich ins Dampfbad der Polarstation gehen oder schlimmstenfalls zur Grenzwache.«
»Ist das tschuktschische Dampfbad etwa schlechter?«, fragte Narowtschatow verunsichert.
»Vielleicht«, murmelte Dorian. »Eigentlich ist es nicht schlechter. Sogar neuer … Aber dort baden die Tschuktschen und Eskimos …«
»Na und?«, meinte der Dichter schulterzuckend.
»Die Leute von hier sind nicht sehr hygienisch«, brummte der Archäologe. »Sie haben manchmal Hautkrankheiten und Ungeziefer …«
»Als ob die Russen das nicht hätten«, kicherte Narowtschatow. »Ich muss Sie warnen, Herr Archäologe. Sie sollten unser Zimmer meiden … Manchmal besuchen uns Freunde, Tschuktschen und Eskimos. Und auch mein Begleiter ist kein Tangitan … Vorsicht! Ansteckungsgefahr!«
Sergejew zuckte mit den Schultern, warf den Kopf zurück, als wolle er mit dieser Bewegung seine moderne Metallbrille zurechtrücken, und verließ stolz unser enges Zimmerchen.
»Und der will der beste Freund der arktischen Ureinwohner sein!«, sagte Narowtschatow entrüstet.
Natürlich brach der Kontakt mit den Archäologen nicht ab, wir trafen sie auf der Straße, in der Kantine und im Einkaufsladen. Eines Tages teilte uns Sergejew freudig mit, er habe eine Fundstelle aus dem Neolithikum entdeckt – eine bestens erhaltene unterirdische Behausung, gebaut aus Rasenplatten und Walknochen, direkt unter den Fenstern der alten Schule, auf der Südseite. Mein Begleiter und ich gingen uns diesen Fund anschauen.
Im Frühjahr 1943 war von der Insel des Großen Diomiden ein einäugiger Eskimo mit seiner Frau und vier Kindern nach Uëlen gezogen. Er wurde als Heizer in der Schule eingestellt. Anfangs wohnte er bei Verwandten, aber als der Schnee taute, machte er sich daran, eine eigene Behausung zu bauen. Er beschloss, sie ganz in der Nähe seines Arbeitsplatzes zu errichten. Das Baumaterial sammelte er ebenfalls ganz in der Nähe: am Strand, auf der Kiesellandzunge, in der Tundra.
Im Hochsommer war die in die Erde gegrabene neue Behausung fertig. Ich bin einige Male durch den niedrigen Eingang ins Haus gegangen. Drinnen war es recht geräumig und vor allem sehr warm, sogar im Winterfrost.
Nach dem Tod des einäugigen Eskimos zogen die Bewohner in ein normales Holzhaus, die Walknochen, die die Hütte gestützt hatten, stürzten ein, und die verlassene Erdhütte füllte sich mit Erde und interessierte in Uëlen keinen mehr.
Das alles erzählte ich dem Archäologen Dorian Andrejewitsch Sergejew, dem Leiter der archäologischen Expedition der Akademie der Wissenschaften.
Er setzte bestürzt die Brille ab, rieb sie mit einem Spezialtuch blank, setzte sie wieder auf und sagte nachdenklich: »Und ich hatte den Eindruck, die Behausung entspreche genau dem Bild des bekannten russischen Zeichners Luka Woronin von der Expedition des Vitus Bering. Seine Illustrationen hat auch Tan-Bogoras im Buch über die Tschuktschen benutzt …«
Eine Rekonstruktion der Behausung des Heizers der Uëlener Mittelschule entdeckte ich später in Dorian Sergejews Arbeiten. Sie wurde von ihm als Relikt der typischen alten Architektur der Beringstraße ausgegeben.
Seither hat mein Interesse an Archäologie stark nachgelassen.
Dampfbad
Баня
nymytran
Banja war das erste russische Wort, das ich hörte. Die wenigen Landsleute von mir, die bereits eine Prozedur im Dampfbad mitgemacht hatten, berichteten vor allem von Unmengen an heißem Wasser, das dort vergeudet wurde. Man hätte damit eine riesige Menge von schwarzem Briketttee aufkochen und mehrere Tage lang die gesamte Bevölkerung von Uëlen beköstigen können, und es wäre noch immer etwas für die benachbarte Siedlung Intschoun und die Eskimosiedlung Naukan übrig geblieben! Und dazu die Hitze. Eine unerträgliche, erstickende Hitze, der man nicht entfliehen konnte, ehe man den letzten Dreck von sich abgekratzt hatte.
Die erste Uëlener Banja gab es auf der Polarstation. Dorthin gingen nur die Tangitan – die Mitarbeiter der Polarstation selbst und die Lehrer. Die Banja wurde von Ryppel geheizt, unserem Landsmann. Er war auch der Erste von uns, der sie besucht hatte. Seiner Erzählung vom heißen Bad hörten wir mit großem Interesse zu. Seinen Worten zufolge konnte die Banja dem Luorawetlan nur Unglück und körperliches Leiden bringen. Besonders der Dampfraum, ein kleines Zimmerchen, in das so brennend heißer Dampf strömte, dass man darin gekocht wurde. Nicht zu glauben, dass die Tangitan mit Genuss darin schwitzten und wollüstig stöhnten, nein, sie schlugen sich auch noch mit Ruten, die aus Polarbirken geflochten waren. Die Haut der Tangitan wurde dermaßen rot, dass nicht viel fehlte, und aus ihren Poren wäre heißes Blut geflossen. Wenn sie sich genug geschlagen und genug heißen Dampf eingeatmet hatten, rannten die Tangitan nach draußen und stürzten sich mit einem Schrei ins eiskalte Wasser der Uëlener Lagune. Die Banja war für diese qualvolle Prozedur extra ans Ufer gestellt worden.
Ich war zum ersten Mal im Pionierlager der tschuktschischen Kulturbasis in der Banja, am Ufer der Sankt-Lorenz-Bucht … Wir gingen in ein halbdunkles Vorzimmer, in dem es wider Erwarten relativ kühl war und nach warmem, feuchten Holz roch. Mein Herz pochte stark und laut. Ich gab mir Mühe, meine Angst nicht zu zeigen und mutig zu tun, um mein plötzlich auftretendes Zittern zu unterdrücken.
»Ist dir kalt?«, fragte mich fröhlich der Pionierleiter. »Gleich wird dir heiß!«
Da sah ich plötzlich in einer Ecke Birkenruten mit trocknen Blättern hängen und erinnerte mich an die Erzählung meines Landsmanns Ryppel von seinen Banja-Abenteuern auf der Polarstation. Ich hätte am liebsten geheult und das Weite gesucht. Aber ich nahm all meinen Mut zusammen: Sicher standen mir große Prüfungen, vielleicht sogar Leiden bevor. Aber bestimmt keine tödlichen. Soweit ich mich erinnerte, kamen die Uëlener Banjabesucher auf der Polarstation immer fröhlich und krebsrot aus dem Häuschen heraus. Aber das waren die Tangitan …
Mit schwerem Knarren öffnete sich eine dicke Holztür, und uns schlug heiße, feuchte Luft entgegen. Wir betraten ein großes Zimmer mit langen Bänken, auf denen Metallschüsseln glänzten. Neben jeder Schüssel lag ein Stück brauner Seife und ein Schwamm aus gelbem Lindenbast. Der Pionierleiter erklärte uns ausführlich, wie wir den Schwamm einseifen müssten. Zuallererst sollten wir unseren Kopf waschen und aufpassen, dass die Seife nicht in Augen und Mund geriet. Ich bemühte mich gewissenhaft, den Anweisungen des Banja-Spezialisten Folge zu leisten. Es zeigte sich, dass das Waschen gar nicht schrecklich, sondern im Gegenteil sogar angenehm war. Aber einer schrie auf, offenbar war ihm Seife in die Augen geraten. Unser Pionierleiter wusch ihm die Augen mit frischem kaltem Wasser aus und wies uns noch einmal an, mit dem Schaum vorsichtig umzugehen.
Ich seifte mich mehrere Male gewissenhaft ein. Mithilfe meines Freundes Petka, des Sohns unseres Bäckers, wusch ich mir den Rücken. Ich spürte verwundert, dass mir leichter zumute wurde, so als ob mit dem Schmutz alles Schwere abgewaschen würde.
Da sagte der Pionierleiter plötzlich: »Wer möchte, kann jetzt in den Dampfraum.«
Nun kommts, dachte ich. Nun kommt die richtige Prüfung! Der Pionierleiter stieß eine fast unsichtbare Tür auf, und der aus der Dunkelheit uns entgegenschlagende heiße Dampf verbrannte den Körper. Unwillkürlich schreckten wir zurück, aber unser tapferer Pionierleiter schwenkte die Birkenrute, stürzte sich hinein und war verschwunden. Ich machte mir ernsthaft Sorgen um sein Leben. Keiner meiner Freunde wagte es, dem Helden zu folgen. Wir warteten aufgeregt, bis er wieder auftauchte, lebendig und unverletzt, aber rot, mit hervortretenden Augen und keuchend. Wir atmeten erleichtert auf.
Die erste Banja schenkte mir das ungewohnte Gefühl von Leichtigkeit, und ich begriff, welche Wonne es ist, sauber und gründlich gewaschen zu sein. Bis zur Pionierbanja hatte ich mir nur von Zeit zu Zeit mein Gesicht und die Hände mit frischem Urin abgerieben, bevor ich morgens zur Schule ging. Wenn aber die Ferien begannen, hatte ich leichten Herzens auf diese Hygienemaßnahme verzichtet.
Die erste Banja aber hat sich mir für immer eingeprägt, und seitdem wollte ich nicht mehr aufs Waschen verzichten. Als ich in den letzten Schuljahren ins Internat zog, haben wir in Uëlen statt der Banja eines der Zimmer geheizt, auf der Kochplatte aus Schnee Wasser gemacht und uns damit gewaschen. Als ich in der Pädagogischen Fachschule studierte, gingen wir in die Banja von Anadyr, die angeblich noch von russischen Kosaken erbaut worden sein soll. Obwohl sie häufig geheizt wurde, erkaltete sie sehr schnell, sodass das Eis auf dem Fußboden nie wirklich auftaute. Wir zogen uns immer Gummigaloschen an, um nicht an den Füßen zu frieren.
Es gab noch eine weitere wunderbare Banja in meinem Leben – in der Prowidenije-Bucht. Das dortige Hafenelektrizitätswerk pumpte für die Kühlung der Aggregate kaltes Wasser aus der Bucht und heißes ungenutzt zurück ins Meer. So geschah es mehrere Jahre, bis es einem findigen Kenner des Metiers in den Kopf kam, das heiße Wasser für sich und seine Kollegen zu nutzen. Sie bauten in einem Hangar ein Schwimmbecken mit Sauna. Als ich in der Prowidenije-Bucht überwinterte, rannte ich morgens, das Gesicht vor dem eisigen Wind schützend, der von der mit dickem Eis bedeckten Beringstraße wehte, zum Elektrizitätswerk. In dieser frühen Morgenstunde fand man im Schwimmbecken nur Männer im Adamskostüm. Eilig warf auch ich meine Kleider ab und stürzte mich in das heiße salzige Meerwasser. Dann ging ich in die Sauna und sog die brennende trockene Luft ein. Durch eine Tür gings in den Hof, der mit Holzbrettern ausgelegt war. Nach einigen Minuten auf diesen Brettern war ich von oben bis unten mit weißem Reif bedeckt. Als weißer Mann stürzte ich zurück in das heiße Wasser des Schwimmbeckens.
Solch eine Banja ist mir nie wieder begegnet.
Dieb
Вор
tulylyn
Der Diebstahl galt bei den Luorawetlan als eine der schlimmsten Sünden, und der Mensch, der bei dieser schändlichen Tat erwischt wurde, bekam für sein ganzes Leben einen Stempel, den er nicht mehr abwaschen konnte. So musste eine gesamte ehrenhafte Uëlener Familie, deren eines Mitglied des Diebstahls nur verdächtigt wurde, in ein fernes Nomadenlager am Ufer des Eismeers ziehen.
Ich erinnere mich noch an eine Zeit, da die Türen in unserer Siedlung keine Schlösser hatten, und zwar nicht nur die der Jarangas, sondern auch die der wenigen Holzhäuser der tangitanischen Bewohner. Als Wächter des Lebensmittellagers der Handelsbasis war der blinde Erzähler Iok eingesetzt.
Bei den Tangitan etwas zu stehlen, galt allerdings nicht als große Sünde. Ganz anders stand die Sache bei den eigenen Stammesgenossen! Wenn aber ein Tangitan einen Luorawetlan beauftragte, etwas zu bewachen, brauchte er sich um sein Eigentum keine Sorgen zu machen.
Während des Krieges, als überall Mangel zu spüren war, litten meine Stammesgenossen besonders unter dem Defizit an Tabak. Es geschah, dass mein Stiefvater beauftragt wurde, aus dem Lager der Polarstation einen riesigen Sack Machorka ins Gebietszentrum Kytryn zu transportieren. Der Sack hatte keine speziellen Stempel und war mit einer gewöhnlichen Schnur einfach zusammengebunden. Weder meinem Stiefvater noch einem anderen wäre es in den Sinn gekommen, die Schnur zu lösen und sich eine kleine Portion des wertvollen Tabaks zu nehmen. Der Sack wurde in unserer Jaranga aufbewahrt – das Wetter gestattete es meinem Stiefvater nicht, sich gleich auf den Weg zu machen. Er legte sich den Sack anstelle eines Kissens unter den Kopf. Das Einzige, was er unseren Gästen erlaubte: Sie durften am Sack riechen. Sie sogen geräuschvoll den Tabakduft ein und stöhnten vor unbefriedigtem Verlangen.
Bei stürmischem Wetter warfen die Wellen eine Menge Holz ans Ufer der Uëlener Landzunge – von abgerissenen Türen bis zu ganzen Holzstämmen. Diese Beute gehörte dem, der als Erster die unverhoffte Gabe des Meeres fand. Um kenntlich zu machen, dass das Stück Holz oder der Baumstamm bereits einen Besitzer hatte, reichte es, ein Steinchen daraufzulegen. Danach wäre es keinem auch nur im Traum eingefallen, sich die Beute anzueignen. Der Diebstahl kam erst später zu uns, in der Nachkriegszeit, als es rein gar nichts mehr zu kaufen gab.
Anfangs wurde Alkohol gestohlen. Die Diebe schlichen sich ins Lager oder den Laden und betranken sich entweder gleich an Ort und Stelle oder nahmen so viel mit, wie sie tragen konnten. Alkohol war das Hauptobjekt des Diebstahls. Die Tangitan, vor allem die Frauen, merkten plötzlich, dass ihre Parfümvorräte auffällig schrumpften: Sie wurden von denen ausgetrunken, die ihren morgendlichen Kater bekämpften. Dennoch war und blieb der Diebstahl eine schändliche Angelegenheit.
Als das schlimmste Vergehen galt es, aus einer fremden Falle ein Pelztier zu nehmen. Das wurde sehr bald ruchbar und durch allgemeine Verachtung bestraft, da körperliche Züchtigung in Bezug auf die eigenen Leute nicht anerkannt wurde.
Obwohl der Begriff »Privateigentum« im modernen Sinne des Wortes in unserem Volk nicht existierte, wurde das Eigentum des Nächsten geachtet und von der öffentlichen Meinung strenger gehütet als von Wächtern, die dafür angestellt waren.
Mit Diebstahl bin ich erstmals zusammengestoßen, als ich meinen Heimatort Uëlen verließ und mich auf den langen Weg zur Leningrader Universität machte. Zwei Jahre brachte ich an der Pädagogischen Fachschule von Anadyr zu, im Gebietszentrum, wo alles abgeschlossen und bewacht wurde. Hier konnte nicht einmal die Rede davon sein, dass man einfach in ein Haus hineinging. Der Diebstahl hatte Hochkonjunktur. Vor allem wurde Fisch geklaut, der unterm Dach in der Sonne gedörrt wurde. Nachts schlichen findige Kerle auf die Dächer und schnitten mit scharfen Rasierklingen, die an langen Stangen befestigt waren, die gedörrten Störe ab. In den ersten Nachkriegsjahren herrschte Hunger, und das Hauptziel war es, Nahrung zu ergattern.
Wir Studenten der Pädagogischen Fachschule aßen in der Mensa, und das Essen dort war zwar nicht üppig, aber immerhin sicher. Zur Bereicherung unseres Speiseplans fingen wir den ganzen Sommer hindurch an einem uns speziell zur Verfügung gestellten Abschnitt hinter dem alten Kosakenfriedhof Fische und deckten uns damit so reichhaltig ein, dass der Fisch nicht nur uns satt machte, sondern auch unsere Hunde.
Im Winter wagte es jemand, in die Küche einzubrechen und Lebensmittel zu stehlen. Das schmälerte natürlich unsere Ration. Zuerst verdächtigten wir unsere Köchin, aber sie erwies sich als ehrliche Frau. Die Lebensmittel musste einer unserer Kommilitonen gestohlen haben. Vor allem fehlten Brot, Butter, Zucker, alles, was man gleich aufessen konnte.
Wir organisierten einen Hinterhalt in der Hoffnung, den Dieb zu fangen, aber erfolglos. Für eine gewisse Zeit wurde nicht mehr gestohlen. Dann aber fing es wieder an. Dabei blieb das Schloss, das vor der Küchentür hing, unversehrt. Da kam der Direktor unserer Fachschule auf eine, wie ihm schien, scharfsinnige Lösung. Er gab uns den Küchenschlüssel und erklärte, wir würden von nun an selbst für die Sicherheit der Lebensmittel verantwortlich sein. Eine gewisse Zeit herrschte Ruhe.
Eines Abends aber saßen wir in einem Zimmer des Studentenheims, das im selben Gebäude untergebracht war wie die Mensa, und spielten Karten. Einer bekam plötzlich Durst. Frisches Wasser gab es nur in der Küche, im großen Kessel, der in die Kochplatte eingelassen war. An diesem Abend war gerade ich derjenige, der den Küchenschlüssel verwahrte und für die Sicherheit der Lebensmittel verantwortlich zeichnete. Wir schlossen die Tür zur warmen Küche auf – die große Kochplatte hielt die Wärme bis zum nächsten Morgen.
Während ich genüsslich das geschmolzene Schneewasser trank, fiel mir plötzlich etwas Ungewöhnliches auf. In der Küche hielt sich ganz offensichtlich noch jemand auf, aber wir konnten ihn nicht entdecken. Ich ging vorsichtig um die große Kochplatte herum und erblickte die geduckte Gestalt eines Studenten aus dem ersten Studienjahr, des Eskimos Tagroi aus Naukan. In der einen Hand hielt er ein großes gelbes Stück Butter, in der anderen einen länglichen Laib Weißbrot. Die geschmolzene Butter tropfte ihm bereits aus der Hand. Tagroi blickte mich an. Er zitterte, seine Augen sahen denen eines Hundes ähnlich, der Schläge erwartet.
»Was machst du hier!«, schrie ich ihn an, bemüht, meiner Stimme einen äußerst strengen und zornigen Ausdruck zu geben.
»Ich habe Kohldampf«, stöhnte Tagroi leise und begann zu heulen. »Mein Kopf tut weh.«
Ich weiß nicht mehr, was in meiner Seele vorging, jedenfalls war ich selbst kurz davor loszuheulen. Ich nahm Tagroi die Butter und das Brot weg, suchte ein großes scharfes Messer, schnitt einige Scheiben ab und schmierte großzügig Butter darauf. Mit Genuss aßen wir das nicht eingeplante Abendbrot, und ich bat Tagroi zu erzählen, auf welchem Weg er in die Küche gekommen war, ohne das Schloss aufzubrechen.
»Durch das Loch«, erklärte Tagroi und zeigte auf eine kleine Öffnung in der Wand, durch das die Köchin uns das Essen reichte. Es war so klein, dass man sich nur schwer vorzustellen vermochte, wie einer dort hindurchkriechen konnte. Mit der dünnen langen Klinge seines Jagdmessers hatte Tagroi die Leiste des Riegels von der Innenseite der Küche weggedrückt und sich regelrecht in das Loch hineingeschraubt. Dafür hatte er nicht länger als zwei Minuten gebraucht. Einer von uns versuchte, es ihm nachzumachen, aber er schaffte es nicht.
Am nächsten Morgen gab ich den Küchenschlüssel dem Direktor zurück und gestand, dass die gesamte Gruppe Butter und Brot gestohlen hätte.
Der Direktor seufzte und sagte plötzlich leise: »Ich habe solche Kopfschmerzen …«
Rabe
Ворон
wetly, walwinyn
Der Rabe gehört zu den wenigen Tieren, die die Tundra, die Berge und die Meere der Arktis im Winter nicht verlassen. Groß und schwarz zeichnet sich der Vogel dann deutlich auf dem weißen Schnee ab, und sein trocknes und lautes Krächzen ist manchmal der einzige Laut, der die weiße Stille stört. Von Zeit zu Zeit fliegt er zu einem anderen Platz, die Flügel über den von Stürmen glatt polierten Schneewehen ausgebreitet, setzt sich auf eine neue Erhöhung und hält Umschau. Im Winter jagt der Rabe in der Tundra Lemminge, frisst das als Köder für Pelztiere ausgelegte Fleisch von Ringelrobben und Bartrobben und Abfall. Er taucht als Erster auf dem Friedhof auf, gleich nachdem ein in die andere Welt Entschwundener in die symbolische Abgrenzung aus kleinen Steinen gelegt wurde, und pickt als Erstes die Augen des Leichnams aus.
Einem sitzenden Raben kann man sich bis auf wenige Schritte nähern. In der Kindheit hat es mich immer gereizt, den schwarzen Vogel zu fassen, aber etwas hat mich im letzten Moment davon abgehalten. Ein Gefühl der heiligen Ehrfurcht, versteckte Angst, gemischt mit unerklärlichem Misstrauen.
Vor allem aber war es Furcht vor der Bestrafung, die ich für die Nichtachtung eines heiligen Wesens bekommen hätte. Der Rabe war das Gefäß und die Quelle verborgener Kräfte und geheimnisvoller Erscheinungen in der Natur und in den Menschen. Außerdem war er eine Hauptperson unserer Legenden, historischen Überlieferungen, kosmischen Theorien und Zaubermärchen. Dabei war er keineswegs immer weise und allwissend. Zusammen mit anderen Figuren geriet er in dumme und komische Situationen und wurde von listigeren und erfahreneren Tieren übertrumpft. Am häufigsten aber war er die Kraft, die eine verwickelte Geschichte schließlich zu einem guten Ende führte.
Und gleichzeitig war er das Wesen, durch das der Schöpfer die gesamte, den Menschen umgebende materielle Welt schuf. Nach Überlieferungen verlief das folgendermaßen:
Ein Rabe flog im endlosen Raum, der noch keine Gestalt und Bestimmung hatte. Während seines gleichmäßigen Fluges, der eine unbegrenzte Zeit dauerte, ließ er Kot und Urin fallen. Aus den großen und festen Stücken, die der Rabe ausschied, bildete sich das Festland – die Kontinente und Bergketten. Aus den kleinen die Inseln. Und wenn etwas Flüssiges nach unten fiel, entstand die weite morastige, hüglige Tundra.
Da der Rabe seinen Schöpfungsflug nicht unterbrach, bildete sich aus dem Urin so etwas wie eine Schnur, die sich in Flüsse verwandelte. Ganz zum Schluss, als nur noch wenig Urin übrig war und es aus dem Raben nur tropfte, bildete sich eine große Zahl von kleinen Tundraseen. Allerdings war die Mission des Schöpfungsraben damit noch lange nicht zu Ende. Die Welt musste mit lebendigen Wesen besiedelt, mit Pflanzen bedeckt werden, aber die Hauptsache war das Licht. Denn die erschaffene Welt besaß noch kein Sonnenlicht, am Himmel gab es nicht einmal Sterne.
Da rief der Rabe all seine nahen und fernen Verwandten, die Vögel, herbei. Zuerst wählte er den stärksten und zähsten aus – den großen Adler, und befahl ihm, an den Rand zu fliegen, wo Himmel und Erde aufeinanderstießen, und dorthinein ein Loch für die Sonnenstrahlen zu hacken. Sich dem Befehl beugend, schlug der Adler mit den riesigen Flügeln und flog in die angegebene Richtung davon. Der Rabe musste lange auf ihn warten. Der Adler kehrte völlig erschöpft zurück, sein Schnabel war bis zum Stumpf abgewetzt. Er teilte dem Raben mit, dass er den Befehl nicht hatte ausführen können, das Himmelsgestein hatte sich als zu hart erwiesen. Da schickte der Rabe die weiße Eismeermöwe los. Aber auch sie kehrte unverrichteter Dinge zurück. Genauso erging es der Eule, der Ente, der Gans, dem Taucher, und es gab immer noch kein Licht auf der Erde …
Da hüpfte die Schneeammer vor den nachdenklich gewordenen Raben und erklärte ihren Wunsch, das Licht zu holen. Der Rabe schaute ungläubig auf den winzigen Vogel. Aber er hatte keine andere Wahl. Die Schneeammer verschwand in der undurchdringlichen Finsternis. Sehr lange musste der Rabe warten. Die Schneeammer aber hackte und hackte in das harte Himmelsgestein. Sie hatte bereits ihren kleinen Schnabel völlig abgewetzt, und Blut tropfte aus einer Wunde auf die schneeweißen Brustfedern des kleinen Vogels.
Da entdeckte der Rabe, der unverwandt auf die Innenseite des Himmels blickte, einen roten Schein. Zuerst war es nur ein Punkt, der aber immer größer und breiter wurde und dann auch in die Höhe wuchs, und aus diesem Rot flammten plötzlich helle Lichtstrahlen hervor. Der Rabe selbst und alle Lebewesen, die dieses Wunder sahen, kniffen die Augen zusammen. Das war die Sonne!
Die erschöpfte, aber glückliche Schneeammer kehrte fast ohne Schnabel zurück, ihre Brust war rot von Blut, aber sie kam mit dem Licht des Sonnenaufgangs, auf den alle Lebewesen auf der gerade erschaffenen Welt warteten.
Auch heute noch kann man auf der Brust jeder Schneeammer die blutroten Federn sehen.
Der Rabe hat großen Anteil an der Erschaffung der lebendigen Welt auf der Erde. Er ist so etwas wie der Vertreter des Schöpfers, der ihn von einem unbestimmten Platz im Weltall aus dirigiert und die Handlungen seines Gesandten streng kontrolliert.
Den Frühling des Jahres 1944 habe ich für immer im Gedächtnis behalten. Unsere Siedlung Uëlen wurde von einem schrecklichen Unglück heimgesucht – von einer hinterhältigen Grippeepidemie, die sich jeglicher Medizin zäh widersetzte. Das Unglück kam genau zu der Zeit, als die Wintervorräte zusammengeschrumpft und die Fleischgruben leer waren. In den Fässern war das eingesalzene Grünzeug ausgegangen. Es gab keinen Tran mehr, um die steinernen Lampen in den kalten Pologs aufzufüllen.
Jeden Tag wurden Tote auf den Hügel der ewigen Ruhe, auf den Berg Linlinnej, gebracht. Meist waren es alte Leute und Kinder. In der Ferne saßen schon die Raben und beobachteten in völliger Stille die traurigen Riten, die die Hinterbliebenen mit letzter Kraft vollführten.
Die Menschen stiegen, ohne sich umzusehen, vom Berg Linlinnej herab, hörten aber im Rücken das trockene, laute Krächzen.