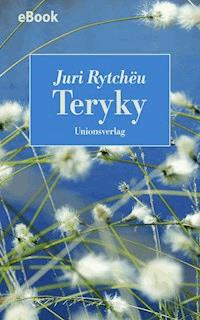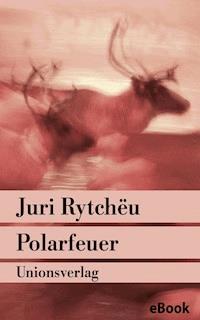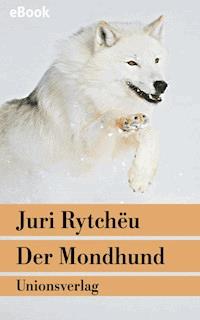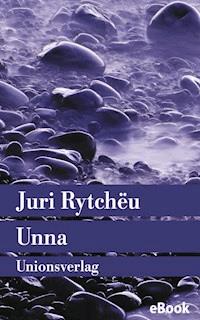
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als das Tschuktschenmädchen Unna ins Internat geschickt wird, findet sie bald Gefallen an der Zivilisation: Das städtische Leben, die Sauberkeit, aber vor allem der Schulausflug in den Süden, wecken in ihr den Wunsch nach einem anderen Leben. Sogar ihren Vater, der oft vor Alkohol und Sehnsucht nach seiner Tochter trunkenen ist, stößt sie von sich. Sie rebelliert gegen die eigene Herkunft. Beinah gelingt es ihr, auf der Leiter ihrer politischen Karriere ganz nach oben zu gelangen. Zu spät begreift sie, welche Opfer man von ihr dafür verlangt. Zum ersten Mal erzählt Rytchëu von einer Tschuktschin, die sich fern von ihrer Heimat mit der Zivilisation arrangieren muss. In welchen Zwiespalt dieses Leben zwischen Anpassung und Ablehnung führen kann, erfährt Unna am eigenen Leib.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 336
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
Zum ersten Mal erzählt Rytchëu von einer Tschuktschin, die sich fern von ihrer Heimat mit der Zivilisation arrangieren muss. In welchen Zwiespalt dieses Leben zwischen Anpassung und Ablehnung führen kann, erfährt Unna am eigenen Leib. Zu spät begreift sie, welche Opfer sie dafür bringen muss.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Juri Rytchëu (1930–2008) wuchs als Sohn eines Jägers in der Siedlung Uëlen auf der Tschuktschenhalbinsel im Nordosten Sibiriens auf und war der erste Schriftsteller dieses nur zwölftausend Menschen zählenden Volkes. Mit seinen Romanen und Erzählungen wurde er zum Zeugen einer bedrohten Kultur.
Zur Webseite von Juri Rytchëu.
Charlotte Kossuth (1925–2014) war Russisch-Lektorin in Halle/Saale und fast dreißig Jahre lang Verlagslektorin für russische und sowjetische Literatur in Berlin.
Zur Webseite von Charlotte Kossuth.
Leonhard Kossuth (*1923) lehrte am Literaturinstitut in Leipzig und war dreißig Jahre lang Cheflektor für Sowjetliteratur in Berlin. Zudem ist er als Herausgeber, Übersetzer, Literaturkritiker und Publizist tätig.
Zur Webseite von Leonhard Kossuth.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Juri Rytchëu
Unna
Roman
Aus dem Russischen von Charlotte und Leonhard Kossuth
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 3 Dokumente
Eine erste Fassung des Romans erschien 1992 unter dem Titel Unna in der Zeitschrift Newa Nr. 11/12, St. Petersburg.
Originaltitel: Unna (1992)
© by Juri Rytchëu 1994
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30458-1
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 26.06.2024, 01:28h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
UNNA
1 – Als die Erzieherin ihr diesmal ankündigte, der Vater …2 – Einige Jahre waren vergangen, und Unna Owto erinnerte …3 – Im Internat war es ziemlich leer …4 – Nach Neujahr und den Winterferien, die sie auch …5 – Sooft Unna später über den Whäner Liman fuhr …6 – Drei Jahre waren seit jenem denkwürdigen Augustmorgen vergangen …7 – In die Bezirksstadt kam das Moskauer Fernsehen …8 – Die beste Zeit in Whän war die zweite …9 – Jakow Lasarewitsch kam pünktlich zur festgesetzten Zeit …10 – Bereits beim Bau des Restaurants, einer der ersten …11 – Jakow Lasarewitsch begleitete Unna zum Flugzeug nach Magadan12 – Mit jedem Jahr verlor der Eisgang auf dem …13 – Zwei Jahre waren vergangen14 – Unna arbeitete nicht. Die meiste Zeit verbrachte sie …WorterklärungenMehr über dieses Buch
Über Juri Rytchëu
Juri Rytchëu: Der stille Genozid
Eveline Passet: Juri Rytchëu – Literatur aus dem hohen Norden
Leonhard Kossuth: Wo der Globus zur Realität wird
Über Charlotte Kossuth
Über Leonhard Kossuth
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Juri Rytchëu
Zum Thema Russland
Zum Thema Arktis
Zum Thema Frau
1
Als die Erzieherin ihr diesmal ankündigte, der Vater sei gekommen, rannte ihm Unnotschka Owto, anders als sonst, nicht durch den langen Internatskorridor mit den riesigen, bis zum Boden reichenden Fenstern freudig entgegen, sondern suchte eine Weile unterm Bett ihre Fellpantoffeln, ging dann langsam über die knarrenden Dielenbretter und spürte, wie in ihrem kleinen Herzen unbewusst Zorn, Verdruss und Scham anschwollen.
Ja, Owto, der älteste Hirt einer Nomadensiedlung gleichen Namens, war wie gewöhnlich, wenn er in die Große Siedlung kam, stark angetrunken, und in seinen spärlichen Schnurrbarthaaren glänzten widerwärtig Perlen von Schweiß oder gar durchsichtigem Rotz. Seine roten Augen aber schienen leicht überzuquellen. Als er die ihm entgegenkommende Tochter erblickte, stellte er eine große Papiertüte auf den Boden und begann laut zu singen:
Mainy – ten – memlyetschgyt
Ynky nutek any kole!
Mynylpyn ynken korgaw –
Torwagyrgyn ynky warkyn!
Er versuchte sogar ein paar Tanzschritte – nicht nur, um seiner großen Freude über das Wiedersehen mit seiner einzigen Tochter Ausdruck zu verleihen, sondern auch, um zu zeigen, dass er ein geselliger, moderner Mann sei, der sich so zu benehmen wisse, wie es sich gehört, wenn man tüchtig getrunken hat.
Doch das missmutige und unzufriedene Gesicht der Tochter ließ ihn innehalten, und besorgt erkundigte er sich auf tschuktschisch: »Fehlt dir auch nichts?«
»Ich verstehe nicht!« antwortete Unnotschka streng auf Russisch, denn sie hatte bemerkt, dass die Erzieherin und die Internatskinder interessiert beobachteten, was da vor sich ging. Das verstärkte ihre bittere Scham, weniger über die Verfassung und das Benehmen des Vaters als über sein verlottertes und erbärmliches Aussehen.
»Gesunt nich?« erkundigte sich der Vater teilnahmsvoll und wischte sich, um ein anständiges Aussehen bemüht, die Tropfen aus dem Schnurrbart. Er versuchte, die russischen Wörter richtig auszusprechen, aber das gelang ihm schlecht, selbst die einfachsten russischen Ausdrücke wurden in seinem Mund unverständlich.
»Ich bin nicht krank, ich bin gesund«, antwortete Unna auf Russisch, griff nach der Papiertüte und stieß streng hervor: »Du aber geh! Und komm nicht wieder betrunken hierher!«
»Nich betrunken!« entgegnete Owto empört. Und fuhr auf tschuktschisch fort: »Wir hatten doch gerade erst angefangen. Haben je eine Flasche Wermut geleert. Ach, Töchterchen, du hast noch nie einen richtig betrunkenen Mann gesehen!«
Er besann sich, verstummte, suchte mit großer Willensanstrengung seinen kargen russischen Wortschatz zusammen und sagte: »Da ist Geschenk … Für dich – Geschenk. Mama, Papa, Geschenk …«
»Nimm die Geschenke, Unnotschka«, erlaubte ihr die Erzieherin und sagte: »Sie aber, Genosse Owto, sprechen noch immer schlecht Russisch. Sie müssen lernen! Und noch etwas – ins Internat muss man nüchtern kommen.«
»Gutt, gutt«, murmelte Owto hastig, bückte sich schnell, für alle überraschend, und sog geräuschvoll das ganze Bouquetvöllig unbegreiflicher Gerüche eines für den Tundrabewohner fremden Lebens ein, in dem Unnotschka, sein einziges, langersehntes Kind, nun schon vier Jahre weilte. Er hoffte, mit dem altentschuktschischen Kuss, dem Ukwen, wenigstens einen schwachen Hauch zarten kindlichen Dufts zu erhaschen.
Unnotschka wich erschrocken zurück, sah den Vater zornig an und trippelte schnell den langen, von der tief stehenden Wintersonne hell erleuchteten Internatsflur entlang.
Doch aus irgendeinem Grund ging ihr das alte Lied nicht aus dem Sinn, das sie vor langer Zeit, als Tundrakind, in der Jaranga gehört hatte:
Mainy – ten – memlyetschgyt
Ynky nutek any kole …
Sie kannte die Worte, verstand aber deren Bedeutung schon nicht mehr, obwohl sie sich erinnerte, dass der Vater das Lied nach einer Reise verfasst hatte, die ihn anlässlich des fünfzigsten Jahrestags der Revolution zu einer Versammlung der Rentierzüchter in die große Stadt Magadan führte; das war vor jenem Jahr, in dem Unnotschka Owto endlich in die Schule geschickt wurde.
In der Klasse war sie viel älter als ihre Mitschüler, denn die Eltern hatten ihre Existenz lange verheimlicht, damit das Mädchen nicht in den Kindergarten musste.
Doch das war noch nicht das größte Übel. Viel schlimmer war, dass das Mädchen damals überhaupt nicht Russisch sprach.
Sogar der Direktor des Schulinternats, Iwan Iwanowitsch Mitrochin, kam eigens herbei, um sein Phänomen in Augenschein zu nehmen. Er sah sich das verschreckte kleine Mädchen an und sagte entrüstet: »Abscheulich! Einem Kind so das Leben zu verpatzen!«
Noch im ersten Jahr ihres Internatslebens versuchte Unnotschka Owto, in die heimatliche Siedlung zu flüchten. Sie lief frühmorgens weg, und erwischt wurde sie erst gegen Mittag.
Nach diesem Vorfall wurde Unnotschka Owto zu allen Ferien in die Tundra gebracht.
Meistens nahm sie der Vorsitzende des Exekutivkomitees, Alexander Wenediktowitsch Komarowski, mit.
Er unterschied sich merklich von den anderen Russen, die Unnotschka Owto kannte. Vor allem sprach er ausgezeichnet Tschuktschisch.
Vor etwa zehn Jahren war in der Nomadensiedlung Owto ein rotblondes, verschrecktes Bürschchen in einem kurzen Übergangsmantel und mit Zottelmütze aufgetaucht. An den Füßen hatte er Segeltuchschuhe, die ganz und gar nicht für ein Leben in der Siedlung unter den Bedingungen des nahenden Winters taugten. Sascha Komarowski aber war in die Tundra gekommen, um lange hier zu leben, und er besaß nicht nur ein Diplom des Kostromaer Veterinärtechnikums, sondern war auch noch offiziell in die Tundra, in die Siedlung delegiert worden. Die Kreisbehörde hatte allerdings nicht einmal daran gedacht, den jungen Mann, der ein Rentier bisher nur von Bildern oder aus dem Kino kannte, entsprechend einzukleiden.
Doch der junge Zootechniker wurde in der Tundra freundlich empfangen, man nähte ihm wunderschöne Winterkleider und brachte ihm allmählich das Handwerk eines Rentierzüchters bei. Nach drei Jahren zog Sascha Komarowski in die Große Siedlung, wo man in dem erwachsen gewordenen, sommersprossigen jungen Mann das scheue Bürschchen aus Kostroma gar nicht wieder erkannte. Dann aber begriffen sie, dass er genau der Mann war, der in der Kreisstadt gebraucht würde, und boten ihm verschiedene wichtige Posten an, die er zunächst ablehnte.
Komarowski führte regelmäßige Untersuchungen und Behandlungen erkrankter Rentiere ein, brachte Medikamente in die Tundra, stark riechende Flüssigkeiten, mit denen die Tiere besprüht wurden, um Bremsen abzuwehren, die ja auch das Fell beschädigen. Die Rentiere in der Siedlung Owto gewannen den Ruf, stets gut genährt und gesund zu sein. Das wiederum brachte spürbar höheren Verdienst.
Komarowski führte auch neue Bräuche ein: Samstags brannten in den Jarangas heiße Feuer, die Leute wuschen sich den Tundraschweiß der Woche ab und erlebten, wie leicht man sich nach solchem Waschen fühlt. Sascha selbst aber stürzte sich, wenn er seinen Körper in heißem Dampf erhitzt hatte, in eine Schneewehe und schrie: »Banja! Banja! Uch! Ach!«
In Owtos Jaranga badete man im ersten Wasser das Mädchen, und Unna prägte sich fürs ganze Leben ein, welche unerklärliche Leichtigkeit sie nach dem Bad in dem verzinkten Trog, im warmen Dampf des heiß brennenden Feuers überkam. Nach der Banja, dem Schwitzbad, tranken sie Wodka und Tee. Die Leute lärmten und baten Sascha Komarowski, ihnen seinen erstaunlich weißen, mit braunen Pünktchen von Sommersprossen übersäten Körper zu zeigen.
»Wie von Bremsen zerstochen, die Haut!« riefen die Tschuktschen verwundert. »Macht dir das keine Sorgen?«
»Nein, keine Sorgen«, antwortete Komarowski fröhlich und erstaunte alle durch seine gute Aussprache, sein Verständnis für das fremde Leben und seine Herzensgüte.
»Das ist ein echter Russe«, sagte der alte Ponto, der, wie behauptet wurde, sich noch an die Zarenzeit erinnerte und sogar von einem russischen Popen getauft worden war.
Von allen Russen bewies allein Komarowski Mitgefühl mit Owto, und er tat alles, um ihm zu helfen, dass dieser sein Kind nicht in eine staatliche Einrichtung geben musste.
Das Hauptargument der Funktionäre war die mangelnde Hygiene in der Tundra-Jaranga, die angeblich auch das Leben des Mädchens gefährde.
»Man könnte ja meinen, sie machen selber nichts anderes, als sich immerfort zu waschen!« murrte die Mutter, als sie wieder einmal die zarte Haut des Mädchens nach dem Baden trockenrieb. »Haben sie etwa keine Insekten in ihren Wohnungen?«
Owto, der immerhin ab und zu in der Kreisstadt zu tun hatte, erzählte: »Als ich in diesem Frühjahr da war, stank es überall fürchterlich. Sie machen alles in den eigenen Wohnungen, wenn es aber warm wird, taut, was sich den Winter über angesammelt hat, und beginnt zu stinken.«
»Können sie denn von ihren Wohnungen nicht etwas weiter weg gehen?« wunderte sich seine Frau.
»Wohin denn?« erklärte Owto mit Sachkenntnis. »Die Häuser stehen eng beieinander, bis einer die hinter sich gelassen hat, hält er es doch nicht aus, da müssen sie es eben in der Wohnung erledigen … Für Gäste haben sie eigens Buden gebaut. Aber wenn man da hineingeht, wird einem übel von dem Gestank, sicherlich werden die auch nie gereinigt. Im Winter geht es ja noch, da verhindert der Frost den Gestank, im Sommer aber darf man sich so einer Holzbude nicht mal nähern … Was jedoch die Insekten anbelangt, so haben sie zwar keine Läuse, dafür aber Wanzen und Kakerlaken.«
»Was sind denn das für Raubtiere?« fragte die Frau neugierig.
»Das hast du gut gesagt – Raubtiere!« Owto grinste. »Eine Wanze ist bestimmt zehnmal so groß wie eine Laus!«
»Kykewynywai!« stöhnte die Frau. »Hast du denn schon mal welche gesehen?«
»Als ich in dem alten Hotel übernachtet habe, konnte ich einfach nicht einschlafen. Kaum legst du dich hin und machst das Licht aus, stürzen sie sich auf dich wie hungrige Hunde. Gegen Morgen war ich so zerbissen, als wäre ich in ein wütendes Rudel geraten.«
»Anywai«, stöhnte die Frau erneut auf, drückte das Kind an sich, und sie stellte sich vor, riesige russische Läuse – Wanzen – würden den zarten Körper in Stücke reißen.
»Und dann gibt es noch Kakerlaken«, fuhr Owto fort und stürzte seine Frau endgültig in Entsetzen, »solche bärtigen Ungeheuer, manche so groß wie bei mir ein Fingerglied. Menschen fressen sie nicht, aber dafür lieben sie alles: Brot, Wurst … Besonders viele gibt es in den Kantinen.«
»Warum prahlen die Russen dann, dass sie so sauber sind!« empörte sich die Frau.
Als Owto den Ausdruck unverhohlenen Entsetzens auf ihrem Gesicht wahrnahm, versuchte er sie zu beruhigen: »In dem neuen Hotel stinkt es schon nicht mehr. Da sind in einem Extraraum, wo man seine Notdurft verrichtet, Töpfe in den Boden eingelassen, die sehen aus wie mittelgroße, emaillierte weiße Kasserollen. Sie sind durch eine Röhre mit einem eisernen Kasten verbunden, der bis obenhin voll Wasser ist. Wenn du die Notdurft verrichtet hast, ziehst du an einem Strick, und in den Topf ergießt sich ein Wasserstrom, der alles so sauber spült, dass man aus der Pfütze, die auf dem Boden zurückbleibt, sogar trinken könnte … Aber Kakerlaken gibt es trotzdem«, beendete Owto seufzend seinen Bericht.
2
Einige Jahre waren vergangen, und Unna Owto erinnerte nicht im Entferntesten mehr an das scheue, schweigsame Mädchen, das an einem Wintermorgen auf einem Schneepfad in die heimatliche Siedlung laufen wollte. Russisch sprach sie geläufig, und es war kaum zu glauben, dass sie vor nur knapp drei Jahren nicht mehr als zwei, drei Worte gekannt und sogar die auszusprechen sich geniert hatte. Auf dem Nachttisch hatte sie immer einige Bücher liegen, die sie abends neben der Pflichtlektüre las, darunter den recht umfangreichen Band über den unerschrockenen jungen Pionier Pawlik Morosow. Als Unna das Buch zum ersten Mallas, dachte sie mit bebendem Herzen: Hätte sie so handeln können wie dieser tapfere Junge? War vielleicht nur der Anfang schrecklich, der erste Schritt? Danach aber kam das erhebende Gefühl, seine Pflicht erfüllt zu haben, der Ruhm eines Helden, Aufmerksamkeit nicht nur vonseiten der Altersgefährten, sondern auch der Lehrer. Bei festlichen Veranstaltungen ein Platz im Präsidium oder zumindest neben der Fahne. Laute Musik, feierliche Reden, bedeutsame Worte, und von der Wand blicken freundlich Lenin und Breshnew.
Unna hatte schnell begriffen, was sie tun musste. Vor allem: gut lernen, die russische Sprache vorzüglich beherrschen. Das Lernen an sich erwies sich als nicht so schwer, wenn man akkurat und fleißig war. Das Wichtigste war: in den Stunden aufmerksam den Erläuterungen des Lehrers zu folgen, die Hausaufgaben pünktlich zu erledigen, solange das, was sie in der Stunde gehört hatte, noch frisch im Gedächtnis war. Erst dann kam jede Menge Freizeit. Sie konnte lesen oder in der Großen Siedlung spazieren gehen, an der Hauptstraße entlang, die von fünfgeschossigen Häusern gesäumt war, an dem zweigeschossigen grünen Haus vorbei, in dem die Behörde untergebracht war, bis hinter das Kesselhaus mit dem hohen eisernen Schornstein, der so schwarzen Kohlenrauch ausstieß, dass der Schnee wie Asche aussah. Unna bemühte sich immer, möglichst schnell auf reinen Schnee zu gelangen, der begann erst weit hinter dem kleinen Haus, in dem die Tuberkulosekranken aus dem ganzen Kreis untergebracht waren.
Hinter einer Ödfläche befand sich ein Walknochenfriedhof. Die hiesigen Jäger waren berühmte Walfänger gewesen. Doch das lag weit zurück, als sie noch auf der schmalen, von Kieselsteinen bedeckten Landzunge lebten, die weit ins offene Meer ragte. Auf Fellbooten oder hölzernen Schaluppen waren sie hinausgefahren.
Der Hauptproduktionszweig im Sowchos war die Pelztier- und die Rentierzucht. Pelztierzüchter gab es relativ wenige, damit befassten sich hauptsächlich Frauen, die Männer aber fanden im Winter keine Beschäftigung, denn zur Jagd hätten sie weit hinausfahren müssen, an die alte Stelle, doch jetzt gab es bereits weder Hundegespanne noch andere Transportmöglichkeiten. Etwas taten sie aber doch: Für das Kesselhaus hackten sie Kohle aus dem großen Haufen am Ufer, brachten Wasser aus einem fernen See, und wenn der im Winter bis zum Grund zufror, herausgehauene blaue Eisbrocken. Der eine oder andere schleppte Kisten aus dem Lager in den Laden und durfte dafür Alkohol kaufen, oder er fegte den Schnee beim Ortssowjet und beim Sowchosbüro.
Jeden Sommer kam das Walfangschiff »Sternblick« in die Bucht und hatte zwei oder auch drei Wale im Schlepp. Es ging auf der Reede vor Anker, Schaluppen fuhren zu ihm hin, um die Walkörper ans Ufer zu bugsieren, dort wurden sie dann von einem Traktor an Land gezogen und mit großen alten Messern, die noch aus der Zeit stammten, da die Männer selbst Wale erlegten, zerteilt. Am Ufer versammelten sich dann wie in guten alten Zeiten alle Alteingesessenen, schnitten sich Itgilgyn – Walhaut mit Fett – ab und kauten genüsslich.
Am Ufer brannten Feuer, darum versammelten sich Betrunkene, unterhielten sich laut, sangen und erinnerten sich an die Jugend, als sie selbst noch Wale gefangen hatten.
»Und jetzt bringt man sie uns wie ein Almosen, wie ein erniedrigendes Geschenk!« schrie der einäugige Rultyn, ein alter Jäger in speckiger Kamlejka aus Wachstuch, die er nicht mal im Kino ablegte, obwohl er dort starken Trangeruch verbreitete.
Unterm Schutz der Nacht vollzogen die betagten Walfänger ein altes, halbvergessenes Ritual, das jedoch, wie sie meinten, unentbehrlich war, um sich selbst wenigstens etwas aufzurichten, den fast verlorenen Stolz und die Selbstachtung wiederzugewinnen, auf die Menschen das Recht haben, die einstmals mit den größten Meeresbewohnern kämpften.
Unna stand in einiger Entfernung und sah schweigend zu. Sie wusste von den Lehrern, dass dies Hokuspokus war, ein Relikt der Urgesellschaft. Dennoch fühlte sie eine innere Unruhe, seltsame Erregung stieg aus den geheimsten Winkeln ihres Herzens, eine sonderbare Melodie ging ihr lange nicht aus dem Kopf, in den Ohren widerhallten ihr unbekannte Worte mit dunklem Sinn, lange fand sie mit wild klopfendem Herzen keinen Schlaf.
Je mehr sich Unna Owto von der Rückständigkeit jenes Lebens überzeugte, das ihr noch vor Kurzem wunderschön und als das einzig annehmbare erschienen war, empfand sie nun zunehmend nur Mitleid mit ihren Anverwandten. Doch nicht nur das, allmählich wuchs in ihr eine Verachtung für diejenigen, die noch immer in Dunkel und Unwissenheit dahinvegetierten. Anfangs kämpfte sie gegen dieses Gefühl an, schämte sich seiner, dann aber gewöhnte sie sich daran, und sogar die seltenen Besuche des Vaters wurden ihr peinlich. Es war ihr unangenehm zu sehen, wie er – mit einer über die Fell-Kuchljanka gezogenen rosa Kamlejka, einer Ohrenklappenfellmütze, in die oben auch noch ein Loch geschnitten war, schütterem Bart und spärlichen Schnurrbartborsten, seinem von tiefen Schrammen durchfurchten Gesicht – sie einschmeichelnd anblickte, ihr in die Augen schaute und versuchte, ihr Leckereien aus der Tundra zuzustecken: Stücke von Prerema – einer Rentierwurst mit daran klebenden weißen Rentierhaaren –, gedörrtes, geräuchertes, von grau gewordenen Fettadern durchzogenes Fleisch, was sie dann ohnehin alles den Hunden vorwerfen musste; und sie wartete voller Ungeduld, wann dieses beklemmende, sich in die Länge ziehende Wiedersehen zu Ende sein würde.
Wie erleichtert war sie, wenn der Vater gegangen war!
Es ergab sich von selbst, dass Unna aufhörte, im Sommer in die Tundra zu fahren. Sie verbrachte ihre Ferien in der Gegend von Magadan, wo richtige hohe Bäume wuchsen – Birken mit Stämmen, die aussahen, als wären sie mit weißen Papierstreifen umwunden.
Noch eine andere Reise hatte sich ihr eingeprägt: in den fernöstlichen Süden, an ein warmes Meer, in dem man baden konnte.
Zum ersten Malsah Unna Owto eine richtige große Stadt mit hohen, mehrstöckigen Häusern und Straßen voller Autos, Straßenbahnen und Trolleybussen. Eine glatte Asphaltstraße lief am freundlichen Meer entlang – auf der einen Seite warmes Wasser, auf der anderen dichter grüner Wald, den zu betreten man sich nicht traute.
Unna Owto war die Älteste in ihrer Gruppe und achtete darauf, dass die Kinder sich ordentlich benahmen, Tschukotka keine Schande machten.
Alles wäre gut gegangen, wäre da nicht Awgust Shirindan gewesen, ein lebhafter, neugieriger und ausgelassener Junge von der Nordküste. Trotz seines russischen Vornamens und des sonderbar klingenden Familiennamens war er ein rein blutiger Tschuktsche und beherrschte im Unterschied zu Unna seine Muttersprache vorzüglich. Die Erzieherin hatte Unna ermahnt, ihn besonders im Auge zu behalten.
Seinen Vornamen hatte er bekommen, weil er am ersten August das Licht der Welt erblickt hatte. Der klangvolle Familienname Shirindan aber gründete sich auf seinen tschuktschischen Spitznamen Ryryntat, was soviel heißt wie »einer mit Haaren auf den Zähnen«. Als Shirindan hatte ihn der Direktor Mitrochin eingetragen, der die tschuktschischen Laute auf seine Weise wahrnahm. So machte er aus dem Vornamen Tschypyn, das heißt Taucher, den russischen Familiennamen Schipin, und aus Rotschgynto, wörtlich: dem vom anderen Ufer, schuf er den typisch ukrainischen Familiennamen Rostschenko.
Mit dem Namen von Unna Owto war es übrigens auch nicht glatt gegangen. In der Geburtsurkunde stand eindeutig: Unna Owtowna Owto, aber Mitrochin fand das unüblich, wollte Unna, den Namen des Mädchens, durch Anna ersetzen. Doch diesmal hatte sich die Vorsitzende des Sowjets, Larissa Munikan, widersetzt: Es blieb bei dem Namen, den die Eltern gewählt hatten: Unna, die Tundrabeere.
Die Pracht der blühenden grünen Welt überwältigte Awgust; den Mund vor Verwunderung weit aufgerissen, sah er sich um.
»Mach den Mund zu!« schrie ihn Unna an.
»Ich habe doch so was noch nie gesehen! Sogar der Film oder der Farbfernseher können das nicht wiedergeben … Wie die Leute leben! Nicht zu vergleichen mit unserem unwirtlichen Neschkan!«
Am glücklichsten war Unna, wenn sie im Pionierlager zu den Klängen einer richtigen Blaskapelle marschieren konnte, auf der Tribüne stand und vor Ehrengästen und der Lagerleitung salutieren durfte. Das war ein echtes Fest, und wenn die ununterbrochene Musik, die feierlichen Reden zu Ende gingen, schnürte es ihr das Herz zu vor Bedauern.
Während die Kinder in Anadyr auf das Flugzeug für die Heimreise warteten, führte man sie in das Heimatkundemuseum, wo im ersten Stock auf künstlichen Felsen aus gefärbter Pappe abgeschabte Vertreter von Tschukotkas Tierwelt zu sehen waren. Ein mächtiges Rentier stand da mit haarendem Fell, obwohl die Rentiere zu dieser Jahreszeit, wie Unna sich dunkel erinnerte, das kräftigste Fell hatten. Hinter dem Ren stand ein Schneehammel mit Glasaugen und davor auf krummen Beinen ein grauweißer Polarfuchs und ein staubig wirkender Hase, nur die Lemminge auf dem bräunlichen Watteschnee sahen lebendig aus.
In der historischen Abteilung betrachteten die Kinder mit stockendem Herzen die Reliquien des ersten Revolutionskomitees auf Tschukotka. Erst kürzlich hatte man entdeckt, als die Überreste der ersten Revolutionäre des Nordens auf Tschukotka umgebettet werden sollten, dass die Körper der erschossenen Mitglieder des Revolutionskomitees im ewigen Eis des Massengrabs noch nicht verwest waren. Und hier lagen nun die Überreste.
August Shirindan lief in die zweite Etage, und als er zurückkam, zog er mit rätselhafter Miene Unna mit.
»Du wirst gleich staunen!« rief er viel sagend.
In einem kleinen Saal hing an der Wand eine anschauliche grafische Darstellung, die zeigte, wie sich der Mensch auf Erden entwickelt hatte. Den Anfang bildete eine Reihe von Figuren in gebückter Haltung, tief gebeugt stand da ein behaarter menschenähnlicher Affe, von Zeichnung zu Zeichnung aber verwandelte er sich in ein Ebenbild des heutigen Menschen. Am Ende der Reihe prangte ein hoch gewachsener blonder Europäer mit ausgeprägter Muskulatur und prachtvollen weißen Zähnen.
Awgust führte Unna zu dem Diagramm und sagte leise, fast geheimnisvoll: »Siehst du?«
»Na und?« fragte Unna verwundert.
»Sie stammen vom Affen ab!«
»Wer?«
»Die Engländer!« verkündete Awgust feierlich. »Ich habe davon schon früher gehört, jetzt aber sehe ich es selber.«
Unna betrachtete das Diagramm genauer: Ja, es zeigte sehr überzeugend, wie sich mit der Zeit der Vorfahr des Menschen verändert und er sich allmählich vom Affen zu seinem heutigen Aussehen gewandelt hatte.
»Warum ausgerechnet die Engländer?« fragte Unna.
»Bei denen gab es einen Gelehrten namens Charles Darwin«, teilte ihr Awgust mit. »Ich habe über ihn gelesen. Er hat diese wissenschaftliche Entdeckung gemacht.«
»Stammen nur die Engländer vom Affen ab?« fragte Unna neugierig.
»Ich glaube, nicht nur sie, sondern alle Tangitanen, alle Fremdländischen«, meinte Awgust.
»Und wir?«
»Wir – das ist was ganz anderes«, erwiderte Awgust. »Ich habe von meiner Großmutter die Legende gehört, dass wir, die am Meer leben, von der Wal-Urmutter abstammen.«
»Und die Leute aus der Tundra wie ich?« fragte Unna verwundert.
Awgust überlegte. »Sicherlich stammen die Luorawetljane, die Tschuktschen aus der Tundra, auch von den Walen ab«, meinte er nicht sehr überzeugt.
Unna betrachtete noch einmal, diesmal aber sehr aufmerksam, das bunte Diagramm. Ja, wirklich, aus ihm ging hervor, dass die Engländer und die anderen Tangitane von diesen unförmigen behaarten Wesen abstammten, die an die legendären, zottigen unglücklichen Teryky erinnerten – zottige, unglückliche Wesen, die auf einer driftenden Eisscholle ins Meer hinausgetragen wurden und fern von den Menschen verwilderten. Wenn aber ihre Vorfahren, wie Awgust sagte, von Walen abstammten, von wem stammten dann die Schwarzen und die anderen Völker ab? Zugleich fühlte sich Unna den Engländern und anderen Menschen, die ihre Herkunft nicht von Walen ableiteten, in gewisser Weise überlegen und empfand sogar Stolz gegenüber der russischen Lehrerin und Erzieherin, die sie auf der Reise begleitete.
3
Im Internat war es ziemlich leer – die meisten seiner Bewohner waren noch nicht aus den Ferien zurück. Unna erinnerte sich an den Besuch des Anadyrer Museums. Inzwischen schon gut mit der Evolutionslehre des großen englischen Naturforschers Charles Darwin vertraut, musste sie innerlich schmunzeln, aber manchmal überlegte sie doch, dass es in der Tat gar nicht so übel wäre, Nachfahre eines so großartigen und mächtigen Tieres wie des Wals zu sein.
Unna Owto hatte sich geweigert, nach Hause in die Nomadensiedlung zu fahren, denn sie stellte sich vor, wie sie wohl nach dem sommerlichen Pionierfest und im weißen Pionierhemd dort in der Tundra in den verräucherten, halbdunklen Tschottagin ihrer Jaranga treten, im Fell-Polog mit den kratzigen Rentierhaaren schlafen würde und sich morgens weder ordentlich waschen noch duschen könnte. Und das Essen … nichts als Renfleisch, oft nicht mal frisch, oder blutiger grünlicher Brei aus dem Mageninhalt eines Rens. Am schlimmsten aber war, dass sie mit niemandem reden könnte. Die Mutter schwieg ständig, und auch der Vater war nicht gerade redselig. Das Tschuktschische hatte sie obendrein fast verlernt, sie musste ihr Gedächtnis schon sehr anstrengen, wenn es sich mal ergab, dass sie in ihrer Muttersprache reden musste. Dafür erntete sie viel Lob von den Lehrern: »Du sprichst ja wie eine echte Russin!«
Gern betrachtete Unna ihr Gesicht im Spiegel. Jemand hatte einmal gesagt, sie sehe gar nicht wie eine Tschuktschin aus. Das hatte sie aus irgendeinem Grund erregt, und sie hatte begonnen, sich aufmerksam zu betrachten. Die Augen schienen nicht schmal zu sein, eher ziemlich groß, jedenfalls größer als bei vielen Stammesgefährten. Auch die Wangenknochen standen nicht so hervor. Die Haare zeigten einen braunen Schimmer. Nur auf der linken Wange, über dem Mund, war ein kleiner blauer Kreis. Viele hielten das für ein Muttermal, aber Unna wusste, es war ein heiliges Zeichen, das der Vater eintätowiert hatte, als sie noch ganz klein war. Schon des Öfteren hatte Unna versucht, es loszuwerden, sie hatte das Fleckchen gerieben, bis es blutete, aber die Wunde verheilte, und das Fleckchen zeichnete sich wieder auf ihrer rundlichen Wange ab, ärgerte sie.
Es regnete, Unna las in ihrem Zimmer, als sie hörte, wie jemand die Tür öffnete.
Erst auf den zweiten Blick erkannte sie den Vater in der durchnässten Kamlejka aus Wachstuch. Sein Gesicht war feucht vom Regen. Er schluchzte und sagte: »Deine Mama ist durch die Wolken dahingegangen.«
Unna brauchte eine Weile, um den Sinn von Vaters Worten zu verstehen, aber dann füllten sich ihre Augen unwillkürlich mit Tränen, sie begann laut zu weinen und zitterte am ganzen mageren Körper. Plötzlich hatte sie mit erbarmungsloser Klarheit erfasst, dass sie die Mutter nie wieder sehen, ihre Stimme nie wieder hören, aber auch nicht wieder ihre wundersamen Hände auf sich spüren würde – ihre schwieligen, von schwerer Arbeit und Kälte verkrümmten Finger, die unendlich weiche Wärme ausströmten.
»Jetzt sind wir beide allein auf der ganzen Welt«, sagte Owto schluchzend und drückte das Mädchen an sich.
Diesmal stieß Unna den Vater nicht zurück, obwohl er nicht nur den unangenehmen Geruch der Tundra-Jaranga ausströmte, sondern auch nach Alkohol roch.
Sie saßen eine Weile beisammen und weinten, dann ging der Vater schwankend hinaus in den Regen.
In dieser Nacht fand Unna lange keinen Schlaf in dem leeren, mit kahlen Betten vollgestellten Internatszimmer.
Erinnerungen an die Jaranga vermischten sich mit den unvergesslichen Eindrücken von der Reise ins Pionierlager. Wie arm war doch das eigene Leben, verglichen mit dem hellen Leben im milden Klima, am warmen Meer, das nur wenige Flugstunden von der trostlosen, kalten und armen Heimat entfernt toste und funkelte. Die Menschen da waren schön, gut angezogen, fröhlich und lächelten. An das Pionierlager grenzten Erholungsheime, und eine festlich gekleidete Menge bevölkerte nicht nur die Sandstrände der Pazifikküste, sondern auch alle elektrischen Bahnen, die Läden, Restaurants und Bierhallen. Sogar die betrunkenen Urlauber unterschieden sich von Unnas betrunkenen Landsleuten. Sie sangen laut, lachten, suchten Gesellschaft und benahmen sich ganz anders als die vergrämten Rentierzüchter, die sich bis zur Bewusstlosigkeit betranken, sich dann in Gräben, Hinterhöfen und Müllgruben wälzten, von Passanten geschlagen und ausgeraubt wurden, erfroren, unendlich jämmerliche Wesen, die ihre menschliche Würde verloren hatten.
Unna spürte, wie in ihrem kleinen Herzen unüberwindliche Abneigung gegen dieses Leben wuchs. Sie wollte weg vom Geruch der Tundra-Jaranga, aber auch diese Sprache nicht mehr hören, die ihr schon wie ein Strom misstönender Verbindungen mit vielen schwer aussprechbaren, gurgelnden Lauten vorkam.
Als sie einmal spätabends an ihrem Lieblingsort spazieren ging, wo die von Wind, trockenem Winterschnee und Regen glattpolierten und gebleichten Walknochen lagen, nahm sie zuerst den charakteristischen Geruch von verbranntem Papier wahr und entdeckte schließlich ein flackerndes Feuer, neben dem der Internatsdirektor Mitrochin stand und mit einer langen Eisenstange in der Asche stocherte. Ihm half die einheimische Lehrerin Valentina Petrowna. Einem großen Haufen entnahm sie Bücher, riss Seiten heraus – offenbar, weil sie dann besser brannten – und reichte sie dem Direktor.
»Ja, Makulatur hat sich gerade genug angesammelt«, meinte Mitrochin und warf erneut ein Buch ins Feuer.
»Oh!« rief plötzlich Valentina Petrowna. »Das ist doch die Fibel, mit der ich lesen lernte! Darf ich sie behalten?«
»Aber ja, natürlich!« sagte Mitrochin gnädig.
»Und das sind die Märchen der ›Tschautschu‹, der Rentierleute. Das erste Buch, das ich gelesen habe. Von der ersten Seite bis zur letzten … Darf ich auch das nehmen?«
»Nimm es nur.«
»Und schon wieder das Kenmu-Gesetz.« Valentina Petrowna zog einen kleinen Band in festem Stoffeinband aus dem Haufen.
»Wieder die Verfassung!« rief Mitrochin verärgert. »Davon haben sie viele gedruckt … Und sie brennt schlecht.«
»Ein Band Gedichte von Këulkut … Auch dieses Buch nehme ich mir.«
Unna kam näher ans Feuer. Das Schauspiel hatte etwas Entsetzliches an sich. Nicht zufällig haben Mitrochin und Valentina Petrowna einen so abgelegenen Ort gewählt, dachte sie. Es war unschwer zu erraten, dass hier Bücher aus der Schulbibliothek in tschuktschischer und in Eskimosprache ins Feuer geworfen wurden. Es waren ziemlich viele, darunter sogar Ausgaben in lateinischer Schrift, offenbar die ersten Bücher in ihrer Muttersprache, die in Leningrad ganz zu Beginn der Einführung einer Schrift für Tschuktschen und Eskimos herausgegeben worden waren.
Schwarzer Rauch stieg auf, trieb dann, heruntergedrückt von einer feuchten, tiefhängenden Wolke, über die Erde, heftete sich an die weißen Walknochen, breitete sich dann über dem nahen Meerwasser aus, der nassen Tundra mit den von kalter Feuchtigkeit durchtränkten Mooshügeln.
Plötzlich spürte Unna eine Kälte, die tief aus ihrem Innern stieg, so als wäre wie durch ein Wunder ein Splitter von blauem Flusseismitten in ihr Herz geraten. Das Mädchen fröstelte, obwohl vom Feuer mit fettem schwarzem Ruß auch Hitze zu ihr strömte. Graue Flocken von Papierasche fielen auf die feuchten, glänzenden Kiesel, auf die stillen dunklen Meereswogen.
Mitrochin und Valentina Petrowna unterhielten sich sachlich, sprachen über ein jüngstes Opfer der politischen Reform. Zu Füßen der Lehrerin lagen verloren einige vor dem Feuer gerettete Bücher.
Eine Weile noch trat Unna von einem Fuß auf den andern, dann raffte sie sich auf, machte unbemerkt kehrt und schlenderte ziellos an den zu Anfang der fünfziger Jahre gebauten Häusern entlang.
Hier und da lagen auf dem nassen Geröll neben Baracken Hunde. Sie bellten nicht, knurrten nicht, saßen an Pfähle gebunden da und folgten mit den Augen verloren dem freien Wesen. In den Tschuktschensiedlungen ließ man die Hunde im Sommer gewöhnlich frei, schenkte ihnen nicht nur Freiheit und Erholung nach dem schweren Joch, das sie im Winter als Zugtiere zu tragen hatten, sondern gab ihnen auch die Möglichkeit, sich selbst mit Nahrung zu versorgen.
Der Geruch von angebranntem Papier verfolgte Unna bis zur Tür des Internats.
Im geschlossenen Speiseraum standen auf einem mit Wachstuch gedeckten Tisch ein kaltes Abendessen und eine große chinesische Thermoskanne mit heißem Tee. Unna wusch sich die Hände, setzte sich an den Tisch und schraubte die Thermoskanne auf.
Die Tür knarrte, und in den Essraumtrat Awgust Shirindan. Er wirkte still und gesammelt, was für ihn ganz ungewöhnlich war.
»Du bist nicht nach Hause gefahren?« fragte Unna.
»Ich war schon zu Hause«, sagte Awgust leise.
»Und warum bist du zurückgekommen?«
»Zu Hause ist es schlecht.« Awgust schniefte und schmierte sich Butter aufs Brot. »Sie schießen.«
»Warum schießen sie?« fragte Unna verwundert.
»Papa hat seinen Bruder erschossen«, antwortete Awgust ruhig. »Hat sich betrunken, ist total durchgedreht, hat die Schrotbüchse genommen und den Bruder erschossen.«
»Und was wird jetzt mit ihm?« fragte Unna entsetzt.
»Es heißt, man wird ihn verurteilen und auch erschießen«, erklärte Awgust sachlich, offensichtlich, ohne sich über die Tragik des Geschehens im Klaren zu sein. »Es gibt ein Gesetz. Wenn einer jemanden tötet, wird auch er getötet.«
»Und bei mir ist die Mutter gestorben«, teilte ihm Unna mit.
»Hat man sie auch getötet?«
»Nein, sie ist von allein gestorben«, sagte Unna, Trauer in der Stimme. »Vater ist gekommen, hat es gesagt. Er meint, sie sei lange krank gewesen, habe Blut gehustet.«
»Bei uns im Dorf husten viele Blut«, sagte Awgust. »Die werden auch in Gefangenschaft geschickt. Nur heißt das nicht Gefängnis, sondern Hospital. Die Krankheit aber heißt Perdikulose.«
»Tuberkulose«, verbesserte Unna.
Lange saßen sie noch im leeren Essraum, zwei kleine Menschen in Erwartung einer herrlichen Zukunft.
Unna dachte stets daran und war überzeugt, dass alles, was die Lehrer taten, was sie lehrten, sie diesem Ziel näher brachte.
»Ich habe gesehen, wie Bücher verbrannt wurden …«
»Ich habe es auch gesehen«, erklärte Awgust. »Das ist, weil im Kommunismus die Tschuktschensprache nicht mehr gebraucht wird.«
»Ich habe sie schon fast vergessen.«
»Ich kann meine Sprache nicht vergessen«, sagte Awgust, Bitternis in der Stimme. »Der Lehrer schimpft dauernd mit mir, weil ich nicht richtig Russisch spreche.«
»Du musst mehr lesen«, sagte Unna altklug. »Vor allem Gedichte. Lern sie auswendig.«
»Vielleicht mache ich das auch«, versprach Awgust.
In den Speisesaal kam die Erzieherin Jelisaweta Markowna, eine große weiße, teigige Frau. Die größeren Kinder nannten sie hinter ihrem Rücken »Makkaronina«. Ihre ältere Schwester war Vorsitzende der hiesigen Abteilung des Sowchos.
»Zeit fürs Bett!« sagte die »Makkaronina« streng.
Die Kinder beeilten sich, denn sie wussten, von ihr war nichts Gutes zu erwarten. Gelegentlich konnte sie einem sogar eine solche Kopfnussgeben, dass man danach noch lange Schmerzen hatte. Manchmal quälte Unna die Frage: Woher kommen wohl so böse Menschen? Oder sind sie nur bei der Arbeit böse, im Internat, im Geschäft hinterm Ladentisch, im Sowchosbüro … Und wenn sie nach Hause kommen, werden sie zu normalen Leuten, sprechen normal mit ihren Männern, Kindern und Verwandten. Die »Makkaronina« konnte man sich freilich kaum freundlich und lächelnd vorstellen.
4
Nach Neujahr und den Winterferien, die sie auch hier, in der Großen Siedlung, verbracht hatte, erhielt Unna Owto einen Personalausweis.
Es war schon Abend, als sie mit dem neuen Ausweis das Milizgebäude verließ. Im tiefen, rötlichen Schein der Wintersonne funkelte auf den Bergkuppen ringsum blutroter Schnee. Die im Eis der Bucht festgefrorenen Schiffe »Leuchtturm« und »Wega« weckten mit ihren vereisten Aufbauten romantische Gefühle. Unna stieg aufs Eis hinunter, überzeugte sich, dass niemand sie sah und hörte, und rezitierte – an die funkelnden Bergkuppen und an das offene Meer hinter dem kilometerweiten Festeis gewandt – laut Majakowskis Verse vom Sowjetpass. Das Vorgefühl von einer noch rätselhaften, aber viel versprechenden Zukunft bewegte sie, nahm ihr den Atem. Nachdem sie eine Weile einsam übers Eis der Bucht gegangen war, stieg sie am Ufer der Landzunge hoch. Dann ging sie am Laden »Delfin« vorüber und langsam wieder hinunter.
Beim Laden »Schneeflocke« erblickte Unna einen Geländewagen der Miliz. Zwei kräftige Milizionäre stießen einen betrunkenen Tschuktschen in den Wagen, der aber brüllte über die ganze Straße:
Mainy – ten – memlyetschgyt
Ynky nutek any kole!
Sie stießen den armen Kerl in den Dienstwagen, der Motor heulte auf, und die Milizionäre kletterten in die Kabine. Aber noch lange hörte Unna durch den Lärm des davonfahrenden Autos die Stimme des starrsinnigen, betrunkenen Landsmanns.
Kann man denn solche Menschen lieben oder Mitleid mit ihnen haben? Das ist doch peinlich. Und statt Mitgefühl entsteht der Wunsch, wegzugehen, wegzulaufen, um nur nicht einen schmutzigen, betrunkenen oder vor einem Milizionär oder sonstigen untergeordneten Beamten scharwenzelnden, eingeschüchterten und verängstigten Tschuktschen hören und sehen zu müssen.
Unna ging auf die andere Straßenseite und eilte ins Internat.
Ihr Zimmer lag im Erdgeschoss, abseits nicht nur von den anderen Schlafräumen, sondern auch vom Dienst habenden Pförtner. Daher pflegte Jelenas Grenzsoldat Gluchich unbesorgt ins Zimmer der Mädchen zu kommen. Auch diesmal war er zu Besuch, und nach dem zerknautschten Bett zu urteilen, das Jelena hastig in Ordnung zu bringen suchte, während der Grenzer langsam die Tür öffnete, hatten sie, wie es in Büchern heißt, »Liebe gemacht«.
Jelena entschuldigte sich stotternd bei Unna.
»Du musst nicht denken … musst nicht denken, was du jetzt denkst …«
Schweigend, aber mit ihrer ganzen Haltung zeigte Unna, dass sie mit alldem höchst unzufrieden sei; sie setzte sich auf ihr Bett und ließ demonstrativ den Grenzer nicht aus den Augen, bis der sich eilig angezogen, die vielen Knöpfe zugeknöpft und das Koppel festgeschnallt hatte. Jelena wollte schon mit ihm hinausgehen, aber Unna verbot es ihr in herrischem Ton: »Bleib hier!«
Gehorsam kehrte Jelena zu ihrem Bett zurück und zog sich langsam den Mantel aus. Böse, mit zusammengekniffenen Augen, sah sie Unna an und flüsterte plötzlich mit hassverzerrtem Gesicht: »Uuuh! Du Speichelleckerin, du miese Karrieristin! Denkst du wohl, es sieht niemand, wie du in Wirklichkeit bist? Du bist nicht stolz, sondern gemein, du bist nicht höflich, sondern duckmäuserisch, und deine Prinzipienfestigkeit ist eine Maske! Jawohl!«