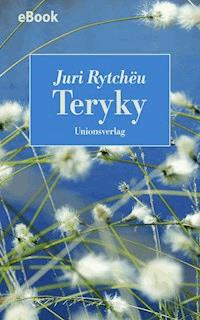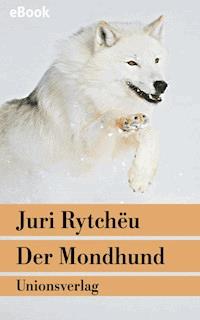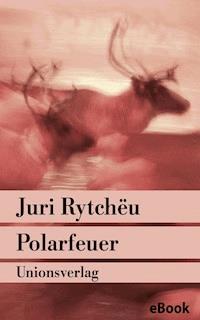
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Kanadier John MacLennan hat sich für ein Leben bei den Tschuktschen entschieden. Eine Schamanin hat ihm nach einem Unfall das Leben gerettet, seither hat er diese uralte Kultur kennen- und lieben gelernt. Aber die »Zivilisation«, die er hinter sich gelassen hat, um eine erfüllte Zukunft bei den Tschuktschen zu finden, holt ihn ganz unerwartet wieder ein: Der äußerste Osten Sibiriens wird von den Umwälzungen der Russischen Revolution erfasst. John McLennan gerät in den Strudel der Weltgeschichte, sein Lebensglück steht auf dem Spiel. In der Sowjetunion konnte Polarfeuer nur zensiert erscheinen. Für die deutsche Übersetzung hat Juri Rytchëu nun die ursprüngliche Fassung wieder hergestellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 484
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
Der Kanadier John MacLennan hat sich für ein Leben bei den Tschuktschen entschieden. Aber die »Zivilisation«, die er hinter sich gelassen hat, holt ihn ganz unerwartet wieder ein. John McLennan gerät in den Strudel der Weltgeschichte, sein Lebensglück steht auf dem Spiel.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Juri Rytchëu (1930–2008) wuchs als Sohn eines Jägers in der Siedlung Uëlen auf der Tschuktschenhalbinsel im Nordosten Sibiriens auf und war der erste Schriftsteller dieses nur zwölftausend Menschen zählenden Volkes. Mit seinen Romanen und Erzählungen wurde er zum Zeugen einer bedrohten Kultur.
Zur Webseite von Juri Rytchëu.
Antje Leetz (*1947) war Lektorin für neue russische Literatur im Verlag Volk und Welt Berlin und Redakteurin in einem Verlag in Moskau. Sie als Herausgeberin, Übersetzerin und als Autorin von Radiofeatures zum Thema Russland tätig.
Zur Webseite von Antje Leetz.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Juri Rytchëu
Polarfeuer
Roman
Aus dem Russischen von Antje Leetz
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 3 Dokumente
Die Originalausgabe erschien 1971 unter dem Titel Inej na poroge in Moskau.
Sie wurde vom Autor für diese Ausgabe vollständig anhand des ursprünglichen Manuskripts überarbeitet.
Die Übersetzung wurde gefördert vom Literarischen Colloquium Berlin mit Mitteln der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia.
Die Übersetzerin dankt dem Deutschen Übersetzerfonds e.V. für die Unterstützung.
Originaltitel: Inej na poroge (1971)
© by Juri Rytchëu 1971
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30448-2
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 26.07.2024, 18:30h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
POLARFEUER
Vorwort1 – »Ich bin Amundsen!«, stellte sich der hochgewachsene Mann …2 – John beschloss, zum Kap Onman zu fahren …3 – Die vier Jarangas standen mit dem Gesicht zum …4 – In Enmyn ging das Leben seinen Gang …5 – Nichts ist bitterer, als in der dunklen Winterzeit …6 – Die Entenjagd ging in diesem Frühling mit großem …7 – Zum ersten Mal entfernte sich Jako so weit …8 – In dem kleinen Kontor befanden sich außer Tegrynkëu …9 – Für den Ausgang von John MacLennans und Tegrynkëus …10 – John schickte sich an, die Jaranga mit neuem …11 – Die Lagune war zugefroren, das Meer aber noch …12 – Krawtschenko sagte es John direkt ins Gesicht:»Seien Sie …13 – Jako brachte Neuigkeiten. Eine Zusammenkunft hatte stattgefunden …14 – Die Jagdausrüstung, die Anton Krawtschenko bekam, hatte einst …15 – Obwohl die Menschen vom Hunger geschwächt waren …16 – Das Badehaus hatten sie in der Nähe der …17 – So lebten John und Armagirgin und die Frauen …18 – Bei der Fahrt nach Enmyn saß John auf …19 – Tynarachtyna, Orwos Tochter und Notawjes Braut, gab ihrem …20 – »Willst du uns zur Hochzeit einladen?«, fragte John …21 – Das Eis war aufgebrochen. Die kleinen Boote schaukelten …22 – Beunruhigende Nachrichten drangen nach Enmyn. Sie kamen aus …23 – Jedesmal wenn John den Motor reparierte, der immer …24 – Sie schleppten die Schaluppe zur Landzunge, auf die …25 – John musste alle abgeladenen Waren in Empfang nehmen …26 – Als die langen Tage kamen, wurde das Leben …27 – Im Hochsommer drängte es Krawtschenko plötzlich, in Ilmotschs …28 – Orwo wurde nach neuem Brauch beerdigt …WorterklärungenMehr über dieses Buch
Über Juri Rytchëu
Juri Rytchëu: Der stille Genozid
Eveline Passet: Juri Rytchëu – Literatur aus dem hohen Norden
Leonhard Kossuth: Wo der Globus zur Realität wird
Über Antje Leetz
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Juri Rytchëu
Zum Thema Arktis
Zum Thema Russland
Zum Thema Abenteuer
Vorwort
Polarfeuer ist die Fortsetzung des Romans Traum im Polarnebel, der von den Abenteuern des jungen kanadischen Seemanns John MacLennan erzählt. John MacLennan, der seiner Natur nach ein Romantiker war, gehörte zur Mannschaft des Walfischfängers Belinda, der im September 1910 am Kap Enmyn, am Nordufer der Tschukotka-Halbinsel, vom Eis eingeschlossen wurde. Die Seeleute versuchten das Eis, das das kleine Schiff einzwängte, mit Dynamit zu sprengen. Durch eine unvorhergesehene Explosion wurden John MacLennan beide Hände zerfetzt. Die Tschuktschen erklärten sich bereit, den Verwundeten in ein Krankenhaus, Hunderte Meilen entfernt in der Kreisstadt Anadyr, zu bringen. Unterwegs bekam John MacLennan Wundbrand. In einem Nomadenlager in der Tundra operierte ihn eine Schamanin und rettete so dem jungen Kanadier das Leben. John MacLennan kehrte an die Küste von Enmyn zurück, aber die Belinda war bereits weggefahren, obwohl der Kapitän versprochen hatte, auf John zu warten. Erschüttert von dem Verrat seiner Landsleute beschloss John MacLennan, in Enmyn zu bleiben. Er zog in die Jaranga eines jungen Tschuktschen, der ihm das Jagen beibrachte und die Menschenwürde zurückgab. Aber ein Unglück geschieht: Unbeabsichtigt tötet John seinen neuen Freund. Wie es der Brauch will, heiratet er die junge Witwe Pylmau und beschließt, für immer bei den Tschuktschen zu bleiben, die ihm lieb und teuer geworden sind. Nicht einmal seine Mutter, die eigens angereist kam und ihn anflehte, doch in die Heimat, zu dem gewohnten Leben der Weißen zurückzukehren, kann ihn umstimmen. Bevor sie nach Kanada zurückfährt, sagt sie ihm: »Lieber sehe ich dich tot als so.«
Dem Roman Polarfeuer war, obwohl kurz nach Traum im Polarnebel erschienen, ein schweres Schicksal beschieden. Unter der sowjetischen Zensur musste ich einige Stellen umschreiben und, was das Schlimmste war, das Ende des Romans streichen …
Der vorliegende Text ist die erste vollständige, unverfälschte Fassung.
Juri Rytchëu
März 2000
1
»Ich bin Amundsen!«, stellte sich der hochgewachsene Mann vor, als er den Tschottagin betrat. Er war über und über mit Schnee bedeckt. Das Gesicht wirkte schwarz im Kontrast zu dem weiß gefrorenen Schnurrbart, den bereiften Brauen und dem weißen Wolfspelz.
»Kommen Sie rein!«, sagte John leise, verblüfft über diese sonderbare Begegnung.
Langsam tauchten in seiner Erinnerung die vor langer Zeit gelesenen Zeitungsberichte auf, in denen der Name des mutigen Norwegers, der als Erster die Nordwestpassage bezwang, genannt wurde. Auf den Fotos hatte Amundsen damals einen Eskimoparka getragen und Schneeschuhe in den Händen gehalten. Aber er war auch in einem strengen schwarzen Gehrock mit zwei Knopfreihen abgebildet gewesen.
Das war er also, Vilhjálmur Stefánssons glücklicher Rivale! Das war der Mensch, von dem die ganze Welt sprach!
Amundsen ging vorsichtig tiefer in den Tschottagin hinein und schaute sich neugierig um. Seine gerade und große Nase wies den Augen den Weg. Die Lippen, auf die vom Schnurrbart tauende Eisstückchen herabfielen, zitterten.
»Ich freue mich, Sie bei mir begrüßen zu können«, murmelte John.
Pylmau sah ihren Mann beunruhigt an. Sie erkannte ihn nicht wieder. Niemals, bei keinem einzigen weißen Menschen, war John so verstört gewesen. Als ob der märchenhafte russische Zar selbst gekommen wäre, den sie, so erzählte man, von seinem hohen goldenen Thron gestoßen hatten.
Amundsen schlug die Kapuze des Parkas zurück, wischte mit der Hand den restlichen Raureif von Schnurrbart und Brauen und lachte breit, wobei er die Zähne entblößte, die so groß und weiß waren wie bei einem jungen Walross.
»Ich freue mich ebenfalls, Sie kennenzulernen«, sagte er. »Ich habe von Ihnen in der Zeitschrift National Geographic gelesen. Ehrlich gesagt, habe ich an Ihre Odyssee nicht geglaubt. Ich dachte, das sei wieder einmal so eine schöngefärbte Legende aus dem hohen Norden … Übrigens, ich habe Ihnen eine Nummer mitgebracht.« Amundsen reichte John die Zeitschrift. »Aber ich bin sehr froh, dass ich mich geirrt habe. Ich entschuldige mich nicht, dass ich hier so überraschend reingeplatzt bin. Als echter Nordländer werden Sie mir Ihre Gastfreundschaft nicht verwehren, denke ich.«
»Natürlich nicht«, rief John, der sich noch nicht von seiner Verlegenheit und Verwirrung erholt hatte. »Fühlen Sie sich wie zu Hause!«
John rief Pylmau leise zu sich und bat sie, dem Gast ein Bett aus Eisbärfell herzurichten.
Amundsen zog seine Oberbekleidung aus und klopfte sorgfältig den Schnee ab, wobei er geschickt das dafür vorgesehene Rentiergeweih benutzte. Dann kroch er in den Polog. Er nahm fast die ganze Länge vom Fellvorhang bis zur Tranlampe ein.
John bat Pylmau, das Kämmerchen herzurichten, in dem zuletzt Bob Carpenter gewohnt hatte, und kroch ebenfalls in den Polog. Er fühlte eine eigenartige Neugier, gemischt mit Begeisterung und einer gewissen Scheu, in sich aufsteigen.
In der Ecke, unter dem schwarzen Holzgesicht des Gottes, saß Jako, er umarmte seine kleinen Geschwister und schaute mit Wolfsaugen auf den unerwarteten Gast.
»Keine Angst«, beruhigte John die Kinder, die drauf und dran waren loszuheulen, »unser Gast ist ein guter Mensch.«
Amundsen reichte den Kindern Bonbons. Als der mutigste erwies sich Bill-Toko, der sofort nach dem glänzenden Papier griff und sich damit den verurteilenden Blick des großen Bruders einhandelte.
John bat den Gast noch einmal, es sich bequem zu machen, und trat hinaus in den Tschottagin, um seiner Frau zu helfen.
»Wer ist das?« Pylmau deutete mit dem Kopf zum Fellvorhang.
»Das ist Amundsen!«, sagte John mit ehrfurchtsvoller Stimme. »Du kannst dir nur schwer vorstellen, was das für ein Mensch ist!«
Pylmau kniff die Augen ein wenig zusammen und warf ihrem Mann einen unbehaglichen Blick zu, ganz seltsam war er geworden in seiner übermäßigen Aufgeregtheit und Geschäftigkeit.
Schweigend holte er ein unzerteiltes Stück Robbenfleisch aus dem Fass und schnitt ein Stück vom Rentierspeck ab, der an der Decke hing. Pylmau entfachte im Tschottagin ein so großes Feuer, dass sich die Hunde, die zusammengeringelt dalagen, streckten und aus ihrem süßen Schlaf aufwachten. Der Geruch des Essens hatte sie aufgerüttelt.
»Ich hab noch schwarze Bohnen übrig.« Pylmau zeigte John ein Leinensäckchen, in dem sich ein halbes Pfund gerösteter Kaffee befand.
»Großartig!«, rief John und gab seiner Frau spontan einen Kuss auf die Wange.
Pylmau errötete und sagte vorwurfsvoll: »Du bist wie ein Kind.«
Amundsen benahm sich ungezwungen. Er fühlte sich in der Tat wie zu Hause. Aber John ärgerte sich über seine eigene Verkrampftheit. Er schämte sich vor Pylmau und den Kindern, die mit ihren scharfen Augen seine Aufgeregtheit natürlich sahen.
Beim Abendessen erzählte Amundsen von seiner Reise durch die Nordostpassage, von den Begegnungen mit Menschen aus nördlichen Völkern und von der Überwinterung, die nun schon ein ganzes Jahr lang dauerte.
»Und nun werde ich wieder aufgehalten, kurz vor Schluss! Aber gerade diese unvorhersehbaren Umstände sind es, die den Charakter eines Polarforschers prägen und seinen Willen stählen …«
Amundsen warf einen Blick auf John, in dem sich Anteilnahme und Herablassung mischten, und dieser Blick war nicht mehr neugierig.
Pylmau zündete im Kämmerchen eine große Tranlampe an, die heiß wurde. Sie kratzte den Reif ab, der sich auf der durchsichtigen Schwimmblase gebildet hatte, die über das kleine runde Fensterchen gezogen war, klopfte das Bett aus, holte eine Decke aus weichem Renkalbfell, und wartete, bis das Kämmerchen warm wurde. Sie saß auf dem Bett, dachte über Johns eigenartiges Verhalten nach und schämte sich für ihn. Wozu in aller Welt kamen diese Weißen angereist? Sie waren schuld, dass es einem traurig ums Herz wurde. John brachten sie nur Unglück. Kaum stand er neben einem Weißen, wurde er ganz fremd und sein Gesicht nahm einen anderen Ausdruck an.
Da saßen sie im Polog und redeten laut. Ihre Stimmen konnte man deutlich durch den Fellvorhang hören. Ihr Lachen brachte die Stützbalken des Pologs zum Wackeln und die Flamme in der Tranlampe zum Zittern und jagte den Kindern einen Schreck ein … Bestimmt tranken sie von diesem üblen, lustig machenden Wasser und sagten vor jedem Glas einen Spruch, als ob Worte Nahrung seien!
In Pylmaus Herz wuchs der Unmut, ihre Stimmung wurde immer dunkler. Sie kämpfte mit Vernunft dagegen an, indem sie sich selbst einredete, dass Gäste ja wieder gehen und sie in Ruhe lassen.
Seit Johns Mutter hier gewesen war, fürchtete Pylmau das Meer. Das große Wasser, das sich bis zum Horizont erstreckte, jagte ihr Angst ein. Wenn ein weißes Segel am Horizont auftauchte oder Rauch, krampfte sich ihr Herz zusammen und eine schwarze Wolke legte sich wie ein Schatten auf die sorglose Freude des einfachen Lebens. Wenn John mit den Kindern und ihr doch bloß in die Tundra ginge, wenn sie doch bloß Rentiermenschen wie Ilmotsch würden, jeden Tag woandershin zögen und sich in ferne Gegenden verirrten, wo große Bäume wuchsen, wie ein Mann so hoch. Da würde niemand sie finden …
Ein Gespräch unter Weißen … Die Worte waren nicht zu verstehen, sie schnitten Pylmau wie das Sägen eines stumpfen Messers auf den Knochen einer alten Bartrobbe ins Ohr. Wie Menschen sich so ihre Zunge brechen und sich sogar noch verstehen konnten dabei!
Als Pylmau sich davon überzeugt hatte, dass die Tranlampe das Kämmerchen ausreichend erwärmte, kroch sie in den Polog und teilte ihrem Mann mit, dass der Platz für den Gast bereitet sei. John übersetzte, und Amundsen nickte Pylmau freundlich zu. Als Antwort setzte Pylmau eine gütige Maske auf.
Amundsen und John wechselten in das Kämmerchen hinüber.
»Sie haben sich gemütlich eingerichtet«, lobte der Gast. »Ich habe große Hochachtung vor einem Menschen, der sich nicht nur an die Umstände anpassen kann, in die er freiwillig oder nach dem Willen des Schicksals geraten ist, sondern sich mit maximalem Komfort in diesen Verhältnissen einzurichten versteht.«
»Schade, dass Sie nicht zu Robert Carpenter fahren, einem Händler aus Keniskun«, bemerkte John. »Er hat sogar ein Bad mit heißen Quellen!«
»Hab von ihm gehört«, entgegnete Amundsen. »Eigentlich will ich zu ihm, wenn der Winterweg am Ufer wieder befahrbar ist.«
»Aber er geht bald nach Amerika …«
»So?« Amundsen zog verwundert seine dichten Brauen nach oben.
»Er hat Angst vor den Bolschewiki«, kicherte John.
»Ihr Lachen ist fehl am Platz.« Amundsen setzte sich bequemer auf die mit Rentierfell bedeckte Bank. »Die Bolschewiki halten die Macht fest in den Händen, und es sieht so aus, als ob sie die Expeditionstruppen der Amerikaner und Japaner im Fernen Osten zurückschlagen. Sie können sich also bald auf Gäste einstellen.«
»Ich habe keinen Grund, mich vor den Bolschewiki zu fürchten«, antwortete John scharf. »Ich bin kein Händler, kein Kapitalist, ich bin einfach ein Mensch.«
»Mein lieber Freund …« In Amundsens Stimme war ein gönnerhafter Ton zu hören. »Alle Politiker, sogar die, die für eine absolute Monarchie eintreten, picken sich zuallererst die Menschen heraus, die besonders auffällig sind. Und sie prüfen, ob diese Menschen ihnen nützlich sein können oder, im Gegenteil, ihnen schaden. Und dann, je nachdem, räumen sie sie aus dem Weg oder heben sie auf einen Sockel … Und leider ist ein nicht alltäglicher Mensch mit unabhängigen Gedanken für alle Machtmenschen ein Dorn im Auge. Deshalb versucht man ihn zuallererst aus dem Weg zu räumen. Und dafür hat die Menschheit eine Menge Methoden erfunden«, lachte Amundsen. »Im besten Fall sperren sie ihn ein.«
»Ich störe doch niemanden«, rief John heftig, »ich habe keine Lust auf eine große Rauferei, wie meine Landsleute den Krieg nennen. Man soll mich in Ruhe lassen. Sie, Amundsen, hängen ja auch von keiner Regierung oder Partei ab, sie gehören der Menschheit.«
»In gewisser Hinsicht haben Sie recht«, sagte Amundsen nach kurzem Nachdenken. »Aber das hat mich große physische und seelische Kraft gekostet. Der Weltkrieg hat mich gezwungen, viele meiner Pläne neu zu überdenken. Er hat mir sogar finanzielle Mittel gebracht, die ich gespart habe. Ich habe einfach die Kriegskonjunktur ausgenutzt … Aber das ist nicht so wichtig. Die Hauptsache ist, nach der Nordwestpassage die Nordostpassage zu erforschen und meine Weltreise über die Polarmeere, am Rand der Polarkappe, zu vollenden!«
Amundsen lächelte John erneut freundschaftlich an: »Gestatten Sie mir, noch einmal meine Hochachtung über Ihr Leben auszudrücken … Jawohl, die Menschheit rühmt die Verdienste der großen Weltreisenden, die neues Land entdecken, riesige Entfernungen und Hindernisse überwinden, die die Natur ihnen in den Weg stellt. Aber nicht weniger schwer und ehrenhaft ist die Erforschung der unbekannten Kontinente in der menschlichen Seele, die auf dieser Welt von den verschiedenartigsten Völkern repräsentiert werden. In die rätselhaften Seelen der arktischen Ureinwohner einzudringen, ist nicht weniger verdienstvoll und genauso schwer wie das Eindringen in die weiten Schneefelder … Ich bin begeistert von Ihnen, Mister MacLennan! Ihre Beobachtungen bereichern die Wissenschaft auf unglaubliche Weise, denn sie werden nicht aus der Entfernung gemacht, sondern von innen heraus.«
»Sie irren sich gewaltig«, widersprach John energisch. »Keiner will mich verstehen, und keiner, nicht einmal meine Mutter, kann glauben, dass ich mich hier allein aus dem Wunsch angesiedelt habe, mit diesen Menschen ein normales Leben zu führen. Weiter nichts, glauben Sie mir!«
Das Gesicht des berühmten Polarforschers drückte plötzlich Neugier und eine gewisse Verwirrung aus. »Verzeihen Sie, aber ich wollte Sie nicht kränken«, murmelte er.
»Ich habe es verlernt, mich von solchen Dingen kränken zu lassen«, sagte John lächelnd. »Ich träume nur davon, dass dieses Land denen gehört, die darin wohnen, dass die Ordnung, die seit Jahrhunderten hier herrscht und sich in harten Prüfungen bewährt hat, erhalten bleibt und dem Wohl dieser Menschen dient …«
»Sie sprechen aus, worüber ich mir seit vielen Jahren den Kopf zerbreche«, sagte Amundsen versonnen. »Diese Gedanken sind mir schon vor einiger Zeit gekommen, als ich an der Südküste von King William Island überwintert habe. Damals bin ich zum ersten Mal Eskimos begegnet und habe am eigenen Leib ihre Gastfreundschaft erlebt. Und ich konnte mich von ihrer hohen Moral überzeugen …«
»Die besonderen moralischen Eigenschaften dieser Menschen zu loben ist genauso falsch wie sie zu unterschätzen«, bemerkte John. »Tatsache ist, dass die Tschuktschen und Eskimos genau solche Leute sind wie die übrige Menschheit. Dass ich bei ihnen lebe, als eine Ruhmestat zu betrachten, bedeutet, sie nicht als unseresgleichen anzuerkennen …«
»Verzeihen Sie, ich verstehe Sie nicht ganz …«, unterbrach Amundsen ihn höflich.
»Wenn ich bei Wölfen leben und ihre Gesetze einhalten würde oder, sagen wir, bei Bären oder irgendwelchen anderen Tieren, wäre das auch als Ruhmestat angesehen worden, als etwas Außergewöhnliches, weil ich im Namen der Wissenschaft meine urmenschlichen Bedürfnisse eingeschränkt hätte«, erklärte John. »Aber ich lebe mit Menschen zusammen! Worin also besteht das Ungewöhnliche? Vielleicht nur darin, dass mein jetziges Leben, wie auch das Leben meiner Landsleute, der menschlichen Natur weitaus mehr entspricht! Verzeihen Sie, ich habe nicht den Plan, mich mit irgendwelchen Forschungen zu befassen, weder mit ethnografischen noch mit anthropologischen. Ich halte das für kränkend meinen Freunden und auch mir gegenüber …«
»Verzeihen Sie«, brummte Amundsen erneut. »Ich wollte Sie weder kränken noch beleidigen. Ich wollte Sie nur daran erinnern, dass jeder zivilisierte Mensch eine Pflicht gegenüber der Menschheit hat. Rassistische Vorurteile und ein enger Blick auf die Dinge und Erscheinungen sind nicht selten. Für die Entlarvung der grässlichen und verleumderischen Erfindungen, dass kleine Völker nicht vollwertig seien, wäre Ihre Zeugenschaft von unerhörtem Wert … Und bedenken Sie: Alle zivilisierten Menschen, die aus diesen oder jenen Gründen in eine ähnliche Lage geraten sind wie Sie, haben es für ihre Pflicht gehalten, darüber zu schreiben. Wenn schon keine wissenschaftliche Abhandlung, dann wenigstens lebendige Beobachtungen und Gedanken. Sie werden doch wohl ein Tagebuch führen!«
Bei der Erwähnung des Tagebuchs schämte sich John plötzlich dermaßen, als hätte man ihn eines Vergehens überführt. Er senkte die Augen und bekannte schuldbewusst: »Schon lange habe ich kein Papier mehr angerührt.«
»Das ist nicht richtig«, bemerkte Amundsen sanft. »Ich könnte Ihre Schriften in einem angesehenen Verlag unterbringen. Vom Ruhm und vom Honorar will ich erst gar nicht reden. Für Ihre Aufzeichnungen interessieren sich bedeutende internationale Organisationen wie zum Beispiel der Völkerbund. Vielleicht könnte man eine internationale Konvention durchbringen, welche die nordischen Völker, ihre Kultur und ihre ursprüngliche Lebensweise schützt …«
»Genauso wie Naturschutzgebiete für seltene Tiere geschaffen werden … Man braucht übrigens gar nicht lange nach Beispielen zu suchen. Nehmen wir nur die Indianer in Kanada oder in den Vereinigten Staaten!«
»Ich meine ja nicht, dass man die Fehler der Vergangenheit wiederholen, sondern künftige vermeiden soll!«, widersprach Amundsen ärgerlich. »Vergessen Sie nicht, dass sich die bolschewistische Macht gleich nebenan befindet – in Anadyr und Uëlen!«
»Warum mahnen alle mich zur Vorsicht und nicht Orwo, Ilmotsch oder Tnarat?«, rief John schmerzlich.
Jemand kratzte an der dünnen Brettertür. John öffnete und erblickte Pylmau. Mit den Augen rief sie ihren Mann.
»Verzeihen Sie.«
John ging in den Tschottagin und schloss hinter sich die Tür. Der große Reisende blieb im Kämmerchen zurück.
»Was ist los?«, fragte John.
»Ilmotsch ist da. Er will uns etwas sehr Wichtiges sagen. Er war in der Nähe von Anadyr.« Pylmau sah ihren Mann flehend an.
Ihrem Blick gehorchend, fragte John unwillig: »Na gut, wo ist er?«
»Im Polog, er trinkt Tee«, antwortete Pylmau und hob bereitwillig den Fellvorhang.
Nur mit einem Fellgurt bekleidet, schlürfte Ilmotsch heißen Tee von einem Teller. Er hielt die von Amundsen mitgebrachte Zeitschrift in der Hand und schaute sich neugierig die Bilder an.
»Lange habe ich meinen Freund nicht mehr gesehen!«, sagte er schmeichlerisch. »Ich habe dir verschiedene Geschenke mitgebracht – ein Renkalbfell für Winterkleidung, Rentierfleisch. Ich habe gehört, der Kapitän von dem eingefrorenen Schiff ist bei dir. Kapitäne mögen Rentierfleisch …«
John setzte sich dem ungebetenen Gast gegenüber und nahm eine Tasse Tee in die Hand. Ungemütlich geworden war es ihm in der eigenen Jaranga: Es gab kaum einen Tag, an dem die Familie sich ungehindert im Polog bewegen konnte. Immer waren Gäste da, Reisende …
Ilmotsch seufzte und schmatzte mit den Lippen. Er machte, den Regeln des Anstands folgend, noch verschiedene andere Anspielungen. Als er sich aber davon überzeugt hatte, dass bei John kein Schnaps zu holen war, begann er:
»Ich bringe dir Nachricht von der schrecklichen, blutigen Schlacht in Anadyr. Im Winter wurde dort eine neue Macht errichtet – sie nennt sich Revolutionskomitee. Die schlimmsten Habenichtse sind nach oben gekommen. Sogar der Tschuwanze Kurkutski hat sich ihnen angeschlossen. Er hat weder Rene noch Gewehre noch Netze zum Fischfang und will auch an die Macht! Die neuen Chefs haben sich alle Lebensmittellager angeeignet und verteilen die Waren, was das Zeug hält. An alle möglichen Gauner, an alle, die sich nicht selbst ernähren können und sich deshalb als ›mittellose Menschen‹ bezeichnen. Nicht nur in Anadyr herrscht dieses Revolutionskomitee. Ihre Kuriere sind mit Hundeschlitten nach Markowo, nach Ust-Belaja gefahren. Kaum waren sie angekommen, haben sie den Leuten gleich ein neues Leben versprochen – die Macht der Armen. Sie haben gedroht, denen die Rene wegzunehmen, die große Herden besitzen. Es gab welche, die sich für das neue Leben entschieden haben. An die Spitze der Siedlungen haben sie die schlimmsten Vagabunden gestellt …«
Ilmotsch kratzte sich, er versuchte mit seinem kurzen Arm die Mitte des Rückens zu erreichen. Er schnaufte lange, bis ihm Jako zu Hilfe kam. Der Junge rieb den mageren Rücken des Rentierzüchters, auf dem die einzelnen Wirbel zu sehen waren. Er erfüllte eine Pflicht, die aus der Achtung vor dem Älteren herrührte.
»Na, den Hungerleidern und Nichtsnutzen bleibt ja auch nichts anderes übrig. Sie haben sich gefreut, haben gelernt, laut zu sprechen, und schon reden sie über die neue Macht und strecken ihre Hände nach fremden Lebensmittellagern aus. In Markowo haben sie dem verehrten Kaufmann Malkow nicht einmal die Hosen gelassen, sodass er umherzog und um welche bettelte …«
Ilmotsch stellte seine Tasse hin, John goss automatisch Tee nach.
»Die vom Revolutionskomitee haben viel und deutlich geredet. Sie haben einen roten Lappen auf das Haus der Landesregierung gehängt, und an die Mauer haben sie jeden Tag weiße Zettel geklebt, voller Buchstaben … Und dieser Prahlhans, dieser Tschuwanze Kurkutski, tut so, als ob er die Zeichen versteht.«
»Und weiter?«, fragte John ungeduldig.
»Hör zu!«, antwortete Ilmotsch ruhig. »Alle, die sie im dunklen Haus eingelocht hatten, wurden nach und nach rausgelassen. Sie haben ihnen befohlen zu arbeiten, und den einen und anderen haben sie ans gegenüberliegende Ufer der Bucht geschickt, wo die Kohlengrube ist. Alles wäre gut gegangen, wenn nur der weiße Mann nicht ewig der Macht hinterherjagen würde. Alle, die abgesetzt wurden, haben sich versammelt und das Haus belagert, in dem das Revolutionskomitee saß und was beredete. Und haben sie geschnappt.«
»Also herrscht in Anadyr wieder die alte Macht?«, fragte John.
»Hör doch«, sagte Ilmotsch ruhig und belehrend. »Alle, die geschnappt wurden, haben sie auf dem Eis des Flüsschens Kasatschka in Anadyr erschossen. Sie haben auf sie gezielt wie auf wilde Tiere bei der Jagd. Ein schrecklicher Anblick soll es gewesen sein, erzählen die Leute. Und alle, die in andere Siedlungen geflohen sind, wurden aufgespürt und auch erschossen.«
Ilmotsch trank die Tasse leer, klaubte aus der Wange ein gelb gewordenes Zuckerstückchen und legte es ordentlich auf den Tellerrand. »Wie viel Blut vergossen wurde!«, seufzte er.
»Also ist die alte Macht nach Anadyr zurückgekehrt?«, fragte John erneut.
»Nicht doch, die Bolschewiki haben wieder gesiegt«, antwortete Ilmotsch. »Jetzt sind andere gekommen, auf einem großen Dampfer, die haben sich die gegriffen, die es nicht geschafft haben, nach Amerika abzuhauen. Sie haben wieder den roten Lappen aufgehängt, und die Erschossenen haben sie nach russischem Brauch in einer Kiste beerdigt. Aber sie haben auf den Gräbern keine Kreuze aufgestellt, sondern Pfähle mit einem roten Stern. Und haben drei Mal nach oben geschossen.«
»Und was sagen die Leute?«, fragte John beunruhigt.
Ilmotsch gähnte mit weit geöffnetem Mund, wobei er die abgenutzten, etwas gelblichen, aber noch kräftigen Zähne zeigte.
»Die Leute sagen gar nichts. Die Rentierzüchter sind von Anadyr weggezogen. Die Anadyrer werden jetzt lange kein Rentierfleisch mehr sehen. Sollen sie doch ihren stinkigen Lachs essen!«
Ilmotsch lehnte sich an die Rückwand des Pologs und schloss die Augen. Das war ein Zeichen, dass er müde war und schlafen wollte.
John nahm die National Geographic in die Hand, blätterte darin herum und stieß schließlich auf den Artikel über sich: »Ein Weißer unter den Wilden des asiatischen Russlands«. Sein Blick streifte über die Zeilen …
»Ein niedriger Uferstreifen zwischen zwei Felsen – hier beginnt das Land, das sich der Kanadier John MacLennan für ein neues Leben ausgesucht hat. Er stammt aus Port Hope, vom Ufer des Ontariosees, hat an der Universität in Toronto studiert. Ungefähr zehn Jahre lebt dieser Mann schon unter den Wilden im Nordosten Asiens. Er nahm ihre Bräuche, Gewohnheiten, ihre Religion an und gründete sogar eine vielköpfige Familie.
Die Geschichte begann im Spätherbst des Jahres 1910, als der aus Nome kommende Schoner Belinda, der dem Industriellen und Händler Hugh Grover gehörte, am Kap Enmyn gegenüber der Landzunge, auf der die Jarangas der Tschuktschen, der asiatischen Eingeborenen, stehen, vom Eis eingeschlossen wurde.
Die Seeleute versuchten das Eis zu sprengen. Einer von ihnen, der Held unseres Artikels, wurde dabei schwer an den Händen verwundet und vom Kapitän in das Kreiskrankenhaus von Anadyr geschickt, da es in den riesigen Weiten des asiatischen Russlands mit medizinischer Hilfe schlecht steht. Die Tschuktschen erklärten sich gegen Bezahlung bereit, John MacLennan in das Krankenhaus und zurück nach Enmyn zu bringen. Zwei Gespanne machten sich auf den Weg durch die verschneite Tundra ins ferne Anadyr, auf einem Hundeschlitten wurde der weiße Mann davongetragen. Der Kapitän seinerseits beabsichtigte, in der Nähe eines Nomadenlagers zu überwintern.
Nach einigen Tagen näherte sich vom Süden ein Schneesturm und löste das Küsteneis vom Ufer, wobei sich eine große offene Wasserfläche bildete, auf der sich der Schoner bewegen konnte. Der Kapitän zögerte nicht, diesen glücklichen Umstand auszunutzen, und gab den Befehl, die Maschinen anzuwerfen und das Segel zu setzen. Er glaubte ohnehin nicht an eine Rückkehr John MacLennans: Der Verwundete hatte bereits eine Blutvergiftung, als er losfuhr. Und nach Anadyr braucht man sogar bei gutem Wetter nicht weniger als einen Monat.
Aber die Eingeborenen gingen mit John MacLennan erstaunlich menschlich um. Wie John MacLennan selbst versichert, hat die Operation, bei der die abgestorbenen Hände amputiert wurden, eine Schamanin durchgeführt. Auf diese Weise haben wir einen Zeugen dafür, dass die Medizin der Primitiven nicht in jedem Fall Scharlatanerie ist und die Zauberer offenbar gewisse Heilungsmethoden beherrschen.
John MacLennan kehrte nach Enmyn zurück, aber zu seinem großen Leidwesen fand er das Schiff nicht mehr vor. Er überwinterte in einer Jaranga und plante, im nächsten Jahr mit dem ersten Schiff in die Heimat zu fahren.
Aber nun begann das Rätselhafte. Die Tschuktschen gaben John MacLennan die Fähigkeit zurück, nicht nur die Waffe zu benutzen, sondern sogar zu schreiben. Er wohnte in der Jaranga eines Ureinwohners mit Namen Toko, dessen Frau Pylmau den jungen Mann aus Kanada durch ihre wilde Schönheit bezauberte. John MacLennan selbst behauptet, dass er aus purem Zufall seinen Rivalen auf der Jagd tötete. Wie die Tschuktschen selbst über diesen Fall denken, ist nicht bekannt. Obwohl man einige Schlüsse ziehen kann: John MacLennan nämlich war nach lokalem Brauch verpflichtet, die Frau des Opfers, Pylmau, zu heiraten (es kam der primitive Ritus des Levirats, der »Schwagerehe«, zur Geltung) und ihre Kinder zu adoptieren. Jedenfalls ist nur noch schwer festzustellen, ob die Tschuktschen John MacLennan zur Heirat gezwungen haben oder ob er freiwillig beschloss, bei den Wilden im Nordosten Asiens zu bleiben.
Vor einiger Zeit besuchte John MacLennans Mutter, Mary MacLennan, ihren Sohn in Enmyn. Dieser Besuch hinterließ bei ihr einen schrecklichen Eindruck und fügte dem ohnehin schon gequälten Mutterherz eine unheilbare Wunde zu. John MacLennan weigerte sich entschieden, in das Vaterhaus zurückzukehren. Mary MacLennan versicherte, dass ihr Sohn nicht bei vollem Verstand sei und die Wilden ihn mit Gewalt festhielten. Allerdings berichten Reisende, die John MacLennan begegnet sind, dass der Kanadier bei klarem Verstand und mit seinem Leben offenbar sogar zufrieden sei. Solche Mitteilungen, die zweifellos verlässlich sind, erhielten wir beispielsweise von der Expedition des kanadischen Forschers Stefánsson und von Kapitän Bartlett, der Folgendes schreibt: ›Der Besuch bei dem unter den Tschuktschen lebenden John MacLennan hinterließ in uns den besten Eindruck. Sein Heroismus verdient nicht weniger Verehrung als das Eindringen des Menschen in unbewohnte Eisgebiete.‹
Bald sind es zehn Jahre her, dass John MacLennan sich bei den Eingeborenen der Arktis niederließ. Es wird berichtet, dass er viele Kinder habe und eine riesige Rentierherde! Aber wie lange kann ein Mensch, der in einer zivilisierten Gesellschaft aufgewachsen ist, unter den primitiven Ureinwohnern aushalten?
Das unerhörte wissenschaftliche Experiment geht weiter!«
John schleuderte die Zeitschrift beiseite und legte sich neben Pylmau.
2
John beschloss, zum Kap Onman zu fahren, um auf Amundsens Schiff Vorräte und Patronen für die Winchester zu kaufen.
Mit Munition stand es in Enmyn schlecht. In diesem Herbst fuhren die Schiffe an der kleinen Siedlung vorbei. Robert Carpenter klagte über die instabile politische Lage in Russland und über die Furcht der Händler, ihm große Warenmengen zu liefern. Die Regale in seinem Laden waren leer.
Eine große Hundeschlitten-Karawane fuhr zu dem im Eis eingeschlossenen Schiff am Westufer der Insel Aion im Tschaunsker Meerbusen. John war noch nie in diese Richtung gefahren, und ihn verblüfften die düsteren steilen Felsen, die sich vor dem blendend weißen Schnee, der das Meereseis wie Zucker bedeckte, durch ihre Schwärze krass abhoben.
Amundsens Schiff Maud lag, eingefroren im Eis, nicht direkt am Ufer, sondern weiter draußen im Meer. Neben dem Schiff ragten kleine Häuschen aus dem Schnee – ein Zwinger für Amundsens Schlittenhunde, aus leeren Fässern zusammengeschustert und mit Zeltbahnen und Brettern bedeckt, und ein Zelt für Magnetbeobachtungen. Noch ein drittes Gebäude war zu sehen – ein Mittelding zwischen Zelt und Jaranga, mit Hunden und Hundeschlitten davor. An Deck des Schiffes und auf dem Eis standen Menschen und winkten der sich nähernden Karawane freudig entgegen.
Die Bewohner der seltsamen Hütte auf dem Eis waren Besucher, die sich um Amundsens Schiff geschart hatten. Am Fallreep hing ein Plakat mit einer Aufschrift, dass es verboten sei, ohne Einladung an Bord der Maud zu gehen. Amundsen stellte John jeden einzelnen von ihnen namentlich vor.
Einige kannte John bereits aus Robert Carpenters Erzählungen. Alexander Kisk – eine Person polnischer Herkunft – sprach ausgezeichnet deutsch, polnisch, russisch und tschuktschisch. Trotz seiner bemerkenswerten linguistischen Fähigkeiten war Kisk beim Handeln ein Pechvogel. Wahrscheinlich wegen seiner starken Vorliebe für Alkohol. Dann stellte sich der mit einer geschmackvollen, reich verzierten Kuchljanka bekleidete Grigori Kibisow vor, ein arktischer Handlungsreisender, der, wie er selbst versicherte, das Geschäft nicht des Gewinns wegen betrieb, sondern aus Liebe zum Abenteuer.
Und schließlich Grigori Karajew, ein Steppenmensch in einer wundervoll gefertigten Kuchljanka, die etwas sperrig war, aber so reich geschmückt, dass ein Kenner sie zu schätzen wusste.
Nachdem er John mit allen bekannt gemacht hatte, lud Amundsen die Leute ein, sich an Bord der Maud zu begeben. Die Begrüßungszeremonie wurde auf dem Schiff fortgesetzt. Unter den Mannschaftsmitgliedern traf John auch einen Russen, der Olonkin hieß.
In der Messe konnte man sich gleich behaglich fühlen. An der Decke brannte eine elektrische Lampe, und auf einem Mahagonigestell standen ein pompöses Grammofon und eine Plattensammlung.
»Ich bitte meine Gäste am Tisch Platz zu nehmen!«, schlug der Kapitän herzlich vor.
Während sich alle einen Stuhl suchten, schnupperte Alexander Kisk am Kochtopf, der auf einem Extratisch stand. »Das ist bloß Preiselbeersaft, Mister Kisk«, sagte Amundsen und blinzelte den übrigen Gästen schelmisch zu.
Am Tisch wurde über die politische Lage in Russland diskutiert. Die Mehrheit war sich einig, dass es noch zu früh sei, darüber zu urteilen, welche Macht sich in Russland halten würde. Von der Möglichkeit der Rückkehr des Zaren auf den Thron sprach allein Alexander Kisk, aber seine Worte nahm niemand ernst.
»Solange der große Machtkampf anhält«, meinte Grigori Kibisow fröhlich, »dürfen auch wir unsere Chance nicht verpassen!«
Der schweigsame Koch, gleichzeitig Steuermann des Schiffs, reichte in hohen Gläsern heißen Grog.
»Und wie ist Ihre Meinung zur aktuellen Lage?« Amundsen wandte sich an Karajew.
Es war dem Russen an der Nasenspitze anzusehen, dass er seine Worte mit Bedacht wählte, seine Meinung interessierte alle. »Zurzeit kann man schwer ein Urteil fällen«, sagte er leise und leckte vorsichtig den Grog von seinem Schnurrbart. »Von einem bin ich überzeugt – dass Tschukotka und Kamtschatka russisches Besitztum bleiben. Deshalb ist es die Aufgabe jedes echten Patrioten, sich der Plünderung der hiesigen Reichtümer entgegenzustellen und die Rechte der örtlichen Bevölkerung zu verteidigen.« Diese Worte sprach Karajew mit leiser Stimme, aber sie hatten Gewicht.
John betrachtete den russischen Händler mit großem Interesse. Ein markantes Gesicht, scharfe, durchdringende Augen und grobknochige Finger, die ruhig auf dem polierten Tisch lagen.
Die Gäste senkten die Köpfe. Jeder war auf die eine oder andere Weise in die »Plünderung der hiesigen Reichtümer« verstrickt, wie Karajew sich ausdrückte.
An Bord hörte man Hundgebell. Die Schiffswache kam in die Messe und machte Meldung: »Die Tschuktschen sind bereit zum Handeln!« Alle gingen an Deck.
Die Eisfläche um das Schiff herum hatte sich in einen Marktplatz verwandelt. Hundegebell, Peitschenschläge, die kehligen Rufe der Kajure, der Schlittenführer – all diese Geräusche vermischten sich und erzeugten den Eindruck eines großen belebten Platzes.
Amundsen ging aufs Eis, gefolgt von seinen Gästen, den weißen Händlern von Tschukotka, die diesmal einfache Zuschauer waren.
Viele der Neuankömmlinge erkannte John. Sie waren aus Nachbardörfern, andere wiederum kamen aus dem fernen Seschan und hatten eine lange Reise hinter sich.
Vor einem Hundeschlitten, auf dem ein Kajur das wundervolle Fell eines Polarwolfs ausgebreitet hatte, blieb Amundsen stehen und winkte Alexander Kisk heran. »Sagen Sie ihm«, er deutete mit dem Kopf auf den Tschuktschen, »dass ich ihm für das Fell sechs Päckchen Tabak gebe.«
»Ich habe auch noch Polarfüchse.« Der Kajur knüpfte hastig einen großen Leinensack auf und ließ wunderbar verarbeitete Polarfuchsfelle auf den Schnee fallen.
»Sagen Sie ihm, für ein Polarfuchsfell gebe ich ihm nur drei Päckchen Tabak«, erklärte Amundsen laut. »Und dann lade ich alle zum Tee ein mit Zucker und Zwieback.«
Amundsen ging die Hundeschlitten ab, die sich alle in einer Reihe aufgestellt hatten. Die Augen der Tschuktschen schauten voller Hoffnung auf ihn und blitzten, wenn er seinen Schritt verlangsamte.
John ging neben ihm und sein Herz erstarrte vor Scham. Ohne etwas von Johns Gefühlen zu ahnen, sagte Amundsen mit geschäftiger Stimme: »Ich habe jetzt sechsundvierzig Rentierfelle. Das reicht für Kleidung. Ich möchte noch so viel wie möglich wertvolle weiche Renkalbfelle dazukaufen. Mich verblüfft die Ehrlichkeit dieser Leute. Ich habe noch kein einziges Mal erlebt, dass sie versucht haben zu betrügen. Allerdings wundert mich das niedrige Bildungsniveau dieser Menschen. Sie kennen nicht einmal die Uhr und können weder lesen noch schreiben. Das ist eine Schande, und ich verstehe sehr gut, dass die alte Ordnung gestürzt werden musste.«
Amundsens Gehilfen gingen indes die Schlitten ab, tauschten Waren gegen weiches Renkalbfell und brachten es in den geräumigen Laderaum. Amundsen war zufrieden mit dem Geschäft und gab den Befehl, einen riesigen Kessel mit starkem Tee und einen Sack mit Schiffszwieback direkt aufs Eis zu stellen.
Die Tschuktschen stürzten sich auf das heiße Getränk. Diejenigen, die kein Trinkgefäß mithatten, rannten um das Schiff herum und suchten im Schnee nach leeren Konservendosen. Die Gäste gingen zusammen mit dem Kapitän an Bord der Maud und beobachteten von dort aus die geräuschvolle Teezeremonie.
Amundsen schaute den Tschuktschen zu, sein Blick drückte Mitgefühl aus, und er sagte, zu John gewandt:
»Man kann sich nur schwer das Ausmaß der Tragödie vorstellen, die diese Menschen in Zukunft erwartet! An anderen Orten habe ich Leute getroffen, die für Schnaps bereit waren, nicht nur ihr letztes Hab und Gut, sondern auch ihre Frauen und Töchter herzugeben. Ich habe den Mitgliedern meiner Expedition verboten, an der ganzen langen Küste ein Verhältnis mit einer Frau anzuknüpfen, nur Dank dieser Maßnahme haben wir die besten Beziehungen zur örtlichen Bevölkerung, sie ist von nichts belastet und überschattet.«
Ilmotsch, der als wohlhabender Mann galt, ließ sich nicht dazu herab, mit allen anderen Tschuktschen aus dem großen Kessel zu trinken. Er lief immer hinter Amundsen her, wie ein zugelaufener Hund, hing an seinen Lippen, lächelte, nickte zum Zeichen des Einverständnisses mit dem Kopf. In ihm gärte der Wunsch, »der Freund des Kapitäns Amundsen zu werden«.
Ilmotsch passte den richtigen Moment ab, rief John zu sich und flüsterte ihm eifrig zu: »Sag dem Kapitän, dass die Rene, die ich mitgebracht habe, ein Geschenk von mir sind. Ein Geschenk an den Freund. Ich will von ihm nichts haben.« Ilmotsch hatte dabei einen solch komischen Gesichtsausdruck, dass John sich nicht zurückhalten konnte und loslachte. »Sag es ihm«, hauchte ihm Ilmotsch zu. John übermittelte Amundsen die Worte des Rentierzüchters.
Das Gesicht des Polarforschers bekam einen tiefsinnigen und nachdenklichen Ausdruck. »Sagen Sie ihm, dass ich gerührt bin von seiner Herzlichkeit. Wissen Sie, meine Herren«, wandte er sich an die russischen Händler, »er hat etwas getan, wovor sich viele Vertreter der aufgeklärten Menschheit drücken! Sie können sich nicht vorstellen, wie viel Anstrengungen jede Expedition kostet. Oft reicht die Unterstützung der Regierung nicht aus, und ich muss um freiwillige Spenden bitten … Wie schwer ist das manchmal und erniedrigend!« Amundsen trat zu Ilmotsch und drückte dem Rentierzüchter, der vor Glück ganz aus dem Häuschen war, die Hand. Und beim Abschied erhielt Ilmotsch dennoch ein Geschenk.
Auf dem Rückweg nach Enmyn, während einer Rast, fragte John den Rentierzüchter: »Weißt du, was Kapitän Amundsen macht? Womit er sich befasst?«
»Womit schon kann sich ein weißer Mann befassen?«, entgegnete Ilmotsch verwundert. »Er treibt natürlich Handel! Ich habe in den Laderaum geschaut. So viel Waren auf einen Haufen habe ich noch nie gesehen. Und das Schiff! Voll behängt mit Bärenfellen und Polarfuchsfellen. Das sieht sogar ein Blinder, womit sich Langnase befasst.«
»Kapitän Amundsen ist ein großer … ein großer …« John fand nicht das richtige Wort auf Tschuktschisch für »Reisender«. Die wörtliche Übersetzung hätte so etwas wie »Landstreicher« bedeutet. Da er aber nichts anderes fand, bezeichnete er Amundsen auf Tschuktschisch als »großen Landstreicher«.
»Das ist doch nichts Schlimmes«, erklärte Ilmotsch, so als wolle er sich für Amundsen einsetzen. »Nimm den Eskimo Typlilyk. Er ist auch ein Landstreicher, aber ein guter Mensch. Wie viel Märchen er kennt! Jeder will ihn in seine Jaranga holen, ihm was zu essen und zu trinken geben, nur damit er ein Märchen erzählt. Auch Langnase hat eins erzählt, und ihr habt alle still zugehört. Wie dumm, dass ich die Sprache des weißen Mannes nicht verstehe, sonst hätte ich mich mit meinem neuen Freund unterhalten!«
»Aber Amundsen ist nicht so ein Landstreicher wie Typlilyk«, wandte John ein. »Roald Amundsen fährt durch die nordischen Länder, um für andere Menschen nach neuen Wegen zu suchen. Er erforscht die kalten Länder, entdeckt neue Gebiete«, begann John zu erklären.
»Was erzählst du mir das alles, als ob ich töricht bin und nichts im Leben verstehe?«, entgegnete Ilmotsch gekränkt. »Ich habe alles verstanden: Langnase geht voran, wie das Leittier bei einem Hundegespann. Die anderen folgen seiner Spur und treiben Handel in verschiedenen neu entdeckten Ländern. Immer muss jemand vorangehen. Das ist stets ein starker und mutiger Mensch, so wie Langnase. Er hat mir gleich gefallen.«
John erinnerte sich, was in den Zeitungen alles über die Reisen und Entdeckungen Roald Amundsens geschrieben stand. Jawohl, er war ein Held, er hat im Zeitalter der Gewinnsucht dazu beigetragen, dass Tapferkeit und Selbstaufopferung wieder geachtet wurden. Und dennoch … Es stimmte, Amundsen hatte glühenden Ehrgeiz, der sogar jahrhundertealtes Eis zum Schmelzen brachte.
Bestimmt begeisterte sich der große norwegische Forschungsreisende für bestimmte Charakterzüge bei den Nordvölkern, denen er auf seinen langen Reisen begegnete. Aber niemals würde er sie als Seinesgleichen anerkennen. Im besten Fall würde er zustimmen, dass sie seine jüngeren Brüder waren, die eine Führung brauchten. Das Bewusstsein der eigenen Überlegenheit war Bestandteil seiner Natur. Sich davon zu befreien, würde bedeuten, die Haut zu wechseln oder ein ganz anderer Mensch zu werden … Aber wie sollten die Tschuktschen weiterleben, wie sich vor diesen Händlerscharen retten, die nur auf eine günstige Stunde warteten, um sich mit ihren Waren auf die kleinen Küstensiedlungen zu stürzen? Grigori Kibisow sah man es an der Nasenspitze an, dass auf seinem mit Rentierfell abgedeckten Schlitten ganze Kanister mit Selbstgebranntem und reinem Sprit lagen. Oder dieser Karajew mit seinem klugen Lächeln, das tief in seinen Augen verborgen war. Auch der würde die Gunst der Stunde nicht verpassen wollen, der würde Gewinne erzielen, wo andere leer ausgingen …
Die Rückfahrt nach Enmyn dauerte länger als die Hinreise zu Amundsens Schiff. Am zweiten Tag begann ein starker Schneesturm, und sie mussten zwei Nächte in einer Höhle verbringen, die sie in eine großen Schneewehe unter einem Felsvorsprung gegraben hatten. Die ganze Zeit musste sich John Ilmotschs Geschwätz anhören, wie er zu Langnase Kontakt halten könnte.
»Wenn ich ins Lager zurückkomme, befehle ich den Hirten, dass sie die Herde näher an den Tschaunsker Meerbusen treiben sollen. Zwar weidet dort Armagirgin, aber mit dem komme ich schon zurecht.«
»Wer ist Armagirgin?«, fragte John.
»Der Herr der Insel Aion«, erklärte Ilmotsch respektvoll. »Ein starker Mensch, ein großer Schamane. Er besitzt nicht nur eine Rentierherde. Er hat auch einen eigenen Walrosslagerplatz. So ein Mann ist das!«
»Und wenn er plötzlich selbst ein Freund von Langnase werden will?«, foppte John Ilmotsch.
»Daraus wird nichts!«, unterbrach ihn Ilmotsch brüsk. »Armagirgin ist anders gebaut! Er raucht keine Pfeife, trinkt kein übles lustig machendes Wasser, trägt keine Kleider aus Stoff, nichts, was ein weißer Mann gemacht hat. Es ist verrückt, aber sogar sein Essen kocht er in steinernen Töpfen! Nein, der würde nie Kontakt zu einem weißen Mann suchen. Wenn er erfährt, dass einer seiner Hirten geraucht oder gar Tee getrunken hat, dann jagt er ihn davon! Jagt ihn von der Insel! So ein Mann ist das, Armagirgin, der Herr der Insel Aion!«
John hatte von diesem Mann schon gehört, aber er war weit entfernt, wie eine Figur aus einem Zaubermärchen. Und nun stellte sich heraus, dass er ganz in der Nähe lebte, dass man sogar zu ihm fahren konnte, ohne große Umwege zu machen.
Der Gedanke gefiel John, und er schlug Ilmotsch vor: »Komm, lass uns bei ihm vorbeifahren.«
»Bei Armagirgin?«, fragte der Alte verwundert. »Wieso?«
»Ich würde ihn gern mal sehen, und auch mit ihm reden.«
»Da gibts nichts Interessantes!«, unterbrach ihn Ilmotsch grob. »Der Alte hat schon Moos angesetzt, nichts zu sehen.«
»Ich fahre trotzdem hin«, erklärte John resolut.
Ilmotsch druckste herum, stimmte dann aber zu, die Schlitten auf die Ostseite der Insel Aion zu lenken, wo zwischen niedrigen Hügeln am Meer fette Rene weideten.
3
Die vier Jarangas standen mit dem Gesicht zum Meer. Kein einziges Rentier war in der Nähe zu sehen. Das Lager erinnerte eher an eine Insel, die auf Stützbalken ruhte, wie ein Kanu auf einem Gestell für lange Lastschlitten, mit Walschulterblättern, die in die Erde gegrabene Fleischvorratskammern – die Uwerane – bedeckten.
Vor einer großen Jaranga standen Menschen und blickten den näher kommenden Hundeschlitten entgegen. Keine Rufe, kein Hundegebell.
Für einen Augenblick kamen John Zweifel: War es nicht ein Fehler, zu einem Mann zu fahren, dem jeder Fremde ein Dorn im Auge war? Aber zur Umkehr war es zu spät. Ilmotsch trieb seine sehnigen, mit magerem Rentierfleisch gefütterten Hunde an, schnalzte mit der Zunge und versprach mit dem Ruf »Jara-ra-ra-rai« baldige Rast. Die Gespanne fuhren vorsichtig an die Jaranga heran, die Kajure hielten die Schlitten an.
John betrachtete aufmerksam die schweigenden Menschen. Es waren nur Männer. Alle waren einfach, aber solide gekleidet. Offenbar waren ihnen noch nicht die guten, von der Pferdebremse verschonten Rentierfelle ausgegangen.
Die Ankömmlinge warteten einige Minuten auf die Begrüßung. Ein junger Mann trug auf seinen Schultern ein relativ großes Kind in einer weißen Kuchljanka aus Rentierfell und einer mit puschligem Fell gesäumten Mütze. Es sah irgendwie krank aus. Das Kind begrüßte die Ankömmlinge, und John war von seiner erwachsenen, ja beinahe alten Stimme frappiert:
»Ettyk? Menkotore? Woher kommt ihr?«
Das kam so unerwartet, dass die Reisenden sich verwundert ansahen und Ilmotsch erschrocken blinzelte.
Ohne die Begrüßung zu erwidern, betrachtete John das ungewöhnliche Menschlein, das eine so laute Stimme hatte und allem Anschein nach unheilbar krank war, sehr eingehend.
»Ettyk? Menkotore?«
Diesmal kam die Stimme fordernd, und da erkannten Ilmotsch und John schließlich, dass auf den Schultern des jungen Mannes kein Kind saß, sondern ein vertrockneter Greis mit scharfen, durchdringenden Augen.
»Wir kommen von der Küste«, antwortete Ilmotsch hastig. »Wir haben beschlossen, auf der Rückfahrt Eure Insel zu besuchen. Vielleicht gibt es Neuigkeiten?«
»Ej, spannt die Hunde aus und füttert sie. Die Gäste bringt in die Jaranga!«, befahl der Greis und gab dem jungen Mann die Sporen, damit er ihn in den breiten Tschottagin trug.
Der Boden war sorgfältig gefegt. Drei Hängepologs mit grauen Vorhängen aus Rentierfell bildeten eine Reihe. Aus jedem Polog schauten neugierige Frauenaugen, verschwanden aber gleich wieder. Nur eine alte Frau, die sich auf dem frostharten Boden niedergelassen hatte, fachte eifrig das Feuer an.
Der junge Mann ließ den Greis vorsichtig auf ein Rentierfell hinabgleiten.
»Armagirgin«, verkündete der Alte feierlich seinen Namen. »Und wer seid ihr?«
»Ich bin Ilmotsch, ein Nomade«, entgegnete der Rentierzüchter würdevoll. »Und das ist mein Freund Son aus der Siedlung Enmyn, verheiratet mit Pylmau, die ihren Mann verloren hat.«
»E-e!«, sagte der Alte gedehnt und betrachtete John neugierig. »Dann bist du der Weiße, der so leben will wie wir?«
»I-i«, entgegnete John auf Tschuktschisch. »Wir haben viel von dir gehört, von deiner Weisheit, und beschlossen, bei dir vorbeizufahren und dich zu sehen.«
»Kakomej!«, sagte Armagirgin. »Du kannst ja sprechen, als ob eine Tschuktschin dich geboren hätte.« Armagirgins Stimme wirkte freundlich, und John bekam Mut.
Das Haus des großen Mannes war eine einfache Jaranga. John hätte sie bestimmt nicht so eingehend betrachtet, hätte Ilmotsch ihn nicht darauf aufmerksam gemacht, dass der Alte nichts leiden konnte, was aus Übersee kam, und dass das Stärkste, was er trank, Rentierbouillon war.
Der Kessel über dem Feuer hing an einer gewöhnlichen Eisenkette und war auch selbst eindeutig aus Metall. Johns Auge entdeckte ein Gewehr in einer Hülle aus Robbenhaut. Es hing dort, wo es in allen Jarangas war. Auch das kleine Messer, das auf einem kleinen Brett am Feuer lag, hatte eine Stahlklinge. Was wollte Ilmotsch also.
Armagirgin hielt die Regeln ein und fragte seine Gäste nicht aus, bevor er sie bewirtet hatte. Halblaut erteilte er den Befehl, und sein zweibeiniges Pferd verwandelte sich in einen flinken Diener, der jede beliebige Anweisung ausführte. Er las seinem Herrn jeden Wunsch von den Augen ab und rief, obwohl Armagirgin kein einziges Wort gesagt hatte, die Nachbarn herbei. Auf einer länglichen Holzschale tauchten die ausgesuchtesten Leckerbissen auf – Prerem, die Wurst aus Rentierfleisch, Knochenmark, sogar ein Stück leicht gelblich gewordener Itgilgyn, der Walspeck.
Armagirgin zog ein scharfes Messer aus Sheffield-Stahl heraus und lud die Gäste ein, am niedrigen Tisch Platz zu nehmen.
Eine Zeit lang waren im Tschottagin nur das Schmatzen, das Klappern der Messer auf der Holzschale, das Knacken des Holzes und der schwere Atem der Frau, die ins Feuer blies, zu hören.
»Warum seid ihr gekommen?«, fragte Armagirgin, nachdem er sich den Mund mit dem Saum des Fellärmels abgewischt hatte. »Was für ein Begehr hat euch hierher geführt?«
»Kein Begehr«, antwortete John. »Ich habe schon gesagt: Wir haben beschlossen, den verehrten Mann zu besuchen und ihm unsere Ehrerbietung zu erweisen.«
Armagirgin blinzelte mit den kleinen schmalen Augen, als ob er den Sinn von Johns Worten nicht gleich verstünde. »Ehrerbietung?«, wiederholte der Alte langsam, so als horchte er auf den Klang des Wortes. »Wieso?«
John war verwirrt. Hilfe suchend schaute er Ilmotsch an, aber der Rentierzüchter tat so, als sei er vollauf mit dem Zerbeißen der harten Wurst Prerem beschäftigt.
»Obwohl wir weit voneinander entfernt wohnen«, sagte John, »habe ich viel von Armagirgin gehört, von seinem Leben … Und was ich gehört habe, hat mir gefallen, da wollte ich mal vorbeischauen …«
»Vorbeischauen – stimmt das oder ist es gelogen?«, fragte Armagirgin ohne Umschweife.
»Es stimmt nicht ganz«, sagte John, der versuchte, sich aus der unangenehmen Lage herauszuwinden. »Einen Menschen wie dich zu sehen, ist immer interessant …«
»Sag doch gleich – ihr seid aus Neugier gekommen«, entgegnete der Alte mit einem schiefen Lächeln, er kicherte plötzlich wie ein kleines Kind. »Ich verurteile Neugier nicht«, erklärte er mit ernster Stimme. »Neugier ist die Quelle des Wissens. Einen Neugierigen kann man nicht überrumpeln. Das habt ihr gut gemacht, dass ihr gekommen seid. Über den alten Armagirgin werden an der Küste alle möglichen Gerüchte und Legenden verbreitet. Manche behaupten sogar, ich sei längst gestorben, und junge Männer tragen meinen ausgetrockneten Körper … Warum die Leute nicht selbst zu mir kommen, verstehe ich nicht«, seufzte Armagirgin. »Ob sie Angst vor mir haben?«
»Sie haben Angst«, brummte Ilmotsch, der plötzlich wieder reden konnte.
»Und wovor?«, fragte Armagirgin. »Ich bin kein Teufel und kein böser Mensch. Vielleicht das Gegenteil – vielleicht will ich den Menschen Gutes tun? Du weißt doch, Ilmotsch, wenn ein Hungerjahr kommt, zu wem fahren sie? Doch nicht zu dir. Du spürst das Unglück im Voraus und ziehst mit deiner Herde so weit weg wie möglich, damit dich niemand findet … Zu mir kommen sie, zu meinen Walrossen, die mich lieben und wissen, dass sie auf meiner Insel geschützt sind. Spreche ich nicht die Wahrheit?«
Armagirgin hob seine kleinen Augen, umfing mit seinem Blick alle, die sich im geräumigen Tschottagin versammelt hatten, und viele Stimmen verkündeten:
»Die wahrhaftige Wahrheit!«
»Hörst du, was die Leute sagen!« Armagirgin drehte sich zu John: »Auch die Gerüchte über meine Schamanenkraft stimmen … Und alles für das Wohl der Menschen, die leben wollen, satt sein wollen, Kinder gebären und großziehen wollen, damit dieses Land nicht verödet. Spreche ich nicht die Wahrheit?«
»Die wahrhaftige Wahrheit!«, rauschte es durch den Tschottagin.
Die stumme Frau räumte die leeren Holzschalen weg und stellte neue hin, gefüllt mit heißem Fleisch.
»Esst, meine Gäste!« Armagirgin hob einen besonders schönen Knochen hoch und reichte ihn John. »Iss, weißer Mann, der du ein richtiger Mensch werden willst.«
John nahm das Stück Fleisch aus Armagirgins Händen entgegen.
»Wenn ich dich ansehe«, fuhr Armagirgin fort, »dann denke ich: Wird deine Ausdauer reichen, bei uns zu bleiben? Ich habe von dir gehört. Auch dass deine Mutter da war, um dich zu holen und du nicht mit ihr wolltest. Erstaunlich! Was hast du davon? Ein Mensch kann doch nicht mir nichts dir nichts sein Leben verändern! Nun hast du deine Neugier, was mich betrifft, gestillt, jetzt kannst du auch auf meine Frage antworten.«
Armagirgins scharfer, durchdringender Blick drang bis in Johns Herz, und der Gast beugte sich dem Willen des Gastgebers. »Ich habe beschlossen, so wie ihr zu leben, weit weg von Lärm und Lüge«, entgegnete John gehorsam.
»Gibt es hier denn keinen Lärm und keine Lüge?«, fragte Armagirgin mit listig zusammengekniffenen Augen. »Das Eis macht Lärm, der Schneesturm heult, die Schneelawinen krachen, die Walrosse schreien im Frühling und das Polarlicht rauscht. Und Lüge? Solange es Menschen gibt, existiert das Böse … Nein, dein Wunsch, hier zu bleiben, rührt von etwas anderem her, was du vor den Menschen verheimlichst.« Armagirgin starrte John an, so als wollte er ihn mit Blicken durchbohren.
Johns Herz klopfte aufgeregt, er schüttelte die magische Kraft, die von Armagirgins Augen ausging, ab und sagte fest: »Was ich gesagt habe, ist die Wahrheit. Andere Ziele habe ich nicht. Hier leben meine Frau und meine Kinder, und ich bin mit ihnen.«
Der Herr der Insel spürte, dass er ein bisschen zu weit gegangen war, und änderte seinen Ton. Er sagte friedfertig: »Deine Absichten und deine Worte, dass die Weißen hier nichts zu suchen haben, sind lobenswert. Stimmt es, dass du das gesagt hast?«
»Ich habe es gesagt, und ich bin von Tag zu Tag immer mehr davon überzeugt«, antwortete John. Er fühlte, dass er sich trotz seines inneren Widerstands Armagirgins Zauber nicht entziehen konnte. Er war wie gefangen. Ob er ein Hypnotiseur ist?, dachte er bei sich. Er erinnerte sich an ein Buch über die alten Religionen, das er in seiner Studentenzeit gelesen hatte. Dort stand geschrieben, dass einige Schamanen hypnotische Fähigkeiten besitzen, was ihnen unbegrenzte Macht über die Menschen gäbe … Offensichtlich war Armagirgin aus besonderem Holz geschnitzt. Solch eine originelle Persönlichkeit hatte John während seines ganzen Aufenthalts auf Tschukotka noch nicht getroffen. Also stimmte es nicht, dass den Tschuktschen die Idee einer höheren Macht fremd war. Armagirgin war ein lebendiger Beweis dafür, dass es auch in dieser Welt ungekrönte Könige gab, Menschen, die über den anderen standen. Zum Glück hatten die Tschuktschen keine Regierung wie in den zivilisierten Ländern …
Zum Abschluss des Gastmahls wurde in breiten Holztassen kräftige Rentierbouillon, gewürzt mit duftenden Kräutern, gereicht.
»Ich habe keinen Tee – dieses Gesöff sieht aus wie angewärmter Urin«, erklärte Armagirgin stolz. »Auch andere Getränke gibt es bei mir nicht. Nur Fleischbouillon. Trinkt und hört zu, wie sich die heiße Brühe in euren Mägen mit dem Fleisch unterhält.«
Trotz des langen, reichhaltigen Essens fühlten sie keine Schwere im Magen. Die Gäste erhoben sich leicht und beschwingt.
»Ich möchte dir ein paar geschlachtete Rene schenken«, sagte Armagirgin zu John. »So ein Fleisch hast du noch nie gegessen. Seine« – Armagirgin deutete mit dem Kopf geringschätzig auf Ilmotsch – »Rene ähneln mageren Hunden. Er füttert sie nicht richtig, jagt sie durch die Tundra, lässt sie kein Fett ansetzen.«
Dann traten alle aus der Jaranga. Der junge Mann sprang zu seinem Herrn, duckte sich, der Alte kletterte auf seine Schultern und umklammerte seinen Hals fest mit den Beinen, die in weißen Hosen aus dem Fell von Rentierläufen steckten. Die Stiefel waren aus dem gleichen Fell genäht.
Auf leichten Rentierschlitten, die die Hirten bereits vorbereitet hatten, jagten sie zur Rentierherde. Sie weidete in der Nähe, hinter den Hügeln am Meer, am Ufer eines großen Sees, der mit glattem Eis bedeckt war.
Aus dem Schnee ragte einsam eine Jaranga mit einer Rauchkrone. Aus der Jaranga krochen Menschen. Die Männer rannten den Schlitten entgegen, fingen die Zugtiere ein und führten die Gespanne zur Jaranga. Armagirgin bestieg wieder den jungen Mann und sagte von oben herab zu den in ehrfurchtsvollem Schweigen erstarrten Hirten: »Zu uns ist ein Gast gekommen mit Namen Son. Ihr habt von ihm gehört. Schlachtet für ihn drei fette Rene. Und dem Rentierzüchter vom Festland, Ilmotsch, gebt ihm auch drei fette Rene.«
Die Hirten rannten zur Herde.
Mit dumpfem Hufschlag kamen die Rene angetrabt. Die gefrorene Erde bebte, und man konnte den Geruch der Tiere spüren. Armagirgins Rene waren mindestens zweimal so groß wie die vom Festland. Das waren richtige Prachtexemplare. John war frappiert: Welch ein Unterschied zu Ilmotschs Tieren!
Ilmotsch erklärte John: »Auf der Insel gibt es keine Wölfe und Insekten. Deshalb sehen die Rene hier so schön aus. Das kommt nicht vom Schamanenzauber.«
Geschickt warfen die Hirten die Schlingen über ausgewählte Tiere, rissen sie zu Boden und stießen ihnen ein Stahlmesser ins Herz. Aus seiner erhöhten Position feuerte Armagirgin die Hirten an. Den Tieren wurde noch an Ort und Stelle, auf dem Schnee, die Haut abgezogen, dann wurden sie auf die Schlitten gelegt.