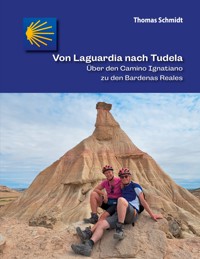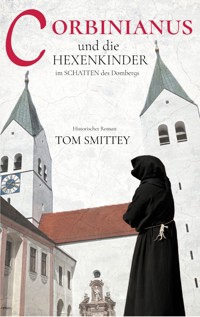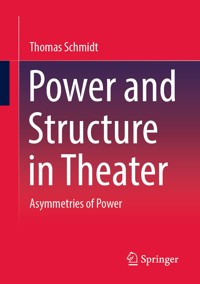Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der II. Weltkrieg ist vorüber. Die Kinder entdecken ihre Heimatstadt Torgau als Abenteuerspielplatz wieder. Thomas Schmidt schildert detailgetreu die wahren Erlebnisse der Jagd nach den vermeintlichen Schätzen. »Was meine Heimatstadt Torgau anbetrifft, ist dort der II. Weltkrieg in gewissem Sinne vergraben worden. Die Russen marschierten zum Kriegsende 1945 aus dem Osten und die Amerikaner aus westlicher Richtung auf die Stadt zu. Zwischendrin befanden sich noch Teile der deutschen Wehrmacht wie Korn, das jeden Moment zwischen zwei Mühlsteine geraten konnte. Man plante einen Stellungskrieg gegen die beiden Armeen wie Don Quichotte seinen Kampf gegen die Windmühlenflügel. Viele Punkte in der Stadt und am Stadtrand, auch im gesamten Kreisgebiet, waren für die Errichtung von »Barrikaden gegen den Feind« auserkoren worden. Nach dem strategisch wichtige Bauwerke, wie zum Beispiel die Brücken über die Elbe, sinnloser Weise zerstört waren, begann die Flucht der deutschen Militärs, eines zum Rückzug gezwungenen Wehrmachtsrestes. Übriggeblieben sind Teile einer soldatenlosen Kriegsmaschine, die man noch Jahre nach dem Krieg wie »Freilichtmuseen« in den Wäldern wiederfand, oder eine, die unter den eigenen Füßen buchstäblich begraben lag. Kriegsgerät, Sprengstoff und Munition hat man »auf der Flucht« in Seen und Flüsse versenkt, in den meisten Fällen aber in flache Gräben geworfen und dürftig mit Erde überdeckt unter der Maßgabe, dass »Gras über die Sache wachse«. »In den Baumwipfeln singt die Amsel, und der Buntspecht schlägt seinen Takt, Lerchen hüpfen futtersuchend im Gras, darunter ist der II. Weltkrieg verscharrt.«
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 278
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Titelseite
Impressum
Vorwort
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Thomas Schmidt
Thomas Schmidt
Als wir den II. Weltkrieg ausgruben ...
Impressum eBook:
eISBN: 978-3-86901-323-7
Copyright (2009) Engelsdorfer Verlag
Impressum Printausgabe:
Bibliografische Information durch Die Deutsche Bibliothek: Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Copyright (2007) Engelsdorfer Verlag
Alle Rechte beim Autor
www.engelsdorfer-verlag.de
Vorwort
Ich bin zwar in Torgau geboren, aber meine erlebnisreiche Kindheit begann erst einmal in der zu fünfundachtzig Prozent zerbombten Stadt Dessau. Die Trümmermeere und Bombenkrater, die Wahrzeichen des Krieges in dieser Stadt, waren nun mal das streng verbotene »Spiel-Eldorado« für unartige Kinder, zu denen ich gehörte. Wer den Krieg miterlebte, hat diese Trümmerfelder gemieden, so gut er konnte, uns aber haben sie magisch angezogen, weil wir erst nach dem II. Weltkrieg auf die Welt gekommen sind. Magisch angezogen haben uns auch die Verbotsschilder mit der Aufschrift:
Betreten strengstens verboten – Einsturzgefahr!
Was meine Heimatstadt Torgau anbetrifft, ist dort der II. Weltkrieg in gewissem Sinne vergraben worden. Die Russen marschierten zum Kriegsende 1945 aus dem Osten und die Amerikaner aus westlicher Richtung auf die Stadt zu. Zwischendrin befanden sich noch Teile der deutschen Wehrmacht wie Korn, das jeden Moment zwischen zwei Mühlsteine geraten konnte. Man plante einen Stellungskrieg gegen die beiden Armeen wie Don Quichotte seinen Kampf gegen die Windmühlenflügel.
Viele Punkte in der Stadt und am Stadtrand, auch im gesamten Kreisgebiet, waren für die Errichtung von »Barrikaden gegen den Feind« auserkoren worden. Nachdem strategisch wichtige Bauwerke, wie zum Beispiel die Brücken über die Elbe, sinnloserweise zerstört waren, begann die Flucht der deutschen Militärs, eines zum Rückzug gezwungenen Wehrmachtsrestes. Übrig geblieben sind Teile einer soldatenlosen Kriegsmaschine, die man noch Jahre nach dem Krieg wie »Freilichtmuseen« in den Wäldern wiederfand, oder eine, die unter den eigenen Füßen buchstäblich begraben lag. Kriegsgerät, Sprengstoff und Munition hat man »auf der Flucht« in Seen und Flüsse versenkt, in den meisten Fällen aber in flache Gräben geworfen und dürftig mit Erde überdeckt unter der Maßgabe, dass »Gras über die Sache wachse«. Manchmal hat ein Pflugschar oder ein starker Regenguss ein Flakgeschoss, einen alten Stahlhelm oder Karabiner freigelegt, vielleicht war es auch nur ein Wildschwein, das den Waldboden durchfurcht hat.
»In den Baumwipfeln singt die Amsel, und der Buntspecht schlägt seinen Takt, Lerchen hüpfen futtersuchend im Gras, darunter ist der II. Weltkrieg verscharrt«. »Eine makabere Poesie«, wird der eine oder andere sagen!
Einer muss ja mit dem Schürfen nach Munition begonnen haben, aber wer?! Das weiß nur der Himmel!
Apropos Himmel: Manche sind dort oben, die durch die Spuren dieses Weltkrieges noch viele Jahre nach 1945 zu Tode gekommen sind. Darunter sind sogar angehende Familienväter, die beim Spiel mit Munition, Sprengstoff oder gefundenen Waffen ihren Kick fanden, mit dem sogenannten ‚Anstieg des Adrenalinspiegels‘. Das Schürfen nach Munition, Sprengstoff und Kriegsgerät war oft vom Vorsatz geprägt, damit etwas Verbotenes anzustellen, denn die Gesetzgebung des Staates war ja eindeutig!
Die Spuren dieses Krieges konnten nie beseitigt werden. Vielleicht gelingt es in den nächsten Generationen! Wir jedenfalls wollten im übertragenen Sinn den II. Weltkrieg wieder ausgraben. Manchmal sind wir auch durch Zufall auf seine Übrigbleibsel gestoßen.
Mein Vater und Großvater und die meisten Väter und Großväter meiner Freunde hatten das Glück, dass sie im II. Weltkrieg nicht erschossen wurden. Sie kamen nach dem Krieg nach Hause und wurden von ihren Familien in die Arme geschlossen. Alle haben sie den Krieg verdammt und uns für immer zu Kriegsgegnern ideologisiert. Kriegsteilnehmer, körperlich und seelisch Verwundete, haben sich, falls wir kindlich unbekümmert nach ihren Kriegserlebnissen fragten, oft von uns distanziert. Nach und nach erstarkten ihre Seelen wieder und sie standen uns unbekümmert Rede und Antwort.
Kriegsverherrlichendes oder terroristisches Gedankengut und Gehabe gab es für uns nicht, denn wir liebten unsere Heimat, und weil wir unsere Heimat liebten, unsere Eltern, Lehrer und Lehrmeister respektierten und um ehrlich zu sein, auch ein wenig Angst vor einer für den Staat DDR wichtige Behörde hatten, nämlich vor dem Ministerium für Staatssicherheit, haben wir uns nie erwischen lassen. Aufgefallen sind jedoch die, die beim Spiel mit dem Feuer weder Grenzen noch Vernunft kannten und dadurch zu Schaden gekommen sind.
Bedeutsam für uns war natürlich auch die intensive Suche nach Zeitdokumenten und Belegstücken des II. Weltkrieges oder der Kontakt zu vertrauenswürdigen Zeugen aus dieser Zeit, die es mit der Wahrheit sehr genau nahmen. Diese Aktionen waren interessant und abenteuerlich, manchmal sogar auch gefährlich.
Geschichten und Ereignisse in diesem Buch sind nach wahren Begebenheiten erzählt. Alle Namen, außer den des Autors, habe ich geändert.
*
Dass es 1953 einen 17. Juni, d.h. einen Volksaufstand geben wird, weiß in unserer Familie niemand. Weil meine Eltern und Großeltern vom letzten Krieg die Schnauze voll haben, sind sie momentan politisch desinteressiert, bis Weltkriegspanzer T 34 in die Zerbster Straße der Stadt Dessau einrollen und an unserer Hausnummer 38 stoppen. Es ist eine schöne ,38‘, eine schmiedeeiserne, befestigt an einem schmiedeeisernen Scherengitter! Weil diese Hausnummer neulich ganz schief gehangen hat, befestigte sie der Hausmeister Ebert mit einem Stück Draht. Jetzt hängt die No 38 immer noch schief! Die Russenpanzer stoppen nicht rein zufällig an unserer Haustür und schon garnicht, weil die Hausnummer schief hängt – in der Nähe befindet sich nämlich ein Menschenknäuel, welches sich partout nicht von selbst auflösen will. Ein Offizier mit einem Sprachrohr stellt sich auf den Panzer neben den Geschützturm und ruft die Dessauer Bürger in gebrochenem Deutsch zur Besonnenheit auf. So schlecht kann das Deutsch auch wieder nicht gewesen sein, denn die Leute haben sich jetzt in kleine Grüppchen aufgeteilt und verziehen sich in Richtung Rathaus und Albrechtsplatz. Zwei Straßenbahnzüge sind hintereinander zum Stehen gekommen. Wir toben begeistert um einen dieser Panzer herum und können die leuchtenden Augen des Panzerfahrers hinter dem Sehschlitz erkennen. Dann fangen die Ketten dieses Panzers wieder an zu knirschen, und er rollt weiter. Dabei hinterlässt er Kratzspuren auf der erst kürzlich ausgebesserten Straße, dort, wo eigentlich meine Kindheit mit Kreiselpeitsche, gusseisernem Roller und Schiefertafel unterm Arm, beginnt. Auf dieser Schiefertafel befindet sich vorerst nur ein »Allerlei« an hingekrakelten Mondgesichtern, weil wir noch nicht schreiben können. Da ist da noch der dicke Seifert, der Sohn vom Fleischer, der versucht hat, ein Hakenkreuz auf solch eine Tafel zu kratzen – es steht total verkehrt herum! Ein Hakenkreuz habe ich z.B. in der stinkenden Pissbude am Stadtpark gefunden. »Das sind doch nur Blödheiten«, meint die Dessauer Bevölkerung, »die dummen Jungens wissen doch gar nicht, was sie da hingeschmiert haben!«
Im Mittelpunkt für uns steht das allerschönste, nämlich das Versteckspiel in einer Umgebung tödlicher Gefahren – es sind die Ruinen der 1945 zu 85 % zerbombten Stadt.
Ich bin heute mit Seifert verabredet, eben mit dem Sohn vom Fleischer. Wir wollen ein wenig in den Ruinen herumstrolchen, bis dahin sind es von unserem Hauseingang kaum hundert Meter. Mein Stiefvater hält es mit dem Fleischer Seifert, denn ab und zu gibt es Schweinslende und Schweinslende ist kaum zu haben. Unterm Ladentisch gibt es sie manchmal. Der olle Seifert wiederrum hält es mit meinem Stiefvater, weil der eine gutgehende Augenarztpraxis führt und eine Hand wäscht bekanntlich die andere. Er will unbedingt eine »Heliomatic« auf der »Nese« sitzen haben, d.h. eine Brille, deren Gläser sich der Intensität der Sonneneinstrahlung anpassen. »Wozu braucht Seifert eine Heliomatic, dieser alberne Fatzke?!«, fragt meine Mutter meinen Stiefvater. Zum Schluss bekommt Seifert doch solch eine Brille, und dafür gibt es bei uns zu Hause ab und zu Filet vom Rind.
Ich soll heute bei Ellmanns einen Liter Magermilch holen, den Liter zu elf Pfennigen. Da mein Stiefvater vor Geld stinkt, wundere ich mich, dass ich billige Magermilch einholen soll. Vielleicht haben meine Eltern an des Nachbars Katze gedacht – das wäre natürlich ein guter Zug! Ich selbst bin ein absoluter Milchfeind. Einen Fünfziger hat man mir in die Hosentasche gesteckt, den Rest des Geldes soll ich wieder mitbringen. Ich verfresse davon vierzig Pfennige auf dem Weg dorthin, indem ich mir vier Kugeln Wassereis zu vierzig Pfennigen einverleibe. Es bleiben nur zehn Pfennige übrig, und weil ich der Sohn vom Augenarzt bin, wage ich es mir nicht, für diesen Liter Milch eben nur zehn Pfennige auf den Ladentisch zu schmeißen und bei Ellmanns einen Pfennig Schulden zu machen! Wenn man mich zu Hause fragt, wo die Milch geblieben ist, sage ich, dass ich den Fünfziger verloren habe.
Heute treiben wir uns wieder in den Kellern zerbombter Häuser herum. Eigentlich haben wir dort nichts zu suchen. Außerdem werden die Trümmerfrauen und -männer, wenn sie Pech haben, streng bestraft, falls sie uns nicht vom Trümmerfeld jagen. Meine älteren Kumpane und ich erfahren, dass die Trümmerfrauen heute wieder nach altem Hausrat suchen. In einem Fall sind wertvolle Antiquitäten mit musealem Wert in solch einer Ruine gefunden worden. Das gehört dann dem Staat, habe ich gehört, und man bekommt als Trümmerfrau oder -mann trotz der beschissenen Trümmerarbeit nicht einmal das Dreckige unterm Fingernagel, geschweige Finderlohn! Ist das nicht ungerecht?
Die Polente bekämpft auch die sogenannten »Kupfer- und Bleimarder«. Das sind Leute, die z.B. kupferne und bleierne Wasserleitungen aus den Ruinen klauen. Sie hauen mit Beilen und Äxten die Rohre einfach von den Wänden, weil das so schneller geht und verkaufen sie dann beim Schrotthandel.
Also: So lange die Trümmer noch stehen, haben wir tolle Spielplätze, manchmal in luftiger Höhe, so dass man das »Kornhaus«, die wunderschöne Gaststätte an der Elbe, erblicken kann. Oft pilgern wir durch muffige und gespenstische Keller, in denen es acht Jahre nach Kriegsende genauso nach Einkellerungskartoffeln riecht, wie bei uns zu Hause, komisch! Einmal hat eine Trümmerfrau zu mir gesagt, es sei gefährlich, in den Trümmern herumzutoben, weil Trümmer manchmal Ruinen sind, oder umgekehrt. Dann habe ich begriffen, wie sie es gemeint hat. Gestern sind wir in eine Ruine der Teichstraße gestiegen und zwar bis ganz nach oben ins letzte Geschoss. Die Sprengbombe ist vom Dach aus bis in den Keller geflogen und hat die Hälfte des Hauses weggepustet, trotzdem ist das erste und das zweite Obergeschoss zur Hälfte stehengeblieben. Die Pfeiler sind zum Teil eingestürzt. Die Holzbalkendecken in den Zimmern sind nur noch einseitig in den Wänden eingebunden, so dass sie auf- und niederwippen, wenn wir auf sie springen. Es ist überhaupt sehr lustig, weil die ganze obere Etage wie ein Lämmerschwanz hin und her wackelt! »Auch Trümmer können baufällig sein, so dass sie irgendwann, sogar Jahre nach dem Bombenangriff, einstürzen können«, erklärt mir eine Trümmerfrau. »Vielleicht könnte man die Ruinen reparieren, so dass eben diese Gefahr nicht besteht. Der Krieg hatte also auch sein Gutes, denn ...«, habe ich geantwortet. Bevor ich meinen Satz zu Ende gesprochen habe, hagelt es schmerzhafte Kopfnüsse.
Irgendwelche Nachbarn entdecken uns in den Ruinen, aber niemand traut sich hinter uns her. Dann wird meine Mutter gerufen, weil mein Stiefvater dienstlich unterwegs ist. Sie lässt Praxis Praxis sein und kommt im weißen Kittel angesaust. Sie will unser Obergeschoss erklimmen, um uns herunter zu holen. Allerdings ist die Treppe weggebombt, und der Weg zu uns nach oben führt nur über ein Dachrinnenfallrohr. Später hat sie mich verdroschen, allerdings daheim, weil es dort keiner gesehen hat.
Gucken darf man, hat man uns gesagt, doch dabei ist es nicht geblieben. Wir sind immer wieder in dunkle Keller gestiegen oder auf ausgebrannte Dachböden geklettert.
Heute sind wir wieder mit Trümmerfrauen und Trümmermännern in einem Kellergewölbe. Da zieht eine Trümmerfrau eine Pistole und richtet sie lachend auf mich und fragt, ob sie mich totschießen soll. Natürlich ist das nur Spaß, denn die Pistole ist so vergammelt, dass sie bestimmt keinen Schuss, nicht einmal den leisesten, von sich geben würde. Kein Wunder, denn das Ding liegt ganze acht Jahre nach dem Krieg im Dreck! Später findet man einen ganzen Haufen Panzerfäuste. Sie sehen aus wie neu, weil sie zugedeckt in einer Kellerniesche gelegen haben. Jetzt ist die Polizei angerollt und hat diese Dinger mitgenommen. »Das war die Bewaffnung der Volkssturmleute im April 1945«, sagt die Trümmerfrau, die jetzt die Pistole auf einen Schutthaufen geschmissen hat. »Die wollten mit den Panzerfäusten die Russenpanzer aufhalten«, erklärt sie mir. Anfangs dachte ich, der jeweilige Volkssturmmann schlägt mit diesem keulenartigen Gegenstand wie wild auf den Panzer, um ihn zur Räson zu bringen. »Schön wär’s für den Panzerfahrer«, erklärt mir ein Trümmermann, »die Panzerfaust war eigentlich für die Panzerbesatzung tödlich!«
Heute stapeln wir sogar Mauersteine aufeinander. Damit verschaffen wir uns ein Alibi für den Aufenthalt in den Trümmern. Vorher muss der alte Mörtel abgehackt werden, weil man die Steine wieder zum Bauen verwendet. Wir stehen einige Zeit zwischen den Trümmerleuten und bilden mit ihnen eine Kette, so mehr zum Spaß. Letztenendes geht uns das Steineweitergeben zu schnell, und wir verdrücken uns. Am nächsten Tag sind wir wieder an der gleichen Stelle. An den Wänden findet man Reste wunderschöner Stofftapeten. »Hier hat die Créme de la créme gehaust«, sagt ein Arbeiter und zerrt an einem der herunterhängenden Fetzen herum, so dass ein großer Putzfladen von der Wand fällt. Mit Créme de la créme hat er die hohen Herrschaften gemeint, denen diese bombardierte Stadtvilla gehört hat. »Vielleicht sind die hohen Herrschaften totbombardiert worden«, sage ich zu diesem Arbeiter. Daraufhin ist er perplex und schweigt.
Heute hat mich die »Schusterin«, so nennen meine Eltern unsere Haushälterin, Frau Schuster, persönlich zum Mittagessen gerufen und zwar aus den Ruinen heraus. Sie hat »hintenherum« erfahren, wo ich mich herumtreibe, mich heimlich nach Hause beordert und damit verhindert, dass mich meine Mutter in den Ruinen entdeckt. Ich finde das höchst anständig, weil ich deshalb um eine erneute körperliche Züchtigung herumgekommen bin. Überhaupt ist die Schusterin eine wahnsinnig tolle Haushälterin. Leider ist ihr Ehemann während der Winterschlacht 1942/43 in Stalingrad gefallen. Voriges Wochenende ist sie mit mir nach Berlin-Schöneberg zu ihrem Bruder gereist, weil meine Eltern während eines Ärztekongresses in Hannover weilten. Der Bruder der Schusterin hat sich mit mir sofort angefreundet, weil meine Eltern zu Hause eine Augenarztpraxis betreiben. Allerdings war er der Meinung, dass es ihm unter amerikanischer Herrschaft viel besser ginge, als uns Ostbürgern unter der Fuchtel der Russen. »Komisch«, denke ich, »haben doch die Amis alle unsere Städte in Schutt und Asche gelegt« ...
»Hoffentlich gibt es nicht wieder Krieg, denn irgendetwas braut sich da zusammen«, sagen die Leute. Weil vorgestern wie zum Kriegsende 1945 Panzer durch unsere Straße gerollt sind, geraten die Leute außer Rand und Band. Da sich nun doch etwas zusammenbraut, bringt mich meine Frau Mama schnell zu meiner Großmutter nach Torgau. Nun ist es erst einmal aus mit unseren geliebten Spielplätzen in den Trümmern und Ruinen Dessaus!
»Es gibt keinen Krieg«, sagen meine Großmutter und mein Großvater zu mir. Dann hat mein Großvater mir erklärt, dass Krieg übertrieben sei, es wäre nur das Aufflackern eines bürgerkriegsähnlichen Zustandes, und das ist etwas anderes! Ich werde aus dem ganzen Gesabbel nicht schlau! Ich bin voller Hoffnung, dass ich mit Seifert wieder in den Ruinen herumklettern kann und freue mich wie ein Schneekönig auf die Bahnfahrt zurück nach Dessau. Daraus wird vorerst nichts, denn es gibt einen Ausnahmezustand – kein Zug fährt in den Dessauer Hauptbahnhof hinein und keiner hinaus. Stalin-II-Panzer aus dem II. Weltkrieg stehen auf den Bahngleisen und haben erst einmal den Zugverkehr gestoppt. Meine Mutter kann mich also nicht nach Hause holen. Ich sitze also bei meinen Großeltern fest und werde in Torgau eingeschult. Danach drücke ich fünf Wochen eine Torgauer Schulbank und werde dann wieder nach Dessau verfrachtet. Da gibt es dann so etwas wie eine zweite, wenn auch nur provisorische Einschulung, nämlich eine ohne Zuckertüte! Die Atmosphäre ist unangenehm, weil mich dreißig Schülerinnen und Schüler unentwegt angaffen, als sei ich aus Schokolade.
Inzwischen hat man einige der gefährlichsten Ruinen weggerissen, insofern sie nicht von selbst umgekippt sind. Das Gelände ist von Zäunen umgeben. Trotzdem – wir kriechen unterm Draht hindurch und klettern wieder in die Trümmer hinein, weil sich dort oft noch alter Hauskram befindet. Die Leute sagen, die Ruinen wären derart gefährlich, dass ohnehin keiner auf die Idee kommt, sich da hinein zu begeben. »Gut für uns«, meine ich, »so fallen wir wenigstens nicht auf!« Wir befinden uns jetzt in einer Ruine, aus der man 1945 alle Familien nach dem Bombenangriff tot geborgen hat. Es ist richtig unheimlich in diesem Gemäuer! Wir haben allerlei Krimskrams aus den Trümmern gebuddelt, z.B. Kaffeebüchsen, einen Nachttopf aus Blech, einen alten Fleischwolf und einen zerbeulten Emaillebrotkasten, einen Kohlenkasten auf Rädern ...
Unser Enthusiasmus kennt keine Grenzen! Über uns, also im ersten Obergeschoss, ist eine Küche von einer Bombe zur Hälfte abgesprengt. Übriggeblieben ist ein blau-weißes Fliesenmuster an der Wand, ein Handtuchhalter, ein Ausguss an der Wand und eben der halbe Küchenfußboden. Alles zusammen sieht richtig wohnlich aus – dort wollen wir hinauf! Es ist tatsächlich noch ein Stück Treppe vorhanden, aber es fehlen die ersten fünf Stufen. Ich schichte Mauersteine aufeinander und versuche nun, die erste Treppenstufe zu erklimmen. Ich kann meine Handteller bereits auf die sechste Treppenstufe legen. Dabei habe ich das Gefühl, dass der ganze Treppenaufgang schwankt. Der dicke Seifert will von hinten nachschieben, und ich kippe mit dem Steinstapel um. Plötzlich bewegt sich eine Steinlawine von oben nach unten, wie aus »heiterem Himmel« und verschüttet die Hälfte des Kellerhalses. Wir stehen da wie versteinert, dann ergreifen wir die Flucht.
*
Ich bin ein nomadisches Schulkind geworden. Meine Eltern haben, wie man so schön sagt, wieder mal »in den Sack gehauen« und sind, ohne mich zu fragen, mit mir nach Eisenach weitergezogen. Wenigstens haben sie mich nicht in Dessau sitzen lassen! Ich komme mir vor, wie einer vom Zirkus, nur dass wir zu Hause richtige Fenster und Türen vor den »Löchern« haben. Vielleicht ist mein Stiefvater vom Vater Staat nach Eisenach gerufen worden, weil wieder mal ärztlicher Notstand herrscht?! Was solls!
Juli 1956 – es sind Ferien, die ich in Torgau verbringen werde. Das entfernte Grollen ist eine Detonation, die Scheiben vom Doppelfenster in der Küche klirren, die Küchengardine ist ganz leicht in Bewegung geraten. Über dem Torgauer Stadtwald hängt ein Rauchstreifen, der sich wie eine Zickzacklinie vom blauen Himmel abhebt. »Der Munitionsbergungsdienst sprengt wieder Munition aus dem II. Weltkrieg. Früher nannte man diese Truppe »Himmelfahrtskommando«, erklärt mein Großvater. »Was ist ein Himmelfahrtskommando«, frage ich wieder. Meine Großmutter hat die Antwort schon parat: »Nu, die vom Himmelfahrtskommando haben Munition in die Luft gesprengt oder Landminen unter Einsatz ihres Lebens vernichtet.« »Himmelfahrt ist doch ein schöner Tag für erwachsene Männer«, sag ich. »Dieses Kommando hat mit dem Himmelfahrtstag nur im übertragenen Sinn zu tun! Vorigen Dienstag ist einer von dieser Truppe umgekommen, also gen Himmel gefahren«, ist die Antwort. Und wenn die Glocken der Torgauer Marienkirche zur Beerdigung läuten, geht ihr das immer sehr nahe, weil nun jemand »heimgegangen« sei. Ich knie meinen Großeltern mit meiner Fragerei förmlich auf den Nähten herum. »Ein Mann ist also gestorben, also gen Himmel aufgefahren wie Christi!«, bohre ich weiter. »Da ist einer von 'ner Panzerfaust zerrissen worden«, platzt mein Großvater heraus, »der Gerhard Angermann, ein Kriegsteilnehmer der »letzten Tage«, ein ehemaliger Flakhelfer. Er hat herumgespielt und versucht, solch ein Ding auseinander zu nehmen«, klärt mich mein Großvater auf. Dabei ist er richtig aufgebracht. Meine Großmutter schaut jetzt meinen Großvater ganz böse an, als wäre er Angermanns Mörder. Sie ist nämlich der Meinung, man habe mir eine Illusion geraubt, aber ich bleibe völlig ruhig. »Die brauchen jeden Mann zum ‚Entsorgen’ der Munition. Die vom Himmelfahrtskommando verdienen gutes Geld!«, fährt mein Großvater fort und erweckt dabei den Eindruck, als sei das Ergebnis einer lukrativen Tabakernte gemeint. Dabei macht er ganz große Augen und stopft sich gleich eine Pfeife mit »Selbstangebautem«. Meine Großmutter verjagt mit ihrer Kittelschürze die blauen Rauchschwaden. »Das, was da am Dienstag passiert ist, steht heute in der Leipziger Volkszeitung. Die mussten es reinsetzen, weil mehrere Leute Leichenteile gefunden haben! Der Artikel in der Zeitung soll auch abschreckend wirken, so dass sich niemand an Munitionsblindgängern vergreift!«, fügt mein Großvater hinzu und sieht mir dabei streng in die Augen. Das habe ich zwar begriffen, aber mich erschüttert dieser Bericht nicht sonderlich, weil mein Klassenlehrer 1945 Luftschutzhelfer war und in den Trümmern der Häuser nach Überlebenden suchen musste. Davon hat er oft berichtet. Mir gehen die Geschichten zu den Bombenangriffen auf Dessau im Kopf herum und die halsbrecherischen Klettertouren damals in den Ruinen dieser Stadt. Die Augen meiner Großmutter werden feucht, und dann fängt sie an zu weinen, weil der Angermann gestorben ist, obwohl er dem Himmelfahrtskommando, oder besser gesagt, dem Munitionsbergungsdienst angehörte. Zudem war er noch ein Jahr jünger als ihr eigener Sohn, also mein leiblicher Onkel, dessen Panzer an der Oder-Neisse-Linie sogar mit einer deutschen Panzerfaust im März 45 in die Luft gesprengt wurde. Dabei hat er Diesel geschluckt, weil er im umgekippten Panzer dreivierteltot unter einem Leck des Dieseltanks lag. Mein Onkel ist damals mit dem blauen Auge davongekommen, trotz seines »Pechs im Unglück«!
»Und wieso ist die Panzerfaust neulich in die Luft gegangen, obwohl sie doch schon soo lange im Dreck lag?«, frag ich meinen Großvater schon wieder, »von 1945 bis 1956 sind es ... elf Jahre! Ist so ein Ding da nicht schon total vergammelt oder vom Rost zerfressen?« Als Antwort klärt mich mein Großvater lediglich darüber auf, dass das Himmelfahrtskommando eher im Volksmund existiert hat und dann eigentlich nur während des Krieges.
*
Ich schaue auf das Fensterkreuz des Küchenfensters. »Welch ein Fliegendreck aber auch!«, denke ich und erinnere mich dabei an das unermüdliche Geflimmere und Gewienere unserer damaligen Haushälterin mit Mopp und Putzlappen. Meine Großmutter beobachtet mich von der Seite. »Nichts mit Fliegendreck, falls du das denkst!«, sagt sie, als ob sie Gedanken lesen kann. Sie hat mir gesagt, sie wäre sogar telepathisch veranlagt. Dass ich meine Schulferien eine Woche später antreten würde als abgesprochen, wäre ihr klar gewesen! Der Beweis dafür seien die mittelfrühen Süßkirschen, die sie für mich auf dem Baum hängen ließ! Jedenfalls sind die schwarzen Punkte auf dem Fensterkreuz kein Fliegendreck, sondern Löcher im Holz, hervorgerufen von Reißzwecken. Immer wenn im Radio Luftalarm gemeldet wurde, haben meine Großeltern Verdunklungen innen vor die Fenster gezweckt. Die Amerikaner sind mit ihren Pulks an Torgau fast herangewesen, als sie dann Gott sei Dank nach Süden flogen, um Chemnitz und Dresden in Schutt und Asche zu legen.
Hennig war Angehöriger des LS, des Reichsluftschutzbundes in der Eigenschaft eines Luftschutzwartes. Er ist pflichtgemäß in die Grundstücke gegangen, um zu kontrollieren, ob abends, nach Einbruch der Dunkelheit, nicht etwa noch kleine Lichtfünkchen hinter den Fenstern zu sehen seien. Er selbst hätte das gar nicht tun müssen, weil ja ein Luftschutzwart der Befehlshaber einer Luftschutzgemeinschaft ist. »Er war eben immer sehr dienstbeflissen«, sagt meine Großmutter. »Er hat seine dreckigen Löffel zu gern an die Fensterscheiben anderer Leute gedrückt, um herauszubekommen, was die so reden, oder ob sie nicht etwa den englischen Rundfunk abhörten. Dann haben ihn ein Paar Leute abends im Dunkeln ‚gegriffen’, ordentlich verdroschen und ihm den nackten Arsch mit ‚Bärenkleber’ vollgeschmiert. Das ist eine stinkende Dichtungsmasse, die die Klempner zum Abdichten von Rohrverbindungen verwenden. Hennig hat nie herausbekommen, wer die vermummten Gestalten während der Nacht- und Nebelaktion waren. Trotzdem hatten die ‚Täter’ Angst vor Hennig, weil der gleich mit dem KZ gedroht hat.« Während meine Großmutter diesen Bericht abgibt, haut sie sich begeistert auf die Knie. Es schwingt sogar Schadenfreude in ihrer Stimme mit – es hat den Anschein, als sei sie die Übeltäterin gewesen und hätte erst gestern den Hintern Hennigs eigenhändig verunreinigt. »Den Spitznamen ‚Gummiohr’ hat Hennig weg, für alle Zeiten!«, sagt sie. Dann fordert sie von mir, dass ich den ‚Rand’ halten und diese Geschichte vergessen soll! »Heute, also in der DDR, ist Hennig nämlich gesellschaftlich sehr aktiv. Er hat eben den Mantel nach dem Wind gehangen«, sagt sie. »Z.B. ist er dem VKSK, also dem Verein der Kleintierzüchter, Siedler und Kleingärtner beigetreten und führendes Mitglied in einer Karnickelsparte geworden.« Wenn man meiner Großmutter zuhört, kann man annehmen, Hennig wollte unserem DDR-Präsidenten, Wilhelm Pieck, den Rang streitig machen.
Da nun die ganze Zeit vom Luftschutzwart Hennig, bzw. vom Reichsluftschutzbund des III. Reiches die Rede war, fällt mir besonders der blecherne Wandschrank neben dem Handtuchhalter in der Küche auf. Mit knallroten Großbuchstaben steht auf der Schranktür geschrieben:
– LUFTSCHUTZ-HAUSAPOTHEKE –
Natürlich interessiert mich der Sinn dieses Schrankes brennend, doch viel mehr der Inhalt! Es sind aber nur Sanitätsutensilien aus der Neuzeit, wie z.B. Hansaplast, Binden etc. darin. Gedacht war er aber für Erste-Hilfe-Einsätze im Luftschutzbunker oder Keller während Bombenangriffen im II. Weltkrieg. Ich schließe die blecherne Schranktür auf und lese das schwarz Gedruckte auf der Innenseite: »Zum Waschen von Phosphorbrandverletzungen nehme man 25 Bicarbonicum-Tabletten und löse sie in einem halben Liter Wasser auf!« Diese Brühe ist auch für Rachenreizungen gut – so jedenfalls verstehe ich den Text! Der nachfolgende Kurzvortrag meines Großvaters z.B. zu »Bicarbonicum« ist bombensicher. »Das ist lateinisch! Diese Vokabel klingt ja auch lateinisch und dann ist sie es auch! Man muss ja nicht gleich die lateinische Sprache beherrschen, um das herauszuhören!«, sagt er. Nun bin ich so schlau wie vorher und weiß eben, dass es sich um eine Chemiekalie handelt. All das haben wir schon einmal in der Erde gefunden, als wir einen Schulgarten anlegen wollten. Da hat unsere Lehrerin gesagt, dass man dieses Zeug deshalb in der Erde verbuddelt hat, weil man mit dem Krieg abrechnen wollte.
»Wo sind eigentlich die Phosphor-Brandverletzungen hergekommen«, will ich zwischendurch wissen, doch meine Fragerei ist überflüssig. Ich weiß längst, dass Phosphorbrandbomben, z.B. in Dessau und Dresden 1945 eingesetzt wurden.
»Hier steht sinngemäß: Man rührt zweihundert Gramm Chloraminpuder mit Wasser zu einem Brei, schmiert ihn auf die Haut und verschwunden ist die Kampfstoffverletzung, hervorgerufen z.B. durch ,Gelbkreuz‘ oder ,Senfgas‘!«, sage ich, doch mein Großvater meint, dass ich ein blödsinniger Kerl sei, weil das im Text nicht so bagatellisiert ist, wie ich es wiedergebe! ,Gelbkreuz‘ oder ,Senfgas‘ wäre ein hochwirksamer, ätzender, zuweilen auch tödlicher Kampfstoff gewesen, den man schon im ersten Weltkrieg eingesetzt habe. »Woher soll ich das wissen! Also ist all das, was da innen auf der Blechtür geschrieben steht, untertrieben – man hat damals die Hausapotheke einfach unter den Arm geklemmt und gemeint, so, jetzt kann der Krieg losgehen!«, sage ich. Sonst bestand die Bestückung dieses Blechgehäuses im Allgemeinen aus standartisiertem Erste-Hilfe-Inventar, vielleicht war es auch noch etwas mehr. Ich lese weiter: Zwanzig Gramm Salmiakgeist, zum Riechen bei Ohnmachtsanfällen, aufzubewahren in sechseckiger Flasche! »Blödsinn«, denke ich, »wozu die sechs Ecken um die Flasche herum?!« Was ich ganz herrlich finde, ist die Anleitung zum Gebrauch, bzw. zur Einnahme von Baldrian! Man nehme 25 Tropfen davon, treufelt sie in Wasser oder auf Würfelzucker. Auch die Anzahl der Stück Würfelzucker in der Hausapotheke ist vorgeschrieben! Der Grund der Einnahme von Baldrian ist der, dass er beruhigend wirkt! »Na klar!«, sage ich, »Baldrian wirkte damals während der Bombennächte beruhigend, besonders dann, wenn die Leute aus ihren Luftschutzkellern krochen und feststellten, dass ihre Häuser verschwunden waren.«
*
Als Mittagsmahlzeit für einfache Leute gibt es heute Pellkartoffeln und Quark mit schönen dunkelgrünen Zwiebelröhren und dazu Rapsöl. Gegessen wird bereits um elf Uhr, weil es heute zum Stoppelfeld geht – ich soll beim Kartoffelnstoppeln helfen! Ich finde es ekelig, wenn sich die Ackererde so unter die Fingernägel schiebt. In meinem eigentlichen Elternhaus wird nach dem Händewaschen immer die Seife abgespült, bevor sie wieder in die Seifenschale gelangt – das ist beinahe schon zum Gesetz geworden und daran habe ich mich gewöhnt. Es ist auch ekelig, ein dreckiges Stück Seife anzugrapschen, was da ein anderer versaut hat. Komisch, dreckiges Obst, vor allem beim Kirschenklau, hat mich nie gestört. Jedenfalls ist das Kartoffelnstoppeln immer damit verbunden, mit den Händen im Acker herumzuwühlen. Mein Großvater hat sogar einen passenden Stiel an die Kartoffelhacke geschraubt, weil ein zukünftiger Vierklassenschüler wie ich mit einem zu langen Hackenstiel seiner Meinung nach nicht effektiv genug arbeiten kann! Jedes Mal, wenn ich mit auf dem Kartoffelfeld bin, sehne ich mich danach, dass der Kartoffelsack endlich voll ist, und das dauert eine Ewigkeit. Die Kartoffelkombinen arbeiten so penibel genau, dass manchmal wirklich nur kleine, lächerliche Kartoffelmurmeln auf dem Acker liegenbleiben. Na ja, für die Verwendung als Tierfutter sind sie natürlich gut genug, obwohl: Pellkartoffeln hat meine Großmutter davon auch schon gekocht. Sie sagt, dass Butter verfeinere und streicht schnell eine große Messerspitze Butter auf eine gekochte Kartoffel. Ich bekomme trotzdem nichts von alldem herunter, weil mich meine Herumtreiberseele in den Bann gezogen hat. Ich drücke mich elegant um das Kartoffelnstoppeln herum, schließlich sind meine Schulferien keine Ferien zum Arbeiten, sondern Ferien! Was die bloß immer haben! Meine Kumpane sind jetzt z.B. in den sogenannten Kartoffelferien und rennen wie angestochen mit Kartoffelkörben hinter Kartoffelkombinen her. Wenn die Körbe voll sind, müssen sie sie dem Traktoristen oder Pferdefuhrwerker vorzeigen, damit der Beschiss nicht allzu große Auswüchse erfährt. Dann werden die Kartoffeln auf einen Anhänger gehievt und ausgeschüttet. Für solch eine Aktion gibt es lächerliche fünf Pfennige. Allerdings sind das kleinere Körbe als die der Erwachsenen. Da ist mir das Flaschensammeln auf einer dreckigen Müllkippe lieber und außerdem viel abenteuerlicher!
Mit dem Fahrrad radle ich in Richtung Stadtwald, um herauszubekommen, wo man eigentlich gestern so eine schöne Detonation erzeugt hat. Als ich fast heran bin, versperrt mir ein Mann mit einer Armbinde den Weg – bestimmt ist es einer von diesem Himmelfahrtskommando. »Mir homm hier obgesperrt, ‘s konn keener durch!« Der Mann klingt so schlesisch wie mein Deutsch-Altlehrer Kretzschmar. Außerdem fehlt ihm der rechte Arm. Ich kehre erst einmal um und plane, das Gelände am nächsten Tag zu inspizieren. Als ich zu Hause ankomme, steht Friedrich Raschke auf dem Hof und holt stolz eine Gewehrpatrone aus der Hosentasche und krakelt mit der Spitze des Geschosses an unserer Hauswand herum. Dass diese Patrone vermutlich mit einem ,Karabiner 98 K‘ des letzten Weltkrieges verschossen wurde, weiß er von seinem Vater, denn der hat sie 1946 als Souvenier von der sogenannten Westfront, d.h. aus Frankreich mitgebracht und in einer Rumpelkammer aufbewahrt. Metallhülse und Projektil sind blankgeschmirgelt. Auf dem Metall erkennt man die Kratzspuren groben Sandpapiers. Friedrich Raschke zeigt mit seinem dreckigen Zeigefinger stolz auf das unversehrte Zündhütchen der Hülse und dokumentiert damit, dass die Patrone noch nicht abgeschossen sei. Als mein Großvater mit seinen Holzpantinen über den Hof klappert, ist die Patrone ruckzuck wieder in Friedrichs Hosentasche verschwunden. »Die muss wieder an ihren Platz!«, sagt er, »sonst schlägt mich mein Vater tot.« »Der Herr des Hauses« und Oberhaupt der Familie, Raschke, schlägt niemanden und schon gar nicht tot!«, gebe ich zur Antwort. Dabei bin ich auf der sicheren Seite, weil Raschke mit uns, trotz der gärtnerischen Hochsaison, stundenlang Fußball gespielt hat, zum Leidwesen seiner fleißigen Ehefrau Anne.
Friedrich muss seiner Mutter heute beim Stoppeln helfen – ohne Pardon! Als er nicht mitwill, packt ihn Mutter Anne mit der rechten Hand am Schlafittchen und mit der Linken erhebt sie drohend ihren Pflanzstock.
Friedrich legt mit Hand an, so lala. Dabei stochert er lustlos in der Erde herum, da, wo die Erde schon drei Mal umgewühlt ist und findet dabei Infanterie-Munition in zwanzig Zentimeter tiefer Ackererde und zum Teil in vermoderter Verpackung. Eine Patrone hat er in der Tasche verschwinden lassen und den Rest in den Acker zurückgetreten, ohne dass es jemand gemerkt hat. Dabei sind einige Patronen auseinandergebrochen. Darin befindliches Schwarzpulver ist teilweise herausgerieselt, denn die Metallhülsen sind zum Teil durch die Feuchtigkeit brüchig geworden. Friedrich hat die Fundstelle mit einem kleinen Stöckchen markiert. Er ist der Meinung, eine größere Markierung würde seine Fundstelle verraten, also verwendet er ein dünnes Zweiglein. Er will, wenn die Luft »rein« ist, den Rest mit mir ausgraben. Er meint, dass sei zu zweit besser, dann könnte einer »Schmiere« stehen. Außerdem wüsste er, dass ich dazu mutig und verschwiegen genug sei, um nicht Verrat zu üben. Während dessen er das sagt, stupst er mit seinem schmutzigen Zeigefinger gegen meine Brust.
*
Viel Brühe hat mein Großvater im Leben um nichts gemacht, selbst dann nicht, als man ihn zum Ende des I. Weltkrieges noch an die Front schicken will. Während der Novemberrevolution 1918 reißt man ihm die Soldatenschulterstücken herunter und der Krieg ist für ihn aus! Da gibt es von ihm noch ein Foto, sepiabraun, so, wie alle alten Fotos, geschossen 1917. Zu sehen ist er mit Pickelhaube, Knarre und aufgepflanztem Seitengewehr. Letzteres ragt über seinen Kopf und auch noch bis in die Mitte der Pickelhaube, da mein Großvater klein von Wuchs ist. 1933 bekommt er den Wundstarrkrampf, auf Grund seiner starken Natur übersteht er ihn, zieht sich dann aber einen komplizierten Oberschenkelbruch zu, man muss den Knochen wohl durch eine Nagelung zusammenflicken. Trotzdem schickt man ihn 1935 wieder zum Barras. Man steckt ihn in eine motorisierte Schützenkompanie. Irgendwann taucht ein Foto auf, dieses Mal nicht sepiabraun, sondern schön schwarz-weiß in Hochglanz: Mein Großvater mit Knarre, dieses Mal mit heruntergeklapptem Bajonett, in strammer und militärischer Haltung, neben einem Schützenpanzerwagen stehend. Das Korn seines Karabiners und der Kopf bilden eine Linie. Im Vergleich zu 1917 macht er eine richtig gute Figur, obwohl er von 1917 bis 1936 kaum einen Millimeter gewachsen ist. Er trägt zwischen Oberlippe und Nasenflügel ein gepflegtes Bärtchen, wie der Adolf Hitler. Den Spitznamen »Hitler« hat ihm meine Großmutter verpasst, weil auch sein gesamtes Äußeres dem damaligen Reichskanzler ziemlich ähnlich ist. Wenn sich beide gestritten haben, ich meine nicht meinen Großvater und den Hitler, sondern meine Großmutter und meinen Großvater, hat meine Großmutter stets ihre schwerste Waffe eingesetzt und böswillig behauptet, mein Großvater wäre vom »Oberkommando der Wehrmacht« auf Grund seiner geringen Körpergröße gefeuert worden. Das stimmt nicht, denn er war nur Soldat und mit solch einem Dienstgrad befasst sich ein solches Oberkommando wohl kaum! 1937 wird mein Großvater wieder ausgemustert. Ich habe angenommen, dass dies aus Kulanzgründen erfolgt ist, weil doch mein Großvater ein Haus bauen wollte. Hätten nur alle Männer um diese Zeit Häuser